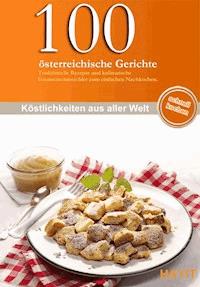
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mundo Marketing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Welt zu Gast haben – jedenfalls in kulinarischer Hinsicht –, das macht die Serie „Köstlichkeiten aus aller Welt“ möglich. Denn drei grundlegende Aspekte dieser Kochbuch-Reihe sorgen dafür, dass internationale Gerichte und Getränke von jedermann zubereitet werden können: Unkompliziert Kochen Für die Zubereitung der Gerichte sind keine aufwendigen und komplizierten Vorbereitungen erforderlich, und die angegebenen Gewürze und Zutaten sind problemlos erhältlich. Preiswert Kochen Köstlich-Raffiniertes muss nicht teuer sein, dafür sorgen die ausgewählten Zutaten und viele Tipps. Schnell Kochen Auch um exotische Genüsse auf den Tisch bringen zu können, muss man nicht stundenlang in der Küche stehen; die hier gesammelten Rezepte lassen sich in kurzer Zeit zubereiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Köstlichkeiten aus aller Welt
100 österreichische Gerichte
von
Anita Nuding
Impressum
100 österreichische Gerichte, 2. Auflage
Köln, Hayit Medien, 2013
Hayit Medien ist eine Unit von Mundo Marketing GmbH
ISBN Print: 978-3-87322-208-3
ISBN PDF: 978-3-87322-209-0
ISBN ePub: 978-3-87322-210-6
ISBN mobi: 978-3-87322-211-3
© Copyright 1994/2013, Mundo Marketing GmbH, Köln
Autorin: Anita Nuding
Herausgeber: Ertay Hayit, M.A.
Alle Rechte vorbehalten
All rightsreserved
Coverbild: © otahei - Fotolia.com
www.hayit.de
www.koestlichkeiten.de
Einige Worte vorweg
Wer hat das nicht schon in seinem Österreichurlaub erlebt? Man genießt kulinarische Schmankerl, die dem Gaumen zwar nicht völlig ungewöhnlich, aber äußerst reizvoll erscheinen. Man bekommt sie auf Almhütten serviert, in Kaffeehäusern, Weinlokalen oder in kleinen, schnuckeligen Restaurants, die in einer ganz normalen Wohnung im ersten Stock untergebracht sind und wo der Blick in die Küche nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht ist.
Man schlemmt im Urlaub, und kann dann zu Hause leider nicht zubereiten, was einem so gut geschmeckt hat – weil die Rezepte und speziellen Kochtipps fehlen –, obwohl diese Gerichte, da sie sich in Bezug auf die Zutaten und Gewürze wenig von denen der deutschen Küche unterscheiden, wunderbar auf den eigenen Esstisch passen würden. Diesem Manko soll das vorliegende Buch abhelfen.
Spezialitäten von Weltruhm ...
Die österreichische Küche hat nicht nur viele Spezialitäten von Weltruhm hervorgebracht, z.B. den Kaiserschmarren oder die Salzburger Nockerln: Ohne sie würden wir auch auf die Mehlspeise, den Strudel, die Knödel oder die Suppeneinlagen verzichten müssen – um nur einige Beispiele zu nennen. Sie sehen, die österreichische Küche hat einen wesentlich größeren Einfluss auf die internationale Küche, als die meisten spontan damit verbinden.
... und die Kocherfahrung vieler Völker
Die „Wiener Küche", die man allgemein als die Küche Österreichs ansieht, hat sich vor dem Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie, vor dem Untergang des Kaiserhauses, entwickelt. Sie ist geprägt von den unterschiedlichen Einflüssen der verschiedenen Völker und Kulturen, der Kronländer, mit denen sie in Berührung kam bzw. verschmolz: Der ungarische Gulasch ist hier ein ebenso unumstößliches Element wie etwa die böhmischen Buchteln und der Powidl. In Wien, als dem Zentrum des Kaiserreichs, entwickelte sich auch ein Zentrum des Völkergemischs, das durch den Zuzug der vielen Menschen aus den Kronländern entstand; und die Bevölkerung lernte bald, neue kulinarische Einflüsse aufzunehmen, abzuwandeln und in die eigenen Kochtraditionen einzuarbeiten. So findet man in vielen altösterreichischen Gerichten sogar Relikte aus der türkischen Belagerungszeit.
Für Bauer und Kaiser – eine Küche, die zwischen „oben" und „unten" vermittelt
Aber nicht nur fremde Speisen und Zutaten haben ihren Weg in die Wiener Küche gefunden, die die Küche des gehobenen Bürgertums widerspiegelt. Man integrierte auch höfische und bäuerliche Gerichte, variierte die Zutaten und fand so einen Ausgleich zwischen den Extremen. Das beste Beispiel dafür ist die Mehlspeise. Die einfachen Gerichte bäuerlichen Ursprungs wie Bachlkoch oder Sterze findet man heute noch in den meisten Regionen Österreichs. Auch sie wurden in diesem Buch nicht außer Acht gelassen, denn sie sind wichtige, wenn vielleicht auch weniger bekannte Bestandteile der österreichischen Küche.
Was dieses Buch Ihnen bietet
Preiswert, schnell, unkompliziert ?!
Dieses Buch soll absolut typische, aber dabei unkomplizierte, preiswerte und schnell zuzubereitende Gerichte präsentieren – ein Unterfangen, das bei der österreichischen Küche zwar schwierig, aber nicht unmöglich ist. Gutes Essen ist in Österreich sehr wichtig, und man kocht in der Donaurepublik wie wohl fast überall mit Liebe, aber meist auch mit viel Zeit und ausgesuchten Zutaten.
Ich habe mich bemüht, die gängigsten Gerichte in diesem Buch aufzuführen und kam somit nicht umhin, bei einigen wenigen Gerichten die Punkte „schnell" und „preiswert" etwas außer acht zu lassen. Aber man kann hier auch oft „pfuschen": Den Rostbraten kann man zum Beispiel auch mit Rouladenfleisch zubereiten, und fürs Wiener Schnitzel kann man auch Schweinefleisch nehmen.
Zeiten und Mengenangaben
Zu den angegebenen Zeiten ist zu sagen, dass sie Erfahrungswerte darstellen, die von vielen Faktoren (Qualität der Zutaten, Größe des Kochgeschirrs etc.) abhängen und als Richtlinien zu sehen sind.
Die Mengenangaben bei den folgenden Rezepten sind, falls nicht anders angegeben, für vier Personen berechnet.
Und nun viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!
Anita Nuding
Herzlichen Dank
An dieser Stelle möchte ich meiner Familie und Frau Helene Wittenhöfer für ihre Unterstützung danken.
Ganz besonderer Dank gilt auch Frau Helene Diehlmann, die mir bei der Auswahl der Gerichte und bei der Überarbeitung half. Ohne sie und ihr Engagement wäre dieses Buch wahrscheinlich nicht zustande gekommen.
Essen und Trinken in Österreich
Als die Sonne nie unterging – ein wenig Geschichte
Österreich, das „Land der Mehlspeisen und Knödel", wird seit jeher von den kulturellen und damit auch den kulinarischen Einflüssen der verschiedensten Volker geprägt. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, wie viele verschiedene Volker und Kulturen sich hier begegnet sind.
Schon das im zweiten vorchristlichen Jahrhundert gegründete Königreich Norikum mit seinem illyrischkeltischen Mischvolk unterhielt ausgedehnte Handelskontakte und war Umschlagplatz für Waren aus Afrika, Phönizien, England und SüdrussIand. Auch Rom gehörte zu den Handelspartnern, was nur ca. 150 Jahre später zum Ende des Königreiches und zur Einverleibung in das römische Herrschaftsgebiet führte. Die Römer kultivierten das Land, und in der Folgezeit wurden für die Bevölkerung fremde und neue Gemüse und Obstsorten angebaut.
Zu Zeiten der Völkerwanderung ging es auf dem heutigen Gebiet Österreichs stürmisch zu. Völker aus dem Norden und Osten wie Goten, Sweben, Markomannen, Hunnen oder Slawen jagten sich gegenseitig das Land ab und besiedelten es. Erst den Babenbergern gelang es Ende des ersten nachchristlichen Jahrtausends, die verschiedenen Stämme und Völker zu einigen. Auch knüpften sie verwandtschaftliche Bande zu Byzanz, den Staufern und den Welfen.
1282 kam es zu einem tiefen Einschnitt in der Geschichte (und damit verbunden der Kochkultur) Österreichs: Die Habsburger errangen die Macht im Land. Es begann eine fast siebenhundert Jahre wahrende Herrschaftszeit, während der auch das „Haus Österreich" entstand. Aber erst Karl V. (1519-1556) vereinigte alle Länder der Habsburger und machte die Dynastie zum mächtigsten Herrscherhaus Europas. In seinem Reich ging nie die Sonne unter, besagt ein Spruch aus jener Zeit. Denn: Neben Österreich gehörten, wenn auch nur zeitweise, Spanien, die slawischen Länder, Böhmen, Ungarn, Galizien, die Niederlande, das Elsass, die Lombardei und – sehr kurz – auch Peru und Mexiko, um nur einige zu nennen, zum Macht bzw. Einflussbereich der Habsburger. Diese „Kronländer" kamen durch Kriege, aber auch durch geschickte Heiratspolitik zu dem Kaiserreich. Nicht umsonst heißt es schließlich: „Tu felixAustria, nube!", „Du glückliches Österreich, heirate!"
Schließlich herrschte die kaiserlich und königliche (k. u. k.) Monarchie vor ihrem Zusammenbruch im ersten Weltkrieg über 52 Millionen Menschen, ein Imperium, das 676 600 qkm umfasste und in dem 16 verschiedene Sprachen gesprochen wurden.
Die Mitgift eines jeden Volkes in die „Ehe" mit Österreich waren unter anderem auch neue Rezepte, Zutaten und Gewürze. Dieses Erbe spürt man noch heute deutlich: Der ungarische Gulyas (Gulasch) und die Paprika, die böhmischen Buchteln, Powidltatschkerln und die verschiedenen Knödel – um nur die bekanntesten zu nennen –, haben ihren festen Platz in der österreichischen Küche gefunden.
Eher bürgerlich – die Wiener Küche
Bekannter als der Begriff der „Österreichischen Küche" und für viele auch der Inbegriff dafür, ist der der „Wiener Küche". Dieser feststehende Ausdruck hat weniger einen lokalen, als vielmehr einen nationalen Charakter. So beklagte sich 1830 selbst Goethe darüber, dass es in Deutschland keine Stadt, kein Land gäbe, von denen man behaupten könne, sie waren Deutschland, aber „fragen wir in Wien, so heißt es: Hier ist Österreich". Und wirklich findet man wohl kaum ein anderes Land auf der Erde, dessen Rationale Küche so durch eine Stadt geprägt wird und in ihr ihren Ausdruck findet wie eben Österreich.
Haute cuisine und Hausmannskost
Wien, die Hauptstadt, war von Anfang an das pulsierende Herz des „Hauses Österreich". Diese Stadt wurde zum „Schmelztiegel der Kulturen" der Kronländer – schon lange bevor sich etwa der Begriff „Melting Pot" für New York etablierte. Und hier befand sich auch das Sammelbecken der verschiedenen Küchen. Jedes Kronland brachte natürlich seine kulinarischen Eigenheiten mit an den Hof, und viele Menschen aus fernen Ländern verschlug es als Bedienstete in die Haushalte des gehobenen Wiener Bürgertums.
So ergaben sich zwei Ebenen für die Entwicklung der Kochkultur: zum einen die internationale Haute cuisine am Hofe, die dann gemächlich über die Adelshäuser auch in die bürgerliche Küche einfloss, und zum anderen die einfache Hausmannskost, wie sie die in jedem Haushalt, der etwas auf sich hielt, anzutreffende böhmische Köchin auf den Tisch ihrer Herrschaft brachte.
Harmonie und Ausgeglichenheit
Aber bekanntlich schreibt man den Österreichern, und besonders den Wienern, auch typische Charakterzüge zu, wonach dieser Menschenschlag besonders danach strebt, Harmonien herzustellen und Gegensätze auszugleichen. Dementsprechend brachte die Wiener Küche auch schnell die verschiedenen Kocharten auf einen Nenner: Die übertrieben ausgefeilte höfische Küche wurde vereinfacht, die eher schlichten Gerichte aus dem bäuerlichen Umfeld wurden verfeinert. Hieraus ist die unverwechselbare Wiener Küche, wie man sie heute kennt, entstanden; sozusagen die Küche des gehobenen Bürgertums.
Einfach, aber unverwechselbar – die regionalen Küchen
Die einfachere, eher bäuerliche Küche findet man in Österreich, wenn man sich anderen Regionen als Wien zuwendet. Denn es ist zwar so, dass Wien die Rationale Küche verkörpert, aber die einzelnen Landstriche wie Tirol, die Steiermark oder das Salzburger Land haben sich eine sehr eigenständige Kochkultur bewahrt – und diese mit sehr viel Stolz gegen fremde Einflüsse verteidigt. Nur die Tiroler Küche lässt einen leichten italienischen Einschlag erkennen, was unter anderem auf die Nähe zu Italien und auf die Förderung der italienischen Kultur durch Ferdinand II. (1619-1637) in diesem Gebiet zurück zuführen ist. Diese regionalen Küchen sind im Allgemeinen zwar einfacher in Bezug auf Zubereitung und Zutaten, aber nicht weniger schmackhaft. Hier haben sich viele althergebrachte Traditions- und Fastengerichte – wie etwa Bachlkoch, Sterze oder Plente – halten können.
Typisch Österreich: gut heißt auch viel
Anders als bei den eher einfachen ländlichen Gerichten der „Muasbauern" wurde in der nationalen Küche Österreichs traditionell großer Wert auf Reichhaltigkeit gelegt. Dass etwa einem ausgiebigem Essen mit Vorspeise und opulentem Fleischgericht noch eine dicke Mehlspeisenkalorienbombe folgt, bringt niemanden aus der Fassung. Hans Sachs, deutscher Meistersinger aus Nürnberg, stellte denn auch 1567 über Wien fest:
Nun diese Stat, volkreich vür war,
Doch kumbtüberflussiger weis
Täglich darein allerlei Speis
An korn, weizen, prot, flaisch und visch,
Krebs, air, vogel und wildpret frisch.
Diese Zeit der reichhaltigen, opulenten Küche hat ihren Ursprung im 16. Jahrhundert, als Kaiser Karl V. über ein riesiges Reich herrschte, in dem „nie Sonne unterging".
In dieser Zeit sind aber auch die wichtigen Umwalzungen in der Küche zu finden: Fremdartige Gewürze, unbekannte Früchte und Gemüse aus Übersee – wie etwa die Kartoffel oder der Kaffee – bürgerten sich ein. Die offene Feuerstelle wurde durch den gusseisernen Herd ersetzt, und feinere Essmanieren, begleitet von Essgabel und Porzellangeschirr, wurden bei Hofe eingeführt.
Wiener Großhändler boten in ihren Läden Käse aus Holland, Gewürze aus Indien und Weine aus Spanien an; und dem Bürgertum wurde damit die Möglichkeit gegeben, die Speisen, die im großen Stil am Hofe kredenzt wurden, zu Hause im kleinen nachzuvollziehen. Die Rezepturen dafür stammten aus Kochbüchern, wie sie von den Küchenchefs der Fürstenhöfe verfasst und seit Ende des 16. Jahrhunderts gedruckt wurden. Ihren Höhepunkt fand diese kulinarische Opulenz zur Zeit des Barocks: Das Schönheitsideal dieser Epoche zeichnete sich neben üppigen Allonge-Perücke und reich verzierten Stöckelschuhen durch gewaltige Körperfülle aus. Man tat auch alles, um dieses Ideal zu erreichen – was sich natürlich im Speiseplan widerspiegelte. Ein gewöhnliches Essen an einer fürstlichen Tafel bestand zum Beispiel zumindest aus acht ausgiebigen Gängen:
1. Gang: klare und gebundene Suppen
2. Gang: Schinken, Wurst, Zungen, Wildbretpasteten und Frikassees
3. Gang: „großer" Braten: Fasan, Rebhuhn, Truthahn, Hasen
4. Gang: „kleiner" Braten: Schnepfen, Lerchen, Drosseln
5. Gang: Fische – Lachse, Forellen, Hechte und Karpfen, Krebsgerichte und Schildkrötenfrikassee
6. Gang: Eiergerichte
7. Gang: Obst, Gebäck, Käse
8. Gang: Süßigkeiten, Konfekt, kandierte Früchte etc.
Aber nicht nur in der adeligen Gesellschaft war Völlerei gang und gebe, man mag es kaum glauben, aber auch im bäuerlichen Umfeld frönte man dem reichlichen Essen – wie etwa Guarinonius in seinem Buch Die Greul der Verwüstung menschlichen Geschlechts (1610) berichtet. So pflegten Bäuerinnen im Wochenbett 24 mal am Tag zu essen, und dem Kind wurde nach dem Stillen noch ein aus 1,5 l Milch zubereiteter Brei „eingestrichen". Es war die Zeit, in der jede nur erdenkliche Gelegenheit gefeiert wurde, dazu gehörten offizielle Feiertage und Kirchenfeste, Hochzeiten und Begräbnisse ebenso wie private Vertragsabschlüsse, ein gelungener Einkauf oder ein erfolgreich beendeter Gerichtsprozess.
Aber nicht nur die Kochkultur erlebte in der Zeit des Barocks und Rokokos ihren Aufschwung, Adel und Klerus wetteiferten darüber hinaus untereinander mit Prachtbauten und Kunstwerken. Und dennoch: In dieser Zeit des allgemeinen Baubooms hatte zum Beispiel im Jahre 1742 ein Kloster jährlich zwar ca. 1700 Gulden an Baukosten zu tragen, das selbe Kloster benötigte aber allein 2405 Gulden, um Maria Theresia (1740-1780) und ihren Hofstaat einen Tag lang zu bewirten. Maria Theresia selbst kehrte die sparsame Hausfrau hervor: Die Reste der Hoftafel wurden lukrativ ans reiche Bürgertum verkauft.
Die Vollendung im Biedermeier
Erst das 19. Jahrhundert brachte eine grundlegende Wendung. Es war die Zeit des Biedermeiers, des Bürgertums. Kaffeehaus und Walzerseligkeit gehörten genauso dazu wie der Wein, der Gugelhupf und das Hotel Sacher. Damals entstand, was man sich heute noch unter dem Namen Wien vorstellt.
Es war auch die Zeit, in der die Wiener Küche ihre Vollendung fand. Zunächst eher aus Not: Wegen Napoleons Kontinentalsperre zur Blockade des englischen Handels gelangte der teure, aus Zuckerrohr gewonnene Zucker nicht mehr nach Österreich. Man schaute sich um und fand heraus, dass aus breitflächig angebauten Zuckerrüben die begehrte Süße ebenso, und viel billiger, hergestellt werden konnte. Von da an führte kein Weg mehr an der Mehlspeise vorbei.
Vom Alltagsbrei zur raffinierten Spezialität – die Mehlspeisen
Die warme Mehlspeise ist ein Gericht, das ursprünglich aus dem bäuerlichen Umfeld stammt. Für die Milch und Getreidebauern waren Mehlspeisen die alltägliche Kost, die Zutaten wurden selbst produziert. Mehlspeisen waren ursprünglich natürlich ungesüßt, Zucker aus Zuckerrohr, war zu teuer, Zuckerrüben als preiswerter Lieferant der Süße noch nicht entdeckt. Man unterschied zwischen den Pfannengerichten, wie Schmarren oder Palatschinken, und den Breiarten, den Sterzen und Nockerln. Dazu wurde meist ungesüßtes Obstkompott gegessen. Es gab jedoch zu viele lokale Unterschiede in Zubereitung und Zutaten, um hier näher darauf einzugehen.
Zucker nur beim Apotheker





























