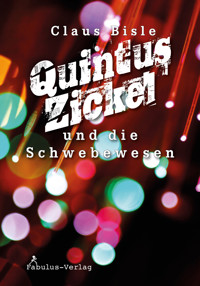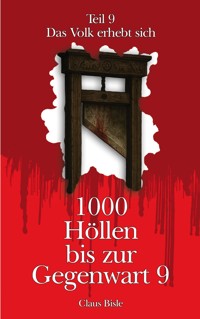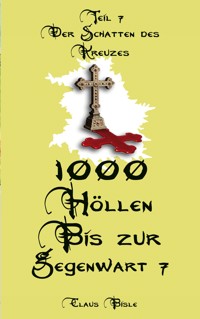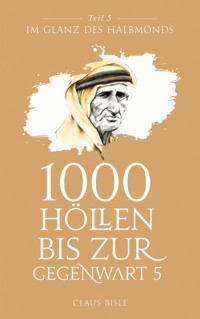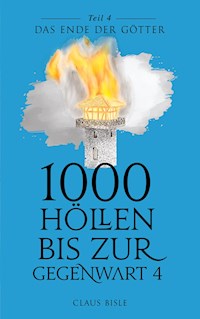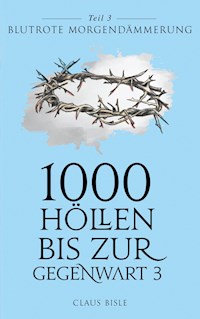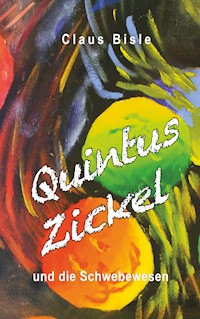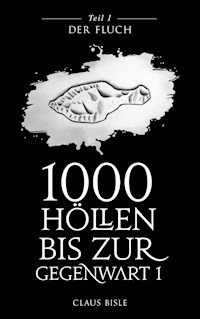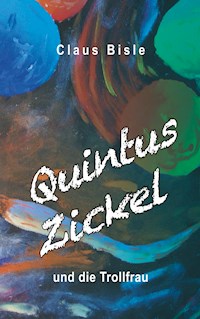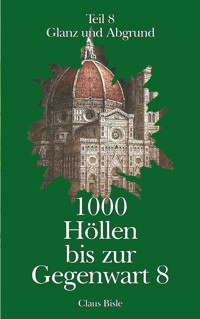
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: 1000 Höllen bis zur Gegenwart
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Los, die Menschheitsgeschichte durchleben zu müssen, stolpert Manuel weiter. In Teil 8 tritt er in die Sphäre der Neuzeit ein. Neuen Gefahren muss er sich stellen. Weiterhin haftet die Pest an seinen Fersen, die unheimliche Welt der Päpste lässt ihn erschaudern. Währenddessen wird Amerika erschlossen und Martin Luther wirbelt die christliche Geisteshaltung durcheinander. 1000 Höllen bis zur Gegenwart ist sicher eines der aufregendsten und umfassendsten Romanprojekte. Historische Korrektheit und phantastische Erscheinungen reichen sich die Hände. Mit Abschluss des zehnten Teils wird der größte Roman Deutschlands vorliegen, ein Werk, das die Ansprüche eines Jugend-, Historien- und Entwicklungsromans vereint. Der Leser soll die Geschichte nicht von außen betrachten, sondern Teil von ihr werden. Durch das Eintauchen in diese 4. Dimension wird das Geschichtsverständnis auf atemberaubende Art geschärft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Jungfernrebe (1428 n. Chr.)
Türkenbund (1453 n. Chr.)
Medinilla Magnifica (1478 n. Chr.)
Teufelskralle (1494 n. Chr.)
Agave salmiana und Silberbaum (1519 n. Chr.)
Bitterkraut und Quinoa (1534 n. Chr.)
Waid (1571 n. Chr.)
Schwarze Rose (1604 n. Chr.)
Hexen- und Gallenröhrling (1631 n. Chr.)
Glossar
Zum Autor
JUNGFERNREBE (1428 N. CHR.)
In einem unbezähmbaren Wirbel schlug ich durchnässt auf Wiesengrund auf. Ning wurde von mir gerissen.
Nur mit Mühe kam ich auf die Beine.
Sternenlose Dunkelheit.
Meine Finger ertasteten Steinquader … genauer: Grabsteine.
Zweifellos steckte ich auf einem Gottesacker. Fahler Mondschein schimmerte durch einen Wolkenspalt.
Das Schattenbild einer verwaisten Kirche verdeutlichte mir den Ort.
„Ning?“, rief ich halblaut.
Keine Antwort. War ich wieder auf mich gestellt?
Kälte. Die Frische der Nacht und eine unangenehme Brise Wind setzten mir zu. In dem sakralen Gebäude wäre ich geschützt.
Stimmen.
Zwischen Hecken flimmerten Lichter. Männer näherten sich. Einige trugen Fackeln in der Hand, andere Kerzen.
Eine ganze Gemeinde schloss sich den Vorauseilenden an. Der Tumult erweckte das Interesse eines Geistlichen, der aus Richtung des Kirchenbaus hinzueilte.
Hinter dem, was sich in Folge ereignete, war ein Plan erkennbar. Drei Männer setzten einen Holzstoß in Brand, andere hoben eine Grabplatte an und schlugen ihre Spitzhacken in die Erde.
Eine Handvoll Kleriker trat aus der Ansammlung, gab Hinweise und zeigte, nachdem eine gewisse Tiefe ausgehoben worden war, auf Gegenstände, die zu bergen waren.
Gebeine, einen Schädel brachten sie hervor. Im Feuerschein untersuchte ein Pater das Knochenhäufchen. Mit dem Ergebnis gab er sich nicht zufrieden. Er drängte auf weitere Anstrengungen.
Rippenknochen wurden laut gezählt. Nach einer halben Stunde begnügten sich die Herren mit dem Fund. Nur wenige Worte verstand ich. Es folgte eine Predigt oder Salbung. Dem ganzen Procedere vermochte ich keinen Sinn beizumessen. Endlich ergriffen einige Helfer die Menschenteile und warfen sie in das Feuer. Die Glut wurde verbissen angeheizt, pausenlos Holz nachgelegt.
Es gelang mir nicht länger, ein Niesen zu unterdrücken.
„Wer ist dort?“ Einer der Priester wandte sich verunsichert um.
Ohne zu zögern gab ich mich zu erkennen. „Ich bin reichlich durchgefroren. Die Wärme täte mir gut.“ Ich zeigte ich auf den Brandmeiler.
„Sie ist zu manchem Heil“, antwortete er.
„Darf ich näherkommen?“
„Solange du keiner der Lollarden bist und ein frommer Christ, will ich es dir nicht verbieten.“
„Sagt mir nichts. Getauft bin ich allemal.“
Die Herren waren mit der Entgegnung zufrieden und so fügte ich mich in die Runde ein. Geduldig warteten sie bis zum Verglühen des Brandherds.
Die Gesichter, die starr auf den Vorgang gerichtet waren, zeigten selige Zufriedenheit, provokant gewichtet: Albernheit. Der Sinn dieser Prozedur erschloss sich mir nicht. Was mochte es bringen, ausgegrabene Leichenteile in Brand zu stecken? Noch lange Zeit starrten sie stumm in die Lohe.
„Herr Bischof, Ihr müsst nicht abwarten. Wir begleiten das Werk bis zum Ende“, bemerkte einer der Arbeiter.
„Der Heilige Vater besteht auf einen Bericht“, antwortete er, „daher wird unser Erzbischof Einzelheiten erfragen. Es ist zuträglich, wenn mir nichts entgeht. Sobald die Gebeine ausgeglüht sind, wollen wir die Asche in die Swift werfen. Der Fluss wird jede Erinnerung reinigen.“
Der Sachverhalt war klar. Die Reste eines der Kirche lästigen Zeitgenossen waren eliminiert und aus dem Gedächtnis entfernt worden.
Ich erhoffte mir für die Nacht bei einem der Anwesenden eine Unterkunft und gliederte mich daher in die Gruppe ein. Nach wenigen hundert Metern erreichten wir das Gewässer.
Der Bischof erbat erneut einen himmlischen Segen, während eifrige Priester die Aschereste Hand für Hand in die Fluten schleuderten. Einer der frommen Diener trat mir im Anschluss zur Seite. „Falls du im Dorf abkömmlich wärest, hätte ich eine Aufgabe für dich.“
„Wenn es eine ehrenwerte Sache ist, wird sich eine Lösung finden lassen“, entgegnete ich erwartungsvoll.
„Du warst Augenzeuge der erfolgreichen Verrichtung. Dringend soll Erzbischof Thomas Arundel davon erfahren, eine flüchtige Erstinformation, mehr nicht.“
„Mir, einem Fremden vertraust du?“
„Das ist einerlei.“ Er schob alle Zweifel, die bei mir aufkamen, beiseite. „Wie geschwind bist du zu Pferde?“
„Für einen schnellen Ritt bin ich zu gebrauchen.“
„So will ich mich auf dich verlassen. Mir ist es ein erträgliches Geldstück wert. Morgen zum Mittag halte ich ein Schriftstück bereit.“
Eifrig willigte ich ein.
Wenn ich mir eingeredet hatte, am kommenden Tag unbeschwert nach Canterbury zu reiten, hatte ich mich geirrt. Ein geistlicher Herr wurde für die Aufgabe auserkoren. Seine Exzellenz, der Bischof des Bistums Norfolk, händigte ihm das Schriftstück aus. Meine Rolle blieb auf die eines Begleiters begrenzt.
Nachträglich schmeckte die erlebte Zeremonie der Knochenverbrennung gallebitter, und je mehr ich die Hintergründe der absurden Aktion verstand, umso mehr widerte mich das Vorgehen an.
„John Wyclif! Du hast wahrlich nie von ihm gehört?“, wunderte sich Anselm, der mir zugeordnete Begleiter, und schwang sich auf sein Pferd.
„Tut mir leid, die Geschichte um ihn entging mir“, gestand ich ein.
„Ist zu verzeihen. Er ist vor deiner Zeit gestorben.“
„Dann lag seine Beisetzung lange zurück?“
„Weit über 40 Jahre.“
„Aus welchem Grund werden nach so beträchtlicher Zeit die Gebeine eines Verstorbenen ausgegraben und ausgelöscht?“
„Die Knochen verschmutzten die geheiligte Erde des Gottesackers.“
„Er war ein Massenmörder?“
„Keinesfalls, weit eher ein gebildeter, gelehrter Mensch, aber der Häresie verfallen. Er forderte die Abkehr der Kirche von Besitz und weltlicher Macht, verdammte den vom Heiligen Vater geforderten Ablass und verurteilte den Lebenswandel der Vertreter Gottes.“
Das saß. Ich hatte es verstanden. Der Einfluss und die Ausstrahlung John Wyclifs muss nachhaltig gewesen sein und das weit über seinen Tod hinaus. Ich bohrte nach.
„Hat der Heilige Vater die Verbrennung angewiesen?“
„Sie wurde vor zehn Jahren auf dem Konzil zu Konstanz beschlossen. Unser Erzbischof, Thomas Arundel, verzögerte die Durchführung. Vermutlich fürchtete er Ausschreitungen der Lollarden.“
„Anhänger Wyclifs?“
„Durchaus.“
„Daher diese verschwiegene nächtliche Veranstaltung?“
„Es liegt nicht an uns, es zu hinterfragen. Es ist manch Unheil geschehen, und größeres gilt es zu vermeiden.“
„Mag sein, dazu fehlt mir der Überblick.“
„Dann versuche ich es, in wenigen Worten zusammenzufassen. Zu Wyclifs Zeit regierte unser König Richard II.. Er entschied sich für eine Frau aus dem Land der Böhmen, Anne. Die Werke Wyclifs gelangten über diese Verbindung in die Hände eines böhmischen Rebellen, Jan Hus.“
„Oh!“, unterbrach ich, nachdem der Funke gegriffen hatte, „Rebell? Nicht Professor und angesehener Wissenschaftler?“
„Hüte deine Zunge! Er hat den gesamten Nonsens Wyclifs als wahr erachtet, öffentlich vertreten und für das böhmische Volk verständlich in deren Heimatsprache ausgebreitet. Ihm wurde darauf die Stellung des Synodalpredigers aberkannt. Trotzdem predigte er weiter. Papst Alexander V. hat ihn exkommuniziert. Selbst Johannes XXIII. schloss sich dem an.“
„Beide Heiligkeiten?“
Klar war mir, der eine saß in Rom, der andere in Avignon.
„Johannes löste den Bann, damit diesem Hus erlaubt war, nach Konstanz zu reisen. Er gestand ihm nachsichtig die eigene Verteidigung zu. Es war kaum grundlos, dass er binnen drei Wochen verhaftet wurde und - nachdem der Heilige Vater selbst aus Konstanz floh - ebenfalls gefangen und eingekerkert wurde…“
„Der Heilige Vater oder Jan Hus? Du verwirrst mich.“
„Seine Heiligkeit wurde nach der Flucht ergriffen und inhaftiert! Verzeih, es ist eine andere Sache. Ich werde auf das Ausgangsthema zurückkommen. Die Vollversammlung verurteilte Hus zum Feuertod und schrieb die Verbrennung der Gebeine Wyclifs fest. Ersteres wurde an Ort und Stelle durch den Pfalzgrafen Ludwig ausgerichtet, einem weltlichen Herrn. Töten ist nicht die Aufgabe der Kirche.“
„In simplen Worten: Hus hat man verbrannt und mit Wyclif ließ man sich Zeit.“
„Es war weniger drängend.“
„An der Hinrichtung des Böhmen störte sich niemand?“
„Bedenke, der Vertreter Gottes hatte entschieden. Etwas anderes erregte die Gemüter weit mehr: der Tod Wenzels.“
„Verstehe ich nicht. Wer ist Wenzel?“
„Der Sohn Kaiser Karls IV.. Wenzel trat an seine Stelle, wurde aber, da er sich um wenig kümmerte, für abgesetzt erklärt. Man wollte den Luxemburger … Du weißt, dass Karl vom Geschlecht der Luxemburger war?“
„Ist mir bekannt.“
„Man entschied, dieser Sippschaft das Heft aus der Hand zu nehmen und wählte einen Wittelsbacher, Rupprecht von der Pfalz, zum König.“
„Weichst du nicht vom Thema ab?“
„Geduld. Rupprecht regierte zehn Jahre. Nach seinem Dahinscheiden fiel Jobst von Mähren die Herrschaft über das Heilige Römische Reich zu, der wiederum im ersten Regierungsjahr vergiftet wurde. So heißt es. Seine Entscheidungen waren nicht zufriedenstellend. Ihm folgte Wenzels Halbbruder Sigismund. Und der unterstützte auf dem Konstanzer Konzil die Hinrichtung Hus´. Wenzel, der zwar als Herrscher des Heiligen Römischen Reichs entthront worden, aber König der Böhmen geblieben war, stand ihm als erbitterter Widersacher gegenüber.
„Kaiser Sigismund kontra Böhmenkönig Wenzel, und auf dem Spielfeld stand Hus. Verstehe ich recht?“
„So lass ich es gewähren. Die vom Huswahn geblendeten Böhmen gerieten ob seiner Hinrichtung in Wut, und das hatte Folgen. Sie drangen in das Prager Rathaus und warfen den kaiserfreundlichen Bürgermeister, zwei Ratsherren und weitere sieben Personen aus dem Fenstern.“
„In den Tod?“
„Soweit sie nach Atem rangen, wurden sie erschlagen. Seit dato folgt ein Krieg dem anderen. Böhmens Hain und Fluren sind vom Blut getränkt.“
„Die Hussitenkriege“, murmelte ich.
„Der Begriff passt.“
Eines wurde deutlich, eine neue Ära war angebrochen. Wyclif hatte mit seiner Anklage ein Tor aufgeworfen und Jan Hus seine Gedanken verbreitet. In der Folge würde Martin Luther in den Startlöchern stehen. Die ersten Weichen zur Reformation waren gestellt. Für mich selbst war eine andere Erkenntnis weit wichtiger: Das 15. Jahrhundert eröffnete sich vor mir, das Janusjahrhundert, das sowohl auf das Mittelalter, wie auf große Veränderungen blickte. Humanistisches Denken entflammte, wissenschaftliche Erkenntnisse begannen zu greifen und gleichzeitig regierte die Kirche mit brutalster Härte.
Der Hinweis Anselms auf die Päpste warf meine Gedanken in überstandene Stunden zurück. Gemeinsam mit Ning, dem treuen Freund, hatte ich die unleidige Geburt des sogenannten Schismas erlebt, der Situation, in der zwei sich hassende Heiligkeiten die Geistlichkeit beherrschten.
Aus Anselm die weiteren Entwicklungen herauszukitzeln, war nicht schwierig. Mir lag daran, ein rundes Bild zu bekommen, zumal ich mich zur Stunde in klerikalen Kreisen bewegte.
Eines begriff ich auf Anhieb: Das im ausgehenden 14. Jahrhundert entfachte Chaos bestand unverändert. Übersichtlich war die Entwicklung in Avignon. Clemens VII. war im Gegenkonklave zum Widersacher Urbans VI. gewählt worden. In Rom konnte er nicht fruchten, die Bevölkerung lehnte ihn ab, so wich er nach Avignon aus. Ihn beerbte Benedikt XIII., der Luna. Zu Rom verstarb Urban VI. nach einem satten Jahrzehnt. Bonifatius IX., Innozenz VIII., Gregor XII. folgten, der letzte war zum Rücktritt bereit, um die ungnädige Zweiteilung zu beenden. Doch ihm wurde dies massiv abgeraten, da man befürchtete, der Einfluss der Franzosen werde gestärkt. Ein absolut absurder Zustand ergab sich nach einem neuerlichen Konzil. Es wurde in Pisa einberufen. Doch anstatt sich auf einen Papst zu einigen, wurde zusätzlich Alexander V. gewählt, so dass es jahrelang drei Heilige Väter gab!
Luna hatte zwischenzeitlich im Frankenland an Rückhalt eingebüßt und belegte die schwächste Position. Trotzdem stellte er sich einer Abdankung entgegen. In Pisa wurde den bisherigen Päpsten eigentlich der Gehorsam aufgekündigt, sie wurden als Ketzer gebrandmarkt.
Ungeachtet dessen blieben die iberischen Länder Luna treu, Rupprecht, der das Heilige Römische Reich regierte, Gregor XII.. Die meisten Herrscher schworen auf den frisch erkorenen Alexander V., der ein Jahr später verstarb. An seine Stelle trat Johannes XXIII. Das Konstanzer Konzil wurde somit bitternötig. Bei dieser Gelegenheit sollten alle drei Päpste abdanken.
Massive Auseinandersetzungen zwangen Johannes zur Flucht aus der Bodenseestadt. Er wurde verfolgt, gefasst, verhaftet und seines Amtes entkleidet. Sein Name, Johannes XXIII., wurde aus den Büchern entfernt, so dass eine weitere Heiligkeit, Jahrhunderte später, das Recht zustand, auf ihn zurückzugreifen.
Gegen Luna wurde ein Prozess eröffnet, Gregor XII hatte abgedankt. Die Konzilsuperiorität, die sich über alle Väter erhoben hatte, entschieden sich für einen neuen Vertreter: Martin V., Italiener aus dem Geschlecht der Colonna. An ihm lag es, den Kirchenstaat zu reformieren und zu erneuern.
Das entspricht die Situation, in die ich geraten war.
Unser Eintreffen in Canterbury fand unter wirren Umständen statt. Die Geistlichkeit hatte sich auf hohen Besuch eingestellt. Es wurde vom Prinzen, von den Herzögen von Gloucester und Bedfort gesprochen. Wir waren klägliches Beiwerk. Der Erzbischof erzwang sich ein minimales Zeitfenster, um uns geschwind abzufertigen. Mir war es lieb.
Anselm übergab seiner Exzellenz das Schriftstück. Der warf einen kurzen Blick darauf.
„In der Swift verstreut?“
„So hatte es der Bischof von Norfolk angeordnet.“
„Vortrefflich. Dann ist mir gestattet den Akt zu schließen. Ich danke.“
Damit waren wir entlassen.
„Macht Platz! Der zukünftige König.“
Hektisch wurden wir in dem festlichen Flur, den wir zu passieren hatten, zur Seite gedrängt. Ich drückte mich zwischen zwei Wandlüster. Eine Gruppe adliger Herren schritt vorüber. Ein Junge, ich schätzte ihn auf sechs oder sieben Jahre, bewegte sich unter ihnen. Als sich unsere Blicke trafen, zögerte er. Wie es meiner Art eigen war, grüßte ich ihn freundlich. Den anderen entging sein Zaudern nicht, sie hielten inne.
„Heinrich, Seine Exzellenz steht bereit“, mahnte einer der Anwesenden.
„Darf ich dich nach deinem Stand fragen?“, wandte sich der Junge ungeachtet des Einwurfs an mich.
„Ich habe allein einen Namen“, entgegnete ich mit geneigtem Kopf, „Manuel. Er trägt mich durchs Leben.“
Der Junge lachte herzlich und zog weiter.
Anselm stupste mich aufgeregt an. „Weißt du, wer das war?“
„Der zukünftige König?“
„Englands und Frankreichs, der Sohn Heinrichs V.. Heute wird über seine Krönung beraten.“
In der folgenden Nacht wurde ich in unserer Herberge in Canterbury aufgegriffen, fast will ich sagen verhaftet, zumal ein intensives Verhör folgte, dessen Sinn sich mir nicht erschloss. Nachforschungen zu Details meines Herkommens umging ich wie ein Balletttänzer. Unverständnis war vorprogrammiert.
Ein Gelehrter wurde hinzugezogen. Die Befragung, zunächst eine banale Unterhaltung, schlitterte nach und nach in ein ernstes Gespräch. Der Austausch geriet derart intensiv, dass ich mich schwertat, den engen Pfad zwischen Häresie und Christentreue zu bestehen.
Es gelang.
Erleichtert verabschiedete ich mich am Ende des Gesprächs.
„Wohin wirst du gehen?“
„Es wird sich ergeben“, sagte ich in dem Versuch, vage zu bleiben.
„Man hat ein Zimmer vorbereitet.“
„Für mich?“ Ich stockte. „Wo?“
„Nahe Seiner Majestät, dem zukünftigen König. Wir alle sind über deine Kenntnisse in der Historie überrascht, zudem bist du des Arabischen mächtig und trägst edle Gesinnung. Seiner Majestät wird deine Gegenwart nicht zum Schaden sein.“
„Seine Majestät bat darum?“
„Ein derartiges Ersuchen liegt vor.“
Das Vertrauen des Prinzen gewann ich im Flug. Heinrich litt unter dem Druck seiner Erzieher und Vertreter, die die Ländereien an seiner Stelle verwalteten. Er wurde von seiner Mutter, Katharina von Valois, ferngehalten, der Weg zu ihr war ihm verwehrt. Man hatte Angst, sie könne französische Sympathien in ihn pflanzen und eine Art pflegen, die wider England stünde. Den Kontakt zwischen Mutter und Sohn am Leben zu erhalten, war brandgefährlich. Der Prinz deutete mehrmals an, er sähe meine Zukunft in diesem Aufgabenbereich.
Heinrich V., der erfolgreichste Regent seiner Generation war zu früh verstorben, sein Sohn zählte am Todestag gerade acht Monate. Das Geschick Heinrichs bestand zum einen darin, dass er den englischen Adel zu einigen verstand und mit Erfolg einen Krieg gegen Frankreich führte. Sein Ableben war daher ein Desaster. Humphrey, der Herzog von Gloucester, der Prinz nannte ihn nur „den Gloster“, verwaltete die Insel. Das Kriegsgeschehen lag in den Händen Johns, dem Bedfort. Er war der Stärkere der beiden Dukes, wie mir schnell deutlich wurde.
Monate brachte ich in London und des Prinzen Umgebung zu.
Bald kristallisierte sich ein Datum heraus. Heinrichs Krönung wurde auf den 6. November 1429 fixiert. Er würde von dann ab einer der mächtigsten Männer der Welt sein, zumal Bedfort ein realistisches Vorhaben fest im Visier behielt: die vollständige Unterwerfung Frankreichs. Der Krieg war ständig in aller Munde. Da er sich nicht auf englischem Grund abspielte, war man an einem Frieden wenig interessiert.
Im Gegenteil, die britischen Edlen genossen es, auf fernem Erdboden Ruhmestaten zu sammeln, mit denen sie prahlten. An einem derartigen Kriegszug für zwei oder drei Wochen teilzunehmen war, wie bereits erwähnt, mit einer Kurzsafari vergleichbar, zumal man sich gewöhnlich auf der Gewinnerspur sah.
Knapp bevor ich die aberwitzige Papstwahl in Rom miterlebt hatte, war Englands König Eduard III. gestorben, zuvor dessen Sohn, der als schwarzer Prinz in die Geschichte einging. Damals schon blieb die Verantwortung an einem Kind hängen, Richard II., dem Sohn des schwarzen Prinzen. Wenn auch erfolgreich, war er den Auseinandersetzungen mit dem Parlament auf Dauer nicht gewachsen, er verstarb im Gefängnis, während sein Widersacher, Heinrich IV., das Zepter an sich riss.
Der Großvater „meines Heinrichs“, konnte mit seinem Sohn, dem späteren Heinrich V., zunächst nicht zufrieden sein, da dieser ein ausschweifendes Leben führte. Der Alte missbilligte das.
Der Literatur sollte diese Situation in ferner Zukunft zugutekommen, da William Shakespeare sie den Geschichten der lustigen Weiber von Windsor und des Falstaffs zugrunde legte. Später entpuppte sich der missratene Sohn zum englischen Star. Er erkannte Frankreichs Schwächen, ließ den Krieg - wir kennen ihn heute als den Hundertjährigen - erneut aufflammen und eroberte erhebliche Teile des Landes.
Der Enkel würde diese Auseinandersetzung und damit die Verantwortung für das Elend erben. Frankreich befand sich ausgeblutet in der Defensive. Wie ständig betont wurde, fehlte ein letzter Streich, um die Stadt Orleans, die von den Gegnern unter allen Mühen gehalten wurde, zu Fall zu bringen.
Heinrich würde nicht allein der König Englands sein, sondern ebenso über die eroberten Gebiete Frankreichs bestimmen. Dem wollte man mit einer zweiten Krönung in Reims Rechnung tragen. Wie trefflich ich doch die Zeremonie kannte: fränkische Herrscher werden traditionell in Reims gekrönt. Auf Grund der Kriegswirren war dies nicht gefahrlos möglich. Die Adligen waren gezwungen, den Plan abzuändern.
Paris kam zur Sprache. Notre Dame.
Zufrieden war mit dem Vorschlag keiner. Bedfort fand sich damit ab, der Gloster keinesfalls. Er, im Übrigen der fünfte Sohn Heinrich IV., wollte unbedingt wissen, ob sich nicht doch eine Möglichkeit ergäbe, nach Reims auszuweichen. Die Anweisung war unmissverständlich. Eine kleine Delegation hatte Klarheit zu schaffen, und zu der wurde ich verpflichtet. So bestieg ich im November 1428 das königliche Schiff und wechselte nach Frankreich über.
Mein erster Eindruck war niederschmetternd. Während man sich auf der Insel feierte, traf ich den einst gallischen Grund erneut verwüstet, ausgeplündert, komplett ausgeblutet an.
Paris … Ich erspare mir die Schilderung. Zu der verwahrlosten Metropole passte die Wortschöpfung „entblüht.“ Ausgesaugt, von englischfreundlichen Windhunden bestellt, fehlte ihr jeglicher Ansatz einer denkbaren Entfaltung.
In meiner Anwesenheit sah ich keinen Sinn.
„Es ist die Glut, die die Menschheit zum Schmelzen bringt und in deren Asche aller Hass der Welt überlebt!“
Mit welcher Wucht ward ich aus dem Schlaf gerissen! Ich setzte mich auf.
Nacht. Ruhe, soweit man die leichten Schnarchtöne nicht störend empfand. Hatte ich nicht Worte gehört, deutlich, laut, drohend? Verwirrt erhob ich mich, schlich aus dem Raum, über den Flur, vor das Haus. Ausgestorben erlebte ich alles rings um mich. Rastlos zog ich umher, wiederholte ständig den Satz, obgleich er längst fest eingestempelt in mir schwelte.
Karl, der Köhler! Er sprach von der Glut, die er wider Kastraventa beziehungsweise deren Töchter unermüdlich anheizte.
Warum wühlten mich derartige Gedanken in jener Nacht so auf?
Ich versuchte, sie von mir zu schieben, ergriff andere Fäden, um neue Bilder zu stricken.
Es war sinnlos. Die Gewalt der Worte hatte mich erfasst und mir die Dämonenwelt vor die Augen geführt. Jedes Widerstreben scheiterte.
Ich floh aus Paris und streunte durch die gebrandschatzten Ländereien, stets den Kohlbrenner vor Augen.
Weit über einen Monat lang trieb ich mich in eisiger Kälte durch die Lande, fand glücklicherweise bei manchem Bauern eine Bleibe, die ich voller Dank abdiente. Die Weihnachtstage, die die Geschlagenen in größter Armut verbrachten, blieben mir nachhaltig in Erinnerung. Ausgehungert, erwartungslos, die letzten Stofffetzen zu Hemden geheftet, erduldeten sie ihr Schicksal. Die Resignation hatte nach nahezu 100 Jahren Krieg gesiegt.
Der Zerrissenheit begegnete ich innerhalb der Mauern Vaucouleurs hautnah. Die Stadt, die sich unter französischer Krone nur mit größter Mühe behauptete, lag im Machtbereich der Burgunder. Das Königreich Burgund war am Rande der pausenlosen Kriegsereignisse zu einem einflussreichen Staat geraten, der mit England kooperierte. Die Bürger Vaucouleurs versuchten, ein leidliches Leben zu gestalten, und übten im Schatten von durchflutenden Soldatenhorten und Bittstellern ihr Handwerk aus. Mit stoischem Gleichmut, kaum zielgerichtet, klebten sie an ihrem Tagwerk.
Verschwenderischer Funkenflug, entzaubert durch Schläge auf glühendes Eisen, gebot mir Einhalt. Die Paarung Glut und höllische Töchter waren ohnehin gegenwärtig. Kein Auge wendete ich von ihr ab.
Der Schmied hielt inne.
„Du bist neu hier? Ein Durchreisender?“.
„Lediglich ein Wanderer.“
„Dann suchst du nicht nach einem Eisen für dein Pferd?“
„Hätt´ ich doch eines.“
Er schlug weiter auf das Metall ein. Ich blieb unverrückt an Ort und Stelle, als sollte mich etwas einholen. Es verunsicherte den Meister.
„Dir ist sicher nach einem Suter?“
„Oh nein!“ Ich schaute auf meine Sohlen. „Ihr Zustand ist zwar bedauernswert, aber eine Aufbesserung kann ich mir kaum leisten.“
„Was hält dich hier?“
„Gibt es eine Herberge für eine Nacht?“
„Bei uns?“
„Im Ort. Ich treffe an jeder Ecke auf ein kräftiges Durcheinander. Es ist schwer zu erkennen, wer Gast, wer Anwohner ist. “
„Wir sind´s gewohnt. Es lohnt sich nicht, sich daran aufzuhalten.“
„Jaques, wir haben Besuch.“ Eine junge Frau war dazugestoßen und strahlte über beide Ohren.
„Darf ich raten?“
„Du weißt schon.“
„Johanne?“
Ein Mädchen, wenige Jahre der Pubertät entschlüpft, schob sich in die Werkstatt.
„Junge, du hast heute unerwünschte Karten, unser freies Bett ist vergeben.“
„Da habe ich Verständnis“, erwiderte ich scherzend, „irgendein vergessener Schuppen wird seine Freude an mir haben.“
Das Mädchen verströmte einen Charme, den ich aus ganzem Herzen erwiderte und so entschuldigte ich mich und wandte mich um.
Johanne, die nicht wissen konnte, in welchem Verhältnis ich zu dem Schmied stand, unterstellte eine Bindung und suchte nach einer Lösung.
„Mir ist es recht, wenn er im Hause bliebe. Stroh ist schnell zur Hand und darauf schläft es sich gut.“
Der Vorschlag kam derart scharf und tonangebend, dass der Hausherr eine Zurückweisung nicht im Geringsten in Erwägung zog. Er ergab sich dem Willen des Mädchens diskussionslos.
Freundschaftlich wurde ich in ein oberes Stockwerk geführt. Zwischen den Schlafstätten der Hausangestellten wurde auch mir eine hergerichtet.
Als ich wider Erwarten zum abendlichen Tisch eingeladen wurde, versuchte ich mich erkenntlich zu zeigen und bot Hilfe bei der Arbeit an. Es erheiterte den Schmied.
„Lass es gut sein“, sagte er bloß.
Mir war es unangenehm. Johanne erkannte das und beruhigte mich mit der Anmerkung, bei den Royers stets am rechten Ort zu sein.
„Was wäre es für eine entsetzliche Welt ohne die Herzen der Menschen“, erwiderte ich.
„Denen Gott Leben verschafft“, ergänzte sie und tauchte ihren Löffel in die Bohnensuppe.
„Ich vermute, du wirst es abermals wagen?“, sprach Royer sie an.
„Wie schätzt du meine Chancen ein?“, wollte Johanne wissen.
„Hauptmann Baudricourt steht mit dem Rücken zur Wand. Es ist fraglich, wie lange wir uns gegen die Burgunder stemmen können. Unser König ist in einer ähnlich verzweifelten Lage. England wirft pausenlos Soldaten auf den Kontinent.“
„Die Briten bemühen sich, das Land zur Krönung Heinrichs abzusichern“, warf ich unbedarft ein.
„Gibt es denn einen Termin?“ Johanne schaute mich verwundert an.
„Ich denke ja.“
„In diesem Jahr?“
„Der Monat November ist im Gespräch.“
„Zuvor wird es eine ganz andere Krönung in Frankreich geben, die schmerzvoll für die Unterdrücker sein wird.“
Royer lächelte. „Johanne, du überrascht uns immer wieder mit einer selbstverständlichen Sicherheit.?“
„Wenn ich es sage.“
„Du sprichst nicht von Heinrich VI.?“
„Nein, von ihm rede ich nicht.“
Johanne Dark - mit ihr teilte ich an jenem Abend das Mahl.
Vom ersten Augenblick an verband uns eine warmherzige Freundschaft.
Für Hoyer verrichtete ich nun doch kleinere Arbeiten in der Schmiede. Ich sicherte mir dadurch vorübergehend eine Unterkunft. Johanne sorgte in der Stadt für einigen Wirbel, der sie ins Gespräch brachte. Sie verstand es, auf einer politisch unheilvollen Welle zu schwimmen, was, gepaart mit ihrer konsequenten Überzeugung, zum Erfolg ausersehen war. Die Vereinigung von drei Wesenszügen unterstützte ihr Ansinnen. Zunächst fiel ihre bedingungslose Frömmigkeit auf. Gebete gehörten zu ihrem Tagesablauf. Unter Menschen überzeugte ihr unwiderstehliches Charisma. Und schließlich vervollkommnete ihre bissige Weise vorwärtszustreben, die Gesinnung gnadenlos umzusetzen, ihre Stärke. Ich fragte mich in jenen Monaten öfter, woher sie die unerschütterliche Kraft schöpfte, jedes Hindernis zu bestehen, und kam zu dem Schluss, dass sie solche gar nicht wahrnahm. Stolpersteine erlebte sie als eine von Gott geschenkte Stufe, um einem Ziel näherzukommen.
Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir in der Schmiede führten. Johanne kam erschöpft von ihrer Tagesarbeit zurück.
„Kommst du voran?“, fragte ich.
„Baudricourt wird mich nicht mehr lange beiseiteschieben.“
Baudricourt, so will ich ergänzen, war der Stadthauptmann, der mit Raffinesse verstand, Vaucouleur französisch zu halten.
„Was erwartest du von ihm?“
„Er muss mir den Weg nach Chinon freimachen, das Tor zum Dauphin.“
„Dem König?“
„Dem Dauphin“, nickte sie.
Man muss sich fragen, woher das bescheidene Mädchen die Selbstverständlichkeit nahm, einem Stadthauptmann ein derartiges Einverständnis abzufordern, um dann unbeirrt vor das Staatsoberhaupt zu treten. Es brauchte ein wenig Zeit, bis ich es begriff.
Oft wird von einem Bauernmädchen gesprochen. Das passt nicht. Ihr Vater war in ihrem Geburtsort Domrémy, einem kleinen malerischen Dorf an der Maas, eine angesehene Person mit Mitspracherecht. Das „etwas bewirken können“ war ihr bedingt in die Wiege gelegt. Wesentlicher erachte ich ihre sensible Art, Missstände hochemotional zu realisieren und sie im Halbschlaf zu verarbeiten. Verbunden mit dem tiefen Gottesglauben reifte in ihr ein Bewusstsein, das Gerechtigkeit und Fairness über alles erhob. Dies kristallisierte sich zu ihrer ureigenen unumstößlichen Charakteristik. Vieles deckte sich mit der Geisteshaltung der Mitmenschen. Die von ihr beschworene Jungfernschaft blieb dabei Abbild ihrer Reinheit und garantierte den Schutz der Kirche.
Manches davon wurde in Vaucouleur deutlich.
Zwei Tage nach unserem Gespräch wurde Johanne vor den Stadthauptmann gebeten. Heute würde man sagen, ihm „brannte der Frack“ und so war ihm jeder Rettungsanker lieb.
Noch wurde das Wunder „Johanne“` nicht in den Himmel gehoben, doch waren die Herzen der Menschen von ihr gefesselt. Baudricourt konnte sie nicht mehr ausblenden, so entschloss er sich zu einem vorsichtigen Herantasten, gestand ihr die Reise nach Chinon zu und versicherte ebenfalls, ihr ein Empfehlungsschreiben für den Dauphin an die Hand zu geben.
Johanne hatte ihr erstes Ziel erreicht.
Weitere Visionen, die Befreiung Frankreichs, die Salbung des Dauphins zum französischen König und damit verbunden, die Beerdigung des Kriegs, behielt sie unbeirrt im Blick.
Eine Eskorte wurde zusammengestellt. Bertrand de Poulengy, Jean de Metz und Colet de Vienne waren die auffälligsten Persönlichkeiten der Gemeinschaft. Mir fiel die Gunst aus schlüssigem Anlass zu: Die Tage zuvor hatte ich Johanne das Reiten und den Umgang mit Pferden gelehrt.
Genau erinnere ich mich, wie sich Johanne an jenem 13. Februar 1429 mit frisch geschnittener Pilzkopffrisur, Hosen und schwarzem Umhang auf ihr Ross schwang. Eine Strecke von 400 Kilometer lag vor uns, weitgehend durch die feindlichen Gebiete der Engländer und Burgunder. Klirrend kalte Flüsse hatten wir zu durchqueren, mit etwas Glück würde der strenge Winter Eisbrücken gebaut haben.
Jean de Metz führte einen Freibrief des Stadthautmanns mit sich, so fanden wir zumindest ohne Probleme Herbergen, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass wir meist nachts ritten. In feindlichen Gebieten banden wir die Pferdehufe in Säcke ein, um den Klang eines harten Aufschlags zu dämmen.
Die Ankunft in Chinon glich einem kleinen Wunder.
Mir war schleierhaft, wie Johanne den Dauphin, wie sie den Thronerben stets nannte, da er von den Eltern verschmäht und verstoßen wurde, von ihrer Vision zu überzeugen gedachte. Ruhig und gefasst saß sie auf ihrem Pferd, als sich die Fallbrücke senkte und sich das Tor zur Burg öffnete, die über der Stadt Chinon wachte. Unbeirrt trat sie vor den König. Dies allein war eine bezaubernde Begebenheit.
„Sehr edler Dauphin!“ Sie verneigte sich. „Man nennt mich Johanne, die Jungfrau. Ich bin gekommen, Euch und dem ganzen Königreich Hilfe zu bringen. Der König des Himmels lässt Euch durch mich ausrichten, dass ihr in Reims gesalbt und gekrönt werden sollt. Und weiter sage ich Euch im Auftrag Gottes, dass ihr der wahre Erbe des Reiches und der rechtmäßige Sohn des Königs seid und dass ich gesandt bin, Euch nach Reims zu führen.“
Was sich in jenem Moment im Kopf Seiner Majestät abspielte, war schwer zu erkennen. Seine Fluchtkutsche stand ständig bereit. Ziel: La Rochelle. Sein Wesen war von Niederlagen gezeichnet. Johanne betonte das Grundsätzliche, seine edle Herkunft, die ihm selbst von den Nächsten abgesprochen wurde. Es war scharfsinnig, auf die Rechte abzustellen, die dem Dauphin zustanden und von denen er nur träumen konnte.
Längst war ihm der Trubel um Johanne zugetragen worden. Das Volk vergötterte sie. Sie zu verstoßen, wäre es politischer Selbstmord gewesen?
Sein Blick wanderte von einem der Anwesenden zum anderen. Die Antwort, die er sich erhoffte, blieb aus. Er entschied sich für eine gesunde Neutralität, bot uns Quartier im Turm an und bedankte sich.
Was sich für Johanne als Triumph anfühlte, nämlich nahe dem Dauphin zu sein, erlebte ich weniger beglückend. Einst war in jenem Turm, in dem wir untergebracht waren, Jacques Molay, der Großmeister der Templer, an dessen Seite ich beinahe den Feuertod gefunden hatte, eingekerkert. Weiterhin stellte sich ein Edler, Gilles de Rais, vor, der das Vertrauen Johannes gewann, mir aber zutiefst zuwider war. Später sollte er als brutaler Kinderschlächter in die dunklen Geschichten des Mittelalters eingehen. Die abträglichen Keime schlummerten tief in seinem Wesen.
Johanne wurde einer strengen Prüfung unterworfen. 16 Herren und zwei Bischöfe durchforschten sie in Verhören, die täglich zwei Stunden in Anspruch nahmen, hartnäckig. Die Schwiegermutter des Dauphins und ein Hofdamenduo versicherten sich gar ihrer Jungfräulichkeit. Nebenbei ließ sie sich das Kriegshandwerk erklären. Dabei blieb sie im Widerstreit mit sich selbst. Zwar vermochte sie flink das Schwert zu führen, zum Töten aber war sie keinesfalls geboren.
Trémoille, ein Berater des Königs, hielt sich bedeckt und beäugte den wachsenden Ruhm des Mädchens, mit Argwohn. Die Glorie Johannes erfasste nicht nur die Herzen der Menschen, sondern auch die des Heers. Es reifte eine Zuversicht und diese festigte den Glauben an den großen Erfolg.
Trémoille widerstrebte diese Entwicklung.
Den Anblick des Königs brachte ich instinktiv mit dem Niedergang der fränkischen Monarchie in Verbindung. Wobei es mir an einer logischen Begründung fehlte.
Bertrand de Poulengy erklärte mir das Grundproblem. Und wieder half mir bereits Erfahrenes weiter. So war mir in Erinnerung geblieben, dass die Schwester Kaiser Karls IV. mit Johann II. verheiratet wurde. Ihr Sohn, wiederum ein Karl, erbte den westfränkischen Thron - zwischenzeitlich ist es erlaubt, vom französischen zu sprechen. Keinesfalls darf jener französische König Karl V. mit dem späteren Kaiser Karl V., dem Habsburger Erbe, verwechselt werden. Eine Generation weiter folgte der Sohn Karl VI. im Frankenland. Er litt an einer Krankheit, die ihm zeitweise die Sinne raubte. Zwar beeinträchtigte dies seine Beliebtheit nicht, doch übten die Oheime, die Herzöge von Burgund und Orleans, die Regierungsgeschäfte aus. Die Ausfälle des Königs spalteten das Land. Während der Herzog von Orleans seine Macht im Süden ausdehnte, gelang dem Burgunder, Philipp dem Kühnen, auf Grund seiner Bürgernähe die Festigung eines unabhängigen Reichs. Er bemächtigte sich Flanderns und löste damit ein neues Problem aus, denn die gefügten Reichsteile hörten auf unterschiedliche Päpste.
Bertrand übersprang nähere Ausführungen und kam auf Philipps Sohn, Johann, zu sprechen, der nicht ohne Grund mit dem Beinamen „der Unerschrockene“ ausgezeichnet wurde. Johann ließ seinen Gegenspieler Ludwig von Orleans auf offener Straße töten, um seinen Ruf zu festigen. Er verkaufte die Tat als Tyrannenmord. Ein solcher war der Orleans durchaus. Der Mord strahlte aus und führte zu einem Massaker an der Pariser Bevölkerung und dem Bürgerkrieg der Armagnacs und Bourguinons. Johann wurde in dessen Verlauf selbst ermordet. Der Stahl traf ihn hinterrücks auf der Seinebrücke von Montereau. Er hatte sich dort zu einem vermeintlichen Versöhnungsgespräch mit dem Dauphin, dem Sohn Karls VI. - also jenem Fürsten, der uns beherbergte - getroffen.
Das Letztere trug sich vor zehn Jahren zu. Die Schwächung Frankreichs hatte den englischen König Heinrich V. dazu verleitet, die Kriegshandlungen zu eröffnen und die Ländereien der Armagnacs an sich zu reißen. Im Frieden von Troyes verlor Karl VI. den Thron. Heinrich ehelichte dessen Tochter und ward so zum scheinbar rechtmäßigen Herrscher über beide Länder.
Die Zusammenhänge der Misere lagen nunmehr deutlich vor mir ausgebreitet.
Die Anwesenheit Johannes im königlichen Umfeld steigerte das Vertrauen und die Zuversicht des Heers. Von Natur aus besaß sie das Talent, Menschen zu fesseln. Die royale Stütze veredelte ihren Ruhm. Die Fürsten belauerten den Trend, ließen ihn gewähren und zogen ihre Schlüsse. Johanne wuchs zu einer Galionsfigur, durchaus nicht unumstritten, doch alternativlos und am Ende hatte ohnehin der Dauphin die Entscheidungsgewalt.
Orleans blieb ständiger Gesprächsstoff. Mit dieser Stadt stand oder fiel der Widerstand Frankreichs. Würde sie stürzen, wäre das Einfallstor nach Bourges aufgerissen und das Erbe den Engländern ausgeliefert. Bedford, den ich in London persönlich kennengelernt hatte, war sich dessen bewusst. Er zielte konsequent darauf ab, Orleans zu bezwingen. Einer Katze gleich umschlich er sein Opfer und lauerte auf den passenden Augenblick für den fehlenden Todesbiss.
Sein Vorgehen war durchdacht. Bedford hatte die Versorgungswege der Stadt abgeschnitten und schwächte durch das Leid des Mangels die Moral der Einwohner. Warenlieferungen waren bedingt über die Loire möglich. Ausreichend waren sie keinesfalls. Die Zeit spielte für die Gegner. Krisenstimmung.
Von Tag zu Tag wurde das Elend bedrohlicher. Handeln war angesagt, doch wie?
Der Dauphin stand bei seiner Entscheidung zwischen dem eisernen Willen Johannes, die in überzeugtem Gottvertrauen an seinen Sieg glaubte und dem übervorsichtigem Trémoille, der zu politischen Lösungen neigte. Das mochte ihn ehren, es gab dazu aber keine Ansatzpunkte.
Der anschwellende Druck zwang den Herrscher, auf das Mädchen zu setzen. Wie zu einer Heiligen wurde zu ihr aufgeschaut und selbst die entfernten Bürger Orleans, klammerten sich an diesen Strohhalm.
Der König entschied, die Aura Johannes zu nähren und zu fördern. Er versah sie mit Symbolen, einem eigenen Banner, einem mystischen Schwert und unterstützte ihre Mahnungen, auf Plünderungen und Flüche zu verzichten und keine Huren zu dulden. Gott würde durch sie das Heer befehligen und so mussten Ausschweifungen verderblich sein. Johanne erfüllte die Funktion der heiligen Lanze. Sie stand für die Gewissheit zu obsiegen.
Der Anfang war unheilschwanger. Johanne führte ihr Heer, das aus einer bunten Mischung von erfahrenen Kriegern und dahergelaufenem Volk bestand, zur Loire. Unser Lager positionierten wir zehn Kilometer östlich von Orleans. Ziel war es, die Stadt auf dem Wasserweg zu erreichen. Ein Problem lag in der steten Westströmung der Winde, die ein Vordringen mit Segelhilfe erschwerten.
Als ob es das Mädchen verdient hätte, drehte sich der Wind. Dies wurde wie ein Wunder, das Gott Johanne zudachte, gefeiert. Die Fahrt gelang zügig und erfolgreich. Ehe es die Engländer begriffen hatten, schwang sich Johanne vor den Toren auf ein Pferd und ritt unter großem Jubel in Orleans ein.
Es trat ein, worauf der Dauphin gebaut hatte: Die Bevölkerung fasste Mut, verfiel in eine Euphorie und hing in wachsender Siegesgewissheit an den Lippen des Mädchens. Über allem schwebte etwas Magisches und als nach drei Tagen weitere Verstärkung eintraf, feierte Johanne dies nicht bei einem Bankett, sondern in einer schlichten Messe.
Den Engländern war dies alles nicht entgangen. Die Kriegsmaschinerie lief an. In überstürzter Eile bauten sie ihre Stellungen aus und zogen erfahrene Ritter zusammen. Es fielen Namen wie der des Sir John Fastolf.
„Wir greifen an!“
Trotz allem kam der Befehl überraschend. Johanne kannte das Leiden, die Kadaver auf der Straße, um die sich Raben und Hunde stritten, nicht aber den Krieg und die Todesschreie hunderter Dahinsterbender.
„Meinst du, sie hat einen Plan?“, hörte ich jemanden fragen.
„Den braucht sie nicht“, war die Antwort.
Und das traf es. Johanne setzte auf Überraschung. Sie ignorierte das, was man unter Kriegsstrategie verstand. Eine Klosterruine, die zu einer Schanze ausgebaut war, hatte sie ins Auge gefasst. Hochmotiviert stürzte sich ihr Heer auf das Ziel. Die Frau, hoch zu Ross, strahlte in die Weite und verunsicherte die Gegner. Die Wirkung war immens und brach den Widerstandswillen.
Am darauffolgenden Tag war Christi Himmelfahrt und somit der Einkehr gezollt.
Der kleine Erfolg, der Johanne zukam, führte unmittelbar zu Unsicherheiten. Sie selbst, getragen von ihm, entschied, an die erblühte Motivation ihrer Soldaten anzuknüpfen. Die militärischen Vertreter des Dauphins rieten zur Zurückhaltung und versuchten Kampfhandlungen abzuwürgen.
Johanne fühlte sich verraten, missverstanden, verwies auf die Gegner, die den Augenblick nutzen, die Ruine des Augustinerklosters, wie auch eine Brückenfestung zur Bastion auszubauen.
Es gelang ihr, sich zu behaupten und der Erfolg gab ihr Recht. Wieder rollte das wilde Heer über die Engländer hinweg.
Während des ersten Angriffs nach der Mittagspause geschah das, was zu befürchten gewesen war, ein Pfeil traf Johanne in der Schulter. Die Engländer ahnten, dass allein durch ihren Tod der Zauber zu brechen wäre.
Johanne brach zusammen.
Ich war schnell zur Stelle und half bei der Entfernung des Brustpanzers. Olivenöl sollte die Verletzung desinfizieren, Speck die Wunde schützen.
Mit dem Sturz des Mädchens brach die Moral des Heers. Sie erfasste es auf der Stelle und biss die Zähne zusammen.
„Legt mir den Harnisch um“, bat sie.
Ich wandte mich an den Krieger, der sich um sie bemühte und dem ich ärztliche Kenntnisse zutraute. „Schafft sie es?“
„Die Wunde ist nicht tödlich.“
„…und wenn sie zu viel Blut verliert?“
„Das Fett verhindert es“, erklärte er mir und bat Johanne: „Halte dich möglichst starr im Sattel. Bitte unterlasse beherzte Bewegungen.“
„Ich werde mich hüten“, versprach sie und ließ sich auf das Pferd heben. „Gebt mir die Standarte.“
„Sie macht dich zum Ziel“, warf ich ein.
„Das ist der falsche Gedanke“, widersprach sie, griff nach der Stange und ließ ihr Wappen für alle sichtbar flattern. Wie durch einen Vitaminschub schoss Leben in das Heer. Die Engländer wurden hemmungslos überrannt.
Sir William Glasdale, einer der gegnerischen Heerführer, floh über eine brennende Holzbrücke. Sie brach. Er fand in den Fluten den Tod.
Tags darauf hoben die Briten die Belagerung auf. Orleans war gerettet, Johannes göttliche Sendung bewiesen.
Bei allem Erfolg Johannes darf eines nicht ignoriert werden: Dauphins Berater hatten Streicheleinheiten dringend nötig. Logischerweise sprachen sie von ihren strategischen Hinweisen, die befolgt worden waren, und hefteten sich damit das Gelingen an die eigene Brust. Schlüssige Begründungen fehlten. Die Heeresleitung zielte auf kleinere weitere Schlachten ab, die sicher zu bestehen wären.
Johanne hatte wenig Gespür für solche taktische Erwägungen, sie platzte in die Runde und setzte ein neues Zeichen: „Der Dauphin muss in Reims zum König gekrönt werden. Es ist Gottes Wille!“
Der Einwurf saß gleich einer Ohrfeige.
Allen war klar. Nur mit der Salbung in Reims erlangte der König sein Recht auf den französischen Thron. Reims lag in Feindeshand. Vieles reizte den Dauphin an Johannes Weisung. Vom Erbrecht ausgegrenzt, sah er die Durchsetzung seines Anspruchs greifbar nahe. Die Salbung würde alles besiegeln. Die Zeit drängte. Man musste der Krönung des englischen Heinrich zuvorkommen.
Verbissen lenkte Trémoille ein: „Wir wollen den König in Reims krönen - aber allein, um zu verhindern, dass sie gekrönt wird.“
Es war eine Abwägung, die mich nicht zur Ruhe kommen ließ. Auf der einen Seite sah ich Johanne, wie sie für ihr Land einstand und das Ende dieses ewigen Krieges ersehnte. Dem gegenüber erblickte ich den jugendlichen Heinrich, den ich ebenfalls ins Herz geschlossen hatte. Der Junge wurde regiert. Er hatte nicht den geringsten Einfluss auf das Geschehen in Frankreich.
Das Ende des Schreckens, wie käme es dazu? Für Friedensverhandlungen war der Augenblick nicht reif. Welcher der beiden aufstrebenden Könige hatte mehr Macht, den Krieg abzuwürgen?
Die neue Aufgabenstellung erforderte es, den Weg nach Reims zu ebnen. Erstmals erlebte ich direkt den Einsatz von Kanonen mit. Der Widerstand der Stadt Jargeau wurde auf diese brutale Weise gebrochen.
Ein zusätzliches Problem reihte sich ein. Nicht nur Engländer und Burgunder waren zu bezwingen, sondern ebenso ein Herzog, der lange dem Dauphin eng ergeben war.
Arthur III., Herr der Bretagne. Er wurde „Richemont“ gerufen, weil sein Vater ihn für das Erbe der englischen Grafschaft Richmond vorsah. Eine Konfrontation mit Trémoille hatte Richemont dem Dauphin entfremdet und ihn zum Widersacher gebrandmarkt.
Nachdenklich schaute Johanne in die Ferne, als sie von der Situation erfuhr. Wie war Richemont einzustufen, wie Trémoille? Trémoille war ihr ein Dorn im Auge. Würde er sich scheuen, die eigenen Truppen gegen Richemont zu verwenden? Die Auseinandersetzung neigte dazu, in einen bürgerkriegsverwandten Zustand abzugleiten.
„Du scheust einen Konflikt mit Richemont?“, wollte ich von ihr wissen.
„Es wäre voreilig, sich einem Zwist mit ihm auszusetzen, solange nicht geklärt ist, ob er uns nicht doch zugetan ist.“
Wieder hatte Johanne ins Schwarze getroffen. Zum Leidwesen Trémoilles verständigte sie sich mit Richemont. Er setzte seine Streitmacht an die Seite des Mädchens.
Manche feindliche Stellung überrollte unser Heer ohne nennenswerten Widerstand, doch unseligerweise blieben blutige Schlachten nicht aus. Eine Konfrontation in Patay traf die Briten schmerzlich.
Ihr Heerführer, Lord Talbot, gelangte in unsere Hände, Falstolf gelang die Flucht. Er sollte unmittelbar danach oberster Befehlshaber der Engländer werden.
An jenem Abend brach Johanne bei ihrem Beichtvater Pasquerel in Tränen aus. Sie trauerte um das viele englische Blut, das vergossen wurde.
Troyes und Chalons übergaben die Stadtschlüssel ohne Konfrontation. Das war die Art von Krieg, die sich Johanne wünschte. Die englischburgundischen Truppen wichen nach Norden aus. Der Weg war frei.
Der Ablauf der Krönung widersprach dem Weltbild der jungen Frau. Der König, wie auch der Erzbischof entkleideten sich in der Kirche bis auf das Wenigste und warfen sich zur Erde. Es beeindruckte Johanne. Vom geistlichen Herrn mochte sie es erwartet haben, nicht vom König. Sie stellte ihn über den Klerus. Er war in ihren Augen der Auserwählte Gottes. Sie selbst, Tochter des Herrn, hatte ihn zum Thron geführt.
Hingerissen warf sie sich ihrerseits vor die Füße des Gesalbten, nachdem dieser sich erhoben hatte.
Das Volk jubelte.
Die Träume der Jungfrau hatten ihre Erfüllung gefunden.
Die Tage nach erfüllten Stunden tragen stets eine gewisse Bitternis in sich, der auch Johanne nicht entging. Ihre Sendung sah sie eingelöst. Drohte der Augenblick des Abschieds? Wenig trieb sie zurück nach Domrémy, in ihr Heimatdorf. Was erwartete sie dort? Einem Freier erliegen? Gänse hüten?
Unruhe entbrannte in ihr.
Paris lag vier Tage entfernt. War es zu bezwingen?
Étienne de Vignolles, von manchen La Hire - die Wut - bezeichnet, druckste bei einem Besuch wider seine Art herum.
„Frei heraus, guter Étienne, in dir schlummern Neuigkeiten“, forderte Johanne ihn auf.
„Es wurde über einen Waffenstillstand entschieden.“
„Wer hat das entschieden? Der König?“
„Er und Trémoille.“
„Mit England?“
„Von Burgund war die Rede. Im Grunde ist es eins. Worin unterscheidet sich Burgund und England?“
Die letzten Worte klangen abschätzig. Johanne kurz davor zu explodieren.
„Du weißt nichts davon?“, fragte Étienne, obwohl er die Antwort genau kannte.
„Man hat es vor mir verheimlicht“, zischte sie.
Er blieb stumm.
Auf dem Ritt zurück wurde Johanne vom Volk gefeiert. Sie nutzte die Gunst der Stunden, um sich die Basis für ein eigenes Heer zu schaffen. Tapfere, ihr ergebene Bauernjungen, band sie an ihre Seite. Welches Ziel sie verfolgte, behütete sie verschlossen.
Étiennes hatte besonnen Späher vorausgeschickt. Sie warnten uns, kurz bevor wir die Seine erreicht hatten. An der Brücke von Bray, dem einzigen Übergang, habe sich Bedford mit einer kampfstarken Streitmacht verschanzt.
„Er selbst?“ Johanne stockte. Dem englischen Strategen, der seine Schlagkraft konsequent zu führen verstand, war sie nie gewachsen. Sie bemerkte meine Bestürzung, die sie zusätzlich verunsicherte.
„Rätst du von einer Konfrontation ab?“, fragte sie mich ungewöhnlicherweise.
„Ich sehe nur Blutvergießen, auf keiner Seite einen Erfolg.“
„Wir werden uns mit den Heerführern besprechen.“
Johanne entschied sich unversehens für eine neue Zielrichtung. Wenn der Weg heimwärts verbaut war und die Gefahr bestand, zu unterliegen, musste es eine von Gott gewollte Alternative geben. Die junge Frau richtete ihren Blick zurück, zurück nach Paris. Wäre sie im Stande, das Herz Frankreichs zu erobern? War das der Wille des Herrn?
„Eine mutige Reaktion“, entkam mir.
Es war die Angst vor Bedfords Heer, der die Einigung beschleunigte. Vor die Tore Paris zu fliehen, war erst einmal gefahrlos. Man würde dann schon sehen. So in etwa war die Einwilligung zu deuten.
Wir wurden urplötzlich zu Verfolgten. Bedford hetzte uns seine Meute nach.
Johanne explodierte nahezu, als sie erfuhr, dass Trémoille einen Waffenstillstand von vier Monaten vereinbart hatte und ihn mit der Zusage verband, die gewonnenen Städte wieder freizugeben. Alles Erreichte schien ihr damit wie Sand durch die Finger geglitten.
Von der Wut geleitet, entschied sie, Paris anzugreifen. Jegliche Diskussion würgte sie ab. Selbst den König stieß sie vor den Kopf. Sie ersuchte ihn nicht um eine Meinung, sondern forderte die bedingungslose Absegnung des Vorhabens.
Er gab sich schmallippig und ließ nur verlauten, es wäre ihm gleich. Ernüchtert lief sie durch die Reihen.
Mit kompromissloser Energie sammelte sie Truppen und forderte weiterhin das klare Ja des Monarchen. Am Ende musste sie es sich nahezu erzwingen.
„Ziehst du unlieb ins Feld?“, wollte sie am frühen Morgen von mir wissen.
„Vermutlich ist es nicht Gottes Wille, dass viele Leben geopfert werden“, erwiderte ich.
„Wie sehnte ich mich nach einer Verständigung, doch kann es einen Frieden ohne Krieg geben, wo nur Hass zu finden ist? Ich bin glücklich, wenn ein Gegner kampflos bezwungen wird. Wir haben es nicht in der Hand.“
„Du wirst einem Gefecht nicht ausweichen können.“
„Mein Lieber, alles wird aus Schmerz geboren.“
Früh am Morgen traf ich Johanne an einem kleinen Flüsschen. Mit der Hand spielte sie in den Wellen.
„Wenige Schritte vor meinem Vaterhaus floss die Maas dahin. Kennst du den Fluss?“, fragte sie mich.
„Nicht diese Stelle.“
„Die milden Hügel Lothringens habe ich geliebt. Die leichte Anhöhe, die Bäume oben auf, um die wir gespielt haben.“
„Du denkst an deine Familie?“
„Ich hoffe, sie bauen auf Gott und sind unbesorgt.“
An jenem Tag bohrte sich ein Pfeil in Johannes Oberschenkel. Durch die Beinschiene hindurch war er mit Wucht eingedrungen. Verwegen zog sie sich die Spitze selbst heraus. Fast zeitgleich fiel der Standartenkämpfer.
Am Abend wurden die Kämpfe eingestellt. Das Kriegsglück hatte sich gewendet.
Compiégne war eine der Städte, die das französische Heer bezwungen hatte. Der Einfluss Burgunds wurde trotzdem nicht gebrochen. Die Nachricht, dass Johann von Luxemburg eine Rückeroberung plante, alarmierte Johanne und ihre Freiwilligen.
Zu jener Zeit hatte ich entschieden, mich abzusetzen.
Sie stemmte sich dagegen und bat, wenigstens bis nach dieser Konfrontation abzuwarten.
„Du hast viel erreicht“, entgegnete ich, „weit mehr, als es jede Vorstellung zuließ. Doch es gibt Schwellen, die müssen wir scheuen.“
„Du meinst, Gott würde mich im Stich lassen?“
Das kam scharf.
„Soweit er dein Werk als lobenswert befand, hat er die Hand über dich gehalten. Früher oder später ist ein Scheitern vorgegeben. Johanne, ich bin kein Krieger, kein Soldat. Du hast mich nie mit einer Waffe gesehen. Ich nütze dir bei den folgenden Aufgaben nichts.“
Es war eine schmerzvolle Trennung.
In der darauffolgenden Auseinandersetzung gelangte Johanne bei der Absicherung eines Rückzugs in den Hinterhalt und fiel dadurch in die Hände einer burgundischen Schwadron. Zwar blieb Compiègne französisch, doch war das Ende der jungen Frau damit besiegelt.
Es wurde von Lösegeld gesprochen.
Der König war nicht bereit, die verlangte Summe zur Verfügung zu stellen. Er feierte lieber prunkvolle Feste und verschleuderte Johanne für 10.000 Dukaten an die Engländer. In einer Gefängniszelle in Rouen vollzog sich ihr Inquisitionsprozess, dem sie schutzlos ausgeliefert war. Er wurde geführt, um sie zu töten.
Scheinheilig wählten die Briten französische Geistliche in das Tribunal, die gezielt gelenkt wurden. Die üblichen Folterandrohungen sparte man sich. Wie unzählige vor ihr fürchtete Johanne den drohenden Tod und bekundete ihre Schuld. Sie bereute dies unmittelbar und gab sich dadurch den Flammen preis.
Obwohl ich wusste, dass ich dem Verlauf der Geschichte hilflos gegenüberstand, brach ich meine Reise ab. Gab es irgendetwas, wie ich mich für Johanne einsetzen konnte?
Mit Le Hire verfolgte ich die Thematik der Lösegeldverhandlungen. Keiner von uns hatte die Möglichkeit, einzugreifen. Wir führten Gespräche, doch vorgespielte Interessen und Interesselosigkeit gaben sich die Hand.
Zeitweise kursierte die Hoffnung einer Auslieferung. Ich suchte nach einer Gelegenheit, Johanne in ihrer Haft zu besuchen, verfiel allerdings einer Verblendung, die mich irreleitete.
Die Aura Utukxuls drängte mich in einen Schwebezustand, der mich leichtfüßig werden ließ und zu Aussagen ermutigte, die mir schaden mussten. Ich begriff diese Gefahr und resignierte.
Le Hire versicherte, das Letzte für Johanne zu geben. Ergebnislos.
Am 30. Mai 1431 erwachte ich in einem dichten Eichenwald durch einen jähen Regenschauer. Es sollte der Tag werden, an dem Johanne den Flammen übergeben wurde. Fernab nahm ich von der mörderischen Prozedur nichts wahr.
Der junge Heinrich VI. wurde in demselben Jahr in der Kathedrale Notre Dame zum König Frankreichs erhoben.
Nachdem Karl VII., der ehemalige Dauphin, seine Erhöhung zum König einer verurteilten Hexe zu verdanken hatte und dadurch schmachvoll deklassiert in der Welt stand, wurde er zum Handeln gezwungen. Er diktierte die Neubelebung des Inquisitionsprozesses. Wie zu erwarten war, lag bei diesem Verfahren das Resultat ebenfalls im Voraus auf dem Tisch: Sie durfte nur eine Heilige sein. So kam es zu der Rehabilitation der jungen Frau.
Weiterhin tobte der aberwitzige Hundertjährige Krieg. Die vollzogene Wende läutete letztlich den Ausklang ein.
Langandauernde Phasen, zu denen ich verdammt wurde, beängstigten mich. Stets war die Sorge präsent, dass mich die höllischen Kräfte in der Vergessenheit auszuhungern versuchten. Insofern war jede zeitliche Veränderung mit einem Aufatmen verbunden, wenn auch der fortgeschrittene Zeitraum neue lebensbedrohende Situationen heraufbeschwor.
Drei Jahre streunte ich zwischenzeitlich in den Verwüstungen dieses ewigen Kriegs herum. Ein Ende war nicht absehbar. Die trägen Stunden, die dahinschlichen, wurden mir mehr und mehr zur Folter. Sehnsüchte an meine hoffentlich lebenden Nächsten, Ängste, was sie erleiden würden, quälten mich fürchterlich. Gelegentlich hätte ich mir am liebsten die Seele aus dem Leib gerissen.
Es war eine linde Nacht, in der mich derartige Träume malträtierten. Tief im Innern vergrabene Bilder fanden zu neuem Leben. Ein Sinneseindruck wiederholte sich pausenlos in unterschiedlichen Facetten. Ich brachte ihn mit Babylon und den Gärten der Semiramis in Verbindung.
Semla? War sie es, die in luftigem Gewand, das sich farblich unaufhörlich veränderte, mich betörte? Damals war ich mir über die Person sicher. Jetzt verlor sich die Gewissheit. Mehr als jemals zuvor brannte dieses Bild, wie ihr der Schleier entglitt.
Aufgewühlt schreckte ich auf.
Vor mir, weich gebettet, lag ein Mädchen, das mich mit jenem einladenden Blick fesselte, der sich eben in diesen Illusionen aber und abermals eingestellt hatte. Noch war ich auf Semla fixiert, nannte ihren Namen, stockte. „Soraya?“
„Du erinnerst dich?“
Geplättet schaute ich mich um. Wir lagen in einem prächtig ausgestatteten Raum, die Wände mit Blumen bemalt, die selbst dufteten. Sanfte Schwankungen entgingen mir ebenso wenig.
„Sehr genau. Wir hatten uns aus den Augen verloren.“
„Für mich war es eine martervolle Erfahrung. Lange suchte ich nach dir. Am Ende blieb allein die Sorge. Wie froh bin ich, dich wiederzuhaben.“
„Wo sind wir?“
„Fühlst du es nicht?“
„Auf einem Schiff?“
„Auf einer Dschunke. Ich zeige sie dir.“
„China?“
„Lass dich überraschen. Kommst du mit nach oben?“
Sie erhob sich. Das dürftige Tuch entglitt ihr gänzlich.
„So wohl kaum“, hielt ich sie zurück.
Mit einem sanften Lächeln warf sie sich einen Umhang über.
Sonne, leicht bewegte See. Soweit das Auge reichte, war das Meer von Riesendschunken übersäht. Es war überwältigend.
„Wem gehört eine derartige Fülle an Schiffen?“, trudelte es aus mir heraus.
„Die flotte Zhen Hes.“
„Das ist keine Flotte, das ist ein Rausch!“, rief ich ergriffen aus.
„Man spricht von über 300 Dschunken. Es ist eine schwimmende Großstadt.“
„Zu welchem Zweck?“
„Viele Gründe werden angeführt. Am Anfang stand die Suche nach einem Prinzen, dann der Handel mit fremden Völkern. Diese Fahrt ist schmerzvoll. Es wird die letzte sein. Ein endgültiges Mal gelang es Zhen He, den Kaiser zu ermutigen, seine Flotte auszusenden. Der Kapitän ist alt und krank. Es ist fraglich, ob die Reise abgebrochen werden muss. Er wehrt sich dagegen. Im Süden Chinas ließ er eine Tafel anbringen.“
„Darf ich raten? Er wollte sich verewigen?“
„Wir haben über 100 000 Li des Ozeans befahren und riesige Wellen bezwungen, die wie Berge bis zum Himmel ragten. So steht dort geschrieben.“
„Das wünschte ich uns für die weitere Fahrt nicht.“
„Du bist in den besten Händen.“
Ich betrachtete unsere Dschunke, über 100 Meter lang, 50 breit. Neun Segelmasten zählte ich, bei benachbarten Schiffen weniger. Die Takelage bestand aus roten trapezförmigen Segeln, die mit Bambusrohren versteift waren. Drehungen in unterschiedliche Richtungen waren blitzschnell ausführbar.
„Eine schwimmende Großstadt …“, wiederholte ich fassungslos.
„Absolut. Wir stehen auf einem der größten Schiffe. Zhen He hält sich auf dem Schwesterschiff auf. Es sind 100 Kabinen eingerichtet.“
„Auf vier Stockwerken, wie mir nicht entgangen ist.“
„Das ist nur bei den Toppschiffen so. Du findest Spezialboote. Einige mit Pferdeställen, andere mit Tanks voller Frischwasser, viele führen Kanonen zur Verteidigung. Begleitest du mich in den Garten?“
„Wie?“
Soraya schwebte davon, ich folgte ihr angetan.
„Ich bin die Hüterin der Heilkräuter.“
Vor uns lag eine Gartenanlage mit unterschiedlichsten Pflanzen. Vorsichtig brach sie ein abgestorbenes Ästchen ab. Sie roch daran.
„Sterbende Blättchen verschenken das schwindende Leben, um anderes zu erhalten.“
„Du bist die Ärztin Zhen Hes?“
„Ärzte und Apotheker hat er genug, doch er schätzt mich. Um ihn tänzeln 50 bis 100 Schamanen. Was weiß ich. Auf seiner Dschunke ist er zudem von Astronomen und Orakellesern umringt.“
„Das ist nicht fassbar. Wie viele Personen sind hier auf Reisen?“
„Fünfundzwanzig mal die tausend, hörte ich.“
„Du braust Medizin für den Kapitän?“
„Er hat mich ins Herz geschlossen. Denke dir nichts dabei. Er ist kein Mann.“
Wie erleichtert ich war, nach langen Jahren auf ein bekanntes Gesicht zu treffen. Und doch verdüsterte sich meine Stimmung in den nachfolgenden Tagen. Wiederkehrende Ahnungen, die ich mit ihr verband, brachte ich nicht aus dem Kopf. Hatte nicht Varverina barsch reagiert, als ihr Name gefallen war?
Ein Vorwurf nistete sich hartnäckig ein: dass sie es gewesen war, die das Auffinden von Olam und Amnara aus womöglich vorgespieltem Anlass boykottiert hatte. Dem gegenüber lagen mir Olms Worte tröstlich im Ohr, Amnara hätte der damals nach ihnen greifenden Gefahr erfolgreich getrotzt. An diese Aussage klebte ich mich. Trotz allem, Soraya blieb mir ein Rätsel. Was für eine Rolle spielte sie? Jede Figur, die in meiner Umgebung wiederholt in unterschiedlichen Zeiten erschien, hatte einen aufgabenträchtigen Hintergrund. Ihr einen passenden Platz zuzuordnen, gelang mir nicht. Sie war erst in jüngster Epoche aufgetaucht. Würde sich ein neuer Kreis finden, zu dem ich sie rechnen durfte?
Da sie zweifelsohne zu den Zeitlosen gehörte, versuchte ich, sie zu älteren Freunden auszufragen. Mit einer spöttischen Antwort spielte sie auf ihre Jugend an und ließ mich in diesem Punkt blamiert abblitzen.
In jenen Tagen freundete ich mich mit weiteren Personen an. Xi Li war Geomant. Er suchte unaufhörlich nach himmlischen Zeichen, die er interpretierte. Zum Beispiel deutete er Wolkenbilder und den Wellengang, wenn dieser in ungewöhnliche Richtungen schlug. Ebenso fesselten ihn Sternbilder.
Heil oder Unheil ersah er daraus und vermochte in Übereinstimmung mit den Astrologen die gesamte Reise auf den Kopf zu stellen.
Weniger das Okkulte an seiner Tätigkeit bestrickte mich als die wissenschaftlich fundierten Errungenschaften, die dafür genutzt wurden. Xi Li zeigte mir die Kompassnadel, die auf einer Holzbox schwebte, und ein Holzkreuz, mit dem die Höhe des ´beichen`, ´zhiü´ oder ´denglonggu´ ermittelt wurde, womit Polarstern, Leier und das Kreuz des Südens gemeint waren. Kapitäne und Steuermänner, die sich damit auskannten, konnten damit ihre Position bestimmen.
Xi Li fragte ich, warum Zhen He nicht mehr in See stach.
„Es sind die hohen Kosten der Reise, die Unruhe stiften“, erklärte der Wissenschaftler.
„Du meinst, sie sind für den Kaiser nicht gewinnbringend?“
„Du hast ein falsches Bild. Der Kaiser, der die Flotte aufbaute, und der Herrschende sind nicht dieselben, und die Personen, die die Göttlichen umgeben, sind wiederum andere.“
„Hilf mir. Ich habe von Chu Yüan-chang gehört. Er widersetzte sich der Herrschaft der Mongolen und beabsichtigte seine Dynastie, die er Ming nannte, zu etablieren. Ist es so?“
Xi Li nickte nachsichtig. „Chu war ein großer Kaiser, aber streng.“
„Brutal?“
„Es ist viel Blut geflossen. Er hatte 25 Söhne, doch ist der Erstgeborene vor ihm gegangen. Chu erkannte viele Widersacher in Menschen in seiner Nähe.“
„Ließ er sie töten?“
„Es war seine Aufgabe, die Reinheit der Nachfolge nicht zu gefährden.“
„Fand sich einer der Söhne dafür?“
„Das Erbe stand dem Sohn des Erstgeborenen zu.“
„Dem Enkel?“
„Chien-wen. Er war 21 Jahre alt, als er zum Kaiser ward.“
„Vermutlich unterschied er sich von seinem Vorgänger?“
„Grundlegend. Chien-wen war den Büchern und Weisen zugetan. Sanftmut fand man in seinen Augen.“
„Was nicht allen lieb war?“
„Der vierte Sohn des ersten Kaisers sah sich für das Amt berufen und zettelte einen Aufstand an. Geschickt nährte er ein Aufbegehren gegen verräterische Beamte, die den Kaiser angeblich irreführten. Dabei konnte die Hauptstadt Nanking erobert werden. Bei der Palaststürmung verschwand der Kaiser.“
„Stopp“, bremste ich Xi Li. „Der erste Auftrag der Flotte war, einen Prinzen zu suchen. Sprechen wir dabei von Chien-wen?“
„Es hieß, dass er sich im Gewand des Wandermönchs verberge.“
„Und der vierte Sohn des Kaisers wollte ihn töten! Ist es so?“
„Falls er lebte. Manche bezweifeln dies. Es spielt keine Rolle. Yung-lo, jener rebellische Sprössling, trat vor knapp drei mal zehn Jahren das Erbe an.“
„Lebt er noch?“
„Nein, seit seinem Tod sind acht Sommer vergangen“, lautete die Antwort. „Er war ein entschlossener Mensch, der viele Reiche unterwarf und die Gefahr durch die Mongolen bannte. Gleichfalls leitete ihn die Unsicherheit. Er scheute die alte Hauptstadt und baute sich eine neue: Peking. Es war gut so, denn die jüngere Metropole liegt unweit der nördlichen Grenze und so ist ein besserer Schutz vor den aggressiven Völkern im Norden gewährleistet.“
„Wer regiert derzeit?“
„Xuande. Yung-lo hatte seine Regierungsriege aus Eunuchen geschaffen.“
„Und zu ihnen gehörte auch Zhen He, unser Flottenführer?“
„Er legte dem alten Kaiser den Ausbau der Flotte nahe, da den Wohlhabenden daran lag, Schätze aus fernen Kulturen zu erlangen. Die große Handelsstraße in den Westen war von Menschen, die Allah anbeten, unterbrochen und so riet Zhen He zu einer Straße über die Meere.“
„Und deshalb stellte er ein bewegliches Reich ins Wasser?“ Ich musste grinsen.
„Die Untertanen bezahlten sie mit einer Sondersteuer. Die Gewinne jedoch, sie kamen nur den Palasteunuchen zugute. Ihnen erwuchsen Rivalen in Beamten, deren Weltbild Konfuzius prägte. Xuande schläferte die Reisen ein, die bis nach Afrika reichten. Zhen He erzwang diese Fahrt unter großen internen Kämpfen. Es ist sicher, es wird die Letzte sein, und es wird davon gesprochen, dass die Flotte danach eingefroren wird.“
Xi Li sollte mit seiner Vermutung recht behalten.
Ich sonnte mich tagelang auf dem Deck. Meine einzige Tätigkeit bestand aus Rundgängen. Die ganze Reise trug sich gefahrlos zu und eben das verunsicherte mich.
Utukxul, hast du mich vergessen?
Soraya erfüllte pflichtbewusst ihren Dienst und besuchte einmal pro Woche Zhen He. Er ließ sie mit einem kleinen Schiff, das für Einladungen vorgesehen war, abholen.
Stets pflegte sie ihre betörende Ausstrahlung. Meine Unterstellung, das würde Zhen He erwarten, trog. Jedes ihrer Worte, ihr Tun und Lassen, waren auf die Nähe zu mir ausgerichtet. Sie unterstrich manchen schwärmerischen Satz mit einer anmutigen Bewegung, die entzückte. Ich verhielt mich stur kritisch-distanziert.
In einer solchen Situation fragte ich sie: „Was wird unser Ziel sein?“
„Das Reich Vijayangara.“
„Indien?“
„Das Fest der Liebe währt drei Tage und drei Nächte. Es ist bezaubernd.“
Sie küsste mich auf die Wange und entfernte sich.