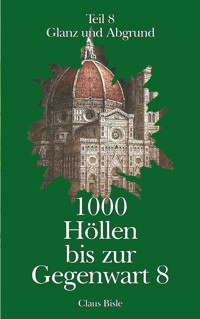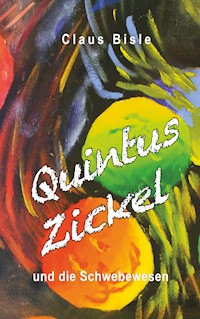Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Ruf einer Eule hält Manuel von einem Einstellungsgespräch ab. Als er ihm folgt verändert sich sein Umfeld auf unfassbare Weise. Die vielen Rätsel, die sich um ihn aufbauen, gipfeln in einem Fluch, der unseren Helden dazu verdammt, die gesamte Menschheitsgeschichte durchleben zu müssen. Der Fluch, ist die erste Folge eines atemberaubenden humanistischen Romans, der die Leser hinter einer fantastischen Rahmenhandlung, die Geschichte von der frühen Steinzeit bis zur Gegenwart hautnah durcherleben lässt, wobei der Held Manuel Jebich in ständiger Lebensgefahr eine besonderer Rolle spielt. "Sie haben unsere Sympathie und Hochachtung, und wir wünschen Ihnen viel Kraft und Erfolg mit Ihrem Projekt." DEUTSCHE FRIEDENSGESELLSCHAFT BONN"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nichts ist so unglaubwürdig wie die Wirklichkeit.
Dostojewski
Lieber Leser,
das größte aller Abenteuer liegt in Deinen Händen. Auf den folgenden Seiten wirst Du in die Fluten der Weltgeschichte gezogen. Fiktionen treffen auf Realitäten. Wenn Du gemeinsam mit den Helden in einer Traumwelt zu ertrinken scheinst, bildet sich um Euch die Wirklichkeit heraus, die Vergangenheit, die jede Fantasie und Vorstellung in unfassbarem Maße übersteigt. Wenn auch die Rahmengeschichte einer märchenhaften Grundidee entspringt, so darfst Du den historischen Begebenheiten Glauben schenken. Es wurde stets darauf geachtet, dass alle historischen Aspekte auf dem aktuellen Forschungsstand basieren.
Sobald es Dir gelungen sein wird, den Ozean dieser Bücher zu durchschwimmen, wird sich Dein Blick auf vieles erweitert haben. Die Menschheitsgeschichte wird ein Teil von Dir werden.
Ich wünsche mir, dass Du die Herzen Manuels, Semlas, Chen Lus und vieler anderer bald in Dir pochen fühlst.
Viel Freude, spannende und unvergessliche Stunden bei dieser gewaltigsten aller Reisen.
INHALTSVERZEICHNIS
Der Fluch des Fremden
Steppengras (ca. 1.500.000 vor Chr.)
Schlüsselflechte (ca. 40.000 Jahre vor Chr.)
Wildemmer (ca. 5000 Jahre vor Chr.)
Tjufi (2496 v. Chr.)
Steinbrech (1259 v. Chr.)
Weltenbaum
Misteln (600 v. Chr.)
Glossar
DER FLUCH DES FREMDEN
Manuel Jebich! Sie sind dann der Nächste!“, fertigte er mich ab.
Er hätte auch ‚der Letzte‘ sagen können. Außer mir hatte nur noch ein eingeschüchterter, zappeliger junger Kerl hier gewartet. Das Abi hatte der wohl in der Tasche.
Der Typ begleitete ihn aus dem Raum, nachdem er mir einen abschätzigen Blick zugeworfen hatte. Ich ärgerte mich, dass ich noch warten musste.
Stühle in Wartezimmeranordnung, ein niederer Glastisch, Jalousien, teils herabgelassen, so blass wie die Wand.
Eine Zeitung lag vor mir. Ich versuchte, ihr auszuweichen. Ein wiederholter Blick fiel auf das Datum.
25. September 2015. Die aktuelle Tageszeitung. Flüchtlinge auf dem Titelbild. Irgendetwas mit Angela Merkel und ‚deutsches Problem‘.
Manuel Jebich! Sie sind der Nächste!
Ich kannte diesen Menschen sehr gut. Er war wenige Jahre älter, hatte dieselbe Schule besuchte, benutzte denselben Bus und wohnte gerade einen Straßenzug weiter. Er ignorierte mich konsequent, wenn er ins Zimmer kam, um einen Bewerber vor das Tribunal des Personalchefs der Firma Jauch und Spreizli AG zu zitieren. Dort wartete das Richtbeil auf uns.
Ich war aus der Schule geflogen. Rausgeworfen worden, weil ich die Mitarbeit verweigert hatte. So stand es in meinen Zeugnissen. Mehrmals. Was hatte ich zu meiner Verteidigung zu sagen?
Nichts. Es war so.
Die letzte Geschichtsarbeit hatte mir den Todesstoß gegeben. Die Weltkriege. Ich saß vor einem weißen Stück Papier. Übelkeit. Ich zitterte am ganzen Leib. Der Schreibstift wanderte von meiner linken Hand in die rechte und wieder zurück. Was war damals mit mir los? Ein entsetzliches Gefühl, Ablehnung und Wut entbrannten in mir. Der Stift brach. Mein Blatt zerknittert, leer.
Nasse Flecken.
Waren es Tränen?
Ähnlich ging es mir bei einem Deutschaufsatz - eine Erörterung über ein weltübergreifendes Umweltthema. In mir wuchs der Zwang, zu fliehen. Ich stand auf, ging zur Tür. Der Lehrer, der mich bremsen wollte, stellte mir mit scharfem Ton die Frage, was das sollte. Ich gebe zu, ich vergaß mich, als ich antwortete: „Das ist doch eh alles scheiße ...“
Natürlich tat es mir sofort leid, doch dieser Lehrer hatte mich längst auf dem Kieker. Wahrscheinlich wurde er vom Schulrektor angeheizt, der mich ständig gängelte, unter einem billigen Vorwand aus der Klasse holte und mich vor allen lächerlich machte.
Meine Mitschüler hatten an meiner unsicheren Defensive ihre Freude und kosteten die Situationen als willkommene Unterbrechung aus.
Hoffnung machte ich mir keine, bei der Weltfirma einen Arbeitsplatz zu erhalten. Doch was sollte ich tun? Ich war dazu verdonnert, mich überall zu bewerben. In der Schule gab es für mich keine Zukunft. Diese Chance hatte ich endgültig verspielt. Ich erfüllte nie die Ansprüche, die an mich gestellt wurden. Der Unterricht war für mich nichts mehr als ein Strauß vertrockneter Blumen und den Tod dieser Pflanzen starb ich mit.
Ich kämpfte jetzt seit drei Monaten ergebnislos um einen Arbeitsplatz. Mein Alltag begrenzte sich auf Aufstehen, Bewerbungen schreiben, Mittagstisch, Bewerbungen verpacken, Porto drauf und ab zur Post, Abendessen, Magda treffen. Solche Vorstellungstage wie heute waren keine prickelnde Abwechslung, sie deprimierten. Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche - das Loch, in das ich nach jeder Ablehnung fiel, wurde von Woche zu Woche größer. In zehn Minuten würde es wieder so weit sein.
Die anderen elf, die bereits aufgerufen wurden, hatten klug ausgesehen. Alle hatten sie einen erfolgreichen Abschluss. Ich hatte nichts in der Tasche. Gescheitert, lange bevor ein Abschluss in greifbare Nähe gerückt war.
Stand ich den anderen an Bildung wirklich so weit nach? Vieles flog mir zu. Manchmal bekam ich Angst vor meinem eigenen Wissen und fast immer erwies es sich als Glatteis, auf dem ich hart aufschlug.
Manuel Jebich! Sie sind dann der Nächste!
Dieser Typ, der mich mit dieser Bemerkung geärgert hatte, bekam alljährlich eine Auszeichnung. Klar, solche Exemplare suchte eine Firma wie Jauch und Spreizli. Sie konnten sich die Besten herauspicken.
Warum sie mich zu dem Bewerbungsgespräch eingeladen hatte, wurde mir von Minute zu Minute unverständlicher. Bestimmt war es ein Fehler. Sie hatten die Unterlagen verwechselt. So musste es gewesen sein.
Jeder blickte heute auf mich. Meine Eltern, Magda und die sechs Kameras an der Decke. Ich hatte mich an die Dinger gewöhnt. Heute hatte ich beinahe vier Stunden mit meinen Mitbewerbern in diesem Zimmer verbracht.
Das Tribunal nutzte die Zeit, um unser Verhalten zu beobachten und zu bewerten. Es war immer so. Ich hatte mir angewöhnt, mich so zu geben, wie ich eben war. Wahrscheinlich war das ein Fehler. Doch über das gekünstelte und aufgesetzte Getue der anderen konnte ich nur lachen. Sie waren es nicht gewohnt, auf diese Art gemustert und verurteilt zu werden. Der Stress presste aus ihnen Verhaltensweisen, die nicht ihrem Wesen passten. Das Bild von Nackten auf einem Maskenball ließ mich für einen Moment den Ernst der Situation vergessen, traf aber in etwa zu.
Gleich musste die Tür aufgehen. Ich entschied, diesen blöden Hund wie einen alten Schulkameraden direkt anzusprechen und zu fragen, wie er es angestellt hatte, hier zu landen. Hans-Baldur war sein Name.
Vielleicht war auch ein lockerer Spruch besser? „Wie sieht es aus? Lohnt sich der Weg in die Folterkammer oder kann ich gleich abbiegen?“ – Ach nein, die Kameras. Solche Scherze durfte man sich nicht leisten.
Inzwischen war ich davon überzeugt, dass es eine Schwarzliste mit Versagern gab, die unter den Firmen kursierte. Belegte man dort einen der oberen Ränge - und dieses Verhängnis traute ich mir zu - rückte die Gesellschaft für jene so weit auseinander, dass man in der Mitte in einen unendlichen Abgrund fiel.
Ich wurde unruhig. Wartete ich länger als alle andere? Mir war kalt. Bloß – wieso? Die Klimaanlage war nicht für die Bewerber eingestellt worden. Draußen lachte die Sonne.
Ich stand auf und trat ans Fenster. Jauch und Spreizli war am Ortsrand angesiedelt. Hier gab es wenige Wohnhäuser, einige Schrebergärten und einen Weg, der in ein kleines Wäldchen führte. Einen Atemzug frische Luft, durfte ich mir den gönnen? Ich zögerte keine Sekunde, öffnete das Fenster und roch die Freiheit.
Kinder spielten zwischen den Häusern. Um ihre ausgelassenen Rufe beneidete ich sie. Der Motorenlärm einer Straße war sehr fern zu hören. Und der Klageton einer Eule ...
Woher wollte ich wissen, dass es der Ton einer Eule war? Wie versteinert schaute ich in die Richtung, aus der ich den Laut vernommen zu haben meinte. In meinem Inneren erwachte ein banges Gefühl. Der Ruf eines Käuzchens, so lernte ich es von meinem Großvater, verkündete den Tod eines Menschen. Nein, ein Käuzchen war es nicht. Warum war ich mir so sicher? Der Ruf der Eule enthielt Schmerz und eine Botschaft. „Komm endlich, wo bleibst du?“, verstand ich ihre Schreie.
Was passierte mit mir? Wie magisch zog es mich aus dem Gebäude. Ohne eine vernünftige Erklärung stand ich plötzlich vor dem Verwaltungskomplex ...
Ich stockte.
Nicht der Wald war mein Ziel.
Ich eilte durch das anschließende Industriegebiet. Ich dachte weder an mein Bewerbungsgespräch, noch an mein Fahrrad, das vor Jauch und Spreizli abgestellt war. Mein Weg führte zum Bahnhof. Ein 50-Euro-Schein steckte in meinem Geldbeutel, das gab mir Sicherheit.
Fünf Minuten später stand ich vor dem Fahrkartenautomaten der S-Bahn-Station. Mit 50-Euro-Scheinen wusste er nichts anzufangen. Eine Kreditkarte? Hatte ich noch nicht! Wie sollte ich einen Fahrschein lösen? Würzburg! Das Ziel stand wie in Stein gemeißelt vor mir.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. 11.30. Es waren 45 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Das passte. Ich wusste, zu welchen Zeiten der Zug stündlich abfuhr, und rannte los. Ampeln, Warnhinweise und eingezäunte Gärten waren für mich nur störende Hindernisse, die mir alle Abkürzungen verwehrten. Eine innere Stimme mahnte mich, die Regeln zu vergessen. Durch fremdes Eigentum, verwachsenes Mauerwerk und mit einem Slalomlauf durch die Fußgängerzone erreichte ich mein Ziel. Ich sah auf die Anzeigetafel: Würzburg in zwei Minuten. Die Zeit, eine Fahrkarte zu lösen, fehlte mir. Ich hastete in den Waggon. Die Tür schloss sich hinter mir, der Zug fuhr ab.
Ich sprach sofort einen Schaffner an, der ebenfalls zugestiegen war: „Bitte entschuldigen Sie, ich habe noch keinen Fahrschein. Ich konnte nicht planen ... ein Notfall. Den Zug habe ich gerade noch erwischt. Ich habe 50 Euro, vielleicht auch 52, und muss nach Würzburg.“
Der Beamte schaute mich bedachtsam an. Er machte keine Anstalten, sein Scangerät zur Hand zu nehmen und mir eine Fahrkarte auszudrucken.
„Nach Würzburg?“
„Ja, meine Großmutter liegt im Sterben.“
„Setz dich in mein Abteil. Ich schließe dir auf. Das geht dann in Ordnung.“
Ohne eine weitere Nachfrage schritt der Schaffner voraus, öffnete die Tür zu seinem Zugabteil und bot mir einen freien Platz an. Mit einem freundlichen Blick verabschiedete er sich, um seine Runde zu drehen.
Wie kam ich darauf, ihm so eine entsetzliche Ausrede an den Kopf zu werfen? Es passte ganz und gar nicht zu mir. Mit dem Tod zu spielen, gar zu betrügen ... mich grauste vor den eigenen Worten. Es war mir unerklärlich, dass ich trotz allem der festen Überzeugung war, nichts Falsches zu tun. Die Eule fiel mir ein. Ein dummer Gedanke. Ich hatte doch gerade selbst festgestellt, dass der Ruf eines Käuzchens vom Tod einer Person kündete, nicht der einer Eule.
Ich blieb dabei, dass der Appell des Tieres einen tieferen Sinn hatte. Allerdings wurde mir auch bewusst, dass der Drang, zu meiner Großmutter flüchten zu müssen, nichts mit dem Lockruf des Vogels zu tun hatte.
Mein Handy klingelte.
„Vater?“
„Manuel, kann ich mit dir schon reden? Steckst du noch in der Prüfung?“
„Nein, nein, geht schon. Ich habe noch kein Ergebnis“, mogelte ich mich um die Wahrheit herum.
„Gut. Wo steckst du gerade? Wir holen dich ab.“
„Vater, was ist los?“
„Oma geht es sehr schlecht. Die Klinik hat angerufen. Ihr letzter Wunsch ist es, dich zu sehen.“
„Vater, welche Klinik? Ich bin im Zug auf dem Weg nach Würzburg.“
„Wie bitte?“ Auf die Frage folgte eine Pause. „Dann weißt du es schon? Sie liegt in der Theresienklinik. Findest du den Weg?“
„Ich nehme mein Handy als Navi und ein wenig kenne ich mich aus.“
„Gut. Wir fahren ebenfalls gleich los. Bis dann.“
Wie betäubt schaute ich auf die vorbeifliegenden Bäume.
„Alles klar, mein Junge?“ Der Schaffner stand in der Tür.
„Ja, danke. Sie liegt in der Theresienklinik, habe ich gerade erfahren. Muss ich nichts bezahlen?“
„Darf ich du sagen?“
„Natürlich.“
„Weißt du, es gibt Situationen im Leben, die erfordern, dass Regeln über Bord geworfen werden. Ich bin der Meinung, dass dein Besuch sehr wichtig ist. Dein Geld wirst du für ein Taxi brauchen.“
„An ein Taxi habe ich gar nicht gedacht. Den Weg schaffe ich auch zu Fuß.“
„Versprich mir, ein Taxi zu nehmen.“
„Abgemacht.“
Der Beamte nickte zufrieden und ging weiter.
Was war das? Ich atmete auf und wunderte mich zugleich. War er lediglich ein weitsichtiger Mensch? Warum betonte er, dass der Besuch wichtig wäre? Es war nicht einfach ein Satz, der aus Belanglosigkeit in den Raum geworfen worden war. In ihm lag eine Überzeugung, die mich fröstelte. Allerdings, so schloss ich meine Gedanken ab, wenn mich schon Eulen aus Gebäuden locken, dann mochte ein solcher Instinkt bei einem Beamten der Deutschen Bundesbahn dreimal möglich sein.
*
Ich hielt einen Zettel mit der Zimmernummer in der Hand.
Großmutter hatte ein erfülltes Leben gehabt, das - wie sich meine Mutter in einem nachdenklichen Moment einmal erinnert hatte - in einer entsetzlichen Jugend fußte.
Es war nicht verwunderlich, als Jüdin war meine Großmutter in eine schlimme Zeit geboren worden.
Sie sprach nie darüber. Ich kannte sie stets als glückliche und lebensfrohe Frau. Das 90. Lebensjahr hatte sie überschritten und sich noch bis vor einer Woche selbst versorgt. Sie liebte ihr kleines Gärtchen, in dem sie ihr Lieblingsgemüse und Salate anpflanzte.
Als ich sie sah, wusste ich um den Ernst der Stunde.
„Oma?“
„Manuel ...“, entgegnete sie mit einer sehr schwachen Stimme.
Ich hatte den Eindruck, sie wollte sich aufrichten, doch hatte sie nicht mehr die Kraft dazu. Der Arm sank zurück.
„Oma, wie geht es dir?“
Ein leichtes Lächeln huschte über ihre Lippen, schelmisch, spitzbübisch, so wie ich es von ihr kannte.
„Manu, nimm die Rose an dich.“
„Oma, welche Rose?“, antwortete ich, da ich mir kein Bild machen konnte, wovon sie sprach.
„Im Schlafzimmer, an der Wand ...“ Jedes Wort fiel ihr schwer.
Ich erinnerte mich. Von jeher hing über ihrem Nachttisch eine ausgetrocknete Pflanze. Wahrscheinlich war sie die Rose.
„Sie ist ...“
„Ich weiß, wo“, unterbrach ich sie, damit sie nicht sprechen brauchte. „Die getrocknete Blume.“
„Ja“, kam es mit spürbarer Zufriedenheit. „Sie ist dein ...“
Noch einmal lag das vertraute Lächeln auf ihrem Gesicht. Die kleine Geste musste sie schwer angestrengt haben. Oma schloss die Augen und atmete sehr ruhig.
Sie war eingeschlafen.
*
„Wie geht es ihr?“ Meine Eltern trafen nicht viel später ein.
„Sie schläft.“ Ich hielt die beiden davon ab, ans Bett zu treten. „Ich glaube, sie ist sehr glücklich.“
„Das wäre schön“, erwiderte meine Mutter und sah mich an. „Du hast mit ihr gesprochen?“
„Ja, aber ... Können wir draußen reden?“
Ich hatte das Bedürfnis, meiner Mutter von dem merkwürdigen Wunsch zu erzählen, scheute mich aber davor, es in Anwesenheit der alten Dame zu machen. Sie begriff schnell, strich durch das Haar der Kranken und folgte mir vor das Zimmer.
„Was hat es mit der Rose auf sich? Sie hat mir die getrocknete Rose geschenkt.“
„Manuel, du bist der Enkel, zu dem sie immer eine besondere Beziehung hatte. Nimm sie als ein ganz persönliches Geschenk.“
„Das ist ja in Ordnung. Trotzdem verstehe ich den Wert der Rose nicht.“
„Es ist nur eine Vermutung. Sie sagte einmel zu mir, diese Rose hätte ihr das Leben gerettet.“
„Eine Rose? Wie soll das gehen?“
„Oh, Manuel, wahrscheinlich nicht die Rose. Da steckt bestimmt ein Mann dahinter.“
„Du meinst, eine Liebesbeziehung?“
„Ich denke schon. Stelle dir die damalige Situation in Deutschland vor: Jüdin, Drittes Reich ... Da bleibt nicht viel von solchen Beziehungen übrig.“
„Sie hat nie darüber geredet?“
„Natürlich nicht. Das war ihr Geheimnis.“
*
Es war ein eigenartiges Gefühl, in das verlassene, kleine Häuschen meiner Großmutter zu treten. Schon der Weg durch den Vorgarten fühlte sich an, als wäre plötzlich später Herbst. Meine Eltern gingen voraus und überprüften, dass uns in dem Gebäude keine unangenehmen Überraschungen erwarteten. Magda war an meiner Seite.
Die Stimmung war gedrückt. Oma war tags zuvor sanft entschlafen. Ich empfand es seltsamerweise nicht als Abschied. Sie hatte mit geschlossenen Augen gelächelt. Mutter hatte mich daraufhin aus dem Zimmer geführt. Sie war davon überzeugt, dass dieses Erlebnis mir sehr nahegehen musste. Doch so war es nicht. Natürlich schmerzte es mich, nicht mehr mit ihr reden und scherzen zu können, doch zu der Stunde, als sich unsere Wege trennten, empfand ich es nur als das Ende eines Erlebnisses.
Erinnerungen holten mich beim Gang durch das leblose Gebäude ein. Die Sofakissen, die ich als kleiner Junge zu Bergen geformt hatte, um darauf meine Spielfiguren aufzubauen, waren ordentlich aneinandergereiht. Der Krug, in dem Großvater ehemals seinen Most aus dem Keller holte, stand inmitten des Büfetts. Im darunterliegenden Fach standen die wenigen Bücher. Ich griff nach dem größten, dessen Bilder ich unzählige Male zusammen mit Großvater durchgeblättert hatte. Seite 35 war eingerissen. Das war ich schuld. Es war mir damals aus der Hand gerutscht und zu Boden gefallen. Immer, wenn ich es danach aufschlug, landete ich auf dieser Seite.
Das Foto, das sich dort befand, zog meine Aufmerksamkeit immer aufs Neue an. In einem farbenprächtigen See schwamm eine Seerose. Oma hatte mir erklärt, es wäre eine Lotusblume. Ob es das Bild war oder die Pflanze, ich konnte nicht bestimmen, was mich an dem unscheinbaren Foto fesselte. Eine innere, fast anregende Seligkeit durchfloss mich.
Der Kaffeetisch war noch angerichtet. Mutter war dabei, die Tassen abzuräumen, ich ergriff die Kanne. Beim Öffnen des Deckels – ich wollte den Rest in den Ausguss schütten – erreichte mich der Kaffeegeruch. Kalt, abgestanden und doch war da der Duft der geschroteten Bohnen. Er erweckte eine nicht fassbare Erinnerung in mir, ein Bild, das ich nicht greifen konnte.
Es war da und weg, optisch nicht fassbar. Eine Saite des Unterbewussten war ins Schwingen gekommen.
Magda rief mich. Sie stand am Fuß der Treppe, die unter das Dach führte. „Wohin geht es dort?“
„Zu ihrem Schlafzimmer und zu meinem Kinderzimmer. Gehen wir hoch?“
„Okay.“
Magda hatte ich vor wenigen Wochen in einem Tierfachgeschäft kennengelernt. Sie war Pferdebesitzerin und hatte eine neue Kardätsche gesucht. Mich zog es oft aus Langeweile in solche Geschäfte, da ich liebend gern die jungen, verspielten Tiere dort beobachtete. Allerdings taten sie mir in ihren Gefängnissen leid. Oft redete ich mir ein, sie hätten mir etwas zu sagen.
Meine Freundin eilte die Stufen hinauf. Ich folgte.
Tags zuvor hatte ich Magda von einigen Ereignissen erzählt, die sich in dem Häuschen zugetragen hatten. Aus ihrem neugierigen Blick schloss ich, dass sie die Augenblicke nachfühlen wollte. Jetzt kam sie auf diese oder jene Begebenheit zu sprechen. Das Schlafzimmer der Großeltern streiften wir nur mit einem Blick. Die ausgetrocknete Rose, die mir gleich ins Auge fiel, wollte ich noch an ihrem Platz belassen.
Mein Zimmer hatte ich als Kind als riesig empfunden. Jetzt wunderte ich mich über die Enge. Der mächtige Zwetschgenbaum vor dem Fenster hatte an Höhe gewonnen. Ich blickte in ein Blättermeer.
Magda stand vor einem einfachen Bild, das über meinem ehemaligen Bettchen hing. Das bessere Wort wäre Skizze gewesen. Es bestand aus einem Stück Stoff, das mit Farben bearbeitet worden war, die mir fremd waren. Rötel oder Ähnliches sollte es sein. Als Kind hatte ich es oft betrachtet. Eine einfache hügelige Landschaft, eine bescheidene Hütte und ein anschließendes Waldstück bildete den Hintergrund. Im Zentrum fiel eine Brücke auf, die einen schmutzigen Pfad über einen größeren Bach leitete.
„Passiert dir das auch? Manchmal betrachte ich ganz normale Dinge, und es kommt mir vor, als steckte in ihnen ein Geheimnis. Es geht mir nicht nur bei Gegenständen so, sondern auch bei Worten, manchmal bei Klängen. Wie soll ich es beschreiben? Es ist, als wären diese Dinge ein Stück der eigenen Seele“, griff ich ein Thema auf, das mich immer wieder beschäftigte.
„Du meinst, sie erinnern dich an etwas?“
„Ja, so in etwa. Es geht sogar noch tiefer, es entstehen Eindrücke, als erlebte man mit den Dingen einen Augenblick zum zweiten Mal.“
„Das kommt schon vor. Es fühlt sich komisch an, stimmt´s?“
„Ja und nein.“
„Soviel ich weiß, spielt uns das Gehirn dabei einen Streich. Ein Psychologe könnte dazu mehr sagen. Bestimmt gibt es eine einfache Erklärung.“
Klar hatte Magda recht. Unser Gehirn vollbringt ständig Hochleistungen. Eine Spiegelung von Fakten, was war Besonderes daran?
„Geht es dir bei dem Bild auch so?“, bohrte sie nach.
„Als ich es das erste Mal sah, fühlte ich einen Stift in meiner Hand.“
„Ist das lange her?“
„Klar. Ich war kaum ein Dreikäsehoch.“
„Wenn du mich fragst, mit einem Stift wurde es nicht gemalt. Kannst du zeichnen?“
„Ich? Gott bewahre.“
Magda wandte sich um, verließ das Zimmer und huschte die Treppe hinab. Als ich am Schlafzimmer der Großeltern vorbeikam, fesselte die dürre Rose nochmals meine Gedanken. Was war besonders an ihr? Durfte ich sie so unbeachtet hängen lassen? Ich hatte meiner Großmutter gegenüber ein Versprechen abgegeben. Also ging ich hin und berührte sie. Die Blätter waren zum Brechen steif. Sie war keine gekaufte Rose. Sie war von einem Strauch abgebrochen worden.
*
Meine Eltern und Magda waren sich noch fremd. Wie gesagt, kannte ich sie erst wenige Tage. Die Skepsis, die Mutter ihr gegenüber in den Augen trug, stach mich. Mir lag daran, mich mit Magda schnell aus dem Staub zu machen. Sie fühlte sich ebenfalls unwohl, das sah ich meiner Freundin an. Ihre Bitte, sie während der Rückfahrt am Sportplatz abzusetzen, ließ mich aufatmen. In der Nähe des Sportplatzes befand sich ein Reitstall. Sie hatte dort ihr Pferd untergestellt und wollte es mir gern vorstellen.
Ich verabschiedete mich von meinen Eltern. Meine Mutter klang fast, als würde sie mich wie ein kleines Kind ermahnen wollen, nicht zu spät zurück zu kommen.
Pferde sind hochgewachsene Tiere, gefährlich und stinken. Rossschweiß, Leder, Pferdekacke. In diesen Duft sollte ich mich wohlfühlen?
„Da vorne steht er“, erklärte Magda stolz und zeigte in eine Richtung, in der ich nur helle Tiere erkennen konnte.
„Schön“, erwiderte ich, ohne zu ahnen, von welchem Pferd sie sprach. Ich wusste nur, dass sie einen Schimmel hatte.
Magda fieberte dem Augenblick entgegen, der ihr merklich wichtig war. Sie bog kurz in einen kleinen Raum ab und kam sogleich mit einem Sattel im Arm zurück.
„Du willst aber nicht, dass ich reite?“
„Angst?“
„Dinge ohne Bremspedal sind mir unheimlich.“
Sie lachte verschmitzt. Es war mir klar, dass sie mit dem Gedanken spielte, mich auf das Tier zu setzen. Meine Auswege sahen bescheiden aus. Ich hatte allerhöchsten Erfahrung mit Kamelen. Zwar hatte ich nie auf deren Rücken gesessen, doch es hatte ein rührendes Erlebnis gegeben, an das ich mich noch heute erinnerte.
Meine Eltern waren oft und viel gereist. Als wir vor Jahren unter dem Berg Tabor in Israel auf einen Bus warten mussten, ruhte dort ein Kamel in der Mittagshitze. Ich setzte mich neben das Tier und – man mag es glauben oder nicht – es legte den Kopf an meine Wange. Ob das Ganze gefährlich war, weiß ich nicht. Ich spürte eine Liebe zu dem Tier und wir betrachteten uns wie uralte Freunde.
Inzwischen hatte Magda das Tier gesattelt und legte die Trense an.
„Der Stall wird umgebaut. Du musst aufpassen. Wenn wir nachher ins Freie gehen, kommen wir an allerlei Bauschutt vorbei. Ich hoffe, die haben es bald gepackt.“
„Du reitest im Freien?“
„Klar, du auch. Bei dem Wetter bleibt man nicht im Stall! Mach dir aber keinen Kopf, wir versuchen es auf dem Turnierplatz, nicht in die Wildnis.“
Sie führte ihren Schimmel an mir vorbei und aus dem mit Spinnweben gespickten Raum.
Wahrscheinlich hätte ich die Schönheit des Tieres loben müssen. Bestimmt erwartete sie das. Ich entschied, es später nachholen.
Skeptisch folgte ich den beiden.
Als ich aus dem Stall gehen wollte, schlug in einer Box zu meiner Seite ein Tier mit den Hufen gegen die Wand. Ich erschrak. Aus dem Verschlag starrten mich zwei Augen an. Ein Mädchen war dabei, die Hufe ihres Tieres auszukratzen, hielt inne und sah mich an. Wie gelähmt blieb ich stehen. Traurigkeit und Sorge lagen in dem Augenpaar. Es sah aus, als ob sie Angst um mich hatte. Wie konnte ich auf so einen Gedanken kommen? Ich grüßte. Sie blieb stumm. Wie kann ich beschreiben, was in mir vorging? Ich war mir ganz sicher, dass ich sie nie zuvor gesehen hatte, und doch lag mir ein Name schon fast auf der Zunge. Woher kam dieses flaue Gefühl in meinem Magen?
Draußen bremste uns gebrochenes Mauerwerk, Balken und Ziegelsplitter. Der Teil eines Spiegels lehnte an der Wand. Ich sah mich in dem Scherbenstück. Magda bog mit ihrem Pferd ab und trat ins Freie. Es dauerte einen kurzen Augenblick. bis mir klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Ein leises Rascheln hinter einem Vorsprung machte mich nervös. In zügigem Schritt wollte ich Magda folgen, da sah ich mich im Spiegel ... stehend. War es nicht mein Ebenbild? Im nächsten Moment verschwand das Bild. Die Kleidung? Entsprach sie auch meiner? Ich konnte mich nicht an sie erinnern. Verunsichert trat ich zu dem guten Stück zurück, um mich noch mal darin zu betrachten. Wieder raschelte es. Da war doch jemand! Den Typen wollte ich kennenlernen, sprang um den Vorsprung herum, doch ... dort war niemand. Es blieb rätselhaft.
Über mir erspähte ich eine Tenne. War der Fremde dorthin geflohen? Warum? Ich konnte keine Leiter sehen. Er könnte sie hochgezogen haben.
Ich gebe zu, der Moment kam mir unheimlich vor.
Magda wartete draußen bereits ungeduldig. „Fängst du an?“, ergriff sie die Initiative.
Skeptisch betrachtete ich das Tier. Sie deutete meinen kritischen Blick richtig und schwang sich selbst auf den Rücken des Pferdes.
„Er gefällt mir. Es ist ein schönes Tier“, schob ich mein Lob nach.
„Weißhaupt ist auch mein ganzer Stolz. Ich habe drei Jahre auf ihn gespart.“
„Reitest du schon lange?“
„Seit meiner Kindheit.“
Ein leichter Druck ihres Unterschenkels setzte das Tier in Gang. Ich schaute den geschmeidigen Bewegungen der beiden zu. Mit leichtem Schritt durchquerten sie die Bahn.
„Du bist sofort an der Reihe. Er ist heute gut zu führen“, rief sie mir nach einer Wendung zu.
Plötzlich verspürte ich einen Schatten über meine Empfindung fliegen. Meine Muskeln verkrampften sich. Ein solches Gefühl hatte ich immer nur dann, wenn ich mich in Gefahr glaubte. Es war nicht Angst vor dem, was Magda gleich von mir fordern würde.
Nein, etwas unheimlich Fremdes schnürte mir die Kehle zu.
„Ich muss dir Walther vorstellen“, rief meine Freundin mir zu. Sie war bereits wieder bei mir angekommen und sprang vom Pferd. An meiner Seite stand plötzlich ein Mann, sein Pferd hielt er am Zügel. Er war ein Hüne. Ich reichte ihm kaum bis zur Brust, obwohl ich normal gewachsen war. Er lächelte mich freundlich an, aber das schien mit eine Maske zu sein, die die Sanftmut nur vortäuschte.
„Dein neuer Freund?“, wollte er von Magda wissen. In seiner Stimme war ein Flackern. Es war keine Routinefragen. Er forderte eine Antwort, und nicht nur das. Eine Begründung, eine genaue Schilderung der Umstände, das war das Mindeste, was er erwartete.
Magda lächelte ihm zu. „Das passt schon, mach dir keine Gedanken!“
Ich selbst stand hilflos zwischen den beiden Parteien. Es drängte mich weg von dem Menschen, der nichts Gutes in sich trug. Das Quietschen der Stalltür lenkte mich ab. Das Mädchen, das vor wenigen Minuten noch dabei gewesen war, die Hufe ihres Tieres zu reinigen, trat mit einem Braunen aus dem Stall. Sie sah uns - und erschrak. Mit einem kurzen, unscheinbaren Wink bat sie mich, zu ihr zu kommen. Durfte ich die Gruppe so mir nichts, dir nichts verlassen, um mich an eine Fremde wenden? In diesem Fall drängte mich eine unfassbare Kraft zu dieser Unhöflichkeit.
„Bitte entschuldigt mich einen kurzen Moment.“ Die Reaktionen der beiden ignorierend lief ich zu dem Mädchen. Die Furcht, die weiterhin in ihren Augen lag, war noch nicht verflogen.
„Kann ich dir helfen?“, versuchte ich unschlüssig, ein Gespräch in Gang zu bringen.
„Verschwinde, so schnell du kannst!“
„Wie bitte?“ Ich glaubte, mich verhört zu haben. Verschwinden? Wie kam sie dazu? „Ich verstehe nicht, was du meinst“, antwortete ich voller Zweifel.
„Verschwinde endlich!“, flehte sie drängender, wobei eine Träne über ihre Wange rollte.
Das Mädchen hatte so eine bezaubernde Art, dass ich sie trösten, in die Arme nehmen wollte. Ihre Worte klangen so, als hinge ihr eigenes Leben von meiner Flucht ab.
„Wohin?“, lenkte ich unschlüssig ein.
„Du weißt genau, wohin. Nimm das schnellste Pferd.“
„Das bringt nichts, ich kann nicht reiten“, warf ich ein.
Ein bitteres Lächeln umspielte ihre Lippen. „Du? Nicht reiten? Das erzähle, wem du willst!“
Verwechselte sie mich mit jemandem? Ich wusste nicht mal, wie ich auf den Rücken eines Tieres kommen konnte.
„Jetzt mach schon!“
Der Riese drehte sich zu uns um. Er erschrak, als er das Mädchen an meiner Seite sah. In seinen Augen lohterte Wut auf. Dieser böse Hass, der in ihm aufschäumte, galt sowohl mir als auch ihr. In dem Leuchten seiner Pupillen spiegelte sich die Lust, uns alle Knochen zu brechen. Die vorgespielte Güte, die ich im ersten Moment wahrgenommen hatte, hatte sich in Gewaltbereitschaft verwandelt. Zweifellos war ich in Gefahr. Wie hatte dieses mir unbekannte Mädchen es wissen können?
Wie von der Tarantel gestochen lief ich los und saß unversehens auf dem Pferd des Fremden. Ein Lendendruck, und es riss sich aus seiner Hand, flog im Galopp davon und übersprang den Weidezaun.
„Bravo!“, hörte ich den Ruf des Mädchens.
Es war mir weder erklärlich, wie ich auf das Tier gekommen war, noch, warum ich nicht spätestens beim Aufsetzen des Pferdes hinter dem Zaun auf der Erde lag. Das edle, mächtige Ross jagte weiter, ohne von mir gelenkt zu werden. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich auf dem Rücken zu halten, presste die Schenkel fest zusammen. Die Steigeisen flatterten im Wind. Wäre es sicherer, in sie zu schlüpfen? Nein, bei der Geschwindigkeit war nicht daran zu denken. Gelegentlich, wenn das Tier stutzte und den Kopf hob, klammerte ich mich am Hals des Wesens fest. In solchen Momenten wurde es vorsichtiger. Das Pferd versuchte, es mir so leicht wie möglich zu machen, damit ich die Balance halten konnte. Odins Pferd, scherzte ich in Gedanken. Bestimmt lenkte der alte Gott es und hieß es, mich schonend an ein Ziel zu bringen.
„Du weißt, wohin“, hatte die Unbekannte mir wie selbstverständlich zugeraunt. Sie verwechselte mich! Ganz bestimmt! Ich erinnerte mich an den Spiegel im Reitstall. Hatte ich dort nicht noch jemanden gesehen? Ihn wollte das Mädchen mit der Warnung erreichen, nicht mich.
Irgendetwas in meinem tiefsten Inneren ließ mich allerdings daran zweifeln. War es ihr Blick, der mir vertraut schien? Es war mir unheimlich.
Das Pferd galoppierte weiter. Je länger ich mich auf dem Rücken hielt, desto mehr Sicherheit gewann ich. Die anfängliche Verkrampfung löste sich. Ich fand mich in den Rhythmus des Tieres ein. Wir flogen gleichförmig über Felder und durch Bewaldung. Über das Ziel machte ich mir keine Gedanken. Das Erlebnis, auf so leichte Art über der Erde zu schweben, war etwas Erhebendes. Immer wieder musste ich Ästen ausweichen, und so duckte ich mich geschickt, mal nach rechts, dann nach links, ein anderes Mal legte ich mich tief auf den Hals meines neuen Freunds. Merkwürdigerweise löste die Art der Berührung weitere Empfindungen aus.
Für einen Sekundenbruchteil hatte ich den Eindruck, mich nicht vor Ästen, sondern vor Äxten, Schwertern, Lanzen ducken zu müssen.
Als ich das Ende des Waldes erreicht hatte, fühlten sich meine Arme und Beine ausgekühlt an. Durchblutungsprobleme hatte ich nie gehabt. Das konnte es also nicht sein. War es ein Temperatursturz? Doch das Gefühl hielt nicht länger als zwei oder drei Minuten an, schon glühte ich wie in Feuer geworfen. Ich hörte es knistern, bildete mir Balken ein, die unter den Flammen brachen. Hatten diese Gefühlswallungen mit dem Reiten zu tun?
Glockentöne verscheuchten die Irrbilder. Das Pferd strauchelte und wurde langsamer. Dann lief es auf die Kirche zu, deren Glocken ich hörte. Ob ich den Impuls für die Richtungsänderung gab oder das Ross selbst, konnte ich nicht sagen.
War das mein Ziel? Ich war nie ein frommer Mensch gewesen. Zwar wuchs ich im Glauben der katholischen Kirche auf, doch hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob das für mein Leben wichtig war oder es gar bereicherte. Zudem hatte sich während meiner vor Kurzem überstandenen Pubertät Interesse für die hinterindische Religionswelt entwickelt. Ich lehnte den christlichen Glauben nicht ab, sondern stand ihm schlichtweg gleichgültig gegenüber.
Den Trab zu der Kapelle nahm ich widerspruchslos in Kauf. Alte Blutbuchen standen vor dem Gebäude. Ich brachte das Tier mit einem leichten Zug an der Trense zum Halten. Gesänge kamen aus dem Gebäude. Männerstimmen – ich denke, sehr alte Musik. Gregorianische Chormusik. Es war einmal Thema im Musikunterricht gewesen.
Sie berührte mich. Schon oft hatte ich solchen Gesang gehört, doch nie hatte ich etwas Besonderes daran gefunden. Was war mit mir los? Warum fesselte mich heute die Wirkung dieses einfachen Tonsatzes? War es die Friedlichkeit, die diese gleichförmige Tonbewegungen ausstrahlte? Auch verstand ich nicht, wie ein Chor in die kleine Kapelle passen sollte.
Das Rätsel war schnell gelöst. Nachdem ich abgestiegen war und den engen Kirchenraum betreten hatte, stand ich vor Lautsprechern. Wahrscheinlich wollte die Gemeinde das Bewusstsein der Demut auf diese Weise fördern. Der Innenraum hatte ansonsten nicht viel zu bieten. Es gab grobe Holzbänke, die nur wenigen Personen Platz boten, einen mit künstlichen Blumen geschmückten Marienaltar, an der Seite das Kreuz …? Das Kreuz …
Das unumstößliche Symbol ...
Es flimmerte vor meinen Augen, als ich auf die Jesusfigur blickte. Spielte meine Einbildung mir einen Streich? Verschiedene Gestalten blitzten nacheinander in dem Lindenholzstück auf. Wie von Leben erfüllt schrien sie auf, verschwanden wieder. Mir war, als ob mich ein Messer zerschnitt, meine Zunge lag für Momente ausgetrocknet, wie ein Stein, in meinem Mund. Die Vorstellung verwarf ich sofort und vehement. Nein, nichts anderes war vor mir zu sehen als eine aus einfachem Holz geschnitzte Figur mit der Aufschrift INRI. Doch noch einmal schwindelte mir. Die Buchstaben begannen, zu flimmern und sich zu sonderbaren Zeichen zu verziehen. Hebräisch, Hieroglyphen, Keilschrift ... Was sollte ich damit anfangen? Endlich normalisierten sich meine Sinne wieder. Bestimmt hatte ich mir das alles nur eingebildet.
Als ich aus der Kapelle trat, erinnerte ich mich erneut an die Worte des Mädchens. „Du weißt, wohin.“ Ein Blick zurück auf das Gebäude half mir nicht weiter.
Dieser Ort sagte mir nichts. Ich musste falsch sein. Das alles war Wahnsinn. Warum hatte sie mir das gesagt? Ich hatte recht gehabt: Ich war nicht der, den sie meinte.
Und nun? Wohin? Woher sollte ich die Antwort nehmen?
Ich stand auf einer Anhöhe, ein Kreuzweg führte geradeaus steil in eine Stadt hinab. Ihn säumten neben mittelgroßer Ebereschen auch andere Sträucher.
An den Stamm einer der Vogelbeerbäume lehnte ich mich und schloss die Augen. Sie meinte mich! Warum war ich mir da nur so sicher? Ich brachte die Eschen mit irgendetwas in Verbindung, aber ich konnte mir kein Bild machen, womit. In mir brodelte eine Ahnung. Wie konnte ich sie greifen? Dieses Mädchen hatte mich und keinen anderen gemeint!
Ich blickte noch einmal zurück.
Vor der Kapelle stand eine Bank, daneben wuchs ein Kirschlorbeerstrauch. Vielleicht sollte ich alles sacken lassen. Ich setzte mich auf die Bank und sah ins Tal, um mich abzulenken.
Ein Paar stieg den Kreuzweg herauf. Geistesabwesend riss ich einige Äste von dem Strauch und beobachtete die beiden. Sie dürften um die vierzig sein. An frommen Orten wie diesen begegnete man meistens älteren Leuten. Ich belächelte mein Vorurteil. Als sie die Kapelle erreicht hatten, schritt das Pferd an meine Seite und wieherte. Der Herr schaute es verwundert an und musterte danach mich.
„Sie reiten das Pferd des Regierungspräsidenten Weber?“
„Ja, es ist so gewollt“, entgegnete ich. Gleichzeitig hallte das Wort Regierungspräsident in meinem Kopf nach. Ich hatte das Pferd eines Staatsmannes gestohlen? War der, vor dem ich solche Beklemmungen bekommen hatte, eine große Persönlichkeit? „Nimm das schnellste Pferd!“ Das hatte die Unbekannte gesagt. Sie hatte ganz genau gewusst, welches Tier das war. War ich wahnsinnig? Was hatte ich getan? Und wie hatte ich es als das edlere Pferd erkannt? Gaul war für mich Gaul.
Wäre mir vor zwei Tagen in dieser Situation noch das Herz in die Hose gerutscht, so hatte ich in diesem Augenblick die Gewissheit, richtig gehandelt zu haben. Das „Ja, es ist so gewollt“ hatte ich sicher und wie selbstverständlich geantwortet.
Der Fremde nickte und folgte seiner Frau in die Kapelle. Ich betrachtete meine Hände. Während der wenigen Sätze hatte ich aus den Lorbeerzweigen einen Kranz geformt. Warum mir bei dem Anblick das Forum Romanum Roms in den Sinn kam, war nicht schwer zu erraten. Das Jahr zuvor hatte ich mit meinen Eltern die Überreste besucht. Meine Mutter zwinkerte mir damals beim Anblick eines Lorbeerstrauches zu. Aus dem hätten sich Cäsar und Augustus ihre Kopfbedeckungen gemacht. Wir lachten damals herzlich über die Bezeichnung ‚Kopfbedeckung‘. An kalten Tagen dürften die alten Cäsaren heftig über den unzureichenden Schutz geflucht haben. Ihre Heere rüsteten die Herren wohlüberlegt mit geschlossenen Helmen aus.
Eine gewaltige Explosion schreckte mich aus meinen Träumereien. Direkt unter mir, dort, wo sich die Sportanlagen befanden, stieg dichter Qualm auf. Wenige Sekunden lang war es still. Dann quietschten Bremsen, ein Alarm sprang an, das Pferd hinter mir … Es wieherte und drückte mich mit dem Kopf von der Parkbank. Im selben Moment wusste ich, dass ich dort unten, was auch immer gerade vorging, gebraucht wurde.
Den Weg missachtend rannte ich den Grasabhang hinab. Nach wenigen Minuten stand ich vor der brennenden Halle.
Weder die Polizei noch die Feuerwehr waren schon eingetroffen. Personen kämpften sich aus dem Inferno.
Syrer oder andere Geflüchtete – sie waren in diesen Notzeiten dort untergebracht. In ihren Ländern herrschte Krieg und wütete der Tod.
Ein Attentat?
Müßige Frage. Es spielte keine Rolle. Tatsache war, es brannte und in dieser Halle waren Menschen, bestimmt auch Kinder in Lebensgefahr.
Ich drängte mich durch die Entgegenkommenden und stand kurz darauf mit wenigen Blessuren im Innenraum der Sporthalle, die in zahlreichen Kämmerchen aufgeteilt war. Die aufgescheuchte Menge rief mir in einer fremden Sprache zu, mitzukommen, den unheilvollen Ort zu verlassen. Einzelne Männer ergriffen mich, versuchten, mich nach draußen zu zerren. Ich widersetzte mich. Dichter Qualm verdeckte die Hallendecke. Am anderen Ende schossen die Flammen hoch. Ob es Leichtsinn oder Übermut war, der mich trotz allem durch die notdürftig gezimmerten Räume jagen ließ, kann ich nicht mehr sagen. Ich war felsenfest davon überzeugt, eine verlassene Seele, einen vergessenen Menschen zu finden. Am wenigsten dachte ich an mein eigenes Leben, als wäre ich tausendmal in ähnlichen Situationen gewesen, hätte vergleichbaren Gefahren unzählige Male getrotzt.
Erst, als ich einen der letzten Räume erreicht hatte, holte mich die Vernunft ein. Dieser entsetzliche Qualm musste zum sicheren Tod führen!
„Eridu“, hörte ich eine Stimme.
Wie versteinert blieb ich stehen. Es dauerte mehr als einen Augenblick, bis ich mich besann. Im nächsten Raum war noch jemand.
„Eridu“, erklang es drängender.
Der Begriff wirkte wie ein Zauberwort auf mich. Was tat er noch in der Gefahrenzone? Ich fand einen älteren, gebrechlichen Mann, der kaum in der Lage war, sich zu erheben. Sein flehender Blick drang tief in mein Inneres.
„Eridu“, hörte ich noch einmal, und dieses Mal liefen ihm Tränen über die Wangen. Es war, als hätte er mir einen Namen gegeben. Einen Namen, den er nicht in dieser Minute erfand, sondern den er schon immer, vielleicht sein Leben lang, für diesen Moment aufgehoben hatte.
Ich verschwendete keine Sekunde, packte den ausgezehrten Menschen, um mit ihm so schnell wie möglich zum Ausgang zu kommen. Die Beine versagten ihm. Obwohl ich nicht sehr kräftig war, setzte ich ihn auf meinen Rücken und so keuchte ich tapfer vorwärts. Die Luft wurde unerträglich. Ich erinnerte mich an einen Jugendfreund, der aufgrund eines Brandes in einer Alpenhütte allein durch die Rauchentwicklung zu Tode gekommen war.
Konnten wir es schaffen? Ich kämpfte weiter. Zu keiner Sekunde kam mir der Gedanke, meinen Begleiter fallen zu lassen, um mich selbst in Sicherheit zu bringen. Ich hielt die Luft an, hetzte, rannte.
Vor meinen Augen wurde es schwarz und fast drohte ich, zu stürzen. Ein kräftiger, frischer Luftzug zog in den Saal, der mir ein gefahrloses Durchatmen erlaubte. Gleichzeitig gab er dem Feuer Nahrung, das angeheizt in die Höhe schoss. Die Halle hatte den Kampf verloren.
Zwei Feuerwehrleute schauten durch den Eingang und sahen uns. Sie stießen wilde Flüche aus. Hektisch eilten sie uns zur Hilfe und zogen uns aus dem Inferno. Draußen war ich am Ende meiner Kräfte. Ich brach zusammen und kam neben meinem Begleiter zu liegen. Tief atmete ich die reine Luft ein.
„Starke Leistung“, lobte einer der Helfer. „Wo bist du her?“, wollte er von mir wissen.
„Bin von hier“, keuchte ich, ehe mich ein Hustenanfall schüttelte.
Auch mein Nachbar hatte mit der Stimme zu kämpfen. Er legte die Hand über die meine und drückte sie. Ich erwiderte den Dank. Als sich unsere Blicke trafen, sah ich in Augen, die einen unsäglichen Frieden ausstrahlten.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass er die Rettungsaktion für mich veranstaltet hatte. Warum ich mir dabei vollkommen sicher war, blieb mir noch ein Rätsel. Er versuchte, mir etwas zu sagen, doch leider verstand ich kein Wort. Es schlich sich ein Anflug von Enttäuschung in seine Miene. Begriff er erst jetzt, dass ich des Arabischen oder was immer er sprach, nicht mächtig war? Ich hauchte das Wort „Eridu“. Sofort wurde sein Gesichtsausdruck milder. Wieder waren Tränen in seinen Augen zu sehen.
Zwischenzeitlich trafen Sanitäter ein. Sie luden meinen Schützling auf eine Trage und trugen ihn zu einem Krankenwagen.
Ich erbrach mich. Ein weiterer Rettungswagen, der fast gleichzeitig eintraf, war für mich bestimmt. Die eifrigen Helfer baten mich, Ruhe zu bewahren, und reichten mir eine Maske, über die ich frischen Sauerstoff zu inhalieren hatte.
Mir war zu übel, um mich zur Wehr zu setzen. Der Wagen fuhr los.
Im Krankenhaus schlossen sich mehrere Untersuchungen an, die ich nur mit halbem Bewusstsein verfolgte. Die Zeit verflog, bis ich in ein Zimmer gebracht wurde. Bald schlief ich ein.
*
Ich hatte nie verstanden, warum man in Krankenhäusern zu früher Stunde aus dem Schlaf gerissen wird. Wahrscheinlich sind Patienten Opfer eines Dienstvertrags, der durch die Pfleger und Pflegerinnen zu erfüllen ist, und ein solcher Vertrag sieht den Arbeitsbeginn zu einer brachialen Zeit vor. Blutdruck- und Temperaturmessungen, wenige Worte und schon wurde ich mit meinen Gedanken allein gelassen. Ob sie meine Eltern verständigt hatten? Erst jetzt dachte ich an meine Familie, an meine Freundin Magda. Sie mussten sich Sorgen machen, schließlich war ich gestern nicht nach Hause gekommen.
Der vergangene Tag! Was für ein Wahnsinn hatte sich abgespielt. Ich erinnerte mich an Jauch und Spreizli, der Ruf der Eule hallte noch in mir nach. Was war mit dem Pferd geschehen, das ich dem hohen Regierungsbeamten gestohlen hatte? Pferde finden zurück in den Stall. Wie war ich auf den Aberwitz einer solchen Tat gekommen? Was war das für ein Mädchen, das in kürzester Zeit einen solchen Einfluss auf mich ausgeübt hatte? Hatte sie geahnt, dass es ein Leben zu retten galt? Wie ging es dem Fremden? Ich spürte noch immer seine Hand. Sie fühlte sich wie die Hand eines Freundes an, die einen ein Leben lang begleitete. Dann ärgerte ich mich wieder über den Typ bei Jauch und Spreizli, der mich, einen Schulkameraden, auf so arrogante Art behandelt hatte. War er mehr wert als ich?
Die Tür wurde geöffnet, ein junger Arzt trat ein. „Herr Jebich? Haben Sie gut geschlafen? Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen.“
„Herzlichen Dank“, erwiderte ich den Gruß. „Wissen meine Eltern Bescheid?“
Der Arzt nickte zuversichtlich. „Sie sind unterrichtet und werden Sie heute besuchen.“
„Darf ich noch nicht nach Hause?“
„Wir wollen noch einen Tag warten. Die Presse bat um einen Termin. Immerhin haben wir einen richtigen Helden auf der Station. Wir sind bei solchen Anfragen vorsichtig und fragen zuerst die Patienten, ob das erwünscht ist.“
In der Öffentlichkeit zu stehen, war nicht mein Ding, es passte mir daher nicht. „Muss das sein?“, erwiderte ich etwas widerborstig.
„Natürlich nicht. Ich kann sie problemlos abwimmeln. Ruhe steht Patienten zu und unsere Aufgabe ist es nicht, Stresssymptome zu fördern. Außerdem wollen wir in einer halben Stunde noch eine Doppleruntersuchung machen.“
„Doppler? Der Akt gestern hat wohl meine Lunge geschrottet?“, warf ich flapsig ein.
„Na, die reinigt sich schnell. Uns interessiert mehr Ihr Herz.“
„Mein Herz? Das verstehe ich nicht. Ich hatte noch nie Probleme damit.“
„Wirklich? Noch nie?“
„Absolut nicht.“
„Hm ...“ Der Arzt schaute mich nachdenklich an und setzte sich auf die Bettkante. „Treiben Sie Sport?“
„Nicht mehr oder weniger als jeder andere. Ich bin eher der musische Typ, wobei ich Ski fahre, gelegentlich bin ich auf dem Tennisplatz.“
„Sie haben nie bemerkt, dass Sie Schweißausbrüche bei Anstrengungen bekommen? Fühlten Sie sich immer voll belastbar?“
„Ich weiß nicht, wie andere sich fühlen, ich hatte nie Beschwerden. Was ist mit meinem Herz?“
„Es hat sonderbare Narben. So fällt eine Wunde am großen Herzmuskel auf, die nur von außen erfolgt sein kann. Hier beginnt unser erstes Rätsel. Ihre Haut hat keine Narben. Sie hatten nie eine Operation und auch keine Verletzung. Weitere vorhandene Vernarbungen mögen Knoten seelischen Ursprungs sein. Wir kennen solche Wunden bislang nicht und haben daher Probleme, es richtig einzuordnen.“
„Ist es lebensgefährlich?“
„Nach den gestrigen Untersuchungen zu urteilen, will ich ‚Nein‘ sagen. Die Funktion des Muskels zeigt keine Einschränkungen.“
„Sehen Sie!“
„Wir müssen sichergehen und Ihnen eine Überwachung anraten. Ich hoffe, Sie widersprechen der angesetzten Untersuchung nicht?“
„Nein, keinesfalls. Womöglich stellt sich doch alles als ganz harmlos heraus.“
„Das wäre schön.“
„Der Fremde, dem ich gestern helfen konnte, ist er ebenfalls in der Klinik?“
„Muba? Es geht ihm gut, und wie ich hörte, fragte er schon nach Ihnen. Er liegt zwei Zimmer weiter. Meine Hochachtung für Ihre Tat.“
„Muba?“ Ich sah die Buchstaben fast zum Greifen vor mir. „Darf ich ihn besuchen?“
„Wir sind hier nicht im Gefängnis“, lachte der Arzt, während er aufstand. „Sie können sich frei bewegen. Die Untersuchung findet erst in einer Stunde statt. Wir werden Sie rufen.“
„Vielen Dank“, schloss ich das Gespräch ab.
Mein Gegenüber stand bereits an der Tür und nickte mir noch mal zufrieden zu.
Die Sorge um mein Herz teilte ich nicht. Die Untersuchung konnte nicht schaden, doch fühlte ich mich restlos fit.
Das dünne Hemd, das man mir tags zuvor zu den Untersuchungen übergeworfen hatte, war mir zu wenig. Meine Kleider fand ich zum Glück schnell.
*
Mein neuer Freund saß im Rollstuhl. Seine Freude war groß, als er mich sah. In dieser neuen Welt, weit weg von seinen Vertrauten - sie wurden vermutlich in irgendwelche alternativen Notunterkünfte verteilt - war ich die Person, die ihm am nächsten stand.
Wir konnten uns natürlich nicht unterhalten. Wir hatten nur ein Wort gemein, das uns auf eine sonderbare Weise verband, dessen Bedeutung ich aber nicht kannte: Eridu!
Es fiel uns trotzdem nicht schwer, ohne Sprache auszukommen. Eine Krankenschwester, die nach dem Rechten schauen wollte, schlug mir vor, mit meinem Freund eine halbe Stunde in den Park zu gehen. Er wäre direkt vor der Tür, die Sonne schon aufgegangen und der Morgen geradezu lau. Auf meinen Einwurf, es stünde ja noch eine Untersuchung an, entgegnete sie, eine halbe Stunde ginge klar, außerdem wüsste sie ja, wo sie mich fände.
Es tat uns gut. Der Qualm und die Dämpfe während unserer Flucht aus der Halle hatten nicht nur in unseren Organen ihren Niederschlag gefunden, sondern auch auf der Psyche. Die frische Morgenluft hatte ich nie so intensiv wahrgenommen wie in dieser Stunde. Ich scheute gar, zurück ins Gebäude zu gehen. Wahrscheinlich ging es meinem Freund ähnlich. In dem überschaubaren Park befand sich ein kleiner Teich. Zur Hälfte war er von Schilf begrenzt, den anderen Teil säumte ihn der angrenzende Weg.
Als wir nahe genug an dem Gewässer waren, bat er mich, anzuhalten. Ich gönnte ihm den Moment. Wahrscheinlich war ihm eine solche Idylle etwas Neues. Es war spürbar, wie er alles in sich aufsaugte.
Eine weit geöffnete Seerose fiel mir ins Auge. Änderte sie ihre Farbe? Ein leichtes Gelb verwandelte sich in ein zartes Rot und plötzlich strahlte sie in intensivstem Blau. Ich schloss kurz die Augen und sah wieder hin. Sie war weiß. Weiß wie jede andere Seerose.
Was war mit mir los? Gingen die Verrücktheiten des Vortages weiter? Ganz sicher hatte ich es mir nicht eingebildet. An irgendeinem Wechsel der Lichtverhältnisse konnte es auch nicht liegen.
Ein Kampfflugzeug, das dicht über den Ort flog, schreckte uns auf. Von Krieg war die Rede. Die westlichen Regierungen wollten sich zwar nicht direkt im mittleren Osten engagieren, trotzdem wurden Aufklärungsflugzeuge mobilisiert. Immer, wenn mich die Wucht der Schallwellen von Starfightern und ähnlichen Maschinen erreichte, wusste ich den Tod an meiner Seite. Auch in diesem Augenblick erwachte ein Schmerz aus meinem Unterbewussten.
Eine Erklärung dafür fand ich nicht. Wahrscheinlich ging es jedem so.
Mein Freund hatte die Veränderung meiner Gesichtszüge bemerkt. Er nickte, als wollte er mir etwas Unbegreifliches bestätigen. Vielleicht deutete ich es auch falsch. Es war wohl an der Zeit, zurückzugehen.
Wir befanden uns auf einem leeren Flur, als mein Begleiter mich festhielt und zum Stehenbleiben zwang. In seinem Blick fand sich eine Strenge, eine gebündelte Konzentration. Es arbeitete in ihm. Er hob den Arm und zeigte auf das Ende des Gangs.
Dort war nichts zu sehen. Starr blickte er auf einen Punkt. Der Arm blieb unverrückt in der Luft.
Schritte? Ein Arzt bog um die Ecke und kam uns forsch entgegen. Ich erschrak. Dieses Gesicht? War es nicht der Regierungsbeamte, dessen Pferd ich ...? Das Herz rutschte mir in die Hose. Nein. Es konnte nicht sein. Dieser Herr trug einen Arztkittel. Regierungspräsidenten und Ärzte sind zwei total verschiedene Dinge.
Er war über die Art und Weise, wie ich ihn anschaute, verunsichert, wurde langsamer und musterte mich genau.
„Kann ich Ihnen helfen?“, sprach er mich an.
„Entschuldigung Sie“, versuchte ich, die Situation zu klären. „Ich war kurz der Ansicht, wir würden uns kennen. Ich habe mich wohl getäuscht.“ Die Situation war mir peinlich.
„Mich? Das kommt gelegentlich vor. Wo soll es denn gewesen sein?“
„Auf einem Reiterhof.“
Seine Miene fror ein. Ohne eine weitere Bemerkung wandte er sich ab, setzte seinen Weg fort und ließ mich stehen. Ich schaute ihm nach.
Vielleicht nach fünf oder zehn Metern hielt er an, wandte sich nochmals um, scannte mich argwöhnisch und setzte darauf seinen Weg fort. Diese kurze Sequenz hätte ich sofort verdrängt, wäre mir nicht eine Nichtigkeit ins Auge gesprungen: Er lief jetzt merklich schneller.
Warum hatte er es plötzlich eilig? Es mochte unzählige Gründe dafür geben, doch ich war mir sicher, dass es einen kausalen Zusammenhang mit meiner Erklärung gab.
Mein Begleiter zog an meinem Ärmel. Was war mit ihm? Feuer lag in seinen Augen. Wie sollte ich mit dieser Situation umgehen? Wurde von mir etwas erwartet?
Alles um mich war seltsam. Wieder hatte sich eine sonderbare Spannung aufgebaut. Auf was wartete ich? Es kam mir vor, als schaute die ganze Menschheit auf mich. Was drängte mich?
Wie in Trance folgte ich dem vermeintlichen Arzt.
Er stand vor einem Wagen und telefonierte, die Augen auf mich gerichtet. Ich hatte nicht die geringste Möglichkeit, seinem Blick auszuweichen, als ich durch die Drehtür der Klinik ins Freie trat. Sofort drückte er seinen Gesprächspartner weg und kam mir entgegen.
„Darf ich Sie zum Kaffee einladen?“
Diese Frage war unglaublich. Ich stand einer Person gegenüber, der ich ungeschickt begegnete, und sie konterte mit einer Einladung. Warum sollte er mich zum Kaffee einladen?
„Ja“, antwortete ich zögerlich.
„Auch ein Stück Kuchen?“ Er wartete keine Antwort ab, sondern war bereits unterwegs zurück ins Krankenhaus. Ich folgte ihm in eine kleine, lichtdurchflutete Cafeteria, die mit einfachen Bistromöbeln bestückt war. An einem Tresen war eine ältere, etwas schwerfällige Dame damit beschäftigt, die Wünsche der Gäste zu erfüllen.
„Himbeerkuchen? Er ist zu empfehlen“, schlug der Arzt mir vor.
„Sehr gerne.“
„Nimm Platz.“ Übergangslos schlitterte er in eine persönlichere Form der Anrede.
Gespannt kam ich seiner Bitte nach, ihn nicht aus den Augen lassend. Er hatte bereits wieder sein Handy am Ohr, eilte zu der Dame und orderte zwei Stück Kuchen und bestimmt auch Kaffee.
„Der Rest kommt gleich.“ Er setzte sich zu mir und schob einen Teller vor mich. „Sie meinen, mich wirklich zu kennen?“
„Nur für einen Augenblick“, antwortete ich. „Nein. Ich lag völlig falsch. Hat Ihre Einladung einen besonderen Grund? Ich bin sehr überrascht.“
„Ich habe eine Stunde frei. Zugegeben, es interessiert mich, wem ich ähnele. Sie sind Besucher?“
„Nein. Eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein. Dr. Schmoldorf wollte noch eine Herzuntersuchung machen.“
„Oh, Sie haben ein Problem mit dem Herzen? Das tut mir leid. Darf ich mich noch mal entschuldigen?“
Wieder sprang er auf und ging in Richtung Theke, um erneut zu telefonieren. Als er zurückkam, setzte er sich nicht sogleich. „Der Kaffee! Es fehlt der Kaffee. WO BLEIBT DER KAFFEE?“, rief er wirr und heftig zur Theke.
Die Dame, die dabei war, eine Kleinigkeit zu notieren, zuckte erschreckt zusammen, richtete nun eilig ein Tablett her und brachte es uns. Ihre Hände zitterten. Die Tasse, die sie vor mir abstellte, schwappte leicht über. Seine Tasse setzte sie nicht direkt vor meinem Gegenüber ab. Sie zögerte. Allerdings nicht aus Unsicherheit, sie traf eine Entscheidung. Mit einem verächtlichen Blick ließ sie die Tasse samt Untertasse auf den Oberschenkel des Arztes fallen. Einfach so.
Er schrie auf. Natürlich hatte er sich verbrüht. Die Flüssigkeit drang durch seine weiße Hose.
„Sehen Sie, was Sie angerichtet haben!“, tobte er.
„Es tut mir leid. Ich will auch alles wiedergutmachen!“ Ihre Stimme klang weder um Verzeihung bittend noch freundlich.
Sie packte ihn am Kittel, zog ihn hoch und zerrte ihn regelrecht in die angrenzende Küche. Bevor sie unseren Tisch verließ, warf die nun sehr geschickt agierende Frau eine Serviette auf meinen Kuchen. Meinem fragenden Blick wich sie aus. Sie war gänzlich mit meinem Begleiter beschäftigt, der sich heftig zur Wehr setzte, doch sie ließ ihm keine Chance.
Die anwesenden Gäste taten, als würden sie lesen oder sich weiter unterhalten und den Vorfall nicht beachten, doch natürlich starrten sie alle zu uns herüber.
Ich nahm die Serviette, die ... nein, sie war nicht säuberlich zusammengelegt. Schon wollte ich sie auf die Seite legen, als sie aufklappte. Sie war beschrieben.
Aufgewühlt betrachtete ich die flüchtig gekritzelten Buchstaben: „Sie bringen dich um.“
Ich las die Worte einmal, zweimal ...
Gerade zog die Bedienung den Arzt durch eine Tür. Wer wollte mich umbringen? Er? Warum stand da `sie`? Gab es eine Gruppe, die ein Problem mit mir hatte? Er hatte telefoniert. Hatten sie über mich gesprochen? Warum sollte mich jemand töten? Das war doch ein Witz.
Ich hatte nicht die geringste Idee, was eine solche Tat rechtfertigen könnte. Andererseits zweifelte ich keinen Moment an der Botschaft.
Ich stand auf, warf noch einen Blick auf die Küchentür und verließ die Cafeteria.
Wohin? Nach Hause? Alle Ereignisse der vergangenen zwei Tage ergaben keinen Sinn. Fetzen von Begebenheiten vernebelten meine sonst so klaren Gedanken auf eine Weise, die mich unfähig machte, einen Weg auszumachen.
Ich lief einfach los.
Der Klinik schloss sich ein Wald an. Im Schatten der Bäume fühlte ich mich wohler. Allein die Chance, mich hinter Stämme zu verstecken, im Unterholz abzutauchen, ließ mich befreiter atmen. Ich belächelte diese Vorstellung. Kein normaler Mensch verkroch sich im Unterholz.
Wieder und wieder tauchten die Bilder auf. Der Gesichtsausdruck des Mädchens im Reitstall, die Rose meiner Großmutter, der Fremde aus Syrien.
Ich sollte einer Gefahr gegenüberstehen? Welcher? Hatte ich je einem Menschen etwas Böses getan?
Ich fühlte die Bedrohung. Nie zuvor hatte ein ähnlicher Druck auf mir gelegen. War dieser Irrsinn der Anfang eines ausbrechenden Verfolgungswahns? Bildete ich mir alles ein? Nicht mein Herz, mein Verstand sollte untersucht werden.
Im Schatten huschte ein Tier an mir vorbei. Kein Knistern, kein Knacken. Es war mir nicht möglich, zu sehen, woher es kam und wohin es verschwand. Nur das Rauschen der Blätter begleitete seinen Weg.
Da war er wieder, der Ruf der Eule. Eindringlich, intensiv. Es war kein Warnruf, wie ich ihn beim ersten Mal verstanden hatte. In diesen Lauten versteckte sich ein Aufschrei, der Tod. Eiskalt durchdrang er meine Glieder. Auf einen Schlag war mir klar, dass das Ende meines Lebens bevorstand. Ich blieb stehen, atmete durch, kontrollierte meinen Körper. Ich spürte keine Schmerzen.
„Freund Hein, wo versteckst du dich?“, rief ich aus.
Der Wind stockte, die Blätter hingen starr an den Ästen. Stille.
Wieder erklang der mahnende Ruf der Eule.
Ich ging unbeirrt weiter und stand bald vor einer Wegkreuzung. Links bog der Pfad in einen noch dunkleren Wald ab, rechter Hand löste er sich in einem weiten Feld auf. Dort, auf der freien Ebene, stand ein großer Käfig. Beim Nähertreten erkannte ich Raben, die sich in dieser Falle verfangen hatten. Meine Verwunderung war groß. Krähen sah man allerorts, diese riesigen Geschwister hielt ich für nahezu ausgestorben. Wie kam es zu dieser Ansammlung? Es war ihnen möglich, durch einen engen Spalt in das Geflecht zu kommen, ein Zurück gab es nicht mehr. In der Enge gerieten sie in Panik, zerfleischten sich gegenseitig. Tote Tiere, Blut und verendete, entfiederte Fleischbrocken füllten das Innere. Es war ein Bild des Grauens. Ich öffnete das Verlies. Unsicher und kraftlos hüpften die noch lebenden Tiere in die Freiheit. Ein letzter Vogel blieb unbeirrt auf seinem Platz und schaute mich an. Es war, als wollte er mir danken. Er schritt an mir vorbei, breitete seine Flügel aus und wandte sich dann noch einmal um. Wollte auch er mich warnen? Mit bösem Kratzen in der Stimme rollte er einen dunklen Ton. Warum mir der Laut Mut einflößte, vermochte ich nicht zu enträtseln. Ein, zwei kräftige Schläge und er hob von der Erde ab. Ich schaute ihm noch lange nach, bis er sich in weiter Ferne vereint mit seinen Geschwistern im Blau des Himmels verlor.
Ich fühlte die Anwesenheit eines Menschen hinter mir.
„Du willst mich töten?“, fragte ich leise.
„Ja. Es ist so weit.“
Die Antwort wurde genauso ruhig und sicher gesprochen wie meine Frage.
Langsam drehte ich mich um.
„Sie?“
„Du kennst mich?“
„Ja und nein.“
Ich zögerte bei meiner Antwort.
Die Person, die vor mir stand, war mir durchaus nicht fremd, doch wusste ich ihr keinen Platz zuzuweisen. Als Erstes kam mir mein ehemaliger Schulrektor in Erinnerung, dann ein Nachbar, der sich in einem engen Dachstübchen in dem uns gegenüberliegenden Haus zurückgezogen hatte, am Ende blitzte gar noch ein Großonkel auf. Alle diese Personen trugen etwas sehr Persönliches von seinem Wesen in sich.
Nein, ihn kannte ich nicht.
„Suchen Sie mich schon lange?“
„Dich musste ich nie suchen. Zu jeder Zeit wusste ich, wo du warst.“
„Warum wollen Sie mich töten?“
„Du kannst dir keinen Grund vorstellen?“
„Beim besten Willen nicht, nein.“
Mein Gegenüber lachte. „Was du doch für ein Narr bist. Dein Leben ist längst überfällig. Du gefährdest die Ordnung der Welt. Es gibt Gesetze, die eingehalten werden müssen. Wir brauchen keine Störfaktoren.“
„Ich? Ein Störfaktor? Sie irren sich! Schauen Sie sich um. Ich bin der Falsche!“
Wieder lachte er mit einer Bitternis, die mir die Sprache verschlug.
Wolken zogen auf. Sie ballten sich in großer Geschwindigkeit zu einer drohenden, gewichtigen Masse auf. Er schaute nach oben und zuckte zusammen. Passten sie ihm nicht in den Plan? Sein Gesicht verfinsterte sich, Unsicherheit zeigte sich in seiner Miene.
„Nein! Der Falsche bist du auf keinen Fall. Mehrmals war ich kurz davor, dich zu töten. Oft ist es mir beinahe gelungen, doch wurdest du von Mächten geschützt, die nicht gewollt sind. Wir sind uns einig, haben wir dich vernichtet, haben wir auch diese Mächte ausgeschaltet.“
Ein Donnerrollen schreckte ihn auf.
„Ist das eine dieser Mächte?“, zeigte ich zum Himmel.
„Es waren immer irdische Gewalten.“ Zweifel vibrierte in seinen Worten.
„Wie wollen Sie mich töten? Ich sehe keine Waffe.“
„Ich selbst werde es nicht machen. Es ist nicht meine Aufgabe. Nach dem Gesetz muss ich rein bleiben.“