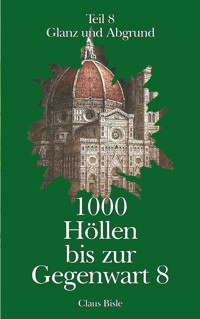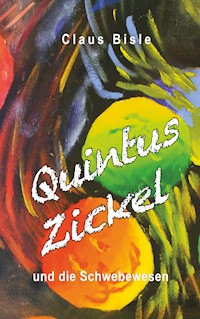Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Es ist eine atemberaubende Art, die Menschheitsgeschichte zu durchleben. In dem Gesamtwerk begleitet der Leser Manuel Jebich in seinem Bestreben, das Gewesene zu bestehen. In Band VI stellt er sich den Herausforderungen des frühen Mittelalters, dem Zeitraum von Karl des Großen bis Heinrich IV. Neben der Spannung wird wiederum hintergründiges Wissen garantiert. Der Autor achtet streng auf historische Korrektheit. Nie wurden weltweite Zusammenhänge derart plastisch und verständlich herausgearbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman für die Jugend und Menschen, die die Geschichte neu erleben wollen.
Inhaltsverzeichnis
Eiche (772 n. Chr.)
Kaiserkrone (799 n. Chr.)
Bambus (825 n. Chr.)
Schlehen (841 n. Chr.)
Drachenwurz (885 n. Chr.)
Aechmea fasciata (926 n. Chr.)
Märzenbecher (933 n. Chr.)
Mannstreu (972 n. Chr.)
Baum-Wolfsmilch (1053 n. Chr.)
Fasanenbeere (1077 n. Chr.)
Glossar
Zum Autor
Eiche (772 n. Chr.)
Der Satz: „Die Schlacht ist zu Ende, du bist in Sicherheit“, trommelte in meinen Ohren. Mir war übel. Ich erbrach mich.
Hatte nicht eben eine junge zarte Frau vor mir gestanden? Wo war sie? Konnte der Erdboden sie verschluckt haben?
Alles hatte sich um mich verändert ... Ein karger Bergfetzen. Vor wenigen Augenblicken war dieser noch nicht hier. Heidekraut. Widerborstig hielt es sich in den Spalten.
Da war eine Schlacht – ich versuchte, mich zu erinnern. Franken, Karl, Araber, vieles tauchte nach und nach vor meinem geistigen Auge auf. Mein Arm tat höllisch weh. Ich besann mich auf den geschmolzenen Stahl, der sich über ihn ergossen hatte, strauchelte und ließ mich ins borstige Buschwerk fallen. Langsam stabilisierte sich mein Kreislauf.
Lichtreflexe. Wurden sie von der aufgehenden Sonne, deren Strahlen sich in den Felsen brachen, verschleudert? Mir war, als befände ich mich in einem Raum, der von einer irren Beleuchtung durchflutet wurde.
Vorsichtig erhob ich mich. Die Felsformationen, die zum Greifen nahe waren, verschoben sich in meinem Bewusstsein. Wieder hielt ich inne, bis sich alles beruhigt hatte. Behutsam tastete ich mich vorwärts, griff von Gestrüpp zu Gestrüpp, das mir etwas Halt gab. Ich fürchtete die nahen Felsabbrüche. Instinktiv wandte ich mich den flacheren Höhenlagen zu, um nicht abzustürzen.
Mittelgebirge. Das war eindeutig. Durch Ginstersträucher kämpfte ich mich vorwärts, hielt immer wieder inne. Ein Wald hob sich in der Ferne ab. Wäre ich in ihm besser geschützt?
Beim Näherkommen spielte auch er mir einen Streich. Knorrige Stämme erhoben ihre begrünten Häupter, die sie zuvor tief zur Erde geneigt hatten, und nahmen Menschengestalt an. Wie sie so vor mir standen, erinnerten sie mich an die Luftgestalten, die ich einst gefürchtet hatte.
Ich wischte mir die Augen. Nein, ein biederer Wald lag vor mir. Konzentriert rief ich mir die Realität zurück. Es gelang, doch sobald ich mich weiter vorwagte, drohten mir die Täuschungen erneut, verstärkt, wilder.
Ich blieb stur, und bald stand ich direkt vor einem der Stämme. Ich umarmte den Ersten, strich über seine Rinde und näherte mich auf diese Weise langsam der Normalität. Nichts war mehr ungewöhnlich. Das finstere Gehölz besänftigte mich.
Immer wieder schaute ich auf meinen verwundeten Arm. Er brannte schier unerträglich. Um weiterzukommen, musste ich mich durch abgestorbenes starres Fichten- und Tannenastwerk zwängen – wie scharfe Messer stachen die ausgedörrten Enden in meine Wunde.
Abgekämpft blieb ich stehen, als ich die Anhöhe des Bergrückens erreicht hatte. „Die Schlacht ist zu Ende, du bist in Sicherheit“, der Satz verfolgte mich weiterhin. Wer war sie, die mir diese Worte so vertraut auf den Weg gegeben hatte. Von welcher Schlacht sprach sie? Ich zermarterte mir den Kopf, doch je intensiver ich mich abquälte, umso mehr entglitt mir jeder Ansatzpunkt.
Woran konnte ich mich überhaupt erinnern? Da waren Menschen, die sich aufs Haar glichen und mich in einer Stadt in die Enge drängten. Das Bild war deutlich. Geschah dort etwas mit mir? Ein Schwert, ein Blitz, der geschmolzene Stahl … erkannte ich glasklar.
Eine Windböe jagte durch den Wald, die Kronen der Bäume wirbelten durcheinander, Äste und Stämme rieben sich knarrend, mit stöhnendem Laut aneinander. War ich hier doch in Gefahr? Wie leicht konnte einer der Riesen entwurzelt werden, oder es brach ein Ast. Wäre ich in einer Senke besser aufgehoben?
Ein schwaches Gefälle führte in ein Hochtal, das einen langgestreckten, schmalen See versteckte. Die Gelegenheit nutzte ich und kühlte meinen Arm. Als sich die Wasseroberfläche wieder beruhigte, bemerkte ich in der Tiefe zwischen dichtem Tang ein Gesicht. Es hatte die Züge einer alten, nahezu versteinerten Frau. Sie erinnerte mich an jemanden. Intensiv visierte ich sie. Sagte sie etwas? Ja, tatsächlich erreichten mich Worte.
„In zwei finde die 72. Der zwei bleibe treu.“
Voller Spott begann die Grimasse zu lachen. Ich ergriff, durchdrungen von Ablehnung, einen Stein und zerstörte die Erscheinung.
Warum berührte mich der Satz so intensiv? Verband ich etwas mit den Worten? Enge fühlte ich, Dunkelheit, einen Raum, Spinnweben - und alles doch mitten in Gottes Natur. Was sich in den folgenden Stunden in meinem Geist abspielte, war äußerst beklemmend. Ich hatte ernste Bedenken, dem Wahnsinn oder einer seltsamen Schizophrenie verfallen zu sein.
Während ich am Ufer des Sees entlang stolperte, spielten mir pausenlos Trugbilder einen Streich. Es kam so weit, dass die Erscheinung dieser alten Frau sich wiederholt aus dem Unterholz erhob und in irgendeine Richtung wies, um sich danach wieder in nichts aufzulösen.
Plötzlich bildete ich mir ein, in die Augen eines verlassenen Menschen zu sehen, der zu einem Kreuz geführt wurde. Ein weiterer Herr, in orientalischem Gewand, redete auf mich ein. Was wollte er mir erklären? Mir fehlte jegliche Basis, irgendetwas zu verstehen. Neue Wahnvorstellungen - durchgedrehten Personen, die in Kirchengebäude eindrangen, Bilder zerschlugen, mit schwerem Gerät Teile aus den Wänden brachen und Mosaike zertrümmerten – verwirrten mich mehr und mehr und erfüllten mich mit lähmender Angst. Je mehr die Eindrücke in mir wüteten, umso verstörter und planloser irrte ich umher. Immer wieder hielt ich inne und umarmte Stämme, die mir die einzige Sicherheit gaben.
Der Wald lichtete sich. Ich schaute über ein weites Land. Von einer kleinen Anhöhe herab, die sich zu meiner Rechten erhob, meinte ich eine Stimme zu hören.
Konnte ich den Wahnsinn abstreifen, wenn ich unter Menschen kam? Jeden Versuch, um zur Normalität zurückzufinden, musste ich ergreifen. Also stürmte ich aufwärts und gelangte bald auf einen kleinen kahlen Bergkegel.
Ein massiger aufrechtstehender Stamm beherrschte die Oberfläche. Wundersame Zeichen waren in ihn geschnitzt.
„Den Göttern sei Dank, du bist hier!“
Ich erschrak bis tief in die Seele. Eine junge Frau stürmte auf mich zu und fiel mir erleichtert um den Hals. War sie es, die mir kurz zuvor die Worte von Kampf und Sicherheit zugeworfen hatte? Ich versuchte, ihr Gesicht in Erinnerung zu rufen, und trat einige Schritte zurück.
„Du kennst mich? … Oder?“ Verunsichert hielt sie inne.
Ich las eine tiefe Enttäuschung in ihrem Blick. „Manuel was ist mit dir?“ Tränen bildeten sich in ihren Augen. „Du weißt nicht, wohin mit mir?“
Verzweifelt verneinte ich ihre Frage.
„Was ist passiert?“ Wieder stockte sie. „Du weißt es nicht?“
„Das hier“, ich zeigte ihr meinen Arm. „Es war Feuer auf ihm. Sonst kann ich mich an nichts erinnern. Wer bist du?“
„Eine Freundin, ...die beste überhaupt, glaube mir“, beteuerte sie, wobei sie ihre Erschütterung nicht verbergen konnte.
Unser Gespräch wurde unterbrochen. Aus verschiedenen Richtungen traten schwer bewaffnete Männer dazu. Die blonden Haare hingen ihnen weit über die Schultern. Ein hochgewachsener Hüne fragte: „Herrin, du fürchtest das Schlimmste?“
Die Angesprochene war jedoch derart von unserer kurzen Unterhaltung benommen, dass sie keine Antwort fand.
„Wo sind wir überhaupt?“, versuchte ich Anschluss an unser Gespräch zu finden.
„Siehst du sie nicht?“ Sie zeigte auf den hohen Stamm. „Die Irminsul!“
„Sie wird uns beschützen“, warf der Fremde ein. „Sie ist ein Geschenk der Götter. Sie wird ihren Zauber entfalten und uns beistehen. Der Fluch Wotans wird die Eindringlinge zu Stein erstarren lassen.“
„Die Götter sind mächtig, aber ich höre ebenfalls das Weinen der Nornen. Die Schicksalsgöttinen flehen uns an weiterzuziehen. Bitte Korngard, meide den Kampf“, bat das Mädchen inbrünstig.
„Das Heiligtum wird uns und wir es beschützen. Komme, was wolle.“
„Mein Wort steht dagegen, und du weißt, was das bedeutet“, fuhr sie den gestandenen Mann scharf an.
Die Aufregung, die Unsicherheit, die in den Kriegern kochte, war mir nicht entgangen. Brechende Äste, Rufe, Geschrei verrieten die nahende Gefahr. Blitzschnell griffen die Recken zu ihren Schwertern.
„Manuel darf nichts geschehen! Bringt ihn weg!“, rief die Frau. Für eine Flucht war es zu spät. Hochgerüstete Reiter mit massiven Rüstungen, brachen aus dem Gestrüpp und schlugen wahllos auf die Anwesenden ein. Verloren stand ich unter den Truppen.
Die Angreifer waren sowohl zahlenmäßig als auch an Kampferfahrung weit überlegen. Fochten die Verteidiger auch noch so wacker, gegen diese erdrückende Übermacht konnten sie wenig ausrichten. Einer nach dem anderen sank getroffen zur Erde. Die Letzten mühten sich tollkühn, als ein mächtiger Reiter in strahlender Rüstung auf dem Kampfplatz erschien. Mir kam es vor, als wäre er Odin persönlich.
„Brennt sie nieder!“, übertönte er sein mordendes Heer, den Blick auf die Irminsul gerichtet. Dann presste er die Fersen in die Lende seines Pferdes und trieb es zurück in die Richtung, aus der er gekommen war.
Äxte krachten in das Holz der Irminsul. Der riesige Stamm neigte sich und stürzte dann um. Sein Aufschlag lähmte die letzte Hoffnung der Verteidiger. Hatten die Götter sie aufgegeben? Würde Wotan diesen Anschlag auf seine Söhne ungestraft lassen? Warum öffnete sich nicht der Himmel? Wo blieb Donar, der mit einem Wink, die Feinde zerschmettern konnte?
Nichts geschah. Ein Krieger an meiner Seite zog ein Messer aus seinem Bund. „Keinen Franken lasse ich an mein Leben!“, rief er triumphierend und drückte sich den Stahl ins Herz.
„Küsse das Zeichen Enkis!“, gellte die Frau, die bemüht war, sich aus einer Enge zu befreien.
„Wovon sprichst du?“, schmetterte ich zurück.
„Das Amulett!“
Überrascht ertastete ich an meiner Brust einen Gegenstand, riss ihn aus dem Hemd, doch ehe ich es an den Mund führen konnte, stockte mein Blut. Ein markerschütternder Schrei. Ein Speer hatte die Maid durchbohrt. „Weg! Weg!“, las ich in ihren Augen, bevor sich ihr Glanz verlor, und sie leblos zur Erde sank.
Zu ihr zu kommen war unmöglich, zwei der Aggressoren knieten sich vor ihr nieder, um zu prüfen, ob sie ganze Arbeit geleistet hatten. Das Teil in meiner Hand begann sich aufzulösen, feinsten Staub wirbelte der Wind in alle Richtungen. Mir war in dem Moment, als risse es mir die Seele in tausend Stücke.
Das Hauptaugenmerk der Angreifer lag auf der Irminsul. In lodernde Flammen wurden gewaltige Stücke geworfen. Das konnte meine Chance sein! Ich rutschte rückwärts aus der Gefahrenzone, übersah jedoch einen Abbruch, fiel zwei Meter in die Tiefe und wurde glücklicherweise von einem Holunderbusch aufgefangen.
Nichts gebrochen, attestierte ich. Schürfwunden, etwas Blut. Auf und davon, sagte ich mir.
Außer Atem erreichte ich das Tal und ließ mich ins hohe Gras fallen.
Das alles, was um mich geschehen war, war nicht fassbar. Die junge Frau – ständig hatte ich ihr Bild vor mir, der Speerwurf, der Schrei. Sie hatte mich gekannt, wollte mich schützen. Das Amulett – was hatte es damit auf sich? Alles, was geschehen war, brannte sich in mein Herz, und doch verstand ich es nicht. Zerbrechlich, sanft und würdevoll war sie aufgetreten. So prägte sie meine Erinnerung. Trotz der Trauer, die sich meiner bemächtigte, blieb sie eine Fremde. Keinen Impuls der Vertrautheit konnte ich erkennen.
Ich rollte mich gleich einem Fötus ein, presste die Arme über den Kopf, wollte all das, was ich eben erlebt hatte, von mir fernhalten.
Wie lange ich verängstigt in der Position verharrt hatte, wusste ich nicht.
Es dämmerte.
Als ich mich wieder aufraffte, war ich weiterhin in meinem Albtraum gefangen. Ich irrte ziellos umher, bis der überaus helle Sternenhimmel mir einen Trampelpfad beleuchtete. Ich folgte ihm auf eine Anhöhe zu einer verlassenen Ansiedlung.
Bis auf die Grundrisse lag dort eine Burg in Schutt und Asche. Ich schrie auf, als ich über einen Erschlagenen gestolpert war. Neben toten Soldaten in zertrümmerten Rüstungen fand ich nach und nach Personen in Alltagsgewändern, Frauen, Kinder. Eine grausame Metzelei hatte sich auch hier zugetragen. In welchem Inferno war ich angekommen?
Diesem Anblick war ich nicht gewachsen. Wie im Wahnsinn rannte ich den Abhang hinab, stolperte, rutschte, war bald wieder im Tal, rannte und rannte, bis mir in einer Ebene der Atem versagte. Rastlos, wenn auch langsamer irrte ich weiter.
Ständig tauchten neue Bilder in meinem Bewusstsein auf, mit denen ich kaum etwas anfangen konnte. Schreckensgemälde durch und durch. Unverkennbar war, dass ich in sie eingeflochten war.
Dem allen wollte ich entkommen. Doch wie? Nochmals rannte ich weiter, besann mich jedoch nach einer guten Meile. Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche waren dahin.
An einem kleinen See starrte ich verloren auf den leichten Wellengang.
An einem der folgenden Abende roch ich Feuer, dann angebranntes Fleisch. Hinter einer Reihe dunkler Hainbuchen spürte ich, vom Fackelschein angestrahlt, eine kleine Gruppe von Männern auf. Mein Hungergefühl ließ mich jede Vorsicht vergessen. Langsam, mit gesenktem Kopf, ging ich auf sie zu. Sie sprangen erschrocken auf und griffen zu ihren Streitäxten.
Ich blieb ohne Anzeichen einer Verteidigung gefasst und unerschütterlich stehen. Da ich waffenlos und zudem in zerfetzten Stoffen vor ihnen stand, beruhigten sie sich sofort. Erst jetzt fielen mir Frauen und Kinder auf, die geschützt im Schatten lagerten. Keine Gebäude. Waren sie ebenfalls auf der Flucht?
Gelassen setzte ich mich nieder, als ob ich seit Jahren zu ihnen gehörte. Dass alle verunsichert waren, muss ich nicht betonen.
„Fremder, wer bist du? Woher kommst du?“, wollte einer wissen.
Ich schaute zu ihm auf und wartete mit einer Antwort. Gespannt hefteten sich alle an meine Lippen. „Sie haben sie zerstört“, begann ich vorsichtig.
„Wovon sprichst du?“
„Von der Irminsul.“ Die Erschütterung, die aus meinen Worten herauszuhören war, berührte sie merklich. Ich hatte den besten Einstieg erwischt.
„Die Weltensäule, die fest verwurzelt uns mit den Göttern verband - sie ist gefällt. Wir wissen es“, sinnierte ein älterer Mann. „Was muss noch alles geschehen, damit der Fluch der Götter sie trifft? Es ist ein mörderisches Volk. Ziu, Donar, Tanfana, Frija, wo seid ihr! Wodan, wo versteckst du deine Heere?!“
„Selbst Donars Eiche wurde geschlagen“, erinnerte sich ein weiterer.
„Von einem, der sich Priester nennt.“
„Bonifatius soll er heißen, so wird erzählt.“
Immer vertrauensvoller gaben sich die Menschen und banden mich am Ende in ihren Kreis ein. Einer übergab das Wort dem anderen. Aus ihren Ängsten und Gedanken entstand eine kleine Geschichte.
„Die Götter gaben den Friesen die Macht in die Hände, den Unheilvollen zu töten.“
„Bonifatius?“, fragte ich nach.
Sowie ich den Namen gehört hatte, blitzte in meinen dunklen Erinnerungen ein flüchtiger Lichtschein auf und beleuchtete weitere Begriffe, die ich mit Königen, zumindest Herrschern in Verbindung brachte: Pippin, Karl Martell, Merowech.
Den Umstehenden fiel auf, wie ein Beben durch meinen Körper zog. „Holt Wasser!“, rief eine ältere Frau, und sofort erhob sich eine der Jüngeren und stellte wenig später einen Krug vor mir ab.
„Ihr seid keine Friesen?“, versuchte ich abzulenken.
„Fürwahr, das sind wir nicht. Wir gehören dem Sachsengeschlecht an.“
„Du hast sie gesehen?“, drängte sich ein alter, zahnloser Kerl in die Runde.
„Was willst du wissen?“, schaute ich zu ihm auf.
„Die Irminsul. Du hast sie fallen sehen?“
„Vor meinen Beinen schlug sie auf.“
„...und er war selbst dabei?“
Was sollte ich antworten? Alles war mir fremd.
„Karl, der König der Franken?“, präzisierte ein aufgeschlossener junger Kerl.
Unwillkürlich dachte ich an den gewaltigen Reiter und bejahte die Frage. Die vielen Erzählungen und damit verbundenen Leiden, die sich nach und nach anschlossen, sammelte ich hellwach ein. Nebenbei verschlang ich manchen Happen, der auf einem Holzbrett mir vor die Beine gelegt wurde.
All das, was mir zugetragen wurde, verarbeitete ich in den nächsten Tagen. Merowech, war einer der Namen, an dem ich mich festhielt. Weitere wuchsen aus dem Wortsamen – Chlodwig, Chlothar, Childerich – und plötzlich hatte ich ein ganzes Herrschergeschlecht vor meinen Augen, das fahl und kraftlos auf das eigene Ende wartete. Daneben erhoben sich einflussreiche Männer, und immer wieder tauchte der Begriff Karl auf. Nicht gewahr wurde mir, dass ich an jenem Tag, als die Säule Irminsul geschlagen wurde, einen kurzen Moment vor dem mächtigen Gebieter gestanden hatte, der unerschütterlich seinen Platz in der Geschichte fand: Kaiser Karl der Große.
Am folgenden Morgen riefen die Männer zur Jagd. Die Fleischvorräte mussten aufgefrischt werden. Ich nahm einen ihrer Bogen derart ungeschickt in die Hand, dass sie mir einen Umgang mit Waffen kaum zutrauten.
„Der verscheucht uns die Tiere“, lästerte ein Kraftprotz.
Ich büßte bei allen Beteuerungen an Achtung ein. Am Ende war es mir gleich.
Innerhalb der Gruppe herrschte eine große Rivalität. Pausenlos kam es zu Wortgefechten und Aggressionen. Das zeigte mir, wie angespannt die Situation war. Diese Sachsen hatten ihre Heimat verloren. Manche bestanden auf eine Rückkehr in ihren Stammsitz. Von Egloffs sprachen sie. Dort wollten ihre verwüsteten Häuser erneut aufbauen. In anderen steckte große Angst, und sie dürsteten nach Sicherheit. Diese trieb es fort. Im Herzen des Sachsenreichs erhofften sie sich eine bessere Zukunft.
Der alte Zahnlose nahm mich zur Seite. „Junge, du hast uns nicht erzählt, von woher dich dein Weg geführt hat.“
„Ich weiß keine Namen für die Orte.“
„Was für ein kluger Satz“, jubelte er. „Ich sage es stets, die meisten der ganzen Namen sind unsinnig. Vermutlich wirst du aber doch etwas aufgeschnappt haben. Bist du nirgends geboren?“
Ein herzliches Lachen schenkte ich ihm. „Ich wurde in Erdas Schoß gelegt.“
„Wie wir alle!“, jubelte er erneut. „Dann bist du Sachse.“ Eine Erwiderung verbiss ich mir.
Auf einmal schrien die Kinder auf. Aus dem Schatten eines Tollkirschenstrauches entschlüpfte ein hochgewachsener älterer, dennoch rüstiger Mann und trat entschieden in die Mitte. Die Frauen wichen panisch zurück, schlossen die Kinder in ihre Arme, die wenigen Männer, die von der Jagd zurückgeblieben waren, versuchten, ihn auszugrenzen.
Der Fremde passte so gar nicht in diese Welt: keine Rüstung, sparsamste Kleidung aus Leinenstoffen, keinesfalls Leder, das Gesicht schmal mit zerzausten, dürftigen Bartspitzen, die ungepflegt im Zufall endeten. Auffällig war allein der Speer, den er bei sich trug.
„Ich bringe ihn dir zurück.“ Bei dieser merkwürdigen Begrüßung schlug er die Waffe vor meinen Beinen tief in die Erde.
Der Zahnlose schien am wenigsten beeindruckt zu sein und begann sofort abzuwehren. „Nein mein Freund, du irrst dich. Er kann mit so etwas nicht umgehen. Waffen sind für ihn so etwas, wie es für mich Rätsel sind. Mit manchen Dingen kann man einfach nichts anfangen.“
Der geheimnisvolle Fremde ließ sich nicht beeindrucken, setzte sich auf einen morschen abgestorbenen Baumstumpf und wartete ab.
„Was willst du noch?“, wunderte sich der Alte und versuchte auf andere Weise, sich Gehör zu verschaffen. „Die Stange hast du abgeliefert. Es hat uns gefreut. Wir wünschen dir einen schönen Tag.“
„Fürchtest du mich?“ Der Fremde blieb gelassen.
„Ich? Wohin denkst du? Was weißt du schon von mir?“
„Du bist Waldemir, ein Sohn der Engern, dem tapferen Stamm der Sachsen!“
„Wie? Er kennt mich!“ Der Alte sprang auf, wobei in seinen Worten so etwas Ähnliches wie Triumph aufflackerte.
„Beruhige dich Alter. Nicht dich suche ich. Manuel braucht mich.“
„Der Junge? Er hat einen Namen? Es gibt viele unsinnige Namen. Warum soll‘s ihm erspart bleiben.“
Der Fremde lachte laut auf, womit er den unheimlichen Bann, den er aufgebaut hatte, sprengte. Die Menschen wurden zutraulicher und wagten sich näher.
„Es hat einen tieferen Grund, warum du gekommen bist“, brachte sich der Alte wieder in den Mittelpunkt.
„Manuel hat viele Fragen - die müssen beantwortet sein.“
Die ganze Situation blieb für mich unfassbar. Ich hatte keine Vorstellung, nach was ich mich hätte erkundigen können. Der Fremde roch das offenbar. Er ergriff eigenständig Themen und gab ihnen Farbe. Alle hingen an seinen Lippen. Er erzählte von alten Völkern, die es längst nicht mehr gab, von Sippen, Stämmen, die sich bekriegten, Herrschern, die weit weg, unerreichbar im Orient exotische Reiche schufen.
Einzelne Jäger, die zurückkamen, störten die Spannung, ließen sich aber schnell von den Worten des Fremden in den Bann ziehen. Mit unendlich vielen Namen und Begriffen war dessen Vortrag gespickt. Deckte er Geschehnisse auf, die in meinem Innern verschüttet lagen? Füllte er sie mit neuem Leben? Mir war auf einmal so…
„Warum erzählt er das?“, warf einer der Jäger nach einiger Zeit ein, womöglich hatte er zwischenzeitlich Hunger.
„Sei still! Der Junge muss das alles wissen!“, wies in der Alte zurecht. Der Frager gab sich damit zufrieden und lauschte weiter.
Aus der grausamen und doch anrührenden Erzählung ergab sich das Bild einer Welt, die in sich zusammengebrochen war, und die in ihrem Schutt neue Blüten trieb. Als zum ersten Mal der Begriff „Franken“ fiel, ahnte ich, wohin die Reise gehen sollte. Es lag dem Wundersamen daran, verständlich zu machen, was um mich geschehen war. Während ich diesen Karl vor mir sah, der die Irminsul verbrennen ließ, berichtete der Erzähler vom Geschlecht der Merowinger, die Könige der Franken waren. Naiv vermutete ich, dass jener Karl, der vor mir hoch zu Ross saß, ebenfalls ein Merowinger sein musste. Mit diesem Verdacht hielt ich nicht hinterm Berg.
„Karl, den König, habe ich gesehen“, fiel ich dem Fremden ins Wort.
Der schaute mich milde an. „Manuel, welchen Eindruck hattest du von ihm?“
Wieder nannte er meinen Namen, das verwirrte mich. „Weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll.“ Ich stocherte gedankenversunken um eine konkrete Antwort herum. „Dominant“, fällt mir ein. „Der Anblick seiner Person polarisiert.“
„Der Weg Karls ist schwer einzuschätzen. Es scheint, als gelänge es ihm, seinem Vater an Macht ebenbürtig zu werden. Ob er jemals dessen Bedeutung erreichen wird, wage ich zu bezweifeln.“
„Seines Vaters? Pippins?“, warf einer der Anwesenden ein. „Schon der hat regelmäßig unser Land überfallen. Ihm vermochten wir zu trotzen. Erfolgreich war der nicht.“
Mich verwirrte die Erzählung. Ständig tauchte der Name Pippin auf, und es dauerte lange, bis ich begriffen hatte, dass der Fremde zwischenzeitlich vom dritten Pippin sprach. So hieß der Vater des Karls, den er ebenso Martell nannte und der eine Schlacht gegen Araber geführt hatte, und Pippin hieß auch dessen Sohn, von dem jetzt gesprochen wurde. In der Familie schienen sich die Namen Karl und Pippin pausenlos die Hand zu geben.
„Wenn er in diesem Land zu keinem Erfolg kam, so hat er doch Maßstäbe gesetzt, die unbestritten sind“, behauptete der Fremde. „Wo war ich stecken geblieben? Oh, ich hatte erzählt, wie jener Karl Martell das Araberheer nach Iberien zurückdrängte und das ehemalige Aquitanien von ihnen säuberte. Er stellte das Reich der Franken auf stabile Beine, wurde allerdings nie selbst König. Er blieb Verwalter der merowingischen Könige. Sein Amt vererbte er den Kindern Pippin und Karlmann, die beide fromm im Sinne der strengen angelsächsischen Missionare erzogen wurden. Karlmann war für diese Aufgabe nicht geschaffen. Er widersetzte sich der Verantwortung und fand in einem Kloster seine Erfüllung, zuerst in Sorante, dann auf dem Monte Cassino.“
Wieder entflammte bei dem Begriff ein Bild in meinem Kopf.
„Ein Jahr nach dem Tod des Vaters zog Pippin, der darauf die ganze Macht innehatte, gegen die Bayern. Der Angriff stieß auf Ärger am päpstlichen Hof. Ein Legat gar verbot Pippin die Kampferöffnung. Pippin ließ sich nicht abschrecken. Ihm gelang ein Sieg. In Rom musste man erkennen, dass Gott hinter Pippin stand.“
Der Fremde sah sich in der Runde seiner Zuhörer um.
„Warum erzähle ich das? Pippin war sich der Tatsache bewusst, dass an ihm, dem Verwalter des fränkischen Königreichs, kein Weg vorbeiführte, und so stellte er selbstbewusst die Frage an den Heiligen Vater: Wer soll regieren? Der König, damals Childerich III, der Merowinger, oder eben er, der die wirkliche Macht hatte. Papst Zacharias wusste genau, was er tat, als er entschied, dem Geschlecht der Merowinger die Vorherrschaft abzusprechen. Er roch die Gefahr, die von Aistulf, dem Langobardenführer, ausging, der auch bald darauf Ravenna, die Schaltstelle Ostroms im Westen unterwarf.“
Wieder machte der Erzähler eine kurze Pause und ließ seine Worte wirken.
Dann fuhr er fort: „Pippin hatte die Antwort des Papstes erwartet und ließ ohne zu zögern König Childerich die Haare scheren und ins Kloster werfen. Er selbst, somit Stammvater der Karolinger, griff nach der Krone. Sein Bischof, Bonifatius, so wird erzählt, salbte Pippin im Auftrag des Heiligen Vaters und erhob ihn auf diese Weise zur Königswürde.“
„Und dieser Aistulf? Er wurde eine Gefahr für den Papst? Hatte er gar König Pippin zu fürchten?“
„Die Päpste hatten in der Zwischenzeit gewechselt. Die direkte Bedrohung traf Papst Stephan II. An Ostrom wäre es gewesen, zu helfen. Aber dort hatte man andere Probleme. Stephan blieb nur, sich an Pippin zu wenden. Der empfing seine Heiligkeit ehrfürchtig, ergriff auf dem Weg zu seinem Haus die Zügel des päpstlichen Pferdes und führte es selbst. Ein Freundschaftseid zwischen beiden markierte die neue Zeit. Pippin versicherte dem Papst, ihm weltlichen Trost zu gewähren. Im Gegenzug wurde Pippin und seinen Söhnen Karl und Karlmann der Titel Patricius Romanorum geschenkt.“
„Pippin besiegte Aistulf?“
„Es waren zwei Anläufe nötig, um ihn endgültig zu lähmen. Der Erfolg stieß in Ostrom bitter auf. Die aufgehende Blüte des Frankengeschlechts wurde deutlich. Ein Anspruch auf Rom war längst nicht aufgegeben. Pippin betonte dagegen selbstbewusst, er hätte das Land für den Heiligen Petrus und zu Gunsten des lebenden Papstes erkämpft, keineswegs für den fernen östlichen Kaiser. Der Papst versicherte zudem, Jesus Christus würde die Franken lieben.“
„Pippin lebt aber nicht mehr“, warf ich ein. Es war Karl, den ich gesehen hatte. Er war für mich keine fiktive Person. Erzählungen über ihn konnte ich mit einem Gesicht verbinden. „Karl hat die Macht geerbt?“
„Er und sein Bruder Karlmann. Ein übergroßes Reich fiel den beiden zu. Pippin hatte die Alemannen und Aquitanien fest eingebettet.“
„Dann ist dieser Karl nicht alleiniger König.“
„Zwischenzeitlich schon. Im vergangenen Jahr starb Karlmann. Die Liebe der Brüder zueinander hatte sich ohnehin in Grenzen gehalten.“
„Kommt zwischen Brüdern vor.“
„Von Anfang an umschlichen sie sich wie zwei blutrünstige Raubkatzen.“
„Wer von uns Sachsen hätte gedacht, dass Karl uns zur tödlichen Gefahr würde!“, warf einer der Krieger ein, „Hat er nicht mit seinen Langbärten genug zu schaffen?“
„Da muss ich dir beipflichten“, nickte der Erzähler. „Nachdem Aistulf besiegt war, kam es zu einer Hochzeit zwischen Karl und der Tochter des Langobardenkönigs Desiderius. Das stärkte deren Position, und bald machten die Langbärte erneut Druck auf den Papst, wissend, Karl auf ihrer Seite zu haben. Karlmann lebte in jenen Tagen noch und ergriff Partei für den Heiligen Vater. Wie gesagt, als Karlmann starb, änderte sich die Situation vollkommen.“
„Karl fiel über den Papst her? War es so?“, folgerte ich.
„Im Gegenteil, es geschah etwas absolut Unerwartetes. Karl trennte sich von seiner Frau. Die Scheidung muss barsch abgelaufen sein, denn sie flüchtete zu ihrem Vater Desiderius, der aus Wut vehement Partei für die Erben Karlmanns ergriff. Das ist das Letzte, was ich dazu sagen kann.“
„Du meinst, die Kinder Karlmanns sind in Gefahr?“
„In Lebensgefahr! Karl würde deren Ansprüche an das Reich nicht anerkennen. Er wähnt sich als Alleinerbe.“
Wie ein Blitz schlug in mir die Erinnerung an den blutrünstigen Herrscher ein. „Er wird sie töten, ganz sicher, so wie er diese junge wunderschöne Frau getötet hat.“
Der rührige Erzähler erschrak. „Was meinst du damit?“
Was wollte der Fremde von mir hören? Vor mir lagen Erlebnisse, Fragmente, die ich in keinen sinnvollen Zusammenhang bringen konnte.
„Ich kann von einer kleinen Anhöhe berichten“, stocherte ich herum, „dort, wo sich die Irminsul befand. Eine Frau sah ich und Krieger, die es schützen wollten.“
„Es waren Männer von unserem Stamm“, warf einer der Anwesenden dazwischen. „Sie alle wurden erschlagen!“
„Was geschah mit der Maid?“, brauste der Erzähler auf.
„Sie wurde ebenso getötet“, entgegnete ich leise.
„Weißt du, wer sie war?“
Die Frage traf mich in ihrer Vehemenz wie eine Drohung, ein Vorwurf. Ich sah mich in eine Ecke gedrängt. Hilflos schaute ich zur Erde. „Sie kannte mich...“ Die merkwürdige Gegebenheit mit dem Amulett kam mir wieder in den Sinn. „Die Halskette!“ Ich sprang auf. „Ich trug ein Steinstück am Hals. Sie rief mir zu, es zu berühren. Ich war zu langsam und weiß nur noch, wie sie ein Speer traf, und der harte Stein zu Staub verfiel.“
„Abgemagert, helle lange Haare, ein fahles eingefallenes Gesicht, Augen mit Blut unterlaufen?“
„So sah sie mich an.“
„Fairra!“, schrie der Fremde heraus und sprang verzweifelt auf.
„Du kennst sie?“
Mit beiden Händen packte er den Speer, den er mitgeführt hatte. „Wie soll es weitergehen?!“, brüllte er in die Unendlichkeit der Wälder.
Alle starrten ihn erschüttert an.
„Es ist dein Speer! Du wirst ihn brauchen!“, wandte er sich mir zu.
In dem Moment, in dem ich ihn berührte …
Kaiserkrone (799 n. Chr.)
… Wurde ich von einer unfassbaren Kraft zur Erde geworfen.
Ich verstand nichts. Wie konnte ich mich von Knall auf Fall zwischen unzähligen Gebäuden befinden? Vor mir lag der Speer, dahinter, ebenfalls dahingestreckt, der Fremde.
Die sächsische Sippe war verschwunden, anstatt derer stand an dieser Stelle ein prachtvoller Tempel. Er war umringt von alten Pinienbäumen und Oleandersträucher, die ihre Blüten eng geschlossen hielten.
Ich rappelte mich am Stamm einer der Bäume auf und versuchte, mit den Umständen klarzukommen. Der Fremde lag wie tot vor mir. War er derart heftig gestürzt? Ich beugte mich über ihn, in der Hoffnung ein Lebenszeichen zu finden. Ein fast lautloser Flügelschlag dicht über meinem Kopf schreckte mich auf. Eine Eule hatte mich mit ihrer Schwinge berührt und ließ sich auf dem Ast einer jungen Platane nieder, der sich weit nach unten beugte. Hatte sie keine Angst vor mir?
Auf unglaubliche Weise nahm das Tier wundersame menschliche Formen an, ohne dass sich der intensive Ausdruck ihrer Augen veränderte. Schon erinnerte mich der Vogel an die Frau, die ich wenige Tage zuvor hatte sterben sehen, erkannte dann sofort, dass ich es mir einbildete.
„Du musst dir um deinen Freund keine Sorgen machen“, brachte die Gestalt mit einer federleichten kratzigen Stimme hervor.
„Er lebt?“
„Solange du mich gewahrst, wird er ruhen, wie ebenso die ganze Welt den Augenblick nutzt, um durchzuatmen.“
„Was bist du für ein wunderliches Ding?“
Ihr helles Lachen frischte die düstere Stimmung auf. „Du siehst den Tempel vor uns? Er wurde Minerva geweiht, der Weisheitsgöttin der römischen Welt, dem Spiegelbild Athenes.“
„Bist du die weise Göttin?“
Bezaubert schenkte sie mir einen gütigen Blick und räusperte sich kurz. „Ich?“
„Ich traue es dir zu.“
„Meine Fähigkeiten sind begrenzter.“ Starr fixierte sie mich.
Gebannt erlag ich der eisernen Visitation. Gleichzeitig zog eine sonderbare Lebenskraft in meinen Körper ein. Der trübe Dunst, der jede Erinnerung vernebelt hatte, löste sich. Gallenbitterer Schleim füllte den Mund. Ich warf ihn aus.
„Pfui“, reagierte die zum Menschen gewordene Eule.
„Enetha?“, fand ich einen Namen.
„Puh, ein Schritt ist getan“, erwiderte sie zufrieden, verwandelte sich zurück, streckte ihre weiten Schwingen von sich, warf sich in die Lüfte und entfernte sich blitzartig.
Ich versuchte, mir klarzumachen, was geschehen war. Unzählige Erinnerungen, die in den vergangenen Tagen im Trüben gelegen hatten, tauten frisch, wie neugeboren auf und stabilisierten mein wiederkehrendes Bewusstsein.
Kaum war Enetha außer Sichtweise, als auch mein Begleiter zurückfand. Er stützte sich auf und wunderte sich nicht weniger über die neue Umgebung.
„Der Tempel der Minerva“, erklärte ich.
„Rom?“
Was alles verband ich mit dieser Stadt. Wie in einem bunten Strauß fächerten sich die Ereignisse vor mir auf, die Gesetzestafeln, Nero, das große Feuer, die Erlebnisse in Trajans Einkaufszentrum. Das alles berührte mich.
„Du kennst den Tempel?“ Ich sah es ihm an.
„Dunkel. Er wird seit langer Zeit nicht mehr genutzt. Nicht weit von hier, wenn du der Straße folgst, triffst du auf eine ehemalige Palastanlage, das Sessorium. Septimius Severus ließ den Grundstein legen. Ich meine, unter seinem Enkel Elagabal, endeten die Bauarbeiten. Später folgten Umbauten. Kaiser Konstantin funktionierte die Anlage zur Villa für seine Mutter Helena um, wobei - so kam es mir zu Ohren - ein Saal zur Kirche St. Croce in Gerusalemme ausgeschmückt wurde.“
„Schon gut. Was tun wir hier?“
„Langsam“, bremste mich der Alte. „Kaiser Septimius Severus: Sagt dir der Name etwas?“
Voller Spannung erwartete er eine Antwort.
„Wer weiß, womöglich bin ich ihm schon im Zweistromland begegnet.“
„Ist das nur so dahergeplappert oder steckt mehr hinter deinen Worten?“
„Es mag sich absurd anhören. Ich stand ihm gegenüber.“
Der Alte atmete auf.
„Sieh mich an. Findest du einen passenden Namen für mich?“
„Ich weiß nicht...“
„Pavavritti?“
Enttäuscht schüttelte ich den Kopf.
„Wir wollen von dem reden, was deine Erinnerung zulässt. Du nennst dich Manuel. Ist das dein vollständiger Name?“
„Manuel Jebich.“
„Famos. Wie sieht es damit aus: Perikles?“ Er hielt inne, fixierte mich, ich nickte. „Alexander, Hannibal, Cäsar, Hadrian, Iustinian, Muhammad, Chlodwig?“
Aufgeregt vermochte ich ihm bei jedem Namen zuzustimmen. „Ich kenne sie alle!“, rief ich am Ende aus.
„Olam, Muck, Weilei...?“
Hilflosigkeit.
„Atid? Chen Lu?“
„Wer sind sie?“
„Seraphin?“
„Auch er ist mir unbekannt.“
„Als Seraphina geboren, wollte der Vater einen Sohn erzwingen. Es gelang ihm nicht. Sie blieb Frau, abtrünnig, mutig.“
„Warum erzählst du mir das?“
„Was weißt du von deiner Aufgabe?“
„Mir ist keine bekannt. Will man mich töten?“, flüsterte ich.
„Wenn ja, wüsstest du warum?“
In meinem schattenhaften Bewusstsein entwickelten sich Bilder von Delphi und anderen Orten. Stimmen wisperten Seltsames, Unverständliches. Aus dem Wenigen gewann ich eine unerklärliche Gewissheit.
„Enetha“, brachte ich hervor und versuchte, mehr Licht in die Dämmerung zu bringen, „Enetha, ein Eulenvogel war es. Er brachte mir die Erinnerung zurück.“
„Enethas Weisheit verstand den Fluch, der dich belegt, teilweise zu lösen, zumindest so weit, dass du das Überlebensnotwendige um dich begreifst.“
„Ich erinnere mich an Barak, Krawan, Akabakar.“
Pavavritti atmete auf. „Dann sind wir ein beträchtliches Stück weiter“, merkte er an. „Eines musst du aber wissen: Du hast teure Freunde, die ihr Leben für dich aufs Spiel setzen. Ich bin einer von ihnen. Es gab Zeiten, da nanntest du mich Pava.“
„Dann müsste ich dich kennen?“, erwiderte ich traurig.
„Mich und viele mehr. Kopf hoch, Junge. Sie alle werden dich suchen und du wirst sie nach und nach zurückerobern?“
„Sie werden Fremde für mich sein.“
„Das werden sie.“
„Wie finden sie mich?“
„In einem Amulett waren die Freundschaften verschweißt.“
„Der Stein! Ein Zauber hat es zerstört.“
„Du sagest, wie Sand sei es in deiner Hand zerronnen.“
„Sind dann nicht auch die Freundschaften entglitten?“
„Keinesfalls. Hätte ich dich sonst gefunden?“
„Ich verstehe Vieles nicht.“
„Das Unfassbare macht uns zu dem, was wir sind.“
Von den wenigen Sätzen behielt ich einen bitteren Beigeschmack. Da waren Episoden, Erlebnisse, die deutlich in mein Bewusstsein zurückgefunden hatten, Bilder von Tieren, die untrennbar mit Vielem verbunden waren, dann aber Namen, mit denen ich nichts anfangen konnte.
„Wohin gehen wir? Was schlägst du vor?“, wechselte Pava das Thema.
„Enetha flog in diese Richtung.“
„So meidet sie das Zentrum“, stellte er fest. „Schließen wir uns ihr an.“ Er wandte sich um und schritt voraus.
„Hast du eine Ahnung, wohin wir dort kommen?“
„Die Kirche des heiligen Laurentius ist in der Gegend.“
„Ich gehe stets ins Ungewisse. Ist es so?“
„Wer tut das nicht? Vergiss deinen Speer nicht!“ Er zeigte auf die Waffe, die bislang unbeachtet blieb.
„Er hat eine sonderbare Wirkung auf mich.“
„Die Spitze hast du selbst geschlagen.“
Ich hob die Waffe auf und studierte die scharfen Kanten.
„Aus Flintstein, vor langer Zeit“, ergänzte er.
„Genau kenne ich die Stunde“, bemerkte ich stolz. Lächelnd ging er weiter.
Nach einer kurzen Wegstrecke standen wir von einem Tor, der Porta Tiburtina. Es durchbrach die wuchtige Stadtmauer und entließ uns aus der Stadt.
Kaum waren wir wenige Meter weitergezogen, als wir von Reitern zur Seite gedrängt wurden. In ihrer Mitte trieben zwei herausgeputzte Herren einen Würdenträger vorwärts, der zwischen ihnen eingekeilt war. Weitere Berittene folgten. Auf einen schrillen Ruf hin drangen von der Seite Männer in die Gruppe der Begleiter ein und versprengten sie. Den Geistlichen warfen sie vom Pferd und verprügelten ihn unbarmherzig. Der Wirrwarr endete damit, dass der arme Kerl auf ein Ross geworfen wurde, und die Meute mit ihm davonstürmte.
„Was war das?“
„Eindeutig eine Entführung.“
„Was tun wir?“
„Wie siehst du das Ganze? Meinst du, wir sind zufällig hier?“
„Kaum“, nahm ich an.
„Dann ist die Entscheidung gefallen: Nichts wie hinterher!“
Einige Pferde, die ihre Begleiter abgeworfen hatten, waren treu zurückgeblieben. Blitzschnell saßen wir auf den Tieren und nahmen die Verfolgung auf.
Unser Übereifer wurde nicht mit Erfolg belohnt. Zu schnell hatten sich die Flüchtenden aus unserem Gesichtsfeld gestohlen. Wir wussten nicht einmal, ob sie sich in die Weiten Latiums davongemacht hatten oder etwa einen Haken schlugen, um in die Stadt zurückzukehren.
„Was meinst du?“, fragte ich Pavavritti, nachdem wir einige Stunden ergebnislos herumgeirrt waren. Die Sonne stand hoch und stach, obwohl es relativ früh im Jahr war.
„Es macht keinen Sinn, willkürlich alles abzugrasen. Was hältst du davon, wenn wir uns ein wenig aufs Ohr legen und die Bilder sacken lassen. Uns wird etwas einfallen.“
Ich willigte ein. Gemeinsam warfen wir uns unter einen dürren Maronenbaum.
Nach einiger Zeit schreckten uns kurze markante Schläge auf.
„Merkwürdiger Specht…“, bemerkte ich scherzhaft.
„Das ist kein Tier. Da schlägt jemand Äste ab!“
„Brennholz?“
Wer braucht es nicht? Was hältst du davon, wenn wir uns nach Reitern erkundigen?
„Falls es ein Waldarbeiter ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass ihm im Dickicht jemand untergekommen ist.“
Wir folgten den Schlägen und fanden bald einen Mann, der ...
Mir stockte das Blut. Ich riss Pavavritti an der Schulter zurück.
„Was ist mit dir?“
„Zunderpilze.“
„Ja? Und?“
Für einen kurzen Moment war in mir mein Erlebnis in der Urzeit aufgeflammt, mit all den Grausamkeiten, die damit verbunden waren. „Ist schon gut“, beruhigte ich mich selbst. „Alte Narben.“
Pava legte mir tröstend die Hand auf die Schulter und schritt voraus.
Der emsige Kerl, der sich um die Pilze bemühte, war wenige Jahre älter als ich. „Was treibst du hier?“, sprachen wir ihn an
Der Waldarbeiter erschauderte tief in der Seele. „Wer seid ihr? Was wollt ihr?“, fuhr er uns an. „Lasst mich in Frieden.“
„Ruhig Blut, guter Freund, wir haben uns verirrt, haben dich gehört und wundern uns jetzt, was du hier treibst.“
„Pilze, ich schlage die Pilze vom Baum.“
„Das sehen wir“, lachte Pavavritti und hob einen der Schmarotzer auf.
„Was willst du mit dem Zeug? Es brennt schlecht, glostet nur. Öllampen bringen dir mehr“, ergänzte ich.
„Du Narr, weißt du nicht, was ein Zundelmacher treibt?“
„Weißt du es?“, wandte ich mich an Pavavritti.
Er zuckte mit den Schultern. „Lassen wir es uns erklären.“
„Leder.“
„Wie? Leder macht man aus Tierhäuten?“, entgegnete Pavavritti.
„Nicht ich. Hirsche und Rehe sind mir Freunde und im Wald willkommen. Ich verstehe mich darauf, Leder aus den Pilzen zu ziehen. Schon mein Vater, Großvater...“
„Familiengewerbe, ich verstehe. Und das Zeug taugt etwas?“
„Fragt die Mönche. Sie loben mein Werk und belohnen mich reich mit Brot und ihren Gartenfrüchten.“
„Wir wollen dir glauben. Hast du, Herr der Wälder, etwas von Reitern mitbekommen, die es pressant hatten?“
„Reiter?“
„Reiter.“
„Wie viele?“
„Fünf oder sechs. Wir können es nicht sagen. Sie führen einen Gefangenen mit sich.“
„Hier nicht. Das ist der falsche Wald. Sucht euch einen anderen Wald. Fragt dort.“
„Manuel, wir helfen ihm, die Pilze zu tragen.“
„Sie gehen euch nichts an. Es sind meine Pilze.“
„Wir machen sie dir nicht streitig.“
„Sucht ihr eure Reiter!“
Pava blieb hart. „Geh voraus, du kennst den Weg!“ Er sammelte einige der zähen Gewächse ein.
„Was wollt ihr bei mir?“
„Wir helfen dir bei der Arbeit und als Gegenleistung befragst du die Mönche.“
„Nach Reitern?“
„Du hast es verstanden.“
Kurz taumelte er hin und her, gab sich dann aber geschlagen. Vollbeladen trugen wir die klobigen harten Gebilde in seine kleine Hütte, die lediglich aus einem großen Raum bestand. Entlang der Wände waren ausladende lederartige Teile gespannt. In der Mitte dominierte eine Werkbank, auf der Schneidwerkzeuge auffielen.
Ich sah ihn zweifelnd an. „Solche Lederflecken gewinnst du aus Pilzen? Das nehme ich dir nicht ab.“
„Und doch ist es so!“, triumphierte er. „Schlagt sie am Rand auf.“
„Wir? Du bist Zundelmacher.“
„Ich mache mich auf den Weg zu den Patres. Wenn ihr es schon so wichtig habt, dann will ich einen Nutzen davon haben.“
„Nimm mein Pferd“, bot ich ihm vertrauensvoll an.
„Oh, nein, bitte nicht. Ohne einen Teufel zwischen den Beinen fühle ich mich besser. Die Nacht wirft schnell ihre Schatten. Zuvor will ich zurück sein, zumal ich euch gerne auf dem Weiterweg sehen möchte.“ Er packte einen Schochen seiner fertiggestellten Lederteile, wickelte sie zu einem Pack und band sich diesen geschickt auf den Rücken.
„Wir brauchen genauere Anweisungen, um unser Werk zu deiner Zufriedenheit auf die Reihe zu bringen.“
„Schneidet die Pilze an der Seite auf und zieht das lederige Innenleben heraus. Es lässt sich bis zur zehnfachen Größe dehnen.“
Mit dieser dürftigen Beschreibung mussten wir uns zufriedengeben. Er hatte es eilig und ließ sich auf keine Gegenfrage ein.
„Da haben wir uns ein mistiges Geschäft eingehandelt. Der weiß genau, warum er flieht“, lästerte Pavavritti.
Die harten Klöße waren kaum zu öffnen. Ich wunderte mich, wie geschickt sich damals die Menschen in der Steinzeit angestellt hatten. Wir quälten uns mit dem Stahl, der zur Verfügung stand. Gottlob erkannten wir im Innern des Gewächses ein fleischartiges Gewebe, das sich tatsächlich leicht in die Weite ziehen ließ.
„Die Urmenschen haben darübergepinkelt“, erzählte ich Pavavritti nebenbei und erklärte ihm die Gründe. Überhaupt vertrieben wir uns die Zeit mit Erzählungen und vermochten, manche herbe Gegebenheit auf einen heiteren Nenner zu bringen. Stunden vergingen. Es war längst dunkel, als unser Arbeitgeber erschöpft in der Tür stand.
„Der Papst wurde entführt.“
„Wie?“ Die Botschaft schlug wie eine Bombe ein.
„Papst Leo III. Als ich im Kloster stand und meine Lederstücke ausbreitete, knisterte es schon nach Neuigkeiten. Mir entgeht so etwas nicht.“
„Was wird erzählt?“
„Niemand weiß, wo er geblieben ist. Viele Gerüchte kursieren über die Gründe.“
„Er wird aber doch noch leben?“
„Was weiß ich! Alles Spekulation.“
„Kirchenangelegenheiten“, wandte Pavavritti schroff ein. „Die sollen uns nicht scheren.“
Der Zundelmacher wandte sich an mich. „Zu fromm ist der Alte nicht.“
„Kommt mir ebenfalls so vor“, lächelte ich. „Meinst du, wir können über die Nacht bleiben?“
„Ich habe Brot mitgebracht. Die Patres waren großzügig.“
Den darauffolgenden Tag begannen wir verkatert. Die Säfte der Geistlichkeit, die der Sonderling ebenfalls angeschleppt hatte, zeigten ihre Wirkung. Er legte uns bald auf selbstverständliche Art Arbeit vor die Füße.
„Wir können nicht bleiben“, wandte ich ein.
„Beim Frühstück habt ihr nicht gezaudert, nun dürft ihr etwas dafür tun. Ihr werdet eure Freude daran haben, mich derart zu entlohnen.“
„Na ja“, erwiderte ich zögerlich und hoffte, dass Pavavritti eine passende Argumentation einfiele.
Er nickte verkniffen, gab sich geschlagen, erklärte aber unmissverständlich, dass er auf das Mittagsmahl verzichten wolle.
„Soll mir recht sein“, willigte unser Gastgeber ein.
Kurz bevor wir uns verabschieden wollten, trat ein Pater in den beengten Raum.
„Sind das deine Gäste?“, fragte er unseren Lederzieher.
Der fiel auf die Knie und begrüßte den Fremden auf demütige Weise, indem er eifrig das Kreuzzeichen schlug.
„Uns wurde berichtet, ihr ward Augenzeugen des Vorfalls.“
„Du meinst die Entführung? Wurde der Heilige Vater gefunden?“
„Nicht so hastig!“, bremste er mich. „Es ist belegt, dass man nach ihm trachtet. Ihr hattet euch erkundigt. Warum interessiert euch das?“
„Wir machten uns schlicht und einfach Sorgen.“
„Wer tut das nicht? – Wer nicht?“, überlegte er. „Wollt ihr nicht wissen, wo er sich befindet?
Ich nahm ihn kritisch ins Visier. „Dort wird er wohl in guten Händen sein?“
„Man spricht von verschiedenen Klöstern.“
„Er wird sich bemerkbar machen.“
„So weit ihm die Möglichkeit geschaffen wird.“
Der Pater schien daran zu zweifeln.
„Der Herr der Kirche wird bei Gläubigen in Ehrfurcht aufgenommen werden. So ist es im Sinne der Heiligen Dreifaltigkeit“, behauptete ich provokant.
„Unserem Herrn im Himmel wäre es danach. Doch, wie soll ich sagen...“
Pavavritti entschied, schnell auf den Punkt zu kommen. „Warum bist du gekommen?“
„Ihr zeigtet Interesse an den Vorkommnissen, dafür wird es Gründe geben.“
„Manuel?“ Pavavritti wollte mir die Antwort überlassen.
„Wenn ein Geistlicher auf offener Straße überfallen und verprügelt wird, mag es triftige Gründe geben. Mein Instinkt sagt mir, dass sich hinter dem Anschlag Unerhörtes verbirgt.“
„Dem ist so. Unser Abt wurde auf euch aufmerksam und lädt euch ins Kloster ein - zumindest so lange, bis Klarheit über den Verbleib unseres Heiligen Vaters besteht. Darf ich diese Bitte in seinem Namen aussprechen?“
Mit einem kurzen Blick verständigte ich mich mit Pavavritti. Er zögerte. Ich griff nach einem Kompromiss. „Gerne wollen wir uns mit deinem Herrn austauschen.“
„Dann folgt mir.“
„Alles hat auch seine guten Seiten“, erkannte Pavavritti und drückte unserem Gastgeber einen großen Zunderpilz in die Hand.
Was sollten wir uns aus den Ereignissen zusammenreimen? Standen wir einer hinterhältigen Fehde gegenüber, die jedoch von keiner großen Bedeutung war? Bisher wurde ich regelmäßig mit weltpolitischen Veränderungen konfrontiert. Diese Geschichte hatte etwas Lapidares an sich und doch wurden wir mit Intensität in einen Strudel gezogen, der düstere Ahnungen hervorrief.
Die Aufnahme im Kloster war höflich. Der Abt kniete in einer kärglichen Zelle, als wir vorgelassen wurden. Auf einem kleinen Tischchen lagen Pergament und einige Pinsel. Er beendete sein Gebet und erhob sich.
„Unser Heiliger Vater Papst Leo III. wird vermisst. Es wird von einer Untat gesprochen. Ihr seid Zeugen dieses Vorfalls geworden?“
„Der Zufall wollte es so. Die Not des Opfers ging uns nahe, daher wollten wir der Sache nachgehen und dem armen Geistlichen helfen. Niemals hätten wir vermutet, dass es sich um den Heiligen Vater handelte. Wir hatten den Eindruck, dass er aus Rom hinausgebracht wurde, mögen uns aber täuschen. Zu spät erst konnten wir die Verfolgung aufnehmen und am Ende verirrten wir uns.“
„Es besteht der Verdacht, dass er in einem der römischen Klöster festgesetzt wird.“
„In der Stadt?“
„Die Botschaften, die zwischen meinen Glaubensbrüdern in Latium kursieren, lassen diesen Schluss zu.“
„Rom ist eine unüberschaubare Stadt, es ist leicht, dort jemanden zu verstecken.“
„Oh, da muss ich dir widersprechen.“ Er schaute mich verwundert an. „Rom ist durchaus überschaubar.“
„Bei Millionen von Einwohnern?“
Der Abt runzelte die Stirn. „Wie kommst du auf diese Zahl?“
Ich verkniff mir eine Antwort. Rom hatte ich aus den römischen Kaiserzeiten in Erinnerung. Plünderungen und Kriege hatten die Stadt überzogen. Die von den Cäsaren gewährte Versorgung gab es längst nicht mehr. Die Zeit der Metropole, die die Welt beherrschte, war Vergangenheit. „Von wie vielen Bürgern wird gesprochen?“, stellte ich kleinlaut die Gegenfrage.
„Wer will sie zählen? 20.000, 25.000?“
Ich wurde blass, das waren die Zahlen einer Kleinstadt. War Rom überhaupt noch von Bedeutung? Papstsitz sicherlich und Zentrum des Glaubens. Und er, seine Heiligkeit, war weggeschafft worden.“
„Die einflussreichsten Menschen, die unseren Heiligen Vater umgeben, sind Verwandte seines Vorgängers, Papst Hadrian, der vor vier Jahren verstorben ist. Den Einfluss, den diese Menschen ehemals ausübten, büßten sie während die Herrschaft Leos weitgehend ein. Zu dem ungeheuren Vorfall steht eines fest: Hohe päpstliche Beamte, Campulus und Paschalis, Begüterte aus der Familie Hadrians, haben den Papst in die Enge getrieben, damit der Überfall gelingen konnte. Deckt sich das mit euren Beobachtungen?“
„Wenn es diejenigen Reiter waren, die sich an seiner Seite aufhielten, ist es stimmig.“
Die Einladung des Abtes nahmen wir mit gemischten Gefühlen an. Pavavritti, von Geburt Hindi, waren die katholischen Bräuche fremd. Allein die Sicherheit in den abgelegenen Gütern kam uns entgegen, und daher fügte er sich in den Ablauf.
Wir wollten gerade einen Rundgang außerhalb der Klosteranlage machen, als uns der Abt eilig zurückrief.
„Es gibt Neues?“
„Vieles deutet darauf hin, dass man Leo in San Silvestro festhält.“
„Es ist aber nicht sicher?“
„Die Quelle der Information wird einem alten Gelehrten zugeschrieben: Eusebio. Wir alle achten ihn. Es wird berichtet, Papst Leo sei in einem Interimslager, und man wolle ihn von dort aus an einen absolut sicheren Ort bringen.“
„Das hört sich nach Gefängnis an.“
„Das Kirchenoberhaupt in einen weltlichen Kerker zu stecken, könnte zu einem Politikum werden. Das wagte keiner der Täter.“
„Es gibt in Klöstern Verliese?“
„Das Erasmuskloster auf dem Monte Celio erfüllt die Voraussetzungen.“
„Was wirft man ihm vor? Zur Unterhaltung wird man dieses Procedere wohl nicht organisieren“, unterbrach ich den Abt.
„Man wirft Papst Leo Amtsschändung, Ehebruch und Meineid vor. Gesandte wurden in das Reich der Franken geschickt, um König Karl davon zu unterrichten.“
„Was wird vom König erwartet? Absolution? Zustimmung zu einer Hinrichtung?“ Das war mir über die Lippen gerutscht.
Das Gesicht des Abtes legte sich in Knitterfalten. Mein Einwurf war zu derb. Er entschied sich zur Sachlichkeit. „Zuerst wird zu klären sein, ob die Vorwürfe korrekt sind. Diejenigen, die ihm solche Vergehen unterstellen, wollen ihn grundsätzlich loshaben. Das muss bei einer Beurteilung bedacht werden.“
„Welche Hoffnungen werden auf uns gesetzt?“, wollte ich wissen.
Der Abt lief hin und her. Wollte er eine Antwort verschleppen? Pavavritti ergriff das Wort: „Wie kommen wir überhaupt in das Kloster
„Bittet schlicht um Unterkunft. Ich organisiere über Pater Eusebio eine günstige Ausgangslage. Das Eurasmuskloster hatte einst einen Papst hervorgebracht. Der Einfluss der dortigen Kirchendiener ist enorm.“
„Was soll das Ziel sein?“
„Der Kirche absolute Sicherheit zu verschaffen. Euch kennt niemand. Ihr kommt, geht und berichtet uns.“
„Wir werden in ein politisches Ränkespiel treten“, widersprach ich vorsichtig.
„Gott wird an eurer Seite sein.“ Er schlug das Kreuz und verabschiedete uns.
Unsere Erlebnisse auf unserem Ritt nach Rom und zum Monte Celio waren deprimierend. Ein großer Teil der Stadt war dem Verfall nahe. Vieles erinnerte an Babylon, das ich in einem ähnlichen Missstand angetroffen hatte.
Menschenleere Gebäude, die meisten kurz vor dem Einsturz, Straßen, auf deren Müll sich die Natur ein neues Dasein schuf. Wurzeln brachen selbst stabiles Mauerwerk auseinander.
Vom einstigen Glanz stolzer Herren war nichts mehr zu erahnen. Ein dunkles Zeitalter hatte seinen Schatten über die einst prachtvolle Stadt geworfen.
Der große Gebäudekomplex, vor dem wir bald standen, entsprach den Beschreibungen.
„Ist das das Erasmus-Kloster?“, erkundigte ich mich bei einem Passanten. Er bestätigte und eilte weiter.
„Dann ans Werk“, rief ich Pavavritti zu.
Vor dem großen Tor sprangen wir von den Pferden. Es war verschlossen. Der ganze Gebäudetrakt zeigte sich wenig vertrauenswürdig, kühl, der Welt abgewandt. Ein direkter Zugang zur Kirche war nirgendwo zu erkennen. Wir behalfen uns mit kräftigen Schlägen gegen die Türe, zunächst mit den Fäusten, dann mit den Beinen.
Ein Klappfenster an der Pforte öffnete sich. Wir wurden angestarrt. Nach dieser kurzen Visite wurde die Klappe wieder zugeworfen.
„Wie soll das funktionieren?“, murrte ich angesäuert.
„Der Einfluss dieses Eusebios hält sich in Grenzen.“
„Ich schlage vor, wir behalten den ganzen Trakt aus der Ferne im Auge.“
Pavavritti ging auf meinen Vorschlag ein. „Kommt mir entgegen. Meinst du, wir kommen in der Nachbarschaft unter?“
Gerade wollten wir uns abwenden, als die schwere Tür in den Angeln kreischte. „Was habt ihr auf dem Herzen?“, rief uns ein Pater nach.
„Bruder Eusebio hat uns angekündigt?“, begann ich.
„Ihr seid das. Wartet bitte. Ich muss euch melden, so ist die Regel im Kloster.“
„Wir werden warten“, gab ich mich drein.
„Manuel, das gefällt mir ganz und gar nicht. Dein Vorschlag mit der Visite aus der Ferne war die bessere Variante. Willst du wirklich in diesen Hades?“
„Kloster, Freund, Kloster. Das ist so in etwa das Gegenteil.“
Währenddessen tauchte ein weiterer Pater auf, dem das Misstrauen im Gesicht stand. „Wir haben einen Stall für die Pferde“, stellte er mit einem Blick auf unsere Vierbeiner fest. „Für euch selbst ist eine Zelle vorbereitet. Wir wundern uns über Gäste eurer Art, verwehren aber niemandem den Zutritt.“
Wir folgten ihm einen langen Flur entlang.
Das gesamte Bauwerk machte auf mich den Eindruck eines zweckentfremdeten Palasts. Die langgestreckten hohen Gänge, die Weitläufigkeit der Anlage, alles das wäre von einem Orden jener Zeit wirtschaftlich kaum instandzuhalten gewesen.
„Waffen sehen wir nicht gerne“, wandte sich der Geistliche zwischendurch an mich.
„Ich bin in meinem Leben weit gewandert und habe mich an den Stock gewöhnt.“
„Dieser Stock trägt eine Spitze.“
Genervt lehnte ich meinen Speer an die Wand und trat die Spitze ab.
„Besser so?“
Ohne eine Antwort ging er weiter.
Nach einer weiteren Kehre waren wir am Ziel angekommen. Mit der Zuweisung des Zimmers war die Aufgabe des Paters erfüllt. Er wandte sich ab und ließ uns in dem kühlen von groben Steinen ummauerten Raum zurück. Ein kärglicher Lichtstrahl fand durch ein winziges Fensterchen. Die Türe knallte zu. Ein Schloss rastete ein.
„Das darf nicht wahr sein!“, rief Pavavritti.
„Verschlossen“, attestierte ich. Wir saßen in einer Falle.
„Und jetzt?“
„Feststellung eins, wir sind hier richtig.“
„Da bin ich überglücklich. Und? Was hilft es uns?“
„Guter Freund, das alles ist für mich nicht neu. Wenn sie uns pünktlich Speis und Trank bringen, will ich sagen, so gut ging´s mir selten. Es gibt eine weitere Besonderheit: Ich bin nicht alleine. Du bist bei mir.“ Gelassen ließ ich mich in einer Ecke nieder.
„Schön für dich. Was bin ich für ein Narr! Ich ärgere mich über meine eigene Torheit. Hatte ich es nicht gerochen?“
„Lass die Vorwürfe! Wir werden das Beste daraus machen.“
„Da bin ich gespannt“, kam die missmutige Antwort.
Wie viele Tage wir in diesem düsteren Raum hungerten, will ich aussparen. Manchen Gedanken warfen wir auf, wie wir entkommen könnten. Alle scheiterten an der schweren Türe, deren Verriegelung uns ein Rätsel blieb.
Immer wieder kam die Speerspitze zur Sprache, die ich von dem dürren Stab abtreten musste. Hätte sie uns helfen können?
Eines Morgens wurden wir durch eine ferne Stimme geweckt. Der Inhalt blieb unverständlich. Es kam zu keiner Wendung unserer Situation und schnell erstarb jede Spur von Hoffnung.
„Sagtest du nicht, mit Gewalt löse man unser Problem nicht?“, raunte Pavavritti.
„Gegen wen sollten wir diese denn auch richten?“, wollte ich wissen. „Ich sehe hier nur unbezwingbares Mauerwerk und eine Türe …“
Überrascht hielt ich inne. Mein Stock, der tagelang unbeachtet an der Türe lehnte, hatte während der Nacht hauchfeine Triebe geschoben, die sich durch die Ritzen des Türblattes drängten, sich verbreiterten und zu starken, unnachgiebigen Greifarmen anschwollen. Ihre Kraft drückte die Scharniere aus den Verankerungen. Bislang ging alles lautlos ab. Mehr und mehr entwickelte sich aus dem kaum hörbaren Knistern jedoch ein Brechen. Bretter zersplitterten wie Glas. Die Freiheit hatte uns wieder.
„Sei achtsam“, warnte ich Pavavritti, „die Mönche sind um diese Morgenstunde längst auf den Beinen. Denke an die frühe Vesper.“
Tatsächlich ertönten Gesänge aus fern gelegenen Gängen. Gregorianik. Doch versöhnten die Klänge in jener Stunde nicht. Es war hier und jetzt anders als in jener kleinen Kapelle, die ich vor diesem Fluch fand, und an die ich mich gerade erinnerte.
„Die Mönche sind beschäftigt“, bemerkte Pavavritti.
Wir setzten alles daran, den Gebäudeflügel zu verlassen. Das Glück war auf unserer Seite. An der Pforte hielt sich niemand auf, durch einen einfachen Riegel öffneten wir das unbeachtete Tor.
„Ist mir ein Rätsel“, wunderte sich Pavavritti.
„Es ist Nacht, guter Freund“, stellte ich achselzuckend fest. Wer will hier schon einbrechen?“
„Denke eher an rauskommen“, entgegnete er.
Wie herrlich sich die reine Morgenluft einatmen ließ. Der feuchte muffige Moder unserer Zelle saß mir noch in der Lunge.
Gezwungenermaßen eilten wir die Klostermauern entlang und hielten Ausschau nach Nebengassen, in denen wir verschwinden konnten.
Nach einigen hundert Metern bremste ich ab. „Halt!“
„Was ist mit dir?“
„Wir müssen zurück.“
„Spinnst du?“
„Ich kann nicht weitergehen. Von Schritt zu
Schritt werden meine Beine schwerer, ich selbst fühle mich nach jedem Meter um Jahrzehnte gealtert.“
Pavavritti holte tief Luft. „Was für eine sonderbare Macht steckt in dir? Ist es dein wacher Geist, der dich hemmt oder lähmen dich die Dämonen?“
„Weiß nicht.“ Ich zitterte. „Was meinst du?“
„Deine Anwesenheit an diesem vermaledeiten Ort ist anscheinend unverzichtbar. Geben wir uns also geschlagen?“
„Wie erklärst du dir das?“
„Es kann nur mit diesem Papst zusammenhängen.“
Nur kurz schauten wir uns in die Augen, wandten uns um und rasten, wie vom Wind getragen zurück.
Als wir um eine Ecke geschossen kamen, erkannten wir eine Person, die sich aus einem hochgelegenen Fenster des Klosters abseilte. Auf einem Sockel unterhalb stehend, mühte sich ein Gehilfe, das Tau in der Hand haltend.
„Er schafft es nicht!“
Bevor ihm das Seil ausbrechen konnte, waren wir ihm zur Seite und hängten uns mit vollem Gegengewicht in die Trosse. So gelang es uns, den Flüchtenden behutsam auf die Erde zu bringen.
Der Helfer war jener Mönch, der uns als erster im Kloster empfangen hatte. Hektisch redete er auf uns ein: „Ich muss dringend zurück. Aber ich sage euch: Der Heilige Vater ist in der Peterskirche sicher. Es sind dort Gesandte Karls eingetroffen. Sie werden ihn schützen.“
Der Abgeseilte, nun auf sicherem Grund, nickte. Er konnte nur einer sein, der Heilige Vater. Der Pater stürmte bereits zurück.
„Zur Peterskirche“, wiederholte Pavavritti, der verstanden hatte.
„Ich kenne den Weg, folgt mir!“ Die Unsicherheit hatte Papst Leo uns deutlich angesehen. Wir durften keine Zeit verlieren, und so eilten wir schnurstracks davon.
War das Werk damit getan? Benötigte das Oberhaupt der katholischen Kirche unsere Begleitung bis zum endgültigen Ziel? Unschlüssig suchte ich bei Pavavritti Rat. Er übersah meine Blicke. Mehrmals hielt der Heilige Vater inne, sich versichernd, ob wir folgten. Trotz der ganzen Hetze erhaschte ich einen Blick auf die Engelsburg, Hadrians gigantisches Grab. Dem Verfall der einst ruhmreichen Stadt trotzte das gewaltige Bauwerk unerschütterlich.
Es herrschte große Aufregung, als wir in der Peterskirche eintrafen. Den Heiligen Vater verloren wir schnell aus den Augen. Uns sah man den Hunger an. Emsig wurde aufgetischt. Ein Pater setzte sich treu an unsere Seite, erfragte dies und das. Zu vielem hatten wir keine Antworten. Er akzeptierte es so. Mich bewegte vor allem, was darauffolgend geschehen sollte.
„Wird Papst Leo weiterhin in Gefahr sein?“, warf ich daher ein.
„Wir wissen nicht, was in seinen Gegnern vorgeht. Mit dieser Flucht konnten sie nicht rechnen. Das bringt sie in eine Defensive, deren Folgen wir fürchten müssen. Die Äbte Wirund und Winigis, auch der Herzog von Spoleto haben sich bereit erklärt, dem Heiligen Vater beizustehen. Wir empfehlen ihm, die Stadt zu verlassen.“
„Was sagt er dazu?“
„Ich gehe davon aus, dass er einlenkt. Darf ich euch fragen, ob ihr bereit wäret, seine Heiligkeit zu begleiten?“
„Wir?“
„Ihr!“
Dieses eine Wörtchen nahm der Heilige Vater am Ende selbst in den Mund.
Welche Vorteile sieht er für sich?“, wehrte ich mich.
„Man kennt euch nicht, euch fehlt es an Adel“, erklärte ein Pater.
„Diese Eigenschaften finden sich tausendfach.“
„Er vertraut euch. Diese Tatsache schlägt jede anderweitige Eignung.“
Ich biss die Zähne zusammen. Wie leicht konnte mir die Aufgabe entgleiten. Die Dämonen hingen stets an meinen Sohlen. Waren nicht sie die größte Gefahr für seine Heiligkeit? Schließlich gab ich mich geschlagen. Bis zum nächsten Zeitsprung wäre ich beschäftigt, redete ich mir ein. War dies schließlich nicht mein einziges Ziel?
„Wohin will sich der Herr wenden?“, erkundigte sich Pavavritti.
„Zu Karl, dem fränkischen König.“