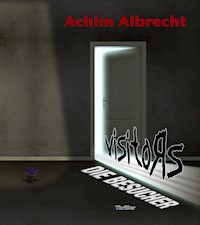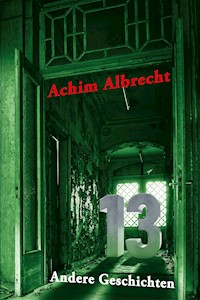
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OCM
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
13 Abgründe der Seele. 13 Geschichten mitten aus dem Leben: feingeschliffen bösartig, grotesk komisch oder verzweifelt tragisch. Geschichten, die man nicht vergisst und die den Leser lange Zeit begleiten. Jede Erzählung eine emotionale Achterbahnfahrt – nervenaufreibend, unerwartet. ANDERS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Cover zeigt einen verfallenen Hausflur vor dessen Eingangstür eine von hinten angestrahlte, dreidimensionale 13 steht die zusammen mit einer Textzeile den Titel „13 andere Geschichten“ bildet.
Achim Albrecht
© 2022 OCM GmbH, Dortmund
Handlungen und Personen sind frei erfunden.
Gestaltung, Satz und Herstellung: OCM GmbH, Dortmund
Verlag: OCM GmbH, Dortmund, www.ocm-verlag.de
ISBN 978-3-949902-06-2
Printed in the EU
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt auch für die fotomechanische Vervielfältigung (Fotokopie/Mikrokopie) und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
1 – Die Begegnung
2 – Die Therapie
3 – Der Albtraum
4 – Kaffeeklatsch
5 – Familienbande
6 – Harry und Elke
7 – Die Gedankenleserin
8 – Der Knabe
9 – Die Alten
10 – Die Einladung
11 – Kindergeburtstag
12 – Die Lesung
13 – Der Hände Unschuld
Über den Autor
Orientierungsmarken
Cover
Impressum
Inhaltsübersicht
Textanfang
1
DieBegegnung
Er hatte senffarbene Träume.
Das war das einzig Bemerkenswerte an dem Mann. Früher, als er noch ein Leben hatte, waren die Träume nur in seine Nächte eingebrochen. Sie hatten nichts an sich als diese mattgelbe, langweilige Qualität, wie vergilbte Blätter. Er hatte lange gebraucht, bis sie ihn beunruhigten. Er glaubte nicht an Träume. Deren Inhalte waren ihm gleichgültig.
Nicht aber ihre Farbe.
Einmal hatte er diesen Film gesehen, diesen Western mit den kargen Dialogen und den stoppelbärtigen Gesichtern in Großaufnahme. Es ging um Recht und Unrecht, und einen Mundharmonikaspieler, der die ewig gleiche, kleine Harmonie hinausblies, bis deren klagender Ton sich in die Gehirne der Zuschauer gefressen hatte. Es war lange her, zu lange, um sich genau zu erinnern. Das Einzige, was geblieben war, war die fahle, ockerfarbene Stimmung des Films und die Gewissheit, dass er damals noch ein Leben gehabt haben musste.
Dann fiel die senffarbene Tristesse über seinen Schlaf her. Nicht dass sie ihn unterbrochen hätte. Dazu war sie viel zu erfahren. Sie schlich sich heran und überzog den Schlaf mit ihrem Gelbton, beschwerte ihn, bis der Mann nur noch flach atmen konnte, und lockerte ihren Griff nicht, bis er im Bett zerschlagen aufwachte und vergeblich den Farbton wegzuwischen versuchte.
Als nächstes kannibalisierte das senffarbene Leichentuch die Tage des Mannes. Zuerst hielt er es für eine Wetterlaune. Er hatte alle Arten von Wetter erlebt und wusste, dass sie unterschiedliche Lichtverhältnisse mit sich brachten. Als Kind war er im Dorf aufgewachsen. Die Leute im Dorf bestanden aus Bauern, Trinkern und Wetterpropheten. Das eine schloss das andere nicht aus, und alles war ehrbar. Die Wetterpropheten hielten angefeuchtete Finger in den Wind, schauten mit gerunzelter Stirn in den Himmel, auch wenn er nur aus Creme und Blau bestand und beobachteten das Treiben der Vögel.
»Es wird Regen geben«, sagten sie und behielten recht.
Er selbst war nicht sensibel genug, um solche Voraussagen zu treffen. Seine Spezialität waren die Gewitter mit ihren bleifarbenen Wolkentürmen, den schwefelgelben Rändern an ihren Bäuchen und der Windstille mit ihrem eigenartigen Geruch nach schwelendem Metall, die dem Ausbruch von Blitz und Donner vorausging. Er unterschied Schwärze von Heiligkeit und akzeptierte das dumpfe Grau als Begleiter bestimmter, unattraktiver Monate. Damit war dem Wetter und den Jahreszeiten Genüge getan.
Womit er nicht zu Recht kam, war die senffarbene Trostlosigkeit, die sich vor seinen Augen einnistete und nicht weichen wollte. Sie ernährte sich von seiner Sorglosigkeit, seiner Unbeschwertheit, seiner heiteren Gemütsverfassung. Sie vergiftete ihn und machte ihn schwach und anfällig. Sie hatte nichts mit dem Wetter zu tun und krallte sich an ihm fest wie ein ungebetenes Geschenk.
Kein anderer konnte die senffarbene Stimmung spüren.
Er begann darüber zu reden.
Reden half. Anfangs hörte man ihm zu, doch die Geschichte nutzte sich rasch ab. Er wurde krank. Der Vorarbeiter seines Betriebes schickte ihn zum Arzt, der Arzt überwies ihn an den Neurologen und dieser an Maschinenungetüme, die seinen Kopf in hauchdünne Fotografien schnitten. Jedenfalls verstand er es so.
Mattigkeitssyndrom auf Lateinisch war die Diagnose. Ein Student, der im Betrieb ein Praktikum absolvierte, erklärte, dass die Ärzte damit ausdrücken wollten, dass sie nicht wussten, was ihm fehlte. Sie hatten auf einen Tumor oder eine sonstige Anomalie gehofft und waren enttäuscht worden. Senffarbene Antriebslosigkeit war in ihrem Medizinstudium keine curriculare Pflichtveranstaltung gewesen.
Was half, war ein altes Rezept.
Es war genauso alt, wie es wirksam war. Es färbte Farben.
Nach der Einnahme begann die Verwandlung unmerklich. Die senffarbene Decke lockerte sich und das Atmen fiel leichter. Es kam auf die Dosierung an. Man musste beherzt, aber beherrscht an die Sache herangehen. Schluck für Schluck. Man war kein Trinker, würde nie einer werden. Man sah auf seine schwieligen Hände und wusste um den Wert der Arbeit und des bürgerlichen Lebensstils. Man schluckte gegen die senffarbene Stimmung an und die Einsamkeit, gegen das Kopfschütteln der Kollegen und das lähmende Einerlei des Alltags. Man schluckte es hinunter. Mit jedem Schluck hob sich die Bedrückung. Man brauchte nur dazusitzen und in eine Ecke zu starren. Schmutzig gelb waren die Ecken, ausgeschlagen mit einem stockfleckigen Pergament aus gelblichen Fasern. Dann färbten sie sich in einen Aprikosenton, freundlich und verheißungsvoll. Die Farbe begann zu tanzen, Gedanken fluteten in den Kopf. Wo zuvor Beklemmung war, meldete sich die Zuversicht, wo sich die Kraftlosigkeit eingenistet hatte, herrschte der Mut.
Mit einem Gläschen Schnaps zwischen den Bieren konnte man in seine Zukunft sehen, eine rosige Zukunft, sorgenfrei, und mit den Händen zu greifen. Zum Schluss hatte man das senffarbene Tier besiegt, hatte es niedergerungen und auf den Fußboden gepresst. Man hatte sich auf seine Leichenteile übergeben und sich darin gewälzt, bis man das Bewusstsein verlor.
Ein solcher Kampf kostet Kraft.
Das Medikament fordert seinen Tribut. Es ist nicht ohne Nebenwirkungen, seine Wirksamkeit auf wenige Stunden beschränkt. Dann muss man die Behandlung wiederholen, muss die Dosis erhöhen.
Die senffarbene Welt ist heimtückisch. Sie kriecht im Schutze des Schlafes davon und sammelt Kräfte. Gegen die Betäubung kann sie nichts ausrichten, aber sie ist geduldig. Sie kann warten. Die Nebenwirkungen des Medikaments sind ihre Verbündeten. Da wären die Übelkeit, die Krämpfe, das geschmolzene Blei im Schädel und der trockene Schlund mit dem abgestandenen Geschmack.
Beim ersten Zucken der Augenlider war das senffarbene Ungetüm zur Stelle und nahm seinen angestammten Platz ein. Die ersten mühsamen Schlucke vertrieben es wieder in seine Schlupfwinkel, wo es auf seine nächste Chance lauerte.
Das Leben des Mannes kam nicht mehr voran. Er unterteilte seine Wahrnehmung in senffarben und nicht senffarben. Für die Arbeit blieb kein Raum mehr. Sein Vorarbeiter führte ein Gespräch mit ihm, dessen Sinn sich ihm nicht erschloss und an dessen Ende die Entlassung stand. Ein Richter, der ihn zu einer Strafverhandlung in Handschellen vorführen ließ, behauptete, er habe den Vorarbeiter mit einer Eisenstange fast zu Tode geprügelt. Durch eine Welt aus senffarbener Watte verfolgte er einen Disput, bei dem es um einen ihm fremden Menschen ging. Rauschtat war ein Begriff, der hin und her geworfen wurde wie ein Prellball. Sein Verteidiger beglückwünschte ihn zu einer Bewährungsstrafe, die in seinen Ohren einen ungesunden Klang hatte.
Der Park war seine Rettung.
Der Park und einige wenige Schnäpse, auf die sich der abgetakelte Kiosk neben den Abfallbehältern spezialisiert hatte. Früher war er selbst einer von denen gewesen, die mit einem Anflug von Verachtung auf die Gestalten sahen, die auf den Parkbänken lungerten. Das war vor der senffarbenen Zeit gewesen. Jetzt war es anders. Jetzt sah er klar. Für andere mochte es so aussehen, als grölte, stritt und versöhnte sich ein zusammengewürfelter Haufen Pack, den die Gesellschaft ausgespien hatte. Für die Betroffenen selbst war die Gesellschaft der anderen eine Notgemeinschaft, die gemeinsam dem Ansturm der Dämonen trotzte. Die Gespräche kreisten darum. Gescheiterte Ehen, verlorene Würde, ein im Mutterleib gestorbenes Kind. Alles farbiger, greller, hartnäckiger als im trägen Strom des normalen Lebens. Von Farben verstand er etwas. Darauf lief es bei ihnen allen hinaus.
Senffarben war seine Bestimmung.
Er verabscheute Tauben.
Es ist richtig, dass jede Kreatur ihren Stellenwert an dem misst, was in der Skala unter ihr rangiert. Er musste akzeptieren, dass das auch für ihn galt. Er hatte einen Grund, Tauben nicht zu mögen. Sie trippelten umher, legten die Hälse schief und schauten, während sie so taten, als widmeten sie sich der Futtersuche. Selbst die heilende Wirkung des Alkohols konnte ihn in diesem Punkt nicht gleichgültig machen. Er wusste, was er sah, und was er sah, waren Sendboten einer senffarbenen Zeit, die ihn belagerten und piesackten, ihn mit ihrem Gegurre neckten und auf die nüchternen Momente warteten, wo sie ihm nahe sein wollten, ganz nahe. Deshalb war es nur allzu verständlich, dass er Flaschen und Steine auf sie schleuderte und alles, dessen er habhaft werden konnte. Flaschen und Steine warf er auch in Richtung der alten Hexe, welche die Tauben vor seinen Augen fütterte und ihnen Kosenamen gab, während sie ihn mit einem angeekelten Blick bedachte.
Der junge bärtige Kerl von irgendeiner Wohlfahrtseinrichtung, der ihn ab und an zur Kleiderkammer führte, ihm kostenlose Mahlzeiten verschaffte und den Kontakt zum Sozialamt hielt, hatte traurige Augen. Die senffarbene Zeit stand ihm noch bevor. Im Moment hatte er noch Kraft und nutzte sie dazu, mit dem neu hinzugekommenen Obdachlosen Gespräche zu führen.
Er wolle ausloten, was er für ihn tun könne, sagte er. Er verstand nicht. Wie hätte er auch verstehen können? Es war alles getan worden. Schon vor langer Zeit. Nichts war unversucht geblieben und das Hier und Jetzt war das Ergebnis. Er dürfe sich nicht so aggressiv gebärden.
Das würde Probleme schaffen, meinte der junge Mann und legte die Fingerkuppen in einer bittenden Geste aneinander.
Der Mann lernte, was ein Platzverweis ist. Es ist nie zu spät, etwas zu lernen. Wenn man von der senffarbenen Pest und den Nebenwirkungen der einzig wirksamen Medizin eingekreist sein Dasein fristet, wird man langsamer. Langsamer in den Beinen und langsamer im Kopf. Die wichtigen Dinge aber behält man besser im Gedächtnis als je zuvor. Eines dieser Dinge war der Platzverweis. Zwei Männer mit Dienstausweis und lauter Stimme sprachen Platzverweise aus. Sie waren gut darin.
Der Mann versuchte, sich zu erinnern, womit er die öffentliche Sicherheit gefährdet haben könnte. Es mochte die Sache mit den Tauben gewesen sein. Er versuchte eine Erklärung, aber die Stimmen wurden lauter, schneidend, und stachen auf ihn ein, wollten ihn an einen anderen Ort treiben, wo keine Tauben waren, deren Sicherheit er gefährden konnte. Er spuckte aus und klaubte seine Taschen zusammen.
Die senffarbene Invasion hatte die Menschen verrückt gemacht. Der Wahnwitz zeigte sich im Platzverweis, der Menschen wie Vieh täglich einmal durch die Stadt trieb, bis sie wieder an dem Ort landeten, wo die Flaschen der letzten Nacht noch im Gras lagen. Gerade vorgestern hatte es einen Platzverweis gegen einen Kameraden gegeben, der seinen Rotweinvorrat mit allen geteilt hatte. Dann hatte es Streit gegeben. Es war um Politik gegangen. Es ging immer um Politik. Manchmal ging es auch um Liebe. Und wenn es um Liebe ging, war die rote Zora im Spiel. Man nannte sie so, weil sie das Lieblingsbuch ihrer Tochter bei sich trug.
Die Tochter war gestorben.
Das Buch lebte weiter.
Die rote Zora bettelte nie.
Sie ging auch nicht zu Ämtern. Alles, was sie tat, konnte man im Schutz der Dunkelheit hinter einem Gebüsch erledigen.
Der Zipfel einer Decke, die Ahnung von dem Aufeinandertreffen zweier bleicher Hintern und unterdrücktes hastiges Keuchen waren Zeugen der Vorgänge. Als Vorgänge bezeichneten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes diese Begegnungen. Sie brandmarkten sie als Verstöße gegen die öffentliche Ordnung. Die öffentliche Ordnung schien weniger wichtig zu sein als die öffentliche Sicherheit, denn ihre Beeinträchtigung zog keinen Platzverweis nach sich.
Die rote Zora lächelte ihr zahnlückiges Lächeln. Manchmal verschwand sie für Stunden, wenn der kräftigere der beiden Männer vom Ordnungsamt mit ihr geredet hatte. Wenn sie zurückkam, trank sie mehr und lächelte weniger. Am nächsten Tag war sie wieder wie immer.
Ich habe keine farbigen Träume, sagte sie.
Er hatte sie gefragt. Ihre Antwort war zu schnell und zu präzise, um wahr zu sein. Ihre Blicke wichen den seinen aus, und ihre Hände falteten sich vor ihrer Brust wie zu einer Fürbitte.
Er verstand.
Auch er hatte Begegnungen. Sie waren nicht der Rede wert. Der Alkohol half ihm, die Blicke an sich vorbeiwischen zu lassen. Sie verloren ihre Aussagekraft, wenn sie sich nicht festheften konnten. Seine senffarbene Welt hob und senkte sich im Rhythmus seines Alkoholpegels. Sie war warm und gleichgültig, sie schleppte sich und ebnete die Unterschiede ein. Er fühlte sich leidlich aufgehoben in seiner Welt. Meistens jedenfalls.
Nur vereinzelt kam es zu Begegnungen, die den Schleier zerrissen. Sie waren schmerzhaft und grell. Sie verängstigten ihn. Eine Frau mit grauem Haar und einem angriffslustigen Mund hatte ihn des Diebstahls bezichtigt. Sie tat es auf offener Straße in empörtem Ton.
Der Inhalt des Abfallbehälters gehöre der Stadt. Er dürfe ihn nicht einfach nach Verwertbarem durchwühlen. Auch der Müll gehöre jemandem. Müll sei ein wertvoller Rohstoff. Er sei ein Dieb, nichts als ein schäbiger Dieb, der vor ein Gericht gestellt gehöre.
Die Worte zerteilten seinen Dämmerzustand wie Peitschenhiebe. Es war nicht die Angriffslust, die diese Ernüchterung bewirkte, sondern die vom Üblichen abweichende Thematik. Halblaut ihm hingeworfene Bemerkungen wie »Sie sollten lieber arbeiten als zu gammeln« oder »Schämen sie sich nicht?« hatten längst einen Gewöhnungseffekt bewirkt und wurden zu Bekannten, die man mit Gleichmut hinnahm, weil sie immer wiederkehren würden. Sie prallten ab, ohne Schaden anzurichten, und verflüchtigten sich mit dem nächsten Schluck aus der Erinnerung.
Damals war er davon geschlurft, um dem Vorwurf zu entkommen. Die Frau und ihre Stimme blieben hinter ihm zurück, doch der Vorwurf blieb an ihm haften, eingebettet in eine senffarbene Hülle.
Die Begegnung an der Fußgängerampel hatte eine andere Qualität.
Wieder war es eine Frau. Er hatte sie nicht bemerkt. Sein Ziel waren die Bänke vor dem Postamt. Das Postamt war eine gute Stelle. Die Post machte aus Menschen friedliche Wesen. Friedliche Wesen sind freigiebig.
Manche fragten nach seinem Befinden und legten nach einem Blick auf sein aufgedunsenes Gesicht einen kleinen Geldbetrag in die neben ihm liegende Mütze. Außerdem gab es gute Ratschläge, und manchmal ein Lächeln, das fast aufrichtig zu sein schien. Es hätte ein durchschnittlich guter senffarbener Tag werden können, wäre die Frau an der Ampel nicht gewesen. Sie war klein, hatte ein breites, teigiges Gesicht ohne nennenswerte Konturen und steckte in einem grauen Mantel. Ein Nest aus sich ringelnden, braunen Locken bedeckte ihren Schädel. Ihre Arme standen von ihrem Körper ab wie Keulen.
All das bemerkte der Mann erst, als sie ihn ansprach. Jedenfalls nahm er an, dass sie mit ihm sprach, denn zwei wässrige Kuhaugen sahen ihn an. Es waren Augen wie Murmeln, mit einer wie aufgemalt wirkenden Pupille über einem halb durchsichtigen Untergrund. Die Augen wirkten friedlich. Sie waren, inmitten des senffarbenen Einerleis der Umgebung, auffallend blau. Ein zusammengedrücktes Etwas von Mund sagte einen Satz, der mit einer eigentümlichen Betonung schwang. Die Arme der Frau standen von ihrem Körper ab, als hätten sie kein Leben in sich. Die Frau wiederholte den Satz und ihre Augen wanderten zu dem roten Ampelmännchen und wieder zurück. Dann trat die Frau zur Seite, als wolle sie ihm für eine wichtige Verrichtung Platz machen.
Er fühlte sich unangenehm berührt. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal zu einem solchen Gefühl fähig gewesen war. Vielleicht wurde er rot. Es war nicht auszuschließen. Die Frau wiederholte den Satz erneut, sanft und bestimmt. Sie nickte ihm auffordernd zu während sie ihn fixierte. »Musst Du drucken«, verstand er. Die Aussprache der Frau war flach und unsicher. Sie musste eine Ausländerin sein. Er drehte sich weg. »Musst Du drucken«, sagte die Stimme. Sie war sachlich, ohne zu fordern.
Er dachte an die Tauben, die er davonjagen konnte, um ihnen zu entkommen. Für einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, die Frau von sich zu stoßen oder sie zu treten, um ihr nicht mehr ausgesetzt zu sein, ihr und ihrem blauen Blick. In seiner senffarbenen Welt war kein Platz für Begegnungen, kein Platz für blauäugige Konversation, keine Nische für unverständliche Sätze.
Dann lief er los. Er entkam auf die Straße. Ein Auto bremste scharf. Stoßstangen bohrten sich in die Tasche mit seinen Habseligkeiten. Er wurde zur Seite geschleudert und fiel. Fiel hart. Ein rotes Ampelmännchen blickte ungerührt auf ihn hinunter. Jemand zerrte an ihm herum. Wässrig blaue Kuhaugen sahen ihn an. Eine Decke schob sich unter seinen Kopf. Er versuchte mit dem teigigen Gesicht der Frau Kontakt zu halten. Ihre Arme bewegten sich und vollführten eine übertriebene Bewegung. Sie schienen es nur für ihn zu tun. Die Augen ließen ihn nicht los. Eine Sirene näherte sich. Sie hatten nicht mehr viel Zeit. Die Hände der Frau schlossen sich um einen gelben Kasten am Ampelpfahl. Die Handballen drückten den Signalgeber. Die Sirene war zu laut, als dass der Gestürzte den lautlos formulierenden Mund der Frau hätte verstehen können. Er konnte ohnehin nachvollziehen, was der Mund sagte. »Musst Du drucken«, sagte er. Dann setzte der Schmerz ein.
Man hatte sich um ihn gekümmert. Beckenbruch und Prellungen, diagnostizierten die Ärzte. »Er muss entgiftet werden«, machten sie zur Bedingung. Infusionen ernährten und stabilisierten ihn. Ein Tablettencocktail spülte frische Träume in sein Dasein und dämpfte das Verlangen nach Alkohol. Ein Gipskorsett zwang ihn zur Ruhe, und geschäftiges Personal winkte einen Therapeuten mit einem kummervollen Gesicht heran, der sich mit Fragen in seinen Kopf bohrte und ihm schließlich seine senffarbenen Geheimnisse entlockte. Nach diesen Wochen wechselten die Medikamente. Manche hatten ihre Schuldigkeit getan, andere kamen hinzu. Sie hielten ihn ruhig und warm. Der Ockerton seiner Welt wurde transparenter.
Die Ärzte nannten es ganzheitliche Therapie. Sie verrieten ihm, dass er Teil eines Programms sei, für kranke Obdachlose von einer Stiftung aufgelegt, deren Namen er noch nie gehört hatte. Sie verrieten ihm auch, dass ihn eine prominente Schauspielerin am Krankenbett besuchen werde, die Schirmherrin der Stiftung. Sie komme mit der Presse vorbei, um sich nach seiner Gesundheit zu erkundigen. Er sei der Vorzeigepatient der Stiftung,
Er nickte. Er wagte es nicht, ihnen zu sagen, dass er von der Schauspielerin noch nie gehört hatte. In der senffarbenen Welt haben Schauspielerinnen keinen Platz. Er fragte sich, was aus der kuhäugigen Frau geworden war.
Lange Wochen, nachdem die Schauspielerin ihre kühlen Hände auf seine Stirn gelegt und Kameras dies aufgezeichnet hatten, waren die senffarbenen Flächen in seiner Welt zu vereinzelten Tupfen geschrumpft, die sich nur noch in seinen Nächten herumtrieben. Er hatte gelernt, mit ihnen umzugehen.
Sie würden austrocknen und von ihm abfallen, versprach der Therapeut, der empfahl, die Medikamentendosis herabzusetzen. Verschüttete Empfindungen wirbelten seine Gemütszustände durcheinander wie Streu im Wind. Er lernte das Gefühl zu mögen und konnte sich nicht mehr daran erinnern, jemals so lebendig gewesen zu sein.
Er hatte üben müssen zu gehen, zu essen und Mensch zu sein. Andere Menschen erkannten ihn, wenn er vorsichtige Spaziergänge unternahm. Sein Gesicht hatte sich in Zeitschriften wieder gefunden. Die Kameras, die der Schauspielerin auf Schritt und Tritt folgten, waren noch wirksamer gewesen als die Medikamente. Gib Deinem Nachbarn eine Chance! Sie hatten einen Slogan aus ihm gemacht. Menschen wollten seine Hand schütteln. Sie erkundigten sich nach seinem Befinden. Ein wohlwollender Politiker erhob ihn zum Beispiel für eine gelungene Wiedereingliederung in den Schoß der Gesellschaft. Zusammen lächelten sie in die Kameras, ein feistes und ein schmales Gesicht.
Die senffarbene Schicht war zu einer unmerklichen Sprenkelung geworden, die sich manchmal in seine Träume stahl, als habe eine Zugehfrau den Boden nicht ordentlich gewischt. Man fragte ihn um Rat, bat ihn in kirchlichen und sozialen Institutionen bei Kaffee und Plätzchen über die Zeit seiner Depressionen und seiner Alkoholabhängigkeit zu sprechen und ermahnende Worte an die Jugend zu richten. Sein ehemaliger Arbeitgeber meldete sich bei ihm, als sei eine lange Urlaubsperiode vorbei, und bat ihn um einen Besuch. Man habe eine Überraschung für ihn. Nur für ihn. Er habe sie sich verdient.
Es fiel ihm leicht, den Weihnachtswunsch der Stiftung zu erfüllen.
Es war ein kitschiger Wunsch. Ein Wunsch für die Schauspielerin und ihre Kameras. Er hatte nichts gegen Kitsch. Er war zu sehr mit seiner neuen, farbenfrohen Welt beschäftigt, um verdrießlich zu sein. Das Weihnachtsmannkostüm und der weiße Bart rochen nach Konservierungsmittel. Der Sack auf seinem Rücken wog schwer. Mit pelzbesetzten Stiefeln und in Begleitung der Kameras stapfte er los. Im Park nahm er sich Zeit, die Tauben zu füttern. Sie sahen wie normale Vögel aus. Sie hatten ihre bösartige Magie verloren.
Er war froh darum.
Die Obdachlosen bedankten sich für die Gaben. Sie stanken nach Alkohol, Schmutz und körperlichem Verfall. Sie sahen zu ihm auf. »Gib Deinem Nachbarn eine Chance«, sagte er, so wie die Kameras es ihm vorschrieben. Später kam die Schauspielerin hinzu. Aus seiner Hand verteilte sie Geschenke an bedürftige Familien, die man auf dem Marktplatz versammelt hatte. Der Duft nach Gewürzen wehte vom Weihnachtsmarkt herüber. Bald würde er seine alte Beschäftigung wieder aufnehmen.
Die kleine Frau mit den Keulenarmen hätte er überall erkannt. Sie stand in der Tür eines kleinen Ladens, einer Änderungsschneiderei. Er trat näher. Sie hatte noch immer die gleichen sanften Kuhaugen, die sich aus dem teigigen Gesicht drückten wie Glasmurmeln. Sie war sein Schicksal. Frierend schlang sie die Arme um sich und ging in den Laden zurück. Das Schild über der Tür trug einen ausländisch klingenden Namen. Ein prächtig ausgestatteter Weihnachtsmann mit fröhlich geblähten Wangen und Rauschebart schob sich hinter ihr ins Ladeninnere.
Stoffe lagen auf einem Holztisch. Es ging ärmlich und eng in der Änderungsschneiderei zu. Die Frau drehte sich zu dem Weihnachtsmann um. Sie hatte eine Schere in der Hand. Ihre Arme standen in einem eigenwilligen Winkel vom Körper ab, ihre fragenden Augen ließen nicht erkennen, was in ihr vorging.
Der Weihnachtsmann hatte gelernt, Scherze zu machen. Scherze waren neu in seinem Leben. Er war noch ungeübt, aber er würde besser werden. Die Zukunft würde ihm gehören. Regungslos standen sie sich gegenüber.
Seit zwei Wochen wurden von einem als Weihnachtsmann verkleideten Räuber Überfälle auf kleinere Geschäfte verübt. Der Weihnachtsmann konnte immer unerkannt entkommen, weil er erbeutetes Kleingeld vor die Füße der Passanten warf und den entstehenden Tumult zur Flucht nutzte.
»Überfall!«, rief der Weihnachtsmann in der Änderungsschneiderei, Gleich würde er den Scherz mit Gelächter auflösen und die Verkleidung abnehmen. Er war gespannt, ob die Frau, die sein Leben veränderte, ihn erkennen würde.
Die Schere fuhr in seinen Hals, als er den künstlichen Bart entfernen wollte. Die Frau mit den Kuhaugen stand vor ihm. Die Arme standen von ihrem Körper ab. Das Leben rann aus seinem Hals. Er wollte erklären. Seine Welt begann sich zu drehen. Die Frau hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen. Er tastete nach seinem Hals. Die Frau presste den linken Handballen gegen ihr Gesicht und starrte auf die Blutfontänen, die aus seiner Wunde schossen. Verzweifelt wiederholte sie die immer gleiche Handbewegung, als wolle sie eine Öffnung verschließen.
Deutlich, ganz deutlich hörte er ihre flache Stimme mit der fremdartigen Betonung, als seine Beine ihren Dienst versagten und er auf die Knie sank: »Musst Du drucken!«
2
DieTherapie
Anfangs ketteten sie mich noch fest, wenn ich in das Behandlungszimmer gebracht wurde. Es waren immer die gleichen Männer, welche die Aufgabe hatten, Scheusale wie mich aus der Zelle zu holen und in den Krankentrakt zu begleiten.
Es ist ein interessantes Phänomen, dass für ähnliche Vorgänge in der Amtssprache die unterschiedlichsten Begriffe Verwendung finden. Die Verlegung von einer Strafanstalt in eine andere mit einem motorisierten Transportmittel heißt verschuben. Verschuben ist ein Wort, dessen man außerhalb der Mauern staatlichen Gewahrsams nicht habhaft werden kann. Es ist in keinem Wörterbuch verzeichnet und fristet sein Dasein hinter den blassroten Aktendeckeln des Strafvollzugs. Innerhalb einer Haftanstalt werden die Insassen zu ihren Bestimmungsorten verbracht. Die Begriffe atmen Disziplin ein und Autorität aus.
Es ist ein geordnetes Leben für alle.
In dem äußeren Rahmen wurde auch ich bewegt. Scheusale wie ich waren selten. Sie nahmen am allgemeinen Zusammenschluss der Häftlinge nicht teil. Man fürchtete um ihre Sicherheit. Arbeitseinsatz und Hofgänge waren streng rationierte Vergünstigungen für den Abschaum, wie man die Pädophilen und sonstigen Triebtäter nannte. Wem es während seines Prozesses nicht gelungen war, ein psychiatrisches Gutachten zu erlangen, das ihm Unzurechnungsfähigkeit attestierte und die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung befürwortete, bildete den Bodensatz in der Hierarchie der Haftanstalten.
Meinem bemühten, aber unerfahrenen Verteidiger und mir war es nicht gelungen, den Gerichtsgutachter von meiner Schuldunfähigkeit zu überzeugen. Er bescheinigte mir nach drei emotionslos geführten Gesprächen Gefühlskälte, gepaart mit einem abnorm ausgebildeten Sexualtrieb und einer hohen Intelligenz, der es jedweder Empathie ermangele. Im Übrigen sei ich voll schuldfähig. Diese Punkte hatte der Gutachter mehr oder weniger aus dem Psychogramm des Buchmonsters Hannibal Lecter abgeschrieben. Ich weiß es, denn ich habe alle Bücher des Autors gelesen. Ich weiß es, denn ich bin ein Kannibale.
Was er dringend empfahl, war eine Langzeittherapie bei einem forensischen Psychiater, der zweimal pro Woche Menschen wie mich aus ihren Zellen holen ließ, um sich in ihren Kopf zu bohren und ihre Beweggründe ausfindig zu machen. Er war auf der Suche nach Verhaltensmustern in dem Pfuhl des Bizarren und Abseitigen.
Ich nannte die Männer mit den steinernen Mienen und den gestärkten weißen Kitteln, die mich von dem Zellentrakt in den Krankentrakt verbrachten, meine Pfleger. Sie waren speziell für den Umgang mit Scheusalen wie mir ausgebildet. Ihre eingeübten Handgriffe und die professionelle Distanz, die sie zu mir hielten, konnten mich nicht täuschen.
Ich durchschaute sie. Ich konnte das Unwohlsein in ihren Augen lesen. Wenn ich auf ihr Kommando hin die Durchsuchung meiner Kleidung und das Abtasten meines Körpers mit weit abgespreizten Armen und Beinen über mich ergehen ließ, wenn ich den Mund öffnete und zwei Finger mit Plastiküberzug in meinen Rachen stießen, bis sie einen Würgereiz auslösten und wenn mein unschuldiger After die gleichen Finger endlich davon überzeugte, dass er keine lebensbedrohliche Schmuggelware transportierte, lächelte ich.
Das Lächeln eines Kannibalen kann eine schreckliche Waffe sein. Meine Pfleger überspielten ihre aufkeimende Furcht mit derben Sprüchen, die mich provozieren sollten.
Ich lächelte.
Der Unterredungsraum des Psychiaters war eine Zelle mit dem Türschild Behandlungszimmer – Bitte nicht stören. Man hatte sich nicht die Mühe gemacht, das vergitterte Fenster und die olivgrüne Ölfarbe der Wände zu schönen, um dem Eintretenden eine andere, freundlichere Realität vorzugaukeln. Der staatliche Etat sah solche Verschönerungsmaßnahmen nicht vor. Therapie brauchte keine Dekoration. Ein massiver, mit dem Boden verschraubter Tisch stand als Barriere quer in der Zelle. Die Hände mit den Handschellen wurden an einen massiven Stahlbügel gekettet, der als Stahlbuckel aus der Resopaloberfläche des Tisches wuchs. Bis auf zwei Plastikstühle und eine Flasche Desinfektionsmittel zum Sprühen war der Raum kahl. Jedes Geräusch erzeugte einen Widerhall, der noch eine Weile zwischen dem Mauerwerk hing, als verbiete ihm seine natürliche Neugier einen schnellen Abschied.
Wenn man herumgestoßen und zum Objekt degradiert wird und weiß, dass dieser Zustand bis zum Lebensende anhalten kann, ist Schweigen und Lächeln eine angemessene Reaktion. Selbstmord ist die andere Variante. Für mich kam sie nicht in Frage.
Ich war auf Mord spezialisiert.
Für die erste Begegnung mit meinen Therapeuten hatte ich eine besondere Begrüßung vorgesehen. Nicht so etwas Profanes wie wüste Drohungen, Augenrollen und Zähnefletschen. Ich bin ein Psychopath, aber keineswegs von Sinnen. Wer schon einmal eine Verabredung mit einem wichtigen Menschen getroffen hat – und das haben wir fast alle – kann dieses Gefühl der Unsicherheit und der gespannten Erwartung nachvollziehen. Es stimmt, dass es keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck gibt. In Sekundenbruchteilen geschieht die Einordnung des anderen in die bekannten Schubladen. Wenige Worte, ein Körperduft, der Schnitt des Haares, eine Geste, ein Augenaufschlag reichen für eine Kategorisierung, die so starr und unverrückbar ist, dass selbst monatelanges Mühen um eine Wahrnehmungsveränderung umsonst bleibt oder allenfalls marginale Modifikationen erzeugt. Mit den mir zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln wollte ich das Heft des Handelns in der Hand behalten.
Als sich die Sicherheitstür in meinem Rücken schloss sagte ich, ohne aufzublicken: »Ich bin ein Kannibale.«
Ich sagte es mit einer flachen Stimme und in einer höheren Tonlage als der, die ich für gewöhnlich anschlug. Ich wollte, dass sich der Satz dämonisch und unwirklich anhörte. Er sollte wie das Werkzeug eines Scheusals wirken. Nur ein Satz. Die ganze Wahrheit und dann nichts mehr als ein Lächeln. Es ging mir um Authentizität, um eine wohlverdiente Einstufung, um den medizinischen Ritterschlag meiner Gefährlichkeit. Das war alles, was ich gewinnen konnte. Und es war viel.
Die Schritte, die ich vernahm, waren leichtfüßiger als ich sie erwartet hatte. Eine Akte fiel auf den Tisch. Ich sah zu Boden. Der Beton war durchzogen von feinen Rissen, die wie kryptische Botschaften auseinander liefen.
»Sie sind kein Kannibale. Soviel können wir gleich feststellen«, sagte eine Stimme, die gemeinsam mit den Schritten meine Sitzposition umrundete. »Wissen Sie, was wahrer Kannibalismus ist?«, fragte die Stimme und ließ keinen Zweifel daran, dass sie es wusste und es mir ohne Verzug mitteilen würde. Als die Stimme in leichtem Plauderton fortfuhr, hatte sie sich mir gegenüber gesetzt. »Blue Straggler sind stellare Kannibalen. Sie sind die einzigen echten Kannibalen des Universums seit der Entstehung von Materie. Sie sind blaue Nachzügler in Kugelsternhaufen, junge, massereiche, heiße Sterne, die den benachbarten Sternen Materie entreißen und sie verschlingen, um ihre Jugend zu erneuern. Das Zentrum des Kugelsternhaufens 47 Tucanae ist der Beweis.« Ein Stuhl scharrte über den Fußboden.
Die Stimme schwieg.
Obwohl ich es gerne vermieden hätte, sah ich auf. Die Stimme hatte ohne Anstrengung mein Konzept zerstört, so als sei sie auf meine Vorstellung vorbereitet gewesen. Es war mir unmöglich, meine Pose durchzuhalten. Zum ersten Mal seit meiner Festnahme war ich neugierig. Ich war neugierig auf das Gesicht, dem die Stimme gehörte und hinter dessen Stirn ein Denkapparat steckte, der in Anwesenheit eines unberechenbaren Scheusals, mit geschwätziger Gelassenheit eine abstruse Geschichte von sich gab, als ob die tiefsten Weltweisheiten in ihr verborgen lägen.
Es wunderte mich kein bisschen, dass ein staubiger Heiligenschein aus Licht schräg über den Schultern des Mannes tanzte, der in entspannter Haltung vor mir saß. Er war korrekt gekleidet. Eine Symphonie aus taubenblau und weiß. Die Anzugsjacke war zu eng. Ein öliger Fleck verunzierte den Hemdkragen. Über dem Gürtel der Hose quoll ein Wohlstandsbauch auf wie ein Teigklumpen. Die Kleidung war billige Massenware. Nichts, womit ich mich zu meiner Zeit in Freiheit abgegeben hätte. Ich legte Wert auf eine gepflegte Erscheinung. Kräftige Finger, wie zum Sprung leicht gekrümmt, trommelten einen komplizierten Takt auf die Pappe der Akte. Die unteren Glieder der Finger waren dicht behaart. Es waren schwarze, gebogene Härchen, geformt wie Klauen. Die Fingernägel waren manikürt, die Nagelbecken gerötet. Die Nägel erinnerten an Klappspaten. Ich sah mir die Daumen an. Dort kurze, breite Nägel mit deutlich sichtbaren Halbmonden. Ich versuchte mich zu erinnern, wer mir so eindringlich suggerierte, dass Menschen mit kurzen, breiten Daumen mit Vorsicht zu genießen sind. Ich glaube, es war meine Großmutter. Vielleicht galt ihre Warnung auch nur für Frauendaumen.
Ich war ein guter Beobachter. Ich war auch ein guter Menschenkenner. Das war eines der Geheimnisse, weshalb man mir erst spät auf die Spur kam. In der Haft perfektionierte ich meine Fähigkeiten. Ich hatte genügend Zeit. Gesichter nahm ich mir immer ganz zum Schluss vor. Sie waren die Krönung meiner Bemühungen.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich enttäuscht war. Ganz sicher aber war ich überrascht. Das kugelige Gebilde, das im Wesentlichen aus fleischigen Wangen und einem ungebärdigen Haarkranz bestand, der sich grau wallend um den Schädel wand, grub sich tief in die Schulterpartie ein. Alles an dem Gesicht glänzte, als sei es kürzlich auf Hochglanz poliert worden. Die Augen saßen wie polierte Knöpfe über einer zierlichen Nase. Sie waren wach, hellwach.
Das Bemerkenswerte war allerdings der Mund. Er war ein breites, großzügig aufgeworfenes Gelände feuchten Lippenrots. Es war die Karikatur eines Mundes, zu grob gezeichnet, um sinnlich zu wirken, mit einer störenden Disproportion zwischen einer schmalen Oberlippe und einer wulstig roten Unterlippe. Der Mund hatte die gesamte untere Gesichtshälfte erobert. Er lächelte. Es war ein Lächeln, das keinen Widerspruch duldete. Ein Lächeln, das abwartend, aber ungeduldig war und seine Ungeduld an die Finger der Hände weitergab.
Ich hatte etwas anderes erwartet. Vielleicht einen Pfeife rauchenden Bonvivant mit spöttisch hochgezogenen Augenbrauen. Vielleicht ein schwermütiges Oval von Gesicht, in das sich Tausende von Therapiestunden mit ihren Tausenden von Abgründen eingegraben hatten. Vielleicht auch ein hochmütiges Ensemble aus Besserwisserei, Pseudowissenschaft und dem Überlegenheitsgefühl dessen, der über das Wohl und Wehe des vor ihm Angeketteten entscheiden konnte, wie es ihm beliebte.
Dann öffnete sich das Lächeln und der Mund fragte: »Was sagen Sie dazu?« Die Hände hatten aufgehört zu trommeln, als wollten sie die Antwort nicht stören.
Ich entschloss mich, zu schweigen. Ich hatte keine Antwort parat, die meinem Image gerecht geworden wäre. Mit wenigen Sätzen hatte der Therapeut mit den Posaunenengelwangen und dem ungeschlachten Mund meine Strategie ad absurdum geführt. Und er wusste es. Damals wollte ich ihn noch nicht töten. Ganz im Gegenteil. Während ich fühlte, wie seine schrägen Ausführungen meine sorgfältig erarbeitete Positionierung als unberechenbares Monster erschütterten, nahm ich mir vor, von ihm zu lernen. Ich würde dem Kugelkopf eine eng begrenzte Zusammenarbeit anbieten. Ich würde ihm erlauben, meine Welt zu betreten und die Erkenntnisse zu gewinnen, die er sich erhoffte. Dabei würde ich ihn ausforschen, seine Art, das Gegenüber spielerisch auszuhebeln, erlernen und gestärkt aus den Begegnungen herausgehen. Ich würde alle Kräfte brauchen, deren ich habhaft werden konnte. Lebenslänglich ist eine lange Zeit.
Endlich hob ich den Kopf und sah ihm in die Augen. »Sie haben einen Fleck auf Ihrem Hemdkragen«, sagte ich.
So begann meine Liaison mit Professor Drescher. Er nannte unsere Treffen Sitzungen. Therapeuten haben ihre eigene Sprache wie alle Spezialisten. Sie sprechen wenig und schreiben viel. Ihre Körpersprache ist offen und dem Patienten zugeneigt. Sie vermeiden es, Barrieren vor ihrem Körper zu bilden. Schockierende Details quittieren sie mit einem Augenflattern und dem verstohlenen Berühren eines Mundwinkels mit dem Zeigefinger der Schreibhand. Oft sind sie beim Pokerspiel erfolgreicher als ihre Gegner. Durchschnittlich fünf Jahre nach Eingehen einer Ehe werden sie geschieden. Sie tendieren zu unauffälligen Mittelklassewagen, altmodischer Kleidung und Mietwohnungen im zweiten Stock. Viele tragen Bärte. Um die Attribute weiblicher Therapeuten kümmerte ich mich nicht. Ich wollte nur für meinen Fall vorbereitet sein.
Die Sache entwickelte sich gut. Wir hatten unsere Rituale. Das war unsere gemeinsame Verbindung zu den Kannibalen. Auch sie hatten Rituale, wenn sie Fleisch verzehrten, das von Artgenossen stammt. Ich eignete mir an, dass man den Kannibalismus unter Menschen Anthropophagie nennt und stellte die These auf, dass beim christlichen Abendmahl eine sozial akzeptierte Form des Kannibalismus stattfindet, wenn die Gläubigen den Leib und das Blut Christi in Form von Brot und Wein zu sich nehmen. Der Professor nickte, als habe er meine Ausführungen so erwartet. Wahrscheinlich hatte er es sogar. Er war ein Meister des Konterns. Er schien einen unerschöpflichen Vorrat verbaler Paraden in seiner Mundhöhle mit sich zu führen, die er ständig mit der Zunge sortierte.
»Transsubstantiation«, sagte er mit seiner weichen Stimme, die im Widerspruch zu seiner derben Mundpartie stand. »Wir sind beide katholisch«, fuhr er fort, »und wissen um die Problematik dieses Ritus.« Dann wischte er mit einer Handbewegung über den Tisch und fegte das Argument symbolisch zu Boden, Es war seine Art, zu zeigen, dass ich etwas Neues aufbieten musste. Er tadelte nicht, er ermunterte nicht, er stellte keine Fragen, die den Gesprächsverlauf zu seinen Gunsten manipulieren sollten. Er wischte und das reichte aus, dass ich bei einer der Sitzungen begann, von mir zu erzählen.
Ich begann nicht in der Kindheit, denn meine Erinnerungen waren bruchstückhaft. Natürlich hatte ich mir überlegt, eine zu mir passende Legende zu schaffen. Die Misshandlungen durch einen trunksüchtigen Vater. Ein inzestuöses Verhältnis zu meiner Mutter. Die kindliche Freude am Quälen von Tieren. Ausgerissene Spinnenbeine, verstümmelte Frösche und dann die erste erschlagene Katze.
Ich verwarf den Gedanken als zu lehrbuchhaft und zu leicht zu durchschauen. Also begann ich mit dem Tag im Mai, an dem der Nachtwind Aufgeregtheit in die Gardinen meines Schlafzimmers wehte. Es würde ein besonderer Tag werden. Das spürte ich. Ich schlief unruhig. Es lag an der jungen Frau. Ich hätte mich nicht noch einmal mit ihr verabreden dürfen. Die Essenseinladung war harmonisch verlaufen, der Kinobesuch führte zu einer Verstärkung der Annäherung. Nichts Ungewöhnliches. Verschwitzte Hände, eine Umarmung, die wie unabsichtlich erscheinen sollte und das Einatmen des Duftes eines fremden Körpers. Wir waren beide erregt. Es war ein Spiel unter jungen Menschen. Die Evolution hatte das Spiel entworfen. Es war mächtig und fordernd.
Die dritte Verabredung würde die Wende bringen.
Der Nachtwind wollte mir sagen, dass es noch Zeit war, abzusagen. Ich sagte nicht ab.
Wir trafen uns im Wald. Sie hieß Isabell. Unsere gemeinsame Ausrede war ein Picknick. Ich verbot Isabell, mit irgendjemandem über unser Picknick zu reden, »Wir wollen ungestört sein«, sagte ich und legte Isabell einen Zeigefinger an den Mund. Ihre Lippen küssten den Finger. Sie hatte verstanden. Ich lächelte. Meine Augen lächelten nicht mit. Sie waren Wölfe, die sich über den Körper Isabels hermachten. Das Verlangen schnürte mir die Kehle zu. Blutrote Lippen an meinem Finger. Was würde man daraus alles machen können.
Der Nachtwind hatte mich beobachtet. Er kannte mich, las meine Träume, über die ich mit niemandem reden konnte. Ich hatte keine Geheimnisse vor ihm. Er mischte sich nicht ein. Nur eine sanfte Warnung. Dann war ich im Wald.
Ich hatte die Stelle gut ausgesucht. Sie lag an einem ehemaligen Holzfällerpfad, der nicht mehr begangen wurde. Der Abhang war steil und der Pfad überwuchert von Brombeerranken und verfilzten Grasbüscheln. Es war heißer als im Tal, wo sich das Dorf in den entferntesten Winkel zwischen zwei Bergketten drängte. Die Geräusche des Waldes fanden sich zu ihrer eigenen Melodie. Ein Kuckuck rief und verstummte. Insekten suchten rastlos Blumenkelche auf. Die Luft war diesig. Es würde ein Gewitter geben.