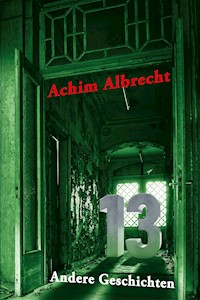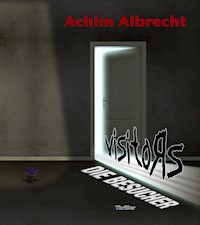Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OCM
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein gelernter Auftragskiller, ein bedächtiger, sachlicher Mann, der keine unnötigen Risiken eingeht. Er ist in die Jahre gekommen. In die Jahre, in denen die Erfahrung beginnt, die Fähigkeiten zu übersteigen. Er hat nichts vergessen. Alles aufnotiert. Er weiß, dass seine Zeit abläuft. Seine Schutzbefohlene ist mit ihm alt geworden. Er beginnt Vorsorge zu treffen für die Zeit, in der sie alleine sein wird. Alleine ohne ihn, denn die Vergangenheit wird ihn bald einholen. Es ist unvermeidlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Achim Albrecht
Der Engelmacher
Thriller
1. Auflage August 2012
©2012 OCM GmbH, Dortmund
Handlungen und Personen dieses Romans sind frei erfunden.
Gestaltung, Satz und Herstellung:
OCM GmbH, Dortmund
Verlag:
OCM GmbH, Dortmund, www.ocm-verlag.de
ISBN 978-3-942672-13-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt auch für die fotomechanische Vervielfältigung (Fotokopie/Mikrokopie) und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
‚Die Rache ist mein; ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten; denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu.‘
5. Mose 32:35
I.
Die Verfassung der Stadt passte zu dem alten Mann. Sie hatten sich aneinander gewöhnt und zu einem gemeinsamen Rhythmus gefunden. Es war nicht leicht gewesen. Mit zunehmendem Alter wird man störrischer und beharrt auf den eingefahrenen Gleisen. Gewohnheiten geben Sicherheit. Das gilt für Städte und für alte Männer in gleicher Weise.
Jetzt schmiegte sich die Stadt an den nächtlichen Spaziergänger heran. Die einsetzende Dunkelheit machte es ihr leicht. Die länger werdenden Schatten wischten über die Unzulänglichkeiten des rissigen Gesichtes der Stadt und bald würden sie eine Decke aus kühler Schwärze über die Unkrautnester und die kahlen Hinterhöfe gelegt haben. Die Stadt hatte bessere Zeiten gesehen. Das Gleiche galt für den Mann.
Als er vor einigen Tagen ankam, konsultierte er seine Aufzeichnungen und prägte sich jedes Detail ein. Das tat er immer. Seit wie vielen Jahren konnte er selbst nicht mehr sagen. Sorgfalt und Vorsicht waren zu seiner zweiten Natur geworden. „Hast macht das Leben zu einer verderblichen Ware“, hatte ein Lehrer einmal zu ihm gesagt, als er sich als Junge auf dem Schulhof beim Herumtollen das Schienbein an einer Eisenstange prellte. Eine bleiche, gezackte Narbe unterhalb des Knies erinnerte den alten Mann an den Schmerz, der unter dem gleichgültigen Blick des Lehrers ins Unermessliche zu wachsen schien. Immer, wenn er in seinem Kastenwagen unterwegs war und die zur Routine gewordenen Anweisungen seiner Checkliste durchging, fuhr er mit dem rechten Zeigefinger über die Narbe und frischte die Erinnerung auf: „Hast macht das Leben zu einer verderblichen Ware“.
Andere mochten auf ihr Improvisationstalent, ihre Kräfte und ihren Elan setzen. Der alte Mann setzte auf Kontinuität, Sorgfalt und Erfahrung. Er konnte es sich nicht erlauben, seinen Broterwerb für einen Moment der Unachtsamkeit aufs Spiel zu setzen. Nicht in seinem fortgeschrittenen Alter. Nicht in seinem Beruf und nicht bei seiner mühsam erworbenen Reputation.
Die Jungen hielten nichts von seinem stoischen Planen. Sie vertrauten auf ihren Instinkt und ihre Kreativität. Sie lebten mit Adrenalin und Aggression – und sie lebten gut. Er wusste von ihnen. Natürlich hatte er sie nie zu Gesicht bekommen. Das war die Grundregel seines Berufs. Man blieb unsichtbar.
Der Wind hatte aufgefrischt. Die abschüssige Straße würde bald in einen spärlich bebauten Vorort abbiegen. Der alte Mann ging wie alte Männer gehen. Er war rüstig, aber man sah ihm seine Jahre an. Sein Schritt wirkte tastend, als ob er die Vorwärtsbewegung für einen Moment aussetzen würde, bevor er den Fuß aufsetzte. Das steife und vorsichtige Gehen war ein Wegbegleiter älterer Menschen. Der körperliche Verfall befiel zuerst die Gelenke und raubte ihnen ihre Biegsamkeit. Dann kam alles andere.
Der Mann konnte sich darum keine Gedanken machen. Er hatte Dinge zu tun. Dinge, die nach der Wegbiegung auf ihn warteten. Er hatte sich darauf vorbereitet. Seine Hüfte ließ ihn heute in Ruhe. Die Luftfeuchtigkeit musste niedrig liegen. Er war dankbar dafür. Das Alter lehrt einen, dankbar für Kleinigkeiten zu sein.
Er hatte die Hände in den Manteltaschen vergraben. Wenn er beruflich unterwegs war, verzichtete er auf den Gehstock. Er tat es nicht aus Eitelkeit. Wäre er eitel gewesen, hätte er vielleicht auch auf die Brille verzichtet. Der Gehstock wäre ihm mehr hinderlich als nützlich gewesen. Außerdem hatte er andere Hilfsmittel. Hilfsmittel, die mit ihm durch dick und dünn gegangen war. Hilfsmittel, deren Gebrauch ihm in Fleisch und Blut übergegangen war. Dinge, die in Manteltaschen Platz hatten und ihm Zuversicht gaben.
Er schritt schneller aus. Sein Schatten streifte an einer Hauswand mit einer hochnäsigen Fensterfront vorbei. Die Gardinen hatten die Außenwelt ausgesperrt. So liebte es der Alte. Sein Atem ging regelmäßig. Er war noch immer gut in Form. Erstaunlich gut, wenn es darauf ankam. Heute kam es darauf an.
Er sah auf die Uhr, ohne seinen Schritt zu verlangsamen. In exakt zwölf Sekunden würden die Straßenlampen mit einer milchig weißen Aura dem schwindenden Tag die Herrschaft streitig machen. In Gedanken zählte er die Sekunden herunter. Autoverkehr tröpfelte an ihm vorbei und verlor sich hinter der Straßenbiegung. Der alte Mann wusste, was er zu Gesicht bekäme, wenn er den Schuhladen zu seiner Rechten passierte und dem welligen Trottoir folgte. Schlagartig würde sich die Szenerie ändern. Das bucklige Altstadtviertel würde sich zu einem weiten Areal ausweiten, dessen Bebauung schon seit Jahren beschlossen war. Die Stadt hatte in der Zwischenzeit einen notdürftig bepflanzten Park angelegt, der mit seinem kümmerlichen Bewuchs öde und zerzaust wirkte. Eine knallbunte Wippe langweilte sich neben einer ebenso grellen Rutsche. Die Kinder schenkten ihnen nur selten Beachtung. Im Hintergrund würde der Güterbahnhof sein übliches dissonantes Konzert aus metallischen Klängen zum Besten geben. Weit rechts, geduckt, mit einem breiten, weithin beleuchteten Maul der Supermarkt, der mit Plakatwänden und Leuchtschriften seine Sonderangebote anpries.
Der Alte hielt den Blick auf den Supermarkt gerichtet. Er ging langsam weiter. Wieder sah er auf die Uhr. Die einzige Variable in seiner Kalkulation war die Frau. Wie alle Frauen war sie keine Konstante. Frauen waren niemals Konstanten. Sie waren von der Natur dazu ausersehen, niemals berechenbar zu sein. Der alte Mann wusste, dass sein Blick auf die Uhr ein Akt der Hilflosigkeit und eine Bitte um Erlösung war. Manchmal half ein solcher Blick.
In seinen Notizen hatte er vermerkt, dass die Frau festen Gewohnheiten folgte. Übersetzt in die Alltagssprache hieß die Bemerkung, dass er an bestimmten Orten zu kalkulierbaren Zeiten auf die Frau treffen würde. Der Supermarkt war einer dieser Orte. Der Zeitrahmen von 18.40 Uhr bis 18.50 Uhr war eine der Zeiten. Seinen Beobachtungen zufolge war es die beste aller Zeiten am besten aller Orte.
Dem Mann halfen die wenigen Vorteile, die das Alter mit sich bringt: Erfahrung und Geduld. Erstere, weil ein über die Jahre geübter Instinkt eine schlafwandlerische Untrüglichkeit entwickelte und Letztere, weil die Unzulänglichkeiten des Alters eine zunehmende öffentliche Demütigung bedeuteten, die nur mit einer resignierenden Langmut zu ertragen war.
Der Mann konnte es sich erlauben, offen nach der Frau Ausschau zu halten. Er würde neben den anderen Passanten nicht auffallen. Niemand achtete auf einen hageren Alten, der sich linkisch seinen Weg zu einem Supermarktparkplatz bahnte. Es war die Zeit der größten Geschäftigkeit, die Zeit voluminöser Einkaufstüten und quengelnder Kinder, die Zeit, in der man mit sich selbst genug zu tun hatte. Selbst ein aufmerksamer Beobachter hätte ihn mit nicht mehr als der Beschreibung „rüstiger Rentner“ versehen.
Der alte Mann war kein Rentner. Er war weit entfernt davon.
Die Frau trug ihren leuchtend orangen Anorak. Sie war leicht auszumachen. Sie war nur leicht verspätet. Der alte Mann nickte zufrieden. Seine Beine fühlten sich kalt an, aber er fror nicht. Wenn er bei der Arbeit war, waren die äußeren Umstände von minderem Interesse.
Er wusste, dass die Frau ihre Einkaufstüten quer über den belebten Parkplatz zur Rückseite des klobigen Gebäudes tragen würde, wo sie auf einem unbefestigten Gelände ihren Kombi parkte. Sie scheute Menschenansammlungen. Das hatte sie mit dem alten Mann gemeinsam. Beide hatten ihre Gründe dafür. Ein Autoradio plärrte einen Schlager über die Wagendächer. Die trotzige Stimme eines Jungen schrie nach seiner Mutter. Der anschwellende Heulton begleitete den alten Mann, der mit gesenktem Kopf das Gebäude umrundete. Er würde schneller sein als die Frau.
Die Nacht hatte das Brachland eher erreicht als den Rest der Stadt. Sie verschluckte Licht und Geräusche und ersetzte sie durch die Sprache der Dunkelheit. Der alte Mann war vorbereitet. Der massige Leib eines Lastwagens bot ihm Flankenschutz. Der Mann lehnte sich gegen das Führerhaus. Der Kombi der Frau bildete mit wenigen anderen Wagen eine zahnlückige Formation.
Der alte Mann rückte seine Brille zurecht. Seine Aufmerksamkeit galt einem Unterschlupf unter einer Laderampe. Er nahm nichts Außergewöhnliches wahr, aber seine Ahnungen trogen ihn nie. Das Jucken in der Armbeuge verhieß nichts Gutes. Es sei eine nervöse Reaktion, bescheinigte ihm ein Hautarzt, der ihm eine Salbe aufschrieb. Der Mann benutzte die Salbe nie. Er begriff das Jucken als Lebensversicherung. In seinem Beruf konnte man nicht genug Lebensversicherungen haben.
Er erkannte die Frau an ihrem Schritt. Sie ging schnell und verlangsamte ihr Tempo auch in der Dunkelheit nicht. Der Kombi reagierte auf das Signal des Schlüssels mit einem Aufblenden der Scheinwerfer, die zwei breit streuende Lichtkegel in die Dunkelheit stanzten.
Der alte Mann sah den Jugendlichen zuerst. Das Jucken in seiner Armbeuge hatte an Intensität zugenommen. Die Frau stieß einen kleinen Schrei aus und blieb stehen. Die Scheinwerfer des Autos trafen auf zwei breitbeinig dastehende Männerbeine. Eine körperlose Stimme sagte: „Lass uns mal sehen, was du eingekauft hast.“ Die Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Es war eine junge, kraftvolle Stimme. Die Frau drehte Hilfe suchend ihren Oberkörper, aber ihre Beine bewegten sich nicht. Der alte Mann konnte ihren Atem hören. Es war der Atem eines verängstigten Vogels.
Eine Hand wischte durch die Lichtbarriere und krallte sich in eine der Plastiktüten. Die Frau würde schreien. Gleich würde sie schreien. Schreien war schlecht fürs Geschäft. Ein Schrei war der Tod jeder Diskretion. In seinem Beruf konnte der alte Mann keine Schreie gebrauchen. Irgendwo, weit oben auf seiner Checkliste war verzeichnet, dass Schreie zu unterbinden waren. Der alte Mann unterband. Es war eine seiner einfachsten Übungen.
Die Frau schrak zusammen, als er sich von der Seite näherte. Sein Gang war fast unbekümmert, so als wolle er sich eine lohnenswerte Vorführung aus der Nähe besehen. Mit heiterer Stimme fragte er: „Darf ich den Herrschaften beim Tragen helfen?“ Der alte Mann hatte ein Lächeln aufgesetzt und wandte sich den gut ausgeleuchteten Männerbeinen zu. Entschuldigend hob er eine Hand und sagte: „Keine Sorge. Ich möchte nicht lange stören. Natürlich weiß ich, dass ich ein nerviger Alter bin, der am besten zum Teufel gehen sollte“. Er machte eine kurze Pause und fügte hinzu: „Vielleicht mache ich das. Nur nicht hier und nicht heute. Iucundi acti labores“. Seine Stimme hatte einen anderen Tonfall angenommen. Sie klang belustigt und hob und senkte sich in perfektem Übereinklang mit der Stahlrute, die einen Halbkreis beschrieb und das Handgelenk des Jugendlichen zertrümmerte, der noch immer die Einkaufstüte der Frau umklammert hielt.
Der alte Mann beherrschte die Choreografie, die sich Stahlruten wünschen, in Perfektion. Mit spielerischer Leichtigkeit schnellte er ihr verdicktes Ende gegen die Schläfe des ziegenbärtigen Gesichtes, das mit hervorquellenden Augen und einem ungesund roten Teint in die Lichtkegel fiel. Das Geräusch war kaum nennenswert. Ein ersticktes Gurgeln, ein trockenes Knacken und ein Körper stürzte einem zertrümmerten Handgelenk hinterher. Kein Schrei. Eine saubere Operation. Der alte Mann erlaubte sich ein Lächeln.
„Angenehm sind getane Arbeiten“, sagte er sanft, als er sich der Frau zuwandte. Er streckte seine Hand aus. Die Stahlrute war verschwunden. Mit der Hand vollführte er eine bittende Geste. Er verstand sich auf bittende Gesten. Er war eine vielschichtige, gereifte Persönlichkeit mit großer Menschenkenntnis. Menschenkenntnis war sein großes Kapital.
Der Mund der Frau stand offen. Ihre weit geöffneten Augen starrten auf das Bündel Mensch zu ihren Füßen. Sie würde nicht schreien. Der Schrei war in ihrem Hals erstickt und würde sich nicht neu formieren. Der Schock hatte das Adrenalin verdrängt. Ohne Adrenalin kein Schrei. Der alte Mann wusste das. Er wusste auch, wie er weiter vorzugehen hatte.
„Angenehm sind getane Arbeiten“, wiederholte er. Seine Stimmlage war warm und einladend. „Cicero, aus De finibus“, vollendete er. Die Frau drehte ihm ihren Kopf zu. Trotz ihrer Blässe sah sie attraktiv aus. Das ungebärdige Kurzhaar ertrank in Strähnchen und die aufgeworfene Oberlippe zeugte davon, dass sie über einen starken Willen verfügte. Ein apartes, fein geschnittenes Gesicht, in das sich die gelebten Jahre eingegraben hatten.
Der alte Mann kannte das Gesicht. Er hatte sich in den letzten Wochen mit nichts anderem beschäftigt. Mit dem Gesicht, mit der Frau und den Aufzeichnungen, die die Frau sezierten wie einen kostbaren Gegenstand. Er konnte nicht arbeiten, wenn er nicht ausreichend vorbereitet war.
Er berührte den Arm der Frau. Sie schrak zusammen. Ihre Augen blickten verständnislos. „Der lateinische Satz“, sagte der alte Mann geduldig. „Es ist die Übersetzung eines Ausspruchs von Cicero“. Was er nicht sagte, war alles andere, was mit dem Satz zusammenhing. Es waren die alten Wahrheiten aus dem Handbuch für die Berufspraxis, die er in all den Jahren seiner beruflichen Tätigkeit zusammengetragen, geprüft und für gut befunden hatte. Er hatte damit begonnen, sie zu ordnen und in eine Reihenfolge zu bringen. Es war sein Privatvergnügen. Das harmlose Vergnügen eines Menschen, der mit seinem Einzug in ein städtisches Projekt „Betreutes Wohnen“ einen Lebensabschnitt begann, der Zeit und Hoffnungslosigkeit freisetzte.
Der lateinische Satz gehörte zu der Kategorie „Ablenkung“: „Ist man körperlich unterlegen und reicht der Überraschungseffekt nicht aus, ist es angebracht zu reden und das Gegenüber abzulenken, um mit einer gezielten Aktion in Vorteil zu kommen.“
Der alte Mann hatte mehr als einmal den praktischen Wert dieses Merksatzes testen können. Latein erbrachte die beste Wirkung. Es erzeugte eine unerwartete Wendung von sperriger Exotik und fiel wie eine Barriere in die Situation. Dem geübten Verwender verschaffte es wertvolle Sekunden. Der alte Mann war geübt. Er hatte den Effekt perfektioniert. Er und die Stahlrute, die vertraut und beruhigend in seiner Hand lag. Mehr brauchte es nicht. Nur sie beide und Cicero.
Behutsam führte er die Frau zu ihrem Wagen. Er hatte ihr die Einkaufstüten abgenommen. Er redete noch immer beruhigend auf sie ein. Die Stadt ließ sie alleine. Der alte Mann schaute sich um. Es war, wie es sein sollte.
Die Frau war ein leichtes Gewicht in seinem Arm. Sie kam ihm kleiner und schutzloser vor als er sie in Erinnerung hatte. Dieses Phänomen hatte er schon öfter erlebt. Menschen, die in Aufzeichnungen auferstanden und durch Beobachtung fixiert wurden, schienen aus der Nähe anders und fremd. Er hatte gelernt damit umzugehen. Er konnte keine Zeit mit ihnen verbringen. Nicht genug Zeit, um sie kennenzulernen.
Er wollte sich nicht beschweren. Jeder Beruf brachte Probleme mit sich.
„Sind Sie ein Schutzengel?“ Die Frage kam zögerlich. Eine verwischte, atemlose Frauenstimme, der man die Autorität abgeschliffen hatte. Er öffnete die Wagentür und setzte die Frau behutsam auf den Beifahrersitz. Er lächelte und rückte seine Brille zurecht. Er liebte den Augenblick des Erkennens.
Es war, als habe er eine Bühne betreten und das Scheinwerferlicht richte sich auf ihn vor einem Auditorium, das aus einer Person bestand. Einer Person, deren volle Aufmerksamkeit nur ihm gehörte.
„Ellen“, sagte er und streckte die Hand nach dem Wagenschlüssel aus. „Ellen, wir sollten fahren“. Mehr sagte er nicht. Mehr brauchte er nicht zu sagen. Die Frau verstand. Sie umschlang ihren Oberkörper mit den Armen und begann zu weinen. Der alte Mann beobachtete sie mitfühlend. Er war sicher, dass seit vielen Jahren niemand Ellen mit ihrem richtigen Namen angesprochen hatte. Ellen gehörte der Vergangenheit an. Die Erinnerung an sie war verschüttet. Nur Schutzengel kannten den richtigen Namen von Personen wie Ellen. Man hatte ihnen versichert, dass dieser Schutzengel existierte, bevor man sie in das Zeugenschutzprogramm aufnahm und ihre frühere Existenz auslöschte. Man hatte ihnen so vieles versichert.
Das neue Leben konnte mit den Versprechungen nicht Schritt halten. Die Versprechen eilten voraus wie junge Fohlen und galoppierten davon, sobald die Zeugenaussagen erfolgt waren. Ein neuer Ausweis, eine neue Stadt, eine veränderte Biografie. Das war alles. Dann war man alleine mit der Welt, die mit feindlichen Augen zurückstarrte. Die Augen verrieten, dass man ausgeliefert war. Die letzte Zuflucht blieb der Schutzengel.
„Wenn Sie sich unsicher fühlen, wenn Sie sich bedroht fühlen, wenn Sie in eine ausweglose Situation geraten – dann werden Sie den Schutzengel sehen. Er wird anders aussehen, als Sie glauben. Normaler. Unauffälliger. Vielleicht die Frau mit dem Kinderwagen, vielleicht der junge Mann mit den Rastalocken und der Strickmütze auf dem Kopf. Vielleicht ein alter Mann, der die Tauben füttert“. „Vielleicht ein alter Mann …“, hatte der Polizeipsychologe gesagt und dabei seine Stirn in Falten gelegt.
„Sie werden ab einem bestimmten Zeitpunkt daran zweifeln, dass der Schutzengel wirklich existiert. Zweifeln Sie nicht daran. Er wird im richtigen Zeitpunkt eingreifen und einen untrüglichen Beweis seiner Existenz liefern. Sie werden sehen“. Der Psychologe breitete die Hände aus und ließ ein gewinnendes Lächeln darauf fallen. Er hatte seine Arbeit getan.
Die Frau bemühte sich, tief zu atmen. „Ellen“, hatte der alte Mann gesagt. Nur der Schutzengel konnte ihren wirklichen Namen wissen. Wie behände und professionell der Mann gewesen war. Wie seltsam sein Auftreten und wie sorgsam er sich um sie kümmerte. Ellen fuhr sich über die Augen.
Der Schutzengel hatte sie diskret ihren Tränen überlassen und war zu dem reglos auf der Erde liegenden Mann gegangen. Er beugte sich über ihn und schien ihn zu untersuchen. Sein weißes, dichtes Haar war in der Dunkelheit gut sichtbar. Mit einer Handbewegung bedeutete er Ellen die Scheinwerfer zu löschen. Mit einem Schlag rückte die Dunkelheit an den Wagen heran. Die Fassade des Kaufhauses verschwand, der am Boden Liegende verschwand und die Besorgnisse der Frau verschwanden. Heute Nacht würde sie keine Albträume haben. Sie würde nicht hinter den Gardinen auf die Straße hinausspähen auf der Suche nach Augenpaaren, die auf sie gerichtet waren. Sie würde ein Stück ihres Lebens zurückerhalten. Ein Stück von Ellen. Und sie hoffte, dass mit dem unerwarteten Auftauchen des Schutzengels ein neuer Lebensabschnitt für sie beginnen könnte.
Als sich die Fahrertür öffnete und der alte Mann umständlich seine Kleidung abklopfte, war Ellen ganz in Gedanken versunken. Ihr Tagtraum war kurz und intensiv. Er handelte von banalen Dingen. Einem geregelten Familienleben und Kindern. Ja, Kinder wären gut. Und ein nettes Haus. Nichts Luxuriöses. Nur vier Wände Sicherheit und ein Ende der Flucht. Mit einem Schutzengel in der Nähe würde das möglich sein.
„Er wird bald wieder auf den Beinen sein“, sagte der Mann und wies in die ungefähre Richtung des Liegenden. „Bevor wir fahren, muss ich Sie jedoch bitten, noch einige Formalien mit mir durchzugehen“. Entschuldigend zuckte er die Achseln. „Sie wissen, wie es bei Behörden zugeht. Auch Schutzengel haben übergeordnete Behörden. Auch sie müssen Formulare ausfüllen und Berichte schreiben“. Der Alte lächelte wehmütig. Früher musste er ein attraktiver Mann gewesen sein, dachte Ellen. Jetzt war sein Gesicht faltig und pigmentiert um eine eingefallene Mundpartie. Wenn er lächelte, konnte man sehen, dass er ein Gebiss trug.
Die Augen des alten Mannes ruhten auf der Frau. Es waren forschende Augen. „Schutzengel gehen nicht in Pension“, sagte der Mann, als ob er die Gedanken der Frau erraten hätte. „Wir können es uns nicht erlauben. Es gibt zu wenige von uns und zu viele von euch“. Er tätschelte die Hand der Frau. „Wollen wir mit den Personalien anfangen?“
Ellen beantwortete die Fragen zu ihrer Person wahrheitsgemäß. Es erstaunte sie, wie gelassen und souverän der alte Mann seine Arbeit tat. Nichts verriet, dass ihn die Routinebefragung langweilte. Immer wieder nickte er bekräftigend, wenn Ellen seine Vermutungen bestätigte. Mit einem leichten Seufzen lehnte er sich zurück und schloss die Augen. „Kein Zweifel“, sagte er. „Ellen ist Sophie und Sophie ist Ellen.“ Mit seinen Worten klang diese Feststellung endgültig.
„Kein Zweifel“, sagte er noch einmal und beugte sich zu der Frau hinüber. Er umfasste die Rückenlehne des Beifahrersitzes und näherte seinen Mund dem Ohr der Frau. Mit kaum hörbarer Stimme sagte er: „Als im ausgehenden 18. Jahrhundert die Franzosen aus Kanada die amerikanischen Pelztiergegenden betraten, kam anfänglich, so wird erzählt, jeden Sommer ein Priester, um die Händler und ihre Männer in ihren religiösen Pflichten zu unterweisen und zu ihnen und den Eingeborenen in lateinischer Sprache zu predigen. Denn Latein war die einzige Sprache, welche der Teufel nicht verstand und auch nicht zu erlernen vermochte.“
Die Gesichter des alten Mannes und der Frau, die früher einmal Ellen gewesen war, berührten sich fast, als er sie erschoss. Er hatte die Kleinkaliberpistole hinter ihrem Ohr angesetzt. Er wusste, dass die Kugel nicht austreten würde. Er beherrschte seinen Beruf, auch wenn er seine dunklen Seiten hatte.
Sein Beruf war der eines Todesengels.
II.
Es war mehr als sechzig Jahre her und es herrschte Krieg, als der Todesengel seine ersten Schritte machte, die in Richtung seines späteren Berufs wiesen. Es sollte eine Berufung werden, aber das wusste damals noch keiner. Noch nicht einmal der Todesengel selbst. Und als er es wusste, durfte er das Wissen mit niemandem mehr teilen. Nicht mit den Lebenden jedenfalls.
Damals war er acht Jahre alt, ein hoch aufgeschossener Junge mit schmalem Gesicht und verschorften Knien, der auf den Namen Viktor hörte. „Viktor“ war ein beinahe revolutionärer Name, anmaßend und ganz aus der Zeit gefallen. Andere Eltern nannten ihre Kinder Ernst, Adolf oder Rudolf. Sie entschieden sich für zukunftssichere, deutschtreue Namen, die einen goldenen Glanz ausstrahlten. „Viktor“ war ein rückwärts gerichteter Name, im besten Falle römisch, eine Bezeichnung für „Sieger“, obwohl jedes Kind wusste, dass die Römer ihre Siegeszüge einer bodenlosen Dekadenz opferten und jetzt die Zeit der Arier angebrochen war. „Viktor“ war eine Hypothek von Namen, nicht gerade entartet, aber antiquiert und für einen Jungen mit Ambitionen unbrauchbar.
Es war jedermann in dem kleinen Dorf klar, dass aus Viktor einmal ein Ingenieur werden würde. Ingenieure betrieben geadelte Handwerkskunst. Sie waren Arbeiter der Faust und des Kopfes, Zwillingsgeburten, die Deutschland zu neuer Größe erheben würden. Viktor hatte einen flinken Verstand, den er fest in seinem Kopf einschloss. Wenn er bastelte und Zeichnungen anfertigte, sah er verdrießlich aus. Er war kein unbeschwerter Junge, sondern ein Erwachsener in der Kutte eines Kindes, wie sein Vater zu bemerken pflegte.
Dieser Viktor also war ein wesentlicher Bestandteil des dörflichen Kinderlebens. Blanke Beine rannten über staubige, ungeteerte Straßen. Der Verkehr bestand aus Pferdefuhrwerken und Traktoren, die tiefe Furchen in die unbefestigten Feldwege drückten. Der Krieg kam über die Volksempfänger in die Wohnzimmer. Er berichtete von Heldentaten, von Eroberungen und der Überlegenheit der germanischen Rasse. Er eilte von Deutschland weg, entfernte sich in riesigen Sprüngen und verklärte sich zu einem stolz glühenden Epos, bevor er mit Macht zurückkehrte und das Vaterland mit unerwünschter Aufmerksamkeit überschüttete.
Viktor war zu dieser idyllischen Zeit der Spieleerfinder der Kinderschar. Man spielte Soldat, man spielte Autorennen, man spielte Verstecken. Viktor aber stand mit einem Ast in der Hand vor einer Sandkuhle und zeichnete den Ablauf eines namenlosen Spiels, das er alsbald in die Gemüter der anderen Kinder verpflanzte. Es gab Rollenspiele und komplizierte Anweisungen. Es gab Würfelspiele nach ausgefeilten Regeln und alles funktionierte. Nicht ein einziges Mal wurde Viktors Kompetenz infrage gestellt. Die älteren Jungen standen um ihn herum und studierten sein verdrossenes Gesicht während der Zeichenphase. Immer wenn Viktor mit einem Aufseufzen sein Aststück weglegte und ein Hauch von Zufriedenheit seine jugendlichen Züge glättete, kam Bewegung in die übrigen Kinder. Sie tuschelten und mutmaßten, traten unruhig von einem Bein auf das andere und waren begierig, das neue Spiel aus dem Sand in die Realität zu katapultieren. Viktor enttäuschte sie nie. Er hatte nur eine Bedingung. Alle mussten mitspielen dürfen. Das brachte ihm die Zuneigung der Mädchen ein.
Eines der Mädchen war Hedwig. Sie entstammte einem Bauernhof, der zu den größeren der Gegend gehörte. Hedwig roch nach dicken, gewachsten Zöpfen, nach Milchwirtschaft und Kartoffeln und nach Kernseife. Sie war ein rotbackiges, blitzblankes Ding, das noch nicht zur Schule ging. Hedwig verehrte Viktor und sie tat es nicht heimlich, sondern mit erstaunten Augen und perfekt aufgefädelten Milchzähnen.
Hedwig hatte ein Kaninchen, an dem sie ebenso sehr hing wie an Viktor. Sie transportierte es in einem Flechtkorb, den sie mit einem roten Tuch abdeckte, das mit weißen Herzen übersät war. Hedwig schleifte den Korb mehr als sie ihn trug. Er schlug gegen ihre stämmigen Beinchen und sorgte für spöttische Bemerkungen der anderen Kinder. Er brachte ihr den Rufnamen „Rotkäppchen“ ein. Hedwig blieb unbeirrt. Für sie zählte nur, was Viktor sagte, Viktor mit seinem Zauberast, mit dessen Hilfe er magische Spielanleitungen in den Sand malte. Und Viktor war ein vollendeter Kavalier. Im Normalfall reagierte er unwirsch, wenn ihn eines der Kinder beim Komponieren neuer Spielideen störte. Wenn die kleine Hedwig allerdings mit ihrem vorwitzigen Zeigefinger auf eine seiner unvollendeten Zeichnungen wies und aufgeregt herausplapperte, legte er sorgsam seinen Schreibast beiseite und ging in die Hocke. Er nahm sich immer die Zeit, das schlappohrige Kaninchen im Korb zu begutachten und Hedwig ermunternd zuzunicken. Dann fasste er das Mädchen an den Oberarmen und erklärte in ernstem, geduldigem Ton, was er gerade tat. Er erklärte es nur für Hedwig. Anschließend nahm er seine Tätigkeit wieder auf, ohne die anderen eines Blickes zu würdigen.
Die ungewöhnliche Freundschaft der beiden Kinder überdauerte auch die unglückliche Phase mit Frau Schneider. Frau Schneider war eine Naturerscheinung. Sie verfügte über eine imposante, ausladende Figur und eine durchdringende Stimme mit schrillen Ansätzen zur Hysterie. Viktor hörte einmal seinen Vater sagen, Frau Schneider sei eine „fette Aster“. Viktor rätselte, was an diesen langstieligen Blumen mit ihren eleganten Strahlenkränzen „fett“ sein mochte. Ein Lexikon verriet ihm, dass Astern zu der Gattung der Korbblütler gehörten. Das war alles.
Einer der älteren Jungen, dem er die rätselhafte Bemerkung seines Vaters zutrug, war sich sicher, dass der Vater „fette Atzel“ gesagt haben musste. Was eine „Atzel“ war, konnte allerdings auch er nicht erklären. Erst der Naturkundelehrer schaffte Abhilfe. Auf die Frage, was eine „Atzel“ sei, antwortete er, dies sei ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen heimischen Vogel, die Elster. Viktor gab sich einstweilen zufrieden. Er hatte bislang nur von diebischen Elstern gehört. In seinen Augen waren Elstern auch nicht wirklich fett. Es waren nach seinem Dafürhalten pralle, lackschwarze Vögel mit prachtvoll dekorierten Schwanzfedern und aufmüpfigen Knopfaugen. Sie hatten auch keine Ähnlichkeit mit Frau Schneider, denn Frau Schneider war fett. Daran bestand kein Zweifel.
Zu dem Sandsteinhaus der Schneiders gehörte ein Rasen. Nicht viele Dorfbewohner konnten sich einen Rasen leisten. „Zierrasen“ war ein Wort, das noch erfunden werden musste. Die Schneiders konnten sich diesen Rasen, der nichts als Rasen sein durfte, nur leisten, weil ihnen der einzige Steinbruch der Gegend gehörte. Damit gehörten sie zu den Neureichen und Neureiche brauchten Rasen. Kaninchen liebten Rasen, der mit Löwenzahn bewachsen war und Hedwig liebte ihr Kaninchen. Es war nur folgerichtig, dass Hedwig ihr Kaninchen aus dem Korb hob und auf die saftige Löwenzahnwiese setzte.
Frau Schneider hatte einen ausgeprägten Sinn für Eigentum. Weitaus weniger Sinn hatte sie für Kaninchen und impertinente, kleine Mädchen. Sie stapfte mit vorgereckter Leibesfülle aus dem Haus, aus voller Kehle zeternd und richtete ihren Medusenblick auf Kind und Haustier. Mit biblischem Zorn sprach sie Verbote aus und belegte jede weitere Zuwiderhandlung mit den drakonischsten Strafen.
Es kam, wie es kommen musste. Kleinen Mädchen war damals wie heute eine Art angeborener Trotz zu eigen. Sie hatten ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und den Grundbedürfnissen von Kaninchen.
Ein Bauer, der sein nahe gelegenes Feld pflügte, erzählte bei einem Bier in der Dorfkneipe, dass er das Mädchen mit den braunen Zöpfen mit untergeschlagenen Beinen auf der Wiese vor dem Haus der Schneiders sitzen sah. „Sie hatte einen Korb dabei und sprach mit ihrem Kaninchen“, sagte er und nahm noch einen Schluck Bier. Man kannte Hedwig im Dorf. Sie war ein Kind, das man gerne haben musste. Nach den Erinnerungen des Bauern kam Frau Schneider wie eine Furie aus dem Haus gestürzt. Verstehen konnte er nichts, aber er glaubte gesehen zu haben, dass Frau Schneider auf das Kaninchen eintrat, bis es sich nicht mehr bewegte. Anschließend habe sie das leblose Tier gepackt und in den Korb des Mädchens gestopft, bevor sie die Kleine an ihren Zöpfen vom Grundstück schleifte und wie einen Sack Abfall auf den Weg warf. Anfangs habe sich das Mädchen noch gesträubt, dann habe es aber ganz stillgelegen. Viel zu still.
Eine alte Frau war die Erste, die an Hedwig vorbeikam. Sie sagte, das Mädchen habe überall Abschürfungen gehabt. Man habe unter all dem Dreck und dem Blut nicht erkennen können, was der Kleinen genau fehle. Das Kind sei bereitwillig aufgestanden. Es habe ein totes Kaninchen in den Armen gehalten. Gesprochen habe es nicht. Nur gestarrt. Mit einem unheimlichen Gesichtsausdruck gestarrt. Hedwig habe nur ein einziges Mal einen Laut von sich gegeben. Sie habe es getan, als die alte Frau versuchte ihr behutsam das Kaninchen aus den Fäusten zu entwinden. Da habe sie geschrien. Einen schrecklichen Schrei. Lang gezogen und voller Verzweiflung. Dann sei sie wieder in ihr starrendes Schweigen zurück verfallen.
Hedwig redete nie wieder. Viktor wurde ihr Sprachrohr.
Er wurde es Frau Schneider gegenüber. Für die Schilderung des Ablaufs der Ereignisse sollte man besser von Elfriede sprechen. Das war der Vorname von Frau Schneider. Wenn man sich so nahe kommt wie der Knabe Viktor und Frau Schneider, ist es angebracht, die besondere Nähe, die beide zueinander entwickelten, dadurch zu betonen, dass man Vornamen benutzt.
Die Zwiesprache der beiden begann mit kleineren Ärgernissen rund um das Anwesen der Schneiders. Begonien und Stiefmütterchen gingen über Nacht ein, ein Unbekannter schoss mit einer Steinschleuder auf die Scheiben des Hauses und Elfriede Schneider litt unter rätselhaften Anfällen von Brechdurchfall. Kurz bevor die Krankheit ausbrach, glaubte sie bemerkt zu haben, dass sich jemand an den Lebensmitteln in ihrem Vorratsschrank zu schaffen gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte sie sich jedoch getäuscht. Ebenso getäuscht wie mit ihrer Vermutung, der gleiche Jemand habe das Vorhängeschloss der rückwärtigen Tür ausgehebelt und nur notdürftig wieder eingehängt. Ihren eigenen Angaben zufolge hatte Elfriede Schneider nur einen leichten Schlaf. In einer der Wachphasen habe sie einen Schatten am Fußende ihres Bettes wahrgenommen. Es sei der Schemen eines kleinen, schmalen Menschen gewesen. Sie habe gerufen, nachdem sie sich von ihrem Schock erholt hatte, aber der Schatten habe keine Antwort gegeben. Er habe nur da gestanden Sie habe den Eindruck gehabt, der Schatten beobachte sie. Ihr sei der Angstschweiß ausgebrochen und ihr Herz habe so wild geschlagen, dass sie es mit ihrer Hand umklammern musste. Ansonsten sei sie vollkommen bewegungsunfähig gewesen. Schließlich sei es ihr gelungen tief Luft zu holen und für einen Augenblick die Augen zu schließen. Als sie die Augen wieder aufgeschlagen und um sich gespäht habe, sei der Schatten verschwunden gewesen. Danach habe sie endlich das Licht anschalten können. Niemand sei im Haus gewesen. Nur das Schloss zur rückwärtigen Tür habe sie beschädigt vorgefunden.
Elfriede Schneider vertraute sich in dieser Angelegenheit einer Freundin unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit an. Elfriede hatte nicht viele Freundinnen. Eigentlich nur eine Einzige. Sie war zugleich ihre beste Freundin und arbeitete im Dorfbäckerladen, der auch Butter, Fahrradschläuche und Wäscheklammern führte. Diese Freundin nun hatte sich als solche qualifiziert, weil sie über ein ängstliches Frettchengemüt verfügte und die Führungsrolle von Elfriede bedingungslos anerkannte. Elfriede warf voluminöse Schatten und die Verkäuferin war zufrieden mit ihrem Schattenplatz und den herablassenden Brosamen, die Elfriede ihr zukommen ließ. Manchmal wandte sich Elfriede Rat suchend an sie. Das geschah nicht oft, aber wenn es geschah, schien für die Verkäuferin die Sonne des Schneider’schen Wohlwollens und sie suhlte sich bereitwillig darin.
Es geschah das, was der stocksteife Dorflehrer noch jahrelang bedeutsam eine „Katharsis“ nannte. Die Chronistenpflicht der krisenhaften Zuspitzung der Ereignisse übernahm unfreiwillig die Backwarenverkäuferin, denn der engwinklige Kramladen war zugleich auch der Umschlagplatz für Klatsch und Tratsch jeder Art, den die Verkäuferin aus den Mündern ihrer Kunden sog, in ihrem Kopf verwirbelte und als angereichertes Konstrukt in die Hirne der nächsten Käufer hineinblies. Die Geschichte Elfriedes war ein über Monate unangefochten an der Spitze des Dorfklatsches waberndes Gespinst von Ungeheuerlichkeiten, das man nach Belieben blähen und dehnen konnte, bis es Ausmaße annahm, die jede Form von Sensationsgier befriedigte.
Dank der Verkäuferin mit dem schnüffelnden, alle Ecken ausforschenden Frettchengemüt war allenthalben bekannt, dass Elfriede Schneider ihren Mann, einen braven Frontsoldaten mit Namen Joseph, so sehr vermisste, dass sie ihr Heil in der Nahrungsaufnahme suchte und alsbald an dem gewachsenen Umfang ihrer Oberschenkel und der lappigen Bauchschürze, die gleich unterhalb des Halses zu beginnen schien, ihre Sehnsucht in Zentimetern und Fettgehalt ihres weißen Fleisches messbar wurde. Der örtliche Bäcker, der zugleich der Vorsteher des Bahnstellwerkes war, ein Mann mit buschigen Augenbrauen und kräftigen Unterarmen, nahm sich Elfriedes an. Er war aus fadenscheinigen Gründen vom Wehrdienst befreit und leistete seinen Solidaritätsbeitrag an der Heimatfront. Am liebsten leistete er ihn zwischen den feisten Schenkeln von Elfriede, bis ihr Doppelkinn unter ihrem Kreischen erbebte und sich zwei Fleischmassen, eine männliche und eine weibliche, wieder voneinander trennten. An solchen Tagen buk der Bäcker, der auch eine Konditorenlehre abgeschlossen hatte, ein krapfenähnliches Fettgebäck, das er mit einer Zitronenglasur und Liebesperlen überzog. Die Krapfen waren eine Vollzugsmeldung für das gesamte Dorf. Man freute sich auf den Verzehr als Folge des nebenehelichen Verkehrs und auch der Frontsoldat Joseph erhielt sein Scherflein in Form eines liebevoll gepackten Paketes von seiner geliebten Elfriede.
Es hätte alles gut sein können, wenn die frettchengemütige beste Freundin von Elfriede nicht darauf bestanden hätte, das Schemengeschöpf am Bettpfosten von Elfriede sei der gramgebeugte, vielleicht aber auch rachedurstige Geist des gehörnten Ehemannes Joseph, der seit einiger Zeit als in Russland verschollen galt. Mit blanken Augen und gespitztem Mund führte die Verkäuferin als Beweis an, dass der beobachtende Schatten bewegungslos, dünn und schmächtig von Statur gewesen war. Man wisse doch, führte sie raunend aus, wie sich die russische Kälte auf den menschlichen Leib auswirke, wenn man kein Bolschewik war. Glied um Glied fror ein, der Körper schrumpfte. Väterchen Frost sog das Mark aus den Knochen. Das Rückgrat beugte sich. Die Fettreserven schmolzen. Musste sie noch mehr sagen?
Elfriede orderte eine Buttercremetorte und gab sich mit einer Kanne Kaffee-Ersatz einer einsamen Vergangenheitsbewältigung hin, die damit endete, dass sie den veritablen Bäckermeister nicht mehr in die Nähe ihres Ehebettes vordringen ließ. Tatsächlich hatte sie sich schweren Herzens und dem Ruf der Pietät folgend dazu entschlossen, ihn überhaupt nicht mehr vordringen zu lassen.
Das ganze Dorf nahm auf seine Art Anteil an dem kummervollen Schicksal von Elfriede Schneider, der Ehebrecherin und Kaninchenmörderin. Manche mit Spott, andere mit einer grimmigen Genugtuung und wenige aus echter Sorge um Elfriede. Das Mitgefühl war in jenen Kriegsjahren nur noch eine dünne Krume, unter der der blanke Stahl des eigenen Überlebens hervorschimmerte. Jede Familie hatte Verluste zu beklagen, viele Söhne waren von der Front verschlungen worden. Der Tod schickte seine Gehilfen von Haus zu Haus.
Was die Episode mit Elfriede davon unterschied, waren die Zutaten der Geschichte. Saftige, pralle Zutaten in einer Zeit, die zwischen Propaganda und Dürre schwankte. Nach den wenigen gesicherten Aussagen des Dorflehrers, bereinigt um die Übertreibungen der besten Freundin Elfriedes, muss sich in einer ruhigen Nacht ohne Fliegeralarm eine Tragödie abgespielt haben.
Elfriede schien mit dem Verzehr der Buttercremetorte, zu deren Erwerb sie wegen ihrer Beziehungen keine Lebensmittelkarten verwenden musste, wieder stabilisiert zu sein. Auf schweren Beinen begab sie sich in einer mondlosen Nacht zu Bett. Wahrscheinlich betete sie noch für das Seelenheil ihres Mannes und ihre Witwenrente, die ihr den Weg in ein gesichertes Buttercremetortenparadies ebnen sollte. Mitten in der Nacht weckte ein Scharren und Schaben sie aus dem Schlaf. Fremdartige Laute krochen die Holztreppe empor und ein flackerndes Licht warf unruhige Schatten.
Elfriede glaubte nicht an übernatürliche Mächte. Sie glaubte an die heilende Macht der Nahrung, an den beruhigenden Einfluss von Eigentum und ein wenig auch an die Liebe, wenn sie zu allen anderen guten Dingen hinzukam. Sie glaubte, was sie sah. Und sie hatte den Schatten ihres im Russlandfeldzug erfrorenen Mannes gesehen, wie er sie forschend vom Fußende ihres Ehebettes aus betrachtete. Eine elende, geschrumpfte Männergestalt, die die Befleckung seiner Ehre nicht ertragen konnte, die sich zum Erfrieren nicht auch noch Hörner aufsetzen lassen wollte. Elfriede hatte es gesehen und es hatte sie zutiefst erschreckt. Sie hatte ihre Konsequenzen daraus gezogen und Abbitte geleistet. Sie war zum ersten Mal seit Jahren mit aufrichtig bereuender Seele in die Kirche gegangen und hatte Kerzen angezündet. Mehr Kerzen als nötig gewesen wären, um die Heiligen zu besänftigen. Mehr Kerzen als notwendig, um den Heiligen abzuhandeln, sie vor dem umhergetriebenen Geist ihres verschollenen Mannes zu schützen. Für Heilige war das weiß Gott keine schwierige Aufgabe. Heilige taten den lieben langen Tag nichts anderes.
Außerdem hatte Elfriede noch Geld in den Opferstock gelegt. Zugegebenermaßen nicht viel Geld, aber sie hatte in ihrem Herzen beschlossen, weit mehr zu opfern, wenn die erste Gabe nicht ausreichen würde, weil die an den Himmel gerichteten Wünsche in Zeiten des Krieges inflationär waren und einer deftigeren finanziellen Grundlage bedurften, um zu den richtigen Himmelshelfern vorzudringen. Wer wusste das schon. Im Krieg war alles anders. Elfriede war sich sicher, dass der Himmel ihre guten Beweggründe erkennen und honorieren würde. Zu guter Letzt hatte sie noch die Manneskraft des Bäckers gegen die zart schmelzende, aber seitensprungneutrale Buttercremetorte eingetauscht. Elfriede war moralisch gerüstet.
Und dann rief eine schwache, gedehnte Stimme ihren Namen. Es war ein zitternder Laut, vorwurfsvoll und sehnsüchtig. Er schlang sich die hölzerne Stiege empor, tastete an den Wänden entlang und brach sich in den Winkeln des oberen Stockwerks. Nichts anderes war zu hören. Elfriede erschauerte und tastete nach dem Beil, das sie aus Vorsicht nach der Nacht der ersten Erscheinung neben ihrem Bett deponierte hatte, falls die Heiligen überarbeitet und zu ihren Gebeten noch nicht vorgedrungen waren.
Dann wieder dieses Scharren, das das Rufen vor sich hertrieb. Elfriede glaubte sich an den Schritt zu erinnern. Es war der Tritt des Steinbruchbesitzers, der Schritt ihres Josephs, verhalten und schlurfend zwar, wie es sich für einen in Russland erfrorenen und ausgemergelten Leichnam gehörte, aber unverwechselbar. Elfriede presste das Beil gegen ihren Busen. Man hatte so manches von Geistern gehört. Man hatte gehört, dass sie an den Ort kamen, der ihnen am meisten vertraut war. Man hatte gehört, dass sie arme Seelen waren, die nur ihren Frieden fanden, wenn man ihrem Willen entsprach. Man hatte so vieles gehört. Elfriede gelang es nicht, das Rauschen ihres Blutes zu besänftigen und zu einem klaren Gedanken zu kommen. Sie hörte das Rufen, das beständig näher kam. Sie spürte die Seelenlosigkeit in der zitternden Stimme, die für einen lebendigen Mann zu hoch, für ein Gespenst jedoch gerade richtig zu sein schien.
Elfriede war eine temperamentvolle Frau von aufbrausendem Gemüt. Sie hatte für Joseph getan, was möglich war. Sie hatte ihn sogar den Himmelsmächten anempfohlen. Er gehörte nicht mehr in dieses Haus. Nicht in diesem Zustand. Elfriede hob das Beil.
Was weiter geschah, kann nur bruchstückhaft rekonstruiert werden. Am wahrscheinlichsten stand der Besucher auf den untersten Treppenstufen. Ein alter Armeemantel war um seine zwergenhaft kleine Gestalt geschlungen. Die genagelten Stiefel schlurften über den Boden. Ein unförmig ballonartiger Kopf ruhte auf schmalen Schultern. Er war eine krude ockerfarbene Maske mit geschnitzten Gesichtszügen. Aus dem Kopf loderte eine Flamme. Die Hirnschale war abgehoben. Der Besucher grinste.„Elfriede“, rief eine zittrige Stimme. Arme ohne Hände tasteten das Geländer entlang.
Wir müssen annehmen, dass es um Elfriede zu diesem Zeitpunkt bereits geschehen war. Ihre geistige Gesundheit war in jenen Momenten auf dem Weg, sich von ihr zu verabschieden. Es muss der Zeitpunkt gewesen sein, in dem Elfriede mit einer berserkerhaften Anstrengung ihr Nachtgewand zerriss und ihrer Fleischesfülle die volle Freiheit gewährte, bevor sie sich auf das Wesen stürzte, das einmal ihr geliebter Mann gewesen war. Wir wissen nicht, was sie rief, aber wir können sicher sein, dass sie nicht lautlos über den gespannten Draht stürzte und dabei mit einem unabsichtlichen Hieb den Kopf des Besuchers spaltete.
Was wir wissen, ist, dass sich eine zähe orange Masse aus dem Schädel löste und auf den aufgedunsenen Leib der Gestürzten fiel. Dann schrie Elfriede. Sie schrie, während der Besucher mit dem zerstörten Schädel weiter nach ihr rief. Sie schrie wegen des Schmerzes, den ihre gebrochene Hüfte ihr verursachte. Sie schrie, als das Wesen den Stolperdraht löste und sie betastete, um sich zu vergewissern, wo sich ihre Ohren befanden. Sie schrie wegen der Botschaft, die ihr der Besucher in die Ohren flüsterte.
Als man sie fand, schrie sie noch immer, doch ihre Augen waren erloschen. Wie Glasmurmeln irrten sie in ihren Höhlen herum. Die Nackte war mit Kürbisfleisch besudelt. Ein Beil lag in der Nähe. Den Kürbis konnte man nicht finden. Alles war rätselhaft und skandalös. Man versuchte noch den Verstand von Elfriede zurückzuholen, als man ihr den Feldpostbrief ihres Mannes vorlas, in dem er ankündigte, überlebt zu haben und bald auf Fronturlaub zurückzukommen. Elfriede stierte nur mit ihren Glasmurmelaugen und leierte Unzusammenhängendes heraus. Dann lieferte man sie in eine Anstalt ein.
Viktor besuchte Elfriede. Er war nicht nachtragend, nachdem er seine Arbeit gemacht hatte. Einmal brachte er Elfriede ein aus Pappe gestanztes Quartett mit. Es war ein Häschenquartett. Die Schwestern fanden, dass dies eine nette Geste sei. Elfriede aber schrie. Vielleicht hatten sie die Karten an etwas erinnert.
Viktor zuckte die Schultern. Er wollte noch nach Hedwig sehen. Für sie hatte er ein lebendes Kaninchen ausgesucht.
III.
Das Wohnstift hatte eine Eigenwahrnehmung, die sich von der Zeit der Planung bis zur Fertigstellung immer mehr von der Wirklichkeit entfernte. Bei der Ausschachtung des Fundaments wäre es noch damit einverstanden gewesen, als konfessionelles Altenheim bezeichnet zu werden. Das Gießen von Fundamenten war keine glamouröse Tätigkeit. Nackter Beton und rostige Eisenfinger in einem schmierigen Erdloch berechtigten nicht zu hochfliegenden Plänen. Noch konnte es sich nicht vorstellen, dass sich zu den kahlen Wänden und den roh verlegten Kabelschächten ein dauerhafter Glanz gesellen könnte.
Eine erste Sinnesänderung erfuhr das Wohnstift mit der Fertigstellung des Rohbaus. Nicht, dass die über sechs Etagen nach oben verlängerte Tristesse Anlass zu einem beginnenden Standesdünkel gegeben hätte. Leer klaffende Fensterhöhlen, nachlässig eingepasste Bautüren und ungeschlachter Putz ließen keine unmittelbare Besserung der Situation erwarten.
Was die Erwartungshaltung des Wohnstiftes änderte, war die sachte einsetzende Werbekampagne. In der Lokalpresse erschienen Anzeigen. Es war von der Fertigstellung erstklassiger Altersruhesitze die Rede. „Erstklassig“ klang vielversprechend. Es war eine Vokabel, die sich nicht gut mit „Altersheim“ kombinieren ließ. „Ruhesitz“ hingegen war die geadelte Variante. Sie bürgte für glattgesichtige, frisch frisierte und vitale Bewohner, für aktive Senioren in der Blüte der Zerfallsphase. Sie ließ den Bodensatz der Desorientierten und Gramgebeugten hinter sich zurück. „Ruhesitz“ war der Aufstieg in die gehobene Liga. „Leben mit Genuss“ war das Motto. Krankheit und Sterben rückten aus dem Fokus. Das Stift begann freier zu atmen.
Im nächsten Schritt streifte man die alten Gewänder vollends ab. Die konfessionelle Ausprägung des Stiftes wurde zugunsten einer kantenlosen, zukunftsorientierten Betreibergesellschaft aufgegeben und dem Stift übergestülpt. Soziale und kirchliche Verantwortung für den Nächsten wichen einer Managementidee vom renditestarken Wohnen in der genussorientierten zweiten Lebenshälfte. Aus dem immer noch schlichten „Altersruhesitz“ wurde eine in großen Lettern angepriesene „Seniorenresidenz am Stadtpark“.
Das Stift war an der Spitze angekommen. Der Stadtpark war einige Blocks entfernt und hatte seinen Namen nicht verdient. Aus den oberen Stockwerken des Stiftes konnte man vereinzelte Blicke auf dichte Baumkronen erhaschen, aber die Magie der Werbetrommeln tat ein Übriges und machte die Erwartung auf verschlungene Spazierpfade, auf Vogelgezwitscher und eine zahme Eichhörnchenpopulation lebendig. Der Stadtpark selbst war eine eher überschaubare und blasse Angelegenheit. Ebereschen und Eichen verteilten sich über ein buckliges Areal. Drei Pfade wanden sich an Parkbänken vorbei und die aufgestellten Mülleimer quollen zu jeder Zeit vor Verpackungsmüll über, ehe sich die Stadtreinigung nach langem Zögern dazu bequemte, ihnen vorübergehende Erleichterung zu verschaffen.
Die Realität änderte nichts an dem Hochgefühl des Stiftes. Neu eingekleidet und auf Wirkung gebürstet, lebte es sein Leben als Residenz. Die Zeichnungen des Bauträgers bewiesen, dass es zu Recht stolz war auf seine neue Identität. Man hatte die Zeichnungen von einem Künstler kolorieren lassen. Sie waren frisch und optimistisch. Der Park schien dichter und einladender zu sein, als man ihn in Erinnerung hatte. Er grenzte mit seinem Saum direkt an das gläserne Eingangsportal der Residenz. Holz, Chrom und Glas gaben sich ein Stelldichein und verwandelten den Neubau in glänzende Fluchten. Prächtig ausgeleuchtete Wohnungen mit erlesenen Möbeln lockten. Man plante Shops, Sportmöglichkeiten und ein Casino. Kein Kasino mit „K“, sondern ein solches mit „C“. Zerstreuung auf höchster Ebene. Bestnoten bis zum letzten Buchstaben. Gestyltes Alter und dienstbare Geister in einem verborgen liegenden Versorgungs- und Pflegetrakt. Dafür suchte man Investoren. Man nannte die Klientel Investoren.
Viktor war einer von ihnen. Viktor war nicht beunruhigt, weil er seine Kräfte schwinden sah. Er ließ sich auch nicht von der Fassade der Einrichtung blenden. Er war als nüchterner Pragmatiker in schwierigen Zeiten aufgewachsen und würde als solcher von der Bühne abtreten. Er hatte seinen Weg gewählt. Wo andere sich bemühten, tiefe Fußstapfen zu hinterlassen, die nur schwer zu verwischen waren, bemühte sich Viktor darum, seine Abdrücke zu tilgen, so gut er es vermochte. Er war gut darin, sich am Rand des Geschehens aufzuhalten und keinerlei Aufmerksamkeit zu erregen. Deshalb war er erfolgreich in seinem Beruf und seine Arbeitsethik färbte auf sein Privatleben ab.
Natürlich hatte sich Viktor verschiedene Objekte angeschaut. Wenn man ihre vollmundigen Versprechen und aufwendigen Fassaden auf das Wesentliche reduzierte, waren sie alle Sterbehilfeeinrichtungen mit geschulten Lächelgesichtern und einem medizinischen Apparat, der reibungslos funktionierte. Je nach Einrichtung erkaufte man sich Obdach und Nahrung, man erkaufte sich professionelle Herzlichkeit und geschultes Mitgefühl. Man konnte kaufen, was immer man sich leisten konnte, bis man sich seine individuelle Illusion von Familie zusammengestellt hatte.
Viktor wusste all das. Das Stift mit seiner neu gewonnenen Selbsteinschätzung konnte ihn nicht täuschen. Er machte sich keine Illusionen. Sein Beruf war es, andere von ihren Illusionen zu befreien.
Die Seniorenresidenz am Stadtpark sollte es sein, weil Hedwig es wollte. Viktor konnte Hedwig keinen Wunsch abschlagen. Sie hatte noch immer das Gemüt eines kleinen Mädchens, dessen Zöpfe dünner geworden und ergraut waren. Sie trug noch immer den gleichen Flechtkorb bei sich, der mit den Wunden des Alltags übersät war und sich von seinem Griff zu lösen drohte. Viktor hatte mehrfach versucht, Hedwig einen anderen Korb schmackhaft zu machen. Er hatte ihr geduldig erklärt, dass man verdiente Veteranen ruhen lassen musste, wenn ihre Zeit gekommen war. Er hatte ihr Körbe präsentiert, die raffiniert ausgestattet und mit erlesener Handwerkskunst gefertigt waren. Hedwig hatte genickt und die Körbe beiseite gestellt. Ihre braunen Augen und die aufgeworfenen Lippen sprachen ihre eigene Sprache.
Als Hedwig mehrere Dutzend Körbe besaß und die Ansammlung lästig zu werden begann, kapitulierte Viktor. Er kapitulierte immer vor Hedwig. Hedwig wusste das. Im entscheidenden Moment setzte sie ihr strahlendes Lächeln auf und sah Viktor mit einem schwärmerischen Gesichtsausdruck an. Er war ihr Held, ihr Spieleerfinder, ihr Schutzengel. Er war gut zu ihr und sie schenkte ihm ihre ganze Zuneigung. Sie gab sich damit zufrieden, dass Viktor in ihrer Nähe war. Sie verstand, warum er sie nicht zu sich holen konnte. Er hatte einen fordernden Beruf. Für die Zeiten ohne Viktor hatte Hedwig ihre Kaninchen. Sie waren ein guter Zeitvertreib.
Viktor dachte an das Jahr, als er der Kommission gegenübersaß. Es war ihm lästig, sich für einen Platz in der Seniorenresidenz bewerben zu müssen, aber so waren die Regeln. Das Alter brachte eine Fülle von Regelwerken mit sich. Das selbstbestimmte Leben verkroch sich allmählich in wenige Winkel. Der Rest wurde in Verhaltensvorschriften verpackt, wie sie nur für Kinder und Alte galten.
Eine grauhaarige Dame mit strengem Blick und schmalen Lippen, die selbst nur einen Gänseschritt vom Alter entfernt war, fragte Viktor, was ihn nach seiner Ansicht qualifiziere, in der Residenz wohnen zu dürfen. Der wie ein Theologe wirkende Mittvierziger trommelte nervös mit den Fingern auf dem Tisch. Er studierte seine Papiere und fragte Viktor nach dessen sozialem Engagement. Er machte den Eindruck, dass er jeden Bewerber nach dem sozialen Engagement fragte. Der Leiter der Residenz, ein löwenmähniger Mensch mit einer dröhnend jovialen Stimme wies darauf hin, dass das Haus bei allen Freiheiten, die man den Bewohnern zu gewähren bereit sei, Regeln habe. Er dehnte die Vokale, als wolle er das letzte Quäntchen Bedeutungsgehalt aus ihnen herausquetschen.
Viktor hatte sich vorbereitet. Er war immer vorbereitet. Sorgfältig hatte er die Dokumente für die Bonitätsprüfung zusammengestellt. Er hatte sich Antworten zu seinem Gesundheitszustand, seiner Motivation und seinen Vorstellungen von der Zukunft zurechtgelegt. Die Antworten waren wohlfeil und auf Wirkung poliert. Sie entsprachen nicht der vollen Wahrheit. Nichts, was man von Viktor zu wissen glaubte, entsprach der vollen Wahrheit.
Die größte Hürde war die Unterbringung von Hedwig. Als die ersten Prospekte von der Residenz eintrafen, klatschte Hedwig in die Hände. Das tat sie, wenn sie einen Entschluss gefasst hatte. War sie sich unsicher, fächelte sie mit geöffneten Händen. Lehnte sie etwas ab, schob sie es entrüstet, mit angeekelter Miene und geballten Fäusten von sich weg. Hedwig war eine charakterfeste Persönlichkeit.
Viktor hatte einen großen Stapel Werbematerial vor sich liegen, als Hedwig ihre Entscheidung traf. Er beobachtete sie genau. Die Tatsache, dass sie nicht sprach und nie ohne die Begleitung eines Kaninchens gesehen wurde, verführte dazu, sie als zurückgeblieben einzuschätzen. Nichts war unzutreffender als dieser Eindruck. Hedwig war eine alte Frau geworden. Sie war mit Würde gealtert und konnte wie jeder ältere Mensch Hilfestellungen und Rücksichtnahme gebrauchen. Ansonsten aber wohnte in dem gedrungenen Körper der alten Frau ein scharfer Verstand, der sich lediglich weigerte, die Schranke von der Kindheit zur Erwachsenenwelt zu durchschreiten. Der traumatische Vorfall in jenen Kriegstagen hatte diese Entwicklung ausgelöst und Viktor verstand.
„Sie hat im Krieg Schreckliches durchgemacht und Heilung in der Kapsel ihrer bis dahin unbeschwerten Kindheit gefunden“, zitierte Viktor das ärztliche Bulletin, das den Allgemeinzustand von Hedwig charakterisierte. Nie hatte jemand danach gefragt, was der Frau im Kindesalter widerfahren sein mochte. Man konnte es sich vorstellen. Der Krieg ist ein grausamer Geselle, der auch vor Kinderseelen nicht haltmacht. Die verrohte Soldateska und das kleine Mädchen. Unvorstellbar. Unaussprechlich. Viktor nickte zu den betroffenen Mienen und beließ es dabei.
Dennoch bedauerte die Kommission. Man könne Hedwig nicht in die Residenz aufnehmen. Sie sei zu betreuungsintensiv. Auch könne man die Anwesenheit eines Kaninchens aus hygienischen Gründen auf keinen Fall dulden. Man müsse sich im Fall von Hedwig überlegen, ob eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung nicht sehr viel angemessener sei. Eine geballte Ansammlung Fachkompetenz bemühte sich um die freundliche Überredungskraft, die nötig sein würde, um den störrischen Alten, der sich als Viktor vorgestellt hatte, zu überzeugen.
Viktor war auf diesen Ausgang des Gesprächs gefasst. Er war vorbereitet, so wie er immer vorbereitet war. Hedwig hatte bei der Durchsicht der Unterlagen in die Hände geklatscht. Sie hatte es nicht unbedacht getan. Hedwig wollte eine Wohnung in der Residenz und sie sollte sie bekommen.
Viktor besaß nur wenige Leidenschaften. Er trieb Sport und las, ernährte sich gesund und unternahm kurze Bildungsreisen, wann immer ihn sein Beruf in fremde Städte führte. Er führte ein kleinbürgerliches Leben, das neben den vereinzelt erforderlichen Tötungsdelikten flach und unaufgeregt verlief. Seine Tage versandeten in Routine und Gleichförmigkeit.
Eines aber weckte alle seine Instinkte. Dann war er wach und aufmerksam. Dieses Eine waren seine Dossiers. Dossiers waren die Leidenschaft von Viktor. Zwischen zwei harmlos wirkende gelbliche Aktendeckel pferchte er Schicksale. Eng beschriebene Karteikarten skizzierten Personen und ihre Gewohnheiten, ihre Stärken und Schwächen. Die Karteikarten waren in einem komplizierten System mit Kordel aneinandergefädelt. Manchmal gesellten sich Fotos hinzu. Aussagekräftige Fotos. Beschriftete Fotos mit Namen und Ortsangaben. Dann wieder große Bögen mit Anmerkungen in verschiedenen Farben und Pfeilen. Viktor glaubte nicht an Computer und die Segnungen von Speichermedien. Für ihn war das sinnliche Erleben wichtig. Sein Beruf war nicht digitaler Natur. Sein Beruf hatte mit Fleisch und Blut zu tun. Mit viel Fleisch und viel Blut. Also beschriftete er mit Sorgfalt seine Karteikarten, fädelte sie auf, wo sie zusammengehörten und legte den Rest lose in die Akte, alle an den ihnen zukommenden Platz, bis er ein lückenloses, chronologisches Profil seiner Klienten erstellt hatte. Das war er seinen Klienten schuldig.
Die Dossiers, die er erfolgreich abgeschlossen hatte, trug er in einem langen Spaziergang in den Wald, schlug sich ins Unterholz und verbrannte sie dort Stück für Stück. Wälder waren ideale Verschwörer. Sie galten als verschwiegen und leidenschaftslos. Viktor liebte Wälder. Sie hatten ihn noch nie enttäuscht.
Er nannte sein kleines Ritual „Rauchopfer“. Es war seine Art Abschied zu nehmen und loszulassen. Das Rauchopfer war mehr als die Beseitigung von Spuren. Es war eine Respektsbekundung und ein Selbstheilungsprozess.
Für das Rauchopfer wählte er stets neue Plätze, die er in Augenschein nahm und auf ihre Tauglichkeit untersuchte.
Dann wartete er auf einen Tag, der unangenehm feucht oder kalt zu werden versprach. Niemand sollte ihn stören. Er badete ausgiebig und rasierte den ganzen Körper. Er kleidete sich in Schwarz und nahm das Dossier zur Hand. Ein letztes Mal blätterte er und verweilte bei einzelnen Karten. Schließlich klappte er das Dossier mit einer energischen Bewegung zu und kreuzte den Aktendeckel mit einem roten Stift.
Das rote Zeichen war immer das letzte Merkmal, das sich in den Flammen des Feuers einrollte und verging. Mit einem abgebrochenen Aststück stand der alte Mann im Unterholz und starrte auf die rußige Masse zu seinen Füßen, die noch glühte und bald erlöschen würde. Er begann mit der Spitze des Astes die verkohlten Blätter zu zerstoßen und zu verreiben, bis ihre Struktur nicht mehr erkennbar war und die Informationen endgültig ausgetilgt waren, davongetragen von einer flimmernden Hitzezunge. Dann füllte der alte Mann die Überreste des Brandopfers in eine Aluschale und tilgte die Spuren des Feuers. Die Aluschale würde er in einen Müllcontainer entsorgen, zusammengeknüllt und erkaltet. Die richtige Stelle dafür hatte er bereits ausgesucht. Bald würde der Wald wieder unberührt daliegen.
Zum Abschluss des Rituals gönnte sich Viktor eine kleine Extravaganz. Nicht dass er betete oder andere komplizierte Verrichtungen vollzog. Er war ein praktischer Mensch, der nicht zur Esoterik neigte.
Viktor fotografierte. Es war eine unbedeutende Geste. Eine Feuerstelle im Gewirr von Brombeerranken. Verbranntes Gras in der Nachbarschaft eines umgestürzten Baumstammes. Angekohltes Geäst in einer Fichtenschonung. Stillleben eines Abschiedes, anonym und endgültig. Die Schnappschüsse druckte Viktor aus. Mit der gleichen Kordel, mit der er die Karteikarten aneinander fädelte, befestigte er eine schlanke Phiole mit ein wenig Asche an dem Foto. Keine Beschriftung, keine Hinweise. Nichts, was auf die Herkunft oder den Sinn der Sammlung hindeuten könnte. Der alte Mann war kein Serienkiller. Er benötigte keine Fetische, um seine Taten rauschhaft nachzuvollziehen, bis der Trieb erneut machtvoll einsetzte und ihn über den Rand der Selbstbeherrschung trieb. Er war ein Handwerker. Er arbeitete auf Bestellung. Emotionslos, gründlich und leise. Ein Handwerker, wie man ihn gerne in sein Haus lässt, außer man ist die Person auf dem Foto.
Wegen Hedwig brach Viktor mit seinen Gewohnheiten. In dem von ihm verfassten Handbuch hieß es: „Vermeide eine offene Konfrontation, wenn du sie nicht unverzüglich und endgültig beenden kannst. Lass niemals Spuren zurück“.
Viktor gedachte die Konfrontation zu suchen und alles in der Schwebe zu lassen. Die Spuren sollten deutlich sichtbar zurückbleiben. Es war ein Risiko, aber eines, das er einzugehen gedachte. Immerhin konnte er sich dabei auf eine andere Regel berufen: „Wenn unvorhersehbare Umstände eintreten, sei flexibel und improvisiere.“ Das gedachte er zu tun. Hedwig war es ihm wert.
Das Dossier war unversehrt, als er es vorlegte. Viktor fühlte sich unwohl. Noch nie hatte er eines seiner wertvollen Stücke aus der Hand gegeben. Dieses Mal musste es sein. Er tröstete sich damit, dass es eine Ausnahme war. Eine Privatangelegenheit, die seine beruflichen Interessen nicht berührte. Er hatte viel Sorgfalt auf die Zusammenstellung der Informationen verwendet und mehr Bilder gemacht als gewöhnlich. Die Bilder waren am überzeugendsten.
Es war einfach gewesen. Behörden und Schulen steckten voller Gerüchte. Das Gleiche galt für Heime, auch wenn sie sich Residenz nannten. Man musste sich nur in die Cafeteria setzen und sie zu sich einladen. Aus allen Ecken wisperten sie. Die Betreiberin der Cafeteria, eine stämmige Frau mit einem losen Mundwerk, steuerte einige Bruchstücke bei. Bewohner ergingen sich in Spekulationen. Man zwinkerte und flüsterte. Auch Viktor zwinkerte und flüsterte. Er hatte Verständnis für die Mitteilungsbedürftigkeit seiner Mitmenschen. Er hatte auch Verständnis für ihre Bitten um Diskretion. Schließlich ging es nicht um Missstände, die man laut und öffentlich anprangern musste, sondern um Skandale, die unter der Decke gehalten werden wollten.