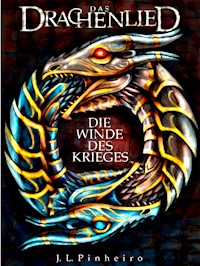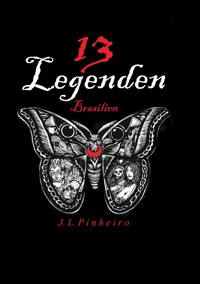
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In Brasiliens Hochland liegt eine Stadt, die von Bergen umarmt und inmitten eines Urwaldes liegt. Sobald die Sonne untergeht, geschieht merkwürdiges auf den Straßen Ouro Pretos. Seltsame Kreaturen wandeln umher, gar viele unbemerkt von den Augen der menschlichen Bewohner. Doch eine Familie rutscht in diese eine unsichtbare Welt, indem die Legenden Wirklichkeit sind. Zwei Brüder stellen sich den Wesen, die ihre Welt bedrohen. Ob sie es schaffen ihre Liebsten vor den Legenden zu bewahren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
In Brasiliens Hochland liegt eine Stadt, die von Bergen umarmt und inmitten eines Urwaldes liegt. Sobald die Sonne untergeht, geschieht merkwürdiges auf den Straßen Ouro Pretos. Seltsame Kreaturen wandeln umher, gar viele unbemerkt von den Augen der menschlichen Bewohner. Doch eine Familie rutscht in diese eine unsichtbare Welt, indem die Legenden Wirklichkeit sind. Zwei Brüder stellen sich den Wesen, die ihre Welt bedrohen. Ob sie es schaffen ihre Liebsten vor den Legenden zu bewahren?
In diesem Buch sind 26 Illustrationen im Stiel alter Holzstiche gezeichnet, die in Brasilien üblich waren. Das empfohlene Alter für dieses Buch wäre über 12.
Der Autor:
J.L. Pinheiro wurde 1993 in Brasilien geboren. Mit seinen Eltern kam er 1999 nach Deutschland. Hier besuchte er die Schule und machte 2015 sein Abitur. J.L. Pinheiro stach besonders in der Schule durch seine Kreativität und das Schreiben hervor. Jeder Aufsatz wurde schnell zu einem kleinen Roman für jeden Deutschlehrer. Der für die Korrektur der Aufsätze länger brauchte als erhofft. Auch im Kunstunterricht begeisterte J. L. Pinheiro durch seine Werke aus Farben auf Leinwände. Derzeit studiert J.L. an der Universität Ulm. Das Schaffen von neuen Welten ist eine Leidenschaft, die J.L. tief in sich trägt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Die Stadt, A Cidade
Kapitel 2
Das Maultier ohne Haupt, A Mula sem Cabeça
Kapitel 3
Der rosafarbene Boto, O Boto-Cor-De-Rosa
Kapitel 4
Der Saci Perere, O Saci Perere
Kapitel 5
Der Mann mit dem Sack, O Homem do Saco
Kapitel 6
Die Sirene, A Sereia
Kapitel 7
Die Deutsche, A Alemoa
Kapitel 8
Der Curupira, O Curupira
Kapitel 9
Die Cuca, A Cuca
Kapitel 10
Die goldene Mutter, A Mãe-de-Ouro
Kapitel 11
Die Große Schlange, A Boiuna
Kapitel 12
Der ausgedörrte Körper, O Corpo Seco
Kapitel 13
Die Feuerschlange, A Boitata
Danksagung
Worterklärung
Vorwort
Wer einmal in Brasilien war, weiß, dass Brasilien eine andere Welt ist. Ein unvergleichbares Land. Von Norden bis Süden von Ost nach West, erzählen die Großeltern ihren Kindern, Legenden die über hunderte von Jahren alt sind. Legenden über Leidenschaft, Liebe und das Wesen der Menschlichkeit, die über das Leben lehren sollen. Aus Afrika und aus Europa kamen die neuen Bewohner des Landes und mischten ihre Traditionen und ihre Legenden mit denen der Ureinwohner. Aus diesem einzigartigen Meltingpot entstanden die verrücktesten wie auch unheimlichsten Legenden die ich als Kind je gehört habe.
Brasilien ist so immens, dass es verschiedene Zeitzonen hat, wie auch verschiedene Klimazonen, von tropisch bis mediterran mild. So wie das Land unterschiedlich ist, so sind auch dessen Bewohner und je nach Ortschaft, können sich die Legenden leicht unterscheiden. Doch hier stelle ich euch, die Besten vor, die ich gehört habe.
In diesen Geschichten geht es um Hoffnung, Liebe, Leidenschaft und die Abgründe der menschlichen Seele. Es gibt kein Monster, das schlimmer ist als der Mensch selbst und es gibt kein Engel, der seliger ist als wir, dies machen diese Geschichten uns klar.
Eine Reise steht dir bevor, nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch die Kultur und durch die Mentalität eines ganzen Volkes, welches von europäischen Missionaren, indigenen Legenden und afrikanischen Lebensweisen geprägt worden ist. Alles, was ich hier in den Legenden erzähle, habe ich nicht frei erfunden, jede Grausamkeit jeder Akt der Verzweiflung oder Hoffnung, fand sich in eine Erzählung, und gar manche Tat wurde eins zu eins so begangen wie geschildert. Auch Brasilien musste, leider ein paar Kapiteln zur Historie der Sklaverei hinzufügen. Auch in manchen Legenden wird der Schrei der Unterdrückten und Versklavten hörbar.
Oft sind die Originalgeschichten der indigenen Gruppen nicht mehr vorhanden, da diese, je nach Stamm unterschiedlich erzählt wurden und auch, weil es keine Schriftzeugnisse der jeweiligen Kulturen existiert. Die einzigen Schriftzeugnisse, die bis zur Entdeckung und der ersten Kolonialisierungswelle reichen, wurden von katholischen Mönchen niedergeschrieben, die weder die Kultur noch die Mentalität dieser Urvölker verstanden und sehr oft die Legenden durch streng christlichen Brillen betrachteten. So wurde z.B. das Bild der Schlange zu einem negativen Symbol für eine neu entstehende Gesellschaft aus verschiedensten Ethnien.
Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen dieser dreizehn Legenden und hoffentlich gruselst du dich wie ich, als ich diese Geschichten zum ersten mal gehört habe.
Kapitel 1
Die Stadt, A Cidade
In einer kleinen idyllischen Stadt, die von brasilianischen Bergen umarmt wird, begann die Sonne über dem Horizont unterzugehen. Ein alter Mann schaute aus seinem Küchenfenster und betrachtete, wie die Sonne unter Wellen aus Stein und grünen Baumkronen versank. Er lehnte seinen Gehstock am Küchentresen an und lies seine faltigen Finger über das weiße Hemd fahren. Mit den Fingerspitzen ertastete er jeden Knopf und überzeugte sich selbst, dass jedes an dessen Platz zu finden war. Die Falten an seinem weißen Baumwollhemd strich er glatt. Als Letztes warf er noch einen Blick in einen kleinen Spiegel, welches neben der Haustür an der Wand hing.
Er sah sich selbst im Spiegel und fragte sich, wo seine Jugend geblieben ist. Er erinnerte sich, wie straff seine Haut einst war, wie sie an seinen Wangenknochen klebten und diese zum Vorschein brachten, er erinnerte sich an die Farbe der nun weißen Haare.
Einen schwarzen Schopf hatte er, wo nun eine Glatze ist, nur die Haare an den Seiten sind ihm geblieben. In seinen Erinnerungen war er größer, und kräftiger, da er in seiner Kindheit immer hart arbeiten musste.
Vor dem Spiegel richtete er nochmals sein weißes Hemd, am Kragen zupfte er, damit dieser stramm saß. Und dort, im Spiegel, sah er seine vernarbte Hand. Eine dünne Haut, voller Flecken bedeckten die tiefen Narben, sie zeichneten sich in seinem Fleisch wie Wurzeln eines uralten Baumes, welches die Erde aufbrach.
Jedes Mal, wenn er seine verunstaltete Hand sah, kam in seinem Geist das Bild von roten Flammen auf, lodernde Zungen, die nach ihm schnappten. Er spürte nochmals jene Hitze auf seinem Gesicht, die Hitze des Feuers und den Schmerz der tausenden Zähnen der Flammen, die seine Hand fraßen. Doch bald verblasste das Bild dieser schrecklichen Erinnerung und an dessen Stelle trat eine neue. Er sah eine Frau, eine junge Dame, ihre pechschwarzen Haare waren zu einem Dutt zusammengebunden worden. Ihre Haut war bleich wie Milch und ihre Lippen glänzte, wie die frischen Blütenblätter einer sich öffneten Rose am frühen Morgen. Sie war wie der kühle Frühlingsnebel, der die Blumen wach küsste.
„Ah Magda“, seufzte der alte Mann, „wir waren so jung! Es war meine Schuld, Magda! Oh Magda, kannst du mir verzeihen?“
Die Kirchenglocke bimmelte, es schlug schon fünf Uhr nachmittags. Der laute Klang der Glocke holte ihn aus seinen Gedanken.
„Es wird Zeit!“, meinte der alte Mann zu sich selbst.
Er packte seinen Gehstock und schloss gleichzeitig seine Haustür auf. Er schritt auf die Veranda und durchquerte seinen Vorhof, zum Gartentor. Eine Mauer umgab seinen Garten und damit Vögel die weiße Wand nicht verschandelten, hatte man zerbrochene Flaschen auf der Mauer einbetoniert. Wie Scherben aus Kristall funkelten sie im orangenen Licht der untergehenden Sonne.
Beim Öffnen des Gartentores, bemerkte der alte Mann wie sich Kinder unter einem Baum, neben den Stufen der Kirche, versammelt hatten.
Neben dem Gartentor stand ein Stuhl, ein Gerät das ihm schon so lange gedient hatte. Mit seiner kräftigen Hand hob er den Stuhl auf und klemmte diesen unter seinem freien Arm. Vorsichtig stieg er vom Fußweg auf die gepflasterte Straße.
„Klack klack“, klang sein Gehstock jedes Mal, wenn es den Steinboden damit schlug und sich darauf stützte.
„Tio Chico!“, hörte er die Kinder nach ihm rufen, „Komm doch!“
„Nicht so hetzen!“, rief der alte Mann zurück, während er den großen Platz überquerte.
Der schwere Stuhl unter seinem Arm verlangte nach Kraft, als er noch jung war, vermochte er damit zu rennen. Jetzt verlangte es ihm Mühen ab, den Stuhl bis zu jener Stelle zu tragen, die Nichteinmal fünfzehn Metern von seinem Haus entfernt lag.
Die Kinder, Mädchen und Jungen, umzingelten den Mann, als er seinen Stuhl bei den Stufen der Kirche, unter dem Baum, abstellte und sich dann hinsetzte.
„Was für ein schöner Abend“, meinte der alte Mann seufzend, „seht euch nur den Himmel an. Orange auf blau, schöner hätte man diesen nicht malen können!“
Die Kinder starrten hinauf, doch bald richteten sie ihre großen Augen dem alten Mann zu.
„Erzähl uns eine Geschichte“, forderte das Mädchen, „denn bald müssen wir wieder nach Hause!“
„Man kann auch Bitte sagen“, antwortete der alte Mann.
„Bitte Tio Chico!“, rief einer der Jungen.
Chico ließ seinen Blick über die Kinderschar wandern, alle kannte er beim Namen und er kannte von jedem die Eltern.
‚Wie die Zeit vergeht‘, dachte der alte Mann, denn er sah auch deren Eltern groß werden.
Doch an diesem Abend fehlten zwei Jungs, Felipe und Jorginho waren nicht da. Dieses Mal würden sie seine Geschichte nicht hören. Eine Traurigkeit legte sich wie ein grauer Schleier um Chicos Herz.
„Komm, erzähl uns eine Geschichte!“, rief einer der Buben lachend.
„Hetz nicht!“, meinte der alte Mann, „ich muss noch überlegen. Ach ja, ich erzähle euch eine Geschichte über diese Stadt. Einverstanden?“
„Jaaa!“, riefen die Kinder freudig.
Der alte Mann stampfte mit seinem Gehstock auf den Pflasterstein unter ihm und fing an, aus seinem Gedächtnis aus zu erzählen, was er einst gehört hatte:
„Ganz früher, als es Brasilien noch nicht gab, sondern Kolonien aus Portugal und Auswanderer anderer Länder Europas, stand hier keine Kirche, keine Häuser waren hier gebaut und der ganze Hügel war bedeckt von hohen Bäumen. Keine Menschenseele hatte dieses Tal zwischen den Bergen entdeckt, hier waren nur Bäume und Tiere. Das Tal zwischen den Bergen war still, denn unter diesem Hügel, der von einem schönen Fluss umspült wurde, schlief etwas Merkwürdiges. Die Kreatur des Hügels war größer als jedes Tier im Wald, größer als sogar die Anakonda selbst, die unter den Wellen des Wassers schlief.
Am Tag waren die Tiere still, um die Kreatur nicht aufzuwecken, in der Nacht verließen sie das Tal, um dem Wesen nicht zu begegnen. Eines Nachts kamen Männer dem Zugang dieses Tals näher, doch in der Dunkelheit konnten sie die Passage nicht finden. Sie hatten nur Kerzen und Tranlampen bei sich, sparsam gingen sie damit um. Sie waren geflohen vor den Holländern, die sich die Küste aneignen wollten. Frauen und Männer, Junge wie Alte, sind den Pfaden gefolgt, bis sie in der Wildnis rasteten und erschöpft sich niederließen. Weit sind sie in das Hochland eingedrungen, weit ab von der Küste und den Schiffen der Piraten und Eroberern.
Der Wald war nicht still in jener Nacht, von überall her hallten Rufe von Tieren, welche die Flüchtlinge nicht kannten. Sie hörten, wie Wasser plätscherte, ein Fluss war in ihrer Nähe, doch war es unklug in dieser Dunkelheit danach zu suchen.
Um möglichen Verfolgern nicht zu verraten, wo sie steckten, machten sie das Licht aus, und ließen nur eine Flamme brennen. Eine Flamme, die ihnen Licht genug bot, um sich zu orientieren. Doch ein Mann, entdeckte in der Dunkelheit ein gelbes Licht, weit entert und vor ihnen tanzte das Licht...“
„Bestimmt der Curupira!“, unterbrach ein Junge die Erzählung.
Tio Chico lächelte, bevor er weiter erzählte: „Doch da, als der Mann näher kam, wurde das Licht größer, golden flackerten die Flammen und warm wurde es ihm ums Gesicht...“
„Die Goldmutter?!“, unterbrach ihn ein lachendes Mädchen.
Tio Chico kratzte sich am Kopf, dabei meinte er: „Ihr habt schon zu viele Geschichten von mir gehört.“
Er betrachtete die großen Augen der Kinder, wie Schwämme sogen sie seine Geschichten auf.
„Als der Mann“, erzählte Tio Chico, „sich umschaute, war er ganz allein. Er blickte hinter sich, doch konnte er seine Gefährten in der Dunkelheit nicht mehr erblicken. Er schaute nach vorn und sah das Licht, das wie eine Morgenröte zwischen den mächtigen Baumstämmen hindurch scheinte. Je näher er kam, desto größer und länger wurde das flackernde Licht. Doch kein Curupira war daran schuld, noch die beliebte Goldmutter war jenes Licht. Als der junge Mann erkannte, was für ein Wesen das ist, war es schon zu spät! Er war bereits zu nahe gekommen und glühende Augen blickten in die seinige.“
Chico hielt inne, gebannt betrachteten die Kinder den alten Mann. Stille umgab die Gruppe und sie alle erwarteten gespannt wie die Gesichte ausging.
„Boo!“, rief Chico aus heiterem Himmel und zerriss so die Stille zwischen dem Geschichtenerzähler und seinen Zuhörern.
Die Kinder zuckten zusammen, holten tief Luft. Kurz saß der Schreck in der Seele, doch bald fingen sie an, darüber zu lachen.
„Was ist es nun?“, fragte einer der Kinder.
„Ja, was soll es sein?“, fragte Gabriela.
Chico lachte leise, bevor er weiter erzählte: „Mannshohe Augen aus Flammen blickten jenen jungen Mann an, Feuer tanzte um das Haupt des riesigen Wesens. Schuppen aus heißer Glut rieben am feuchten Waldboden und brachten es zum Dampfen. Merkwürdigerweise verbrannten die Äste und trockenen Blätter nicht, die Flammen blieben einzig und allein, auf dem Rücken des großen Biestes.“
„Ein Drache!“, rief ein Junge, „ein Feuerdrache!“
„Lasst mich doch die Geschichte erzählen“, meinte daraufhin Chico mit einem Lächeln auf den Lippen, denn er liebte es, wenn die Kinder neugierig waren, „wenn ich weiter erzähle, dann erfahrt ihr, was für ein Wesen hier einst hauste!“
Alle Kinder verstummten und richteten wieder ihren Blick zum alten Mann, der erneut anfing zu erzählen: „Kein Drache war das, aber was Ähnliches. Dieses Wesen hat ein Bruder, das im Wasser lebt und Flüsse gräbt, dieses aber war das Gegenteil seines Bruders, er war Feuer und Licht gleichzeitig. Wasser ist dem Boitata ein Gräuel. Vor dem jungen Mann bäumte sich eine mächtige Schlange auf, ein Biest aus Flammen und Glut. Ein imposanter Anblick bot der Boitata. Wie gelähmt stand der junge Mann da, er konnte sich nicht bewegen, noch nach Hilfe schreien. Die Augen der Schlange hatte ihn in dessen Bann gezogen und ließen ihn nicht los.“
„Hat sie ihn gefressen?“, fragte ein Junge.
„Nein“, meinte ein anderer, „die Schlange spie Feuer und verbrannte ihn!“
„Weder noch“, meinte der alte Mann, „Der junge Mann hörte die Stimme der Boitata in seinen Kopf, sie meinte, dass die Flüchtlinge in ihrem Tal willkommen sei, doch weil er ihr in die Augen geblickt hatte, würde er erblinden. Weil kein Sterblicher dieses heilige Licht sehen sollte. Dann verschwand die brennende Schlange in den dunklen Wald und ließ den Mann zurück. Am nächsten Morgen fanden seine Gefährten ihn, doch er war bereits blind. Der junge Mann erzählte seinen Gefährten, was ihm widerfahren war, und wie erblindete, nie würde er die golden brennende Schlange wieder sehen, doch hatte sich ihr Anblick in seinen Geist eingebrannt. Der junge Mann folgte der inneren Stimme, und führte die Flüchtlinge zu einem hohen Hügel, der mitten im Tal wie eine Kuppel sich erhob. Dort ließen sich die Flüchtlinge nieder.
Jahre vergingen, und aus den Flüchtlingen wurden schon bald die Bewohner des Ortes. Sie bauten Felder und ihre Hütten wurden zu richtigen Häusern aus Lehm und Stein. Jede Nacht, beobachteten sie, wie im Wald das Licht der Boitata flackerte, golden und feurig rot wie die Morgendämmerung. Doch die riesige Schlange tat ihnen nichts. Die Bewohner fingen sogar an, die Schlange zu ehren und sie versammelten sich, um die tanzenden Lichter aus der Ferne zu beobachten, denn sie wussten, was passierte, wenn sie zu nahe kamen.
Doch einem Mönch gefiel das nicht, er begann die Schlange zu hassen, obwohl sie ihm nichts getan hatte, im Gegenteil, sie hatte ihm eine neue Heimat geschenkt. Er fing an, die Bewohner aufzustacheln, und forderte sie auf, endlich eine Kirche zu bauen, um den Teufel von dieser Gegend zu vertreiben.
Die Bewohner fingen an, eine Kirche zu bauen, doch hörten sie nicht auf die Boitata, die Feuerschlange zu bewundern, mit ihren glühenden Schuppen und dem tanzenden Feuer um sie herum. Also ging der Mönch in den Wald und holte dort eine Schuppe der Boitata. Er zeigte ihnen die Schuppe, die im Licht goldig schimmerte, darin waren silberne Muster, als hätte man das Sonnenlicht mit dem Mondlicht vermischt. Er begann die Gier der Bewohner zu schüren, er versprach ihnen Reichtum und dass bald, dieses kleine Dorf eine mächtige Standt werde, wenn sie die Schlange vertreiben würden und in ihrer Höhle das Gold und Silber nehmen würden. Über die Jahre glaubten immer mehr Menschen den älter werdenden Mönch, der bei jeder Gelegenheit ihnen die goldene Schuppe zeigte.
Enes Tages, war die Gier stärker als die Dankbarkeit und die Menschen legten sich auf die Lauer. Sie warteten darauf, das die Sonne aufging, und das die Boitata sich wieder versteckte. Sie beobachteten, wie die Schlange in den Bergen verschwand, in eine Höhle kroch und dort einschlief.
All die gierigen Dorfbewohner folgten der Feuerschlange in den Berg, sie glaubten, sie könnten die Boitata im Schlafe töten und all das Gold und Silber stehlen, welche die Schlange angeblich besaß. Doch sie alle wurden vom Berg verschlungen, die Höhle verschwand unter Geröll und Felsen. Nur der Mönch blieb schockiert zurück. Alleine und sich schämend kehrte er zurück ins Dorf. Er wurde verhöhnt, weil er sehend war, aber doch blind, während ein Blinder sehend war.
Seitdem hatte man die Boitata hier nicht mehr gesehen, sowie jene Dorfbewohner, die danach trachteten, die Feuerschlange zu schaden. Das Gerede von Gold aber, blieb im Herzen der Menschen und breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Schon bald kamen mehr und mehr Menschen, um nach dem Gold zu suchen und aus dem Dorf wurde schon bald eine Stadt mit vielen Familien und vielen Kindern.“
„Fand man Gold?“, fragte eines der Kinder neugierig.
„Ja Antonio“, antwortete der alte Mann, „man fand in den Bergen schwarzen Stein und darin war Gold. Mann nannte es dann Schwarzes Gold, Ouro Preto. So wurde unsere Stadt bekannt, nach dem schwarzen Stein mit dem Gold darin. Das Gold lockte Hunderte an sowie mächtige Männer. Sie wurden reicher und reicher und Bauten richtige Fazendas. Die Stadt wurde sehr bekannt und der Strom der Menschen hörte nicht auf, denn Arbeit gab es genug. Doch in all den Jahren, wo Männer tiefe Stollen gruben, fand man die Boitata nicht. Keiner sah mehr die tanzenden Flammen in der Nacht.“
„Setzt du wieder unseren Kindern Flausen in den Kopf?!“, rief der Metzger, der seine Söhne abholte.
Die Jungen standen auf und der Metzger nahm beide an die Hand, dabei sprach er: „Schlangen sind des Teufels, deswegen tritt unsere Herrin Jungfrau Maria auf eine!“
„Da spricht der böse Mönch aus ihm“, meinte Chico mit einer ernsteren Stimme, „hört nicht auf diese Worte. Alles in der Natur hat seinen Platz und alles in der Natur ist ein Geschenk Gottes. Nichts darin ist des Teufels! Gut und Böse, Gnade und Gier haben diese Stadt aufgebaut, ihr müsst entscheiden zu welcher Seite ihr euch schlägt“, mit diesen Worten, verabschiedete Chico die Kinder, denn es war schon dunkel geworden. Die Abenddämmerung war nur ein schmaler, goldener Streif am Horizont. Müde schritt der alte Mann nach Hause zurück und nahm Platz am Tisch in seiner Küche. Eine Suppe hatte er sich gekocht und ließ sie ihm schmecken, dabei sah er aus seinem Küchenfenster und bemerkte, wie ein riesiger Vollmond aufging, zuerst golden dann silbern schimmernd im mitternachtsblauen Nachthimmel. Doch dann vernahm der alte Mann etwas, was er schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört hatte. Der Wind trug ihm ein Wiehern zu, das mehr einem markerschütternden Schrei glich.
„Klack, klack“, hörte er, ein schreckliches Stampfen, das Stein zum Bersten brachte, „Klack, klack.“
Seine Suppe warf wellen, als würde der Boden unter ihm beben. Näher kam das Geräusch und es wurde zu einem wilden Galopp, erneut hörte er den markerschütternden Schrei eines gequälten Tieres.
Schweiß bildete sich auf Chicos Stirn, sein Blick wanderte zu seiner verbrannten Hand. Sein Herz fing an, schneller zu pochen, seine Beine fingen an zu zittern.
„Nicht noch einmal“, hauchte der alte Mann aus.
Kapitel 2
Das Maultier ohne Haupt, A Mula sem Cabeça
Jorginho saß auf der letzten Stufe zu seinem Elternhaus. Der Junge beobachtete, wie die Nachbarn, fein und schick herausgeputzt, auf die Straße gingen und den Hügel hochstiegen. Selbst Sebastião war herausgeputzt worden, seine wilden Haare waren heute fein säuberlich nach hinten gekämmt und die Pomade glänzte im hellen Sonnenlicht, wie die teueren, schwarzen Lackschuhe seines Vaters.
Von der Spitze des Hügels ertönten die ersten Glockenschläge, welche die Müdigkeit aus Jorginho vertrieben. Sein älterer Bruder stürmte aus dem Haus, beinahe hätte er Jorginho mitgerissen, der friedlich auf der Stufe saß.
„Wir kommen noch zu spät!“, rief sein Bruder ins Haus, „Dann haben wir keine Plätze mehr und müssen hinten sitzen!“
„Was macht Mama noch?“, fragte Jorginho seinen zwei Jahre älteren Bruder.
„Sie sucht die Ohrringe von Oma“, antwortete Felipe und richtete dabei sein weißes Hemd.
„Die mit den Rubinen?“, fragte Jorginho ungehalten.
Er hatte diese Ohrringe ein paar Mal gesehen, doch es reichte, sodass diese Schmuckstücke sich in seinen Verstand einbrannten. Die roten Steine glänzten wie Feuer im Sonnenlicht und das Gold funkelte wie die Sonne selbst.
„Ja, genau diese“, antwortete sein Bruder, „Sie hat vergessen, wo sie diese versteckt hatte.“
„Geht voraus!“, rief Mama aus den Tiefen des Hauses, „Haltet mir einen Platz frei!“
Felipe seufzte und reichte seinem kleineren Bruder die Hand.
„Komm Jorginho“, forderte Felipe seinen Bruder auf, „vielleicht finden wir noch ein paar Plätze in den vordersten Reihen!“
Jorginho ergriff die Hand seines Bruders und beide stiegen den Hügel hoch. Ihre Schuhe machten Klack-Geräusche, jedes Mal wenn sie über die Kopfsteinpflaster schritten. Die Sonne ging gerade über der Kirche auf und die Glockenschläge wurden immer lauter und festlicher. Der Wind wehte von den Bergen herab und brachten die bunten Fähnchen, welche an den Seile hingen, die von Haus zu Haus gespannt waren zum Schwingen. Gelbe und weiße Banner säumten die uralte Straße zur Kirche und der Geruch von Popcorn, vermischt mit dem Duft von frisch gebrühten Kaffee hing in der kühlen Morgenluft. Jorginhos Blick wanderte zur Serra im Süden, die grünen Berge langen noch immer unter dichten, weißen Schwaden. Der Nebel floss wie silbernes Wasser über die Berghänge hinein ins Tal.
„Worauf freust du dich am meisten!“, fragte Jorginho seinem Bruder.
Ein Lächeln huschte über dessen Lippen, ein Grinsen verzog Felipes Gesicht und der Junge antwortete: „Die großen Schokoladeneier, welche jede Familie bekommt!“
Ja, daran erinnerte Jorginho sich, jedes Jahr zu Ostern, bekam jede Familie von der Gemeinde und der Kirche ein großes Schokoladenei. Wenn man dieses öffnete, kamen noch mehr Schokoladenkugeln herausgerollt.
„Worauf freust du dich?“, fragte Felipe ihn.
Die Schokolade schmeckte immer gut, süß und nach Milch. Doch Jorginho liebte die weichen Butterbrote, die seine Mutter immer an Ostern backte und am liebsten den aß er den Pudding aus Kondensmilch mit der Karamellsoße, die von der weißen Pracht runter tropfte.
„Ich freue mich auf den Pudding“, antwortete Jorginho, dabei knurrte sein Magen, wenn er an die goldene Karamellsoße dachte.
In der Kirche war es immer dunkler als draußen, doch bald gewöhnten sich die Augen an das Licht im Gotteshaus. Weiße Wände, bedeckt mit Bildern und Figuren der Heiligen, alle bunt bemalt, erwiderten jeden Blick, welchen Jorginho ihnen rüber warf.
Sein Bruder zog ihn an einem Arm, durch die Menge der Menschen die in die Kirche strömten. Felipe drückte sich an den Älteren vorbei, doch Jorginho war so dünn und klein, dass sich mühelos durch den Wald aus Beinen durchschlängelte.
Einige der Erwachsenen schimpften, als die beiden Jungen durch ihrer Reihen brachen und nach vorne stürmten.
„Ganz nach vorne!“, hetzte Felipe, „damit wir auch eine der besten Eier bekommen!“
Die Glocken bimmelten noch, innerhalb der Kirche klang dessen Töne dumpfer als draußen. In der zweiten Reihe waren noch Plätze frei, übermütig stürzte sich Felipe darauf und zog sein Bruder mit.
Plötzlich vernahm Jorginho das Klacken einer Krücke, die auf den Boden schlug. Er kannte allzugut dieses Geräusch, nach jedem klack, hörte er noch, wie ein Fuß nachgezogen wurde, die Sohle schabte beinahe an den Fließen der Kirche.
Jeder wusste, wo dieser alte Mann sich am liebsten setzte und keiner machte dem Opa seinen Platz streitig.
Ein fester Griff packte Jorginhos Schulter, der Geruch von Kaffee und Zigaretten stieg ihm in die Nase.
„Tio Chi- Chico!“, stotterte der kleine Junge.
Ein Opa mit weißen Haaren an den Schläfen und einer Glatze beugte sich über den Jungen. Die weiße, knittrige Haut war mit Altersflecken bedeckt und dessen Augen war glasig, die Äderchen färbten sie rötlich.
Jorginho hatte immer ein flaues Gefühl im Magen, welches beinahe an Angst grenzte, wenn er den alten Mann sah.
„Rutsch etwas rüber Junge!“, forderte Tio Chico den Jungen auf, „auf diesen kleinen Fleck pass ich nicht ganz drauf!“
Felipe umgriff seinen Bruder und zog ihn näher zu sich. Ohne was zu sagen, ließ sich dann der alte Mann auf den Platz neben Jorginho nieder. Obwohl der Junge, diesen Opa nicht sonderlich mochte, konnte er dennoch nicht die Augen von dessen Krücke nehmen. Ein Eselskopf mit aufgestellten Ohren zierte das helle Holz. Jorginho kannte Tio Chico, sowie jeder in der Stadt ihn kannte. Jeden Tag, im späten Nachmittag, verließ er aus seinem Haus, welches direkt neben der Kirche stand und setzte sich auf einem Stuhl im Schatten eines Baumes, gleich neben den Stufen hin und erzählte wilde Geschichten. Jung und alt, sie hörten gerne die Erzählungen, doch keiner sprach über Tio Chico. Keiner erzählte Geschichten über jenen Mann, der Geschichten erzählte.
Jorginho fürchtete sich am meisten vor der schweren Hand, die der kräftige Opa besaß. Sie war grob und voller Narben, als hätte er sie mal entsetzlich verbrannt. Ein bunter Stoff, rote Rosen und grüne Blätter wehten vor den Augen des Jungen und zog so seine Aufmerksamkeit auf sich.
„Mama, hier!“, sprach Felipe, dabei zeigte er auf dem Platz neben sich, „Ich habe es dir freigehalten.“
Der Blick Jorginhos glitt hoch und er erkannte seine Mutter, ihre schwarzen Haare waren säuberlich zusammengesteckt und ein kleiner Hut hielt sie zusammen. Die Rubine schimmerten wie die Funken des Osterfeuers, wenn sie hochflogen gen Himmel. Die gleiche Farbe hatte ihre Lippen, rubinrot und glänzend.
Sie setzte sich neben Felipe und stellte ihre kleine Handtasche auf ihre Beine. Im selben Moment fing die Orgel an zu spielen, die Gemeinde stand auf und richtete ihren Blick zum Eingangstor der geschmückten barocken Kirche. Ehrwürdig schritten die Ministranten voran und hinter ihnen folgte der neue Pfarrer.
Seine Haut war dunkler als die der meisten, seine Augen so braun wie das Holz des Pau Brasil. Jorginho hat mal gehört, wie einige Frauen ihn Mulato nannten, ein Begriff, was Jorginho nicht kannte.
Der Tag verging, das Fest fand sein Höhepunkt, die Menschen feierten vor der Kirche, sie kauften Popcorn von den Jungen oder gebrannte Cashewnüsse. Es duftete nach gekochtem, süßen Mais und ein leichter Duft von Zimt glitt mit dem Wind.
„Pass auf deinen Bruder auf!“, befahl Jorginhos Mutter Felipe, dabei strich sie mit der Hand über ihre Haare und berührte dabei einer der funkelten Ohrringe mit dem feurigen Steinen.
Felipe seufzte: „Willst du wieder beichten gehen?“
Sie schaute Felipe eisig an, als hätte er wieder Kuchen genascht, bevor sie diesen anschnitt, oder als ob er einen Ball gegen das Fenster geschossen hätte.
„Du bist mein Sohn!“, fauchte sie ihn beinahe schon an, „ich verlange Respekt von dir! Wenn ich sage, pass auf deinen Bruder auf, will ich von dir nur das hören: Ja, Senhora!“
Felipe ließ beschämt den Kopf sinken, gab aber keine Widerworte. Mama wandte sich dann um und schritt Richtung Kirche, dabei machte ihre Absätze der Schuhe klack, klack als sie über den harten Boden stolzierte.
Ein paar Jugendliche riefen dann: „Felipe! Felipe!“
Es war eine Gruppe von Mädchen, die eine hieß Gabriela, ihre Haare glänzten wie gelber Flachs, blond war sie mit wasserblauen Augen.
„Komm Felipe!“, rief sie, „Ich hab Lust auf Popcorn!“
Als Felipe sie sah, konnte er seine Beine nicht mehr ruhig halten, er wollte aufstehen, doch dann sank er wieder auf sein Hintern.
Eindringlich sah er zu seinem Bruder rüber und sprach dann: „Bleib hier sitzen! Ich komme bald wieder!“
Der Zwölfjährige schaute ihn nur an und nickte. Menschen spielten auf Fiedeln und die Musik von Akkordeons. Eine Gruppe von Männern sangen, in die Menschenmenge verschwand sein ältester Bruder zusammen mit dem Mädchen mit dem goldenen Haar und der blauen Schleife darin.
Es wurde dunkler, Sebastião, Antonio und Camillo kamen angerannt, mit ihren kleinen Händen riefen sie Jorginho zu sich.
„Komm Jorginho!“, lockten sie, „Alfredo, Antonios Bruder, hat Feuerwerk! Er will sie zünden, komm schauen!“
Jorginho schaute sich um, doch seine Mutter noch sein Bruder war zu sehen. Er wusste, würde er hier weggehen, würde er gewaltigen Ärger bekommen, sowie sein Bruder.
„Ich darf nicht!“, entgegnete Jorginho den drei Jungen, „ich muss hier warten!“
„Frag deine Mutter ob du kommen darfst!“, rief Camilo dem Jungen zu.
Es hörte sich nach einem guten Einfall an, Jorginho wusste, wo seine Mutter war, er musste nur zu ihr und sie fragen.
Er sprang von der Bank hinunter und eilte zur Kirche, er zwängte sich durch das Gewirr von feiernden Nachbarn, von kleinen Kindern und Frauen, die laut lachten.
Die Stufen ging er hoch, in der Kirche war es nun viel Heller als draußen, er schaute sich um, doch die einzigen Gesichter die er sah, waren die der versteinerten Heiligen. Die Figuren sahen zu ihm, doch keine trug das Gesicht seiner Mutter. Er schlich zu einer der schwarzen Kabinen, doch die purpurnen Vorhänge waren offen, keine Menschenseele war darin zu erkennen. Doch dann, leise und fast nicht zu hören, vernahm Jorginho ein Kichern, welches er wohl kannte. Das Kichern seiner Mutter, so kicherte sie einst, als sie noch mit Vater zusammen war und er über ihre Ohrläppchen streichelte. Sie kicherte nicht mehr, seit er gestorben war, seit das Fieber ihn geholt hatte.
Jorginho folgte dem leisen Kichern, es schien hinter einer Tür zu kommen, das neben dem kunstvoll verzierten Altar stand. Nur einen Spalt öffnete der Junge die Tür und schon sah er seine Mutter. Der Anblick ließ ihn stoppen, sein Körper schien gelähmt. Dunkle Arme schlangen sich um den weißen Leib seiner Mutter, ihre Haut war nass sowie die Haut des Mannes, der sie hielt. Sein Gesicht war vergraben unter ihren dunklen Haaren, sein Kopf lag auf ihren Hals, ihre Beine beugten sich und der Mann küsste sie.
Der Junge erkannte den Pfarrer, jener Mann, der von den anderen Frauen Mulato genant wurde. Plötzlich riss jemand am Jungen, gleichzeitig fuhr ein Schreck durch ihn, welches ihm die Sprache verschlug.
Zwei Hände umgriffen die schmalen Schultern, mit weitaufgerissenen Augen blickte sein größerer Bruder ihn an.
„Willst du, dass ich mit dem Gürtel verprügelt werde?!“, fauchte Felipe, „Ich habe gesagt, dass du auf der Bank warten sollst!“
Doch Jorginho brachte kein Laut von sich, kein Wort kam durch die Lippen. Sein Bruder nahm ihn bei der Hand und zerrte fast ihn aus der Kirche, als Felipe zur Bank kam und Mutter nicht sah, wurde er ruhiger. Nur Gabriela und zwei ihrer Freundinnen wartete auf Felipe. Popcorntüten hielten sie in den Händen und boten ein paar Jorginho an.
Nach langer Zeit kam seine Mutter wieder und alles verlief wie gewohnt, er durfte mit seinen Freunden spielen und Felipe leistete Gabriela Gesellschaft am Osterfeuer.
Eine Nacht verging sowie fast ein ganzer Tag, die Sonne ging unter und der Mond stieg den blauroten Himmel hinauf. Voll rundete er sich und Jorginho merkte, dass seine Mutter die Ohrringe nicht mehr abnahm. Sie vergaß das Abendessen in der Pfanne, das Öl und der Fisch verbrannten, als sie geistesabwesend aus dem Fenster starte und mit den Fingern über die Ohrringe aus Gold und Rubinen strich.
Als sie es bemerkte, wurde sie nicht sauer, wie es gewohnt war. Sie warf den Fisch einfach den Hunden vor und stellte alles andere auf den Tisch.
Es wurde dunkler, die Sonne verbarg sich nun hinter den Bergen und die Nacht brach hinein, Mama legte die Gabel hin, sie hatte kaum was gegessen. Ihre Hand glitt zu ihrem Kopf, sie hielt diesen, als würde dieser hunderte Kilos wiegen.
„Ich habe Kopfschmerzen“, flüsterte sie, „Felipe, räum das Geschir ab und spüle es. Ich gehe schlafen, ich will nicht gestört werden!“
Sie stand auf und schritt zu ihrem Zimmer, dabei machten ihre Schuhe klack, klack. Auf den Fliesen des Bodens.
Auch Felipe und Jorginho gingen nach Erledigen der Aufgabe ins Bett. Schließlich hätten sie am nächsten Tag Schule.
Mitten in der Nacht hörte Jorginho wieder diesen klack, klack. Doch es hörte sich viel schwerer an, als würde jemand stampfen. Dieses Geräusch riss den Jungen aus dem Schlaf, doch es kam nicht aus dem Haus. Mit der kleinen Hand rieb er sich den Schlaf aus den Augen, er stieg aus dem Bett und stolperte zum Fenster. Vorsichtig, um seinen Bruder nicht zu wecken, öffnete er die Läden und blickte hinaus.
Wieder hörte er ein klack, klack, welches aus dem Garten kam. Sein Blick wanderte durch das erhellte Land, denn der Vollmond leuchtete wie eine Lampe vom Himmel herab.
Doch ein anderes Licht mischte sich mit dem fahlen Licht des Mondes. Ein rotgoldener Schein flackerte in den Schatten unter den Obstbäumen, viel heller als die Petroleumlampen oder Gaslaternen. Verwundert beobachtete Jorginho das Spiel von Licht und Schatten, die sich in die Länge zogen und über den Boden krochen. Wieder, ein klack, klack, war zu hören, viel schwerer im Klang, ein greller Schrei zerriss die mitternächtliche Stille; in Ruf, welches aus der Hölle selbst stammte.
Jorginhos Blut gefror, seine Glieder wurden steif und sein kleines Herz schlug nun doppelt so schnell in seiner Brust.
Die Schatten wurden kürzer, das gespenstische Licht wurde heller. Jorginho traute seinen Augen nicht, als er die Kreatur sah, die sich dem Haus näherte. Ein Maultier, dessen Haupt fehlte, galoppierte wild umher. Aus der offenen Speiseröhre des Tiers strömte ein unheiliges Feuer, welches den Kopf ersetzte. Zaumzeug schwebte vor den Flammen, als würde ein unsichtbarer Kopf dort noch sein. Das dämonische Tier schlug mit den Hufen, aggressiv rann es umher, doch dann, mit einem Satz sprang es über die hohe Mauer des Gartens und ein höllischer Schrei entfesselte sich aus der offenen Kehle des Ungeheuers.
Auch Jorginho schrie nun vor Angst, er hatte die Hitze des Feuers auf seiner Haut gespürt, als das Tier über die Mauer sprang. Feste Griffe packten ihn an der Schulter, sein Bruter schüttelte ihn und bläute ihm ein: „Sei ruhig! Willst du von Mama eine Strafe bekommen! Wenn du ein Albtraum hast, sei ruhig und schlaf weiter!“
„Da, da!“, stammelte der kleine Junge, während sein Herz fast aus seinem Mund rausgesprungen wäre, „Ei- ein Ma- Maul- Maultier oh- ohne- Haup- Haupt!“
Felipes Augenbrauen zogen sich fest zusammen, dabei erwiderte er: „So was verrücktes, es war nur ein Traum!“
„Meine Augen waren offen!“, protestierte Jorginho.
„Geh ins Bett!“, forderte Felipe ihn kühl auf, „morgen können wir darüber reden.“
Dabei legte sich Felipe hin und warf sich die Decke über den Kopf.
Am nächsten Morgen, wachten die Jungen mit dem Hahnenschrei auf, „Kikiriki, Kikiriki“, schrie der Hahn aus voller Kehle.
„Eigenartig, dass Mutter uns nicht geweckt hat!“, meinte Felipe, dabei rieb er sich die Augen frei von dem Schlaf. Die Morgensonne färbte den Himmel bereits bläulich- golden. Als sie die Schlafzimmertür öffneten, bemerkte Felipe Rote Erde auf den Fußboden. Jene rotbraune Erde, die von den Wäldern stammte.
„Wenn Mama das sieht!“, flüsterte der Junge ehrfürchtig, denn er wusste, jemand würde dafür die Schuld tragen.
„Da!“, meinte Jorginho, „Die Spur führt zu Mamas Zimmer!“
Die beiden Jungen folgten der Spur aus Roter Erde, vorsichtig stieß Felipe die Tür auf. Beide Jungs sahen ihre Mutter, wie sie auf dem Bett auf der Seite lag. Die teuren Schuhe aus schwarzem Leder, der dünne Absatz, waren besudelt mit rotem Schlamm. Mit dem gleichen schwarzen Kleid, den sie gestern anhatte, schlief sie nun.
„Mutter?!“, wagte Felipe, leise zu sprechen, „Es ist Zeit für das Frühstück! Mutter?!“
Ein kratzendes Stöhnen entwich der Mutter, ein gespenstisches Seufzen folgte.
„Ihr seid alt genug euch selbst Frühstück zu machen!“, ihre Stimme klang nicht nach ihr und ein aggressiver Unterton lag in ihrer Kehle.
Ohne Widerworte zu geben, schloss Felipe wieder die Zimmertür und ging mit seinem Bruder zur Küche.
Den ganzen Tag kümmerte Jorginho jenes Ereignis, welches er in der Nacht beobachten konnte. Jener Dämon in Gestalt eines enthaupteten Tieres verfolgte ihn in seinen Gedanken. Nun lag seine Mutter mit dreckigen Schuhen auf den weißen Bettlaken. Sowas sah es ihr nicht ähnlich.