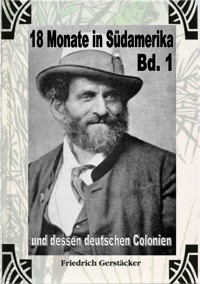
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"So viel ich auch gereist bin, und wohin mich immer meine Bahn geführt, ich habe mir dazu immer nur Länder ausgesucht, in denen die Wildnis mit der Zivilisation ringt, und dort stets den interessantesten Stoff für meine Skizzen gefunden" schrieb Friedrich Gerstäcker zu seinem zweibändigen Werk über seine Reisen durch Südamerika. Zunächst war es die lange Schiffsreise, dann ging es auf abenteuerlichen Pfaden kreuz und quer durch Südamerika, inmitten zahlreicher Revolutionen und Kriege. Seine Schilderungen von Land und Leuten sollten auswanderungswilligen Deutschen wertvolle Hinweise geben, was sie in diesem weiten Land mit seinen verschiedenen Staaten erwartete. Oft unter Lebensgefahr bestand der Weltreisende und Abenteurer zahlreiche Gefahren, bevor er wieder in die Heimat zurückkehrte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Gerstäcker
Achtzehn Monate in Südamerika.
und dessen deutschen Colonien
Erster Band.
Volks- und Familien-Ausgabe Band Vierzehn
der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Ungekürzte Ausgabe nach der von Friedrich Gerstäcker für die Gesammelten Schriften, H. Costenoble Verlag, Jena, eingerichteten Ausgabe „letzter Hand“, herausgegeben von Thomas Ostwald für die Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig, mit besonderem Dank an Frau M. Jonas für die Durchsicht dieses Bandes.
Die Texte Friedrich Gerstäckers enthalten Ausdrücke, wie sie heute nicht mehr verwendet werden. Wir haben sie trotzdem belassen, weil die Werkausgabe seine Originalarbeiten nach der von ihm selbst eingerichteten Ausgabe wiedergibt und nicht dem heutigen Sprachgebrauch angepasst ist.
Unterstützt durch die Richard-Borek-Stiftung und
die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, beide Braunschweig
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. u. Edition Corsar
Braunschweig. Geschäftsstelle Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten. © 2005 / 2023
1. Ausfahrt.
Am 8. Mai 1860 verließ ich zum dritten Mal die Heimath, um dem amerikanischen Continent einen längeren Besuch abzustatten; diesmal aber mit einem viel bestimmteren Ziel als früher, denn der Zweck meiner jetzigen Reise galt vorzüglich den in Südamerika zerstreuten deutschen Colonien und Landsleuten, die aufzusuchen ich mir vorgenommen. Wir werden später finden, daß die Sache hier und da mit einigen Schwierigkeiten verknüpft war. – Am 17. Mai schiffte ich mich in Southampton mit dem prachtvollen englischen Dampfer La Plata ein; in der Mündung des Flusses passirten wir den noch nicht ganz seefertigen Koloß, den Great Eastern, der wie eine schlafende Kaserne auf der Fluth lag, und neben dem selbst unser Dampfer von 2600 Tons wie ein Boot aussah1.
Es war das erste Mal, daß ich mit einem Seedampfer fuhr, aber ich müßte lügen, wenn ich sagen wollte, daß mir die Fahrt gefallen hätte. Rasch geht es, das ist wahr, und Wind oder Windstille kümmern den keuchenden Koloß nicht, der gegen Wind und Strömung starr und eisern seine Bahn verfolgt; aber es ist eben keine Seefahrt, die man macht. Man lebt wie in einem großen Hotel, von einer Unzahl von Kellnern umgeben, und nimmt auch nicht das geringste In/6/teresse an dem Meer selber. Ich bin überzeugt, daß Hunderte von Passagieren eine solche Reise machen und, wenn sie an dem Ort ihrer Bestimmung landen, noch nicht einmal den Salzgeschmack des Meeres gespürt haben. Aber Zeit ist Geld – wenigstens bei unserer Race, denn der spanische Amerikaner kennt kein solches Sprüchwort – und deshalb füllen sich auch die Dampfer, deshalb drängt Alles dem rauchenden Koloß zu, die „Ueberfahrt“ – denn eine Reise nennt man es gar nicht mehr – so rasch als irgend möglich abzumachen. So fliegen wir denn einmal zusammen in’s Weite, und da Zeit Geld ist, wollen wir uns auch nicht lange mit der „Ueberfahrt“ aufhalten. Nur wenige Worte genügen, einen Tag zu schildern, und dreizehn solche bilden eine Reise nach Westindien. Morgens bekommt man den Kaffee schon an’s Bett gebracht, steht dann auf, um zu frühstücken, geht ein wenig an Deck, damit der Tisch für den Lunch oder das zweite Frühstück gedeckt werden kann, und hat kaum eine oder zwei Cigarren geraucht, als schon wieder zum Mittagessen geklingelt wird. Das vorüber, wird Kaffee getrunken, dann Thee, und um elf Uhr werden die Lichter an Bord ausgelöscht – ein ziemlich deutliches Zeichen für die Passagiere, daß sie nun so gut sein mögen, zu Bett zu gehen. An Bord des La Plata wurde jeden Mittag nach zwölf Uhr eine Tafel ausgehängt, auf der die Entfernung angegeben stand, die wir gemacht hatten, wie der Breiten- und Längengrad, auf dem wir uns um zwölf Uhr befanden. Die Schnelligkeit, mit der wir vorwärts rückten, variirte dabei – fortwährend gegen den Wind – von 271 bis 304 englischen Meilen in 24 Stunden. Sonderbarer Weise erreichten wir den Passatwind nämlich dieses Mal erst an demselben Tage, an dem wir in St. Thomas einliefen, also ein klein wenig zu spät.
Die einzige angenehme Unterbrechung des monotonen Lebens an Bord war ein Feuerlärm – Anschlagen eines Gongs, Stürzen der Leute nach den Eimern, Bemannen der Patentpumpe und zuletzt, als kein Pumpen mehr helfen wollte, der Boote, wo Jeder der Leute seinen bestimmten Posten hatte. Etwas später erfuhr man freilich, daß es eben nur ein Exer/7/citium gewesen, die Mannschaft, falls je ein solcher Unglücksfall eintreten sollte, ihre Posten genau zu lehren und die Ordnung dabei aufrecht zu erhalten. Es war auch ganz hübsch, einigen der Passagiere aber flogen die Glieder am Leibe, und ein junger Spanier hatte sich in der Eile, seinen Koffer zu erreichen und an Deck zu schleppen, blos das Schienbein ein wenig aufgeschlagen. Ich muß übrigens noch hinzufügen, daß den Damen vorher Nachricht von dem Manöver gegeben war, um ihnen wenigstens den Schreck zu ersparen.
Die Dampfer, ehe sie Westindien erreichen, passiren eine kahle kleine Guano-Insel, die, aus irgend einem räthselhaften Grunde, Sombrero – der Hut genannt wird; sie hat nämlich nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit irgend einer so genannten Kopfbedeckung. Sombrero ist ein kahles, dürres, trostloses Eiland, ohne selbst einen einzigen Baum; die Yankees aber, die sich schon lange die größte, wenn auch vergebliche Mühe gegeben, in den westindischen Inseln festen Fuß zu fassen, scheinen es hier möglich gemacht zu haben. Einige zwanzig bretterne Häuser, in dem bekannten Styl neu errichteter amerikanischer Städte, stehen auf dem Boden, dem selbst fußhoher Guano keine Vegetation entlocken konnte, und die amerikanischen Sterne und Streifen flatterten lustig in der Brise über einer Sammlung von Wirthshaus- und Trinkbuden-Schildern. Kaum war der Dampfer aber in einer Höhe mit der Insel, als auch schon Signale aufstiegen, und die Frage, die sie an uns mit diesen stellten, war: „ob in Europa Krieg erklärt wäre?“ Die Leute mußten die friedlichen Versicherungen des friedliebendsten Kaisers der Franzosen entweder nicht gelesen haben, oder ihm kein Wort davon glauben. Wir konnten sie indessen beruhigen. An der Insel lagen mehrere kleine Fahrzeuge, die Guano luden.
Die westindischen Inseln, die man hier zuerst berührt, bieten einen trostlosen, öden Anblick. Sie sind dürr und kahl, und auch fast unbewohnt, einige kleine Fischerhütten ausgenommen. Auf einigen wird jedoch, wenn ich nicht irre, Kupfer gewonnen. Nachmittags zwischen drei bis vier Uhr erreichten wir St. Thomas, eine dänische Insel, die von der englischen Compagnie zu ihrem Sammelplatz für die Dampfer /8/ gewählt ist, weil sie den besten Hafen der ganzen Gruppe hat. Sonst zeichnet sie sich eben so wenig durch üppig tropische Vegetation aus, und nur die kleine Stadt liegt ziemlich malerisch auf drei vorspringenden Hügeln und ist von Palmen freundlich eingefaßt.
„Station St. Thomas – fünf Stunden Aufenthalt – Billette, wenn ich bitten darf“ – es ist kaum anders, wie auf der Eisenbahn. Der andere, für Colon bestimmte Dampfer legte auf einer, der für Jamaica schon geheizte auf der andern Seite an, und wie die wilde Jagd wurden Briefsäcke, Kisten, Gepäck und Passagiere nach den verschiedenen Richtungen ausgeladen, um ihre Reise, so gut das gehen wollte, fortzusetzen. Hier bekam auch ein Mann Arbeit, der bis jetzt, die personificirte Langeweile, an Bord herumgeschlendert war und in Officiersuniform einherging. Auf meine Frage, wer er sei, erhielt ich die Antwort: der Admiralitäts-Agent; an Bord der Dampfer heißt er aber kurzweg und keineswegs so ehrerbietig bags, weil er auf die mail bags oder Briefsäcke Acht zu geben hat. Das ist ein Leben –ewig Passagier, und nichts auf der Gotteswelt zu thun, als, in dem Hafen angelangt, dabei zu stehen, wenn die verschiedenen Briefsäcke ausgeladen werden! Zu einem solchen Geschäft gehört auch in der That ein außerordentlich geistreicher Mann, oder Jemand, der gerade das Gegentheil ist – ein Mittelweg findet da nicht statt, oder der Admiralitäts-Agent müßte wahnsinnig werden.
Von St. Thomas bis nach Colon oder Aspinwall an der amerikanischen Küste und dicht unter der Mündung des Chagresflusses fuhren mir mit einem etwas kleineren Steamer, als der La Plata gewesen, und mit vortrefflichem Wind auf völlig ruhiger See, und erreichten am vierten Abend eines der ungesundesten Nester, um das je die tropische Sonne Pest und Fieber ausgebrütet hat. Colon ist auch in der That weiter nichts als eine sumpfige Insel unter Wasser, welcher der hartnäckige Amerikaner gerade genug Boden abgewonnen hat, um ein paar Holzhäuser darauf zu setzen. Durch die Eisenbahnbrücke ist sie mit dem festen Lande verbunden, und was sich der Mensch nur von Morast und Sumpf und /9/ fetter ungesunder Vegetation, von giftigem angeschwollenen Thier- und Pflanzenleben denken kann, findet hier seine Vertreter. Schon der Unrath, der überall aus den Häusern in die stehenden Sumpfwasser geworfen ist und nicht fortgenommen werden kann, athmet Seuchen, und man braucht die grüngelben Menschen gar nicht anzusehen, die hier am Ufer herum und aus einem Hause in’s andere schleichen. Glücklicher Weise ging schon um neun Uhr der Bahnzug nach Panama; ich behielt eben Zeit, einen Brief nach Hause aufzugeben und mein Gepäck in die Expedition zu schaffen, und durfte dann schweres Geld bezahlen, um von diesem Pestorte wieder fortzukommen.
Die Fahrtaxe ist enorm, denn man bezahlt für eine Strecke von 42 englischen, also noch nicht 9 deutschen Meilen 25 Dollars, hat dabei 50 Pfund Gepäck frei und mußte für jedes Pfund Uebergewicht 10 Cents, also für je 10 Pfund wieder einen Dollar bezahlen. Jetzt ist die Gepäcktaxe um die Hälfte ermäßigt. – Einige der Passagiere hatten bis zu 80 Dollars nur an Uebergewicht zu entrichten. Wenn man aber die Bahn befährt, wenn man sieht, durch welchen Grund und Boden die Eisenschienen gelegt wurden, wenn man das ganze Land und diese Vegetation sieht, diese Sonne und diesen warmen tödtlichen Dunst fühlt, dann zahlt man gern und willig solchen Preis, und ist den Leuten, die es unternahmen, noch dankbar außerdem.
Die Bahn, der die Erhöhung des Bodens nicht die geringste Schwierigkeit bot, denn die Cordillerenkette schmilzt hier zu einer Hügelreihe von einigen hundert Fuß Erhöhung zusammen, während nur eine einzige, etwa acht Bogen haltende Brücke gebaut werden mußte, hat acht Millionen Dollars und zehntausend Menschenleben gekostet, und besonders sind hier Irländer, Deutsche und Chinesen zum Opfer gefallen. Aber auch viele Amerikaner liegen hier begraben, denn den Auswanderern nach Californien gab man freie Passage, wenn sie eine gewisse bestimmte Zeit an dieser Bahn mit arbeiten halfen. Die armen Teufel dachten nicht daran, daß sie sich indessen ihre eigenen Gräber ausschaufelten. – Man hat berechnet, daß man die Eisenschienen dieser Bahn /10/ die ganze Strecke lang auf die Leichen der dabei Gestorbenen legen könnte, und es ist wohl nicht die geringste Uebertreibung dabei – aber was thut das! der Unternehmungsgeist des Menschen hat gesiegt, und wieder ein Glied zu der Kette wurde geschmiedet, die unser keckes Jahrhundert um die Erde zieht.
Die Bahn läuft, nur hier und da den Biegungen des Flusses ausweichend, am Chagresstrom aufwärts, und mit Ausnahme kurzer Strecken mußte jeder Fuß breit in dem Sumpf ausgefüllt werden, um die Schienen zu legen. Rechts und links von diesen steht das braune, dunstige Sumpfwasser; rechts und links von diesem ranken fette Schlingpflanzen und bohren sich selbst unter die Schwellen und Schienen hinein, daß es Tausende jährlich kostet, nur um gegen diese Vegetation siegreich anzukämpfen. Selbst auf der Wasserscheide zwischen dem Atlantischen und dem Stillen Meere ist es nur wenig besser. Das Land ist hier allerdings trockener; nur kurze Strecken abwärts beginnt aber der Sumpf schon wieder und läuft ununterbrochen bis Panama hinein. Unterwegs liegen, außer den auf den Stationen gebauten Häusern, nur Indianerdörfer, und nackte Kinder und halbnackte Männer und Frauen stehen vor ihren Hütten und sehen das unbegriffene Ungethüm der Bleichgesichter vorüberbrausen. Die Bahn rentirt sich übrigens vortrefflich, und der Waarentransport, welcher natürlich ermäßigte Taxen hat, soll so bedeutend sein, daß das Unternehmen bis jetzt 12 Procent zahlt, und allem Anschein nach jährlich mehr zahlen wird, selbst wenn ihm auch die Ponypost nach Californien durch die Steppen manchen Passagier abwendig macht.
In Panama langten wir natürlich im Regen an, und ich bekam deshalb wenig davon zu sehen. Der Ort ist übrigens schon oft genug beschrieben worden und bietet, außer den alten Ueberbleibseln der spanischen Baukunst in Kathedrale und Festungswerken, wenig Besonderes. Außerdem ist es das theuerste Nest an der ganzen Westküste, jetzt nicht einmal San-Francisco ausgenommen, und wer sich hier ansiedelte, that es einzig und allein in der löblichen Absicht, die Reisenden mit plündern zu helfen. Ich dankte meinem Schöpfer, als ich /11/ schon am nächsten Morgen Gelegenheit fand, gen Süden wieder unterwegs zu gehen; denn die Anna, ein kleiner, der englischen Compagnie gehörender Dampfer, lag fertig zum Auslaufen, und dampfte auch richtig schon am nächsten Morgen zehn Uhr in die wunderbar schöne, inselbedeckte Bai hinein.
Es giebt kaum etwas Schöneres in derartiger Scenerie, als diese stille, mit Palmeninseln geschmückte Bai von Panama, in welche die kleine sonnige Stadt auf einer schmalen Halbinsel hinausragt. Aber man muß das Alles eben nur als Scenerie, als Decoration betrachten und darf der Sache nicht näher auf den Grund gehen. Die Bai selber schwärmt von Haifischen, so daß nur ein einfaches Bad darin schon halber Selbstmord ist, und wollte man die kleinen, von Cocospalmen überschatteten Plätze am Ufer besuchen, so würde man nichts als Schmutz und Unrath finden.
Uebrigens behielten wir vollständig Zeit, um das Alles genau zu betrachten, denn ich fand bald zu meinem Schrecken, daß wir mit dem Dampfer kaum von der Stelle rückten. Wir liefen unterwegs mit unterem Gang, den der Capitain jedenfalls scherzend, sonst aber ganz ernsthaft full speed nannte, 3 – 3 ½ Knoten die Stunde, und der Erfolg zeigte denn auch bald, daß wir einen Tag mehr brauchten, um die halbwegs zwischen Guajaquil und Panama gelegene Station Buenaventura zu erreichen, als der gewöhnliche Dampfer nöthig hatte, um Guajaquil selber anzulaufen. Es ließ sich aber eben nicht ändern, denn der große Dampfer legte an keinen Zwischenstationen an, und mir lag daran, von einem Engländer zu hören, der irgendwo in Ecuador gelandet war, und den ich zu treffen wünschte.
Schon in Panama hatten wir nun wunderliche Sachen über die neu-granadische Revolution gehört, nach der sich die Caucabevölkerung zuerst einem ungerechten Gesetz der Regierung der Nordstaaten widersetzte und dann Miene machte, die Regierung selber an sich zu reißen, und in Buenaventura fanden wir die Revolution in vollem Gange, ja die ganze militärische Macht – einundzwanzig so zerlumpte Kerle, wie nur je ein altes Schießeisen auf der Schulter getragen – /12/ am Strande aufmarschirt. Der Gouverneur hatte ihnen dort gesagt, unser Dampfer, der vielleicht 300 Tons Gehalt haben mochte, brächte eine Million Soldaten von Panama, ihren Platz zu überrumpeln, und diese einundzwanzig Spartaner wollten sich denen widersetzen. Die Leute schienen übrigens sehr angenehm überrascht, als unsere kleine Anna keine feindseligen Absichten gegen die paar elenden Bambushütten zeigte, und der Gouverneur, der eins der maliciösesten Gesichter der Erde trug, wurde auch natürlich gleich übermüthig und unverschämt. So verlangte er von unserem Capitain, daß er ihm ohne Weiteres die Post überliefern sollte; der Capitain nahm aber nicht die geringste Notiz von ihm, und wir gingen, trotz seiner sehr lebhaften und zornigen Gesticulationen, direct auf das Haus zu, von dem die englische Flagge wehte. Hier residirte der bisherige Postmeister, der aber jetzt durch den Gouverneur der „freien Caucanation“ abgesetzt war. Trotzdem zwang der Gouverneur den armen Teufel, während die Soldateska den Platz besetzt hielt, den Empfang der Briefschaften zu bescheinigen, und nahm sie dann, als sie jenem überliefert worden, augenblicklich in Beschlag und in seine eigene Wohnung. Das Militär marschirte hierauf ab, und der Officier desselben, die einzige anständig aussehende Persönlichkeit der ganzen Regierung, schien sich seines Postens zu schämen, denn er schlenkerte den Säbel, den er trug, am kleinen Finger hin und her, als ob ihn die ganze Sache eigentlich gar nichts anginge, und marschirte so weit von der Truppe ab, wie es die bodenlos schmutzige Straße nur erlaubte.
Die ganze Stadt bestand eben aus der einen Straße, mit größtentheils auf Pfählen errichteten Bambushütten, aus denen überall neugierige und scheue Gesichter in den verschiedensten Färbungen hervorschauten. Jedes Haus fast hatte aber unten einen kleinen Kaufladen, in dem Flaschen mit agua ardiente und anderen, meist europäischen Herrlichkeiten aufgeschichtet standen. Irdenes Geschirr und Kattune, Pulver, alte, rostige Schrotflinten, Seife, Stricke, Cacao, Reis und Kaffee schienen die Hauptartikel, und wild genug war alles arrangirt. Erstaunt blieb ich aber stehen, als ich mitten zwi/13/schen diesem Plunder, mitten zwischen den malerischen, halbnackten Gestalten der Eingeborenen und Spanier was? erkannte, das hier einsam und verlassen recht im Herzen der Wildniß, am Stillen Meere hing? – eine Crinoline. Unwillkürlich fast dachte ich an the last rose of summer, left blooming alone; mitten in der Revolution, in der Aufregung der Gemüther dieses eine stille Bild des Friedens und der Civilisation!
Aber der Aufenthalt in Buenaventura war, trotz der Crinoline, kein angenehmer. Es regnete fortwährend, und die Stadt lag außerdem in Schmutz, Schlamm und Sumpf, die Leute sahen auch bleich und elend genug aus. Trotzdem segnete ich den Platz, denn er befreite uns von einer Quantität der unangenehmsten Mitpassagiere, die ich noch auf allen meinen Reisen gehabt habe. In Panama hatten wir nämlich elf italienische Priester an Bord bekommen, die in Buenaventura ausstiegen und von hier aus über das Land verstreut werden sollten. Es waren, mit Ausnahme eines einzigen, lauter junge Burschen von zwanzig bis vierundzwanzig Jahren, dabei schmutzige, gefräßige, schnatternde Gesellen, die überall das Deck bespuckten, bei den Mahlzeiten die Lebensmittel in sich hineinstopften und hernach seekrank über Bord hingen. So wie sie sich aber nur etwas wohler fühlten, sangen sie lustige Lieder, schrieen, jubelten, spielten Karten, und waren bald von Allen an Bord auf das Herzlichste gehaßt und verabscheut. Die hatten dem Lande hier eben noch gefehlt. Ebenfalls gingen hier einige Deckpassagiere ab, die in die neu-granadischen Goldminen hinaufwollten. Arme Teufel! ich beneidete sie nicht um ihren Marsch und ihre Arbeit in dem Land und Wetter.
Von Buenaventura lag unser nächstes Ziel südlich in Tomaco, einer Insel in der Mündung des Miraflusses und an der Südgrenze der neu-granadischen Republik. Das Ufer ist hier überall flach, und obgleich die Cordilleren gar nicht so weit entfernt liegen, bekamen wir sie nicht ein einziges Mal zu sehen. Dichte Wolken hingen über der ganzen dunkeln Urwaldfläche und hüllten das weite Land in düstern Nebel. Erst in Tomaco erreichten wir höheres Land, und mit einem /14/ Sonnenblick war es, als ob wir ein kleines Paradies betreten hätten. Nie im Leben habe ich auf einer Stelle eine größere Menge von Fruchtbäumen und Früchten gesehen, und die ganze Insel lag von Cocospalmen, Bananen und anderen werthvollen Bäumen fast vollständig bedeckt. Tomaco scheint auch wirklich der Garten der Nachbarschaft, denn selbst von den viel südlicher gelegenen Ortschaften kommen Schooner und kleinere Fahrzeuge hierher, die weiter nichts als Früchte einnehmen und vortheilhaften Handel damit treiben. Und doch könnten die Bewohner aller der Ortschaften, wohin sie dieselben bringen, dieselben Früchte eben so gut und reichlich ziehen – wenn sie nicht eben so verwünscht faul und lässig wären.
Unser nächstes Ziel war von hier aus Esmeraldas. Ich selber hatte die Absicht gehabt, mit dem Dampfer bis Guajaquil zu fahren, von da nach Quito hinauf zu marschiren und auf dem Rückweg von dort die neubeabsichtigte englische Colonie am Pailon zu besuchen2. In Esmeraldas änderte ich meinen Plan, denn hier kam der Chef jener Expedition, den ich in Guajaquil, Quito oder Gott weiß wo vermuthete, an Bord und sagte mir, daß er in den nächsten Tagen nach dem Pailon aufbrechen würde. Rasch hatte ich meine Sachen geordnet und meinen Koffer nach Guajaquil dirigirt, wo ich ihn später wieder in Empfang nehmen wollte, während ich selber mit Büchse und Bergsack in das Boot sprang, um an Land zu fahren.
Das kleine Städtchen Esmeraldas liegt an dem Fluß gleichen Namens auf einer ziemlich hohen Uferbank und hat höhere Berghänge im Rücken. Sonst besteht es aber ebenfalls nur einzig und allein aus ein paar Reihen auf Balken errichteter Holz- und Bambushütten, mit fast eben so vielen Läden und Trinkbuden wie Häusern, mit eben so faul, stumpf und nichtsnutzig aussehenden Bewohnern, mit eben so gelben, braunen und schwarzen Kindern, die halb und ganz nackt durch den Schlamm der Straßen waten. Leider ist die Flußmündung, selbst nicht für ein Walfischboot, in Zeit der Ebbe zu befahren, da sich eine Sand- und Schlammbarre quer davor gelegt hat und Aeste und Stämme dort angeschwemmter /15/ Bäume überall aus dem Wasser hervorragen. Der breite Fluß hat eine wirklich reißende Strömung, und weder Canoe noch Boot kann dagegen anrudern, sondern muß am Ufer hinauf mit Stangen geschoben werden.
Wir logirten beim Gouverneur, einem Señor Anjel Ubillus, der uns auf das Herzlichste aufnahm. Leider zeigten sich aber auch hier die Spuren der Revolution in einem krankhaft aussehenden Truppencorps von zehn oder elf Mann, das in einer Art Bambusscheune exercirte. Ein wirklicher Trommelschläger war dabei, und Lanzen und alte Musketen vertraten die Stelle sonstiger Waffen. General Franco in Guajaquil hatte nämlich erst kürzlich eine Aufforderung hierher gesandt, die Nationalgarde zu organisiren, mit der er in den nächsten Tagen nach Quito marschiren wollte, um sich diese Bergstadt zu unterwerfen. Allerdings gehörte Esmeraldas, dem Namen nach, für den Augenblick seiner Partei an; die Leute schienen seiner Militärgewalt aber schon herzlich müde, und man wollte am liebsten gar nichts mit der ganzen Revolution zu thun haben.
Esmeraldas ist seiner Cigarren wegen berühmt; jedenfalls sind es die besten, die ganz Südamerika erzeugt – was eben noch nicht viel sagen will –, Ambalema selbst nicht ausgenommen. Sie sind zwar leicht, rauchen sich aber sehr gut, und haben einen milden, angenehmen Geschmack, wie den großen Vortheil außerordentlicher Billigkeit. Während alles Andere in dem Neste ganz entsetzlich theuer ist und selbst die Landesproducte mit Silber ausgewogen werden müssen, bekommt man hier sechzehn bis zwanzig Stück für einen Real ecuadorisches Geld – ein französischer Franc gilt für zwei Realen – also vierzig Cigarren für einen Franc. Ich zweifle nicht, daß diese Cigarren einen vortrefflichen Exportartikel bilden könnten, hätten die Leute selber hier nur den geringsten Unternehmungsgeist. Sie lassen die Welt aber ruhig an sich kommen; so lange General Franco seine Drohung nicht wahr macht und in Esmeraldas einrückt, scheinen sie völlig zufrieden gestellt, wenn sie eben nur das haben, was sie zum unmittelbaren Leben brauchen – und Gott weiß es, das ist wenig genug.
/16/ Am ersten Abend in Esmeraldas überraschte mich ein eigener, glockenähnlicher Ton, der in ziemlich monotoner Weise aus einer der Bambushütten herüberdrang – die Marimba, wie die Erklärung lautete, und ich hatte natürlich nichts Eiligeres zu thun, als der Marimba meinen Besuch abzustatten. In einer dieser Hütten, und zwar in der Bel-Etage, fand ich den Spielenden im Kreise seiner Familie. Ein junger Bursch saß auf der Erde und machte mit den Händen Cigarren, während er mit dem rechten Fuß auf einer vor ihm liegenden Trommel den Tact zur Musik trat; die Frau wischte entweder ihr Halstuch in einer Calabasse rein oder die Calabasse aus – es ließ sich nicht erkennen, und der Mann, neben dem ein Kind in einer Diminutiv-Hängematte schaukelte, spielte die Marimba. Die Marimba ist allerdings weiter nichts als eine Holzharmonika, und zwar in der einfachsten Form gespielt; aber die Art, wie sie dieselben hier anfertigen, unterscheidet sich von der unsrigen, und ich will sie deshalb mit einigen Worten beschreiben. Sie hat gewöhnlich einundzwanzig Töne oder drei Octaven, ohne halbe Töne. Die Stücke sehr harten Holzes aber, auf denen wie bei einer Glasharmonika und mit ähnlichen Klöppeln gespielt wird, geben nicht durch ihre Größe und Stärke den Ton an, obgleich die höheren Töne durch kürzere Stücke unterstützt werden, sondern je dem Ton entsprechende Bambusrohre hängen offen darunter. Das zu dem tiefsten Ton gehörige ist etwa zwei Fuß lang, das für den höchsten Ton bestimmte etwa vier Zoll, und alle sind von ziemlich gleicher Stärke.
Die Musik selber ist entsetzlich monoton und bewegt sich nur in vier Tönen, zu denen sie einen Tanz ausführen, welcher der chilenischen Sambacueca außerordentlich ähnelt. Ob aber die Repräsentanten, von denen ich ihn tanzen sah, nicht dazu paßten, oder ob der chilenische Tanz wirklich so viel graziöser ist, ich weiß es nicht, mir gefiel diese ecuadorische Lustbarkeit eben nicht besonders, amüsirte mich aber vortrefflich.
Noch eine bessere Gelegenheit hatte ich, diesen Landestanz zu bewundern. Als wir nämlich von einem Besuch auf einer Cacaoplantage, am Esmeraldas aufwärts, zurückkehrten, mußten /17/ wir unterwegs landen und einen Arzt, der mit uns fahren wollte, einnehmen. Die Leute dort empfingen uns, wie das fast überall der Fall ist, sehr gastfrei, und da Jedermann Zeit hat und es Niemandem auch nur einfällt, sich in irgend etwas zu übereilen, so wurde nach Tisch eine Guitarre vorgenommen, und der Doctor spielte und sang. Danach verlangte er aber auch Tanz, und ein sehr hübsches junges Mädchen in tiefer Trauer weigerte sich zu tanzen. Sie war mit ihrer Mutter vor kurzer Zeit von Quito heruntergekommen, um den Vater am Esmeraldas abzuholen, hatte ihn aber todt gefunden, und ging in den nächsten Tagen wieder mit der Mutter nach Quito zurück. Die Trauer hatte übrigens mit dieser Weigerung nicht das Geringste zu schaffen, denn die Mutter nahm bald darauf für die Tochter die Aufforderung des wunderlichsten Individuums an, das mir je vorgekommen. Der Tänzer, der jetzt mit einem schon sehr lange gebrauchten Taschentuch die nöthigen Evolutionen ausführte, war ein kleiner, sehr scheuer Mensch, der etwa aussah wie ein heruntergekommener Schreiber, obgleich ich zweifle, daß er je eine Feder zwischen den Fingern gehabt. Er trug ein roth gestreiftes Hemd, blau gestreifte Hosen, einen Schuh und ein Paar Ohrringe, und schmachtete, während er nothgedrungen mit der Mutter tanzte, fortwährend nach der nicht die geringste Notiz von ihm nehmenden Tochter hinüber. Das rechte Bein mußte jedenfalls sein Lieblingsbein sein, denn nicht allein hatte er den Schuh daran, sondern auch wahrscheinlich seine sämmtlichen Zehennägel, denn an dem linken Fuß war keiner. Er schaufelte und wedelte entsetzlich herüber und hinüber, und die Cigarre genirte ihn dabei, und der rechte Schuh, und die Mutter, und wir und der Strick der Hängematte, der in einer Schleife über einem Balken mitten in die Stube hineinhing, so daß es aussah, als ob nach der Feierlichkeit gleich Jemand gehängt werden sollte.
Wir tranken auch später Chocolade, das Hauptgetränk hier im Vaterlande des Cacaobaumes, und alle Speisen waren ziemlich gut zubereitet. Wenn die Leute nur eine Ahnung in Südamerika davon hätten, daß es aus einer saubern /18/ Tasse viel besser schmeckt, als aus einer schmutzigen! Ich glaubte früher, die Pampas wären der einzige Platz, wo die Unreinlichkeit zu Hause sei, aber ich kannte damals Ecuador noch nicht, und habe hier schauerliche Beispiele erlebt.
Doch unsere Bahn lag weiter. Nachdem ich an dem nämlichen Abend noch einem Exercitium des ecuadorischen Militärs beigewohnt und Dinge gesehen hatte, die einem preußischen Unterofficier Krämpfe verursacht haben würden, mich aber vollständig kalt ließen, schifften wir uns am nächsten Morgen in einem Walfischboot ein und hielten in die See hinaus, um wieder nach Norden hinauf den Pailon zu erreichen. Der Wind ist nämlich nach dieser Richtung fast immer günstig, ebenso die Strömung, und nach drei Stunden etwa liefen wir am Cap Verde in den kleinen „grünen Fluß“ ein, um dort einen Piloten für die etwas verwickelte Mündung des Pailon zu bekommen. Das Alles geht aber freilich nicht so schnell, und obgleich wir mit einigem Treiben noch an dem nämlichen Abend hätten auslaufen können, hielt es der Doctor, der uns jetzt begleitete, für zweckdienlicher, hier zu übernachten und am nächsten Morgen um zwei Uhr mit ausgehender Fluth unsere Reise fortzusetzen. Es ließ sich nichts dagegen machen. Unsere Sachen wurden in ein leer stehendes Haus geschafft, wo wir auch unser Mittagsmahl einnahmen, und wir sollten uns dann zeitig niederlegen, um zur gehörigen Zeit wieder bei der Hand zu sein.
Unmassen von Pelikanen – eine braune Art – waren hier am Ufer und saßen, was ich bis dahin an Pelikanen noch nie beobachtet hatte, in den Wipfeln der höchsten Bäume. Sie schienen sich dort auch vollkommen heimisch zu fühlen, und die Aeste bogen sich unter ihrer Last. In der Nacht passirte nichts Merkwürdiges weiter, als daß mich eine Ratte in den Fuß biß, es kann auch vielleicht eine der großen Fledermäuse gewesen sein; ich hielt natürlich nicht still, und glaube, daß sie ebenso darüber erschrak, wie ich; sie belästigte mich wenigstens nicht weiter. Glücklicher Weise hatten wir auch hier keine Mosquitos.
Still und grau lag noch leise wogend die See, als wir, /19/ von einer leichten Brise geführt, hinauseilten. Nach und nach gewann sie aber Leben. Im fernen Osten dämmerte der Tag, und Schaaren von Fischen sprangen und schlugen um uns her. Zwischen ihnen hin suchten und fanden die Pelikane ihr reichliches Frühstück; im weiten Bogen kreisten sie umher, und wo sie einen solchen Schwarm aufkommen sahen, schossen sie mit fabelhafter Geschwindigkeit mitten dazwischen hinein, um ihre Beute herauszuholen. Auch Hai und Delphin waren thätig, um ihren Antheil zu bekommen. Es soll mir noch einmal Jemand sagen, daß er sich „so wohl befindet wie ein Fisch im Wasser“, wo die armen Dinger kaum eine Flosse zeigen durften, um auch schon von einem oder dem andern Feinde verschlungen zu werden. Selbst wir im Boot hatten einen Angelhaken mit dem Versprechen einer guten Mahlzeit für einen Fisch aushängen; sie hüteten sich aber, dem zu nahe zu kommen.
Dann und wann sahen wir auch einmal, gar nicht weit von dem Boot entfernt, den derben Wasserstrahl emporsteigen, den ein alter Walfisch in seinem Behagen ausblies – wußte er doch recht gut, daß ihm weder Pelikan noch Hai etwas anhaben konnten –, wenn ihn eben die Harpunen der Menschen zufrieden ließen. Nach und nach wurde aber die Brise stärker, und wir hatten bald nicht allein damit zu thun, auf unsere Fahrt Acht zu geben, sondern auch den höher und höher steigenden Wellen auszuweichen.
Wer schon je in einem guten Boote vor einer solchen Brise gesegelt ist, weiß, wie froh und stolz sich da die Brust hebt, weiß, wie wohl Einem zu Muthe ist, und wie es alle Nerven zu größter Thätigkeit anreizt und spannt. Vor uns lag dabei unser Ziel in einem dunkeln, niedern Waldstreifen, der sich zu Starbord weit hinausdehnte, und dort sollten wir in einer der von Sandbänken und Untiefen etwas gefährdeten Mündung des Pailon einlaufen, wozu wir einen Piloten oder Practico – wie er sich selber nannte – mitgenommen hatten. Wir waren unserer Sechs im Boot und dieses mit unserem Gepäck, Lebensmitteln, Wasser, wie einer Anzahl Cocosnüssen eben nicht leicht geladen, aber Wind und Seegang kamen von hinten und schoben tüchtig nach, und der Practico, der vorn /20/ auf dem Bug stand, versicherte uns, daß wir die schlimmste Einfahrt noch vor Dunkelwerden überstanden hätten. Das war auch wünschenswerth, denn der Wind blies immer heftiger, die Spritzwellen hatten uns wie unser Gepäck schon vollständig durchnäßt, und eine überschlagende See gab uns außerdem bald den Rest und warnte uns, den andrängenden Wogen etwas vorsichtiger auszuweichen. Außerdem hob die See unser Steuerruder aus und brach den obern Haspen, daß wir es nicht mehr gebrauchen konnten, und der Riemen (Ruder), den wir rasch dafür einsetzten, war zu kurz, um ihn mit Leichtigkeit regieren zu können. Aber es ging doch, und als des Lootsen ausgestreckter Arm nach rechts hinüber deutete, fiel der Bug rasch nach dieser Richtung ab und hielt dem Lande zu. Es war die höchste Zeit, denn die Sonne war schon unten, die Dunkelheit eingebrochen, so daß wir das noch etwa zwei Meilen entfernte Land nur in seinen dunkeln Umrissen undeutlich erkennen konnten. Dort lag auch die Mündung des Pailon, und unserem directen Einlaufen schien sich nichts mehr entgegen zu stellen.
Allerdings ließ der Wind jetzt etwas nach; es ist aber eine alte Regel, da, wo man seiner Tiefe nicht recht sicher ist, ein schwaches Kielboot nicht zu rasch vorwärts zu treiben, denn jagt man auf den Grund, so reißt man ihm leicht den Boden aus, und ist dann verloren. Noch etwa eine englische Meile vom Land entfernt, nahmen wir deshalb die Segel ein, um wenigstens vorher eine Barre zu passiren, die dort, nach des Piloten Versicherung, lag. Das konnte auch keine Schwierigkeiten haben, denn unser Boot ging kaum mehr als fünfzehn Zoll im Wasser, und wir hatten noch weiten Seeraum. Daß aber die Barre keine Täuschung war, zeigten uns links die Brandungswellen – sogenannte Breakers, die mit ihren glühenden Kämmen ganz häßlich herüberleuchteten. Kaum hatte ich übrigens den einen Riemen aufgenommen, in die Dolle gelegt und ausgeholt, als ich mit der Kante desselben Grund fühlte. Wir hatten kaum zwei Fuß Wasser. Auf meinen Ruf: seco! fühlte der Pilot vorsichtig mit der Stange über Bord und sagte mit der größten Gemüthsruhe: si – seco! – aber der eigentliche tiefe Kanal /21/ sollte dicht vor uns sein, und dem mußten wir deshalb entgegenarbeiten. Doch es half nichts – mas seco! klang der Ruf des Doctors, dem bei der Sache nicht wohl wurde, denn wir hielten immer mehr auf die Breakers zu – mas seco – immer trockener! – und wenige Minuten später saßen wir richtig fest in einer zähen Masse von Schlamm und Sand.
Es war jetzt völlig Nacht geworden, die Wogen leuchteten wunderbar schön, aber – wir durften unsere Zeit nicht mit Betrachtung der Scenerie versäumen. – Hier, dicht unter den Brandungswellen, konnten wir nicht liegen bleiben, denn die ausgehende Ebbe drohte uns in dem Falle mitten zwischen diese hinein zu setzen.
Der Practico stieg jetzt langsam über Bord, um vor allen Dingen das Boot zu umschreiten und den Stand der Dinge zu erfahren. Er kam aber rascher wieder herein, als er hinausgestiegen war, denn mit einem wilden Aufschrei warf er sich plötzlich über den Rand zurück, und in demselben Moment zuckten auch zwei, drei leuchtende Feuerstreifen dicht um uns hin, und einer von diesen streifte sogar das Boot. Es waren blos drei Haifische, die hier in dem seichten Wasser spazieren gingen – daß es aber drei waren, dem hatte der Practico sein Leben zu verdanken. Ein einzelner – und kaum drei Minuten später schoß ein solcher wieder dicht an uns vorüber – würde den armen Teufel unfehlbar gefaßt und unter Wasser gerissen haben; wo aber zwei oder mehrere dieser Ungethüme zusammen umherstreifen, gönnen sie einander den Bissen nicht und drängen einer den andern fort. So dicht hatte der eine Hai den Mann gestreift, daß er ihn im Vorbeischießen mit dem Schwanz an das Bein traf, und der Schlag mochte ihm auch wohl den Schreckensschrei ausgepreßt haben.
Mit Rudern und Stangen arbeiteten wir nun, so gut es gehen wollte, aus dem Schlamm zurück, und kamen auch richtig wieder in etwas tieferes Wasser, daß wir wenigstens flott blieben. Um die immer näher heranrückenden Brandungswellen mußten wir aber unsern Weg herumfühlen, und plötzlich saßen wir, indem wir versuchten, einen andern Kanal zu treffen, wieder fest. Des Practico Versicherung nach fiel die Ebbe noch zwei volle Stunden, und so hoch auf dem Trocknen durf/22/ten wir das schwergeladene Boot nicht sitzen lassen. Es hätte beschädigt werden können, und daß wir nicht wagen durften, das noch sehr ferne Land in dem Fall mit Waten und Schwimmen zu erreichen, davon hatte uns unser nächtlicher Besuch zur Genüge belehrt. Weder Ruder noch Stangen halfen aber, das Boot wieder flott zu bekommen; in der Zeit, die wir damit versäumten, sank das Wasser immer mehr, und es blieb uns jetzt nichts weiter übrig, als Alle über Bord zu springen und das gefährdete Boot in tieferes Wasser und von unserem Gewicht erleichtert zurückzuheben.
Das war nun allerdings leicht genug, aber mit der noch ganz frischen Erinnerung an die Haifische gerade kein angenehmes Gefühl, unsere Beine dem Element anzuvertrauen, in dem jene heimisch schienen. Die Zeit drängte aber; überdies waren wir diesmal unserer Sechs, und es blieb deshalb vollkommen unbestimmt, für welches Paar Beine sich der Hai zuerst entscheiden würde. Der Engländer sprang zuerst über Bord – wir Anderen zogen erst vorsichtig unsere Schuhe und Strümpfe aus – den Practico ausgenommen, dem etwas Derartiges wohl noch nie die Füße belästigt hatte – und nach kaum zehn Minuten fühlten wir das Boot wieder flott und in so tiefem Wasser, daß wir hier wenigstens die vollständige Ebbe abwarten konnten.
War es schon vorher ein eigenes Gefühl gewesen, mit dem Land im fernsten Hintergrund, im Stillen Ocean herumzuwaten, so erinnerte mich jetzt unsere Befestigung des Bootes an die etwas wunderlichen Ideen der Landbewohner, die nicht selten glauben, der Seemann binde Abends draußen in See sein Schiff an einen Pfahl und warte den Morgen ab. Genau dasselbe thaten wir hier. Wir trieben den Bootshaken so tief in den Schlamm hinein, wie wir ihn bekommen konnten, banden unser Boot daran fest, damit es nicht auf noch höhern Grund getrieben werde, und drückten uns dann ruhig in die verschiedenen Ecken so bequem oder unbequem weg, wie es eben gehen wollte. Es war jetzt acht Uhr; um neun Uhr etwa hatten wir niedrigstes Wasser, und um Elf oder halb Zwölf durften wir versuchen, ob wir aus diesem Chaos von Sand, Schlamm und Brandungswellen einen Ausweg fänden. Vor/23/her ließ sich nicht das Geringste mehr in der Sache thun, und wir konnten nur wenigstens froh sein, daß der Wind einigermaßen nachgelassen hatte.
Jede solche fatale Situation hat auch wieder ihre komische Seite, und wenn auch bis auf die Haut durchnäßt, verließ uns doch nicht unser Humor. Die Nacht war warm, und wir zählten eben all’ die Vortheile auf, die wir auf unserem unfreiwilligen Halteplatz hatten: keine Mosquitos, keine Sandflöhe, keinen Staub, keine Sonnenhitze, keine unreinlichen Betten und Flöhe – keinen Regen – Halt! der Himmel hatte sich langsam umzogen, und es fing leise an zu tropfen. Das schien noch gefehlt zu haben, um unseren Sachen den Rest zu geben. „Vielleicht klärt es sich wieder auf,“ meinte der Doctor, und in kaum einer Viertelstunde goß es, wie es nur eben in den Tropen gießen kann. Die Unterhaltung war dadurch gänzlich abgebrochen; Jeder schützte sich mit irgend einem Kleidungsstück, so gut das gehen wollte, gegen den Guß, und wenn wir denn einmal ein paar Stunden unter einer Dachtraufe verbringen sollten, ließ sich ja doch nichts dagegen machen. So verging Stunde nach Stunde bleiern genug, und nur mit einiger Befriedigung fühlte ich dann und wann den Grund, auf dem wir jetzt wirklich wieder bei zwölf Zoll Wasser festsaßen, und fand, daß die Fluth zu steigen anfing. – Fünfzehn Zoll – jetzt achtzehn – jetzt zwanzig – zwei Fuß, zwei ein halb – drei endlich – es war elf Uhr vorbei, und um halb Zwölf, mit drei ein viertel Fuß Wasser um uns her, lichteten wir den Anker – d. h. zogen den Bootshaken aus dem Grunde, und ruderten langsam der vermutheten Einfahrt entgegen.
Mit steigender Fluth war aber auch keine große Gefahr, daß wir wieder festkommen könnten, denn diese hätte uns in dem Fall doch bald wieder losgehoben. Bald erreichten wir auch das südliche Ufer der Einfahrt, an dem hin ein schmaler Kanal mit tiefem Wasser uns Sicherheit gewährte. Erst einmal hier, setzten wir unser Segel, denn der Wind war günstig, und glitten still und geräuschlos zwischen dem dunkeln Schatten der Mangrovebäume hin, die an beiden Ufern ihre Zweige und wunderlichen Wurzeln in die Fluth senkten.
/24/ Es ist für mich immer ein gar eigenthümliches, geheimnißvolles Gefühl gewesen, in einen fremden Wald einzutauchen. Eine fremde Stadt läßt mich außerordentlich kalt, ein fremder Wald übt einen unendlichen Zauber auf mich aus. Was uns umgab, war übrigens auch geeignet, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, denn hier, in der stillen Bai des Pailon, hörten wir zum ersten Mal das bis jetzt unmöglich Geglaubte: singende Fische. Von der Seite, um uns her, tief aus dem Grund heraus tönte überall ein wunderbarer, halb klagender, halb schwimmender Ton, fast wie ferner melodischer Orgel- und Glockenklang, der, wie uns unser Pilot versicherte, von einer kleinen Art von Fischen herrührte. Dazu das Rauschen der Bäume, das Quirlen der Fluth unter unserem Bug – es war ein eigenes, schwer zu beschreibendes Gefühl. Doch die Wirklichkeit einer Landung im Schlamm machte bald all’ diesem ein Ende. Vor uns tauchten die Umrisse der kleinen Stadt oder des Fischerdorfes St. Lorenzo auf; hier und da brannte in den leichten, auf Pfosten errichteten Hütten noch ein Feuer; dann kam die rasch munter gewordene Bevölkerung des kleinen Ortes schon völlig angezogen (im Hemde, wie sie immer gehen) an’s Ufer, und gleich darauf sahen wir uns von einem wahren Menschenschwarm umgeben, die auch Alle recht gut ausgeschlafen haben konnten, denn es war etwa um zwei Uhr Morgens.
2. Am Pailon.
Unser Empfang am Lande war charakteristisch und überraschte uns etwas, denn wir hatten gar nicht mehr daren gedacht, daß wir uns in einem vollständig revolutionirten Lande befanden, oder es wenigstens eben betreten wollten. /25/ Der Doctor, der zuerst ausstieg, wurde nämlich von einem gar grimmig dreinschauenden und mit einer Lanze bewaffneten Neger angeschrieen: zu welcher Partei er gehöre? Mit der freundlichsten Stimme von der Welt antwortete der Doctor aber, ohne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen: „Zu Ihrer, lieber Freund – ganz zu Ihrer,“ und es war überraschend, welche Genugthuung dieser Aufschluß gab. Den Soldaten schien damit ein Stein vom Herzen zu fallen, und als sie noch dazu hörten, daß „wir die Engländer seien, die den Pailon bevölkern wollten“, thaten sie Alles, was sie uns an den Augen absehen konnten. Der Doctor hatte übrigens vollkommen die Wahrheit gesagt, denn als ächter Ecuadorianer, oder überhaupt Südamerikaner, gehörte er wirklich zu jeder Partei, die gerade die herrschende war.
Die erste Nacht verbrachten wir auf den Boden des ersten besten Hauses ausgestreckt und in unsere eigenen Decken gehüllt, wobei mich nur wunderte, daß wir auch nicht von einem einzigen Mosquito belästigt wurden. Vorher aber brachte uns der Negersoldat, der uns mit eingelegter Lanze empfangen, eine Flasche mit Branntwein, als Willkommen, umarmte mich dabei – der Kerl hatte den ächten mephitischen Geruch der äthiopischen Race – und versicherte mir, daß er der beste und treueste Freund sei, den ich auf der Welt habe. Gott sei Dank, er log!
Den nächsten Tag goß es, was vom Himmel herunterwollte, und wir benutzten die Zeit, um unsere Briefe, die wir schon in Esmeraldas begonnen, an den unmöglichsten Schreibtischen zu vollenden. Am nächsten Tage fuhren meine Reisegefährten mit dem Boot nach Tomaco hinüber, um sie dort auf die Post zu geben, und ich selber blieb, da ich vor der Hand der Seefahrt müde war, allein in San-Lorenzo und zwischen seiner liebenswürdigen Bevölkerung.
Wie bequem wir es übrigens zum nächsten „Briefkasten“ hatten, erhellt daraus am besten, daß das Boot sieben Tage brauchte, um wieder zurückzukommen.
Ich war indessen in einem Haus einquartiert, das, allem Anschein nach, nur von einem Mann und seiner Frau nebst einem kleinen Kinde bewohnt wurde. Die Häuser sind hier /26/ alle sehr leicht auf Pfählen gebaut, und bei jedem Schritt zittert das ganze Gebäude. Die Frau hatte für uns gekocht, sehr primitiv, es ist wahr, aber im Ganzen nicht schlecht, und wir brauchten dabei weiter nichts zu beobachten, als dem Kochen eben nicht zuzusehen, wir hätten uns sonst leicht den Appetit verderben können. Die Kocherei, wie besonders der Platz, wo die Speisen zubereitet wurden, ist eben nicht zu beschreiben. Kaum dunkelte es aber an dem Abend, als sich das bis dahin ziemlich friedliche Stillleben änderte. Bis jetzt hatte mich nur der Mann genirt, der ein furchtbares Geschwür auf dem Rücken hatte, und sorgfältig das Hemd in die Höhe geschlagen trug, damit es Jeder sehen konnte. Jetzt legte sich die Frau hin, bekam Magenschmerzen und winselte kläglich; das Kind fing dazu an zu schreien, ein kleiner, nichtswürdig magerer Hund fing an zu bellen, und der Mann zankte. Dazu lag unter dem Haus ein halb zerbrochenes und umgedrehtes Canoe, über das eine alte blinde Kuh, die sich vor dem jetzt niederfluthenden Regen hierher geflüchtet hatte, ein- bis zweimal hinwegstürzte – kurz es war ein wahrer Heidenlärm, und trotzdem, daß ich mein Bestes versuchte, in der Hängematte einzuschlafen, fand ich es zuletzt unmöglich. Etwas mußte geschehen; ich warf deshalb dem Hund ein paar halbe Cocosnußschalen an den Kopf und trieb die Kuh in den Regen hinaus, dann gab ich der Frau etwa fünfzehn Tropfen Opium in Branntwein, nahm den Jungen in meine eigene Hängematte, und hatte nach etwa einer halben Stunde die Familie ruhig und zufrieden. Das war aber nur die erste Nacht, und das Schlimmste sollte noch kommen. Die Frau bekam am nächsten Tage wieder Schmerzen, und drei Frauen, jede mit einem kleinen Kinde, nahmen sich ihrer an. Der Abend kam, und mit ihm auch wieder das unausweichliche Winseln der Frau, mit Zanken des Mannes, Kuh, Hund, Regen und dem dazu zu addirenden Gebrüll von heute vier Kindern, die ich unmöglich alle bei mir unterbringen konnte.
Die Frau beruhigte ich wieder mit Opium und Branntwein, und ließ ihr dazu den Leib tüchtig mit Salz und Branntwein reiben; die Kinder mußte ich aber schreien lassen, und mochte etwa eine halbe Stunde in dem jetzt stockfinstern /27/ Raum halb verzweifelt in der Hängematte gelegen haben, als draußen die Leiter knarrte. Ich hob den Kopf, und drei glimmende Cigarren – weiter ließ sich natürlich nichts erkennen – tauchten auf und ließen sich, ohne einen weiteren Laut, auf drei an der Wand stehenden kleinen Kisten nieder. Kein Wort wurde gesprochen; ich hörte nur das Gebrüll der Kinder, in den Zwischenpausen das ewige Spucken der Besucher auf den Boden, und sah dazu das unheimliche Glühen der ordentlich leuchtenden Cigarrenstummel. Endlich aber mochte es der Visite doch mit dem Gebrüll zu arg werden. „Maldito!“ brummte der Eine zwischen den Zähnen durch, stand auf und verschwand gleich darauf in dem niederrauschenden Regen – ich konnte nur eben noch hören, daß er die schlüpfrige Leiter halb hinunterrutschte. Ihm folgte der Zweite und Dritte, und sie ließen uns in unserem Elend allein.
Die Frau war ruhig geworden. Als sie aber am nächsten Morgen wieder klagte und Medicin verlangte, schöpfte ich Verdacht, daß sie das Opium nur des Branntweins wegen nahm, und gab ihr Versuchs halber die gewöhnliche Dosis diesmal in einem Löffel Klauenfett. Ich kann dieses Mittel nicht genug empfehlen; es half fast augenblicklich, und die Schmerzen sind nicht wiedergekehrt.
Ich selber aber hatte dieses Leben satt bekommen, und beschloß dem ein Ende zu machen. Am nächsten Morgen schon ging ich aus, um mir ein Haus zu miethen oder zu kaufen, wo ich allein sein, allein und ungestört schlafen konnte; an Arbeiten war in dem Aufenthalt ja so nicht zu denken. Die Sache war auch viel leichter, als ich im Anfange gedacht, denn ich fand ein allerliebstes kleines Haus mit einem trefflichen Dach, sonst aber ohne Möbel und Wände, gerade wie ich es brauchte, dicht an der Bai stehend, das ich mit Grundstück und Allem, und Raum genug zu einem kleinen Garten, für den mäßigen Preis von fünfundzwanzig Dollars erwarb. Zwei Wände ließ ich mir von auseinander gebogenen Palmstämmen und Bambus herrichten, reinigte den Aufenthalt von einer Unmasse alter Calebassen, Bananenschalen, Steinen, Harpunenstangen und Angelruthen, befestigte meine Hänge/28/matte, brachte meine wenigen Habseligkeiten auf an die Pfosten gehangene Regale von Bambus, borgte einen kleinen Tisch, und war nun, mit der weiten Bai vor mir, mit keinen Kühen und Hunden unter, wie mit keinen schreienden Kindern und kranken Frauen in dem Hause, so behaglich eingerichtet, wie ein Mensch in diesem Lande, in dem es fast ununterbrochen regnet, nur irgend sein kann, und doch gehörte dieser Juni zu der sogenannten trockenen Jahreszeit, wie mag es erst in der nassen hier aussehen! Wunderbar verschieden ist aber dieser ganze nördliche Theil Südamerikas von den weiter südlich gelegenen Ländern, und schon ein Blick auf die Karte zeigt den fabelhaften Wasserreichthum dieses Landes. Während in Peru fast gar kein Regen fällt, und Tausende von Aeckern des besten Landes so lange dürr und unbenutzt liegen, bis sie von der sorgenden Hand des Menschen künstlich bewässert werden, ist hier oben im Norden bis Panama, ja selbst bis Costa Rica hinauf, die Luft feucht und der Boden so von Wasser getränkt, daß er die wasserreichsten Bergströme nach allen Seiten aussenden kann. Ein Amerikaner, den wir mit uns an Bord der Anna hatten, und der seit längerer Zeit diese Küsten des Handels wegen befährt, meinte allerdings auch, es sei ein Land, in dem wirklich nur ein Gummielasticumbaum existiren könne, der, wie der Pilz den natürlichen Regenschirm, so auch gleich von der allsorgenden Natur seinen Mackintosh bekommen habe; doch aber scheinen sich die Leute hier vollkommen wohl zu befinden, und in dem kleinen Neste St. Lorenzo am Pailon, das von Lagunen und Mangrovesümpfen umgeben liegt, befand sich, nach meiner erfolgreichen Cur mit dem Klauenfett, auch nicht ein einziger kranker Mensch mehr. Der Ort enthält allerdings nur etwa 140 Seelen – eine unglaubliche Menge von Kindern eingerechnet. Doch ehe ich in meiner Beschreibung der Einzelheiten fortfahre, gebe ich dem Leser lieber erst ein ungefähres Bild des ganzen Landes; er findet sich dann leichter zurecht.
Ecuador ist ein Theil der früheren großen Republik Columbien, die fast den ganzen Norden Südamerikas umfaßte und vor noch nicht so langen Jahren in die drei /29/ Republiken Neu-Granada, Venezuela und Ecuador aufgelöst wurde. Sieht man nun die Karte an, so fragt man sich allerdings: weshalb thaten das die Leute? weshalb behielten sie nicht ein großes und dadurch mächtiges Reich, und zerstückelten sich dafür in so viele Splitter? Lernt man aber das Land selber kennen, und reist man erst gar darin, so springt Einem auch die vollkommen gegründete Ursache einer solchen Zersplitterung in die Augen, denn in einem so großen, von mächtigen Gebirgen durchschnittenen Reiche, in dem fast gar keine Verbindungswege bestehen, ließ sich eine wirkliche Regierung der einzelnen Theile durch die schlaffen Eingeborenen nicht aufrecht erhalten. Selbst diese jetzt viel kleineren Districte können sich nicht friedlich einrichten, und nicht allein der Ehrgeiz oder die Geldgier Einzelner – wie damals in Ecuador – trägt die Schuld an den steten Revolutionen, sondern in vielen Fällen – wie vor Allem in Neu-Granada – die vollständige Unkenntniß der gerade Regierenden von einem großen Theil ihres Landes, dem sie Gesetze anpassen wollen, die sich wohl auf einen District, aber nie und nimmer auf alle anwenden lassen.
Ein anderer mißlicher Umstand ist der, daß noch von keiner dieser zahlreichen Republiken Südamerikas die Grenzen fest bestimmt sind. Ecuador macht davon keine Ausnahme, ja ist vielleicht in dieser Hinsicht einer der am schlimmsten verwickelten Staaten. Nicht allein, daß im Westen die Grenze mit Brasilien vollständig imaginär ist, und dieses Land, während Ecuador die Grenzlinie bis zu 72.° westl. Länge von Greenwich zieht, das ganze Territorium, das der Amazonenstrom östlich von den Cordilleren bewässert, für sich haben möchte, verlangt Peru im Süden beinahe zwei Drittel des ganzen Reichs, und streitet sich Ecuador im Norden noch mit Neu-Granada um die Inseln in der Mündung des dortigen Grenzflusses Mira – hat also vollständigen und genügenden Stoff für interessante Aufregung noch auf Jahrzehnte.
Doch von der jetzigen Revolution später. Als sich die große Republik Columbien in diese verschiedenen kleineren auflöste, wurde die Staatsschuld derselben an England auf die /30/ verschiedenen Länder vertheilt, und Ecuador ist bis jetzt der einzige Staat, welcher Miene gemacht hat, seine Schuld abzutragen.3 Es bot England für die 550,00 Pfd. St. Land an, und suchte dadurch in gar nicht unpraktischer Weise diese Last los zu werden, während es zugleich seine eigene Bevölkerung hob und das eigene Land werthvoll machte. In England wurden darauf Bonds für dieses Land ausgegeben, und eine Gesellschaft kaufte einen großen Theil derselben an. Deren Plan ist nun, außer verschiedenen Landstrecken im Innern und an der südlicher gelegenen Küste, vor allen Dingen den sehr günstig gelegenen nördlichsten Hafen Ecuadors, der in dem cedirten Land inbegriffen ist, in Angriff zu nehmen, und dessen Ufer zu bevölkern, dessen Küsten zu bebauen, wie sich die zahllosen Hülfsquellen des Landes dienstbar zu machen. Die Gesellschaft selber besteht aus Engländern und Deutschen. Besonders sind verschiedene Deutsche im Directorium, und ihr größter Wunsch ist natürlich, die deutsche Auswanderung nach diesem Punkt Amerikas vorzugsweise hinzulenken. Ob sie das erreichen werden, muß die Zeit lehren; einen günstigeren Boden für die Spekulation hat es aber wohl noch nirgends gegeben, und wenn die Sache mit tüchtigen Kräften und mit ein klein wenig gesundem Menschenverstand angegriffen wird, kann man ihr nur eine günstige Zukunft versprechen.
Ecuador selbst liegt recht eigentlich im Herzen der tropischen Zone, denn der Aequator durchschneidet es. Der Pailon, der ziemlich die nördliche Grenze bildet, liegt etwa unter 1° 30‘ nördl. Breite, während die jetzige Südgrenze bis etwa 4° 30’ südl. Breite hinab – oder vielmehr, wie man hier sagt, hinauf geht. Wind und Strömung sind nämlich im Stillen Ocean, der die Westufer von Ecuador bespült, entschieden von Süd nach Nord, wie auch der Passat südlich von der Linie weht, wenigstens von Südost nach Nordwest. Wohin also die Strömung und der Wind gehen, heißt hinab, woher sie kommen, hinauf.
Von Peru an hat nun Südamerika bis nach Cap Horn „hinauf“ fast gar keine Flüsse, oder doch nur kleine Berg/31/ströme, die von dem schmelzenden Schnee der Cordilleren anschwellen und im Spätsommer zu seichten Bächen eintrocknen. Hier dagegen, obgleich das Land zwischen den Cordilleren und dem Meere nur wenig breiter ist als weiter im Süden, erzeugt das feuchte Land, mit den dem Grund entsteigenden Dünsten, ganz ansehnliche Ströme, die breit und einladend in das Meer münden. Schiffbar sind sie freilich deshalb immer nicht, oder doch nur auf kurze Strecken. Auch der Pailon ist nur die breite, von verschiedenen Inseln erfüllte Bai jener Ausläufer; wenn aber auch die Mangrove den untern Theil desselben umgiebt, liegt im Osten desselben das reichste Land, und hier besonders ist die Heimath des Cacaobaums, der bis zu zwanzig und dreißig Fuß Höhe wächst und zahllose Früchte trägt.
Die Bewohner dieser Küste sind eine tolle Mischlingsrace von Spaniern, Indianern und Negern, und eine bestimmte Abstammung ist wirklich bei den wenigsten herauszufinden, die natürlich ausgenommen, wo sich die Indianer noch unvermischt erhalten haben. Einen solchen Stamm, die Cajapas, fand ich an der Tolamündung, prachtvoll gebaute, herrliche Menschen, mit dem langen, straffen Haar der Race. Eine höchst eigenthümliche Thatsache ist es aber, daß sie, allerdings von brauner Haut, doch eine entschieden lichtere Farbe haben als ihre Brüder, sowohl im hohen Norden, als im tiefen Süden Amerikas. Die Sprache ist natürlich wie in ganz Südamerika, mit Ausnahme Brasiliens, spanisch, und die Lebensweise so einfach, wie sie nur möglicher Weise sein kann. Brod kennt man hier gar nicht, ausgenommen ein weniges dann und wann, das gelegentlich von Esmeraldas oder Tomaco herüberkommt. Die Banane (Pisang, Platane) vertritt hier, wie auf den Südsee-Inseln die Brodfrucht, Brodesstelle und wird auf die verschiedenste Weise zubereitet, am meisten aber nicht völlig reif und gebacken genossen. Dazu halten sie sich etwas Rindvieh und Schweine, von denen sie gelegentlich ein Stück schlachten, und leben außerdem von Fischen, von denen die Bai eine Menge der besten Arten liefert. Dann und wann gehen sie auch wohl mit ihrer Lanze oder einer alten Muskete und ein paar Hunden auf die Jagd; im Ganzen /32/ scheint ihnen aber diese Art des Broderwerbs zu beschwerlich. Noch thatsächlicher tritt diese Faulheit in dem kleinen Orte selbst zu Tage; denn in einem Lande, wo man die Saat wirklich nur in den Boden zu stecken braucht, um den reichsten Ertrag zu erzielen, hat kein einziges der Häuser einen kleinen Garten, und nur eine einzige Cocospalme steht in dem ganzen Orte, wo es weiter nichts bedurft hätte, als die Nuß einen Fuß tief in die Erde zu graben.
Es ist ein altes Sprüchwort, daß ein Mensch nicht vergebens auf der Welt gewesen sei, wenn er einen einzigen Baum gepflanzt. Ich habe in St. Lorenzo, ehe ich den Platz wieder verließ, doch wenigstens vier Cocospalmen gepflanzt.
Quito ist die eigentliche Hauptstadt des Landes, und dort bestand damals ein sogenanntes gobierno provisorio aus drei Präsidenten oder Directoren. Mit diesen war der gutgesinnte Theil der Bevölkerung, denn diese Leute wollten keinen „Soldatenstaat“, sondern nur eine Civilregierung und Hebung des Ackerbaus und der Gewerbe. General Flores war der Generalfeldmarschall dieser Partei, während General Franco in Guajaquil, von dem peruanischen Präsidenten Castilla dabei unterstützt, dem Staat Quito den Krieg erklärt hatte und offen dabei heraussagte, daß er weder Wissenschaft noch irgend etwas Anderes der Art brauche, sondern einen Soldatenstaat haben wolle. Guajaquil selber schien diesen Ehrgeiz keineswegs zu theilen. Franco hatte aber eine Menge Gesindel zusammengelesen, das sich in der ruhigen Republik zu langweilen schien, und erklärte sehr gemüthlich: er wolle dem Lande den Frieden bringen und die Bewohner glücklich machen, indem er die eine Hälfte derselben durch die andere todtschlagen ließ. So Haß und Unfrieden, Zwietracht und Bürgerkrieg überall, und wie noth that doch gerade diesem Lande der Frieden, das, selbst mit den unermeßlichen Hülfsquellen und Schätzen seiner Landstriche und Gebirge, in den letzten hundert Jahren nicht die geringsten Fortschritte gemacht, ja, eher, wenn das möglich wäre, zurückgegangen ist. So liegt die alte Stadt Esmeraldas, von dem fruchtbarsten Lande, von Gebirgen umgeben, die reiche Schätze bergen, noch mit ihren /33/ zwanzig elenden Bambushütten, wie sie vor zweihundert Jahren erbaut wurde, und was könnte aus dem Lande geworden sein, wenn sich die anglo-sächsische Race desselben bemächtigt hätte – was wird daraus werden, wenn selbst jetzt noch eine thätige, betriebsame, unternehmende Bevölkerung einrückt und die Schätze ausbeutet, die hier überall zu Tage liegen. Wunderbare Veränderungen werden dann mit diesem Lande vorgehen, und die jetzigen Bewohner desselben wohl ebenso staunen, als die eben so lässigen californischen Spanier staunten, als Schiff nach Schiff die fremden Einwanderer an ihre Küste warf.
Ist aber erst einmal eine tüchtige europäische Bevölkerung hier ansässig, dann hören auch von selber diese lächerlichen und doch für den Einzelnen so traurigen Revolutionen auf, die jetzt alle Augenblicke die Bevölkerung entzweien, und nicht allein den Arbeiter seiner Thätigkeit entziehen, sondern auch stets mehr oder weniger Menschenleben kosten. Für den dabei uninteressirten Zuschauer hat es allerdings etwas Komisches, die verschiedenen zusammengelaufenen Armeecorps, die gewöhnlich aus sieben bis zwanzig Mann bestehen, zu beobachten; aber die Leute tragen Gewehre, die nicht allein manchmal losgehen, sondern auch zu Zeiten platzen; und was haben die armen, unglücklichen Menschen gethan, die, mit nicht dem geringsten Ehrgeiz für sich selber, einer „Idee“ zufolge (wenn wir eine Sache von Thalern, Groschen und Pfennigen so nennen wollen) derartigen Gefahren preisgegeben werden.
Doch jetzt nach St. Lorenzo zurück, wo wir noch eine Menge angenehmer Bekanntschaften zu machen haben – und was für ein wunderliches Völkchen lebte dort! – Ueberhaupt, wie rasch wechseln die Schicksale im Leben und werfen uns arme Menschenkinder toll und rücksichtslos aus einer Ecke in die andere. Heute noch in dem freundlichen Thüringen, auf der wundervollen Rosenau, von allen Bequemlichkeiten, ja manchem Luxus der Civilisation umgeben, und sieben Wochen später als Hausbesitzer in St. Lorenzo, einem der entferntesten Winkel des Erdballs, den auf der Karte zu finden der Leser sich nur unnütze Mühe geben würde. Hausbesitzer in /34/ St. Lorenzo; vor meiner Thür – eine Thür habe ich eigentlich gar nicht – steigt und fällt die Fluth, ich koche mir meinen eigenen Kaffee, fange meine eigenen Fische und thue genau so, als ob ich auf der ganzen Welt keinen Menschen weiter hätte, der mich etwas anginge.
St. Lorenzo liegt am Pailon etwa 1° 30‘ nördl. Breite und ungefähr 87° westl. Länge von Greenwich (denn ich bin einmal nicht mehr gesonnen, mich dem alten deutschen und faulen Schlendrian zu fügen und nach Ferro zu rechnen, das nur noch die deutschen Landkartenkünstler kennen). So weit die Länge und Breite. Sonst liegt St. Lorenzo an einer reizenden Bai, in welche eine Menge aus den Cordilleren kommende kleine und klare Bergströme münden, und es hat den reichsten und fruchtbarsten Boden um sich, den man sich auf der Welt nur denken kann. Allerdings liegt es ebenfalls an der Grenze der Manglaren- oder Mangrovesümpfe, die seine es vom Meere trennenden Inseln füllen. Diese Manglarensümpfe scheinen aber keine ungesunden Dünste auszuathmen, denn sie werden zweimal täglich von der See bedeckt und rein abgewaschen, und können deshalb keine schädlichen Miasmen entwickeln. Dicht dahinter liegt aber auch höheres Land, mit einer Vegetation bedeckt, durch die man weder hinkriechen, noch die man beschreiben kann. Hier mögen die Leute herkommen, die Urwald zu sehen wünschen, oder gar eine Sehnsucht haben, im Urwald spazieren zu gehen. Ich bin doch wahrhaftig schon in mancher Wildniß umhergewandert, aber man kann die Romantik auch übertreiben, denn so etwas von Wurzeln, Stämmen, Dornen, Schlingpflanzen, Sumpflöchern und Lagunen ist mir noch nicht leicht vorgekommen.
St. Lorenzo hat etwa achtzehn Häuser, auf einem Platz zerstreut, der mit mäßiger Einteilung recht gut zweihundert tragen könnte. Dabei ist der Zwischenraum aber keineswegs mit Gärten, sondern nur mit Kühen, Hunden, Schweinen, Hühnern, und halb oder ganz nackten Kindern ausgefüllt, die sämmtlich rücksichtslos durch den nassen Boden herüber- und hinüberwaten. Einzelne Fruchtbäume stehen allerdings hier, besonders viele mit delicaten Früchten bedeckte Orangen, sonst ist aber nur eine einzige tragende Cocospalme auf dem gan/35/zen Platze zu finden, weil die Leute zu lästerlich faul sind, selbst nur eine Nuß in die Erde zu graben. Die Häuser sind so einfach wie dem Klima angemessen gebaut, und stehen alle auf sechs bis acht oder zwölf, etwa zehn Fuß hohen Pfosten, und Bambusleitern, oder noch viel häufiger nur eingekerbte Stämme, die an dem schwanken Fußboden lehnen, dienen Menschen, Kindern und Hunden zu Treppen, um die Beletage zu erreichen. Es ist besonders erstaunlich, welche Geschicklichkeit die Hunde entwickeln, um an diesem Beförderungsmittel nicht allein hinauf, sondern auch herunter zu laufen. Ich würde sagen, sie klettern wie die Katzen, wenn eine einzige Katze im ganzen Orte wäre, um einen solchen Vergleich zu gestatten.





























