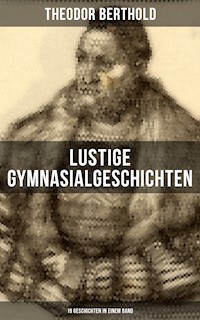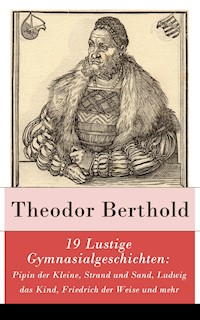
19 Lustige Gymnasialgeschichten: Pipin der Kleine, Strand und Sand, Ludwig das Kind, Friedrich der Weise und mehr E-Book
Theodor Berthold
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "19 Lustige Gymnasialgeschichten: Pipin der Kleine, Strand und Sand, Ludwig das Kind, Friedrich der Weise und mehr" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Theodor Berthold (Pseudonyme: Theodor Bleibtreu, Dorus von Bockelt, Theodor Carus, (1841 - 1909) war ein deutscher Schriftsteller. Theodor Bertholds schriftstellerisches Werk, das zu einem großen Teil in Zeitschriften erschien, umfasst Erzählungen, feuilletonistische Skizzen und Erinnerungen des Verfassers. Den größten Erfolg erzielte er mit seinen Lustigen Gymnasial-Geschichten, die bis in die 1920er Jahre in zahlreichen Auflagen nachgedruckt wurden. Inhalt: Pipin der Kleine Schlaflos Der Hauptgewinn Ein Altertümchen Auf Schneeschuhen Strand und Sand Ludwig das Kind Der Karneval von Dudenrode Des armen Friedel Nikolaustag Meine eigene Stube Schweflers Namenstag Hochmut kommt vorm Fall Corvus Corax Friedrich der Weise Der Schein trügt Albrecht der Bär Harald der Lange Junge Düppelstürmer Erinnerungen eines Tierfreundes
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
19 Lustige Gymnasialgeschichten: Pipin der Kleine, Strand und Sand, Ludwig das Kind, Friedrich der Weise und mehr
Inhaltsverzeichnis
Lustige Gymnasialgeschichten
Pipin der Kleine
Da wird wohl viel gesagt und gesungen von der schönen Jugendzeit. Wir wollen es gelten lassen, daß sie bald einem Frühling mit Blumen, Schmetterlingen und wolkenlosem Himmel, bald einem Morgen mit Sonnenglanz und Nachtigallensang verglichen wird. Aber ein altes Volkslied sagt auch: »Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, er fiel auf die zarten Blaublümelein.« Diese Worte erinnern mich immer an die mancherlei kleinen Leiden und Schmerzen, denen auch die Jugendzeit ausgesetzt ist – die sich wie ein Reif auf ihre schönsten Blüten legen. Namentlich der Knabe weiß von diesen Leiden und Schmerzen zu erzählen, wenn er das Reifenspiel und den Papierdrachen mit der lateinischen und griechischen Grammatik, den Baukasten mit der Algebra und Geometrie, die Bleisoldaten mit den punischen und persischen Kriegen vertauscht hat, kurz, wenn er auf den Bänken des Gymnasiums sitzt und in die klassische Bildung eingeführt wird. Der Weg zu dieser klassischen Bildung ist für manchen mit Dornen bestreut, mit spitzen, stechenden Dornen.
Da sitzt z. B. in der zweiten Bank der Untertertia – es ist eine alte, furchtbar zerschnittene und tintenbekleckste Bank, an der schon Generationen von Schülern »geschwitzt« haben – der kleine dicke Gottfried Hellermann; in Latein und Griechisch ist er ganz fix, auch einen guten deutschen Aufsatz schreibt er; aber Mathematik, Mathematik, die ist seine schwache Seite, seine verwundbare Achillesferse! Weder die Kongruenz der Dreiecke noch die Buchstabenrechnung will ihm ihn den Kopf. Wird er an die Tafel gerufen, um eine mathematische Aufgabe zu lösen, so merkt man ihm die Verlegenheit und innere Verwirrung schon am Gesichte an. Er räuspert sich, er dreht die Kreide zwischen den Fingern, er macht ein paar Striche, schreibt ein paar a und b und c, stottert, kann nicht weiter und »brennt kolossal ab«, wie’s in der Schulsprache heißt. Mit flammendrotem Kopfe und gesenkten Augen kehrt er in seine alte Bank zurück – und im Taschenbüchlein des strengen und ernsten Mathematiklehrers steht neben dem Namen Gottfried Hellermann eine schlechte Note. Gottfried ist unglücklich darüber, daß ihm die Mathematik nicht in den Kopf will. Tränen, helle Tränen hat er schon über ein Dreieck oder eine Gleichung vergossen. Die Mathematik oder Mathese, wie er grollend sagt, verdirbt ihm mit ihrem »ungenügend« jedesmal die ganze Zensur. Er sieht’s voraus, daß er nie durchs Gymnasium kommen wird, daß nie die bunte Mütze des Abiturienten sein Haupt zieren soll. Wenn seine Eltern es nur erlaubten, er ginge nach Afrika, um Strauße zu jagen, oder nach Amerika, um als Trapper durch die Urwälder zu streifen.
»Nach Westen, o, nach Westen hin Beflügle dich, mein Kiel!«
so seufzt er in seinen melancholischen Stunden nicht selten mit Luise Brachmanns Kolumbus.
Da sitzt ferner in der dritten Bank der noble Hans von Schralenburg. Die Mathematik erklärt er für ein Kinderspiel, und er ist wirklich der beste Mathematiker der Klasse. Im Nu hat er bei Kompositionen oder Klassenarbeiten die schwerste Aufgabe gelöst, und stets ist er der erste, der seinen Bogen an den Herrn Professor abgibt. Manche schöne freie Stunde hat er dadurch schon gewonnen. An der Tafel fährt er mit dem Kreidestückchen nur so spielend hin und her, um die kongruenten Dreiecke auseinanderzuwerfen, »daß es klappert«, und seine Zensur zeigt in der Mathematik immer das Prädikat »vorzüglich«. Aber auch Hans hat seine Dornen auf dem Pfade der klassischen Bildung, seinen Reif auf der Jugendblüte. Er steht mit der Rechtschreibung auf dem gespanntesten Fuße! Jeder seiner deutschen Aufsätze wimmelt von Fehlern, so daß der Herr Ordinarius den Kopf schüttelt und von seinem Katheder herunter seufzt: »Hans, Hans, daß dich färbt die rote Tinte!« Oft sind die Fehler recht komisch und erregen das mitleidlose Gelächter der Klasse. So z. B. bei dem Aufsatze: »Rede Hannibals an seine Soldaten vor dem Uebergange über die Alpen.« Hans von Schralenburg ließ seinen Hannibal fortwährend von dem Ruhme sprechen, den sich die Krieger jenseits der Alpen holen könnten, aber hartnäckig hatte der arme Hans »Rum« statt »Ruhm« geschrieben. Bei unserer heutigen Rechtschreibung wäre das nun freilich nicht so schlimm, aber damals war es ein arger »Bock«, der die drolligsten Sätze ergab. »Soldaten, schaut auf den herrlichen Rum, der euch jenseits dieser eisigen Berge winkt! Erwärmt euch an diesem Rum, begeistert euch an diesem Rum, und ihr werdet siegreich Eis und Schnee, Felsenwände und Abgründe überwinden! In der Geschichte unserer Vater ist auf jeder Seite das Wort Rum geschrieben,« u. s. w. Der Herr Ordinarins las diese Sätze vor, die Schule lachte, und Hans, der stolze Hans von Schralenburg stand da in seiner braunen Sammetjoppe, mit bleichem Gesichte, mit zusammengebissenen Lippen und gesenkten Augen, und ein Büschel seiner langen schwarzen Haare hing ihm über die marmorbleiche Stirn. Was für Gedanken mochten durch den Kopf des armen Jungen ziehen? Hans war zu stolz, um später etwas davon zu sagen, aber ich glaube, er hat in jenen Augenblicken, wo er zum Gelächter der Klasse diente, schwer gelitten und sich einen Krieg und Schlachtentod herbeigewünscht, denn er wollte Offizier werden.
Was mich, den Erzähler dieser wahrhaftigen Erinnerungen aus der Gymnasialzeit, betrifft, so hatte auch ich in meines Lebens Lenze ein schweres Leid zu tragen. In den verschiedenen Zweigen der Wissenschaft freilich »konnte ich wohl was«, wie’s in der Schulsprache heißt. Da lag’s also nicht. Die Ursache meines Leidens steckte vielmehr in meinem Körper: ich war klein, allzu klein für meine vierzehn Jahre:
Ein Männchen, das dem Zwerggeschlechte Kaum um drei Zoll entwachsen war –
wie’s in einem Gedichte unseres Lesebuches hieß, und wegen dieses kleinen Formats hatte ich manches Ungemach in der Klasse zu erdulden. Manchen Seufzer hab’ ich ausgestoßen, manche Träne ist mir ins Auge getreten, und tausendmal hab’ ich zum lieben Gott gebetet: »Ach, du guter Gott, laß mich doch wachsen! Setz meinem Körper doch nur einige Spannen zu!«
Mein Vater war als preußischer Beamter aus Ostpreußen nach der Hauptstadt Westfalens versetzt worden. Auf dem Gymnasium zu Rastenburg hatte es mehr so kleiner Knirpse gegeben, als ich war, denn der ostpreußische Menschenschlag ist im allgemeinen weniger stattlich. Das Volk der Westfalen aber ist, wie schon der alte Kosmograph Münsterus sagt: »gesund und stark von Leib«. Als ich nun, kraft meines guten Zeugnisses, in die Obertertia des Gymnasiums zu Münster aufgenommen wurde, staunte ich über die großen Burschen, die dort auf den Bänken hockten und kaum ihre langen Beine unter den Bücherkästchen unterbringen konnten. Aber diese langen westfälischen Recken staunten ihrerseits auch, als sie mich in ihrer Obertertia gewahrten. »Zu Straßburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an!« singt der Schweizerbube; und: »Zu Münster auf der Schul, da ging mein Jammer an!« darf ich wohl singen. Ich hatte mich mit meinem Bücherpacke bescheiden in die letzte Bank der Obertertia gesetzt. Die eintretenden Mitschüler blickten verwundert zu mir herüber, stießen sich mit den Ellenbogen an, flüsterten und lachten untereinander. Endlich trat ein großer und vierschrötiger Schlacks auf mich zu und sagte mit einer tiefen Baßstimme: »Kleiner, du hast dich verlaufen, du gehörst in die Sexta,«
»Ich weiß, daß ich hierher gehöre,« antwortete ich; »glücklicherweise hab’ ich ein Paar Augen im Kopf, um auf der Tür des Klassenzimmers die Aufschrift ›Obertertia‹ lesen zu können – und ich gehöre laut Bestimmung des Herrn Direktors in die Obertertia.«
»Alle Wetter!« sagte der Große, den seine Mitschüler »Büffel« nannten; »hat der Knirps ein Mundwerk! Er scheint sich die homerischen Helden mit ihren selbstbewußten Reden zum Muster genommen zu haben. Aber, Kleiner, wenn du nun einmal in die Obertertia zu gehören glaubst, so rat ich dir, künftig deine Kinderwärterin und die Milchflasche mitzunehmen, denn die lateinischen und griechischen Stunden könnten dir doch arg lang werden.«
Die anderen Mitschüler lachten, und ich fühlte die flammende Röte der Scham auf meinen Wangen brennen.
»Es ist nicht recht,« stammelte ich, »daß ihr mich wegen meiner Körperverhältnisse, an denen ich keine Schuld trage, verspottet!«
»Spricht die kleine Kröte von Verspotten!« witzelte der Große; »und es ist doch nur herzliches Mitgefühl, das wir normale Menschen mit dem Liliputaner haben. Komm, Männchen, setz dich auf dieses dicke Lexikon von Scheller, damit du dich wenigstens etwas ›gehoben‹ in der Mitte der Obertertianer fühlst!«
Ich mochte mich sträuben, wie ich wollte, ein altes, dickes, braunledernes und von Mäusen furchtbar zerfressenes Lexikon wurde mir untergeschoben.
»Aber nun baumeln die Beinchen in der Luft,« bemerkte mein Peiniger bedauerlich; »Jungens, ist da nicht noch ein Gegenstand, den wir dem Däumling als Schemel unter die Füßchen stellen könnten?«
Ein willfähriger Mitschüler mit häßlichen roten Haaren und verschmitzten grünen Augen schleppte einen leeren Holzkasten herbei, und dieser wurde mir mit lautem Gelächter und Hallo unter die Füße geschoben. Ein dritter Mitschüler mit kurzen, flachsweißen Haaren und einer auffallend langen Nase hatte währenddessen von seinem rotbaumwollenen Taschentuche ein Püppchen gedreht, das er mir in den Arm legte, und ein vierter sang: »Heira poppeira, schlags Küchelchen tot!« Bittere Tränen standen mir in den Augen, und ich wünschte, tief in den Kartoffelkeller des Pedellen zu versinken. Da trat plötzlich der Lehrer ein, und:
Wie vom Blitz zerstoben War all der Spötter Schwarm.
Sie verfügten sich hurtig auf ihre Plätze, und nachdem der Herr Professor seinen Hut an den Pflock gehängt und den Katheder bestiegen hatte, begann der Unterricht.
Es war Geschichtsstunde, ich weiß es noch wie heute. Professor Weber sprach in höchst anziehender Weise über das Zeitalter der Karolinger; er erzählte, wie die austrasischen Herzöge, die immer den Fähigsten und Streitbarsten zum Haupt der Familie erklärten, sich durch ihre Kriegstaten das Vertrauen der Nation, durch ihren Eifer um die Verbreitung des Christentums sich die Gunst der Geistlichkeit erworben hätten; er sprach von Karl Martell und seinen Söhnen, die sich nach des Vaters Tod in die Großhofmeisterwürde geteilt u. s. w., und als der Professor eine halbe Stunde vorgetragen hatte, putzte er seine Brille mit einem gelbseidenen Taschentuche und rief einen der Schüler auf, den Vortrag zu wiederholen. Der Aufgerufene war kein anderer als »Büffel«, jener große vierschrötige Schlacks, der mich vor Beginn der Stunde so bitter verhöhnt hatte. Aber wenn er auch »gesund und stark von Leib« war (wie der alte Münsterus sagt), so bewies doch sein Vortrag schon nach wenigen Minuten, daß sein ingenium keineswegs für die Wissenschaften geeignet war (ganz im Gegensätze zu den Worten Janssons, der das ingenium der Westfalen als tauglich ad literas, disciplinam,virtutem, doctrinam et alias honestas artes rühmt). »Büffel« sprach in abgebrochenen Sätzen, stotterte, räusperte sich, warf Namen und Geschichten durcheinander und gebärdete sich, als er die Söhne Karl Martells aufführen sollte, als ob ihm die Namen auf der Zunge lägen und nur augenblicklich nicht darüber wollten.
Der Herr Professor ließ, ohne mit einem Worte nachzuhelfen, den unglücklichen »Büffel« sich einige Minuten fruchtlos abzappeln, dann sagte er kurz und streng: »Setz dich, Anton Haverkamp, du hast mal wieder nicht acht gegeben!« Und er bohrte dem Niedergeschmetterten eine schlechte Note ins Notizbuch.
Dann richtete Professor Weber seine bebrillten Augen auf mich und sagte: »Du Neuer da hinten, willst du mal in dem Vortrage fortfahren?«
Ich stand auf und sah, wie ein feines Lächeln über die ernsten Züge des Geschichtslehrers glitt: mein kleines Figürchen mochte ihm komisch erscheinen.
Doch ließ ich mich nicht stören, und da ich aufmerksam acht gegeben hatte, auch die Geschichte der Karolinger schon kannte, so trug ich in einer Weise vor, die mir wiederholt ein zustimmendes Kopfnicken des Herrn Professors einbrachte. Als ich, durch dieses stumme Lob angespornt, nun klar und fließend erzählte, daß von den beiden Söhnen Karl Martells, die sich nach des Vaters Tod in die Großhofmeisterwürde geteilt, der älteste, Karlmann, sich in das Kloster Monte Casino zurückgezogen habe, der jüngere, Pipin der Kleine, hingegen von einer nach Soissons entbotenen Reichsversammlung weltlicher und geistlicher Großen als König anerkannt worden sei: da ging, bei Nennung des Namens Pipin der Kleine, ein allgemeines Lachen durch die Klasse und aller Gesichter wandten sich nach mir um. Selbst der Herr Professor suchte vergebens ein Schmunzeln hinter seinem gelbseidenen Taschentuche zu verbergen. In diesem Momente wußte ich, daß ich fortan, für immer, auf dem Gymnasium den Spitznamen »Pipin der Kleine« führen würde. Ich hatte vor Beginn der Stunde schon gehört, daß sich unter meinen Mitschülern ein »Hektor«, ein »Plato«, ein »Bruder Tuck«, ein »Schiller«, ein »Schwarzer Kasper«, ein »Puttke«, ein »Hannibal«, ein »Pomadetopf«, eine »Maus«, ja selbst eine »Tante« befand; jetzt war die Zahl der Spitznamen um einen »Pipin der Kleine« vermehrt! Vorläufig hatte ich die Genugtuung, daß der Herr Professor meinen Vortrag, nachdem ich denselben beendigt, als »sehr gut« bezeichnete, daß er mir eine Primanote ins Notizbuch schrieb, und daß er mich endlich dem »abgebrannten« großen Haverkamp als Muster vorstellte. Das war mir eine süße Genugtuung für die vorhin erlittene Pein.
Als die Geschichtsstunde beendigt war, und der Herr Professor das Klassenzimmer verlassen hatte, wurde ich in der Zwischenpause von allen Seiten als »Pipin der Kleine« begrüßt. Es hagelte förmlich von Pipins auf mein armes Haupt. Doch konnte ich merken, daß meine Geschichtskenntnisse meinen Mitschülern imponiert hatten. Sie ließen es bei der Anrede mit dem Spitznamen bewenden und boten mir ferner keine Lexica und Holzkasten zum Unterlegen an.
Von dem rechten Pipin heißt es in der Geschichte: »Die unfolgsamen Großen bändigte er durch die Ueberlegenheit seines Geistes und durch die Stärke seines Armes. Die Sachsen in Westfalen wurden zur Entrichtung eines Tributs gezwungen …« Ach, wie so ganz anders erging es mir, dem kleinen Namensvetter des Karolingerkönigs! Da war von einem Bändigen, von einer Stärke des Armes, von einem Tribut der Westfalen (scilicet meiner westfälischen Mitschüler) keine Rede. Im Gegenteil mußte ich mich unterwerfen, den Arm anderer fühlen und Tribut zahlen (wenn derselbe auch nur in den Aepfeln und Nüssen bestand, die man mir aus den Taschen stibitzte). Ja, seit jenem denkwürdigen Morgen, wo mir der Name »Pipin der Kleine« zu teil ward, habe ich mehrere Jahre hindurch viel gelitten – und alles infolge meiner kleinen Statur! Sie war der Reif, der sich auf meine Jugendblüte legte. »Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, er fiel auf die zarten Blaublümelein!«
Teilnehmenden Jünglingsherzen will ich einige meiner Leiden enthüllen. Vielleicht widmen sie Pipin dem Kleinen eine Träne des Mitleids. Seht, wenn ich mit meinen Mitschülern an schulfreien Nachmittagen einen Ausflug ins Freie machte, um Pflanzen zu sammeln oder Schmetterlinge zu fangen, so konnte ich mit den langen Beinen meiner Genossen nicht Schritt halten und trödelte immer allein hinterher. Das war langweilig, aber auch – gefährlich. Denn wenn unsere Schar an einem Bauernhofe lachend und singend vorüberzog, so wurden dort alle Hunde lebendig. Der schwarze Hofhund wütete wie ein Cerberus an seiner Kette, und der weiße Spitzhund fegte ventre a terre durch den Garten und die Weißdornhecke. Und regelmäßig bekam er mich zu packen, weil ich der letzte war. Mit seinen spitzen weißen Zähnen hatte mich der grimme Köter an der Hose. Ich schrie Zeter und Mordio – und meine Kameraden lachten. Ich schlug mit dem Schmetterlingsnetze dem Köter auf die Schnauze; der aber happte zu und hatte – o Jammer und Graus! – den ganzen Gazebeutel im Maule. Meine Kameraden wollten sich totlachen. Während der Hund sich mit dem Gazebeutel herumschlug, nahm ich Reißaus und kam mit einem Biß in der Wade, einem Riß in der Hose und mit einem leeren Drahtreif am Schmetterlingsnetze bei meinen Freunden (schönen Freunden!) an, die sich die Seiten vor Lachen hielten. »Pipin der Kleine,« hieß es dann, »warum trödelst du auch immer hinterher? Ein Karolinger muß eigentlich immer an der Spitze des Zuges sein! Aber so geht’s, wenn man zu kurze Beinchen hat. Armer Kleiner, tut dir dein Beinchen weh? Und was wird Mütterchen zu der zerrissenen Hose sagen? Und mit diesem Schmetterlingsnetze kannst du Luft fangen und weiter nichts!« So neckte man mich den ganzen Weg, daß ich am liebsten wieder umgekehrt wäre.
Sahen meine Kameraden auf einer von Hecken umhegten Wiese eine schöne Blume, etwa eine seltene Orchidee, so hieß es: »Pipin der Kleine muß durch die Hecke kriechen und uns die Blume holen!« Ich mochte mich sträuben, wie ich wollte, ich mußte durch die Hecke. Der eine hatte gar schnell ein Loch gefunden, der andere duckte mich zur Erde, der dritte faßte meine Beine, als ob es die Handgriffe eines Schiebkarrens wären, und schob mich nolens volens durch die Hecke. Wie ein Dieb mußte ich das fremde Eigentum betreten und die Blume holen. Freilich war es nur eine wilde Blume, die der liebe Gott für alle hat wachsen lassen; aber ich zertrat dabei doch das Gras, das der Eigentümer durch eine Hecke hatte schirmen wollen. Und was war der Dank von Seiten meiner Kameraden? »Pipin der Kleine,« sagten sie, »du eignest dich famos zu einem kleinen Spitzbuben und Einbrecher! Wie ein Mäuschen kannst du durch alle Löcher kriechen!«
Hatten uns die schönen, gelb und schwarz gegitterten Segelfalter und Schwalbenschwänze allzuweit auf eine Blumenwiese gelockt, dann erschien plötzlich mitten in unserem Jubelgeschrei ob gefangener Schmetterlinge der einäugige Flurschütz oder Knüppelschütz, wie wir ihn nannten, der einen kolossalen Eichenknüttel in seiner Rechten schwang, von Graszertrampeln und Malefizbuben schrie und uns den Garaus zu machen drohte. Sauve qui peut! lautete dann unsere Parole. Wie ein Schwarm von Kranichen oder langhalsigen Schwänen (diesen Vergleich gebraucht bekanntlich Vater Homeros) stoben wir durch das Wiesengras dem bergenden Walde zu. Allen voran der große »Büffel« mit seinen langen Beinen, dann kam der schnellfüßige »Hektor«, dann »Achill«, weiter »Bruder Tuck« und »Puttke«, und der letzte war natürlich »Pipin der Kleine«. Meine Angst könnt ihr euch denken, als ich den wütenden Wächter der Wiesen und Saaten hinter mir hörte, als der Zwischenraum zwischen dem Verfolgten und dem Verfolger immer kürzer wurde, als die greulichen Schimpf-und Fluchworte des dem Trunke ergebenen Mannes an mein Ohr klangen, als ich schon den Eichenknüttel durch die Luft sausen hörte. Wäre der wütende Mensch nicht im letzten Augenblicke über eine Baumwurzel gestürzt, wodurch ich einen Vorsprung und den bergenden Wald gewann, mehercule, der Knüttel des Flurschützen hatte Pipin den Kleinen ohne Respekt und Gnade niedergeschlagen.
Kehrten wir auf unseren Ausflügen in einem Schulzenhofe ein, um für ein paar zusammengelegte Groschen einige Gläser frischer Milch zu trinken, so war Pipin der Kleine, obschon er zwei Groschen beigesteuert, immer der letzte, der zu trinken bekam. »Die Kleinen müssen bitten, warten und danken lernen,« hieß es schnöde, wenn ich mich vordrängte, und erbarmungslos wurde ich von meinen größeren Kameraden mit den Ellenbogen beiseite geschoben. Nicht selten hatte ich auch das leere Nachsehen und mußte mich, statt mit Milch, mit einem Trunke Brunnenwassers begnügen, das nach dem Moosbewuchs der Brunnensteine ganz abscheulich schmeckte. Noch heute fühle ich das Blut in meine Wangen steigen, wenn ich daran denke, wie die dicke Bäuerin sagte, als sie gewahrte, daß meine Kameraden mir die Milch vor der Nase weggetrunken hatten: »Ihr großen Schlingel, laßt doch dem kleinen Kinde auch ein Tröpfchen zukommen!« Ich ein kleines Kind! Ich, der fünfzehnjährige Untersekundaner, der zu Ostern Numero Eins und überhaupt die beste Zensur der Klasse davongetragen hatte! Es war schmachvoll, sich von einer dicken Bäuerin als »kleines Kind« titulieren lassen zu müssen! Ich verbat mir deshalb ganz energisch diesen Titel bei der Bäuerin. Da stemmte sie beide Hände in die Seiten, sah mich mit dicken runden Augen an und lachte, ja lachte, daß sie zitterte wie ein Gallertpudding. »Nun hör doch mal einer die kleine Kröte!« rief sie ihrer fuchsigen Magd zu, die pflichtschuldigst mitlachte! Ich rannte wütend aus dem Hause und verwünschte alle Bäuerinnen der Welt.
Doch wozu die Erinnerungen an die Leidensjahre Pipin des Kleinen noch weiter erneuern? Die Jahre sind, Gott sei Dank, vorüber, und es ist für jeden Menschen gut, gelitten zu haben. Wie sagt doch das Sprüchlein? »Es ist einem Manne ein köstlich Ding, daß er sein Joch trage in der Jugend.« Durch Nacht zum Licht, durch Kampf zum Sieg, per aspera ad astra. Diese alte tröstliche Wahrheit erfüllte sich auch an mir. Wohl hatte ich noch einen schweren Weg zu gehen, ehe mir das Licht tagte, ehe ich den Sieg errang, ehe ich mit meinem Scheitel die Gestirne berührte – den Weg der Krankheit! Ich bekam das kalte Fieber. Acht Wochen lang schüttelte und rüttelte dasselbe meinen Körper grausam durcheinander; aber als ich mich endlich genesen von meinem Lager erhob, da staunten alle, die mich sahen: ich war um mindestens einen Fuß gewachsen! Mit innigem Danke gegen Gott betrachtete ich mein verändertes Bild im Spiegel, und triumphierend betrat ich die Obersekunda, in die ich mittlerweile vorgerückt war. Wohl streckten sich meine Hände und Füße allzuweit aus den zu kurz gewordenen Kleidungsstücken, aber das genierte mich nicht. Ich war nicht mehr der Kleinste der Klasse! O Wonne, o Glück! Der Name »Pipin der Kleine« ging laut einstimmigem Beschluß meiner Mitschüler auf den kleinen Felix Pieper über, und ich wurde feierlich als »Karl der Große« proklamiert.
Schlaflos
Man hat mich hierher, nach Tippelskirchen, aufs Land geschickt, damit ich in Stille und Einsamkeit den verlorenen Schlaf wiedergewinne. Schlaflos sein bei vierzehn Jahren – der Arzt schüttelte ungläubig den Kopf, als ich ihm mein Leiden klagte; nachdem ich jedoch dem alten, liebenswürdigen Herrn »die Geschichte« meiner Schlaflosigkeit entwickelt hatte, lachte er so kräftig, daß die weiße Locke auf seinem Scheitel wackelte, und mit einer Stentorstimme, die ich seinen alten Sprachorganen nimmermehr zugetraut hätte, rief er aus: »Ja, davon sollte der Kuckuck nicht schlaflos werden!«
Die Geschichte aber, welche ich dem guten Doktor erzählte, lautete folgendermaßen:
Ich schlafe, Herr Doktor, mit meinem älteren Bruder, dem Primaner, auf einer Stube. Bruder Karl findet ein außerordentliches Vergnügen an der Naturgeschichte und er hat sich umfassende Sammlungen aus allen drei Reichen, dem Tier-, Pflanzen-und Mineralreiche, angelegt. Unsere Studierstube, die zugleich unsere Schlafstube ist, gleicht einem kleinen Museum. Da stehen in den oberen Fächern eines Bücherschrankes Spiritusgläser mit Schlangen, Eidechsen und Kröten, säuberlich mit Papier verschlossen und etikettiert, als wären es der Mutter Einmachegläser mit Essiggürkchen, Perlzwiebeln und roten Rüben; da prangt auf einem Tischlein am Fenster ein mit allerlei scheußlichen Fischen, Käfern, Larven und Salamandern bevölkertes Aquarium, so groß wie eine mäßige Pferdeschwemme; da steht auf einem Stuhle ein mächtiger, mit schwarzer Gaze umkleideter Raupenkasten, in welchem kahle und langhaarige, kleine und große, dicke und dünne Raupen durcheinander wimmeln und sich an Salat und Brennesseln gütlich tun. An einer Wand hängen drei Glaskasten mit Schmetterlingen – aufgespießten und aufgespannten Schmetterlingen, die sich wenigstens ruhig verhalten. In einer Stubenecke steht ein mit feuchtem Moose zugedecktes Kästchen, in welchem einige Schlangen hausen; der Bruder versichert zwar, es seien ganz harmlose, ungefährliche Blindschleichen, ich hege jedoch die Ueberzeugung, daß es junge Klapperschlangen oder Brillenschlangen oder zum wenigsten Kreuzottern sind. Oben auf dem Kleiderschranke paradiert ein Käfig mit weißen Mäusen, und wie niedlich die Tierchen auch sind, so läßt sich doch nicht bestreiten, daß sie einen höchst empfindlichen Geruch ausströmen. Mit diesem Geruch vermischen sich die Ausdünstungen der mächtigen Herbarien, welche vier Fächer in einem zweiten Bücherschranke einnehmen und lange zum Schlupfwinkel verschiedener Mäusefamilien dienten. Diese Mäusefamilien hatte mein Bruder ebenfalls »eingeführt«, damit sie einem Stacheligel, der auf dem Fußboden, namentlich unter dem Bette, sein Wesen trieb, zur Nahrung dienen sollten. Daß die kleinen Nagetierchen es sich in seinen Herbarien bequem machen würden, hatte Karl allerdings nicht vorausgesehen. Doch ich will mit der Schilderung von meines Bruders Menagerie nicht zu weitläufig werden und nur noch erwähnen, daß eine Schildkröte, zwei Kaninchen, zwei Lachtauben, ein Eichhörnchen und vier Kanarienvögel die Mitbewohner unseres Stübchens waren. Auf diesem Stübchen schlief ich, wie gesagt, mit meinem älteren Bruder, dem Primaner, zusammen.
Aber was für ein Schlaf war das, Herr Doktor! Das schöne Liedchen: »Komm, süßer Schlaf, erquicke –!« war offenbar für mich nicht gedichtet. Nein, mein Schlaf war nicht süß, nicht erquickend. Und daran waren die Tiere meines Bruders schuld. Wenn ich mich abends ausgekleidet hatte und müde in den Hafen des Bettes fahren wollte, dann geschah es wohl, daß ich mit dem nackten Fuße plötzlich auf den Stacheligel trat, der, auf der Mausejagd begriffen, unter dem Bettgestell hervorschoß. Natürlich schrie ich bei dem Schmerze, den mir die spitzen Stacheln verursachten, laut auf und flog wie eine Bombe kopfüber ins Bett – mit blutendem Fuße. Ich verwünschte den Igel in den bittersten Ausdrücken, um von meinem Bruder zu vernehmen, daß der Igel ein ganz harmloser Geselle sei, der sich durch Vertilgung von Ratten und Mäusen überaus nützlich mache und deshalb alle Schonung verdiene.
»Aber die jungen Küchlein frißt er auf!« warf ich ärgerlich ein.
»Die haben wir nun nicht, mein Junge, auf unserer Stube,« entgegnete mein Bruder gelassen.
»Ja, das fehlte auch noch!« antwortete ich mit gesteigerter Gereiztheit. »Als ob hier nicht schon genug Getier durcheinander krimmelte und wimmelte und einem den Aufenthalt verleidete!« Ich drückte mich in die Kissen und suchte meinen Aerger zu verschlafen.
Aber kaum hatte der Schlafgott die ersten Mohnkörner in meine Augen gestreut, als die verschiedenen Mäusefamilien in den Herbarien lebendig wurden. Das war ein Huschen und Rascheln, ein Kribbeln und Krabbeln, ein Wispern und Knuspern, ein Piepen und Zwitschern, daß mein schon halb erloschenes Gehör wieder in einen wachen, gereizten Zustand geriet und meine schon halbgeschlossenen Augen sich wieder öffneten. »Die verwünschten Mäuse!« knurrte ich und klopfte mit dem Stiefelknecht, den ich vom Fußboden aufraffte, an den Pfosten des Bettes. Eine viertel Minute waren die kleinen Nager ruhig, dann aber legten sie von neuem mit ihrem unruhigen Treiben los.
»Sie fressen dir deine getrockneten Alpenrosen und deine seltene Orchis fusca auf!« bemerkte ich dem Bruder, um ihm einen Nadelstich zu versetzen.
»Hat nichts zu sagen,« erwiderte der Bruder zwischen Schlaf und Wachen, »die Mäuse sitzen gar nicht in den Herbarien.«
»Da will ich nun jede Wette mit dir machen, daß dies doch der Fall ist,« gab ich triumphierend zur Antwort; »denn ich habe es noch heute nachmittag mit meinen eigenen Augen gesehen.«
»Ich begreife nicht, wie du so gereizt gegen die niedlichen Tierchen sein kannst,« bemerkte der Bruder, meiner Beteuerung ausweichend. »Das Mäuschen, lehrt die Naturgeschichte, ist harmlos, ja gutmütig, und dort, wo es sich ungefährdet weiß, zutraulich, so daß es in der Nähe der Menschen seine Spiele treibt; ja auf den Klang der Musik, für welche es Neigung hat, aus seinem Schlupfwinkel herbeikommt. Mit großer List und Gewandtheit – –«
»Macht es sich über deine getrocknete Campanula latifolia, diese seltene Glockenblume, her!« fiel ich dem Bruder ins Wort.
»Komm, laß uns schlafen!« schnitt Karl meine Rede ab und legte sich auf die andere Seite.
»Schlafen, schlafen!« entgegnete ich höhnisch, »Wenn man unter diesen Amphibien überhaupt schlafen könnte!«
»Die Maus ist ein Säugetier, keine Amphibie,« bemerkte mein Bruder noch mit schwerer Zunge, um schon in den nächsten Augenblicken durch Nase und Kehle jene unromantische Musik zu erzeugen, welche man im gewöhnlichen Leben »Schnarchen« nennt.
Die Mäuse rumorten weiter, aber schließlich übermannte mich die Müdigkeit und ich schloß die Augen. Noch hatte ich so viel Besinnung, um das wohltuende Versinken in den Schlummer mit stiller Freude begrüßen zu können, als ich plötzlich jäh zusammenfuhr: etwas Rauhes hatte meine Hand gestreift, die oben auf der Bettdecke lag.
»Was mag das nun wieder für ein Vieh gewesen sein?« sagte ich ärgerlich zu mir, indem ich mich im Bette aufrecht setzte.
Im nächsten Augenblick hörte ich sowohl auf der Bettdecke als auf den Tapeten der Wandflächen ein seltsames Knistern und Wispern. Jetzt war es hier, jetzt war es dort. Ich lauschte fünf Minuten, zehn Minuten – das Knistern und Wispern nahm nicht ab, sondern zu. Ich konnte es mir nicht versagen, meinen schnarchenden Bruder, der im Traume jetzt vielleicht im zoologischen Garten von Köln herumwandelte, etwas unsanft anzustoßen und ihm zuzurufen: »Da höre! Was ist das nun wieder für ein Spektakel?«
Bruder Karl brummte etwas von Rücksichtslosigkeit, richtete sich aber im Bette auf und lauschte.
»Das ist mir auch ein ungewohntes Geräusch,« bemerkte er nach einigen Augenblicken. »Warte, ich habe die Streichhölzchen hier auf dem Nachttisch liegen; ich will eins anreiben und leuchten,«
Im nächsten Augenblick zuckte,die Flamme auf, und indem mein Bruder die kleine Fackel über die Bettdecke und über die Tapetenwand am Kopfende des Bettes führte, rief er plötzlich aus: »O weh, meine Bärenraupen sind mir sämtlich aus dem Kasten gebrochen! Da muß jemand die Klappe losgelassen haben!«
»Ich bitte mir aus,« entgegnete ich gereizt, »daß du mich nicht mit dem ›jemand‹ meinst. Ich wäre fähig, deine garstigen Raupen zu vergiften, aber ich würde ihnen niemals den Weg zur Freiheit öffnen.«
»Nun, ich kann auch selbst die Klappe losgelassen haben,« lenkte mein Bruder besänftigend ein.
Besänftigend – denn was er nun tat, war wohl geeignet, meinen Verdruß zu steigern, sintemal und alldieweil es mir eine weitere halbe Stunde von meiner Nachtruhe raubte, Bruder Karl stand nämlich auf, zündete eine Kerze an, leuchtete damit auf dem Bette und an den Wänden umher und fing seine flüchtigen Bärenraupen wieder ein. Dabei belehrte er mich, daß die Füße der Raupen, indem sie die Tapete oder den Kattun der Bettdecke berührten, unzweifelhaft das knisternde Geräusch von vorhin erzeugt hätten. Alle Raupen besaßen drei Paare horniger Brustfüße; dann folgten, nach einem Zwischenraume von zwei Leibringeln, die fleischigen Bauchfüße, meist vier Paare; das letzte Leibesglied aber ende in kräftigen, fleischigen Füßen, welche Nachschieber hießen. Hiernach hätten die Raupen niemals mehr als sechzehn Füße, in manchen Fällen aber weniger.
Ich muß gestehen, daß ich bei diesen Erörterungen meines Bruders allmählich süßsauer lachen mußte. Das Bild, wie er so im Hemde in der Stube herumhantierte, beleuchtet vom Schein der flackernden Kerze, wie er so auf Stühle und Tische stieg, um die dunkel-und langhaarigen Bärenraupen – vierundzwanzig an der Zahl waren ihm ausgebrochen! – von den Wänden herabzuholen, wie er so seine Rede mit nachdrücklichen Bewegungen des Kopfes begleitete, dies Bild war gar zu komisch! Endlich hatte er seine Herde wieder beisammen; sie wurde von neuem eingesperrt und diesmal wurde die Klappe des Raupenkastens durch eine aufgelegte griechische Grammatik beschwert. Das Buch, an welchem wir Studenten uns die Köpfe zerbrachen, sollte – freilich in etwas anderem Sinne – doch wohl auch schwer genug sein für die Köpfe der Bärenraupen. »Nun möchte ich aber wünschen, daß ich endlich Ruhe hätte!« war der Seufzer, mit dem ich mich von neuem in die Kissen drückte.
Der gute Morpheus, der ja bei uns lateinischen Schülern noch immer, gleichwie der Jupiter Pluvius, eine Rolle spielt, mußte wohl den Wunsch des gequälten Untertertianers erhört haben, denn ich sank in einen süßen Schlummer, in welchem ich auf rosigen Wolken wandelte – »hoch über der Tiere Geschlechtern«. Ich hatte einen köstlichen Traum. Eine freundliche Fee kam auf einem Purpurwölkchen herangeschwebt und überreichte mir einen mit bunten Mohnblumen umkränzten Zauberstab, mit welchem ich alles Getier, sowohl das wilde als das zahme, sowohl das kriechende als das fliegende, in tiefen Schlummer versenken könnte. Hocherfreut nahm ich den herrlichen Stab aus den Händen der gütigen Fee entgegen und beschloß, sogleich seine Zauberkraft an der Menagerie meines Bruders (den ich aus meinen lichten Höhen tief auf der Erde in seinem Bette liegen sah) zu erproben. Ich streckte den Stab und meine Hand, die denselben hielt, in wagerechter Linie aus und sprach: »Hocus pocus in arabico« – als ich plötzlich an meinem ausgestreckten Arm ein eisiges Gefühl empfand. Ich fuhr zusammen – und erwachte. Der schöne Traum war verflogen; die Rosenwolken waren verduftet und ich lag in einem höchst irdischen Bette. Geblieben war indes das eisige Gefühl an meinem Arm: es saß unter dem Hemdärmel auf der nackten Haut und machte sich gerade in der Armbeuge höchst fühlbar. Im nächsten Augenblicke wußte ich, wodurch diese Empfindung erzeugt wurde.
»Eine Schlange! Eine Schlange!« schrie ich voll Entsetzen und schleuderte das Reptil, indem ich mit meinem Arm eine kräftige Bewegung vom Körper ab aus dem Bette hinaus vollführte, auf die Stubendielen. Klatsch! da lag es.
Bruder Karl war von meinem Geschrei erwacht.
»Eine Schlange hatte sich um meinen Arm geringelt!« schrie ich noch immer voll Schrecken auf.
»Du weckst ja die ganze Nachbarschaft mit deinem Geschrei!« entgegnete mein Bruder ärgerlich.
»Eine Klapperschlange – sie hat mich gewiß gebissen!« schrie ich ebenso laut wie vorhin.
»Unsinn!« erwiderte mein Bruder mit Nachdruck. »Schon hundertmal habe ich dir gesagt, Theodor, daß es ein paar ganz ungefährliche Blindschleichen sind, welche ich in dem Kasten habe. Die Blindschleiche –«
»Ach, komm mir nicht wieder mit deinen naturgeschichtlichen Vorträgen!« erwiderte ich im höchsten Grade gereizt. »Es ist nicht zum Aushalten hier auf der Bude! Keine Stunde hat man Ruhe. Ich werde es den Eltern sagen, damit diese Menagerie auf unserer Schlafstube endlich aufgehoben wird.«
»Pfui, schäme dich!« entgegnete Karl nun ebenfalls gereizt. »Du willst doch nicht den Angeber und Hetzer spielen? Du willst ein deutscher Jüngling sein und ein deutscher Mann werden, und machst dich vor ein paar harmlosen Tieren bange? Unsere Vorfahren, die alten Germanen, wohnten in den Wäldern, mitten unter Auerochsen –«
»Das fehlte auch noch, daß du dir einen Auerochsen hier auf der Stube hieltest! Freilich, wenn du einen bekommen könntest, so würdest du keine Rücksicht auf mich nehmen.«
»Da sprichst du wieder einen Unsinn, der deinen Reden so oftmals eigen ist. Du weißt ganz gut, daß ein Auerochs anderer Lebensbedingungen bedarf, als ich ihm hier auf der Stube gewähren kann. Außerdem solltest du als Untertertianer wissen, daß der Auerochs in Deutschland ausgestorben ist; er wird nur noch in dem Urwalde von Bialowicza in Litauen gehegt,«
»Meinethalben in Buxtehude!« knurrte ich und kroch wieder unter die Bettdecke.
Die Ereignisse der Nacht hatten indes mein Nervensystem so erregt, daß ich mindestens zwei volle Stunden mit offenen Augen da lag.
Doch ich will Sie, mein hochverehrter Herr Doktor, nicht mit der ausführlichen Schilderung all meiner nächtlichen Abenteuer langweilen. Ich will mich darauf beschränken, Ihnen mitzuteilen, daß nächst der Schlange mich das Eichhörnchen in dem kaum gewonnenen Schlummer störte, indem das Tierchen mich in die große Zehe biß, die unten aus der Bettdecke hervorguckte. Auf das Eichhörnchen folgte ein Salamander, der, wie es die Gewohnheit dieser Tiere ist, das Aquarium verlassen und einen Spaziergang in der Stube angetreten hatte, bis ich ihn in meiner Herzgrube auf der nackten Haut verspürte. Als ich auch diesen Schrecken überwunden und kaum wieder etwas Schlaf gewonnen hatte, graute schon der Morgen und die Lachtauben ließen ihr verzweifelt langweiliges »Kumm Fru! Kumm Fru!« ertönen. Bald darauf stimmten die vier Kanarienvögel ihr Liedchen an – so ein Lied, das Stein’ erweichen, Menschen rasend machen kann. Sehen Sie, Herr Doktor, das war meine Nachtruhe, mein Schlaf in einer Nacht! Die geschilderten Abenteuer wiederholten sich aber viele, viele Nächte, nur in etwas abgeänderter Reihenfolge, indem das eine Mal das Eichhörnchen, das andere Mal der Salamander, das dritte Mal das Karnickel anfing. Zuletzt habe ich infolge der fortgesetzten Aufregungen die Fähigkeit zu schlafen ganz verloren – ich bin schlaflos geworden!«
»Ja, davon sollte der Kuckuck nicht schlaflos werden!« lachte der alte gemütliche Herr. »Ich werde mit deinen Eltern sprechen, mein armer junger Freund, daß sie dich irgendwohin aufs Land schicken, wo du in frischer Luft und vor allem in tiefster Ruhe schon deinen Schlaf wiedergewinnen wirst.«
Der gute Herr hat Wort gehalten – und so befinde ich mich seit acht Tagen in Tippelskirchen, einem reizenden Oertchen inmitten eines herrlichen Waldgebirges. Der Förster ist mein Hausherr, die kinderlose Frau Försterin meine Pflegerin. Gott Dank, hier herrscht zur Nachtzeit die tiefste Ruhe und ich fühle den verlorenen Schlaf allmählich wiederkehren. Ich hatte in der letzten Nacht gewaltig geschnarcht, sagte mir heute morgen mein Hausherr beim Frühstück.
Der Hauptgewinn
Es war in der Zehnuhrpause. Der Quartaner Dorus Hanekamp saß bei seinem Imbiß, den ihm seine Kostwirtin, Frau Trampe, auf den Tisch ihrer Wohnstube gestellt hatte. Seine Bücher für die nächste Unterrichtsstunde, welche halb elf Uhr begann, lagen neben ihm, ebenso seine grüne Mütze mit der Silberborte. Mit der rechten Hand führte Dorus das appetitliche Käsebutterbrot zum Munde, mit der linken hielt er das »Birkenroder Volksblatt«, auf welches Frau Trampe abonniert war. Der goldene Sonnenschein eines schönen Junitages verklärte, durch die Oeffnung der Fenstergardinen fallend, das hübsche Stillleben: »Knabe mit Zeitung und Butterbrot.« Dorus Hanekamp trieb zwar keine Politik; es waren die vermischten Nachrichten, welche ihn anzogen, ebenso die Anzeigen, unter denen das Blatt oft ganz köstliche brachte, wie zum Beispiel: »Wer seine Knochen verkaufen will, kann sie in die Messinggasse Nr. 14 tragen,« oder: »Ein braun und weiß gefleckter Jagdhund abhanden gekommen; wer demselben zugelaufen ist, erhält eine Belohnung.« Wenn Dorus solche Blüten fand, dann hatte er für den ganzen Tag was zu lachen, denn er war fröhlichen Gemütes.
Plötzlich blickte Dorus von seiner Lektüre auf und richtete seine goldbraunen Augen mit strahlendem Ausdruck auf seinen ihm gegenübersitzenden Bruder, den Oberprimaner Basilius Hanekamp, welcher beim Kauen des Butterbrotes sich aus Welters Weltgeschichte noch einige Jahreszahlen für die bevorstehende Geschichtsstunde einpaukte.
»He Basil,« rief Dorus freudig, »du wirst dich wundern, wenn du erfährst, was ich da eben im Birkenroder Volksblatt entdeckt habe!«
»Sprich, wir haben nicht lange Zeit!« erwiderte Bruder Basilius. »Schlagen die Griechen wieder gegen die Türken los, oder hat man einen tollen Hund in Birkenrode gesehen?«
»Nichts von beiden,« antwortete Dorus; »keine ollen Jriechen und keine tollen Hunde. Nein, es ist etwas, was mich selbst angeht, und was auch dich erfreuen wird.«
»Wie? Bekommen wir vorzeitige Ferien wegen der in Birkenrode grassierenden Masern?«
»Wär’ wahrhaftig nicht übel, aber das ist’s nicht. Nun, ich will dich nicht länger zappeln lassen: Nummer 3737 ist mit einem Hauptgewinn herausgekommen!«
»Und was geht uns das an?« fragte Basilius, indem er das letzte Stück seines Käsebrötchens in das Gehege seiner Zähne schob.
»Du rühmst dich doch sonst eines so guten Gedächtnisses,« meinte Dorus; »du sagtest noch soeben, du hättest alle Zahlen von Welters Weltgeschichte wie am Schnürchen, und nun hast du vergessen, daß ich ein Los der landwirtschaftlichen Ausstellung genommen habe?«
»Na ja, jetzt fällt es mir ein.«
»Siehst du, wer damals recht hatte?« sagte der Quartaner triumphierend; »du rietest mir ab, ein Los zu nehmen – ich sollte die Mark nützlicher anwenden, sagtest du. Jede Lotterie, war deine Meinung, gliche einem großen Kessel mit Suppe, worauf einzelne Fettaugen schwämmen; der Lotteriespieler gliche aber einem Menschen mit verbundenen Augen, welcher mittels eines Löffels ein Fettauge aus dem Kessel fischen wolle. Ich ließ mich aber durch deinen Vergleich, so homerisch er klingen mag, nicht abschrecken; ich kaufte getrost ein Los, Nummer 3737 – lauter Glückszahlen – und jetzt bin ich mit einem Hauptgewinn heraus.«
»Und worin besteht dieser Hauptgewinn?« fragte der Primaner.
»Das kann ich noch nicht sagen,« erwiderte der weise Quartaner, der Anlagen zu einem römischen Augur zu haben schien; »Geld ist es nicht, aber irgend ein großer nützlicher Gegenstand, der auf die Landwirtschaft Bezug hat.«
»Betrachtest du dich denn als Landwirt, du, mit deinen zwei Kaninchen und drei Blumentöpfen?«
»Das ist nun wieder recht sarkastisch. Aber kann ich den Gegenstand nicht zu Geld machen?«
»Es wird Zeit zur Schule,« schnitt der Primaner das Gespräch ab und raffte seine Bücher zusammen.
»Es trifft sich gut, heute nachmittag haben wir frei, da hole ich meinen Gewinn,« sagte der Quartaner, indem auch er seine Bücher nahm.
Dann gingen die Brüder zur Schule.
Um zwölf Uhr mittags wußte die ganze Quarta und die halbe Tertia, daß Dorus Hanekamp einen Hauptgewinn in der »Landwirtschaftlichen« gemacht hätte. Alle nahmen sich vor, sich beim Ausstellungsgebäude, wo die Gewinne verteilt wurden, einzufinden.
Als Dorus kurz nach zwei Uhr mittags den Ausstellungsplatz betrat, fand er dort die ganze Quarta, die ganze Tertia, die halbe Sekunda und ein Drittel der Prima nebst vielem Volk versammelt, denn in der Zeit von zwölf bis zwei Uhr hatte die Fama seines kolossalen Glückes sich mit wachsenden Riesenschwingen durch die Stadt geschwungen. Es fehlte der versammelten Menge nicht an Spaß, wenn nämlich einer der glücklichen Gewinner mit einem kuriosen Gegenstande die Halle verließ. Allerlei fröhliche Zurufe und Glückwünsche trafen namentlich einen jungen Kaufmann, der in großkariertem englischen Anzuge einen Schafbock mit gewaltigen Hörnern am Stricke führte.
Unser guter Dorus Hanekamp brach sich nur mühsam durch die Menge Bahn. Er mußte seine Arme spreizen wie ein Wegweiser, um sich Platz zu schaffen. Sein Herz klopfte wie ein Schmiedehammer, als er die Halle betrat.
Einer der Ausstellungsbeamten, kenntlich an der blauen, goldbortierten Mütze, nahm mit ausgesuchter Höflichkeit sein Los entgegen, verglich es mit der offiziellen Gewinnliste und sagte: »Stimmt! Ich gratuliere. Sie sind ein Glückspilz, junger Herr. Nummer 3737 ist aber auch danach – lauter Glückszahlen! Bitte, folgen Sie mir. Ihr Gewinn wird Ihnen Freude machen.«
Dorus folgte seinem Führer, wie Dante dem Geiste des Virgilius. Sein Herz drohte durch seine marineblaue Cheviotweste zu springen; seine Augen waren erwartungsvoll in die Ferne gerichtet. Worin mochte sein Hauptgewinn bestehen? Wie würden ihn die Schulkameraden beneiden, und was würde Bruder Basilius sagen, der merkwürdigerweise zu Hause geblieben war, ohne Zweifel in mißgünstiger Stimmung? Wie würde er verwundert aus dem Fenster gucken, wenn er, Dorus, mit dem Hauptgewinn vor dem Hause der Frau Trampe hielte!
Unter solchen Gedanken schritt Dorus durch den langen Ausstellungssaal über die dröhnenden Dielen, immer hinter dem Führer drein. Es waren viele Leute im Saale, welche einen letzten Blick auf die Ausstellung werfen wollten, und mancher stieß seinen Nachbar an: »Du, der Kleine hat gewiß was gewonnen!« Jawohl, dachte Dorus, der Kleine hat was Großes gewonnen; ein blindes Huhn findet auch mal eine Perle, – nein, der Vergleich ist meiner unwürdig.
Am nördlichen Ende des Ausstellungsraumes machte der artige Beamte Halt. Er schob einen Vorhang von grünem Fries zurück und sagte: »Bitte, blicken Sie in diesen Verschlag! Hier haben Sie den Gewinn der Nummer 3737.«
Dorus streckte seinen Kopf vor wie ein gereizter Gänserich und blickte in den halbdunklen Verschlag. O Himmel, da stand ein großes, vierbeiniges, höckeriges Tier und kaute an einem Mundvoll Stroh, den es der Streu entnommen.
»Ein – Kamel!« entrang es sich der keuchenden Brust des Quartaners, im Tone der höchsten Bestürzung und Enttäuschung.
»Jawohl, ein Kamel,« entgegnete der Beamte mit der ruhigsten Stimme von der Welt. »Die Ausstellungskommission hat das Tier aus dem Grunde unter die Gewinne aufgenommen, weil der Herr Baron von Flixenstern auf Flixenhausen, der lange in Aegypten gelebt, auf seinen märkischen Gütern Versuche mit Kamelen angestellt hat; die Tiere erwiesen sich beim Pflügen zwar langsamer als Ackerpferde, aber ausdauernder; als die tüchtigsten Gäule nicht mehr konnten, spazierten die Kamele noch immer in der größten Gemütsruhe die Furchen auf und ab. Der Versuch war mithin erfolgreich, und um den minder begüterten Landwirten zu ermöglichen, auch ihrerseits Versuche anzustellen, die voraussichtlich eine Umwälzung des ganzen Landbaus hervorrufen werden, reihte die Lotteriekommission dies von Hagenbeck in Hamburg bezogene Kamel den Gewinnen ein. Sie haben also ein kolossales Glück gehabt, junger Herr! Sie schreiten mit Ihrem Kamel an der Spitze der modernen Landwirtschaft.«
Dem armen Dorus fielen seine drei Blumentöpfe ein – die konnte er unmöglich mit seinem Kamel bearbeiten.
Während Dorus noch mit klaffendem Munde wie ein Nußknacker dastand, legte ihm der höfliche Beamte einen Strick in die Hand. »Hier haben Sie den Halfter, junger Herr,« sagte er; »wenn Sie jetzt Ihren Gewinn gefälligst abführen wollen.«
Dorus stellte sich mit Schaudern das Gelächter seiner Kameraden vor, wenn er mit dem Kamel aus der Halle treten würde. »Kann ich … kann ich …« stotterte er, »das Tier nicht vorläufig hier lassen? Ich möchte es … zu einer geeigneteren Zeit abholen.«
»Bedaure sehr,« erwiderte der höfliche Beamte, aber diesmal mit unangenehmer Entschiedenheit, »Die Gewinne müssen bis sechs Uhr abends fort sein. Ich darf meine Instruktion nicht übertreten.«
Dorus Hanekamp zögerte noch immer. Da schritt ein andrer Beamter der Ausstellung vorüber, ein großer, schnauzbärtiger, streng ausschauender Mann. Mit seinen grauen stechenden Augen sah er, was hier vorging, und unter seinem roten Schnurrbart her kamen wie Pfeile die Worte geflogen: »Nicht lange stehen und gaffen. Flink, flink, flink! Verstanden, du – Junge mit dem Kamel!«
Was blieb dem eingeschüchterten Dorus anders übrig, als den Halfter anzuziehen und sein Kamel abzuführen? Er fühlte, wie ihm das Blut siedendheiß zu Kopfe schoß, vor Scham, – wie Schweißperlen auf seine Stirn traten, vor Angst – vor Angst über den Spott seiner Kameraden. Einen Vorgeschmack bekam er schon, als er die Leute in der Ausstellung lächeln und lachen sah, und als ein kleiner, dicker, roter Herr mit einer ungeheuren Brille auf der Stumpfnase durch eben diese Stumpfnafe näselnd deklamierte:
»Es ging ein Mann im Syrerland, Führt’ ein Kamel am Halfterband, Das Tier, mit grimmigen Gebärden, Urplötzlich anfing, scheu zu werden.«
Letzteres war nun zwar nicht bei dem Ausstellungskamele der Fall, desto scheuer aber wurde unser Quartaner.
Als Dorus den entsetzlichen Schritt aus dem großen Portale der Halle tat, empfing ihn ein wahrer Sturm von Gelächter und Zurufen. In dem Gebrause desselben gingen die einzelnen Worte verloren, und das war gut – sie hätten den Knaben vielleicht nur noch mehr gekränkt. Seine Kameraden drängten sich an ihn heran und brüllten, ja brüllten ihn mit so furchtbaren Lauten an, daß Dorus das »Nachtkonzert eines Urwaldes« zu hören glaubte, von dem er einmal irgendwo gelesen. Es wurde ihm schwindelig zu Mute. Das Tier, das Unglückstier aber, von dem Lärm erschreckt, spreizte plötzlich alle vier Beine und weigerte sich, weiter zu gehen, Dorus zog und zog an dem Halfter, aber vergebens, »Setz dich doch drauf!« schrie ein Primaner, und: »Setz dich drauf!« echote ein halbes Hundert Knabenstimmen, Der lange Sekundaner Thomas Krulleboll, der wegen seiner Riesenstärke den Spitznamen »Bär« führte, packte mit seinen mächtigen Tatzen den kleinen Quartaner und hob ihn auf das Kamel hinauf, und der Obertertianer Jakob Guler, wegen seiner grünlichen Augen »Isegrim« benannt, gab ihm den entfallenen Halfter wieder in die Hand, Wie es kam, erfuhr Dorus nie: aber plötzlich rannte das Tier in großen Sätzen davon, die Landstraße hinunter, die ins Innere der Stadt führte. Diese Straße war sehr belebt. Frauen kreischten, als sie den seltsamen Reiter erblickten, Kinder schrieen Zeter und Mordio, Männer sprangen bestürzt auf den Bürgersteig; eine Apfelfrau fiel mit ihrem Stuhle um, mitten in eine Mulde Kirschen; eine Horde von Hunden heftete sich mit mörderischem Gebell an die Fersen des nie gesehenen Tieres. »Das soll nun ein Schiff der Wüste sein!« war der einzige klare Gedanke, der dem Quartaner durch den Kopf ging. Aber der Kopf mußte von diesem großartigen Gedanken wohl einen Ruck bekommen haben, denn die grüne, silberbortierte Quartanermütze flog plötzlich fort, mitten in den Karpfenteich hinein, der sich in den städtischen Anlagen befand. Dorus zog und riß an dem Halfter, um den Lauf des Tieres zu hemmen, bewirkte aber dadurch nur, daß das dumme Geschöpf noch rasender ausriß. Dorus fühlte, daß er herunterpurzeln und wie Antäus die mütterliche Erde küssen würde; deshalb schlang er seine beiden Arme schnell um den Hals seines Renners. Nun aber machte er eine noch drolligere Figur, und neben dem Angstgeschrei, das er den Leuten entlockte, hörte er auch schallendes Gelächter. Und dieses Gelächter klang so empfindlich, daß es selbst einem Kamel zu viel wurde: es schwenkte mit einem entsetzlichen Satze plötzlich in eine Seitenstraße ab – und Dorus flog von seinem hohen Sitze herunter, glücklicherweise mitten in einen Kehrichthaufen, Glücklicherweise sagen wir, denn der Kehricht dämpfte die Gewalt des Sturzes; im übrigen war das Lager gerade kein angenehmes und ehrenvolles. Das flüchtige Kamel wurde von einer Meute von Straßenjungen wieder eingefangen. Dorus erhob sich und humpelte hinter seinem Hauptgewinne her. Die Gassenjungen gaben ihm den Halfter wieder in die Hand, und von einem Kometenschweife Neugieriger geleitet, schritt Dorus seiner Behausung zu. Das Stimmengewirr und Gelächter der Neugierigen lockte Frau Trampe vor die Haustür, reizte den Primaner Basilius Hanekamp, seinen Kopf aus dem Fenster des oberen Stockwerks zu strecken. Waren die beiden in staunender Verwunderung, so befand sich Dorus in peinigender Beklemmung. Da stand er nun vor dem Hause – doch wohin mit seinem Kamel? Das Tier ging ja gar nicht durch die Haustür, und auf dem Hofraum befand sich nur ein – Kaninchenstall! Frau Trampe schien diese beiden natürlichen Hindernisse ganz zu übersehen; denn sie schrie in gellenden Tönen: »Das Tier darf mir nicht ins Haus, nun und nimmermehr! Ich habe keine Lust, mich mit meinen Kindern von einem Ungeheuer auffressen zu lassen!«
Was half es Dorus, daß er mit kläglicher Stimme beteuerte, das Tier sei ein Kamel und eines der friedfertigsten Geschöpfe von der Welt? Was half es Basilus, daß er diese Worte mit seiner Primanerweisheit aus dem Fenster heraus bestätigte? Frau Trampe schrie und verbat sich alle Löwen, Hyänen, Tiger und Wölfe in ihrem Hause.
Dorus wünschte – doch wir wollen seine verzweifelten Wünsche lieber gar nicht aussprechen; nur den einen können wir unmöglich für uns behalten, er ist zu komisch: Dorus wünschte, drei Klafter tief im Kartoffelkeller des Pedellen zu sitzen! Dazwischen aber gingen ihm unbestimmt die Worte einer Ballade durch das fiebernde Gehirn: »Und will kein Retter erscheinen?«
Ja, der Retter erschien in Gestalt des Dienstmanns Tübbeke. »Junger Herr,« sagte er, »wenn Sie mit dem Tiere nicht wohin wissen, so will ich es nach dem Zoologischen Garten von Donnershausen bringen. Was soll ich für das Kamel fordern?«
»Nichts, nichts,« rief Dorus, gierig diesen letzten Rettungsanker ergreifend, »ich schenke es dem Zoologischen, ich bin froh, wenn ich es los bin! O, Tübbeke, wollen Sie es hinführen?«
»Warum nicht, wenn Sie mir den Weg bezahlen,« erwiderte der Dienstmann mit der unbefangensten Miene von der Welt.
»Und … und … was kostet das?«
»Na, wollen’s billig machen, unter Freunden: für zehn Mark schaffe ich Ihnen das Kamel vom Halse.«
Dorus dachte an die siebenundzwanzig Pfennige, die er in der rechten Westentasche hatte, und er wünschte zum zweitenmal, in den Kartoffelkeller des Pedellen zu versinken. In seiner Angst und Not warf er einen flehenden Blick nach seinem Bruder hinauf. Dieser fühlte ein menschliches Erbarmen, wickelte ein Zehnmarkstück in ein weißes Papier und warf es in die dargehaltene Mütze des Dienstmanns.
»Kolonne jüh!« sagte Tübbeke mit guter Laune und zog mit dem Kamel ab. Dorus aber schwankte mehr tot als lebendig ins Haus.
Frau Trampe hatte sich in Erinnerung ihrer geharnischten Standrede in die Küche zurückgezogen und ließ sich nicht blicken. Dorus stolperte die Treppe hinauf nach seiner Bude. Was würde Basilius sagen?
Aber Basilius machte es gnädig. Lachend trat er seinem Bruder entgegen: »Da siehst du, was dir die Nummer 3737 eingebracht hat! Hast du jetzt noch Lust, in einer Lotterie zu spielen?«
»Nein, nie wieder!« stöhnte Dorus.
»Du wolltest ja auf meinen wohlgemeinten Rat nicht hören,« sprach Basilius, »jetzt hat dich ein Kamel belehrt!«
Ein Altertümchen
Ferien! holdes Wort für alle Schüler, mögen sie groß oder klein, fleißig oder faul sein, mögen sie die Bänke der Volksschulen oder der höheren Lehranstalten drücken; den Gymnasiasten und Realschülern klingt es ebenso melodisch wie den Elementarschülern und Abc-Schützen, den hoch gelahrten Professoren und Doktoren nicht minder wie den schlichten Lehrern und Dorfmagistern. Jetzt sind die Tage der goldenen Freiheit gekommen, die Gassen bevölkern sich plötzlich mit zahlreicher Jugend; wessen Eltern es gestatten können, der begibt sich zum Bahnhofe, in die Ferienreise, oder zu Fuß mit dem Ränzel in die schöne Umgebung, Die schönsten Ferien, meinen wir, sind doch die in Westfalen und vielleicht auch sonstwo gebräuchlichen Herbstferien! Gaudete juvenes, vacatio imminet, patriam intrare licebit! In der herbstlichen freien Natur reifen die Früchte, und der Schüler trägt die Früchte seines Fleißes – oder auch seines Unfleißes! – auf der Zensur mit heim. Die Kornfelder sind schon gemäht und man gönnt dem Boden einige Zeit, sich auszuruhen; ausruhen darf auch jetzt der Schüler von seinen Lektionen und Pensis, von mündlichen und schriftlichen Aufgaben, Exercitien, Extemporalien etc. Aus des Himmels blauem Spiegel lacht der unbewölkte Zeus, und wenn auch gerade kein Zephyr über die Stoppeln weht, so doch ein erfrischender Luftzug, der die Wangen bald rötet, wenn er nur rechtzeitig und hinreichend genossen wird. Die lähmende Schwüle der Hundstage ist der belebenden Kühle des Herbstes gewichen, die Glieder fühlen sich wieder leicht und elastisch, und die Beine werden zu wahren Fortschrittsbeinen, die im muntersten Tempo die Welt durchmessen möchten.
Wir drei Brüder Lammers, Schüler des Gymnasiums zu Hinterwinkel, durften die Herbstferien auf dem Edelhofe unseres Onkels Adrian im Münsterlande zubringen. »Dort auf den weiten Heiden,« hatte unser lieber Vater zu uns beim Abschied gesagt, »könnt ihr Pflanzen für eure Herbarien sammeln, Schmetterlinge und Käfer für eure Insektensammlungen fangen, seltene Versteinerungen für eure geologische Sammlung suchen, denn die münsterländischen Heiden sind alter Meeresboden.« Von kühnen Hoffnungen geschwellt, von den großartigsten Vorsätzen belebt, hatten wir den Edelhof des Onkels und der Tante betreten. Aber es sollte anders kommen: Pflanzen, Schmetterlinge, Käfer, Versteinerungen, alle verloren sie plötzlich in unsern Augen den Sammelwert – die Dinge lagen ja förmlich zu Dutzenden und Hunderten am Wege! –- als uns der liebenswürdige Onkel seine Sammlung von Altertümern zeigte. In sechs mächtigen Glasschränken, die in einem weiten, lichten Saale ihre Aufstellung gefunden hatten, zeigten sich unsern trunkenen Blicken, denen noch niemals etwas derartiges begegnet war: schwarze Aschekrüge, rostige Spangen, Armbänder, Nadeln und Ketten, feuersteinerne Beile, Speerspitzen, Messer, ferner irdene Vasen, Krüglein, Lampen und Götzenbilder, sodann gebräunte Knochen, Zähne und Schädel, weiter Holzschnitzereien und Elfenbeinsachen, hierauf buntbemalte Glasscheiben und Oelbildchen; ferner alte Schlüssel, Schlösser und Thürbeschläge von Schmiedeeisen, noch weiter Dosen, Schachteln und hundert andre Dinge. Das Haupt-und Glanzstück der Sammlung war aber ein kupfernes Reliquienhäuschen mit Emailleverzierungen; Onkels Stimme nahm ordentlich einen feierlichen Klang an und seine Hände bewegten sich in abgemessenem Tempo, als er das Häuschen uns vorzeigte und erklärte. Das Kunstwerk war aber auch wirklich wunderschön, dabei stammte es aus dem Mittelalter, und es hatte – wie uns die gute Tante hinterher heimlich anvertraute – bare dreitausend Mark gekostet! Uns schwindelte bei dieser Summe, und die paar Mark, die wir als Zehr-und Reisegeld in der Tasche trugen, verloren förmlich ihren Wert, so daß wir beschlossen, sie nur möglichst schnell aufzubrauchen. Ein solches Reliquienhäuschen zu erwerben, das schlossen wir von vornherein in unsern Absichten aus, – aber eine Altertümersammlung, die wollten und mußten wir uns partout anlegen, zumal uns Onkel gesagt hatte, daß mehrere der Urnen, Krüge, Knochen und Waffen aus den Hünengräbern der Heide stammten, welche in der Nachbarschaft des Edelhofes lag. Onkel lächelte über unsern heiligen Eifer, der sofort mit Spaten und Hacke losziehen wollte, und mahnte: »Eile mit Weile!« Vorläufig wolle er uns einen Hünenbackenzahn als Grundstein unsrer geplanten Sammlung schenken. Wer war glücklicher, als die Brüder Karl, Theodor und Ludwig! Stante pede