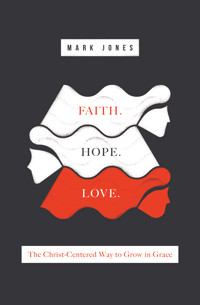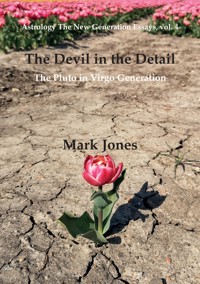21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1923 – Das Jahr der Extreme Es war das Jahr, in dem die deutsche Politik von Krise zu Krise schlitterte, als ein Bürgerkrieg realistisch erschien und die Republik an ihren Extremen und ihrer prekären Wirtschaftslage zu zerbrechen drohte. Was erzählt die traumatische Erfahrung des Jahres 1923 über uns? Der Historiker Mark Jones führt uns mitten hinein ins Krisenjahr 1923: in jene Monate, als französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten, die Deutschen für ein Brot Milliarden zahlten und in den Bierkellern ein Rechtsextremist namens Adolf Hitler reüssierte. Jones erzählt von der Bedrohung des Staates durch Putschisten von links und rechts, von Hunger und Antisemitismus – aber auch davon, wie das Land die Dauerkrise überwand und zu Stabilität und Frieden fand. Am Ende standen die Demokraten als Sieger da.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
1923
Der Autor
MARK JONES, geboren 1981, ist Assistant Professor am University College Dublin. Zuvor war er Research Fellow an der Freien Universität Berlin und Junior Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Zusammenhang zwischen Gewalt und politischer Kultur in Deutschland im 20. Jahrhundert. Sein vielbesprochenes Buch Am Anfang war Gewalt. Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer Republik erschien 2017 bei Propyläen.
Das Buch
Der Historiker Mark Jones beschreibt, wie es zu der Dauerkrise 1923 kam und welche Vorboten es gab. In einer großen historischen Erzählung führt er uns hinein ins Herz des Jahres der Extreme: in jene Monate, als französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten, die Deutschen für ein Brot Milliarden zahlten und in den Münchner Bierkellern ein Rechtsextremist namens Adolf Hitler reüssierte. Jones erzählt von Gewalt gegen Zivilisten und der Bedrohung des Staates durch Putschisten von links und rechts, von Hunger und Antisemitismus – aber auch davon, wie das Land die Dauerkrise überwand und zu Stabilität und Frieden fand. Am Ende des Jahres standen die Demokraten als Sieger da.
Mark Jones
1923
Ein deutsches Trauma
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Alle Rechte vorbehaltenLektorat: Christian SeegerUmschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, CoesfeldTitelfotografie: bpk / Kunstbibliothek, SMB, Photothek Willy Römer / Willy RömerAuorenfoto: © privatE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-2657-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Der Mord an Walther Rathenau: Die Weimarer Republik am Scheideweg
2. Januar: Französische Invasion, deutscher »passiver Widerstand«
3. Februar – März: Übergriffe der Besatzungstruppen im Ruhrgebiet
4. April: »Eine Schande für die Demokratie« – Hitler mobilisiert in München
5. Mai: »Wie die Wilden« – sexuelle Gewalt der Besatzungstruppen
6. Juni: Aktiver Widerstand und der Beginn des Schlageter-Kults
7. Juli: »Ein Anblick zum Erbarmen« – Inflationstrauma und Armut
8. August: Londons Versäumnis, Stresemanns Pech
9. September: Rheinischer Separatismus und Düsseldorfer Blutsonntag
10. Oktober: Die Feinde der Republik marschieren auf
11. November: Antisemitische Ausschreitungen und Hitlerputsch
12. Dezember: Licht am Horizont – Ende der Inflation und Dawes-Plan
Epilog
Bildergalerie
Dank
Bibliografie
Bildnachweis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Mitte November 1923 ging ein 16-jähriges Mädchen, das sich ein schwarz-rot-goldenes Bändchen an die Brust gesteckt hatte, in Bayern spazieren. Ein junger Mann kam ihr entgegen, trat auf sie zu und wies sie an, das Bändchen zu entfernen. Als sie sich weigerte, begann er sie zu schlagen, wobei er versuchte, ihr das Bändchen mit den Farben der Weimarer Republik zu entreißen. Der junge Mann war ein »Hakenkreuzler« – ein Begriff, den deutsche Demokraten damals abfällig für Hitlers Anhänger benutzten. Schließlich ließ er von dem Mädchen ab und rannte fort. Kein einziger Passant war ihr zu Hilfe gekommen. Das Bändchen war beschädigt, aber nicht zerstört worden.1
Wenige Wochen später erklärte der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx – nach Wilhelm Cuno und Gustav Stresemann der dritte deutsche Kanzler des Jahres – gegenüber der deutschen Presse, dass das Jahr 1923 »wohl nicht mit goldenen Lettern in die Geschichte des deutschen Volkes eingetragen werden würde«.2 In jenem Jahr stand das politische Schicksal Deutschlands auf Messers Schneide; die Deutschen hatten mit den Traumata der Besetzung und nationalen Demütigung, mit finanziellem Chaos, Massenarbeitslosigkeit und einer beispiellosen Hyperinflation zu kämpfen. Als diese vielfältigen und sich überschneidenden Krisen Ende Oktober ihren Höhepunkt erreichten, stand die Republik vor der gefährlichsten Bedrohung ihres Überlebens seit ihrer Gründung. Ein Bürgerkrieg zwischen Bayern und Sachsen lag ebenso im Bereich des Möglichen wie ein kommunistischer Versuch der Machtergreifung, ein Militärputsch oder ein Staatsstreich der extremen Rechten. Angesichts all dieser Bedrohungen übertrieb der damalige Kanzler Gustav Stresemann keineswegs, als er sagte, wenn die bewaffneten bayerischen Banden, die die Republik zerschlagen wollten, jemals nach Berlin gelangen würden, »dann sollen sie mich niederschießen an dem Platze, an dem zu sitzen ich ein Recht habe«.3
Die Krisenspirale begann sich am 11. Januar zu drehen, als auf Befehl des französischen Regierungschefs Raymond Poincaré französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten, angeblich zur Konfiszierung von Sachreparationen, nachdem Deutschland den im Versailler Vertrag festgelegten Reparationsforderungen nicht nachgekommen war. Mehrere aufeinanderfolgende deutsche Regierungen hatten diese Forderungen für unerfüllbar erklärt. Die Regierung Cuno erklärte die Invasion für einen illegalen Aggressionsakt. Angesichts eines Aufwallens der nationalen Empörung erklärte sie, dass die Deutschen gegen die Besatzung »passiven Widerstand« leisten würden. Die Zechen und Fabriken des Ruhrgebiets wurden geschlossen. Deutsche Arbeiter und Beamte widersetzten sich den Besatzern, indem sie sich weigerten, auf deren Forderungen einzugehen. Um den passiven Widerstand zu finanzieren, druckte die Reichsbank Geld. Bereits im April zeichnete sich ab, dass Deutschland wegen der folgenden Inflation auf eine »Finanzkatastrophe« zusteuerte.4
Doch der Kurs des passiven Widerstands musste beibehalten werden. Seine Fürsprecher argumentierten, dass die Zukunft Deutschlands als Einheitsstaat auf dem Spiel stehe. Würde er aufgegeben, so befürchteten sie, dann würde das Ruhrgebiet auf Dauer verloren sein. Das war keineswegs nur ängstlicher Nationalismus. Mit Unterstützung der Hardliner in Regierung und Nationalversammlung spielte Poincaré im Laufe des Jahres zunehmend mit dem Gedanken, das Ruhrgebiet dauerhaft von Deutschland abzutrennen. Um den Widerstand der deutschen Bahnarbeiter zu umgehen, gründeten die Franzosen sogar eine Eisenbahngesellschaft, die im Ruhrgebiet die Reichsbahn ersetzen sollte. Sie schufen eine neue innerdeutsche Grenze und eine Zollzone im besetzten Ruhrgebiet, und sie kontrollierten den Zugang zum Ruhrgebiet, das sie als Strafe für das Verhalten der deutschen Bevölkerung mehrfach komplett abriegelten.
Der passive Widerstand wurde erst am 26. September, als Stresemann erkannte, dass er mehr schadete als nützte, beendet. Hätte man ihn fortgesetzt, dann hätte die Hyperinflation, die sich seit dem Sommer dramatisch zugespitzt hatte, die deutsche Volkswirtschaft und vermutlich auch die Republik selbst vernichten können. Aber die Beendigung des Widerstands brachte keineswegs Ruhe. Vielmehr löste sie die nächste Krisenwelle aus, als die Gegner der Republik die Chance erkannten, sich die Situation zunutze zu machen, um ihre Ziele zu erreichen. Die folgenden Wochen zählten zu den angespanntesten seit Bestehen der Republik.
Von Moskau angespornt, glaubten die deutschen Kommunisten, sie hätten eine realistische Chance, die Macht zu ergreifen und den russischen Bolschewiken nachzueifern, nur um ihre Pläne in letzter Minute weitgehend aufzugeben, als sie erkannten, dass sie scheitern würden. Mit Unterstützung der Franzosen glaubten Separatisten im Rheinland, sie könnten binnen weniger Wochen die Unabhängigkeit von Preußen erlangen und einen unabhängigen rheinischen Staat unter französischer Protektion schaffen. Auch Hitler glaubte, es sei ein »Jetzt oder nie«-Moment. Im November versuchte er Mussolini nachzueifern, der nach seinem »Marsch auf Rom« im Oktober 1922 italienischer Ministerpräsident geworden war. Der erste Schritt auf dem Weg nach Berlin war die Machtübernahme in München. Aber trotz einer Steigerung der Mitgliederzahl der NSDAP um das Zehnfache im Lauf des Jahres 1923 verfügte Hitler noch nicht über die notwendige Machtbasis, um dieses Vorhaben ohne die Unterstützung der Reichswehr umzusetzen. Als diese ausblieb, konnte er lediglich einen Marsch zur Feldherrnhalle auf dem Münchner Odeonsplatz veranstalten, wo seine bewaffneten Anhänger von der bayerischen Landespolizei gestellt wurden. Während eines kurzen Feuergefechts kugelte er sich die Schulter aus, als der Mann, den er in der ersten Reihe der Marschkolonne untergehakt hatte, tödlich getroffen wurde und zu Boden stürzte. Wäre die Kugel nur einige Zentimeter weiter rechts eingeschlagen, wäre der Name Hitler heute unbekannt.
Wie in München wurden die Kräfte, die die Republik zerstören wollten, in ganz Deutschland zurückgeschlagen. Auf dem Höhepunkt der Krise machte Friedrich Ebert von seinen Notstandsbefugnissen Gebrauch, um die Verfassung zu stützen, während Stresemann, neben der Beendigung des passiven Widerstands, die Währung reformierte und die Stabilisierung der Wirtschaft einleitete. Die Erfolge der beiden Staatsmänner erinnern daran, dass die Geschichte des Jahres 1923 nicht nur von Radikalisierung und Gewalt handelt; sie ist auch eine Geschichte des Sieges der deutschen Demokraten über ihre Widersacher. Am Ende des Jahres 1923 saß Hitler in Festungshaft, und Thomas Mann hegte sogar die Hoffnung, dass sich Europas Intellektuelle schon bald vereinen würden, um den Kontinent in eine bessere Zukunft zu führen.5 Es ist wichtig, daran zu erinnern: Das Mädchen, das mit einem prorepublikanischen Bändchen an der Brust in Bayern spazieren ging, trug dieses nicht, um das Ende der Republik zu betrauern. Sie trug es, um deren Sieg zu feiern.
Das vorliegende Buch fußt auf einer umfangreichen historischen Literatur zum Jahr 1923.6 Was es von anderen unterscheidet, ist der Maßstab der Analyse: Die hier erzählte Geschichte handelt von dem, was wir entdecken, wenn wir das Mikroskop schärfer stellen, um individuelle Konflikte in den Fokus zu nehmen. Szenen wie jene zwischen dem Mädchen und dem Hakenkreuzler sind nicht bloß anekdotisch. Sie zeigen den Kern dessen, was die sich überschneidenden Krisen von 1923 so gefährlich machte. Das Töten von Zivilisten oder die Vergewaltigung deutscher Frauen durch französische und belgische Soldaten, die Wut, die ausländische Bajonette auf öffentlichen Plätzen auslösten, die fanatischen Appelle an das Nationalbewusstsein, das Gefühl, dass ein Nachbar oder Verwandter es geschafft hat, vom Zusammenbruch der Währung zu profitieren, während die eigene Familie Hunger litt, die radikale Sprache Hitlers und die antisemitische Gewalt seiner Anhänger und Sympathisanten – dies alles waren die Konflikte, die das Krisenjahr antrieben. Sie werden in diesem Buch parallel zu den Konflikten erörtert, die zwischen den Regierungen und Diplomaten in Paris, London und Berlin ausgetragen wurden. Ebendieses Zusammentreffen all dieser »Mikro«-Zusammenstöße mit einem internationalen System, das sich während des größten Teils des Jahres auf die Seite der Franzosen und gegen Deutschland stellte, hätte die Weimarer Republik um ein Haar vernichtet. Nur indem wir beide Geschichten miteinander kombinieren, können wir die wahre Bedeutung der Entscheidungen Stresemanns in seiner kurzen Zeit als Kanzler verstehen.
Gewalt spielt in diesem Buch eine zentrale Rolle. Wir können die Konflikte, die im Lauf des Jahres auftraten, nicht erforschen, ohne innezuhalten, um über ihren Anteil an der Eskalation des Hasses nachzudenken. Die Besetzung des Ruhrgebiets war von Anfang an gewaltsam. Die Besatzungstruppen töteten Zivilisten und vergewaltigten deutsche Frauen und Mädchen. Auf ihre Gewalt wurde seitens der Deutschen mit einer Kampagne des aktiven Widerstands geantwortet, angeführt von rechtsextremen Nationalisten und anfangs heimlich vom Staat gefördert. Zu den verdeckten Operationen dieser Kampagne zählten sowohl Hinrichtungen auf offener Straße im Stil von Gangsterbanden als auch Terrorakte wie Bombenanschläge auf Bahnlinien oder das Deponieren von Sprengstoff in Zugwaggons. Der spektakulärste Bombenanschlag auf einen Zug forderte am 30. Juni 20 Todesopfer und zahllose Schwerverwundete. Als Reaktion zwangen Franzosen und Belgier prominente deutsche Zivilisten, in Zügen mitzufahren, um deutsche Nationalisten davon abzuhalten, sie in die Luft zu sprengen.
Als Albert Leo Schlageter, ein von den Franzosen gefasster Protagonist des aktiven Widerstands, im Mai hingerichtet wurde, machte das Todesurteil schlagartig aus einem Unbekannten einen berühmten nationalistischen Märtyrer. Zuvor hatten in dem umstrittensten gewaltsamen Vorfall des Jahres französische Soldaten in den Krupp-Werken in Essen das Feuer auf Arbeiter eröffnet und 13 von ihnen getötet. Die Franzosen gaben den Krupp-Direktoren die Schuld an dem Verlust von Menschenleben und verurteilten sie zu langen Haftstrafen. Die Eskalation des Hasses, die mit solchen Gewaltakten einherging, hinterließ auf beiden Seiten ein bitteres Vermächtnis.
Doch die Gewalt des Jahres 1923 beschränkte sich nicht auf Schüsse und Explosionen. Dazu zählten auch Zwangsdeportationen und Beschränkungen der Lebensmittelversorgung im Ruhrgebiet. Aus Wut über die Weigerung der Deutschen zu kooperieren wiesen die französischen und belgischen Besatzer mehr als 100 000 Staatsdiener und deren Familien aus dem Ruhrgebiet aus, häufig mit vorgehaltener Waffe. Deren Vertreibung ins unbesetzte Deutschland war Teil einer gezielten Strategie, die deutsche staatliche Präsenz im besetzten Gebiet zu schwächen. Angesichts der Versorgungskrise im Ruhrgebiet wurden über 300 000 Kinder ins unbesetzte Deutschland geschickt, um sich dort zu erholen. Wären sie an der Ruhr geblieben, dann wäre eine unbekannte Zahl von ihnen verhungert.
Das Buch beginnt im Sommer 1922. Zu der Zeit war die Weimarer Republik alles andere als eine perfekte Demokratie, aber sie war auf einem guten Weg. Wenn wir verstehen wollen, inwiefern das Krisenjahr 1923 die Anstrengungen der deutschen Demokraten untergrub, ihre Republik zu stärken, müssen wir mit der Gefährdung der Demokratie in den Monaten vor der französischen und belgischen Invasion beginnen. Wenn wir verstehen wollen, wie das internationale System – und insbesondere die drei Mächte, die 1923 den größten Einfluss auf Deutschland ausübten: Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten – auf das Krisenjahr reagierte, müssen wir uns den Zustand dieses Systems am Vorabend des Krisenjahres vor Augen führen. Darauf zu verzichten hieße, unter den Tisch zu kehren, wie sehr das internationale System die deutschen Demokraten während des größten Teils des Jahres 1923 im Stich gelassen hat. Hätten die Akteure das nicht getan, dann wäre die Geschichte des Krisenjahres und womöglich der Weimarer Republik insgesamt anders verlaufen. Die Saat für ein friedlicheres und weniger nationalistisches Europa war im Jahr 1923 gelegt, ebenso die Saat für ein demokratischeres und weniger nationalistisches Deutschland. Dieses Buch möchte dazu beitragen zu verstehen, was das Wachstum dieser Saat behindert hat und warum ungeachtet der größten Anstrengungen der deutschen Demokraten am Ende eine noch schlimmere Ära des Hasses, der Gewalt und des Krieges anbrach.
1. Der Mord an Walther Rathenau: Die Weimarer Republik am Scheideweg
Die Krankenschwester Helene Kaiser war als Erste bei ihnen. Sie hatte auf dem Weg zu ihrer Arbeit in der Charité an der Straßenbahnhaltestelle gestanden, als sie sich instinktiv auf den Boden warf – aufgeschreckt von einer raschen Abfolge von Geräuschen, die in Grunewald, einem der ruhigsten und teuersten Vororte Berlins, ganz ungewöhnlich waren. Sie hörte das Aufheulen eines Automotors, gefolgt von quietschenden Reifen, einer kurzen Salve aus einer Maschinenpistole und dem dumpfen Knall einer Granate. Sie lag da und horchte, als ein Fahrzeug mit großer Geschwindigkeit davonraste, während ein anderes ausrollte und zum Stehen kam. Dann war nur noch Stille. Sie hatte nicht wirklich gesehen, was passiert war. Später sagte sie, sie habe angenommen, der Schütze sei im Gebüsch gegenüber der Stelle, an der der Wagen stehen blieb, versteckt gewesen. Ihr Helferinstinkt war jedoch zu stark, sie wollte versuchen, ein Menschenleben zu retten, auch wenn das für sie hieß, sich selbst in Gefahr zu bringen. Sie stand auf und lief auf das Automobil zu, ein teures NAG-Cabriolet mit roten Reifen. Das Verdeck war offen. An den Matten im Fond des Wagens züngelten Flammen. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, Josef Prozeller, unverletzt, aber unter Schock. Hinter ihm lag ein weiterer Mann auf der Seite. Auf ihn hatte man geschossen. Aus seinem Gesicht und den Gliedmaßen strömte so viel Blut, dass sich bereits eine Lache bildete.
Zuerst löschte sie den Brand, den die Granate verursacht hatte. Dann nahm sie den verwundeten Mann in die Arme und versuchte, seine Blutung zu stoppen. Sie sagte zu Prozeller, sie sei Krankenschwester und wolle helfen; dann schrie sie: »Schnell, schnell, zum Arzt!«7 Prozeller brachte den beschädigten Wagen in Gang und fuhr los in Richtung der Villa des Verletzten. Helene Kaiser hielt ihn fest in den Armen. Aber sie konnte nichts mehr für ihn tun. Er starb in ihren Armen. Nur zehn Minuten nach der Abfahrt trugen Prozeller und Kaiser den Leichnam des Mannes wieder in sein Wohnhaus zurück. Man hatte ihn fünf Mal getroffen. Die Autopsie ergab, dass schon der erste Schuss tödlich gewesen war. Der Tote war Walther Rathenau, der deutsche Außenminister. Er war von dem 23-jährigen ehemaligen Marineoffizier und Studenten Erwin Kern erschossen worden. Sein Freund, der 26-jährige Hermann Fischer, hatte die Granate geworfen. Das Tatauto fuhr der 20-jährige Ernst Werner Techow.
Kern und Fischer waren Anfang Juni 1922 nach Berlin gekommen. Seitdem erwogen sie zahlreiche Varianten für ein Attentat auf Rathenau. Ein Plan sah etwa vor, auf offener Straße im Berliner Zentrum mit Revolvern auf ihn zu schießen. Doch diese Idee verwarfen sie, weil sie die Fluchtchancen für nicht gut genug hielten. Stattdessen erkannten sie, nachdem sie Rathenaus Tagesabläufe ausgekundschaftet hatten, dass er auf der Fahrt von seinem Haus in Berlin-Grunewald zum Sitz des Außenministeriums in der Stadtmitte am verwundbarsten war. Sie hatten herausgefunden, dass Rathenau regelmäßig die gleiche Route nahm, nahezu um die gleiche Zeit, und dass er stets nur seinen Chauffeur als Begleitung hatte; zusätzlichen Polizeischutz hatte er abgelehnt. Nach reiflicher Überlegung waren Fischer und Kern zu dem Schluss gelangt, dass der beste Weg, ihn zu töten, Schüsse im Vorbeifahren seien. Obwohl sie beide erfahrene Soldaten waren, übten sie in den Wäldern um Berlin das Schießen aus einem fahrenden Auto; dabei stellten sie fest, dass bei der Verwendung von Handfeuerwaffen die Gefahr bestand, ihr Ziel zu verfehlen. Statt dieses Risiko in Kauf zu nehmen, verschoben sie den Anschlag und fuhren nach Schwerin, um eine Maschinenpistole zu holen, die sie dort versteckt hatten. Doch in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 1922 war alles bereit.8
Kern und Fischer waren junge Männer aus angesehenen Familien, die durch die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg radikalisiert worden waren. Sie gehörten dem ersten rechtsextremen Terrornetzwerk Deutschlands an: der Organisation Consul. Deren Anführer war Hermann Ehrhardt, ein ehemaliger Marineoffizier. Männer wie Ehrhardt hatten besondere Gründe für ihren Hass auf die Republik und deren Repräsentanten. Die Revolution, aus der im November 1918 die Weimarer Republik hervorgegangen war, hatte in der Marine begonnen. Die Offiziere der Kriegsmarine hatten die Schmach nicht ertragen, dass die unter ihrem Kommando stehenden Matrosen die rote Flagge gehisst und das Ende des Krieges gefordert hatten, statt zu einer letzten Schlacht gegen die Briten auszulaufen. Im Winter 1918/19 schickten sie sich an, Rache zu üben. Sie gründeten drei hochkarätige Offiziersdivisionen, die sogenannten Marine-Brigaden. Eine wurde von Ehrhardt befehligt und nach ihm benannt.9
Im Frühjahr 1920 schloss sich Ehrhardt mit Wolfgang Kapp und dem ehemaligen Armeegeneral Walther von Lüttwitz zusammen und versuchte, die Republik gewaltsam zu stürzen. Er führte kurzzeitig seine schwer bewaffneten Soldaten in die Stadtmitte von Berlin und erklärte die deutsche Demokratie für beendet. Doch die Pläne liefen rasch aus dem Ruder, und die Putschisten wurden mühelos niedergeschlagen. Nach diesem Fehlschlag tauchte Ehrhardt unter und gründete zusammen mit seinen wichtigsten Offizieren die Organisation Consul. Deren Schattenexistenz wurde durch die Gründung von Tarnfirmen, die Verwendung falscher Adressen und geheimer Codewörter ermöglicht. Jede Form von Verrat unter den Mitgliedern der Organisation wurde mit dem Tod bestraft. Ihr Katz-und-Maus-Spiel mit dem Staat wurde durch ihre zahlreichen Sympathisanten in Polizei und Justiz erleichtert. Obwohl er ein Hauptakteur des Kapp-Putsches war, wurde Ehrhardt erst im November 1922 verhaftet – nach zweieinhalbjähriger Fahndung. Im Sommer 1923 floh er aus dem Gefängnis.10
Die Führung der Organisation Consul hatte die Hoffnung, dass ihr geheimes, schwer bewaffnetes Netzwerk ans Licht der Öffentlichkeit treten könne, sobald die Zeit reif sei, um entweder gegen die Staatsführung zu kämpfen und die Republik zu stürzen, oder um sich mit der geschwächten Reichswehr zu vereinen und die Niederlage vom November 1918 zu rächen. Im August 1921 verübte die Organisation ihren ersten hochkarätigen Mord: Zwei ehemalige Mitglieder der Marine-Brigaden lauerten dem einstigen deutschen Finanzminister Matthias Erzberger auf, der den Waffenstillstand vom 11. November 1918 unterschrieben und für die Annahme des Versailler Friedensvertrags plädiert hatte, und ermordeten ihn, während er im Urlaub in Südwestdeutschland im Wald spazieren ging. Anfang 1922 unternahmen Kern und Fischer ihre erste gemeinsame, wagemutige Terroroperation: Sie führten ein Kommando an, um die ehemaligen U-Boot-Offiziere Ludwig Dithmar und John Boldt aus dem Gefängnis in Leipzig zu befreien.11
Im Sommer 1922 plante die Organisation Consul, eine Serie hochkarätiger Attentate auszuführen. Ihre Gewaltbereitschaft entbehrte nicht einer gewissen Logik: Durch die Morde an Politikern, die symbolisch für die neue deutsche Demokratie standen, hoffte sie die Arbeiterklasse zu einem Aufstand zu provozieren; das darauffolgende Chaos sollte ihr eine weitere Chance bieten, die Republik zu stürzen. Am 4. Juni hätten zwei ihrer Mitglieder um ein Haar Philipp Scheidemann umgebracht, einen der prominentesten sozialdemokratischen Politiker der frühen Weimarer Republik. Scheidemann ging gerade mit seiner Tochter spazieren, als die beiden Männer sich plötzlich auf ihn stürzten und ihn mit Giftgas besprühten. Der 57-Jährige zog geistesgegenwärtig seine Pistole und schoss auf die Angreifer. Die Schüsse gingen fehl, aber der Anblick der Waffe reichte aus, um sie zu vertreiben. Durch das Giftgas verlor Scheidemann das Bewusstsein und erkrankte schwer, erholte sich aber wieder vollständig. Das Scheitern dieses Anschlags erhöhte nicht einmal drei Wochen später den Druck auf Kern und Fischer: Die Führung der Organisation Consul konnte einen weiteren Fehlschlag nicht dulden.12
Am 23. Juni traf sich die innere Zelle aus Kern, Fischer und Techow in einem sicheren Haus in Berlin-Schmargendorf, das Richard Schütt gehörte. Bei ihnen waren Techows 17-jähriger Bruder Hans Gerd, der noch zur Schule ging, sowie dessen Schulfreund Willi Günther, der ihnen bei der Suche nach diesem Ort nicht weit von Rathenaus Villa geholfen hatte. Am nächsten Morgen stand Ernst Werner Techow früh auf. Er erklärte später, der große sechssitzige Mercedes, den sie für den Anschlag geliehen hatten, habe Probleme gemacht und er habe mehrere Stunden unter der Motorhaube werkeln müssen. Die Zeit lief ihnen davon. Gegen 10 Uhr waren sie noch nicht einmal sicher, ob sie an dem Tag überhaupt losfahren konnten. Aber kurz vor 10.30 Uhr war Techow endlich für die Abfahrt bereit. Zuvor versteckte Günther die Maschinenpistole im Wagen, während Fischer gefälschte Nummernschilder anbrachte. Techow und Günther fuhren das Auto aus der Garage, unterdessen gingen Fischer und Kern unauffällig ein paar Schritte zu Fuß, um in der Nähe zuzusteigen. Günthers Job als Tarnung war damit erledigt. Sobald sie ihre Plätze auf dem Rücksitz des Mercedes eingenommen hatten, zogen sie lange nagelneue Ledermäntel an und setzten sich Lederkappen auf, die nur noch das Oval ihres Gesichts freiließen – wie sie die Rennfahrer in den Zwanzigerjahren trugen.
Wenige Minuten nach dem Verlassen ihres Verstecks bogen sie in eine Seitenstraße nicht weit von Rathenaus Villa ein. Dort warteten sie, den Blick fest auf die Königsallee gerichtet. Wenn ihr Plan funktionierte, musste Rathenau auf seiner Route an ihnen vorbeifahren. Und dann, in Sekundenschnelle, war es so weit. Josef Prozeller fuhr mit dem dunkelgrauen Cabriolet vorbei. Wie üblich saß Rathenau hinten links auf der Rückbank. Er rauchte seine Morgenzigarre. Techow nahm die Verfolgung auf.
Eine Gruppe Bauarbeiter und der örtliche Postbote hatten die beste Sicht auf die folgenden Ereignisse. Sie bemerkten einen langsam fahrenden Wagen mitten auf der Straße, gefolgt von einem großen Sechssitzer, der aufholte. Beide hatten das Verdeck offen. Als der erste Wagen wegen einer Kurve langsamer fuhr, heulte der Motor des zweiten Wagens plötzlich auf, als dieser zum Überholen ansetzte. Dann schien die Zeit stillzustehen. Der Mann, der im Mercedes hinten saß, stand auf und eröffnete das Feuer auf Rathenau. Es war Erwin Kern. Als er sich setzte, sprang Fischer auf und warf die Handgranate, die im Fond des Ministerwagens explodierte.
Unmittelbar nach der Detonation trat Techow aufs Gaspedal, und ihre Flucht begann. Die Attentäter hatten keinen Grund zur Panik. Es kam zu keiner Verfolgungsjagd. Einige Zeugen waren dem Wagen nachgelaufen, um zu sehen, in welche Richtung er fuhr, aber wegen der kurvenreichen Straße gelang es keinem, das Fluchtauto im Blick zu behalten. Kern und Fischer zogen die Ledermäntel aus und warfen die Mordwaffe weg. »Wir haben Rathenau erschossen!«, triumphierten sie. Dann setzte Techow sie am Hohenzollerndamm ab, von wo aus sie in die Stadtmitte fuhren. Techow fuhr zur Garage zurück, wo er das Auto versteckte. Euphorisch teilte er dem dort wartenden Willi Günther mit: »Die Sache hat geklappt, Rathenau liegt.«13
Am selben Nachmittag fuhr Techow zum Berliner Zoologischen Garten, um sich mit Kern und Fischer zu treffen. Nur wenige Stunden nach dem Mord am deutschen Außenminister schlenderten die drei gemächlich durch den Zoo. In der kommenden Nacht blieben sie bei Kerns Tante in Berlin-Steglitz. Am 26. Juni trafen sie sich zum Rudern auf dem Wannsee, und am 27. verließen sie die deutsche Hauptstadt.
Unterdessen war eine der größten polizeilichen Ermittlungen in der Geschichte Berlins angelaufen. Nur eine Stunde nach den Schüssen war Polizeichef Bernhard Weiß am Schauplatz des Attentats eingetroffen, begleitet von einer Schar Kriminalbeamter. Bei der Jagd nach den Mördern wurden keine Kosten gescheut. Eine Belohnung in Höhe von 1 Million Mark wurde für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Es gab nur ein Problem: Im Gegensatz zu heutigen Terrorgruppen gab die Organisation Consul keine Erklärungen ab, in denen sie für ihre Anschläge die Verantwortung übernahm. Trotz der vielen Zeugen wusste man anfangs nicht mehr über die Verdächtigen, als dass es sich um drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handelte, die eine »graue Uniform« trugen. Während die Polizei den zahllosen falschen Hinweisen nachging, die bei ihr eintrafen, blieb das Auto in der Garage versteckt. In den folgenden Tagen sah es ganz so aus, als würden Techow, Fischer und Kern mit einem der spektakulärsten politischen Morde der Zwanzigerjahre davonkommen.14
Doch am 26. Juni teilte ein Student der Polizei mit, er habe gehört, wie sich ein junger Mann in Berlin vor einer Gruppe von Studenten des Mordes an Rathenau gebrüstet habe. Die Polizei nahm den Hinweis ernst: Sie machten den Teenager ausfindig und verhafteten ihn. Es war Willi Günther. Unter den Fragen der Polizei brach er zusammen und legte ein Geständnis ab. Die Ermittlung feierte ihren ersten und wichtigsten Durchbruch. Weiß und sein Team kannten jetzt die Identitäten der Mörder. Am 27. Juni spürten sie das Fluchtauto auf und verhafteten Techows jüngeren Bruder Hans Gerd. Zunächst hielten sie diese sensationelle Nachricht geheim, weil sie noch hofften, Techow, Kern und Fischer in einem Versteck in Berlin aufzuspüren. Aber als sie sicher waren, dass die Hauptverdächtigen die Hauptstadt verlassen hatten, veröffentlichten sie flächendeckend Fahndungsplakate. Am 28. Juni waren in ganz Deutschland die Namen der Täter zu lesen. Sie waren die meistgesuchten Personen des Landes.15
Techows Onkel, der Industrielle Erwin Behrens, war in deutschen Wirtschaftskreisen bestens vernetzt. Einen Tag bevor die Namen öffentlich bekannt gegeben wurden, war Techow auf dem Gut von Behrens in der Nähe von Frankfurt an der Oder aufgetaucht, gut 80 Kilometer östlich von Berlin. Als Behrens den Namen seines Neffen in der Zeitung las, rief er diskret die Polizei an. Obwohl sein Neffe ein Hauptverdächtiger für ein Verbrechen war, für das er die Todesstrafe bekommen konnte, lieferte der Onkel ihn aus. Behrens selbst erklärte später, er sei »kolossal erschüttert« gewesen, als er gehört habe, dass Rathenau ermordet worden sei. Er habe sogar erwogen, seinem Neffen eine Pistole in die Hand zu drücken und ihn aufzufordern, sich im nahegelegenen Wald zu erschießen.16
Es folgten weitere Verhaftungen. Von der ursprünglichen Gruppe, die den drei jungen Männern bei der Ausübung des Attentats geholfen hatte, waren binnen weniger Wochen so gut wie alle verhaftet – bis auf Kern und Fischer. Sie waren jetzt auf sich gestellt, versteckten sich in Norddeutschland und suchten nach einem Weg, um von Mitgliedern aus Ehrhardts Netzwerk Hilfe zu bekommen, waren aber unsicher, wer sie womöglich verraten würde. Als sie am 7. Juli unter falschem Namen in einem Gasthaus in Lenzen, einer Kleinstadt an der Elbe, ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg, gemeldet waren, erhielt die Polizei einen Tipp, dass die Rathenau-Mörder in der Stadt gesehen worden seien. Während Polizisten das Gasthaus durchsuchten, saßen Kern und Fischer gerade in der Nähe beim Essen. Sie erkannten sofort, was los war, und flüchteten auf ihren Fahrrädern, mit den Beamten auf den Fersen. In letzter Sekunde, bevor die nahe Elbfähre ablegte, sprangen sie an Bord. Für die Polizeibeamten, die sie jagten, war das Schiff bereits zu weit weg. Kern und Fischer waren entkommen. Sie wandten sich nun nach Süden, verwendeten Wanderkarten, um die Hauptverkehrsrouten zu meiden, und fuhren nur bei Nacht, während sie sich tagsüber versteckten. Ihr neues Ziel war Bayern. Wenn sie es bis dorthin schafften, das wussten sie, würden Anhänger der Organisation Consul und die Nachsicht der bayerischen Landesregierung gegenüber Rechtsextremismus ihnen beste Fluchtchancen bieten.17
Sie schafften es bis Rudelsburg an der Saale, einer Stadt in Thüringen, wo Hans Wilhelm Stein auf Burg Saaleck lebte, einer zweitürmigen Burganlage aus dem Hochmittelalter. Stein war ein engagierter Unterstützer der Organisation Consul und sehr wahrscheinlich auch selbst Mitglied. Nachdem er Kern und Fischer im bewohnbaren Teil seines Turms untergebracht hatte, fuhr er nach München, um sich mit Ehrhardts Organisation Consul in Verbindung zu setzen und ihre Flucht zu planen. Doch diesmal hatte das Glück sie verlassen. Bevor Stein aus Rudelsburg abreiste, erzählte er einigen Einheimischen, dass er wegfahre. Als diese dann ein Licht erblickten, das Kern und Fischer in dem Turm hatten brennen lassen, wunderten sie sich, wer sich wohl dort aufhalten mochte. Aus sicherer Entfernung beobachteten sie Kern und Fischer und erkannten sie dank der Fahndungsplakate. Wenig später traf die lokale Polizei am Schauplatz ein.
Dieses Mal gab es kein Entkommen. Als die Polizei auf den Burghof fuhr, verbarrikadierten sich Kern und Fischer im Turm. Der folgende Schusswechsel war vorüber, ehe er richtig begonnen hatte. Ein Polizist zielte auf das höchste Turmfenster, wo Kern in der Absicht stand, auf die Beamten unten im Hof zu schießen. Der Polizist gab fünf Schüsse ab, einer davon traf Kern in den Kopf, sodass er nach hinten fiel und stark blutete. Fischer versuchte panisch, seinen Freund zu retten, aber er konnte nichts tun. Kern war tot. Während die Polizei draußen in Deckung ging, trug Fischer den Leichnam seines Freundes zu einem der beiden Betten, in denen sie geschlafen hatten. Dann legte er sich in das zweite. Er hielt die Pistole in der Hand, richtete sie auf sich und beging Selbstmord.18
Kern und Fischer wurden später Seite an Seite auf einem nahegelegenen Friedhof begraben. Kerns Sarg wurde in die Fahne der kaiserlichen Kriegsmarine gehüllt und Fischers in die schwarz-weiß-rote Fahne des ehemaligen Kaiserreichs. Kerns Mutter sang das »Ehrhardt-Lied«, das mit dem Refrain »Raus mit den Juden« endete. An ihrem Todestag im Jahr 1933 wurden die Gräber geöffnet und die Särge an eine neu errichtete Ruhestätte im Zentrum des Friedhofs verlegt. Als sie in die Erde hinabgelassen wurden, waren sie diesmal von einer einzigen Fahne bedeckt: der Hakenkreuzfahne. Heinrich Himmler, Ernst Röhm und Ehrhardt waren unter den anwesenden Trauergästen. Kerns Schwester beschrieb die Trauerfeier später als »unvergesslich«.19
Im Jahr 1898 war Walther Rathenau in den Vorstand der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) aufgenommen worden, die sein Vater 1883 gegründet hatte. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 stieg er in dem Unternehmen zu einer einflussreichen Führungsperson auf, hatte sich aber auch als versierter Schriftsteller und Künstler einen Namen gemacht. Er besaß einen einzigartigen Verstand: Er diskutierte ebenso ungezwungen über Schaltkreistechnik oder die für die Leitung großer Organisationen erforderlichen Strukturen, wie er sich mit philosophischen Fragen über die wahre Natur des menschlichen Daseins auseinandersetzte. Ungeachtet seiner liberalen Haltung war Rathenaus nationale Gesinnung untadelig. Im Krieg sorgte er dafür, dass die AEG nach den Krupp-Werken zum zweitgrößten Rüstungsbetrieb aufstieg. Aber nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1915 wollte er mehr tun, als nur Granaten zu produzieren. Er hielt es für seine Pflicht, mithilfe der gleichen organisatorischen Grundsätze, die die AEG leiteten, die deutsche Kriegswirtschaft effizienter zu machen. Seiner Meinung nach stellten deutsche Fabriken aufgrund von Missmanagement nicht genügend Waren her; zugleich beobachtete er entsetzt, dass die staatlich kontrollierte Lebensmittelversorgung immer wieder zusammenbrach. Er war überzeugt, dass diese Probleme durch bessere Organisation gelöst werden konnten. Wegen seiner Ideen geriet er mit den politischen und militärischen Führern in Konflikt, von denen viele aus dem traditionellen Landadel kamen und nur über beschränkte industrielle Kenntnisse sowie für die Leitung großer Organisationen ungeeignete Erfahrungen verfügten. Doch sie wollten nicht auf ihn hören. Für sie war Rathenau nicht nur ein Emporkömmling, dessen vom Vater gegründetes Unternehmen ihm Macht verlieh, die er eigentlich nicht verdient hatte – er war Jude. Und als solcher wurde er, obwohl er seine Religion nie praktizierte, von vielen Mitgliedern der traditionellen herrschenden Klasse Deutschlands mit Misstrauen beäugt.20
Anfang Oktober 1918 reagierte Rathenau mit Bestürzung auf die Nachricht, dass Erich Ludendorff, der allmächtige General, der seit 1916 für die deutsche Kriegspolitik und Strategie zuständig war, vertraulich einem kleinen Kreis politischer und militärischer Führer, darunter auch Kaiser Wilhelm II., mitgeteilt habe, dass der Krieg verloren sei und Deutschland einen sofortigen Waffenstillstand brauche, um einen Zusammenbruch des Heeres und eine Hinwendung zum Bolschewismus zu verhindern. Rathenau startete sofort eine öffentliche Kampagne, um die Absetzung Ludendorffs zu erreichen. Hinter den Kulissen beschwor er die politische Führung, dass die deutsche Wirtschaft selbst in dieser späten Phase des Krieges mit den richtigen Reformmaßnahmen imstande sei, die Lage zu meistern und den Kampf fortzusetzen, wie lange auch immer dies nötig sei. Er forderte die Regierung auf, den diplomatischen Notenwechsel mit US-Präsident Woodrow Wilson zu beenden und zu erklären, dass Deutschland bereit sei weiterzukämpfen. Für einen deutschen Juden war das ein mutiger Schritt: Indem er öffentlich forderte, dass der Kaiser die wichtigste Führungsfigur der Kriegszeit austauschte, weil sie die Nerven verloren habe, deutete Rathenau unverhohlen an, dass die Kriegspropaganda, die die deutschen Generäle als unfehlbare Genies präsentierte, falsch sei. Es ist wohl eine der bittersten Ironien der Geschichte, dass ausgerechnet dieser Mann, der sich im Oktober 1918 wie kaum ein anderer dafür eingesetzt hatte, den Krieg fortzusetzen, keine vier Jahre später von einer Gruppe radikalisierter junger Männer ermordet wurde, die glaubten, man habe damals der deutschen Armee einen Dolch in den Rücken gestoßen.21
Am 10. Mai 1921 übernahm Joseph Wirth nach dem Rücktritt Constantin Fehrenbachs das Amt des deutschen Kanzlers. Er war der fünfte Kanzler der Weimarer Republik und das zweite Mitglied des katholischen Zentrums auf diesem Posten. Der Regierungswechsel war durch eine Ankündigung seitens der siegreichen Alliierten ausgelöst worden. Sie hatten die Reichsregierung wissen lassen, dass sie sich endgültig auf die Summe geeinigt hatten, die Deutschland als Reparationen für den Ersten Weltkrieg zahlen sollte: Der Betrag war auf 132 Milliarden Goldmark festgelegt worden, und der deutschen Regierung wurde mitgeteilt, dass sie binnen 25 Tagen die erste Hälfte des Jahreszinses in Höhe von 2 Milliarden Goldmark zu überweisen habe.22 Das sogenannte Londoner Ultimatum schockierte ganz Deutschland. Inmitten eines nationalen Aufschreis der Empörung trat Fehrenbach, statt die Bedingungen anzunehmen, zurück. Wer immer ihm nachfolgen würde, hatte zwei Möglichkeiten: den Hetzparolen der nationalistischen Rechten nachzugeben und zu verlangen, dass die Alliierten ihre Forderungen mit militärischer Gewalt durchsetzen, oder zu versuchen, mit diplomatischen und politischen Mitteln längerfristig bessere Konditionen auszuhandeln. Wirth entschied sich für Letzteres. Die Strategie, nach der er handelte, wurde bald als »Erfüllungspolitik« bekannt. Sie beruhte auf der Idee, dass der beste Weg, von den Alliierten Zugeständnisse zu erhalten, darin bestehe, deren Forderungen so weit wie möglich nachzukommen und dabei gleichzeitig den Nachweis zu erbringen, dass die Forderungen selbst unsinnig waren. Man hoffte, diese Bereitschaft zur Kooperation werde Deutschland im Ausland Sympathien einbringen und am Ende zu einer neuen Friedensregelung führen, welche die in Versailles geschaffene Ordnung ablösen würde. Über ein Jahr lang hielt sich Wirths Regierung an diesen Kurs, weshalb sie sich scharfer Kritik seitens der deutschen Rechten ausgesetzt sah, ohne nennenswerte Vorteile zu erzielen.23
Angesichts dieser gewaltigen Herausforderungen war sich Wirth – im Gegensatz zu den wichtigsten politischen und militärischen Entscheidungsträgern des späten Kaiserreichs, die Rathenau wegen seiner Religion ausgeschlossen hatten – darüber im Klaren, dass er die begabtesten Führer an Bord brauchte, wenn seine Regierung Erfolg haben wollte. Er überredete Rathenau persönlich, dem Leben als millionenschwerer Industrieller den Rücken zu kehren und gemeinsam mit ihm an vorderster Front die Regierungspolitik zu gestalten. Bei ihrer ersten Begegnung bat sich Rathenau einige Tage Bedenkzeit aus. Er war sich über die antisemitische Gegenreaktion, die ihn erwartete, völlig im Klaren und bezeichnete die Entscheidung als den »schwerste[n] Entschluss« seines Lebens. Aber am Ende war sein Pflichtgefühl viel zu groß, um abzulehnen.24 Von Mai bis Oktober 1921 war er Wirths Minister für den Wiederaufbau, und im Januar 1922, nach einer weiteren Kabinettsumbildung, übernahm er den Posten des Außenministers. Er war einer von nur zwei deutschen Juden, die in der Weimarer Republik ein Ministeramt innehatten, und der einzige deutsche Jude jemals im Amt des Außenministers.
Die Regierung Wirth stand vor gewaltigen Herausforderungen. Die Schlachten des Ersten Weltkriegs hatten auf französischem Boden die größten Zerstörungen angerichtet: Nach dem Krieg waren die zehn reichsten Regionen Frankreichs, ein Gebiet ungefähr von der Größe der Niederlande, komplett verwüstet. Liberal gesinnte Deutsche wie Rathenau akzeptierten den Grundsatz, dass Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, einen Beitrag zu den Kosten für den Wiederaufbau diese Gebiete leisten sollte. Doch in Frankreich und anderswo, auch in Teilen der britischen Elite, forderten viele nachdrücklich, dass Deutschland für die Gesamtkosten des Krieges aufkommen müsse, einschließlich der Pensionen von Millionen Soldaten und aller Darlehen, die man zur Finanzierung der Kämpfe aufgenommen hatte. Aus diesem Grund enthielt der Versailler Vertrag den berüchtigten Artikel 231 – eine Klausel, die die gesamte Verantwortung für den Ausbruch des Krieges dem deutschen Kaiserreich zuschob; sie wurde aufgenommen, um zu gewährleisten, dass es eine Rechtsgrundlage dafür gab, Deutschland zur Kasse zu bitten.25
Seit Sommer 1919 führten die scheinbar endlosen Auseinandersetzungen, die das Problem der Reparationen ausgelöst hatte, zu einer Reihe gescheiterter Initiativen, erfolgloser internationaler Konferenzen und hitziger gegenseitiger Schuldzuweisungen. Zwischen 1921 und 1924 gab es sage und schreibe 15 interalliierte Konferenzen und weitere zehn Konferenzen zwischen Deutschland und den Siegermächten, um die Reparationsfrage zu lösen. Die Teilnehmer bemühten sich, einen für alle Seiten akzeptablen Konsens in den Fragen zu finden, die den Kern des Reparationsproblems ausmachten: Wie hoch waren die tatsächlichen Kriegskosten? Wie viel und wie schnell konnte Deutschland wirklich zahlen? Wie sollten die deutschen Zahlungen unter den siegreichen Verbündeten aufgeteilt werden? Welche Strafe drohte Deutschland, falls es mit den vorgesehenen Zahlungen in Rückstand geriet oder diese ganz ausblieben? Und würden die Deutschen bewusst ihre Volkswirtschaft schwächen, um Reparationszahlungen zu vermeiden?
Auf seinem ersten Posten als Minister für den Wiederaufbau versuchte Rathenau im Jahr 1921, das Problem der Reparationen zu lösen, indem er sich der damals neuen Idee einer französisch-deutschen Kooperation zuwandte. Unter Umgehung von London, so glaubte er, könnten Paris und Berlin zu einer Einigung gelangen, die zu einer neuen Ära europäischer Stabilität führen werde. Sein Plan war einfach: Deutschland würde lediglich für den Wiederaufbau der Gebiete Frankreichs und Belgiens zahlen, die im Krieg verwüstet worden waren; deutsche Unternehmen würden bei deren Wiederherstellung helfen. Sie sollten die Grenze nach Frankreich überschreiten, um Straßen und Brücken zu restaurieren, die Stromversorgung wiederherzustellen und die verwüsteten Regionen wieder für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Am Ende dieses Prozesses wären Frankreich und Belgien wiederaufgebaut, Deutschland wäre ein wichtiger Partner geworden, und Europa würde gestärkt daraus hervorgehen.
Die Idee funktionierte nicht. Französische Unternehmen fürchteten um ihre Gewinne, wenn sie sich den Wiederaufbau mit deutschen Konkurrenten würden teilen müssen, und die britische Regierung unter Premierminister David Lloyd George war entsetzt. Wenn man zuließ, dass eine solche französisch-deutsche Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt war, bestand die Gefahr, dass sich Paris von London abwenden und es zu einer französisch-deutschen Allianz kommen würde, durch die Großbritannien seinen Einfluss auf die Entscheidungen Kontinentaleuropas verlieren würde. Auch innerhalb Deutschlands regte sich Widerstand. Hugo Stinnes, der wohl wichtigste deutsche Industrielle, war gegen den Vorschlag, obwohl er später, in der zweiten Hälfte des Jahres 1922, seinen beträchtlichen Einfluss als Politiker und Lobbyist geltend machte, um zentrale Bestandteile des Vorhabens zu übernehmen. So blieb Rathenaus erster Versöhnungsversuch vergebens, obwohl er und sein französischer Kollege Louis Loucheur im Sommer 1921 in Wiesbaden schon so weit waren, eine Reihe französisch-deutscher Abkommen zu unterzeichnen. Aber es waren Initiativen wie diese, derentwegen Rathenau als einer der visionärsten europäischen Politiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausragte. Doch es gelang ihm in seinem letzten Lebensjahr nicht, genügend Europäer zu überzeugen, sich auf eine Zusammenarbeit mit ihm einzulassen.
Am Nachmittag des 23. Juni 1922, nur wenige Stunden vor seiner Ermordung, mussten Rathenau und Wirth im Reichstag eine Tirade von Karl Theodor Helfferich über sich ergehen lassen, dem Anführer der konservativ-nationalistischen und antisemitischen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP). Er behauptete, sie würden eine Spur des Elends und des Selbstmords hinterlassen, und forderte, sie wegen Hochverrats vor Gericht zu stellen. Vor allem schoss er sich auf Rathenau ein und warf ihm die Zerschlagung des deutschen Mittelstands und die Entwertung der Währung sowie etliche weitere »Verbrechen« vor. Während er sprach, kam es zu tumultartigen Szenen. Seine Anhänger jubelten ihm zu, seine Gegner der politischen Linken und des Zentrums beschimpften ihn lautstark. Auf der Pressegalerie hatte der Journalist Erich Dombrowski, später Mitbegründer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den Eindruck, der Reichstag sei »ein Tollhaus« geworden. Er fragte sich, ob es nicht besser wäre, wenn sämtliche Reichstagsabgeordneten für die Dauer eines solchen Spektakels einfach den Saal verließen – sodass Helfferich seine Hetzreden an sich selbst richten würde. Aber Helfferich bekam das gewünschte Publikum. Als die Sitzung am frühen Abend geschlossen wurde, feierten die Zeitungen der politischen Rechten bereits seine Heldentat. Die Blätter der Linken nannten ihn schlicht einen »Provokateur«.26
Rathenau wusste, dass Helfferich und seine konservativen Verbündeten gefährliche Demagogen waren, die sich in den Mantel konservativer Seriosität hüllten. Als prominentester deutscher Jude war er sich völlig darüber im Klaren, wie Antisemitismus funktionierte. Ende 1921 führte er das Scheitern der Wiesbadener Abkommen nicht zuletzt auf die populistische Taktik zurück, mithilfe von Falschinformationen die Gegner der Regierung zu mobilisieren. Er mahnte, dass die Art und Weise, in der die Populisten immer wieder mit Falschmeldungen und Lügen auf die weniger gebildeten Schichten der Gesellschaft zielten, am Ende Deutschland schaden werde. Er betonte, dass Politiker die Pflicht hätten, eine zivilisierte Debatte zu führen, und warnte sie, dass sie ihre Hände nicht in Unschuld waschen könnten, falls ihr Politikstil letztlich das Land noch stärker spalten würde. Doch er wusste auch, dass er ohne die nachhaltige Unterstützung der ehemaligen Gegner Deutschlands bei der Stabilisierung der deutschen Wirtschaft wenig tun konnte, um bei Helfferichs Publikum einen Sinneswandel herbeizuführen.
Helfferichs Rede gab wenig später die Richtung vor, wie der Reichstag auf die Nachricht vom Mord an Rathenau reagierte. Nur dreißig Minuten nach der verhängnisvollen Tat erfuhren Reichstagsabgeordnete, dass Rathenau tot sei. Es kam zu wütenden Szenen, als sich die Abgeordneten gegenseitig vorwarfen, sie hätten es versäumt, die Demokratie zu verteidigen. Selbst sonst zurückhaltende Politiker erklärten, es sei an der Zeit, mit Helfferich so umzugehen, als sei er ein »Schurke und Mörder«. Eine Zeitung meldete, ein Politiker der Rechten habe einen »Eichenlaubstrauß mit Bändern in den Farben des deutschen Kaiserreichs«27 in den Sitzungssaal gebracht. Auf den Bändern stand: »Herrn Helfferich, dem Verteidiger deutscher Ehre.«28
Führende liberale Journalisten gaben alsbald Helfferich die Schuld an dem Mord. Georg Bernhard, der Chefredakteur der Vossischen Zeitung, bezeichnete ihn als »das Unglück Deutschlands« und den »unangenehmste[n] Typ der deutschnationalen Demagogie«.29 Theodor Wolff, der Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts und einer der scharfsinnigsten Beobachter des politischen Lebens im Deutschland der Zwanzigerjahre, pflichtete ihm bei: »Wir klagen ungern dort, wo die Tat eines einzelnen vorliegt, ganze Kreise an, aber hier ist die Schuld so klar, die Verantwortung so offenkundig, dass es unmöglich ist, nicht Anklage zu erheben und die krass hervortretende Wahrheit zu verwischen.« Wolff warnte, dass die große Mehrheit der Bevölkerung keine Ahnung davon habe, wie vergiftet die Atmosphäre unter antidemokratischen nationalistischen Gruppierungen inzwischen geworden sei. Vor allem regte er sich über Politiker und Journalisten der Rechten auf und beschuldigte sie, gemeinsame Sache mit den Demagogen zu machen, »weil die gewissenlose Aufpeitschung eines blinden Pöbels ihren Parteizwecken förderlich erscheint«.30
Als kurz nach 15 Uhr die Parlamentssitzung schließlich begann, lag auf Rathenaus Stuhl ein Strauß weißer Rosen. Kanzler Joseph Wirth mahnte, dass sich in ganz Deutschland ein schreckliches Gift ausgebreitet habe.31 Der Mord an Rathenau sei nicht nur ein politisches Attentat; er sei ein Anschlag auf die Republik: »Zuerst sollen die Führer der Republik, dann soll die Republik selbst fallen.« Während er sprach, wurde er von Rufen unterbrochen, er werde der Nächste sein.
Noch am selben Abend tagte der Reichstag erneut. Präsident Friedrich Ebert war entschlossen, das in der Verfassung verankerte Notverordnungsrecht zum Schutz der Republik anzuwenden. Mit einer Präsidialverordnung untersagte er antirepublikanische Aktivitäten, einschließlich Versammlungen und Vereinigungen, und führte neue Geldbußen und Haftstrafen für jeden ein, der die Republik beleidigte oder deren Symbole beschimpfte oder schändete, darunter die schwarz-rot-goldene Fahne der Republik, die für rechte Nationalisten ein rotes Tuch war. Auf diesen ersten Schritt folgte ein Gesetz zum Schutze der Republik, das am 21. Juli 1922 verabschiedet wurde. Es sah die Inhaftierung eines jeden vor, der sich gegen ehemalige oder amtierende Regierungsmitglieder der Republik verschwor, und rief vor allem einen neuen »Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik« ins Leben. Er bestand aus neun Mitgliedern. Drei von ihnen kamen aus dem höchsten staatlichen Gerichtshof, dem Reichsgericht, und wurden von dessen Präsidenten ernannt. Ihnen wurden weitere sechs Richter zur Seite gestellt, die vom Reichspräsidenten berufen wurden und nicht unbedingt das Richteramt ausüben mussten. Es konnte sich auch um Laien handeln, die aufgrund ihrer politischen Loyalität zur Republik ausgewählt wurden.
Diese Maßnahmen kamen einem offenen Eingeständnis gleich, dass die Justiz der Weimarer Republik bis zu diesem Zeitpunkt politisch offenkundig voreingenommen gewesen war, mit rechten, noch unter der Monarchie ernannten Richtern, die von Rechtsextremisten begangene Verbrechen ungestraft oder mit nur geringem Strafmaß durchgehen ließen. Der neue Gerichtshof sollte dem ein Ende setzen. Er besaß auch die Vollmacht, andere Behörden anzuweisen, Ermittlungen einzuleiten, oder selbst Ermittlungen aufzunehmen. Das war ein wichtiger Punkt: Während die Anhänger der Republik das Gesetz als Mindestanforderung für den Schutz der Demokratie begrüßten, bedeutete es zugleich, dass der Staatsgerichtshof in der Praxis die Souveränität der deutschen Länder beschneiden konnte, insbesondere die des Freistaats Bayern. Dessen konservative Regierung verwahrte sich unverzüglich gegen die Einmischung eines Gerichts der Republik in die Angelegenheiten der bayerischen Justiz – es war kein Zufall, dass sich das geheime Hauptquartier der Organisation Consul in München befand.32 Nur einen Tag nach Inkrafttreten der Präsidialverordnung sagte ein kommunistischer Reichstagsabgeordneter voraus: »Es wird dieser schwachen Regierung nicht gelingen, in Bayern ihre Verordnung durchzusetzen.«33 Er kritisierte die Regierung für ihre Reaktion auf den Mord an Rathenau und wies darauf hin, dass man nicht einmal ein Jahr zuvor nach dem Mord an Matthias Erzberger bereits ähnliche Reden vernommen habe: »Man hat alle diese Worte schon zum Kotzen genug gehört. Es wird höchste Zeit, dass einmal Handlungen beginnen. Mit Worten schreckt man die Banditen nicht. Dieser Bestie muss man die Zähne zeigen, dass man bereit ist, sie zu zermalmen, sonst wird sie nicht zurückschrecken.«34
Im Tod hatte Rathenau das erreicht, was ihm im Leben verwehrt blieb: Er wurde als ein großer Deutscher gewürdigt.35 Am Tag nach seinem Tod marschierten gewaltige Menschenmengen in Richtung Berlin Mitte und demonstrierten auf dem großen Platz vor dem Reichstag. Die größten Protestversammlungen fanden am 27. Juni statt, parallel zu einer aufwendig gestalteten Trauerfeier, die im Innern des Reichstagsgebäudes abgehalten wurde.36 Der mächtige Deutsche Gewerkschaftsbund ADGB rief zu einem landesweiten halbtägigen Streik auf, damit die Arbeiter an öffentlichen Trauerfeiern teilnehmen und ihre Unterstützung für die Republik unter Beweis stellen konnten. Im Ruhrgebiet, wo die Schichten der Bergarbeiter einen halbtägigen Streik nicht zuließen, legten die Kumpel ihre Arbeit für 24 Stunden nieder.37 Den Arbeitern schlossen sich Beschäftigte der preußischen und deutschen Regierung an, die ebenfalls angewiesen wurden, den traurigen Anlass zu würdigen – ein seltener Moment in einer Gesellschaft, die unter der Kluft zwischen der organisierten Arbeiterschaft und dem Staat litt. Neben den drei großen Parteien der Linken, der Sozialdemokratischen Partei (SPD), der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) und der Kommunistischen Partei (KPD), rief auch Rathenaus Partei, die mittelständische Deutsche Demokratische Partei (DDP), ihre Anhänger auf die Straßen.38 Von den großen pro-republikanischen Parteien schloss sich lediglich Wirths katholische Zentrumspartei nicht den Protestaufrufen an.
Es ist schwer mit Gewissheit zu sagen, wie viele Menschen an diesen gewaltigen Kundgebungen teilnahmen. Rückblickend schätzte Harry Graf Kessler, Autor, Diplomat und einer der ersten Biografen Rathenaus, Ende der Zwanzigerjahre, dass allein in Berlin mehr als eine Million Menschen auf den Straßen waren.39 Möglicherweise war das übertrieben, aber die historische Bedeutung dieser Kundgebungen steht außer Zweifel: Es war eine der größten pro-republikanischen Demonstrationen der Weimarer Republik. Dieser Rückhalt verschaffte Ebert und Wirth die nötige Autorität, um die Republik zu verteidigen und ihr Ansehen wiederherzustellen. Vermutlich war die Unterstützung für die Republik unmittelbar nach dem Rathenau-Mord der Höhepunkt der republikanischen politischen Macht in den Zwanzigerjahren.
Trotz strömenden Regens drängten sich in Berlin die Menschenmengen um das Reichstagsgebäude, wo Rathenaus Sarg in den Sitzungssaal gebracht und auf der Empore aufgebahrt wurde. Der ganze Saal war ringsum mit schwarzem Tuch und Kränzen mit schwarz-rot-goldenen Schleifen geschmückt. Die Reichswehr hielt die Ehrenparade ab, und das Orchester der Staatsoper spielte die Musik.40 Die Zeremonie begann mit der Ouvertüre aus Beethovens »Coriolan«. Präsident Ebert sprach im Namen der deutschen Nation. Neben Rathenaus Sarg stehend beklagte er den Verlust eines der fähigsten deutschen Staatsdiener: »Die Kugeln feiger Mordgesellen haben ihn aus diesem Wege herausgeschleudert. Aber die verruchte Tat traf nicht den Menschen Rathenau allein, sie trifft Deutschland in seiner Gesamtheit. Gerichtet war die Bluttat gegen die deutsche Republik und gegen den Gedanken der Demokratie, deren überzeugter Vorkämpfer und Verfechter Dr. Walther Rathenau war.« Die Mörder, so Ebert, stünden »außerhalb der Gemeinschaft des deutschen Volkes«.
Adolf Korell sprach im Namen der DDP. Seine Worte und die öffentliche Anteilnahme für Rathenau ließen darauf schließen, dass die Republik im Begriff war, sich endlich vom Antisemitismus der politischen Rechten abzuwenden und zu akzeptieren, dass die deutschen Juden zur deutschen Nation gehörten: »Rathenau ist auch als Jude gefallen und damit ein Opfer jener sogenannten Idee von der völkischen Reinheit geworden. Lassen Sie uns vor dem Sarge Rathenaus geloben, endlich einmal zu verzichten auf das Wort ›national‹, wenn damit nur die Partei gestärkt werden soll. […] Willig reichen wir allen denen die Hände, die die deutsche Republik schützen und aufbauen wollen.«
Das Begräbnis war eine Demonstration der politischen Loyalität zur Republik. Es bot konservativen Organisationen wie der Reichswehr, die es versäumt hatte, beim Kapp-Putsch im März 1920 in Berlin ihre Loyalität zur Demokratie zu zeigen, eine Chance zu beweisen, dass auch sie die Republik schützen und sich an deren Zeremoniellen beteiligen würden. Es war eine Bestätigung der Befugnis der republikanischen Machthaber, Deutschland unangefochten durch die antidemokratischen Kräfte der politischen Rechten zu regieren. Es war ein Moment, in dem die Mörder und Antisemiten als außerhalb der deutschen Nation stehend verurteilt werden konnten. Auch jenseits der Berliner Stadtgrenzen demonstrierten unzählige Deutsche im ganzen Land. In den Augen der Repräsentanten der größten politischen Parteien gehörten die Hintermänner des Mordanschlags und jene, die sie unterstützt hatten, dem schlimmsten Teil der Vergangenheit des Landes an und hatten in dessen demokratischer Zukunft keinen Platz.
Helfferichs DNVP gab eine Stellungnahme ab, die entschieden alle Versuche zurückwies, ihre Mitglieder mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Dies seien »unerhörte, unbewiesene und nie beweisbare Beschuldigungen und Verleumdungen gegen unsere Partei, unsere Führer, Mitglieder und Anhänger«. Die Parteiführung erklärte, dass sie nichts mit Verbrechern und »Mordbuben« zu tun habe und beabsichtige, ihre Ziele auf legalem Wege zu erreichen. »Wir verlangen darum auch von der Regierung, dass sie unsere Partei und die in ihr vereinten Millionen deutscher Wähler und Wählerinnen gegen verlogene und hasserfüllte Verleumdungen deckt, dass sie aber auch den Schein vermeidet, als ob sie sich solche Verdächtigung selbst zu eigen machen wollte. Für diesen selbstverständlichen Schutz der staatsbürgerlichen Ehre unserer Mitglieder und Anhänger wird die Partei mit aller Entschiedenheit eintreten.«41
Die radikale Rechte beschränkte sich keineswegs darauf, jede Verantwortung für das Verbrechen abzustreiten. Es war nicht schwer, Menschen zu finden, die sich über die Nachricht von Rathenaus Tod freuten. Der Direktor des Telegrafenamts in Berlin-Moabit gab den Mord mit folgenden Worten bekannt: »Heute mittag gibt’s Judenbrägen, meine Damen, Rathenau ist im Grunewald ermordet.« In München hängte die Dienststelle der NSDAP ein Banner auf, das später von der Polizei entfernt wurde. Darauf stand: »Rathenau war Außenminister. Leider ist er tot. Ebert und Scheidemann leben noch!«42 Indem sie die Beteuerungen der DNVP, durch die Reaktionen auf den Mordanschlag sei ihre Ehre verletzt worden, wiederholten, stellten manche Gegner der Weimarer Demokratie die Ereignisse gar auf den Kopf und behaupteten, Deutschlands Konservative seien nunmehr in Gefahr. Die Rheinisch-Westfälische Zeitung argumentierte, dass doch nichts weiter passiert sei, als dass ein »Minister, dessen Geschäftsführung zu bitteren Klagen Anlass gab, von einem unbekannten Manne ermordet wurde«.43 Ernst Graf zu Reventlow, ein führender antisemitischer Publizist der Weimarer Republik, behauptete sogar, die Reaktion auf den Mord beweise, dass hier gezielt versucht werde, dieses Ereignis dazu zu nutzen, »den deutschen Kampf gegen das Judentum mit Gewalt zu ersticken«.44
In der Weimarer Republik waren rund ein Prozent der Bevölkerung Juden. Die Organisationen, die sie repräsentierten, taten ihr Bestes, Beispiele für fanatischen Antisemitismus zu dokumentieren. Nur zwei Wochen nach dem Rathenau-Mord merkte ein Artikel in einer der wichtigsten jüdischen Zeitungen lakonisch an, dass man es satthabe, ständig hören zu müssen, die Warnungen vor den Gefahren, denen die Juden ausgesetzt waren, seien übertrieben: »Wie oft hieß es: ›Ihr malt zu schwarz! Es ist nur halb so schlimm‹.«45 Erst nach dem Mord an Rathenau wurde selbst den optimistischsten Kommentatoren klar, dass der Antisemitismus seit dem Ende des Ersten Weltkriegs drastisch zugenommen hatte. Zu den Beispielen, die dokumentiert wurden, zählten antisemitische Äußerungen wie diejenige, die den Außenminister einen »Judenbengel« nannte, Anschuldigungen einer jüdischen Verschwörung zur Vernichtung Deutschlands sowie die Zunahme von Bezichtigungen, Juden würden Ritualmorde und Kinderschändung begehen. Der Central-Verein, die Vereinigung der deutschen Juden, bezeichnete derartige Anschuldigungen als Hauptfutter der »Pogromorgane«, eine Anspielung auf Blätter wie den Völkischen Beobachter oder die Deutsche Zeitung. Die Central-Verein-Zeitung zählte Gewalttaten gegen Juden in der jüngsten Vergangenheit auf und wies darauf hin, dass es die staatlichen Ermittlungsbehörden in allen diesen Fällen versäumt hätten, gegen die Angeklagten tätig zu werden.46 Der Central-Verein sah die Lösung in mehr Bildung und verlangte eine dringende Aufstockung der Mittel für Bildungsmaßnahmen, um den Antisemitismus in den Griff zu bekommen; die vielen bestehenden Initiativen hätten ihr Ziel wegen des Mangels an Personal und Mitteln nicht erreicht.47
In seiner grundlegenden Studie über den Rathenaumord argumentiert der Historiker Martin Sabrow, weil die Organisation Consul doch auch Matthias Erzberger ermordet habe, einen Hauptrepräsentanten des politischen Katholizismus in Deutschland, könne der Antisemitismus kein allzu bedeutsamer Motivationsfaktor gewesen sein.48 Dieses Argument ist falsch. Die Marine-Brigade Ehrhardt war von Anfang an extrem antisemitisch. Noch bevor irgendjemand von Adolf Hitler gehört hatte, malten ihre Mitglieder bereits Hakenkreuze auf ihre Helme und gepanzerten Fahrzeuge; und die Soldaten der Brigade gaben den Juden die Schuld an der Novemberrevolution und sprachen offen davon, Juden zu töten.
Es spielte keine Rolle, ob Erzberger Katholik oder Jude war. Die Männer, die ihn ermordeten, Heinrich Schulz und Heinrich Tillessen, waren beide fanatische Antisemiten. Tillessen war überzeugt, dass Erzberger heimlich Jude sei und eigentlich »Herzberger« heiße. Zu dieser Überzeugung gelangte er durch die Lektüre der antisemitischen Publikationen des rechtsradikalen Hammer Verlags, einer der schlimmsten Echokammern der frühen Zwanzigerjahre.49 Schulz nannte Rathenau den »meistgehassten Mann« seiner Kreise. Als er 1933 aus dem Exil, in das er nach dem Mord an Erzberger geflohen war, nach Deutschland zurückkehrte, trat er in die SS ein, wo er bis zum Rang eines Obersturmbannführers aufstieg.
Es ist zwar falsch, die Bedeutung des Antisemitismus für die Männer, die die Morde ausführten, zu unterschätzen, doch es ist nicht falsch, daran zu erinnern, dass diese Gruppierungen, auch wenn sie stark waren und an Zulauf gewannen, dennoch politische Minderheiten waren. Eberts Worte auf Rathenaus Begräbnisfeier und die große Zahl der Trauernden spiegelten die öffentliche Meinung weit eher wider als alles, was Leute wie Helfferich äußerten. Als Ebert sprach, hatten seine Worte Autorität. Doch die Wiedergründung der Weimarer Republik, die der prodemokratische Moment nach Rathenaus Beerdigung bedeutete, sollte nicht von langer Dauer sein. Schon in den folgenden sechs Monaten wurde die Stärkung der demokratischen politischen Kultur, die im Anschluss an das Attentat hätte erfolgen können, zunichtegemacht. Ein Jahr später war sie noch weiter geschwächt worden. Am Jahrestag des Anschlags gedachte kaum jemand dieses Ereignisses. Die Umwälzung der Welt, die seit November 1918 ununterbrochen voranschritt, setzte zur nächsten Umdrehung an: In den folgenden Monaten geriet die Weimarer Republik durch die nationalistische Mobilmachung, durch Invasion und Inflation aus den Fugen. Mit dem Mord an Rathenau war eine der wenigen politischen Figuren, die eventuell imstande gewesen wäre, die internationale Lage in eine andere Richtung zu lenken, ausgeschaltet. Die französische Regierung verkannte im Sommer 1922 die demokratische Mobilisierung, die auf den Rathenau-Mord folgte. Sie sah nur die Mörder und nahm an, diese repräsentierten das wahre Deutschland. Deshalb war sie mehr denn je überzeugt, dass die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, eine Politik der Stärke war.
Zwei Monate vor dem Anschlag, am Ostersonntag, dem 16. April 1922, ging Walther Rathenau in einer Kleinstadt in der italienischen Provinz Ligurien, etwa dreißig Kilometer südöstlich von Genua, allein am Strand entlang. Aus einem nahe gelegenen Restaurant beobachtete ihn eine kleine Gruppe deutscher Diplomaten. Er schritt unruhig auf und ab. In der Nacht zuvor hatte er kaum geschlafen und war am Morgen sehr wortkarg gewesen. Er sah sich dem bislang größten persönlichen und politischen Druck in seiner kurzen Karriere als Minister ausgesetzt. Deutschlands künftiger Platz im internationalen System stand auf dem Spiel.
Rathenau war als Führer der deutschen Delegation nach Genua gereist, wo auf Initiative des britischen Premierministers Lloyd George eine Konferenz zur Wiederherstellung der im Krieg zerstörten internationalen Wirtschafts- und Finanzsysteme tagte. Mit 34 Teilnehmerländern war sie die größte Zusammenkunft von Staaten seit der Pariser Friedenskonferenz 1919. Lloyd George erhoffte sich den Startschuss für ein internationales Konsortium von Geldgebern, die dem ehemaligen russischen Reich Geld für den Wiederaufbau leihen würden. Im Gegenzug sollten sie bevorzugten Zugang zu russischem Erdöl und Gas erhalten. Die anschließende Zunahme des Ost-West-Handels, der im Jahr 1914 zum Erliegen gekommen war, würde, so hoffte Lloyd George, für die nötige Stimulation sorgen, um Europas Wohlstand insgesamt wiederherzustellen – ein Kontinent, den der britisch-amerikanische Dichter T. S. Eliot im Jahr 1922 in einem Gedicht als »das öde Land« beschrieb, als einen Ort, »wo die Toten ihre Knochen ließen«.50
Lloyd Georges Konferenz war zunächst eine gute Nachricht für Deutschland: Genua war das erste Mal, dass der Oberste Rat der Alliierten, also jenes Gremium, das die Siegermächte des Ersten Weltkriegs ins Leben gerufen hatten, um ihren Sieg zu handhaben, die beiden Pariastaaten Europas – die Weimarer Republik und das bolschewistische Russland – zu einer internationalen Konferenz mit dem Status gleichberechtigter Teilnehmer eingeladen hatte. Auf der Eröffnungssitzung am 10. April erklärte der italienische Ministerpräsident Luigi Facta, dass sie nun »nicht mehr Freunde und Feinde, nicht mehr Sieger und Besiegte, sondern nur Menschen und Nationen«51 seien. Lloyd George zeigte sich ähnlich optimistisch. Er kündigte an, dass »die größte Zusammenkunft europäischer Nationen« einen echten und dauerhaften Frieden bringen werde. Nur eine Woche später, an besagtem Strand in Ligurien, erschien dieser anfängliche Optimismus wie ein Ereignis aus ferner Vergangenheit. Die erste Konferenzwoche war für Deutschland sehr schlecht verlaufen. Rathenau war bestürzt. Er rechnete damit, dass er in Kürze als der jüdische Außenminister nach Deutschland zurückkehren müsse, der die Kosten für Russlands Kriegs- und Vorkriegsschulden der deutschen Reparationsrechnung noch hinzugefügt hatte. Sollte es so weit kommen, wusste er, dass er das mit seinem Leben bezahlen würde. In den privaten Briefen, die er an Lili Deutsch schickte, die Frau eines AEG-Vorstandsmitglieds, beschrieb er die erdrückende Last auf seinen Schultern. Die finanzielle Belastung werde die Weimarer Demokratie womöglich ruinieren.