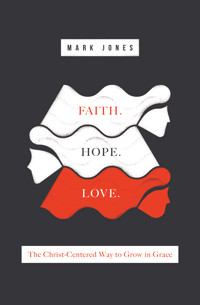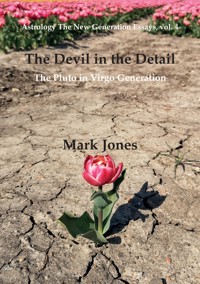24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Historiker Mark Jones schildert die dramatische Gründungsphase der Weimarer Republik erstmals als eine Geschichte der Gewalt. Er zeigt, wie eine anfangs friedliche Revolution in einer Reihe von Tabubrüchen endet, einschließlich des Mordes an Frauen und Kindern durch Soldaten der sozialdemokratisch geführten Regierung. Diese Erfahrung wurde für das weitere Schicksal Deutschlands prägend – bis hin zur entfesselten Gewalt des NS-Regimes. Anhand neu erschlossener Archivquellen, darunter zahlreiche Berichte von Zeitzeugen, führt Mark Jones den Leser an die Orte der staatlich legitimierten und ausgelösten Gewaltexzesse dieser Zeit und lässt die Stimmen der Täter, ihrer Opfer und deren Familien lebendig werden. »Mark Jones' exzellent geschriebenes Buch wirft einen neuen Blick auf die deutsche Revolution von 1918/19.« Sönke Neitzel »Am Anfang war Gewalt ist das Werk eines der meistversprechenden Historikers der jüngeren deutschen Vergangenheit. Es stützt sich auf akribische archivalische Forschung und fügt unserem Verständnis von der Geburt der deutschen Demokratie ein wichtiges Korrektiv hinzu. Zugleich ist das Buch eine Herausforderung für die Historiker, die sich traditionell meist auf die hohe Politik konzentrieren. Denn es eröffnet uns neue Fragestellungen zur Geschichte Deutschlands in der schicksalhaften ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.« Robert Gerwarth, University College Dublin »Eine bemerkenswerte Darstellung der deutschen Revolution von 1918/19 (…) Mark Jones gelingt es, die militärische und politische Geschichte mit der Gesellschafts- und Kulturgeschichte zu verbinden. Ein Buch, das eine breite Leserschaft verdient.« Peter C. Caldwell, Rice University (USA) »Es gibt gute Gründe, anzunehmen, dass dieses Buch einmal als ein Wendepunkt in der Art und Weise eingestuft werden wird, wie die Historiker die revolutionären Umwälzungen und die politische Gewalt erklären, die am Ende des Ersten Weltkrieges den europäischen Kontinent erschütterten (...) Originell und gut geschrieben, ist Am Anfang war Gewalt eine innovative, faszinierende und überzeugende Analyse der Gewalt in der deutschen Revolution von 1918/19. Man kann Mark Jones zu diesem neuen und provokativen Beitrag nur gratulieren.« Ángel Alcalde, Ludwig-Maximilians-Universität München »Ein gründlich recherchiertes und intelligent argumentierendes Buch. Mark Jones verdient Anerkennung für diesen unser Verständnis der deutschen Revolution von 1918/19 bereichernden Beitrag (...) In gewisser Weise kommt seine Darstellung der heute als klassisch geltenden Sichtweise nahe, die Mehrheitssozialdemokraten hätten aus überzogenen Ängsten vor dem Bolschewismus heraus auf die revolutionäre Unruhe überreagiert (...) Doch statt diese Ängste von oben herab verurteilen, macht Jones sich die Mühe, ihre Entstehung und ihre Wechselwirkungen mit den Ereignissen auf der Straße zu analysieren.« Moritz Föllmer, University of Amsterdam
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
»Die Auswüchse mörderischer Gewalt, die die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert prägten, nahmen ihren Anfang nicht 1933, 1939 oder 1941. Vielmehr schlug ihre Geburtsstunde schon in der Gründungsphase der Weimarer Republik; hier schwenkte Deutschland auf den Kurs ein, der später in die Horror-Exzesse des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs mündete. Damit soll nicht behauptet werden, diese seien eine zwangsläufige Folge jener frühen Entwicklung gewesen. Doch in den Winter- und Frühjahrsmonaten 1918/19 hielten Formen von Gewalt Einzug, die bis dahin auf dem Boden des Deutschen Reiches niemals vorgekommen waren, und das in einer nie dagewesenen Größenordnung. Dieses Buch will erklären, wie und warum es dazu kam.«
In einer großen historischen Erzählung schildert Mark Jones die dramatischen Ereignisse während der Gründungsphase der Weimarer Republik. Anhand neu erschlossener Archivquellen, darunter zahlreiche Augenzeugenberichte, zeigt er vor allem die staatlich legitimierten und ausgelösten Gewaltexzesse, mit denen die junge Republik ihre Autorität zu demonstrieren und politische Stabilität herzustellen suchte. Das blutige Fundament der ersten deutschen Demokratie führte zu einer in der deutschen Geschichte bis dahin beispiellosen Verrohung und Abstumpfung der Bevölkerung, die den Boden für das Gewaltregime der Nationalsozialisten bereitete.
Der Autor
Mark Jones, geboren 1981, ist Research Fellow an der Freien Universität Berlin und am University College Dublin. Er studierte an der University of Cambridge, am Trinity College Dublin und am European University Institute in Florenz, wo er in Geschichte promovierte. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Zusammenhang zwischen Gewalt und politischer Kultur in Deutschland im 20. Jahrhundert.
Mark Jones
Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer Republik
Aus dem Englischen von Karl Heinz Siber
Propyläen
Die Originalausgabe erschien 2016unter dem Titel »Founding Weimar. Violence and the German Revolution of 1918–19«bei Cambridge UP.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-1547-8
© 2017 by Mark Jones© der deutschsprachigen Ausgabe2017 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCovergestaltung: Morian & Bayer-Eynck, CoesfeldTitelfoto: © akg-images
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Widmung
Einleitung
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL EINS
Kein Endkampf 1918
Helden
Umsturz in Kiel
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL ZWEI
Gewalt und die große Angst vom November 1918
Berlin
Gewalt und revolutionäre Autosuggestion
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL DREI
Der Liebknecht-Mythos
Zementierung des Liebknecht-Mythos: Karl Liebknecht am 9. November 1918 am königlichen Schloss
Die Angst vor Liebknecht nach dem 9. November 1918
Fixierung auf Liebknecht
Der Liebknecht-Mythos
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL VIER
Blutiger Freitag
Die Straßenpolitik vom 8. Dezember 1918
Die Rückkehr der Frontsoldaten und die Erfolge der Sozialdemokraten
Der »Terror der Straße«
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL FÜNF
Blutweihnacht
Angstvolle Zeiten: Straßenpolitik nach dem 24. Dezember 1918
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL SECHS
Der 29. Dezember 1918
Die Bestattung der Matrosen
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL SIEBEN
Der Januaraufstand
Der Aufstand
Die Regierung antwortet: Frauen und Kinder, geht nach Hause!
Absage an Verhandlungen
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL ACHT
»Die Stunde der Abrechnung naht«
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL NEUN
Die ersten Gräuel: der 11. Januar 1919
Der Angriff auf den Vorwärts – Rosa Luxemburg am Maschinengewehr
Das Blutbad in der Garde-Dragoner-Kaserne
Reaktionen auf das Gemetzel
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL ZEHN
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Die Brüder Pflugk-Harttung
Der Mord an Karl und Rosa
Der Untergang der Wahrheit
Maschinengewehre gegen Trauernde
Vorgeführte Gewalt
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL ELF
Der Märzaufstand
Der Berliner Streik vom März 1919
Die militärische Besetzung Berlins
Die Ouvertüre zur Gewalt
Die Schlacht am Alexanderplatz
Das Ende des Streiks
Kesselschlacht im Osten Berlins
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL ZWÖLF
Schießbefehl
Töten im Schatten des Schießbefehls
Das Massaker in der Französischen Straße
Der Spartakistenmörder
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL DREIZEHN
Gustav Noske, der Held
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL VIERZEHN
Geiselmord in München
Die Radikalisierung der bayerischen Revolution
Das Luitpold-Gymnasium
Die Dynamik der Gewalt in München unter der Räteherrschaft
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL FÜNFZEHN
Gesellenmord in München
Anmerkungen zum Kapitel
Epilog
Anmerkungen zum Kapitel
Danksagung
Abkürzungsverzeichnis
Karten
Bibliographie
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
In Erinnerung an meine Eltern
Einleitung
Am 11. März 1919 senkte sich eine unheimliche Stille auf den Innenhof des Gebäudes Französische Straße 32 in Berlin-Mitte herab. In einer Ecke des Hofes lag Hugo Levin auf dem kalten Boden und stellte sich tot. Rechts und links von ihm lagen 29 tote Männer, darunter die Leiche seines Bruders Erwin. Mit ihnen zusammen war Hugo Levin wenige Minuten zuvor vor ein Hinrichtungskommando gestellt worden. Die Brüder gehörten zu einer Gruppe von 150 oder mehr Marinesoldaten, die man unter dem Vorwand zu dem Haus in der Französischen Straße gelockt hatte, sie würden dort ihre Entlassungspapiere und ihren restlichen Sold erhalten. Es war eine Falle, aufgestellt von Offizieren der Truppen, die in der Endphase des »Märzaufstandes« in Berlin auf Seiten der Regierung kämpften. Die Männer wurden bei ihrer Ankunft nacheinander festgenommen, und um die Mittagszeit wurden 30 von ihnen, ohne auch nur den Anschein eines militärgerichtlichen Verfahrens, von Offizieren zur Erschießung ausgewählt. Die Auswahl erfolgte auf Grund ihrer äußeren Erscheinung und der Wertsachen, die sie bei sich trugen. Soldaten trieben die Ausgewählten unter Schlägen auf den Innenhof. Wie Levin später aussagte, ahnte er zunächst nicht, was ihm bevorstand, bis er zu seinem Schrecken sah, wie auf der gegenüberliegenden Seite des Hofareals in aller Eile ein Erschießungskommando zusammengestellt wurde. Er und sein Bruder beteuerten laut schreiend ihre Unschuld, als auch schon die ersten Schüsse fielen. Eine Kugel traf ihn in den Arm, worauf er ohnmächtig nach vorne fiel. Als er wieder zu sich kam, blieb er regungslos liegen und stellte sich tot. Die ersten Stimmen, die er vernahm, gehörten den Soldaten, die auf die Männer gefeuert und seinen Bruder erschossen hatten. Was sie sagten, ließ ihm vollends das Blut in den Adern gefrieren: »Der da lebt noch! Der da. Der zweite dort lebt noch!« Jedes Mal, wenn er diese Worte hörte, »krachte ein Schuss«. Doch auf ihn wurden die Täter nicht aufmerksam. Er wagte nicht, sich zu rühren, und harrte der Dinge – stundenlang, so kam es ihm zumindest vor. Dann hörte er die Stimmen einiger Männer, die darüber redeten, den toten Männern die Stiefel abzunehmen. Anschließend kehrte wieder Stille ein, bis schließlich ein anderer Mann den Innenhof betrat. Es war ein mit einer Pistole bewaffneter Leutnant. Levin, der das Sichtotstellen nicht mehr aushielt, erhob sich, schaute dem Leutnant in die Augen und bat kniend um Gnade. Der Offizier wandte sich ab und lief davon. Später berichtete Levin seine Erlebnisse in einem Prozess vor einem Militärgericht, das das Massaker untersuchte und die dafür verantwortlichen Offiziere freisprach. Hugo Levin war der einzige der 30 Männer, der den Kugelhagel überlebt hatte.1
Das Massaker in der Französischen Straße zeigt eindringlich, dass die Auswüchse mörderischer Gewalt, die die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert prägten, ihren Anfang nicht 1933, 1939 oder 1941 nahmen. Vielmehr schlug ihre Geburtsstunde schon in der Gründungsphase der Weimarer Republik; hier schwenkte Deutschland auf den Kurs ein, der später in die Horror-Exzesse des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs mündete, ohne dass damit behauptet werden soll, diese seien eine zwangsläufige Folge jener frühen Entwicklung gewesen. In den Winter- und Frühjahrsmonaten 1918/19 hielten Formen von Gewalt Einzug, die bis dahin auf dem Boden des Deutschen Reiches niemals vorgekommen waren, und das in einer nie dagewesenen Größenordnung. Dieses Buch will erklären, wie und warum es dazu kam. Es zeigt auf, dass die zunehmende Brutalisierung aus der Interaktion politischer, militärischer und kultureller Faktoren erwuchs, nicht zuletzt auch aus der populären Forderung, der neue Staat müsse hart durchgreifen, um seinen Machtwillen und die Legitimität seiner Macht zu untermauern. Dieses Buch stellt Fragen wie: In welchen Formen trat die tödliche Gewalt im Verlauf der deutschen Revolution von 1918/19 zutage, und wie reagierten die tonangebenden Politiker und Meinungsmacher auf sie? Wie kommunizierten die Täter ihre Taten, und wie rechtfertigten sie die Ermordung von Mitbürgern? Wie kam es, dass Ende Dezember 1918/Anfang Januar 1919 die Einstellung zur Gewalt umschlug und dass so kurz nach einer den Frieden verheißenden Revolution und nach einem Krieg, der so viele Menschen dazu gebracht hatte, der Gewalt abzuschwören (auch und gerade Veteranen des Grabenkrieges), dennoch so viele politische und publizistische Stimmen nach staatlicher Gewaltanwendung riefen? Und weshalb war kaum der politische Wille vorhanden, diejenigen, die Gräueltaten begangen hatten, vor Gericht zu stellen? Warum verabschiedeten sich die politischen Herren des neuen Staates, die führenden Männer der SPD, vom traditionellen Bekenntnis ihrer Partei zur Gewaltlosigkeit, ordneten stattdessen standrechtliche Erschießungen ohne vorherigen Prozess an und verteidigten Soldaten, die Gräueltaten begingen?
Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen wird der Verlauf der Revolution von 1918/19 unter dem speziellen Blickwinkel der Gewalt erkundet. Das Buch liefert die erste eingehende historische Analyse der Rolle blutiger Gewalt in der Novemberrevolution und exponiert das Thema anschließend, indem es eine Serie gewaltvoller Ereignisse unter die Lupe nimmt, die prägend für die deutsche Politik in der Zeit nach dem Waffenstillstand waren. Jeder der untersuchten Vorgänge markierte eine Eskalationsstufe auf dem Weg zu immer brutaleren Gewaltakten. Dazu gehörten das Niedermähen eines Pulks von Demonstranten mitten in Berlin am 6. Dezember 1918; der »Sturmangriff« auf das Berliner Stadtschloss und den Marstall am 24. Dezember; der »Aufstand« in Berlin in der ersten Januarhälfte 1919 und dessen Niederschlagung; die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im gleichen Monat; der »Märzaufstand« in Berlin und die Verhängung des Standrechts, das Regierungstruppen willkürliche Hinrichtungen erlaubte; die wahllose Ermordung von Männern, Frauen und Kindern als Konsequenz aus dieser Entscheidung und die Niederschlagung der Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919.
Die Anzahl derer, die Opfer politisch motivierter Gewalt wurden, potenzierte sich während dieses Zeitraums. Den besten verfügbaren Schätzungen zufolge starben nach der Ausrufung des Generalstreiks in Berlin am 3. März innerhalb von 10 Tagen 1200 Personen; das war das Vier- bis Fünffache der geschätzt 200 bis 250 Personen, die in der deutschen Hauptstadt zwischen Anfang November 1918 und Mitte Januar 1919 ums Leben kamen. In München war die Steigerung noch krasser: Im November 1918 hatten revolutionäre Massen die Abdankung des bayerischen Königs erzwungen, ohne dass es dabei zu einem einzigen aktenkundigen Todesfall gekommen war. Sechs Monate später, zwischen dem 29. April und dem 6. Mai 1919, starben in der Stadt und ihren Vororten mehr als 1000 Menschen eines gewaltsamen Todes. Hier wie dort fiel die Zunahme der Verlustzahlen extrem einseitig aus: Die Regierungstruppen hatten Zugriff auf die Kampftaktiken und das Waffenarsenal der Westfront. Sie setzten Flugzeuge ein, Artillerie, Panzerwagen, Flammenwerfer, Mörser, Handgranaten und Maschinengewehre – gegen Revolutionäre, die ihnen in aller Regel zahlenmäßig unterlegen waren und nur über Gewehre und Maschinengewehre verfügten. Viele der Getöteten, wenn nicht die meisten, waren unbeteiligte Zivilisten.2
Innerhalb dieser »Gewaltgeschichte« kommt Gräueltaten und Gräuelgeschichten eine besondere Rolle zu. Meine These lautet, dass diese Gräueltaten einen Ansatz für ein tieferes Verständnis der politischen Kultur Deutschlands in der Gründungsphase der Weimarer Republik liefern. Am Anfang war Gewalt baut darauf, dass wir, wenn wir die Dynamik hinter den Gräueln erkennen, für die es zeitgenössische Darstellungen gibt (wie z. B. das Protokoll der Aussagen Hugo Levins), die Voraussetzungen und Gegebenheiten besser verstehen, die zum Tod Tausender Deutscher führten, von denen viele unter nebulösen, nie aktenkundig gewordenen Umständen zu Tode kamen. Zu den Gräueltaten, die sogar in einigen der bekanntesten Werke zur Geschichte der Weimarer Republik kaum Erwähnung finden, während sie für dieses Buch eine zentrale Rolle spielen, gehören die Ermordung von sieben Unterhändlern nach der Kapitulation der Besetzer des Vorwärts-Gebäudes am 11. Januar 1919, die Abschlachtung zweier »galizischer« Häftlinge im Zellengefängnis Moabit am 10. März 1919 und die brutale Ermordung von 21 für Spartakisten gehaltenen Mitgliedern eines katholischen Vereins am 6. Mai 1919 in München.
Selbst wenn jede dieser Gräueltaten eine andere Vorgeschichte und Dynamik hatte, wiesen sie doch eine Gemeinsamkeit auf: Sie konnten nur geschehen, weil die politischen Führer der Republik bestimmte politische Entscheidungen getroffen hatten mit dem Ziel, ihre Macht und ihren Herrschaftswillen um jeden Preis zu demonstrieren.3 Nachdem die entsprechenden Beschlüsse einmal gefasst waren, unternahm die von Friedrich Ebert und nach ihm von Philipp Scheidemann geführte Regierung nur wenig, um die ihnen unterstellten Soldaten im Zaum zu halten, obwohl sie wusste, dass diese Truppen Gräueltaten begingen. Ganz im Gegenteil wurde es zu einem zentralen Anliegen der Regierung und ihrer Anhänger, das Vorgehen von Regierungstruppen und Freikorps ohne Rücksicht darauf, was diese anstellten, zu verteidigen. Dieses rigorose Eintreten für staatliche Gewalt unter sozialdemokratischer Herrschaft verschob die Paradigmen der deutschen politischen Kultur und hinterließ ein bitteres Vermächtnis. Dieses Vermächtnis machte den späteren Zusammenbruch der Weimarer Republik sicher nicht unausweichlich, untergrub aber doch ihre Legitimität, lieferte ihren Gegnern, nicht zuletzt Hitler, einige ihrer wichtigsten ideologischen Argumente, gab ihrem Antisemitismus Auftrieb und bestärkte sie in der Verherrlichung antikommunistischer Gewalt.
Am Anfang war Gewalt ist das Ergebnis jahrelanger Forschungen und Recherchen zur Geschichte der Revolution von 1918/19. Die Quellen umfassen Material aus elf Archiven und über 60 Zeitungen, deren zeitgenössische Reportagen und Kommentare ausgewertet wurden. Die Bilanz lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Auf dieser Etappe der Geschichte war Gewalt Politik, und Politik war Gewalt; jeder Versuch, die beiden zu trennen und als geschichtliche Kapitel für sich darzustellen, hieße den Grundcharakter dieser Epoche zu verkennen. Somit postuliert dieses Buch, dass jeder, der sich mit der Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert befasst, die entscheidende Rolle berücksichtigen muss, die Gewalt, staatlich geförderte Gräuel und der Streit um deren Legitimität in der Gründungsphase der Weimarer Republik spielten. Die vielen von Historikern vorgelegten Darstellungen dieser Ära, ob älter, ob neuer, die dies unterlassen, bleiben im besten Fall bruchstückhaft und laufen im schlimmsten Fall auf eine kritiklose Apologie der Gründerväter der ersten deutschen Demokratie hinaus.4
Gewalt ist etwas Physisches: Sie verwundet und tötet und gemahnt alle, die mit ihr konfrontiert werden, an die Fragilität ihrer eigenen leiblichen Existenz. Jede wissenschaftliche Auseinandersetzung mit politisch motivierter Gewalt muss daher versuchen zu verstehen, wie die von Gewalt ausgehende Gefahr die Reaktion der Zeitgenossen auf diese Gewalt prägte. Eine der zentralen Überlegungen dieses Buches ist die, dass die politischen Führer der im Entstehen begriffenen Weimarer Republik und große Teile der damaligen deutschen Gesellschaft aus Angst, Opfer revolutionärer Gewalt zu werden, am Ende die Anwendung bis dahin unerhörter Mittel kriegsmäßiger Gewalt durch Regierungstruppen und Freikorps gegen den (wirklichen oder vermeintlichen) inneren Feind guthießen. Im Winter 1918/19 nährte sich die Angst vor der Gewalt aus dem Zusammenwirken realer Gewaltakte in deutschen Städten mit imaginierten Szenarien dessen, was in Deutschland geschehen könnte oder würde, wenn Gewaltexzesse, wie man sie mit der Französischen Revolution, der Pariser Kommune von 1871, vor allem aber mit dem noch im Gang befindlichen Bürgerkrieg in Russland verband, auch in Deutschland vorkommen würden.
Zu den Phantasmagorien, die aus dem Zusammenwirken von geschichtlicher Überlieferung, aktuellen Nachrichten und angstbesetzten Vorstellungen resultierten, gehörten der Glaube der Revolutionäre an ein Korps bewaffneter Konterrevolutionäre, die Überzeugung vieler, Karl Liebknecht verfüge über eine Geheimarmee, die bereitstand, auf seinen Befehl hin die Macht zu übernehmen, und auf einer allgemeineren Ebene die Befürchtung, die gesellschaftliche und politische Ordnung Deutschlands stehe am Rande des totalen Zusammenbruchs. Das Zusammenwirken dieser Vorstellungen führte dazu, dass die staatlich sanktionierte Gewalt für große Teile der deutschen Gesellschaft eine charismatische Qualität gewann.
In einem von extremer Angst geprägten Klima war es für viele beruhigend zu wissen, dass die regierungstreuen Truppen Artillerie einsetzten und sogar Flugzeuge und Flammenwerfer in ihrem Arsenal hatten. Das gab ihnen die Gewissheit, dass der neue Staat stark genug war, die Ordnung wiederherzustellen und Deutschland vor dem Absturz in den »Abgrund« der Revolution zu bewahren. Wenn wir die Logik der staatlich verordneten Gewalt im Frühjahr 1919 verstehen wollen, müssen wir deren ostentativen Charakter erkennen: Sie sollte dem Publikum eine leicht begreifbare Botschaft übermitteln, die weit über die unmittelbare Situation hinaus, in der physische Gewalt ausgeübt wurde, von Bedeutung war.5 So unangenehm es vielen Historikern sein mag, die über die Weimarer Republik gearbeitet haben, so müssen wir doch in Erinnerung rufen, dass der Beschluss der sozialdemokratisch geführten Regierung, den Soldaten das Recht zur Durchführung standrechtlicher Erschießungen zu gewähren, den Gegnern der revolutionären Umwälzung half, ruhiger zu schlafen und sich in der Sicherheit zu wiegen, dass der Staat dabei war, die Ordnung wiederherzustellen.
Nur wenige Deutsche denken heute noch darüber nach, dass die Novemberrevolution und ihre Nachwehen eine entscheidende Weggabelung auf dem Weg Deutschlands in das dunkelste Kapitel seiner Geschichte darstellten.6 Nur wenige wissen, dass die Novemberrevolution einen bemerkenswert geringen Blutzoll forderte, dass der Waffenstillstand vom 11. November den Erfolgen der Revolutionäre zu verdanken war und dass die revolutionäre Regierung, der Rat der Volksbeauftragten, in ihren ersten sechs bis acht Wochen bewusst ihr Möglichstes tat, um jedes Aufflackern weiterer Gewalt zu verhindern – bis es in den letzten zehn Tagen des Jahres 1918 zu einer dramatischen Verhärtung der Fronten kam. Niemand in Deutschland gedenkt je der Ermordung von 16 Menschen auf einer belebten Straße im Zentrum Berlins am 6. Dezember 1918; es war das erste Mal, dass auf deutschem Boden Demonstranten unter Maschinengewehrfeuer genommen wurden. Nur die wenigsten Deutschen erinnern sich daran, dass ein militärischer Sturmangriff unter Führung der preußischen Garde-Kavallerie-Schützen-Division auf Stadtschloss und Marstall am 24. Dezember 1918 den ersten willkürlichen, im Affekt angeordneten Einsatz moderner Artillerie in der deutschen Hauptstadt darstellte – eine schwerwiegende Weichenstellung, die gleichsam als Testlauf für den Einsatz kriegsmäßiger militärischer Gewalt auf breiter Front gegen radikale revolutionäre Kräfte in deutschen Großstädten fungierte. Und wie viele Deutsche wissen, dass die ersten Fliegerbomben nicht im Zweiten Weltkrieg in der Reichshauptstadt einschlugen, sondern im Verlauf des Märzaufstandes von 1919?
Jede dieser Lücken im Wissen der heutigen Deutschen über ihre jüngere Vergangenheit ist Teil einer größeren Verdrängungsleistung: Die in der deutschen Geschichtsschreibung jüngst vollzogene Abkehr von der Sonderweg-These geht einher mit einer allzu nachsichtigen Rückschau auf das Deutsche Kaiserreich. Der Preis für diese Neuorientierung ist offenbar der, dass problematische Aspekte der deutschen Zeitgeschichte wie die mangelnde Bereitschaft der Elite des Deutschen Reiches, der Bevölkerung demokratische Mitwirkungsrechte zuzugestehen, immer weniger Beachtung finden. Auf einer allgemeineren Ebene lässt sich sagen, dass das Missverhältnis zwischen der wichtigen Stellung, die die deutsche Revolution in der Geschichte der politischen Gewalt einnimmt, und ihrer weitgehenden Verdrängung aus dem geschichtlichen Gedächtnis der Bevölkerung durch den Kunstgriff einer einfachen Dichotomisierung zunehmend größer geworden ist – durch die Gleichsetzung Weimars mit einem guten Deutschland und der auf Weimar folgenden zwölf Jahre mit seiner hässlichen Kehrseite. In dieser Sicht der Dinge – die auch von manchen mit der SPD sympathisierenden Historikern geteilt wird – erscheinen die Sozialdemokraten im Rückblick als Verfechter und Verteidiger der Weimarer Demokratie und als Opfer des Nationalsozialismus in deren Endphase, während ihre Rolle als aktive Förderer neuer Formen brutaler staatlicher Gewalt in der Entstehungsphase dieser Republik aus dem Blick gerät.
Die geschichtliche Überlieferung sollte uns zu einer vielschichtigeren Betrachtung der deutschen Vergangenheit anregen. Es gab in Deutschland in der Anfangsphase der Weimarer Republik das Gute wie das Schlechte, und das Kräftespiel zwischen denen, die nach Gewaltanwendung riefen, und denen, die sie ablehnten, war ein zentrales Motiv der Politik dieser Umbruchphase, in der die Gewalt ebenso präsent war, wie sie auch anderswo ständige Begleiterscheinung von Staatsgründungen war und ist. Angesichts dieses Zusammenhangs besteht die vordringliche Aufgabe des Historikers nicht darin, moralische oder politische Urteile zu fällen, sondern darin, ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie und weshalb die politischen Akteure zu den Entscheidungen kamen, die sie damals trafen. Wenn wir auf diese Weise an die Geschichte herangehen, können wir uns ein besseres Verständnis dafür erarbeiten, warum sich die Sozialdemokraten von ihrer jahrzehntelangen Tradition des Einstehens für die Schwachen und Unterdrückten im Frühjahr 1919 so gründlich verabschiedeten, sich in Befürworter standrechtlicher Erschießungen verwandelten und zusahen, wie diejenigen, die Gräueltaten begangen hatten, straflos ausgingen. Verstehen zu lernen, wie es dazu kam, dass große Teile der deutschen Bevölkerung in staatlich angeordneter Gewalt eine gute Sache sahen und sie akzeptierten, ist die zentrale Aufgabe dieses Buches. Indem es zeigt, welches große gesellschaftliche und politische Potential für brutale Gewalt in Deutschland schon 14 Jahre vor der Errichtung des NS-Staates und 20 Jahre vor den Eruptionen der Jahre 1939–45 schlummerte, erhebt es den Anspruch, einen sehr viel klareren Blick auf die dynamischen Prozesse zu eröffnen, die im weiteren Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch viel größere und extremere Exzesse der Gewalt möglich machten.
Anmerkungen zum Kapitel
1. »Das Zeugnis eines Überlebenden«, VZ Nr. 620, 5. Dez. 1919AA.
2. Zu den Opferzahlen s. unten.
3. Einen bemerkenswert schwachen Versuch, eine Bilanz der von Freikorps begangenen Gräueltaten zu ziehen, hat Hagen Schulze vorgelegt: Freikorps und Republik, S. 52.
4. Einen aktuellen Überblick über die historiographische Aufarbeitung der deutschen Revolution bietet Niess, Die Revolution von 1918/19. Zu den wegweisenden Veröffentlichungen gehören Kolb, Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918–19 (1962); Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution (1963); Rürup, Probleme der Revolution in Deutschland 1918/1919 (1968); Kluge, Soldatenräte und Revolution (1975); Kluge, Die deutsche Revolution 1918/1919 (1996); Mommsen, »Die deutsche Revolution 1918–1920« (1978); Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung (1984); Rürup; Brandt, Volksbewegung und demokratische Neuordnung (1991); The Problem of Revolution in Germany (2000). In jüngster Zeit hinzugekommen ist Germany 1916–1923(2015).
5. Zur These vom ostentativen Charakter der Gewalt siehe Juergensmeyer, Terror im Namen Gottes, S. 124; Weisbrod, »Terrorism as Performance«; Weisbrod, »Religious Languages of Violence«.
6. Aus Anlass des 90. Jahrestages der Revolution von 1918/19 zog immerhin eine einsame Aufsatzsammlung ein vernichtendes Fazit der Beschäftigung akademischer Historiker mit den Ereignissen des Winters 1918/19, indem sie von der »vergessenen Revolution« sprach: Gallus (Hrsg.), Die vergessene Revolution von 1918/19 (2010).
KAPITEL EINS
Kein Endkampf 1918
Die Oberste Heeresleitung (OHL) in der besetzten belgischen Stadt Spa war das neuralgische Zentrum für die militärische und politische Beschlussfassung der Deutschen während des letzten Jahres des Ersten Weltkriegs. Hier trafen die Oberbefehlshaber General Erich von Ludendorff und Paul von Hindenburg Entscheidungen, die das Leben von Millionen Menschen bestimmten. Am 29. September 1918 standen die Generäle Albrecht von Thaer und Ernst von Eisenhart-Rothe in einem überfüllten Raum Seite an Seite. Sie nahmen an einer Versammlung ranghoher Offiziere der OHL teil. Generalquartiermeister Erich Ludendorff ergriff das Wort. Tagsüber hatte das Gerücht die Runde gemacht, er werde etwas überaus Wichtiges bekanntgeben, etwas, das keiner der Männer für möglich halten würde.1 Diesem Gerücht zufolge hatte Ludendorff kurz vorher einer Handvoll der wichtigsten Männer des deutschen Kaiserreichs, darunter Kaiser Wilhelm II., Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, Staatssekretär des Auswärtigen Paul von Hintze und Reichskanzler Georg von Hertling, eröffnet, Deutschland habe den Krieg verloren. Als Ludendorff zu reden begann, traute keiner der Männer seinen Ohren. Thaer war 50, Eisenhart 56 Jahre alt. An diesem Nachmittag eröffnete Ludendorff ihnen, dass es mit allem, woran sie geglaubt hatten, aus und vorbei war.
Thaer beschrieb die Wirkung dessen, was Ludendorff aussprach, als »unbeschreiblich«, den Zustand, in den es ihn versetzte, als »völlig außer mir«. Nach mehr als vier Jahren Krieg und fast zwei Millionen deutschen Gefallenen hatte Ludendorff nichts Besseres mitzuteilen, als dass »die OHL und das deutsche Heer […] am Ende [seien]; der Krieg sei nicht nur nicht mehr zu gewinnen, vielmehr stehe die endgültige Niederlage wohl unvermeidbar bevor. Bulgarien sei abgefallen. Österreich und die Türkei, am Ende ihrer Kräfte, würden wohl bald folgen. Unsere eigene Armee sei leider schon schwer verseucht durch das Gift spartakistisch-sozialistischer Ideen. Auf die Truppen sei kein Verlass mehr.«2 Thaer fragte sich: »Wache oder träume ich?«
Der Abgrund, der sich in diesem Moment auftat, überforderte viele der Anwesenden. Die Kultur des harten Mannestums, die bis dahin das Auftreten der OHL nach innen und außen geprägt hatte, geriet nach dieser Enthüllung vollkommen aus den Fugen. Nicht wenigen der in dem Raum versammelten Männer liefen Tränen übers Gesicht. Albrecht von Thaer und Ernst von Eisenhart-Rothe fassten einander an der Hand, während von allen Seiten gedämpftes Schluchzen an ihre Ohren drang. Thaer presste seine Hand so heftig in die seines Kameraden, dass er später meinte, sie »kaputt« gedrückt zu haben.3
Die sich abzeichnende Niederlage war schlimmer, als die Männer es sich hätten vorstellen können. Das Deutsche Reich war auf militärischen Siegen aufgebaut. Es hatte noch keinen Krieg verloren. Die letzte Niederlage Preußens lag mehr als hundert Jahre zurück: 1806/07 hatten die Heere Napoleons sogar vorübergehend Berlin besetzt. Doch die Schmach der Niederlage gegen Napoleon hatten die Preußen durch die Niederringung des Franzosenkaisers 1813/15 und durch die Siege Bismarcks in den deutschen Einigungskriegen getilgt. Jetzt, Ende September 1918, schien gewiss, dass die Niederlage, die Ludendorff voraussagte, niemals mehr wettgemacht werden konnte. Falls man nicht einen sofortigen Waffenstillstand herbeiführe, warnte Ludendorff, müsse mit einem feindlichen Vormarsch von unvorstellbarer Wucht gerechnet werden. Die Front werde restlos zusammenbrechen, und das Westheer werde »den letzten Halt verlieren und in voller Auflösung zurückfluten über den Rhein und werde die Revolution nach Deutschland tragen«.4 Es war ein Schreckensszenario, das für Ludendorff nicht einfach nur eine militärische Niederlage beinhaltete, sondern das für Finis Germaniae stand, für das Ende Deutschlands.5
Ludendorffs düstere Voraussage war das Ergebnis des sich beschleunigenden Kriegsgeschehens im Verlauf des Jahres 1918. Da war zunächst die anfänglich erfolgreiche, letzten Endes aber ergebnislose deutsche Offensive vom Frühjahr und Sommer 1918, mit der Ludendorff hoffte, den Krieg entscheiden zu können, bevor sich die Gewichte an der Westfront durch das Eintreffen von immer mehr US-amerikanischen Truppen immer weiter verschieben würden. Nach einigen erfolgreichen deutschen Vorstößen, bei denen kleine Truppenteile die Marne erreichten und sich Paris bis auf 70 Kilometer näherten, kam die Offensive, für die Deutschland einen ungeheuren Preis zahlte, zum Erliegen.6 Nicht nur gelang es nicht, Frankreich oder Großbritannien zu besiegen; schlimmer noch war, dass die Offensive die deutschen Armeen restlos auslaugte. Die kampfstärksten Divisionen des deutschen Heeres erlitten den Löwenanteil der Verluste, viele ihrer besten Leute fanden den Tod. Auch die Moral der Männer, die überlebt hatten, war eine völlig andere geworden: Sie hatten dem Feind alles entgegengeworfen, was sie besaßen, und hatten nichts gewonnen – und mancherorts waren deutsche Soldaten, wenn sie doch einmal bis zu den Schützengräben des Feindes vordrangen, aus allen Wolken gefallen angesichts der Vorräte, die sie dort vorfanden. Mit der Erkenntnis konfrontiert, dass die Menschen auf der anderen Seite der Schützengräben ein besseres Leben hatten, kam vielen der Männer der Wille abhanden, gegen einen offensichtlich überlegenen Feind bis zum letzten Atemzug weiterzukämpfen.7
Dann starteten die Mächte der Entente ihre Gegenoffensive: als Erstes die Franzosen am 18. Juli 1918 bei Villers-Cotterêts, dann die Briten mit Hilfe von Imperialen Truppen am 8. August bei Amiens – Ludendorff bezeichnete diesen 8. August als den »schwarzen Tag des deutschen Heeres«.8 Von diesem Moment an ging der Stellungskrieg, der bis dahin das militärische Geschehen an der Westfront dominiert hatte, langsam, aber unübersehbar in einen Bewegungskrieg über. Die Verluste näherten sich wieder den Höchstwerten von 1914 an. Doch anders als in jenen ersten Kriegsmonaten bestand jetzt die einzige Vorwärtsbewegung deutscher Soldaten darin, dass sie sich massenhaft ihren Feinden ergaben. Und auch wenn die deutsche Propaganda ihr Bestes tat, das Lagebild zu retuschieren, war es eine Tatsache, dass das deutsche Heer im Verlauf des Sommers und Herbstes 1918 allerorten auf dem Rückzug war.9
Die militärisch aussichtslose Lage im Gefolge des deutschen Scheiterns an der Westfront war einer von zwei wesentlichen Gründen für Ludendorffs Einschätzung, dass der Krieg verloren war. Der zweite war die Angst vor dem Bolschewismus. Die Furcht vor einer Revolution unter Führung der Industriearbeiterschaft war mindestens schon seit den 1890er Jahren eines der beherrschenden Motive in der politischen Ideenlandschaft Deutschlands gewesen. Im Verlauf des Jahres 1918 verlieh der Aufstieg des russischen Bolschewismus dieser Angst eine sehr viel größere Virulenz. Unter Bolschewismus stellte man sich nicht nur eine Revolution vor, sondern einen Exzess barbarischer Gewalt. Es war dies keine ganz unrealistische Einschätzung, denn der durch die Revolution ausgelöste Bürgerkrieg in Russland erwies sich schon in seinem ersten Jahr als ein mit erheblicher Brutalität ausgetragener Konflikt. Die Deutschen erfuhren von den Vorgängen in Russland im Verlauf des Jahres 1918 aus diversen Quellen.10 Zeitungskorrespondenten schickten aus Sankt Petersburg und Moskau Reportagen und Berichte, die der deutschen Öffentlichkeit erklärten, was der Bolschewismus war: eine Spielart des Terrorismus, die mit einer Welle von Plünderungen, Morden und Hungersnöten sowie mit einer ganzen Anzahl weiterer negativer Erscheinungen einherging – was in der Summe dazu führte, dass der Ausdruck »russische Zustände« im politischen Denken der Deutschen zu einem Synonym für Weltuntergang wurde.11
Die Zeitungskorrespondenten waren nicht die einzigen Deutschen im ehemaligen Zarenreich. Der im März 1918 geschlossene Vertrag von Brest-Litowsk hatte weitläufige Territorien im östlichen Europa unter direkte oder indirekte deutsche Herrschaft gestellt. Die Militärführung beließ bis zu einer Million deutsche Soldaten in diesen Gebieten, um die territoriale Kriegsbeute, die Deutschland im Osten gemacht hatte, zu sichern. Diese Männer konnten die Realität des Bolschewismus und des russischen Bürgerkrieges aus nächster Nähe beobachten. Viele von ihnen wurden sogar zu aktiven Bürgerkriegsteilnehmern.12 In Finnland, wo antibolschewistische Truppen im Mai 191810000 Aufständische massakrierten, kämpfte die deutsche »Ostsee-Division« unter dem Befehl von Generalmajor Rüdiger von der Goltz auf Seiten der Nationalisten.13 In der Ukraine lieferten sich deutsche Soldaten im Zeichen hasserfüllter Feindseligkeit Kämpfe mit Rebellen, in denen beide Seiten Gräueltaten begingen. An der Schwarzmeerküste exekutierten deutsche Soldaten, nachdem 39 ihrer Kameraden bei einem feindlichen Überfall im Juni 1918 gefallen waren, zur Vergeltung rund 2000 bolschewistische Gefangene.14 Im Juli 1918 wurde in Kiew der ranghöchste militärische Befehlshaber in der Ukraine, Generalfeldmarschall Hermann von Eichhorn, ermordet. Wenig später wurde der deutsche Botschafter bei der bolschewistischen Regierung, Graf Mirbach, im Gebäude der deutschen Botschaft in Moskau ermordet. Kaum hatten die Deutschen diese haarsträubenden Ereignisse verdaut, da erfuhren sie, dass der abgesetzte Zar und seine Familie in einem sibirischen Verlies brutal ermordet worden waren.15
Die wachsende Angst vor dem Bolschewismus hatte nicht nur mit den Nachrichten über Gewaltexzesse weit im Osten zu tun, sondern auch etwas mit den im Inneren absehbaren Bedrohungen. Der Weltkrieg hatte eine bis dahin nicht gekannte Zahl von Ausländern nach Deutschland gespült, wenn auch längst nicht in der Größenordnung der Zwangsarbeiterheere, die die Nationalsozialisten im Verlauf des Zweiten Weltkrieges importieren sollten. 1914 hatte es im Deutschen Reich 1,25 Millionen zugewanderte ausländische Arbeitskräfte gegeben; 1918 hielten sich innerhalb der Grenzen Deutschlands allein 1,4 Millionen (oder mehr) unterernährte russische Kriegsgefangene aus ehemaligen Provinzen des Zarenreichs auf. Das entsprach mehr als dem Doppelten der Anzahl französischer und mehr als dem Achtfachen der Zahl britischer Kriegsgefangener. Viele Deutsche fürchteten 1918 für den Fall, dass man diese Männer freiließ, es könne in Deutschland zu einer Revolution nach bolschewistischem Vorbild kommen, einschließlich der mit dem Bolschewismus assoziierten Gewaltexzesse.16
Als Ludendorff einmal zu der Einsicht gelangt war, der Krieg sei verloren, leitete er die politischen Konsequenzen unverzüglich ein. Er, der bis dahin alle Vorstöße in Richtung auf Friedensverhandlungen abgewürgt und alle Urheber solcher Initiativen politisch ausgeschaltet hatte, forderte jetzt einen sofortigen Waffenstillstand als das einzige Mittel, Deutschland vor dem doppelten Unheil eines militärischen Zusammenbruchs und eines bolschewistischen Umsturzes zu bewahren. Die Wünsche Ludendorffs wurden unverzüglich erfüllt. Am 30. September 1918 verkündete Wilhelm II. per Erlass die Einrichtung einer parlamentarischen Regierung in Deutschland. Der ins Gerede gekommene Reichskanzler Graf Hertling, ein alter Mann, der sich innerlich schon von seinem Amt verabschiedet hatte, wurde durch Prinz Max von Baden ersetzt. Der trat mit dem Auftrag an, das autoritäre politische System des deutschen Kaiserreichs in eine moderne parlamentarische Demokratie westlichen Zuschnitts zu verwandeln – etwas, wogegen sich die deutsche Rechte während der gesamten Dauer des Krieges zunehmend heftiger gewehrt hatte, mit der Begründung, so etwas sei mit der deutschen Kultur unvereinbar.17 Die von Ludendorff verordnete »Revolution von oben« galt vielen als notwendige Voraussetzung dafür, den US-Präsidenten Woodrow Wilson davon zu überzeugen, dass Deutschland ein gutwilliger Partner bei der Schaffung einer neuen, auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie basierenden internationalen Ordnung sein würde.18 Es war ein cleverer Schachzug Ludendorffs – und zumindest teilweise darauf berechnet, die Verantwortung für die Niederlage Deutschlands auf eine zivile politische Führung abzuwälzen –, dass er die erstmalige Berufung sozialdemokratischer Politiker in die Regierung empfahl. Ein aufmerksamer Beobachter des Geschehens, der Historiker Gustav Mayer, meinte, als er von all diesen Veränderungen erfuhr, sie wären für Deutschland ein echter »Segen« gewesen, wenn sie mindestens ein Jahr früher vollzogen worden wären. Da man sie aber erst unter dem Eindruck des »Hammerschlags« an der Westfront eingeleitet habe, würden spätere Historiker, wie Mayer klug voraussah, zu dem Urteil gelangen: »Alles das kam zu spät.«19
Bei den Befehlshabern der deutschen Kriegsmarine herrschte blankes Entsetzen. Erst vor wenigen Wochen, im August 1918, war eine eigenständige Seekriegsleitung (SKL) ins Leben gerufen worden. Nach dem Vorbild der OHL strukturiert und mit ihrem eigenen hochfliegenden U-Boot-Bauprogramm als kriegsentscheidendem Trumpf-As ausstaffiert, war die SKL geschaffen worden, um an die Stelle des wenig praxistauglichen multipolaren Systems zu treten, innerhalb dessen mehrere unterschiedliche Instanzen in Konkurrenz zueinander um die richtige Seekriegs-Strategie gerungen hatten. In der kurzen Zeit ihres Daseins stand die SKL unter dem beherrschenden Einfluss von drei Persönlichkeiten: des Admirals Reinhard Scheer (Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine), seines Stabschefs, Konteradmiral Adolf von Trotha, und des Haudegens Kapitän Magnus von Levetzow. Um eine bessere Koordination zwischen den Führungsstäben der Marine und des Heers zu gewährleisten, wurde zum Sitz der SKL das belgische Spa gewählt, wo auch die OHL ihr Hauptquartier hatte. Am Abend des 29. September, als viele Heeresoffiziere damit beschäftigt waren, den Schock zu verarbeiten, den Ludendorff ihnen mit seiner Ankündigung versetzt hatte, unternahmen Scheer und Levetzow einen Spaziergang. Kein Zeugnis ihrer Unterhaltung ist erhalten geblieben, doch vermitteln uns die Briefe, die Scheer regelmäßig an seine Frau Emilie schrieb, einen Einblick in ihr Denken. In dem Brief an sie, den er an dem betreffenden Abend verfasste, bezeichnete er es als die vordringlichste Aufgabe, sich um die Verbesserung der »unbefriedigenden […] inneren Lage« zu kümmern. Wenn Deutschland wieder mehr »Mut« und »Festigkeit« gewinne, sei es, da war er sich sicher, »noch lange nicht verloren«.20 Auf der Suche nach weiteren guten Gründen für Optimismus äußerte er die Zuversicht, Deutschland könne die Lage in Mazedonien noch stabilisieren, wo sich durch den Zusammenbruch Bulgariens ein weiteres Loch in der Front aufgetan hatte, das Deutschland mit der ständig sinkenden Zahl seiner wehrfähigen Männer füllen musste. Während im Offizierskorps des Heeres Niedergeschlagenheit vorherrschte, konnte Scheer zu seiner Freude feststellen, dass bei seinen Marineoffizieren »die Stimmung ganz gut und keineswegs gedrückt [ist]«.21
Es sollten drei bis vier Wochen vergehen, ehe die Einschätzung Scheers einen praktischen Niederschlag fand. In der ersten Septemberwoche war die einzige Meinung, die wirklich zählte, die von Ludendorff. Er platzte vor Wut, als sich die Umsetzung seines Waffenstillstandsplans um bloße zwei Tage verzögerte. Höchst verärgert forderte er Prinz Max ultimativ auf, unverzüglich eine Friedensnote an die Amerikaner zu schicken. Obwohl der Reichskanzler zunächst zögerte und darauf hinwies, dass man damit den Amerikanern alle Trümpfe in die Hand spiele, gab er dem von Ludendorff ausgeübten Druck alsbald nach. Die erste deutsche Note wurde der US-Regierung am 3. Oktober 1918 über Schweizer Kanäle zugeleitet. Sich bewusst von der Geheimdiplomatie vom Juli 1914 absetzend, gab Prinz Max den Inhalt seiner Note am 5. Oktober 1918 bei seiner Jungfernrede im Reichstag bekannt.22 In einer Ansprache, über die eine angesehene Zeitung schrieb, es sei eine der wichtigsten, die je ein deutscher Staatsmann gehalten habe, erklärte Prinz Max, er habe eine Note an Präsident Wilson geschickt und ihn gebeten, einen Friedensprozess auf der Grundlage seiner 14 Punkte einzuleiten (die der deutschen Öffentlichkeit bei ihrer erstmaligen Bekanntgabe im Januar 1918 nur in einer zensierten Fassung zugänglich gemacht worden waren). Wilson hatte damals die Errichtung eines »Völkerbundes« als zentrales Instrument für die künftige Beilegung aller internationalen Streitigkeiten und Konflikte gefordert. Für die in umstrittenen Grenzprovinzen lebenden Deutschen hörte sich freilich eine Friedenslösung à la Wilson eher katastrophal an: Sie fürchteten die Eingliederung in neue Nationalstaaten, in denen die Deutschen nur noch eine Minderheit sein würden, und gehörten daher zu denen, die im Oktober 1918 am lautesten gegen die Friedensnote des Prinzen Max protestierten.
Die meisten Historiker haben nicht zur Kenntnis genommen, dass Prinz Max, während er seine »Friedensangebote« an die große Glocke hängte, zugleich auch über eine mögliche Fortsetzung des Krieges sprach. In dem Teil seiner Reichstagsrede, die bei der deutschen Rechten den größten Anklang fand, gab der neue Reichskanzler zu bedenken, zu einem Friedensschluss könne es nur kommen, wenn Deutschland Friedensbedingungen zugestanden wurden, die sich mit seiner Ehre vertrugen.23 Ohne ein Wort über die Forderungen Ludendorffs oder die Schwäche der deutschen Truppen an der Front zu verlieren, versprach Prinz Max, falls die Feinde Deutschlands nicht willens seien, einem mit der Ehre Deutschlands zu vereinbarenden Frieden zuzustimmen, werde der Krieg weitergehen. Er setzte dem noch die Aussage hinzu, Deutschland sei, wenn nötig, zu einem »Endkampf auf Leben und Tod« bereit. Ergänzend fügte er den bleischweren Satz hinzu: »Kein Zagen befällt mich bei dem Gedanken, dass dieses zweite Ergebnis eintreten könnte; denn ich kenne die Größe der gewaltigen Kräfte, die auch jetzt noch in unserem Volke vorhanden sind, und ich weiß, dass die unwiderlegliche Überzeugung, um unser Leben als Nation zu kämpfen, diese Kräfte verdoppeln würde.«24
Es lässt sich kaum ergründen, wie viel Glauben Prinz Max selbst und andere Abgeordnete in diese Worte setzten. Schon vor der durch Ludendorffs Offenbarung ausgelösten Krise hatten deutsche Sozialdemokraten die Überzeugung geäußert, Deutschland müsse nur noch einige Wochen lang mit dem Mut der Verzweiflung kämpfen, um sich einen besseren Frieden sichern zu können.25 Es liegen sehr viele Belege dafür vor, dass die Nachricht von Ludendorffs Eingeständnis der deutschen Niederlage in Kreisen der deutschen Eliten weite Verbreitung fand, obwohl sie streng vertraulich behandelt werden sollte. Des Weiteren lassen die Initiativen, die Prinz Max später ergriff, als er zur treibenden Kraft hinter dem Drängen auf einen Verhandlungsfrieden wurde, darauf schließen, dass er sehr genau wusste, dass eine Fortsetzung des Krieges auf einen militärischen Selbstmord Deutschlands hinauslaufen würde.26
Ungeachtet der Frage, ob Prinz Max in seiner ersten Reichstagsrede die verbliebene militärische Reststärke Deutschlands bewusst überbewertete oder nicht, liefen seine Worte auf eine öffentliche Festlegung hinaus, die die Weiterführung des Krieges als Wahl zwischen einem ehrenhaften, für Deutschland annehmbaren Frieden und einem Endkampf auf Leben und Tod definierte.27 Diese Botschaft war wohl kaum geeignet, die deutsche Öffentlichkeit adäquat auf das Ergebnis einer Friedensinitiative vorzubereiten, die auf Geheiß einer Militärführung gestartet worden war, die nach drei Monaten voller militärischer Rückschläge in Panik geraten war und fürchtete, Deutschland stehe an der Schwelle zu einem völligen Zusammenbruch. Noch schwerer ins Gewicht fiel jedoch, dass Prinz Max mit dem, was er sagte und andeutete, die deutschen Gegner eines Friedens à la Wilson geradezu einlud, gegen die eigene Regierung mobilzumachen und Pläne für eine Fortführung des Krieges zu schmieden. An Leuten, die sich diese Sicht der Dinge zu eigen machten, herrschte kein Mangel, am wenigsten in den Reihen der nationalistischen Verbände und bei den deutschen Bewohnern von Gebieten wie Danzig, die dem Reich verlorengehen konnten, wenn Wilsons Politik des Selbstbestimmungsrechts der Völker in die Tat umgesetzt wurde. Männer wie Scheer hörten aus der Rede von Prinz Max genügend Gründe heraus, um anzunehmen, dass der Krieg weitergehen würde. Wie Scheer seiner Frau mitteilte: »Die Rede des Prinzen Max von Baden bei der Reichstags-Eröffnung gefällt mir sehr.« Er dachte dabei sicher nicht an die Aussicht auf einen Völkerbund.28
Zeitungskommentatoren taten das Ihrige, um noch mehr Deutsche davon zu überzeugen, dass ein neues Kapitel des Krieges, ein »Endkampf« um das Überleben der Nation, eine reale Möglichkeit war.29 Eine vielgelesene konservative Zeitung, der Berliner Lokal-Anzeiger, prophezeite ihren Lesern, die Erklärung von Prinz Max bedeute, dass es nun Präsident Wilson obliege, die Entscheidung zwischen einem ehrenhaften Frieden und der Zerstörung weiterer Landschaften und vieler weiterer Menschenleben zu treffen. »Bis zum letzten Blutstropfen«, hieß es in dem Kommentar, »wird das ganze deutsche Volk gegen diejenigen kämpfen, die ihm einen demütigenden Frieden diktieren wollen. Ungebrochen steht unsere Front noch in Feindesland. Gegen den Angriff der Verbündeten durch bulgarisches Gebiet werden wir uns leichter verteidigen können als gegen die Millionenheere Russlands, die uns drei Jahre lang vergebens bedrohten.«30 Theodor Wolff, der liberale Chefredakteur des Berliner Tageblatts, ein Mann, der besser informiert war als die meisten anderen Beobachter der deutschen Politik, hielt den Friedensbefürwortern öffentlich entgegen, Deutschland habe die Kraft, noch lange weiterzukämpfen.31 Nur einige sozialdemokratische Zeitungen warnten davor, die Rede des Prinzen Max simplifizierend darauf zu reduzieren, dass nur noch die Wahl zwischen »ehrenhaftem Frieden« und fortdauerndem Krieg bestand.32
Nur wenige Stunden nachdem Prinz Max die Vision einer schicksalhaften Entscheidung zwischen Endkampf und ehrenhaftem Frieden präsentiert hatte – und während deutsche Zeitungsleser sich noch die veröffentlichten Meinungen zu Gemüte führten –, skizzierte ein in Berlin stationierter Marineoffizier, Kapitän William Michaelis, in einem Schreiben an Levetzow seine Vorstellungen darüber, auf welche Weise die deutsche Überwasserflotte ihren Beitrag zum bevorstehenden Endkampf leisten konnte.33 In seinem große Beachtung findenden Brief stellte er die These auf, die Überwasserflotte sei momentan die einzig verbliebene Waffe, mit der Deutschland noch einen »sichtbaren militärischen Erfolg« erringen könne.34 Wenn die Marine zu einem heroischen Endkampf antrete, werde das, so sagte er voraus, die deutsche Bevölkerung aufrütteln und einen »positiven Stimmungswandel« herbeiführen. Im Zeichen dieses Umschwungs werde das deutsche Volk dem Austausch diplomatischer Friedensnoten eine Absage erteilen und sich dafür entscheiden, den Kampf so lange weiterzuführen, wie es nötig sei.35 Michaelis’ Brief fand allerhöchste Zustimmung. Schon wenige Tage später begann eine Gruppe von Seekriegsplanern auf Anweisung Scheers mit der Ausarbeitung geheimer Operationspläne, um die Vision der SKL, dass der Prolog zum deutschen »Endkampf« auf See stattfinden würde, in die Tat umzusetzen.
Während die Flottenstrategen im Geheimen an Einsatzplänen arbeiteten, gewann um sie herum die Verheißung eines Endkampfs zunehmend an Virulenz, vor allem weil die diplomatischen Noten der US-Regierung im Verlauf der Oktober-Sondierungen immer rigoroser wurden.36 Zum Wortführer derjenigen, die den Standpunkt vertraten, Deutschland sei nicht besiegt und brauche nicht unbedingt einen sofortigen Waffenstillstand, wurde der Industrielle und Intellektuelle Walther Rathenau. Er hatte schon vor der Rede des Prinzen Max, am 2. Oktober, in einem Zeitungsartikel erklärt, Deutschland sei in der Lage weiterzukämpfen. Wahrscheinlich in Kenntnis dessen, was innerhalb der OHL vor sich gegangen war, hatte er gefragt: »Sollen wir uns von den Nerven der Pariser beschämen lassen? Der Feind steht nicht zwischen Jüterbog und Wittenberg und wird, solange wir leben, nicht dastehen; doch wenn er da stände, so hätten wir zu kämpfen. Zu kämpfen um das, was Not tut: den Frieden in Ehren.«37 Nach der Rede von Prinz Max gewann die Argumentation Rathenaus eher noch an Kraft. Einen Tag nachdem Michaelis seine Gedanken über einen möglichen Beitrag der Marine zum Endkampf zu Papier gebracht hatte, gab Rathenau öffentlich zu bedenken, was Wilsons 14 Punkte für Deutschland auch bedeuten würden: eine Zeche von bis zu 50 Milliarden für den Wiederaufbau Belgiens und Nordfrankreichs, dazu den Verlust des Elsass und möglicherweise auch Lothringens und Danzigs. Er stellte die Frage, ob die Initiatoren der von ihm als »übereilt« bezeichneten Friedensinitiative »das übersehen« hätten. Er forderte sodann die Entlassung Ludendorffs: »Wer die Nerven verloren hat, muss ersetzt werden.«38
Rathenaus Thesen stießen auf breite Resonanz. Sogar die alldeutsche Deutsche Zeitung und der ultranationalistische und antisemitische Reichsbote vergaßen für kurze Zeit ihre traditionelle Abneigung gegen einen Juden wie Rathenau und stellten sich hinter seine Argumente.39 Scheer bescheinigte Rathenau ein »sehr treffendes Urteil«.40 Im Verlauf des Oktobers wurde der Chor derjenigen immer lauter, die forderten, die Regierung müsse den Austausch diplomatischer Noten mit Wilson beenden. In Anspielung auf die historische Rolle deutscher Patrioten in den napoleonischen Kriegen fragte die nationalistische Presse: »Ist kein Yorck da?«41 Ein Mitglied der Regierung des Prinzen Max von Baden gab Mitte Oktober 1918 zu bedenken: »Das Volk würde es nicht verstehen, wenn wir jetzt, wo wir noch im Feindesland [stehen], die Waffen streckten.«42 Selbst der sozialdemokratische Vorwärts, das Parteiorgan der SPD, druckte wehrfreudige Artikel und erklärte, es könnten Umstände eintreten, in denen es besser sei, weiterzukämpfen als einen demütigenden Frieden hinzunehmen.43 Als Friedrich Ebert am 24. Oktober eine Rede im Reichstag hielt, versprach er sogar, die Sozialdemokraten würden ihr Land nicht im Stich lassen, falls der ersehnte Friede nicht zustande käme.44
Während im Inneren Deutschlands diese Diskussionen im Gang waren, wurde an der Front weiterhin gekämpft. Obgleich die Offensiven der Entente an Schwung verloren, ging es für die deutschen Truppen weiterhin rückwärts.45 Mitte des Monats begann dann jedoch sogar Ludendorff umzudenken und näherte sich der Position, dass ein Weiterkämpfen möglicherweise besser wäre als die Fortsetzung der Friedensbemühungen. Ursache für seine Meinungsänderung war die zweite Friedensnote der Amerikaner. In dieser schlug der US-Präsident eine härtere Tonart an als in seiner zurückhaltend formulierten ersten Antwortnote. Nach dem Empfinden des liberalen Staatssekretärs Conrad Haußmann schlug die zweite amerikanische Note »wie eine Bombe« ein, ließ sie doch keinen Zweifel daran, dass ein Friede nach den Grundsätzen Wilsons nichts anderes bedeuten würde als die Kapitulation Deutschlands.46 Konkret hieß es in der zweiten Note, bevor die USA den Briten und Franzosen auch nur das Angebot machen könnten, die deutschen Friedensvorschläge formell zur Kenntnis zu nehmen und sie mit Briten und Franzosen zu erörtern, müsse Deutschland die endgültige Festschreibung einer für die Entente vorteilhaften militärischen Lage als Vorbedingung für einen Waffenstillstand akzeptieren. Konkret bedeutete das, dass die deutschen Truppen sich aus den von ihnen besetzten Gebieten in Frankreich und Belgien würden zurückziehen müssen, und zwar nach einem von den Generälen der Entente vorgegebenen und kontrollierten Zeitplan. Während Prinz Max betont hatte, wie wichtig es für Deutschland war, einen mit der deutschen Ehre vereinbaren Frieden zu erlangen, warfen die Amerikaner in ihrer Antwortnote dem deutschen Militär unehrenhaftes Verhalten auf den Schlachtfeldern und auf See vor. Ludendorff zog aus der Note den Schluss, dass es höchste Zeit war, noch einmal darüber nachzudenken, ob Deutschland wirklich einen Waffenstillstand brauchte. Bei einer entscheidenden Unterredung mit der zivilen Regierung Mitte Oktober begann schließlich auch er, offen von einem »Endkampf« mit realen Erfolgsaussichten zu reden.47
Den Anstoß zu diesem Wechsel des Tenors gab nicht zuletzt die öffentliche Meinung in Großbritannien und den USA. Am 11. Oktober 1918 versenkte ein deutsches U-Boot in Sichtweite der Bucht von Dublin ein Passagierschiff, mit dem Ergebnis, dass 450 Menschen starben, darunter 135 Frauen und Kinder und einige Amerikaner.48 Diese Freveltat empörte Briten und Amerikaner und weckte bei beiden Nationen auch Erinnerungen an die Versenkung der Lusitania im Mai 1915. Doch anders als Ludendorff, der in seinem Eintreten für einen Verhandlungsfrieden schwankend geworden war, erkannte Prinz Max spätestens Mitte Oktober, dass ein Weiterkämpfen nur dazu führen würde, dass Deutschland später einen noch schlechteren Friedensvertrag akzeptieren müsste. Als Ludendorff am 17. Oktober erklärte, schlimmer als mit den von den Amerikanern jetzt angebotenen Friedensbedingungen könne es für Deutschland nicht kommen, entgegnete Prinz Max: »Oh ja, sie brechen in Deutschland ein und verwüsten das Land.«49 Entschlossen, dieses Fortsetzungskapitel zu verhüten, schickte Prinz Max am 20. Oktober 1918 eine dritte versöhnliche Note an die USA. Er stimmte darin den amerikanischen Forderungen zu und verteidigte das Verhalten der deutschen Truppen im Krieg. Zu diesem Zeitpunkt bewegten sich viele Deutsche auf die Einsicht zu, die einzige Möglichkeit, wie ihr Land sich noch einen erträglichen Friedensschluss nach Wilsons Muster sichern könne, sei die Abdankung des Kaisers.
Das ging der OHL zu weit. Als die Amerikaner in ihrer Antwort vom 23. Oktober 1918 deutlicher als je zuvor durchblicken ließen, dass sie einem republikanischen Deutschland gegenüber mehr Nachsicht zeigen würden (oder wenigstens einem Deutschland ohne Kaiser), verlegte sich dieselbe OHL, die noch Ende September einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hatte, darauf, die Arbeit der Regierung zu sabotieren und die diplomatischen Friedensfühler zu kappen.50 Am 24. Oktober erließen Ludendorff und Hindenburg einen Heeresbefehl, in dem sie die Forderungen des amerikanischen Präsidenten als unannehmbar bezeichneten und ein Ende des Austauschs diplomatischer Noten forderten. Dann gingen sie daran, konspirativ die Entlassung des Reichskanzlers einzufädeln. Doch zum ersten Mal seit Kriegsausbruch erlitt Ludendorff mit einer seiner politischen Intrigen Schiffbruch. Der Kaiser, verärgert über Ludendorffs politische Manöver, entließ ihn am 26. Oktober 1918, wohl auch in der Hoffnung, damit den Amerikanern glaubhaft zu machen, dass in Deutschland neue Männer am Ruder waren. Hindenburg genoss im Volk eine so große Beliebtheit, dass man nicht wagte, ihn anzutasten; er wurde angewiesen, im Amt zu bleiben.51
Jetzt, da es ums Ganze ging, sahen die Befehlshaber der deutschen Marine ihre Stunde gekommen. Jetzt konnten sie den Beweis dafür liefern, dass die deutsche Überwasserflotte in der Lage war, sich im offenen Kampf zu bewähren und dem deutschen Volk neuen Kampfesmut einzuhauchen – dies zu unterlassen bedeutete nach der Logik ihrer ultra-nationalistischen Weltanschauung, sowohl die Existenz der Flotte als auch die der Nation preiszugeben.52 Es war vielleicht kein Zufall, dass die Operationsplaner der Marine ihr Konzept für den Beitrag der Seestreitkräfte zum »Endkampf« genau am 24. Oktober 1918 fertigstellten, an dem Tag, an dem die OHL beschloss, Prinz Max von Baden auszubooten.
Die Entscheidungsprozesse dieser Offizierselite werden vielfach als Ausfluss der besonderen Mentalität einer Gruppe von Männern gedeutet, deren Erwartungshorizont von der ganz eigenen Welt geprägt war, in der sie lebten: der Welt des Offizierskorps der kaiserlichen Marine. Historiker wie Hans-Ulrich Wehler haben in diesem Sinn in Bekenntnissen und Aufrufen zum »Endkampf« nicht mehr gesehen als »Durchhalteparolen« und einen »letzten Propagandakreuzzug«.53 Selbst wenn in beiden Formulierungen ein Stückchen Wahrheit steckt, bleibt der Beitrag, den sie zum Verständnis des Schlusskapitels des Ersten Weltkrieges leisten können, begrenzt. Hinter dem Befehl der Seekriegsleitung, den Angriff auf Großbritannien zu wagen, steckte nicht nur der Wunsch nach einer glorreichen Zukunft für die deutsche Kriegsflotte, sondern auch die Essenz aus einem allgemeineren gesellschaftlichen und politischen Diskurs über den Topos »Endkampf«.54 Die Seekriegsleitung war kein Monolith; sie war nur eine von mehreren einflussreichen Organisationen, in denen darüber nachgedacht wurde, wie Deutschland den »Endkampf« meistern könnte. In der OHL zermarterten sich Heeresoffiziere den Kopf darüber, wie der Krieg weitergeführt werden sollte und konnte, wenn man sich von der relativen Stabilität verabschiedete, die der Stellungskrieg bis dahin geboten hatte. Sie dachten über einen Bewegungskrieg neuen Typs nach, bei dem dichtbesiedelte Gebiete in Belgien und in den deutschen Westprovinzen zu »Kampfzonen« werden würden – um den Preis einer nicht abzuschätzenden Zahl von Menschenleben. Beamte im preußischen Kriegsministerium suchten währenddessen gedanklich nach Mitteln und Wegen, Hunderttausende zusätzliche Soldaten für den Fronteinsatz auszuheben, so dass Deutschland den Krieg fortführen konnte. Wenn Differenzen zwischen den Planungsstäben in SKL, OHL und Kriegsministerium, den Leitartiklern der nationalen Presse und den nationalistischen Volksrednern bestanden, die die Vorstellung vom »Endkampf« als einer aussichtsreichen Strategie propagierten, dann waren es eher Unterschiede in Bezug auf Machbarkeit als in Bezug auf Mentalität. Mit einer auslaufbereiten Flotte im Rücken war es für die Offiziere der SKL wesentlich einfacher, von der Planungs- auf die Einsatzphase des vielbeschworenen Endkampfs umzuschalten, als für ihre Kollegen in der Heeresleitung oder im Kriegsministerium.55
Nach Erteilung des Befehls zum Auslaufen war Admiral Scheer in aufgekratzter Stimmung. Die Mission, die er seiner Flotte befohlen hatte, übertraf in der Größenordnung alles, was sich in den zurückliegenden vier Kriegsjahren auf See abgespielt hatte. Zum ersten Mal würden alle verfügbaren Schiffe der deutschen Überwasserflotte, unterstützt von U-Booten, Kurs auf Englands südöstliche Flanke nehmen, ausdrücklich zu dem Zweck, die Royal Navy zu einer Schlacht herauszufordern. Um die Briten zu provozieren, sollte eine kleine Zahl deutscher Kriegsschiffe in die Themsemündung einfahren und London unter Granatenbeschuss nehmen. Ungefähr gleichzeitig damit sollten mehr als 800 Kilometer weiter nördlich einige wenige deutsche U-Boote etwas vollbringen, das sich bis dahin stets als undurchführbar erwiesen hatte: Sie sollten die Sperren überwinden, die den wichtigsten Kriegshafen und Stützpunkt der Royal Navy bei Scapa Flow schützten, und so viele der dort liegenden britischen Kriegsschiffe versenken oder manövrierunfähig schießen, wie sie konnten. (Wie vorherzusehen, wurde ein deutsches U-Boot versenkt, als es diesen Auftrag zu erfüllen versuchte, bevor es auch nur einem einzigen britischen Schiff die kleinste Schramme zufügen konnte; 35 deutsche Seeleute fanden dabei den Tod.56) Sobald die britische Flotte aus Scapa Flow auslief, um den deutschen Angriff abzuwehren, sollte sie von einer Phalanx weiterer deutscher U-Boote, die ihr entlang der erwarteten Route auflauern würden, provoziert und geschwächt werden. Gingen die Briten in diese Falle, so konnte man hoffen, die Royal Navy werde, wenn sie schließlich auf die deutsche Überwasserflotte traf, so geschwächt sein, dass ihre zahlenmäßige Überlegenheit geschrumpft und ein deutscher Sieg eine reale Möglichkeit wäre.
Der Oberbefehlshaber der deutschen Flotte, Admiral Franz Ritter von Hipper, rechnete damit, dass er den Einsatz nicht überleben würde. Doch auch wenn das Offizierskorps der Marine überzeugt war, der ehrenvolle Tod unter deutscher Flagge sei einer Kapitulation auf See vorzuziehen, war der Einsatz nicht als Himmelfahrtskommando gedacht, wie die heftigsten Kritiker der Seekriegsleitung es später behaupteten.57 Es ist vielmehr treffender, die Operation als einen vorsätzlichen Akt des militärischen Terrorismus einzustufen.58 Sie sollte den Amerikanern klarmachen, dass die Reden des zivilen Politikers Prinz Max von Baden und seine Botschaft, in Deutschland seien neue Männer am Ruder, irrelevant waren. Nach innen sollte die Operation eine Botschaft an die Soldaten und vor allem an die Heimatfront senden, und diese Botschaft besagte, dass die Politik des Reichskanzlers und seine diplomatischen Noten ein Fehler waren. Der Sturmlauf der deutschen Marine gegen die britische Flotte würde, so sagte Scheer es in einem Brief voraus, den er seiner Frau zu ihrem Geburtstag am 27. Oktober 1918 schrieb, den Deutschen wieder zu mehr Selbstachtung verhelfen und ihren Willen zum Weiterkämpfen stärken. »An den Untergang unseres Volkes kann ich nicht glauben«, schrieb Scheer. »Aus der Flut von Hass, die uns jetzt umströmt, wird doch einmal, und ich glaube sogar bald, das Gefühl der Achtung vor unserer Willenskraft aufgehen und uns zu Ehren und Ansehen bringen.«59 Dieses Denken folgte derselben Logik wie das Mantra, dass Selbstaufopferung wichtiger sei als das schnöde Überleben, ein Mantra, das Hitler in der Endphase des Zweiten Weltkriegs daran hinderte, die Unausweichlichkeit der militärischen Niederlage einzusehen; das Festhalten an dieser Logik kostete 1944/45 Millionen Menschenleben. Der Unterschied war, dass im Oktober 1918 dieser Akt aufopfernder Gewalt letztlich nicht stattfand.
Helden
Die Seekriegsplaner hatten drei Wochen gebraucht, um ihre Operationspläne für den Angriff auf die Royal Navy auszuarbeiten. Dann machten die Matrosen und Heizer der deutschen Kriegsschiffe die Pläne innerhalb von 24 Stunden zu Makulatur. Zuerst wurde die Feindfahrt wegen schlechten Wetters verschoben, doch als dann am 30. Oktober 1918 die Anker gelichtet werden sollten, kam es zu einem der bedeutsamsten Fälle soldatischen Ungehorsams in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Matrosen und Heizer, die die Ausführung der ihnen erteilten Befehle verweigerten, wussten nichts Bestimmtes über die Einsatzpläne, waren aber sicher, dass etwas in der Luft lag. Allein schon der Materialaufwand, der in der Vorbereitungsphase betrieben wurde, ließ keinen Zweifel daran, dass eine Großoffensive bevorstand: erhöhte Kohleanlieferungen, die Anzahl der seeklar gemachten Schiffe und das Auftreten der Offiziere, all das ließ darauf schließen, dass die Überwasserflotte kurz davor war, auf große Angriffsfahrt zu gehen, und das sprach sich bei den Mannschaften herum. Niemand schenkte den offiziellen Verlautbarungen Glauben, denen zufolge die gesamte deutsche Überwasserflotte vor Wilhelmshaven zusammengezogen wurde, um ein Manöver abzuhalten.
Einige Matrosen und Heizer deuteten die Zeichen und verdrückten sich. Die eigentlichen Zentren des Ungehorsams waren jedoch die größeren Schiffe, und die Befehlsverweigerungen ereigneten sich teils zu einem Zeitpunkt, an dem die Geschwaderkommandeure der Flotte bei der SKL ihre Instruktionen abholten, teils unmittelbar danach, als die Schiffskapitäne den Befehl zum Seeklarmachen erteilten. Manche Matrosen beschädigten wichtige Schiffsbauteile, indem sie etwa die Ankerwinden unbrauchbar machten, um so das Auslaufen ihres Schiffs zu erschweren. Andere löschten die Kohlefeuer unter den Dampfkesseln, so dass ihre Kapitäne auf antriebslosen Schiffen saßen. Dies waren Sabotageakte, auf die schwerste Strafen standen, doch blieben gewalttätige Reaktionen zunächst weitgehend aus. Am dichtesten schrammten die Kriegsschiffe Helgoland und Thüringen daran vorbei, auf Befehl kaisertreuer Offiziere beschossen zu werden.60 Ein Marinesoldat an Bord eines Torpedoboots, das den Auftrag erhalten hatte, die Ordnung wiederherzustellen, musste mit »ohnmächtiger Wut« ansehen, wie die Meuterer auf den beiden Schiffen »unsere Maschinengewehre, unsere Geschütze und Torpedos« klarmachten und auf sein Torpedoboot richteten. Die Minuten, die vergingen, bis die Matrosen schließlich doch aufgaben, kamen ihm wie Stunden vor.61 Die Meuterei fand fast so schnell ein Ende, wie sie begonnen hatte, weil sie ein begrenztes Ziel verfolgte: Die Matrosen wollten einfach nur das Auslaufen ihrer Schiffe zum Angriff auf die britische Flotte verhindern; sie machten keinen Versuch, dauerhaft die Kontrolle über die Flotte zu übernehmen, und es kam während der Dauer ihrer Meuterei nicht zu nennenswerten Gewalttaten.
Am 1. November 1918 glaubten die Flottenbefehlshaber trotz der Tatsache, dass die Matrosen den Abbruch der Offensive erzwungen hatten, die Lage wieder unter Kontrolle zu haben. Vizeadmiral Kraft, Befehlshaber des III. Geschwaders, dem 5000 Seeleute und die Kriegsschiffe König, Bayern, Großer Kurfürst, Kronprinz und Markgraf unterstanden, vergatterte seine Männer zu einem Manöver, um ihre Loyalität auf die Probe zu stellen. Nachdem die Mannschaften diese Prüfung bestanden und die Manöver nach Anweisung ausgeführt hatten, lief das Geschwader in der Nacht zum 1. November in den Kieler Hafen ein. Kurz vor dem Andocken wurden an Bord der Markgraf47 Matrosen festgenommen. Einige von ihnen wurden in eine Haftanstalt in der Feldstraße im Zentrum Kiels verbracht. Als das Geschwader vor Anker lag, suchte Kraft den kurz vorher ernannten Gouverneur von Kiel, Vizeadmiral Wilhelm Souchon, auf, um mit ihm die Lage zu besprechen. Die beiden Männer kamen überein, den Matrosen einen Landgang zu erlauben. Sie verteidigten diese Entscheidung später mit der Begründung, sie hätten geglaubt, die Disziplin der Truppe würde halten, solange von oben her kein weiterer Versuch gemacht würde, eine Offensive zu starten.62 In einem Krieg, der von unklugen Entscheidungen der deutschen Militärführung geprägt war, sollte diese Entscheidung der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Umsturz in Kiel
Die Meuterei der Seeleute Ende Oktober 1918 war nicht der erste Fall von Ungehorsam deutscher Matrosen im Ersten Weltkrieg. 1917 waren nach einer Meuterei von Marinesoldaten die Heizer Albin Köbis (25) und Max Reichpietsch (23) hingerichtet worden. Die Erinnerung an das Los dieser beiden jungen Männer war bei den Kieler Matrosen präsent und blieb nicht ohne Einfluss auf ihr Verhalten. Nachdem ihre Schiffe angedockt hatten, suchten rund 250 von ihnen, unter ihnen eine kleine Zahl von Offiziersschülern – die große Mehrheit ihrer Kameraden hielt sich heraus –, am Abend des 1. November das Kieler Gewerkschaftshaus auf. Zwei Themen standen im Mittelpunkt ihrer Diskussion: Lebenswille und Loyalität. Die Männer trieb die Sorge um, sie könnten einen zweiten Anlauf der SKL, zu einer Offensive gegen die Royal Navy abzulegen, womöglich nicht verhindern. Sie besprachen auch, was sie tun konnten, um ihren wegen der Meuterei verhafteten Kameraden das Schicksal zu ersparen, das Köbis und Reichpietsch ereilt hatte. Am Ende der Versammlung beschloss dieser kleine harte Kern hellhörig gewordener Seeleute, sich am folgenden Tag wieder zu treffen.63
Verdeckte Ermittler der politischen Polizei, die die Lage aufmerksam im Auge behielt, mischten sich, als Matrosen verkleidet, in die Bewegung. Sie fanden sich am nächsten Tag am Gewerkschaftshaus ein, wo man ihnen vertraulich die Adresse eines geheimen Versammlungsorts mitteilte, eines Exerzierplatzes an der Waldwiese im Süden Kiels. Als sie dort ankamen, bot sich ihnen ein interessantes Bild: Zwölf Wachleute hielten Ausschau nach ungebetenen Gästen von Polizei oder Militär (nicht wissend, dass deren Agenten, als Seeleute verkleidet, bereits vor Ort waren). An die hundert weitere standen wartend beieinander, während immer neue Gruppen von Seeleuten eintrafen. Die Versammlung wurde eröffnet, als von den Zehntausenden in Kiel weilenden Seeleuten und Arbeitern, die sich der Bewegung hätten anschließen können, 600–700 den Weg zur Waldwiese gefunden hatten.64 Von den vielen, die im Laufe dieser Versammlung das Wort ergriffen, erkannten die Polizeiagenten, die sich unter die Menge gemischt hatten, nur einen: Hermann Popp von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD