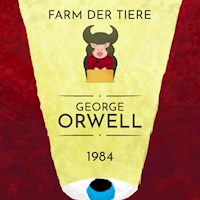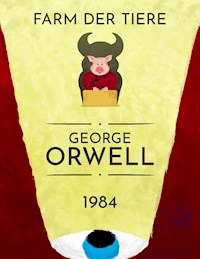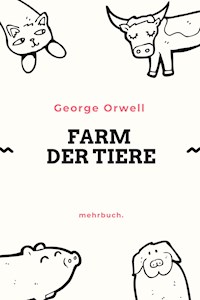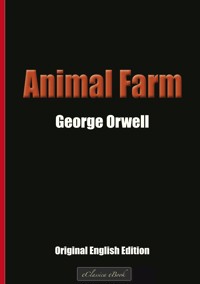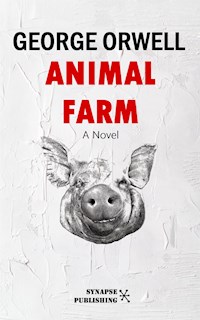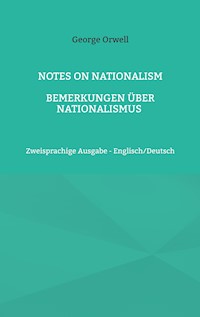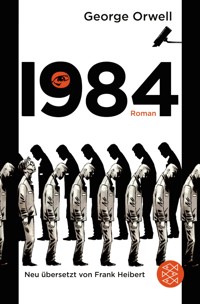
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
George Orwells großer dystopischer Klassiker in meisterhafter Neuübersetzung 1948 beendete George Orwell nach dreijähriger Arbeit seinen letzten Roman, der ihn weltberühmt machen sollte: »1984« schildert eine Welt, in der ein totalitärer Überwachungsstaat das Leben der Menschen bis ins Letzte bestimmt. Was Orwell, neben der sowjetischen Realität, noch als bedrohliche Perspektive sah, ist heute längst Wirklichkeit geworden, wenngleich es nicht (nur) Regierungen, sondern vor allem Konzerne sind, die uns aushorchen und beeinflussen. Frank Heibert legt mit seiner Neuübertragung einen ebenso mutigen wie souveränen Text vor, der die Bezeichnung übersetzerisches Meisterwerk rechtfertigt – die definitive Ausgabe von »1984« für das 21. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
George Orwell
1984
Roman
Biografie
1948 beendete George Orwell nach dreijähriger Arbeit seinen letzten Roman, der ihn weltberühmt machen sollte: »1984« schildert eine Welt, in der ein totalitärer Überwachungsstaat das Leben der Menschen bis ins Letzte bestimmt. Was Orwell, neben der sowjetischen Realität, noch als bedrohliche Perspektive sah, ist heute längst Realität geworden, wenngleich es nicht (nur) Regierungen, sondern vor allem Konzerne sind, die uns aushorchen und beeinflussen.
Frank Heibert legt mit seiner Neuübertragung einen ebenso mutigen wie souveränen Text vor, der die Bezeichnung übersetzerisches Meisterwerk rechtfertigt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Neuübersetzung
Erschienen bei FISCHER E-Books
Das Original erschien am 8. Juni 1949 unter dem Titel »Nineteen Eighty-Four: A Novel« bei Secker & Warburg in London.
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einer Idee und mit einer Illustration von Reinhard Kleist
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491375-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Teil 2
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Teil 3
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Die Grundzüge des Neusprech
Nachwort des Übersetzers
Es war nicht, es ist
Teil 1
1
Es ist ein strahlendkalter Apriltag, und gerade schlägt’s dreizehn. Winston Smith schlüpft, das Kinn auf die Brust gedrückt, um dem fiesen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastür in die Victory Mansions, aber nicht schnell genug, um den hereinwirbelnden körnigen Staub draußen zu halten.
Im Flur riecht es nach gekochtem Kohl und alten Fußabtretern. Am einen Ende ist ein Farbplakat an die Wand getackert. Zu groß für Innenräume. Es zeigt ein riesiges Gesicht, über einen Meter breit, sonst nichts: ein Mann um die fünfundvierzig, kantig-attraktiv mit vollem schwarzem Schnurrbart. Winston geht zur Treppe. Zwecklos, es mit dem Fahrstuhl zu probieren. Auch an guten Tagen funktioniert er meist nicht, und derzeit gibt es nur bei Dunkelheit Strom. Das gehört zum Sparkurs, zur Vorbereitung auf Eine Woche Hass. Seine Wohnung liegt im 6. Stock, und da er neununddreißig ist und über dem rechten Knöchel ein Krampfadergeschwür hat, geht er es langsam an und macht unterwegs mehrmals Pause. Auf jedem Treppenabsatz starrt gegenüber vom Fahrstuhlschacht das Plakat mit dem riesigen Gesicht von der Wand. Es ist eines von den Bildern, die so raffiniert gemacht sind, dass einem der Blick überallhin folgt, wenn man sich bewegt. Darunter steht DER GROSSE BRUDER SIEHT DICH.
In der Wohnung liest eine sonore Stimme eine Reihe Zahlen vor, irgendwas über die Produktion von Roheisen. Die Stimme kommt aus einer rechteckigen Metalltafel, die einem stumpf gewordenen Spiegel ähnelt und in die rechte Wand eingelassen ist. Winston dreht an einem Schalter, die Stimme wird etwas leiser, aber die Worte sind immer noch verständlich. Das Gerät (es heißt Telemonitor) kann man herunterdrehen, aber nicht komplett abschalten. Er tritt ans Fenster: eine schmächtige, schwächliche Gestalt, und der blaue Overall, die Parteiuniform, unterstreicht die Magerkeit seines Körpers noch. Er ist hellblond, strahlt einen natürlichen Optimismus aus, und seiner rauen Haut sind die grobe Seife, die stumpfen Rasierklingen und die Kälte des gerade zu Ende gegangenen Winters anzumerken.
Die Außenwelt sieht auch durch die Fensterscheibe kalt aus. Unten auf der Straße wirbeln kleine Windböen Staub und Papierfetzen hoch, und trotz der Sonne und dem hartblauen Himmel scheint Farbe nur auf den überall hingeklebten Plakaten vorzukommen. Das Gesicht mit dem schwarzen Schnurrbart starrt von jeder größeren Straßenecke herab, genauso von der Hausfassade direkt gegenüber. DER GROSSE BRUDER SIEHT DICH steht auch dort, die dunklen Augen blicken tief in Winstons Augen. Unten, auf Straßenhöhe, flattert noch ein Plakat, an einer Ecke eingerissen, unstet im Wind, es entblößt und bedeckt abwechselnd das einzelne Wort ENGSOZ. Weit weg zieht ein Hubschrauber zwischen den Dächern nach unten, steht einen Moment lang wie eine Schmeißfliege in der Luft und zischt dann in einem Bogen wieder fort. Das ist die Polizeipatrouille, die den Leuten in die Fenster späht. Aber eigentlich sind die Patrouillen unwichtig. Wichtig ist nur die Denkpolizei.
Hinter Winston plappert die Stimme vom Telemonitor immer noch fröhlich von Roheisen und der Übererfüllung des Neunten Dreijahresplans. Ein Telemonitor kann gleichzeitig empfangen und senden. Das Gerät fängt jedes Geräusch von Winston auf, das lauter ist als ein ganz leises Flüstern; wenn er sich im Sichtfeld der Metalltafel befindet, kann es ihn auch sehen. Natürlich weiß man nie, ob man in einem bestimmten Moment gerade beobachtet wird. Wie oft oder nach welchen Kriterien sich die Denkpolizei in den Schaltkreis eines Einzelnen einklinkt, kann man nur spekulieren. Durchaus vorstellbar, dass sie jeden Einzelnen permanent beobachtet. Jedenfalls kann sie sich nach Belieben überall einklinken. Man muss mit der Annahme leben – und tut es auch, aus Instinkt gewordener Gewohnheit –, dass jeder Laut, den man von sich gibt, mitgehört und jede Bewegung, außer im Dunkeln, genau betrachtet wird.
Winston kehrt dem Telemonitor weiter den Rücken zu. Das ist sicherer so; wobei, das weiß er wohl, auch ein Rücken verräterisch sein kann. Einen Kilometer entfernt ragt das Wahrheitsministerium, sein Arbeitsplatz, massiv und weiß in der schmuddeligen Landschaft empor. Das ist London, denkt er mit dumpfem Abscheu, die bedeutendste Stadt von Startbahn Eins, und das ist wiederum die Provinz mit der drittgrößten Bevölkerung Ozeaniens. Ob London schon immer so still war? Angestrengt durchforstet er seine Kindheitserinnerungen. Haben diese verrottenden Häuser aus dem neunzehnten Jahrhundert schon immer das Stadtpanorama bestimmt, ihre mit Holzbalken abgestützten Seitenwände, die Fenster mit Pappe geflickt, die Dächer mit Wellblech, die absurden, in alle Richtungen weggesackten Gartenmauern? Und die Ruinengrundstücke, wo Gipsstaub in der Luft hängt und Weidenröschen auf den Trümmerhaufen wuchern? Die größeren Bombenbrachen, Platz für unzählige verlotterte Siedlungen aus Holzhütten, die nach Hühnerhäusern aussehen? Doch es hat keinen Zweck, er weiß es nicht mehr: Aus seiner Kindheit sind nur eine Reihe greller Tableaus geblieben, ohne Hintergrund und weitgehend ohne Sinn.
Das Wahrheitsministerium – »Miniwahr« auf Neusprech[1] – hebt sich deutlich von allem anderen in seinem Blickfeld ab. Ebene um Ebene ragt eine riesenhafte Pyramidenstruktur aus weiß schimmerndem Beton auf, dreihundert Meter hoch. Von da, wo er steht, kann Winston die eleganten Lettern der drei Parteislogans auf der weißen Fläche gerade so entziffern:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSEN IST STÄRKE
Angeblich besteht das Wahrheitsministerium aus dreitausend oberirdischen Büros und setzt sich unterirdisch entsprechend verzweigt fort. In ganz London gibt es nur noch drei weitere Gebäude von vergleichbarer Anmutung und Größe. Die Architektur der Umgebung ist neben ihnen so restlos zwergenhaft, dass man sie alle vier gleichzeitig vom Dach der Victory Mansions aus sehen kann. Sie beherbergen die vier Ministerien, aus denen der gesamte Regierungsapparat besteht. Das Wahrheitsministerium, das sich mit Nachrichten, Unterhaltung, Bildung und Kultur befasst. Das Friedensministerium, das sich um den Krieg kümmert. Das Liebesministerium, das für Recht und Ordnung sorgt. Und das Wohlstandsministerium, das für Wirtschaft zuständig ist. Auf Neusprech lauten ihre Namen: »Miniwahr«, »Minipax«, »Minilieb« und »Miniwohl«.
Das Liebesministerium macht einem die meiste Angst. Es hat überhaupt keine Fenster. Winston ist noch nie drin gewesen, nicht mal näher als einen halben Kilometer dran. Betreten darf man es nur in offizieller Sache, und auch dann erst, wenn man einen Irrgarten aus Stacheldraht, diverse Stahltüren und verborgene MG-Nester passiert hat. Schon auf den Zugangsstraßen, die zu seinen äußeren Barrieren führen, patrouillieren mit mehrgliedrigen Schlagstöcken bewaffnete Wachen, schwarz uniformierte Gorillas.
Mit einem Ruck dreht sich Winston um. Er hat seine übliche, still optimistische Miene aufgesetzt, wie sie immer angeraten ist, wenn man sich dem Telemonitor zuwendet, und geht hinüber in die winzige Küche. Um das Ministerium zu dieser Uhrzeit verlassen zu können, hat er sein Mittagessen in der Kantine geopfert, und ihm ist klar, dass er bis auf einen Kanten dunkel gefärbtes Brot, den er für das morgige Frühstück aufheben muss, nichts zu essen da hat. Er nimmt eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit vom Regal, auf dem schlichten weißen Etikett steht VICTORY GIN. Der riecht widerlich ölig, wie chinesischer Reisschnaps. Winston gießt eine knappe Teetasse voll, wappnet sich für den Schock und kippt den Inhalt wie eine Dosis Medizin.
Sein Gesicht läuft sofort knallrot an, seine Augen tränen heftig. Das Zeug ist wie Salpetersäure, und beim Schlucken fühlt es sich an, als würde einem ein Gummiknüppel über den Hinterkopf gezogen. Aber das Brennen im Bauch lässt bald nach, und die Welt sieht wieder heiterer aus. Aus einer zerdrückten Schachtel Victory-Zigaretten zieht er eine, hält sie aber unvorsichtigerweise aufrecht, so dass der Tabak auf den Boden rieselt. Mit der nächsten hat er mehr Erfolg. Er geht wieder ins Wohnzimmer und setzt sich an ein Tischchen links vom Telemonitor. Aus dessen Schublade zieht er einen Federhalter, ein Tintenfässchen und ein dickes Notizbuch im Quarto-Format mit rotem Rücken und marmoriertem Einband.
Aus irgendeinem Grund ist der Telemonitor in seinem Wohnzimmer an einer ungewöhnlichen Stelle montiert. Statt wie üblich auf einer schmaleren Endwand, von wo aus sich der ganze Raum überblicken lässt, steckt er in der längeren Wand, dem Fenster gegenüber. Auf der einen Seite gibt es die schmale Nische, wo Winston gerade sitzt und die beim Bau der Wohnungen wahrscheinlich für Bücherregale gedacht war. Wenn er sich nicht zu weit aus der Nische vorbeugt, ist Winston außerhalb der Reichweite des Telemonitors, zumindest visuell. Hören kann man ihn natürlich immer noch, aber nicht sehen, solange er in dieser Position bleibt. Auf das, was er jetzt vorhat, ist er zum Teil erst wegen dieses ungewöhnlichen Raumzuschnitts gekommen.
Aber auch durch das Buch, das er gerade aus der Schublade zieht. Ein ausnehmend schönes Buch. So ein weiches, cremiges Papier, von der Zeit leicht vergilbt, ist seit mindestens vierzig Jahren nicht mehr hergestellt worden. Höchstwahrscheinlich ist das Buch noch viel älter. Er hat es im Schaufenster eines muffigen kleinen Trödelladens in einem heruntergekommenen Teil der Stadt liegen sehen (in welchem genau, das weiß er schon gar nicht mehr), und auf der Stelle hat er es unbedingt besitzen wollen. Parteimitglieder sollten gewöhnliche Läden eigentlich nicht besuchen (»keine Geschäfte auf dem freien Markt tätigen«), aber diese Regel wird nicht streng gehandhabt, da man an verschiedene Dinge wie Schnürsenkel und Rasierklingen gar nicht anders rankommt. Nach einem raschen Blick die Straße rauf und runter ist er hineingeschlüpft und hat das Buch für zwei Dollar fünfzig gekauft. Da war ihm noch gar nicht klar, was er eigentlich damit anfangen wollte. Er hat es mit schlechtem Gewissen in der Aktentasche nach Hause gebracht. Selbst ohne jeglichen Eintrag ist das ein kompromittierendes Besitzstück.
Und jetzt will er ein Tagebuch beginnen, das hat er vor. Illegal ist das nicht (nichts ist illegal, da es keine Gesetze mehr gibt), aber falls er auffliegt, kann er mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er mit dem Tod oder zumindest mit fünfundzwanzig Jahren Arbeitslager bestraft wird. Winston steckt eine Feder in den Federhalter und lutscht sie ab, um das Fett runterzukriegen. Schreibfedern sind ein archaisches Instrument und werden selbst zum Unterzeichnen nur noch selten benutzt, aber er hat sich heimlich und nicht ohne Aufwand eine besorgt, weil er einfach findet, das wunderschöne cremige Papier hat eine echte Schreibfeder statt einen krakeligen Tintenstift verdient. Eigentlich ist er es nicht gewohnt, mit der Hand zu schreiben. Abgesehen von ganz kurzen Notizen wird normalerweise alles in den Sprechschreib diktiert, was sich bei diesem Vorhaben natürlich verbietet. Er taucht die Feder in die Tinte, dann zaudert er kurz. Ein Zittern im Bauch. Das Papier zu beschreiben ist der entscheidende Schritt. Mit kleinen, ungelenken Buchstaben schreibt er:
4. April 1984
Er lehnt sich zurück. Völlige Hilflosigkeit packt ihn. Zunächst einmal weiß er gar nicht sicher, ob das Jahr tatsächlich 1984 ist. Ungefähr muss es hinkommen, denn er ist neununddreißig Jahre alt, und sein Geburtsjahr war 1944 oder 1945. Das glaubt er zumindest; allerdings lässt sich heutzutage kein Datum mehr auf ein oder zwei Jahre genau festlegen.
Für wen, fragt er sich plötzlich, schreibt er dieses Tagebuch überhaupt? Für die Zukunft, für die Ungeborenen. Seine Gedanken umkreisen das zweifelhafte Datum auf der Seite noch eine Weile, dann prallen sie gegen das Neusprech-Wort »Doppeldenk«. Zum ersten Mal geht ihm die Größe seines Unterfangens auf. Wie soll man mit der Zukunft kommunizieren? Das ist per se ein Ding der Unmöglichkeit. Entweder die Zukunft ähnelt der Gegenwart, dann wird sie ihn nicht beachten; oder sie ist anders, dann wird seine jetzige Zwangslage unverständlich sein.
Eine Zeitlang stiert er dumm auf das Papier. Der Telemonitor hat zu scharfer Militärmusik gewechselt. Seltsam, dass ihm gerade offenbar nicht nur die Worte fehlen, er weiß gar nicht mehr, was er ursprünglich sagen wollte. Seit Wochen bereitet er sich innerlich auf diesen Moment vor und ist nie darauf gekommen, dass es dafür lediglich Mut braucht. Das eigentliche Schreiben geht leicht. Er muss nur den endlosen, ruhelosen Monolog zu Papier bringen, der ihm buchstäblich seit Jahren durch den Kopf geht. Doch in diesem Augenblick ist sogar der versiegt. Außerdem juckt sein Krampfadergeschwür unerträglich. Er wagt nicht daran zu kratzen, denn dann entzündet es sich immer. Die Sekunden vergehen, eine nach der anderen. Er registriert nichts außer der leeren Seite vor ihm, dem Jucken über seinem Knöchel, der schmetternden Musik und einem leichten Schwips vom Gin.
Plötzlich kritzelt er in heller Panik los, und was er genau niederschreibt, ist ihm nur unvollständig bewusst. Seine kleine, kindliche Handschrift wandert über die Seite, entledigt sich zuerst der Großbuchstaben und schließlich auch der Zeichensetzung:
4. April 1984. Gestern Abend Kino. Alles Kriegsfilme. Ein sehr guter mit einem Schiff voller Flüchtlinge, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wird. Publikum hochamüsiert über Szenen mit einem dicken fetten Mann, der von einem Hubschrauber verfolgt wird und wegzuschwimmen versucht, erst sieht man ihn wie einen Schweinswal durchs Wasser pflügen, dann durchs Visier vom Hubschrauber aus, dann ist er durchlöchert und das Meer ringsum wird rosa und er sinkt so schnell, als hätten die Löcher das Wasser reingelassen. publikum brüllt vor lachen, als er absäuft. dann ein rettungsboot voller kinder über dem ein hubschrauber schwebt. im bug sitzt eine frau im mittleren alter könnte jüdin sein und hält einen kleinen etwa dreijährigen jungen in den armen. der kleine junge schreit vor angst und versteckt den kopf zwischen ihren brüsten als wollte er sich in sie hineinbohren und die frau legt die arme um ihn und tröstet ihn dabei ist sie selber blau vor angst und hält ihn die ganze zeit so gut bedeckt wie möglich als könnte sie die kugeln mit den armen abwehren. Dann wirft der hubschrauber eine 20kilobombe mitten rein ein furchtbarer blitz und das boot ist kleinholz. dann eine großartige szene wo ein kinderarm nach oben geschleudert wird immer höher dem muss ein hubschrauber mit einer kamera in der nase gefolgt sein und von den sitzen der partei kommt viel applaus aber auf einmal macht eine frau unten im proletenteil des hauses einen riesenaufstand und kreischt dat hättense nich zeing sollen nich vor die kinder dat is nich richtich vor die kinder aber wirklich nich bis die polizei sie raus sie rausschafft ich glaub nicht dass ihr was passiert ist was die proleten sagen interessiert keinen typische proletenreaktion die machen nie –
Winston hört auf zu schreiben, er hat einen Krampf in der Hand. Er weiß nicht, warum er diesen Schwall Blödsinn von sich gegeben hat. Aber komischerweise hat währenddessen in seinem Kopf eine völlig andere Erinnerung Gestalt angenommen, er fühlt sich fast schon in der Lage, sie aufzuschreiben. Und jetzt wird ihm auch klar, dass sein fester Entschluss, nach Hause zu fahren und mit dem Tagebuch anzufangen, noch mit einem anderen Vorfall zu tun hat.
Es geschah am selben Morgen im Ministerium, falls man bei etwas so Nebulösem überhaupt von ›geschehen‹ sprechen kann:
Kurz vor elfhundert. In der Abteilung Archiv, wo Winston arbeitet, ziehen alle ihre Stühle aus den Waben und bilden Gruppen mitten in der Halle, gegenüber vom großen Telemonitor, in Vorbereitung der Zwei Minuten Hass. Gerade als Winston seinen Platz in einer der mittleren Reihen einnimmt, betreten zwei Personen, die er nur vom Sehen kennt, unerwartet den Raum. Die eine ist eine Frau, der er öfters auf den Korridoren begegnet. Wie sie heißt, weiß er nicht, nur dass sie in der Abteilung Fiktion arbeitet. Wahrscheinlich – er hat sie ein paarmal mit ölverschmierten Händen und einem Schraubenschlüssel gesehen – arbeitet sie an einer der Romanschreibemaschinen. Sie ist ungefähr siebenundzwanzig und wirkt unerschrocken, dickes dunkles Haar, sommersprossiges Gesicht und rasche sportliche Bewegungen. Sie trägt, mehrfach um die Taille ihres Overalls geschlungen, eine schmale scharlachrote Schärpe, das Emblem der Jugend-Anti-Sexliga, gerade straff genug, um ihre wohlgeformten Hüften zu betonen. Vom ersten Augenblick an ist sie Winston unsympathisch gewesen. Er weiß auch warum. Es liegt an ihrer Aura: Hockeyfelder und kalte Duschen und Gemeinschaftswanderungen und allgemeine Gedankenreinheit. Fast alle Frauen sind ihm unsympathisch, vor allem die jungen und hübschen. Die bigottesten Parteianhänger, die jeden Slogan schlucken, die Amateurspione, die alles Unorthodoxe erschnüffeln? Fast immer Frauen, vor allem junge. Und diese hier kommt ihm gefährlicher vor als die meisten anderen. Einmal, bei einer kurzen Begegnung im Korridor, hat sie ihm einen raschen Seitenblick zugeworfen, der hat ihn schier aufgespießt und ihm kurz blankes Entsetzen eingejagt. Könnte sie eine Denkpol-Agentin sein? Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Trotzdem befällt ihn, immer wenn sie in seine Nähe kommt, ein merkwürdiges Unbehagen, eine Mischung aus Angst und Feindseligkeit.
Die andere Person ist ein Mann namens O’Brien, Mitglied der Inneren Parteiriege und Träger eines so wichtigen und hohen Amtes, dass Winston nur eine vage Vorstellung davon hat, was das überhaupt sein könnte. Kurz wird es still in der Gruppe bei den Stühlen, als sich der schwarze Overall eines Mitglieds der Inneren Parteiriege nähert. O’Brien ist ein massiger, kräftiger Mann mit Stiernacken und grobem, brutalem Spaßvogelgesicht. Trotz seiner furchterregenden Erscheinung haben seine Umgangsformen eine Art Charme. Wenn er seine Brille auf der Nase zurechtrückt, wirkt das seltsam entwaffnend, ja auf unerklärliche Weise seltsam zivilisiert, das ist einer seiner Tricks. Diese Geste erinnert, falls irgendjemand noch in solchen Begriffen denkt, an einen Edelmann aus dem achtzehnten Jahrhundert, der einem seine Schnupftabaksdose anbietet. Winston hat O’Brien vielleicht ein Dutzend Mal gesehen, im Lauf von ungefähr genauso vielen Jahren. Er fühlt sich stark zu ihm hingezogen, und nicht nur, weil ihn der Kontrast zwischen O’Briens weltmännischer Art und seiner Boxerstatur fasziniert. Insgeheim glaubt er nämlich – oder hofft es vielleicht auch nur –, dass O’Briens politische Linientreue Risse aufweisen könnte. Irgendwas in seinem Gesichtsausdruck legt das unwiderstehlich nahe. Aber vielleicht spricht auch nicht mangelnde Linientreue aus seinem Gesicht, sondern schlicht Intelligenz. Jedenfalls hat er die Ausstrahlung eines Menschen, mit dem man reden kann, sofern man irgendwie die Telemonitore überlistet und ihn unter vier Augen zu fassen kriegt. Winston hat nie den geringsten Anlauf unternommen, seinem Verdacht nachzugehen: Dazu gibt es auch keine Gelegenheit. In diesem Augenblick schaut O’Brien auf seine Armbanduhr, sieht, dass es kurz vor elfhundert ist, und beschließt offenbar, für die Zwei Minuten Hass noch in der Abteilung Archiv zu bleiben. Er lässt sich in derselben Reihe nieder wie Winston, zwei Plätze weiter. Eine kleine Rotblonde, die in der Wabe neben Winston arbeitet, sitzt zwischen ihnen, die Frau mit dem dunklen Haar direkt dahinter.
Und schon bricht ein grässliches, knirschendes Kreischen aus dem großen Telemonitor am Ende des Raums – als würde irgendeine monströse Maschine ohne Öl laufen. Dieses Geräusch geht einem durch und durch, die Nackenhaare stellen sich auf. Der Hass beginnt.
Wie üblich wird das Gesicht von Emmanuel Goldstein, dem Volksfeind, auf dem Monitor eingeblendet. Hie und da zischt es im Publikum. Die kleine Rotblonde quiekt auf, eine Mischung aus Angst und Ekel. Goldstein ist ein abtrünniger Überläufer. Vor langer Zeit (wie lange, weiß keiner so genau) war er eine der Führungsfiguren der Partei, fast auf einer Ebene mit dem Großen Bruder selbst; irgendwann beging er konterrevolutionäre Taten, wurde zum Tode verurteilt und verschwand nach einer mysteriösen Flucht. Das Programm der Zwei Minuten Hass variiert von Tag zu Tag, aber Goldstein ist immer die Hauptfigur. Er ist der Ur-Verräter, der früheste Sündenfall gegen die Reinheit der Partei. Alle nachfolgenden Verbrechen gegen die Partei, jeder Verrat, jedes Abweichlertum, jede Sabotage oder Ketzerei entspringt direkt seiner Lehre. An irgendeinem Ort lebt er immer noch und heckt seine Verschwörungen aus: vielleicht irgendwo in Übersee, unter dem Schutz seiner ausländischen Zahlmeister, vielleicht sogar – wie manche Gerüchte behaupten – in einem Versteck in Ozeanien.
Winstons Zwerchfell zieht sich zusammen. Der Anblick von Goldsteins Gesicht löst bei Winston jedes Mal schmerzhaft gemischte Gefühle aus. Es ist ein schmales, jüdisch aussehendes Gesicht mit einem großen Kranz struppiger weißer Haare und einem kleinen Ziegenbärtchen – ein listiges Gesicht, zugleich von Natur aus verachtenswert, und die lange, dünne Nase, auf deren Ende eine Brille sitzt, hat etwas Seniles, Albernes. Es erinnert an ein Schaf, wie auch die Stimme. Goldstein reitet seine übliche giftige Attacke gegen die Parteidoktrin – eine so übertriebene, verdrehte Attacke, dass ein Kind sie durchschauen würde, aber gerade noch plausibel genug, dass andere, weniger besonnene Menschen womöglich drauf reinfallen könnten. Er beschimpft den Großen Bruder, prangert die Parteidiktatur an, verlangt sofortigen Frieden mit Eurasien, verficht freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Gedankenfreiheit, er jammert hysterisch, die Revolution sei verraten worden – und all das in einer schnellen, vielsilbigen Redeweise, fast einer Parodie des üblichen Parteiredenstils, auch Neusprech-Wörter kommen vor: ja sogar mehr Neusprech-Wörter, als jedes Parteimitglied normalerweise im realen Leben benutzen würde. Währenddessen, falls irgendjemand Zweifel daran hegt, welche Wirklichkeit sich hinter Goldsteins hohlem Geschwafel verbirgt, marschieren hinter seinem Kopf die endlosen Kolonnen der eurasischen Armee über den Telemonitor – unzählige Reihen stämmiger Männer mit ausdruckslosen asiatischen Gesichtern, die auf dem Monitor nach vorn strömen und sofort von anderen, identischen ersetzt werden. Das dumpfe, rhythmische Trampeln der Soldatenstiefel bildet den Hintergrund zu Goldsteins blökender Stimme.
Nicht einmal dreißig Sekunden Hass sind vergangen, da kommt es bei mindestens der Hälfte der Zuschauer zu ungezügelten Wutausbrüchen. Das selbstgefällige Schafsgesicht auf dem Monitor und die furchterregende Macht der eurasischen Armee dahinter sind einfach nicht zu ertragen: Im Übrigen ruft der Anblick, ja schon der Gedanke an Goldstein automatisch Angst und Wut wach. Als Hassobjekt ist er eine Konstante, mehr als Eurasien oder Ostasien, denn wenn Ozeanien mit einer dieser Mächte im Krieg liegt, herrscht für gewöhnlich Frieden mit der anderen. Doch seltsam, obwohl jeder Goldstein hasst und verachtet, obwohl seine Theorien täglich tausendfach auf Bahnsteigen, auf dem Telemonitor, in Zeitungen und Büchern widerlegt, zerschmettert, lächerlich gemacht und dem Auge der Allgemeinheit als der klägliche Quatsch vorgehalten werden, der sie sind, obwohl all das passiert, scheint sein Einfluss nie abzunehmen. Es gibt immer neue Narren, die nur darauf warten, sich von ihm verführen zu lassen. Kein Tag vergeht, ohne dass nicht wieder Spione und Saboteure in seinen Diensten von der Denkpol entlarvt werden. Er kommandiert eine riesige Schattenarmee, ein Untergrundnetzwerk von Verschwörern, die einen Staatsstreich planen. Angeblich heißt sie die Bruderschaft. Man munkelt auch von einem furchtbaren Buch, einem Handbuch aller Irrlehren aus seiner Feder, das im Geheimen zirkuliert. Es trägt keinen Titel, und wer davon spricht, nennt es einfach nur das Buch. Aber von solchen Dingen erfährt man nur durch vage Gerüchte. Kein normales Parteimitglied würde, wenn es sich irgend vermeiden lässt, die Bruderschaft oder das Buch erwähnen.
In der zweiten Minute steigert sich der Hass zur Raserei. Die Leute springen an ihren Plätzen auf und nieder und brüllen aus vollem Hals, um die entnervende Blökstimme vom Monitor zu übertönen. Das Gesicht der kleinen Rotblonden ist leuchtendrosa angelaufen, ihr Mund klappt auf und zu wie bei einem gestrandeten Fisch. Selbst O’Briens massiges Gesicht ist rot geworden. Er sitzt kerzengerade auf seinem Stuhl, die muskulöse Brust geschwellt und bebend, als müsste er der Attacke einer anbrandenden Welle standhalten. Die Dunkelhaarige hinter Winston schreit in einem fort »Schwein! Schwein! Schwein!«, und plötzlich schleudert sie ein schweres Neusprech-Wörterbuch gegen den Monitor. Es trifft Goldstein an der Nase und prallt ab, die Stimme macht erbarmungslos weiter. In einem lichten Moment merkt Winston, dass er brüllt wie alle anderen und mit den Fersen immer wieder gegen die Sprosse seines Stuhls tritt. Das Schreckliche an den Zwei Minuten Hass ist nicht, dass man mitmachen muss, sondern dass es unmöglich ist, nicht mitzumachen. Nach dreißig Sekunden braucht man nichts mehr vorzuspielen. Eine schaurige Ekstase aus Angst und Rachgier, eine Lust zu töten, zu foltern, Gesichter mit Vorschlaghämmern zu zerschmettern, durchzuckt die gesamte Ansammlung wie elektrischer Strom und verwandelt jeden, auch gegen seinen Willen, in einen grimassierenden, kreischenden Irren. Dabei ist die Wut, die man empfindet, eine abstrakte, ungerichtete Emotion, die sich von einem Objekt auf ein anderes umlenken ließe wie die Flamme einer Lötlampe. Winstons Hass richtet sich irgendwann gar nicht mehr gegen Goldstein, sondern gegen den Großen Bruder, die Partei und die Denkpol; in solchen Momenten ist er im Herzen bei dem einsamen, verlachten Ketzer auf dem Monitor, dem einzigen Hüter von Wahrheit und Vernunft in einer Welt der Lügen. Und doch ist er im nächsten Augenblick schon mit allen anderen im Raum eins und glaubt alles, was über Goldstein gesagt wird. Dann schlägt sein heimlicher Abscheu gegen den Großen Bruder in Verehrung um, dann ragt der Große Bruder turmhoch auf, ein unbesiegbarer, furchtloser Beschützer, eine Bastion gegen die Horden Asiens, und Goldstein wirkt, trotz seiner Ausgrenzung, seiner Hilflosigkeit und der Zweifel, ob er überhaupt existiert, wie ein finsterer Verführer, dem man zutraut, allein durch die Macht seiner Stimme die Grundfesten der Zivilisation zu zerrütten.
Manchmal ist es sogar möglich, den eigenen Hass willentlich umzulenken. Plötzlich gelingt es Winston, mit einer ebenso heftigen Anstrengung, wie wenn man seinen Kopf in einem Albtraum vom Kissen wegreißt, seinen Hass von dem Gesicht auf dem Monitor auf die dunkelhaarige Frau hinter ihm zu lenken. Lebhafte, wunderschöne Halluzinationen blitzen durch seinen Kopf. Er wird sie mit einem Gummiknüppel zu Tode prügeln. Er wird sie nackt an einen Pfahl fesseln und mit Pfeilen durchbohren wie den heiligen Sebastian. Er wird sie schänden und ihr beim Höhepunkt die Kehle durchschneiden. Außerdem begreift er jetzt besser als zuvor, warum er sie so hasst. Er hasst sie, weil sie jung und hübsch und frigide ist, weil er mit ihr schlafen will und das niemals tun wird, weil rund um ihre köstliche, geschmeidige Taille, die einen einlädt, sie zu umarmen, nur das aggressive Keuschheitssymbol liegt, die widerliche scharlachrote Schärpe.
Der Hass erreicht seinen Höhepunkt. Goldsteins Stimme ist zu einem echten Schafblöken geworden, auch sein Gesicht verwandelt sich kurz in das eines Schafes. Dann wird das Schafgesicht in die Gestalt eines eurasischen Soldaten überblendet, der riesig und furchterregend mit donnernder Maschinenpistole vorrückt, ja einem schon fast aus der Monitoroberfläche entgegenspringt; einige Leute in der ersten Reihe zucken tatsächlich auf ihren Sitzen zurück. Doch im selben Augenblick wird die feindliche Gestalt überblendet in das Gesicht des Großen Bruders mit seinen schwarzen Haaren und seinem schwarzen Schnurrbart, voll Kraft und mysteriöser Ruhe und so groß, dass es fast den ganzen Monitor ausfüllt. Alle stoßen einen Seufzer der Erleichterung aus, und keiner hört, was der Große Bruder sagt, nur ein paar Worte der Ermutigung, wie sie im Schlachtenlärm gesagt werden, nicht einzeln zu verstehen, aber sie schaffen Vertrauen, einfach indem sie ausgesprochen werden. Dann verblasst das Gesicht des Großen Bruders wieder, und an seine Stelle treten in fetten Lettern die drei Parteislogans:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSEN IST STÄRKE
Doch das Gesicht des Großen Bruders scheint noch einige Minuten lang auf dem Monitor zu verbleiben, als wäre seine Einwirkung auf die Netzhaut aller Anwesenden zu stark gewesen, um so schnell zu verfliegen. Die kleine Rotblonde hat sich über die vordere Stuhllehne fallen lassen und streckt mit einem bebenden Murmeln, das sich nach »Mein Retter!« anhört, die Arme Richtung Monitor. Dann schlägt sie die Hände vors Gesicht. Offenkundig spricht sie ein Gebet.
In diesem Augenblick bricht die versammelte Menschengruppe in einen tiefen, langsamen, rhythmischen Singsang aus: »G-B! … G-B! … G-B!«, immer wieder, sehr langsam, mit einer langen Pause zwischen dem G und dem B – ein tiefes Murmeln, merkwürdig wild, man glaubt, dahinter das Stampfen nackter Füße und vibrierende Trommeln zu vernehmen. Ungefähr dreißig Sekunden lang bleiben sie dabei. Diesen Refrain hört man oft, wenn die Gefühle überkochen. Zum Teil ist das eine Lobeshymne auf die Weisheit und Erhabenheit des Großen Bruders, aber er dient noch weitaus mehr zur Selbsthypnose, ertränkt absichtlich das Bewusstsein in lautstarkem Rhythmus. Winston wird es eisig in den Eingeweiden. Während der Zwei Minuten Hass hat er ins allgemeine Delirium eingestimmt, es geht gar nicht anders, aber dieser untermenschliche Singsang, dieses »G-B! … G-B! … G-B!«, erfüllt ihn jedes Mal mit Entsetzen. Natürlich macht er auch da mit: unmöglich, sich zu entziehen. Es ist ein intuitiver Reflex, sich kein Gefühl anmerken zu lassen, die Gesichtszüge zu beherrschen, dasselbe zu tun wie alle anderen. Aber in einem Zeitfenster von wenigen Sekunden könnte ihn der Ausdruck seiner Augen verraten haben. Denn genau in diesem Moment geschieht das bedeutsame Ereignis – falls es überhaupt geschieht.
Ganz kurz hat er Blickkontakt mit O’Brien. Der ist aufgestanden. Er hat seine Brille abgesetzt und ist gerade dabei, sie mit der typischen Handbewegung wieder auf die Nase zu schieben. Doch dann treffen sich ihre Blicke für einen Sekundenbruchteil, und in dieser kleinen Zeitspanne weiß Winston – ja, er weiß es! –, dass O’Brien genauso denkt wie er. Eine unmissverständliche Botschaft wurde ausgetauscht. Als hätte sich bei ihnen beiden der Geist aufgetan, und die Gedanken wären über die Augen hin- und hergeflossen. »Es geht mir wie dir«, scheint O’Brien zu sagen. »Ich weiß haargenau, wie du dich fühlst. Ich weiß alles über deine Verachtung, deinen Hass, deinen Abscheu. Aber keine Sorge, ich bin auf deiner Seite!« Dann ist das Aufblitzen von Intelligenz wieder weg, und O’Brien schaut so unergründlich drein wie jeder andere.
Das ist alles, und Winston ist sich bereits unsicher, ob es überhaupt geschehen ist. Solche Vorfälle haben nie irgendwelche Folgen. Sie schaffen es aber, den Glauben und die Hoffnung in ihm wachzuhalten, dass er nicht der einzige Feind der Partei ist. Vielleicht stimmen die Gerüchte von der weitgespannten Untergrundverschwörung ja – vielleicht existiert die Bruderschaft wirklich! Trotz all der Verhaftungen und Geständnisse und Exekutionen muss man auch in Erwägung ziehen, dass die Bruderschaft nur eine Legende ist. Manchmal glaubt er daran, manchmal nicht. Es gibt keine Beweise, nur flüchtige Eindrücke, die etwas bedeuten können oder auch nicht: aufgeschnappte Gesprächsfetzen, verblasste Kritzeleien auf Toilettenwänden – einmal, bei der Begegnung zweier Fremder, sogar eine kleine Handbewegung, die nach einem Erkennungszeichen aussah. Reine Spekulation: Höchstwahrscheinlich hat er sich das alles nur eingebildet. Er kehrt zu seiner Wabe zurück, ohne O’Brien noch einmal anzusehen. Der Gedanke, ihren flüchtigen Kontakt weiterzuverfolgen, streift ihn kaum. Selbst wenn er wüsste, wie er das anstellen soll, wäre es unvorstellbar gefährlich. Eine Sekunde lang, vielleicht zwei, haben sie einen vieldeutigen Blick gewechselt, Ende der Geschichte. Doch bei der hermetischen Einsamkeit, in der man leben muss, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis.
Winston reißt sich aus seinen Gedanken, richtet sich auf. Und rülpst. Der Gin steigt aus dem Magen hoch.
Er konzentriert den Blick wieder auf die Tagebuchseite und merkt, dass er während seiner hilflosen Grübelei automatisch weitergeschrieben hat. Die Handschrift ist gar nicht mehr so verkrampft und ungelenk. Die Feder ist genüsslich über das weiche Papier geglitten und hat in ausgreifenden, säuberlichen Großbuchstaben geschrieben:
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
– immer wieder, eine halbe Seite voll.
Der Anflug von Panik ist unvermeidlich, wenn auch absurd, denn das Hinschreiben dieser Worte ist nicht gefährlicher als die eigentliche Tat, das Tagebuch aufzuschlagen; aber kurz ist er versucht, die besudelten Seiten herauszureißen und das ganze Unterfangen bleiben zu lassen.
Das tut er aber nicht, denn er weiß, es hat sowieso keinen Zweck. Ob er hinschreibt NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER oder ob er es sich verbietet, macht keinen Unterschied. Ob er weiter Tagebuch schreibt oder nicht, macht keinen Unterschied. Die Denkpol wird ihn so oder so kriegen. Er hat das grundlegende Verbrechen, das alle anderen enthält, schon begangen, ist kriminell geworden, auch ohne je ein Wort zu Papier zu bringen. »Denkkrim« nennen sie das. Denkkrim kann man auf Dauer nicht verbergen. Vielleicht kann man sich eine Zeitlang erfolgreich wegducken, jahrelang sogar, aber früher oder später kriegen sie einen doch.
Und immer nachts – Verhaftungen finden ausnahmslos nachts statt. Man wird plötzlich aus dem Schlaf gerissen, ein grobes Schütteln an der Schulter, blendendes Licht, harte Gesichter rund um das Bett. In den allermeisten Fällen gibt es keinen Prozess, über die Verhaftung wird nicht berichtet. Die Menschen verschwinden einfach, wortwörtlich über Nacht. Die Namen werden aus den Registern entfernt, nichts, was man je getan hat, ist mehr in den Akten zu finden, erst wird das Leben, das man nur einmal hat, verleugnet und dann vergessen. Man wird eliminiert, ausgelöscht: »verdampft« ist das gebräuchliche Wort.
Kurz packt ihn Hysterie. Er kritzelt los, hektisch, unordentlich:
die werden mich erschießen mir egal eine kugel in den nacken mir egal nieder mit dem großen bruder die schießen immer eine kugel in den nacken mir egal nieder mit dem großen bruder
Etwas beschämt lehnt er sich zurück und legt die Feder hin. Im nächsten Augenblick zuckt er heftig zusammen. Es klopft.
Jetzt schon! Er sitzt mucksmäuschenstill da, in der sinnlosen Hoffnung, die Person – wer immer es ist – würde nach einem einzigen Versuch wieder gehen. Aber nein, es klopft von neuem. Am schlimmsten ist das Hinauszögern. Sein Herz hämmert wie eine Pauke, sein Gesicht aber zeigt, dank der langen Übung, vermutlich keinen Ausdruck. Er steht auf und schleppt sich zur Tür.
Fußnoten
[1]
Neusprech ist die Amtssprache von Ozeanien. Zu ihrer Struktur und Etymologie siehe Anhang.
2
Als Winston nach dem Türknauf greift, bemerkt er, dass das Tagebuch offen auf dem Tisch liegt. NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER steht da viele Male in Großbuchstaben, fast groß genug, um es von der Tür aus zu entziffern. Wie unvorstellbar dumm. Aber trotz aller Panik hat er das cremefarbene Papier nicht verschmieren wollen, das wird ihm klar, drum hat er das Buch nicht über der feuchten Tinte zugeklappt.
Er holt tief Luft und macht auf. Sofort durchströmt ihn eine warme Welle der Erleichterung. Da steht eine farblose, bedrückte Frau mit flusigen Haaren und runzligem Gesicht.
»Ach, Genosse«, sagt sie in schleppendem, klagendem Ton, »mir war doch, als hätte ich dich gehört. Ob du wohl mal rüberkommen und unseren Abfluss in der Küche anschauen könntest. Der ist verstopft und …«
Das ist Mrs. Parsons, eine Nachbarsfrau von derselben Etage. (Die Anrede »Mrs.« wird von der Partei eher missbilligt – man soll alle Leute »Genossen« nennen –, aber bei manchen Frauen benutzt man das Wort instinktiv doch.) Sie ist um die dreißig, sieht aber viel älter aus. Als läge Staub in den Runzeln ihres Gesichts. Winston folgt ihr über den Korridor. Derlei Amateurreparaturen sind ein fast tägliches Ärgernis. Die Wohnungen der Victory Mansions sind alt, um 1930 erbaut, und gehen langsam aus dem Leim. Ständig schuppt Gips von den Decken und Wänden, bei jedem harten Frost gibt es Wasserrohrbrüche, das Dach erweist sich bei Schneefall als undicht, die Heizungsanlage läuft meist nur mit halber Kraft, wenn sie nicht aus wirtschaftlichen Gründen komplett abgeschaltet ist. Reparaturen, abgesehen von dem, was man allein hinkriegt, müssen von fernen Komitees bewilligt werden, was dafür sorgt, dass selbst eine kaputte Fensterscheibe zwei Jahre lang nicht ersetzt wird.
»Natürlich bitte ich dich nur, weil Tom nicht zu Hause ist«, sagt Mrs. Parsons unbestimmt.
Die Wohnung der Parsons ist größer als Winstons und in anderer Hinsicht trist. Alles wirkt angeschlagen und irgendwie zertrampelt, als wäre gerade ein großes gewalttätiges Tier hier durchgestapft. Auf dem Boden liegt überall Sportausrüstung herum – Hockeyschläger, Boxhandschuhe, ein zerschlissener Fußball, verschwitzte Shorts auf links –, auf dem Tisch türmen sich schmutziges Geschirr und eselsohrige Schulhefte. An den Wänden hängen scharlachrote Spruchbänder von der Jugendliga und den Spitzeln und ein Plakat des Großen Bruders in Originalgröße. Den typischen Geruch des gesamten Gebäudes, nach gekochtem Kohl, durchzieht hier ein noch beißenderer Schweißgestank, und schwer zu sagen warum, aber man weiß gleich beim ersten Schnüffeln, dass er zu einer derzeit abwesenden Person gehört. In einem anderen Zimmer versucht jemand, mit einem Kamm und einem Blatt Klopapier die Militärmusik zu begleiten, die immer noch aus dem Telemonitor kommt.
»Kinder eben«, sagt Mrs. Parsons mit einem halb bangen Blick zur Tür. »Sie sind heute noch nicht draußen gewesen. Und natürlich …«
Sie hat die Angewohnheit, ihre Sätze nach der Hälfte abzubrechen. Die Küchenspüle steht fast randvoll mit grünlichem Abwaschwasser, das schlimmer denn je nach Kohl stinkt. Winston geht in die Hocke und untersucht das Knie des Abflussrohrs. Er hasst es, die Hände zu benutzen, und er hasst es, sich zu bücken, weil er dann immer husten muss. Mrs. Parsons schaut hilflos zu.
»Wenn Tom zu Hause wäre, hätte er es natürlich im Nu repariert«, sagt sie. »So was macht er furchtbar gern. Er ist ja so geschickt mit den Händen, mein Tom.«
Parsons ist Winstons Kollege im Wahrheitsministerium, ein dicklicher, aber rühriger Mann von lähmender Dummheit, ein einziger Batzen schwachsinniger Begeisterung – einer jener treu ergebenen, blind gehorsamen Sklaven, von denen, mehr noch als von der Denkpol, die Stabilität der Partei abhängt. Vor kurzem ist er, mit fünfunddreißig, aus der Jugendliga ausgeschlossen worden, und bevor er dorthin aufgestiegen war, hatte er es geschafft, ein Jahr länger als die vorgesehene Altersgrenze bei den Spitzeln zu bleiben. Im Ministerium arbeitet er in einer untergeordneten Stellung, für die es keine Intelligenz braucht, aber im Sportkomitee und all den anderen Komitees, die Gemeinschaftswanderungen, Spontandemonstrationen, Sparkampagnen und ganz allgemein Freiwilligenarbeit organisieren, ist er ganz vorn dabei. Er verkündet gern mit stillem Stolz, seine Pfeife paffend, dass er in den letzten Jahren jeden Abend im Gemeinschaftszentrum verbracht hat. Ein überwältigender Schweißgeruch, der sozusagen unabsichtlich bezeugt, wie strapaziös sein Leben ist, folgt ihm in Schwaden, wo immer er hinkommt, ja sogar wenn er schon weg ist.
»Hast du eine Rohrzange?«, fragt Winston, während er versucht, die Mutter am Rohrknie zu lösen.
»Eine Rohrzange«, sagt Mrs. Parsons, schlagartig rückgratlos. »Das weiß ich nun wirklich nicht. Vielleicht die Kinder …«
Begleitet von Stiefelgetrampel und einer weiteren Runde Blasen auf dem Kamm stürmen die Kinder das Wohnzimmer. Mrs. Parsons bringt die Rohrzange. Winston lässt das Wasser ab und entfernt angeekelt den Propf aus Menschenhaar, der das Rohr verstopft. Dann reinigt er seine Finger, so gut es mit kaltem Wasser geht, und kehrt ins andere Zimmer zurück.
»Los, Hände hoch!«, schreit eine wilde Stimme.
Ein hübscher, robust aussehender Junge von neun Jahren ist hinter dem Tisch aufgetaucht und bedroht ihn mit einer Spielzeug-MP, und seine kleine, etwa zwei Jahre jüngere Schwester tut es ihm nach, mit einem Stück Holz. Beide tragen die blauen Shorts, grauen Hemden und roten Halstücher, aus denen die Uniform der Spitzel besteht. Winston hebt die Hände über den Kopf, aber mit einem unbehaglichen Gefühl; das Benehmen des Jungen ist so voller Bosheit, dass es sich nicht mehr nach einem Spiel anfühlt.
»Du bist ein Verräter!«, kreischt der Junge. »Du machst Denkkrim! Du bist ein eurasischer Spion! Ich erschieß dich, ich verdampf dich, ich schick dich ins Salzbergwerk!«
Auf einmal springen sie beide um ihn herum, brüllen »Verräter!« und »Denkkrim!«, wobei das kleine Mädchen jede Bewegung ihres Bruders nachahmt. Das ist schon ziemlich angsteinflößend, diese zwei herumtollenden Tigerjungen, die bald zu Menschenfressern heranwachsen werden. Im Blick des Jungen liegt berechnende Grausamkeit, das schwer zu übersehende Bedürfnis, Winston zu schlagen oder zu treten, und das Bewusstsein, schon fast groß genug dafür zu sein. Ein Glück, denkt Winston, dass die Pistole da nicht echt ist.
Mrs. Parsons’ Blick zuckt nervös zwischen Winston und den Kindern hin und her. In dem helleren Licht des Wohnzimmers bemerkt er interessiert, dass tatsächlich Staub in den Falten ihres Gesichts liegt.
»Sie werden halt doch recht laut«, sagt sie. »Sie sind enttäuscht, weil sie nicht zur Hinrichtung können, deswegen. Ich habe zu viel zu tun, um sie mitzunehmen, und Tom kommt nicht rechtzeitig von der Arbeit zurück.«
»Warum können wir nicht hingehen? Ich will das Hängen sehen!«, brüllt der Junge mit seiner kräftigen Stimme.
»Will das Hängen sehen! Will das Hängen sehen!«, skandiert das Mädchen, immer noch herumhüpfend.
Einige eurasische Gefangene sollen an diesem Abend als Kriegsverbrecher im Park aufgehängt werden, fällt Winston wieder ein. Das geschieht etwa einmal im Monat und ist ein beliebtes Spektakel. Kinder quengeln immer, weil sie unbedingt hinwollen. Er verabschiedet sich von Mrs. Parsons und geht zur Tür. Nach nicht mal sechs Schritten im Korridor trifft ihn etwas mit einem qualvoll schmerzhaften Schlag im Nacken. Es fühlt sich an, als wäre er mit einem rotglühenden Draht gestochen worden. Er fährt herum und sieht gerade noch, wie Mrs. Parsons ihren Sohn, der eine Schleuder einsteckt, wieder in die Wohnung zerrt.
»Goldstein!«, bellt der Junge, dann fällt die Tür zu. Am meisten erschreckt Winston die hilflose Angst in den grauen Gesichtszügen der Frau.
In seiner Wohnung geht er rasch am Telemonitor vorbei und setzt sich, immer noch den Nacken reibend, wieder an den Tisch. Aus dem Monitor kommt keine Musik mehr, sondern eine abgehackte militärische Stimme verliest mit genüsslicher Brutalität, mit welcher Waffenausstattung die neue Schwimmende Festung gerade zwischen Island und den Färöern vor Anker geht.
Bei solchen Kindern, denkt er, muss die arme Frau ein elendes Leben in Angst und Schrecken führen. Noch ein, zwei Jahre, und sie werden sie Tag und Nacht im Auge behalten, auf der Suche nach irgendwelchen Abweichlersymptomen. Heutzutage sind fast alle Kinder grässlich. Organisationen wie die Spitzel machen sie systematisch zu unkontrollierbaren kleinen Wilden, aber deswegen werden sie noch lange nicht rebellisch gegen die Parteidisziplin – das ist das Schlimmste. Im Gegenteil, sie beten die Partei und alles, was mit ihr zusammenhängt, förmlich an. Die Lieder, die Märsche, die Spruchbänder, die Wanderungen, der Drill mit Gewehrattrappen, das Brüllen der Slogans, die Verehrung des Großen Bruders – all das ist ein herrliches Spiel für sie. Alles Wilde kehren sie nach außen, gegen Staatsfeinde, gegen Ausländer, Verräter, Saboteure, gegen Denkkrim. Es ist fast normal, wenn Menschen über dreißig vor ihren eigenen Kindern Angst haben. Und mit gutem Grund, denn fast jede Woche bringt die Times eine Meldung, dass irgendein lauschender kleiner Schnüffler – »Kindheld« werden sie im Allgemeinen genannt – eine kompromittierende Bemerkung aufgeschnappt und seine Eltern bei der Denkpol denunziert hat.
Der stechende Schmerz von dem Geschoss der Schleuder lässt nach. Halbherzig greift er zur Feder. Was soll er noch in sein Tagebuch schreiben? Da fällt ihm O’Brien wieder ein.
Vor Jahren – wie lange ist das her? Sieben Jahre bestimmt – hat er geträumt, dass er einen stockdunklen Raum durchquert. Und im Vorbeigehen hört er jemanden, der auf der Seite sitzt, zu ihm sagen: »Wir treffen uns an dem Ort, wo kein Dunkel herrscht.« Ganz ruhig, fast beiläufig – eine Feststellung, keine Anweisung. Er geht weiter, ohne innezuhalten. Komischerweise haben ihn die Worte damals, im Traum, gar nicht weiter beeindruckt. Erst später sind sie nach und nach immer bedeutungsvoller geworden. Er weiß nicht mehr, ob er O’Brien vor oder nach diesem Traum zum ersten Mal gesehen und wann er die Traumstimme als O’Briens erkannt hat. Aber erkannt hat er sie, es war tatsächlich O’Brien, der aus dem Dunkel zu ihm sprach.
Winston hat nie mit absoluter Sicherheit herausgefunden – und auch nach dem blitzartigen Blickwechsel heute Morgen bleibt das unmöglich –, ob O’Brien Freund oder Feind ist. Irgendwie kommt es darauf auch gar nicht an. Zwischen ihnen herrscht ein Einverständnis, und diese Verbindung ist wichtiger als Zuneigung oder Lagerdenken. »Wir treffen uns an dem Ort, wo kein Dunkel herrscht«, hat er gesagt. Winston weiß nicht, was das bedeutet, nur dass es eintreffen wird, so oder so.
Die Stimme vom Telemonitor legt eine Pause ein. Eine klare, wunderschöne Trompetenfanfare erschallt in der abgestandenen Luft. Schnarrend fährt die Stimme fort:
»Achtung! Achtung bitte! In diesem Augenblick erreicht uns eine Eilmeldung von der Front in Malabar. Unsere Truppen haben in Südindien einen glorreichen Sieg errungen. Ich darf verkünden, dass die Aktion, von der wir gleich berichten werden, den Krieg in absehbarer Zeit zu seinem Ende bringen könnte. Und hier kommt die Eilmeldung …«
Das bedeutet schlechte Nachrichten, denkt Winston. Und siehe da, auf die schaurige Beschreibung der Vernichtung einer eurasischen Armee mit enormen Zahlen von Toten und Gefangenen folgt die Ankündigung, dass ab der nächsten Woche die Schokoladenration von dreißig auf zwanzig Gramm gesenkt wird.
Winston muss erneut aufstoßen. Die Wirkung des Gins lässt nach und macht einem Gefühl der Ernüchterung Platz. Im Telemonitor – vielleicht um den Sieg zu feiern, vielleicht um den Gedanken an den Schokoladenverlust wegzublasen – scheppert jetzt »’s ist für dich, Ozeanien« los. Da soll man stramm stehen. In seiner derzeitigen Position ist er allerdings unsichtbar.
Auf »’s ist für dich, Ozeanien« folgt leichtere Musik. Winston tritt ans Fenster, immer noch mit dem Rücken zum Monitor. Der Tag ist weiterhin kalt und klar. Irgendwo in der Ferne explodiert mit dumpf dröhnendem Nachhall eine Raketenbombe. Zurzeit gehen etwa zwanzig bis dreißig davon pro Woche auf London nieder.
Unten auf der Straße flattert das eingerissene Plakat im Wind, das Wort ENGSOZ wird jäh sichtbar und verschwindet wieder. Engsoz. Die heiligen Prinzipien von Engsoz. Neusprech, Doppeldenk, die Veränderbarkeit der Vergangenheit. Er kommt sich vor, als irrte er durch Wälder auf dem Meeresboden, durch eine monströse Welt, in der er selbst das Monster ist. Er ist allein. Die Vergangenheit ist tot, die Zukunft unvorstellbar. Welche Gewissheit kann er haben, dass ein einziges lebendiges Menschenwesen auf seiner Seite steht? Und woher soll er wissen, dass die Herrschaft der Partei nicht für immer und ewig andauert? Wie zur Antwort brüllen die drei Slogans auf der weißen Fassade des Wahrheitsministeriums ihm zu:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSEN IST STÄRKE
Er holt eine 25-Cent-Münze aus der Hosentasche. Auch dort stehen in kleiner, deutlicher Schrift die drei Slogans, auf der anderen Seite prangt der Kopf des Großen Bruders. Selbst von der Münze aus verfolgen einen die Augen. Auf Münzen, Briefmarken, Buchumschlägen, Spruchbändern, Plakaten und Zigarettenschachteln – überall. Die Augen beobachten einen immer, die Stimme hüllt einen ein. Ob man schläft oder wacht, arbeitet oder isst, drinnen oder draußen, im Bad oder im Bett – kein Entkommen. Nichts gehört einem, bis auf die paar Kubikzentimeter im eigenen Schädel.
Die Sonne ist herumgezogen, und die unzähligen Fenster des Wahrheitsministerium sehen nun, da kein Licht mehr auf sie fällt, so düster aus wie die Schießscharten einer Festung. Angesichts der riesenhaften Pyramide sinkt ihm der Mut. Der Bau ist zu massiv, der lässt sich nicht stürmen. Auch tausend Raketenbomben würden ihn nicht zum Einsturz bringen. Wieder fragt er sich, für wen er das Tagebuch schreibt. Für die Zukunft, für die Vergangenheit – für ein vielleicht nur imaginäres Zeitalter. Vor ihm liegt nicht der Tod, sondern die Vernichtung. Das Tagebuch wird zu Asche werden und er zu Dampf. Nur die Denkpol wird lesen, was er schreibt, bevor sie es ausradieren, fort und vergessen. Wie lässt sich an die Zukunft appellieren, wenn von einem selbst keine Spur, nicht einmal ein anonymes, auf ein Stück Papier gekritzeltes Wort physisch überleben kann?
Aus dem Telemonitor schlägt es vierzehn. In zehn Minuten muss er los. Um vierzehn dreißig fängt die Arbeit wieder an.
Seltsamerweise flößt ihm das Schlagen der Uhr neuen Mut ein. Er ist ein einsames Gespenst, das eine Wahrheit verkündet, nur wird diese Wahrheit nie jemand hören. Doch solange er sie verkündet, reißt auf eine mysteriöse Weise die Linie nicht ab. Nicht indem man sich Gehör verschafft, sondern indem man bei Verstand bleibt, trägt man das Vermächtnis der Menschheit weiter. Er kehrt zum Tisch zurück, taucht die Feder ein und schreibt:
An die Zukunft oder die Vergangenheit, an eine Zeit, wenn die Gedanken frei sind, wenn Menschen sich voneinander unterscheiden und nicht mehr allein leben – an eine Zeit, in der es Wahrheit gibt und Geschehenes nicht ungeschehen gemacht werden kann:
Grüße aus dem Zeitalter der Uniformität und Einsamkeit, aus dem Zeitalter des Großen Bruders und des Doppeldenk!
Er ist schon tot, überlegt er. Erst jetzt, wo er es allmählich schafft, seine Gedanken zu formulieren, hat er den entscheidenden Schritt getan. Die Konsequenzen jeder Handlung sind schon in der Handlung selbst enthalten. Er schreibt:
Denkkrim führt nicht zum Tod: Denkkrim IST der Tod.
Jetzt, wo er sich als toter Mann erkannt hat, kommt es darauf an, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. An zwei Fingern der rechten Hand hat er Tintenflecken. Genau so ein Detail kann einen verraten. Irgendein schnüffelnder Eiferer im Ministerium (wahrscheinlich eine Frau: jemand wie die kleine Rothaarige oder die Dunkelhaarige aus der Abteilung Fiktion) kann sich plötzlich fragen, wieso er in der Mittagspause schreibt, wieso er eine altmodische Feder benutzt, und vor allem, was er schreibt – und dann an der richtigen Stelle einen Hinweis fallen lassen. Er geht ins Bad und schrubbt die Tinte sorgfältig mit der dunkelbraunen körnigen Seife weg, die die Haut abraspelt wie Sandpapier und sich daher bestens für diesen Zweck eignet.
Er legt das Tagebuch in die Schublade. Sich ein Versteck zu überlegen ist sowieso sinnlos, aber zumindest kann er sich vergewissern, ob es schon jemand entdeckt hat. Ein quer über den Schnitt gelegtes Haar wäre zu auffällig. Mit einer Fingerspitze klaubt er ein sichtbares Körnchen weißlichen Staub auf und setzt es auf eine Ecke des Einbands. Bei der geringsten Bewegung des Buches wird das Staubkorn unweigerlich runterfallen.
3
Winston träumt von seiner Mutter.
Als sie verschwand, muss er zehn oder elf gewesen sein. Sie war eine große, stattliche, eher stille Frau mit langsamen Bewegungen und einer prächtigen blonden Mähne. Seinen Vater hat er undeutlicher in Erinnerung: dunkel, dünn, mit Brille, stets gepflegt und dunkel gekleidet (insbesondere die sehr dünnen Sohlen seiner Schuhe sieht Winston vor sich). Die beiden wurden bestimmt von einer der ersten großen Säuberungswellen der Fünfziger verschluckt.
Jetzt im Traum sitzt seine Mutter irgendwo unterhalb von ihm, seine kleine Schwester auf dem Arm. An die kann sich Winston gar nicht erinnern, außer als winziges, schwächliches, immer stilles Kind mit großen, wachsamen Augen. Die beiden befinden sich an einem unterirdischen Ort – am Grund eines Brunnens vielleicht oder in einem sehr tiefen Grab –, aber dieser Ort, der schon tief unter ihm liegt, bewegt sich noch weiter abwärts. Sie sitzen im Salon eines untergehenden Schiffes und blicken durch das dunkler werdende Wasser hoch zu ihm. Es gibt noch Luft dort, sie können ihn noch sehen und er sie, aber sie versinken in den grünen Wassern und werden bald für immer darin verschwinden. Er ist draußen in Licht und Luft, während sie hinab in den Tod gesogen werden, und sie sind dort unten, weil er oben ist. Das weiß er, das wissen sie, und er liest dieses Wissen in ihren Zügen. Weder auf ihren Gesichtern noch in ihren Herzen liegt ein Vorwurf, nur das Wissen, dass sie sterben müssen, damit er leben kann, das gehört zur unabänderlichen Ordnung der Dinge.
Er kann sich nicht erinnern, was geschehen ist, aber im Traum weiß er, dass seine Mutter und seine Schwester auf irgendeine Weise für ihn geopfert werden. Es ist einer von den Träumen, die sich zwar in typischen Traumgefilden abspielen, aber auch eine Verlängerung des eigenen Geisteslebens darstellen – durch sie gewinnt man Erkenntnisse, die auch nach dem Wachwerden noch neu und wertvoll erscheinen. Und jetzt begreift Winston auf einmal, dass der Tod seiner Mutter vor fast dreißig Jahren auf eine Weise tragisch und leidvoll war, die heute gar nicht mehr im Bereich des Möglichen liegt. Das Tragische, erkennt er, gehört zu den alten Zeiten, als es noch Intimsphäre, Liebe und Freundschaft gab, als die Mitglieder einer Familie auch ohne besondere Gründe zusammenhielten. Die Erinnerung an seine Mutter zerreißt ihm das Herz, denn sie ist aus Liebe zu ihm gestorben, als er noch zu jung und selbstsüchtig war, um diese Liebe zu erwidern, und sie hat sich, er weiß gar nicht mehr wie, für ihr persönliches, unumstößliches Prinzip von Treue aufgeopfert. So etwas kann heute gar nicht mehr geschehen. Heute herrschen Angst, Hass und Schmerz, aber es gibt keine würdevollen Gefühle mehr, kein tiefes oder vielschichtiges Leid. All das glaubt er in den großen Augen seiner Mutter und seiner Schwester zu lesen, die, Hunderte Faden tief und immer tiefer sinkend, durch das grüne Wasser zu ihm hochschauen.
Mit einem Mal steht er auf federndem Boden, in kurzem Gras, das die schrägen Sonnenstrahlen eines Sommerabends vergolden. Die Landschaft vor seinen Augen kehrt so oft in seinen Träumen wieder, dass er gar nicht mehr sagen kann, ob er sie in der realen Welt je gesehen hat. In seinem wachen Denken nennt er sie das Goldene Land: eine alte Weide voller Kaninchenlöcher, mit einem Wanderpfad quer hindurch und hie und da einem Maulwurfshügel. Am anderen Ende wiegt sich das Ulmengeäst eines zerzausten Hags ganz leicht in der Brise, das Laub eine dichte Masse, wie Frauenhaare. Irgendwo in der Nähe, aber nicht mehr sichtbar, plätschert ein langsam dahinfließender, klarer Bach, in dessen Becken unter Trauerweiden Zinnfische schwimmen.
Die junge dunkelhaarige Frau kommt über die Wiese auf ihn zu. In einem einzigen Schwung, so wirkt es jedenfalls, reißt sie sich die Kleider vom Leib und wirft sie achtlos beiseite. Ihr weißer, glatter Körper erregt ihn nicht, er sieht kaum hin. Doch wie sie ihre Kleider wegschleudert, erfüllt ihn mit überwältigender Bewunderung, so anmutig und unbekümmert scheint sie eine ganze Kultur, ein ganzes Denksystem umzustoßen, als ließen sich der Große Bruder und die Partei und die Denkpol allesamt mit einer einzigen prachtvollen Armbewegung hinwegfegen. Auch diese Geste gehört zu den alten Zeiten. Winston erwacht mit dem Wort »Shakespeare« auf den Lippen.
Der Telemonitor gibt ein ohrenbetäubendes Pfeifen von sich, das dreißig Sekunden lang auf demselben Ton anhält. Es ist null sieben fünfzehn, die Weckzeit für Büroarbeiter. Winston hievt seinen Körper aus dem Bett – nackt, denn ein Parteimitglied der Äußeren Riege erhält nur dreitausend Kleidercoupons im Jahr, und ein Pyjama kostet sechshundert –, greift nach einem schmuddligen ärmellosen Unterhemd und den Boxershorts, die über einem Stuhl hängen. Das Sport-»Ruckzuck« fängt in drei Minuten an. Im nächsten Moment windet er sich, wie fast immer kurz nach dem Aufwachen, in einem heftigen Hustenanfall, der seine Lungen so vollständig auswringt, dass er sich erst einmal auf den Rücken legen und einen Moment lang tief nach Luft ringen muss, bevor er wieder normal atmen kann. Von der Anstrengung schwellen seine Adern an, und sein Krampfadergeschwür juckt.
»Gruppe dreißig bis vierzig!«, blafft eine grelle Frauenstimme. »Gruppe dreißig bis vierzig! Aufstellung bitte. Dreißig bis vierzig!«
Winston nimmt vor dem Telemonitor Habachtstellung ein, auf dem eine recht junge, hager-muskulöse Frau in Uniformjacke und Turnschuhen zu sehen ist.
»Arme anwinkeln und strecken!«, stößt sie hervor. »In meinem Rhythmus. Eins, zwei, drei, vier! Eins, zwei, drei, vier! Na los, Genossen, jetzt mal bisschen Schwung hier! Eins, zwei, drei, vier! Eins, zwei, drei, vier! …«
Der Schmerz des Hustenanfalls vertreibt den Nachhall von Winstons Traum nicht ganz, und die rhythmischen Bewegungen der Gymnastik stellen ihn einigermaßen wieder her. Während er mechanisch die Arme vor- und zurückstreckt, mit der grimmig-vergnügten Miene, die für das Ruckzuck als angemessen erachtet wird, kämpft er sich mit seinen Gedanken rückwärts in die düstere Zeit seiner frühen Kindheit. Das ist unglaublich schwierig. Jenseits der späten Fünfzigerjahre ist alles verblasst. Wenn man sich auf keinerlei äußere Aufzeichnungen beziehen kann, verliert auch das eigene Leben alle Konturen. Man erinnert sich an Großereignisse, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nie geschehen sind, man erinnert sich an Details von Vorfällen, ohne ihre Atmosphäre rekonstruieren zu können, und es gibt lange, leere Abschnitte, denen man gar nichts zuordnen kann. Damals war alles anders. Selbst die Namen von Ländern und ihre Gestalt auf der Landkarte. Startbahn Eins etwa hieß damals nicht so, sondern England oder Großbritannien, wobei London, da ist er sich ziemlich sicher, schon immer London war.
Winston kann sich nicht mit Gewissheit an eine Zeit erinnern, als sein Land nicht im Krieg war, aber in seiner Kindheit muss es eine recht lange Friedensphase gegeben haben, denn zu seinen frühen Erinnerungen gehört ein Luftangriff, der damals alle überraschte. Vielleicht war das die Atombombe auf Colchester. Den Angriff selbst hat er nicht mehr im Gedächtnis, aber wie die Hand des Vaters die seine umklammerte, während sie abwärts, abwärts, abwärts an einen Ort tief unter der Erde hetzten, eine Wendeltreppe hinunter, die unter seinen Füßen schepperte, und irgendwann waren seine Beine so müde, dass er anfing zu wimmern und sie eine Pause einlegen mussten. Die Mutter kam, langsam und verträumt wie immer, weit hinter ihnen nach. Sie trug seine kleine Schwester im Arm – vielleicht war es auch nur ein Bündel Decken; er kann nicht genau sagen, ob seine Schwester damals schon geboren war. Schließlich kamen sie an einem lauten, überfüllten Ort heraus, den er als U-Bahnhof erkannte.
Überall saßen Leute auf den Steinfliesen, andere, dicht an dicht und sogar übereinander, auf Metallpritschen. Winston, seine Mutter und sein Vater fanden einen Platz am Boden, und in der Nähe saßen ein alter Mann und eine alte Frau nebeneinander auf einer Pritsche. Der alte Mann trug einen ordentlichen dunklen Anzug und eine schwarze Stoffkappe, die auf den sehr weißen Haaren nach hinten geschoben war; die blauen Augen in seinem dunkelroten Gesicht standen voller Tränen, und er stank nach Gin. Der schien statt Schweiß aus seinen Poren zu quellen, und man hätte meinen können, auch die Tränen in seinen Augen wären reiner Gin. Doch so angetrunken er war, ihm setzte ein echter, unerträglicher Kummer zu. Winston erfasste, ganz kindlich, dass gerade etwas Schreckliches, Unverzeihliches geschehen war, nicht wiedergutzumachen. Er meinte auch zu wissen, was es war. Jemand, den der alte Mann liebte, eine kleine Enkelin vielleicht, war umgekommen. Alle paar Minuten wiederholte er: