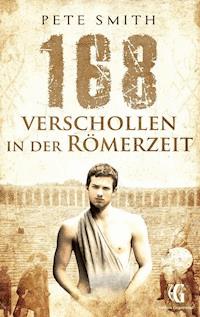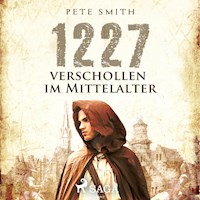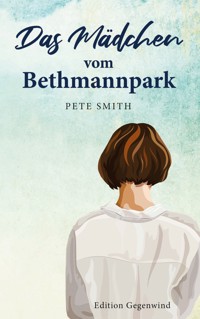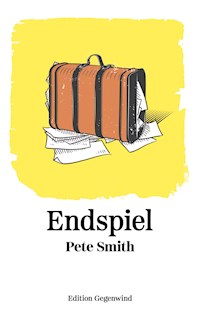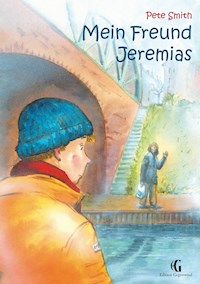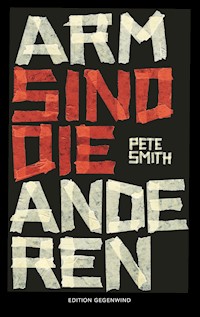Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: "Verschollen"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nelson, Luk, Levent und Judith, Schüler des Hochbegabten-Internats Burg Rosenstoltz, erhalten eine Nachricht aus der Zukunft: Die erste bemannte Mars-Expedition in der Geschichte der Menschheit wird von Terroristen sabotiert. Als wäre das allein nicht schon beängstigend genug, befinden sich an Bord der Raumfähre auch noch die Eltern ihrer Freunde Miriam und Vincent. Madonna, Levents Zeitmaschine, bringt die Freunde ins Jahr 2033, wo sie den Kampf gegen die selbst ernannten Weltraum-Piraten aufnehmen. Dahinter verbergen sich zwei alte Bekannte, die ihnen schon bei ihrer letzten Zeitreise ins römische Köln nach dem Leben getrachtet haben... "2033 - Verschollen in der Zukunft" ist der letzte Teil der spannenden Zeitreise-Trilogie um Nelson und seine Freunde (weitere Romane: "1227 - Verschollen im Mittelalter" und"168 - Verschollen in der Römerzeit").
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Smith
wurde 1960 als Sohn einer Spanierin und eines Engländers in Soest geboren. An der Universität Münster studierte er Germanistik, Philosophie und Publizistik. Er schreibt Kinder- und Jugendbücher, Essays und Romane, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Er lebt in Frankfurt am Main.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zweiter Teil
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Dritter Teil
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Epilog
PROLOG
Die Luft brannte. Senkrecht stand die Sonne über der riesigen Insel aus Asphalt und Beton. Der Schatten, den die Trägerrakete warf, war nur wenige Meter lang und machte sich geradezu winzig aus in Anbetracht ihrer gigantischen Größe. Eine unheimliche Stille lag über dem Tal. Dabei wimmelte es rund um den weiträumig abgesperrten Weltraumbahnhof nur so von Menschen. Viele harrten schon seit Tagen in der sengenden Hitze aus, um hautnah dabei zu sein in der Stunde des Menschheitstriumphs. Einige hatten Zelte aufgebaut, andere die Nächte in ihren Autos verbracht. Jetzt ahnten sie, dass der ersehnte Augenblick gekommen war.
Im Kontrollzentrum herrschte konzentrierte Ruhe. Vor jedem der etwa fünfzig Bildschirmplätze saßen Männer und Frauen, die zwar geschäftig taten, im Grunde aber nur noch auf den unmittelbar bevorstehenden Countdown warteten. Eine Projektion an der Stirnseite des Kontrollzentrums zeigte die Raumfähre in einem Kokon von vor Hitze flirrender Luft. Irgendwo knackte ein Lautsprecher.
„Flight Controller Stand-by.“
Die Anwesenden sahen auf.
In der Mitte des Raumes hatte sich ein Mann erhoben und schritt langsam nach vorn. Er trug als einziger einen Anzug, einen dunkelblauen Zweireiher, dazu ein schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte. Vorne angekommen, blickte er seine Kollegen erwartungsvoll an.
„Comm check“, sprach er in das Mikrofon seines Headsets, und seine Lautsprecherstimme hallte vielfach verstärkt durch den Raum.
„Five-by-five“, antwortete eine Stimme von irgendwoher.
Der Mann nickte noch einmal. Er räusperte sich.
„Geben Sie mir ein Go oder No Go für den Start“, sagte er ruhig. „Booster?“
Die Frau, die ihm am nächsten saß, reckte den Daumen nach oben. „Wir haben Go.“
„EECOM?“
Vor ihr erhob sich ein Mann und nickte. „Go.“
„Network?“
„Go, Flight.“
„Recovery?“
„Wir haben Go!“
„TELMU?“
„Go.“
„FAO?“
„Go, Flight.“
„GNC?“
„Go.“
„FIDO?“
„Wir haben Go, Flight.“
„CAPCOM?“
„Go.“
„MEM Controller?“
„Go, Flight!“
Der Flugdirektor blickte zur Leinwand.
„Wir haben Go für den Start“, sprach er in sein Mikrofon. Als unterhalb der Startrampe die Treibstoffpumpen ansprangen, erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Es hatte den Anschein, als ob sich die Vibration auf die Menschen übertrüge, sowohl auf die Techniker, die in weißen Schutzanzügen um die Startrampe herum wuselten, als auch auf die Hunderttausende von Zuschauern, die erwartungsvoll ihre Smartphones in die Höhe hielten.
„Wir haben Startfreigabe“, hörte man eine weibliche Lautsprecherstimme und kurz darauf: „T minus 30.“
Dann begann die Stimme rückwärts zu zählen:
„29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 ...“
Die Vibration ging über in ein dumpfes Grollen, das lauter wurde, bis es die Halterungen und die Rakete selbst erfasste.
„... 18,17,16,15,14,13,12,11 ...“
Der Mann im Kontrollzentrum blieb die Ruhe selbst.
„Wir beginnen mit der Zündungssequenz“, sagte er.
„... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.“
Ein ohrenbetäubendes Brüllen und Zischen erklang. Weiße Flammen schossen aus dem Triebwerk der Rakete, und dichter Qualm wälzte sich in riesigen Wolken über das Gelände. Gleichzeitig sprangen nacheinander die Halterungen ab. Schwerfällig und majestätisch zugleich erhob sich die Trägerrakete, wie von einem Polster aus Glut und Qualm getragen. Begeistert schrien die Zuschauer auf und klatschten in die Hände. Unterdessen nahm die Raumfähre über ihren Köpfen langsam Geschwindigkeit auf. Rasch wuchs die Glut zu einer riesigen Stichflamme an. Während sich das Ungetüm und mit ihm das infernalische Dröhnen und Fauchen von der Erde entfernte und die kilometerhohe Rauchsäule langsam auseinanderquoll, kehrte allmählich die Stille zurück und senkte sich wie ein Tuch über das wogende Menschenmeer.
Im Kontrollzentrum waren alle aufgesprungen. Wissenschaftler und Techniker beobachteten gebannt, wie sich die Trägerrakete in den blassblauen Himmel bohrte.
„Eine Minute, fünfzehn Sekunden“, ertönte eine Stimme von irgendwoher. „Höhe neun nautische Meilen.“
„Geschwindigkeit nach Plan“, antwortete jemand.
„Höhe Four 0“, sagte ein anderer.
In diesem Moment kippte die Spitze der Raumfähre zur Seite. Die ausgebrannten Boosterraketen wurden abgeworfen und glitten an Fallschirmen zurück zur Erde. Wie ein Pfeil schoss die Raumfähre weiter, bis sie im weißblauen Nichts verschwand.
Im Kontrollzentrum brandete Applaus auf. Die Gesichtszüge des Flugdirektors entspannten sich. Seine Augen verrieten die Andeutung eines Lächelns.
„Okay, Leute, das war’s!“, sagte er und blickte in die Runde. „Dann also an die Arbeit!“
ERSTER TEIL
„Es kommt nicht darauf an,
die Zukunft vorauszusagen,
sondern darauf,
auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“
Perikles (490 – 429 v. Chr.)
1
„Seht nur! Schon wieder eine! Ich glaub, ich werd verrückt!“ Sie lagen auf dem Sportfeld unterhalb der Burg und sahen hinauf in den glänzenden Nachthimmel. Sarah schien völlig weggetreten. Immer wieder stupste sie Levent an und deutete nach oben, wo sich den vier Freunden in der Tat ein überwältigendes Schauspiel bot.
Selbst Nelson, der das Weltall kannte wie kein anderer im Internat, konnte sich nicht daran erinnern, jemals zuvor eine schönere Nacht als diese erlebt zu haben! Der Himmel war übersät mit Sternen, Myriaden winziger Leuchtdioden, einige strahlend hell, andere matt und weißlich glänzend, manche schienen zu blinken, während das blasse Licht weit entfernter Gestirne zu einem einzigen Sternennebel verschwamm. Von Zeit zu Zeit wischten Silberfäden über den tiefschwarzen Himmel, immer an einer anderen Stelle, Sternschnuppen und Feuerkugeln, deren unvermutetes Aufflackern wie ein göttliches Augenzwinkern, wie ein kosmischer Schabernack erschien.
Unwillkürlich musste Nelson an seinen Opa denken. Vor vielen Jahren einmal hatte ihm sein Großvater die Sternbilder erklärt: Pegasus und Orion, Andromeda und Kepheus, die Nördliche Wasserschlange, Luchs und Jungfrau.
„Aber was sind alle Sterne dieser Welt gegen das kleine Glück einer Sternschnuppe?“, hatte er seinen Vortrag beendet. „Wenn du am Nachthimmel eine entdeckst, dann darfst du dir etwas wünschen, mein Junge. Schließ die Augen, denk fest daran, und dein Wunsch geht bestimmt in Erfüllung. Aber nur wenn du niemandem davon erzählst. Wirklich niemandem, hörst du?“
Nelson schloss die Augen. Er musste nicht lange überlegen. Eigentlich hatte er nur einen Wunsch. Allerdings wusste er, dass er sich noch etwas gedulden musste, bevor dieser Wunsch in Erfüllung gehen konnte.
Drei Tage, dachte er. Und drei Nächte. Aber vielleicht ...
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete er, wie Sarah ihren Kopf auf Levents Schulter legte. Er wischte den letzten Gedanken beiseite.
Keine Chance, dachte er. Sonst hätte sie doch längst angerufen.
Es war die letzte Ferienwoche vor Beginn des neuen Schuljahrs. Nelson konnte kaum glauben, dass bereits sein zweites Jahr im Hochbegabten-Internat Burg Rosenstoltz bevorstand. Vor zwei Tagen erst war er aus dem Urlaub zurückgekehrt und von Berlin aus gleich nach Köln weitergereist. Seine Eltern mussten arbeiten, und in der Hauptstadt hatte er sowieso keine Freunde. Was vor allem daran lag, dass er und seine Eltern erst seit gut einem Jahr wieder in Deutschland lebten. Da sein Vater viele Jahre als Botschafter im Ausland beschäftigt gewesen war, hatte Nelson seine Kindheit überall auf der Welt, nur nicht in seinem Geburtsland verbracht. Sie hatten in Indonesien, später in Bolivien, Venezuela und in Namibia gelebt. Vor einem Jahr hatte man seinen Vater zurückbeordert. Seither arbeitete er im Auswärtigen Amt in Berlin. Weil seine Eltern jedoch in ganz Deutschland nur eine einzige Schule ermitteln konnten, die imstande war, sowohl dem Wissensdurst als auch dem Lerntempo ihres Sohnes Rechnung zu tragen, hatten sie Nelson schweren Herzens auf ein 580 Kilometer entferntes Internat gegeben, eben jenes Hochbegabten-Internat Burg Rosenstoltz, das in der Nähe von Köln auf einem Hügel direkt über dem Rhein thronte.
Sein Freund Luk, der in diesem Moment neben ihm lag und von Zeit zu Zeit gestelzte Kommentare über die fortwährenden Himmelserscheinungen von sich gab, war erst am Morgen wieder eingetrudelt. Er wolle sich in Ruhe auf das neue Schuljahr vorbereiten, hatte er verkündet. Aber Nelson war sich ziemlich sicher, dass auch ihm daheim einfach die Decke auf den Kopf gefallen war.
Levent, der Älteste von ihnen, hatte die meiste Zeit seiner Ferien auf Burg Rosenstoltz verbracht. Er war Waise und kannte auch sonst niemanden, bei dem er die unterrichtsfreie Zeit hätte zubringen können. Immerhin kannte er Sarah, die im Dorf unweit der Burg wohnte. Mit ihr war er zwei Wochen in der Türkei gewesen. Die beiden waren seit geraumer Zeit immer mal wieder ein Paar.
Nelson setzte sich auf und rieb die Hände gegeneinander. Ihn fröstelte, obwohl die Nacht lau und trocken war. Einige hundert Meter entfernt ragten die Türme von Burg Rosenstoltz in den glitzernden Himmel. Sein Herz machte einen Sprung, als ein weiterer Bolide aufleuchtete und im selben Augenblick ins Nichts verlosch.
Er lächelte still. Sternenstaub, dachte er. Wie im Märchen.
Nelson, dessen größte Leidenschaft die Astrophysik war, wusste natürlich, dass sie dieses nächtliche Schauspiel bloß millimeterkleinen Meteoren verdankten, die mit 30 bis 70 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre trafen und dort verglühten. Er wusste, dass es nicht das verglühende Teilchen selbst, sondern die Elektronen der Luftmoleküle waren, die aufgrund der Reibung am Nachthimmel aufleuchteten. Und selbstverständlich war ihm auch klar, dass die Häufung der Sternschnuppen in dieser Nacht nur darauf zurückzuführen war, dass die Erde den Meteorstrom der Perseiden kreuzte, wie in den Sommermonaten eines jeden Jahres. Aber jenes Wissen blieb ohne Widerhall in seinem Herzen, weil es die Schönheit dieses Feenzaubers nicht zu erfassen vermochte.
Es war genau dieses Gefühl, das sein Opa das kleine Glück einer Sternschnuppe genannt hatte.
„Wieder eine“, bemerkte Luk, aber diesmal klang es schon nicht mehr so begeistert wie noch am Anfang ihres nächtlichen Picknicks.
Zu viele Wünsche auf einmal, dachte Nelson, der ahnte, dass auch sein Freund im Grunde nur einen einzigen Wunsch hegte.
Der Gedanke blitzte plötzlich auf. Wie eine Sternschnuppe.
„Was ist?“, raunte er Luk ins Ohr. „Wollen wir Madonna einen Besuch abstatten?“
Luk sah ihn verdutzt an. „Du meinst jetzt? Jetzt sofort?“
„Warum nicht?“ Nelson rückte noch etwas näher an ihn heran. „Mitternacht vorbei, keine Lehrer auf der Burg, Kunkel schläft den Schlaf der Gerechten, und die beiden hier werden uns nicht allzu sehr vermissen, fürchte ich.“
Luk grinste. „Oo-kay“, hauchte er gedehnt. „Vielleicht ist ja Post für mich da.“
„Liebesgrüße aus der Zukunft“, entgegnete Nelson und grinste.
Levents Kopf tauchte aus dem Schlafsack hervor. „Liebesgrüße? Zukunft? Was habt ihr vor?“
„Nur ein kleiner Spaziergang“, erwiderte Nelson leichthin. „Wollen das junge Glück ein paar ausgedehnte Momente allein lassen.“ Dabei zwinkerte er Levent zu und deutete mit dem Kopf auf Sarah, deren Silhouette mit der Levents zu einem Bild der stillen Eintracht verschmolz.
Levent schnaubte verächtlich. „So viel Rücksicht bin ich von euch gar nicht gewohnt“, brummte er und blickte seine Freunde argwöhnisch an.
„Sei doch nicht so“, warf Sarah ein. „Ist doch süß.“
Nelson vermutete, dass sie ganz bestimmt nichts dagegen hatte, wenn er und Luk sich eine Zeit lang verkrümelten.
„Ich kann mir schon denken, wohin euch euer kleiner Spaziergang führt“, murmelte Levent.
Nelson grinste. „Na dann.“
„Benehmt euch“, warf Luk den Turteltäubchen noch zu. Dann machten er und Nelson sich an den Aufstieg zur Burg.
Als sie die Auffahrt zum Burghof erreichten und unter ihren Füßen der Kies knirschte, war sich Nelson mit einem Mal nicht mehr sicher, ob sie wirklich unbemerkt von Hausmeister Kunkel ihr unterirdisches Ziel erreichen würden. Der Schlüssel, den er ins Schloss des Eingangsportals steckte und vorsichtig herumdrehte, quiekte wie ein Ferkel, und die schwere Pforte knarzte beim Aufdrücken so jämmerlich, als ob sie für irgendeinen dämlichen Gruselschocker extra so präpariert worden wäre. Er und Luk hielten die Luft an und lauschten in die Nacht. Aber während von fern her das Grollen eines Flugzeugs an ihr Ohr drang, blieb es in den Fluchten der Burg totenstill.
Sie zogen die Schuhe aus und flitzten die Treppen hinab in den Keller. Nelson knipste seine Taschenlampe an. Der Heizungsraum lag hinter einer schweren Eisentür. Hier hielt Hausmeister Kunkel jene Schlüssel versteckt, die er nur selten benötigte, weil sie Türen öffneten, die in die kaum genutzten Katakomben unterhalb der Burg führten. Das Versteck war so geheim, dass mindestens die Hälfte aller Internatsschüler davon wusste.
Luk drehte an einem der Rohre, die nur zum Schein aus dem Heizungskessel ragten, und fischte ein Schlüsselbrett heraus.
„Alois, wir haben dich ja so lieb“, flüsterte er und grinste.
Er nahm einen kleinen Schlüssel vom Haken, dann liefen sie weiter.
Vom Heizungsraum drangen sie tiefer in die Eingeweide der Burg vor. Die Lichtkegel ihrer Taschenlampen wischten über Wände, deren Felsgestein jahrtausende-, wenn nicht jahrmillionenalt war. Als sie ein in den Fels geritztes Kreuz entdeckten, hielten sie inne. Die Falltür zu ihren Füßen war kaum zu erkennen. Gemeinsam zogen sie sie auf und leuchteten nach unten. Eine in den rohen Stein gehauene Treppe führte 86 Stufen weit in die Tiefe. Nelson setzte einen Fuß auf die oberste Stufe. Kalt kroch es ihm das Bein hoch. Er kam nicht gern hierher und hätte sich gewünscht, dass sich Madonna bequemer erreichen ließe. Aber zumindest schien sie dort, wo sie ruhte, vor Entdeckungen halbwegs sicher zu sein.
Unten angelangt, wandten sie sich nach links und folgten dem Gang, bis sich der zu einem höhlenartigen Raum weitete. Dort wählten sie einen weiteren Schacht, der noch tiefer in den Berg hineinführte, und stoppten schließlich vor einer hohen Felswand, die auf den ersten Blick so abweisend wirkte wie alle anderen Höhlenwände auch. An einer Stelle jedoch spaltete sich die Formation in zwei überlappende Fronten, die einen schmalen Durchlass gewährten. Luk und Nelson schlüpften hindurch und fanden sich mit einem Mal im weitaus größten Gewölbe der Katakomben wieder – im Dom!
Die kathedralenartige Höhle kannten im Internat bloß wenige Schüler vom Hörensagen. Aber dass es sie wirklich gab, wussten außer Nelson und Luk nur Levent, Judith und eine Handvoll ehemaliger Schüler, unter ihnen Luks ältere Schwester Paula, die ihr Wissen an ihren Bruder weitergegeben hatte.
Vom eigentlichen Geheimnis dieses sagenhaften Ortes hatten jedoch auch die Ehemaligen nicht die blasseste Ahnung. Der Dom nämlich barg die vielleicht bedeutendste Erfindung der Menschheit! Levent, ihr Konstrukteur und Entwickler, hatte sein Baby liebevoll auf den Namen Madonna getauft – Madonna, die Jungfrau, Madonna, der schillerndste Popstar aller Zeiten!
Die Freunde blieben unweit der Zeitmaschine stehen.
„Sie haben Wort gehalten“, flüsterte Luk.
„Hattest du etwas anderes erwartet?“, antwortete Nelson.
Sie näherten sich der Apparatur, deren gläserne Front das Licht ihrer Taschenlampen reflektierte. Hinter dem Glas wurde ein abgewetztes schmales Sofa sichtbar, das vor einem Schaltpult mit mehreren Bildschirmen und Rechnern stand. Auf dem Sofa lag ein eingerolltes Blatt Papier, das von einer Schleife gehalten wurde.
Luk grinste. „Hab ich’s nicht gesagt?“
Er löste die Schleife und rollte das Papier auf. Ein Medaillon fiel heraus. Luk zögerte. Er sah erst auf den Brief, dann auf das Schmuckstück, entschied sich dann aber für den Brief, den er laut vorlas:
Liebe Freunde,
wie ihr seht, sind wir wohlbehalten in unserer Zeit gelandet. Wir fühlen uns beide noch sehr schwach, haben aber leider kaum Muße, um uns wirklich auszuruhen. Denn hier steht ein epochales Ereignis bevor, das die Welt verändern wird, und wir befinden uns plötzlich mittendrin. Ich werde euch ein andermal davon berichten, versprochen!
Für das, was wir empfinden, gibt es keine Worte, daher an dieser Stelle nur ein einziges Wort: Danke!
Wir sprechen oft über euch und darüber, was ihr im Amphitheater und danach auf euch genommen habt, um unser Leben zu retten. Wir beide haben vorerst genug von Zeitreisen, das könnt ihr uns glauben. Dennoch hegen wir die Hoffnung, dass wir uns irgendwann – in eurer Zukunft oder unserer Vergangenheit? – einmal wiedersehen werden. Bis dahin senden wir euch die herzlichsten Grüße und freuen uns darauf, bald von euch zu hören!
Miriam und Vincent
PS: Das Medaillon soll euch an uns erinnern!
Luks Augen leuchteten, als er den Anhänger in die Hand nahm und den filigranen Deckel aufschnappen ließ. Miriam und Vincent lächelten ihn an. Luk lächelte zurück.
„Ich hab’s doch gewusst“, murmelte er. „Hab ich’s nicht gesagt?“
Unterdessen hatte Nelson den Brief zur Hand genommen, um ihn noch einmal zu lesen. Was meinte Miriam, wenn sie von einem epochalen Ereignis sprach, das die Welt verändern würde? Und dass sie sich plötzlich mittendrin befänden?
Miriam und Vincent waren der Grund dafür gewesen, weshalb sich Nelson und seine Freunde vor einigen Monaten zu ihrer zweiten Zeitreise aufgemacht hatten. Ein seltsamer Fund im Garten der Burg hatte Nelson auf die Spur zweier Zeitreisender gebracht. Er hatte herausgefunden, dass ein Jugendlicher aus der Zukunft im Jahr 168 nach Christus gestrandet und dort als Gladiator versklavt worden war. Nelson, Luk und Judith hatten ihn und seine Schwester aufgespürt und mit Levents Hilfe befreit. Madonna schließlich hatte sie alle zurückgebracht: Nelson und seine Freunde in die eigene Gegenwart, Vincent und Miriam ins Jahr 2033.
Luk war Miriam während ihres Abenteuers im römischen Köln sehr nahegekommen. Jetzt erwies sich, dass ihren Gefühlen zueinander auch die Zeit nichts anhaben konnte.
„Wir müssen ihnen zurückschreiben!“, rief Luk. „Am besten sofort!“
Nelson blickte ihn geistesabwesend an. Langsam kehrte er in die Gegenwart zurück.
„Zurückschreiben ... Ja, natürlich.“ Er zögerte. „Nur, meinst du nicht, wir sollten warten, bis Judith wieder da ist?“
Luk reagierte genervt. „Aber das dauert doch noch ewig!“
„Höchstens drei Tage“, präzisierte Nelson. „Und außerdem: Levent würde unsere Grüße bestimmt auch gern unterschreiben.“
„Ach der“, erwiderte Luk. „Der hat schließlich andere Dinge im Kopf, oder etwa nicht?“
Als Nelson darauf beharrte, die Freunde nicht zu übergehen, verwandelte sich Luk vor seinen Augen in das Leiden Christi.
„Drei Tage“, klagte er theatralisch. „Aber keinen Tag länger!“
2
Als sich drei Tage später kurz nach Mittag an der Haltestelle vor der Einmündung zur Burg Rosenstoltz die hintere Tür des Linienbusses öffnete, stieg ein einziger Fahrgast aus. Anderswo hätte die Erscheinung sicher neugierige Blicke auf sich gezogen. Aber hier gab es weit und breit niemanden, der hätte aufmerken können. Allenfalls ein paar Kühe, die sich aber nicht stören ließen, sondern weiter träge in der Mittagshitze dösten.
Die junge, barfüßige Frau wartete, bis der Bus wieder anfuhr, öffnete dann ihre Reisetasche und fischte ein Paar schwarze Turnschuhe heraus, in die sie schlüpfte. Währenddessen sah sie sich in der Gegend um. Als sie die Schuhe gebunden hatte, blickte sie einen Moment versonnen ins Nichts. Schließlich warf sie sich ihre Tasche über die Schulter und machte sich an den Aufstieg zur Burg.
Vor dem Hintergrund der sommerlichen Naturidylle – den sattgrünen Wiesen, den Weinbergen und dem bis zum Horizont mäandernden Rhein – wirkte die junge Frau wie jemand, der sich hierher verirrt hatte und eigentlich in einer Metropole wie Mailand oder Paris heimisch war. Ihre blauschwarze, von weißen Strähnchen durchzogene Pagenfrisur war ebenso stylish wie ihre weiß umrandete Sonnenbrille, deren Katzenaugenform an Leinwandstars der Fünfzigerjahre erinnerte. Ihre weite schwarze Flickenhose wurde von einem breiten weißen Stoffgürtel gehalten, dessen Silberschnalle das Wort TABU formte. Darüber trug sie ein kurzes schwarzes Top mit einem kleinen weißen Pfeil, der auf die bunten Glasperlen in ihrem Bauchnabel deutete.
Wenngleich die Sonne brannte und der Weg zur Burg steil war, ging ihn die junge Frau leichtfüßig und mit einem Lächeln im Gesicht. Doch kaum hatte sie das Tor zum Burghof erreicht, da erlosch ihr Lächeln, und sie hielt abrupt inne. Direkt vor dem Eingang parkte ein Krankenwagen! Die hintere Tür stand offen. Davor wartete ein junger, bärtiger Mann in Rettungsweste und rauchte eine Zigarette.
Obwohl der Kies unter ihren Schuhen knirschte, bemerkte er sie erst, als sie fast hinter ihm stand. Sein eben noch schlaff wirkender Körper straffte sich. Ungeniert gaffte er sie von oben bis unten an.
„Aber hallo!“, rief er. Sein Blick blieb an ihrem Piercing hängen.
„Was ist los?“, fragte sie, ohne auf seinen schmierigen Blick zu reagieren. „Ist etwas passiert?“
Das Gesicht des Sanitäters verzog sich zu einem anzüglichen Grinsen. „Passiert? Noch nicht“, erwiderte er, „aber was nicht ist, kann ja noch werden.“ Dabei starrte er weiter auf ihren braun gebrannten Bauch.
„Hey, ich hab dich gefragt, was hier los ist!“, fauchte die junge Frau. „Warum ihr hier seid!“
„Was soll schon los sein, Süße?“, entgegnete ihr Gegenüber ungerührt. „Bis eben war hier tote Hose, würde ich sagen.“
„Idiot!“, zischte die Schwarzhaarige und ließ den Bärtigen ohne ein weiteres Wort stehen.
In der Eingangshalle traf sie auf Alois Kunkel, den Hausmeister des Internats Burg Rosenstoltz.
„Ah, Judith“, begrüßte er sie. „Auch wieder da? Schön, schön. Wie waren denn deine Ferien?“
„Was ist mit dem Krankenwagen da draußen?“, erwiderte Judith ungeduldig. „Hatte jemand einen Unfall? Ist irgendetwas passiert?“
„Unfall? Passiert?“ Der Hausmeister blickte sie erschrocken an. Dann entspannten sich seine Gesichtszüge wieder. „Ach ja, der Krankenwagen ... Nein, nein, das ist nur wegen ... Ein neuer Schüler, gelähmt. Oder war es eine Schülerin? Was weiß denn ich, mit mir redet ja keiner. Aber wenn‘s ernst wird, bin ich doch wieder der Gelackmeierte.“ Er sah auf die Uhr. „Der Neue ist gerade bei Professor Papadopoulos. Der zeigt ihm – oder ihr? Ist ja auch egal, jedenfalls muss ihm doch einer zeigen, wie das hier alles funktioniert. Wenn man mich gefragt hätte, aber ich bin ja ...“
„Ich dachte schon“, unterbrach ihn Judith erleichtert. Sie schob ihre Sonnenbrille ins Haar und grinste den Hausmeister an. „Vielen Dank. Ich geh dann mal. Und einen schönen Tag noch!“
Auf dem Weg hinauf in den Mädchentrakt kam ihr eine Schar aufgeregt plappernder Erstklässlerinnen entgegen. Als sie Judith wahrnahmen, blieben einige von ihnen abrupt stehen und begannen zu tuscheln. Judith nahm keine Notiz von ihnen. Sie war es gewohnt, dass ihre Mitmenschen auf sie reagierten, manche bewundernd, andere feindselig. Manchmal nervte sie das, meistens jedoch nicht. Heute jedenfalls konnte ihr niemand die Laune verderben. Endlich war sie wieder da, wo sie sein wollte.
In ihrem Zimmer angekommen, sah sie sich erst einmal um. Alles war so, wie sie es vor sechs Wochen verlassen hatte. Allerdings schien der Raum ein wenig sauberer als sonst, Judith meinte sogar, Spuren von Essigreiniger zu erschnüffeln. Sie öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Von ihrem Zimmer aus hatte sie den ganzen Hof im Blick. Der Typ mit dem Bart zündete sich gerade eine weitere Zigarette an. Plötzlich zuckte er zusammen. Umständlich fingerte er in seiner Jackentasche herum und zog endlich ein Handy heraus. Nachdem er einige Zeit hinein gelauscht hatte, warf er fluchend seine Zigarette weg und eilte ins Gebäude. Kurze Zeit später tauchte er wieder auf. Jetzt schob er einen bunten Rollstuhl vor sich her, in dem ein Mädchen saß. Sie hatte lange blonde Dreadlocks und war etwa in Judiths Alter. Begleitet wurden die beiden von Professor Papadopoulos, dem Dozenten für Neogräzistik, der wie immer einen schwarzen Umhang trug und damit eher einem Mönch denn einem Schullehrer glich. Vor dem Wagen beugte er sich zu dem Mädchen herunter und verabschiedete sich von ihr. Judith konnte nur Wortfetzen verstehen. Das Mädchen nickte. Als Papadopoulos zurück ins Gebäude ging, schob der Zivi den Rollstuhl auf die Rampe und bediente die Automatik. Während die Plattform hochfuhr, blickte das Mädchen geradewegs in Judiths Richtung. Judith winkte. Das Mädchen lächelte zurück. Dann schob der Bärtige sie ins Wageninnere und schloss die Tür. Sekunden später fuhr der Wagen Kies spritzend los.
Judith packte ihre Tasche aus und legte ihre Kleider in den Schrank. Dann griff sie zum Telefon. Sie wählte, aber niemand hob ab. Sie versuchte eine andere Nummer, aber auch diesmal hatte sie kein Glück. Enttäuscht warf sie sich aufs Bett und starrte an die Decke. Doch schon nach wenigen Augenblicken sprang sie wieder auf und machte sich auf den Weg in die Cafeteria.
An einem Tisch saßen Mahmut und Janeck, an einem anderen brütete Hoffmann über Heideggers Sein und Zeit.
Der, den sie eigentlich treffen wollte, war nicht da.
Sie bestellte einen Espresso und hockte sich zu ihren Mitschülern an den Tisch.
„Schalom“, begrüßte sie Mahmut, ein in Deutschland geborener Palästinenser, der gern über den Weltfrieden meditierte. „Du hast bestimmt ziemlich aufregende Ferien verbracht, hab ich recht?“
„Sicher“, antwortete Judith gedehnt. „Willst du wissen, wie oft ich mich aufregen musste? Oder mit welch ungeheuer spannenden Themen ich meine Zeit vergeudet habe?“
Alarmiert vom Ton ihrer Stimme, zog es der Deutsch-Palästinenser vor, lieber nicht weiter nachzufragen. Stattdessen fing er plötzlich an, merkwürdige Schnalzlaute auszustoßen, die anderswo den Notarzt auf den Plan gerufen hätten.
Seinem Tischnachbar Janeck hingegen war der Ausbruch seines Freundes nur ein müdes Gähnen wert.
„Xhosa, eine Khoisan-Sprache der afrikanischen Buschleute“, erklärte er Judith. „Damit nervt er schon die ganze Zeit.“
Mahmut grinste. „Hab ich mir in den Ferien draufgeschaufelt.“
„Die neunundvierzigste?“, fragte Judith, um Höflichkeit bemüht. Mahmut war das Sprachgenie auf Burg Rosenstoltz.
„Die fünfzigste“, erwiderte er stolz. „Die nächste wird Shona sein, eine Niger-Kongo-Sprache der Bantu-Gruppe. Weißt du, dass die Menschen in Simbabwe mehr als 200 Wörter für gehen kennen?“
„Ich geh dann auch mal“, erwiderte Judith, dankbar für das Stichwort, trank ihre Tasse leer und stand auf. „Übrigens. Hat einer von euch Nelson gesehen?“
Janeck erwachte aus seinem Tiefschlaf. „Nelson?“ Er warf Mahmut einen vielsagenden Blick zu. „Nein, tut mir leid.“ Er zögerte. „Ihr beide, ihr hängt in letzter Zeit ganz schön oft zusammen ab.“ Dabei kniff er ihr ein Auge zu und grinste. „Sag schon, läuft da was zwischen euch, was ich wissen sollte?“
„So wie zwischen dir und Mahmut?“, fauchte Judith. „Ihr beide, ihr hängt ja auch ziemlich oft zusammen ab. Was läuft denn zwischen euch beiden Süßen, was ich wissen sollte?“
Noch bevor Mahmut und Janeck protestieren konnten, hatte sie ihnen bereits den Rücken zugewandt und marschierte mit weit ausholenden Schritten hinaus.
Kaum hatte sie die Eingangshalle erreicht, vernahm sie plötzlich einen spitzen Schrei, dem unmittelbar darauf ein weiterer folgte. Sie brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um sich auszumalen, was ihr jetzt bevorstand. Schon kamen Kim und Lea auf spitzen Absätzen die Treppe herunter getrippelt.
„Liebes!“, rief Lea.
„Judy-Maus!“, tönte Kim.
Dass sich genau in diesem Augenblick das Eingangsportal öffnete und sich Nelsons Silhouette im Türrahmen abzeichnete, erschien Judith im Nachhinein wie der Prolog eines schlechten Films, in dem man ihr die Hauptrolle zugedacht hatte. Während Kim und Lea an ihr herummachten, Küsschen links und Küsschen rechts, nahm das Schicksal seinen Lauf. Luk im Schlepptau, kam Nelson näher und blieb, da er Judith entdeckte, wie vom Donner gerührt stehen. Zwischen zwei Schmatzern konnte Judith erkennen, wie ihn Luk in die Seite stieß und dabei angewidert in ihre Richtung wies. Verzweifelt versuchte sie sich aus der Umklammerung ihrer Freundinnen zu befreien, doch in dem Moment, da es ihr gelang, drehte sich Lea nach den beiden Jungs um und keifte quer durch die Halle:
„Was glotzt ihr denn so blöd? Sind wir Kino, oder was?“
Woraufhin Luk postwendend zurückschoss: „Splattermovies in echt sieht man halt nicht alle Tage!“
Daraus entwickelte sich ein fieser Schlagabtausch, der im Nu Zuschauer fand und letztlich unentschieden endete, als Frau Kodiak aus ihrem Sekretariat herbeieilte, um die Streithähne und -hennen zu trennen. Judith blieb nichts anderes übrig, als Kim und Lea die Stange zu halten, während Nelson den tobenden Luk zu beruhigen suchte. Ein unverfänglicher Blick war das Einzige, was den beiden an diesem Nachmittag vergönnt war.
Später lag Judith auf ihrem Bett und überlegte, ob sie Nelson anrufen oder doch lieber warten sollte, bis er den ersten Schritt tat. Eigentlich, so fand sie, war es an ihm, zum Hörer zu greifen, schließlich hatte sie vor ihrer schicksalhaften Begegnung mit den beiden Grazien bereits die halbe Burg nach ihm abgesucht. Sie wartete eine viertel Stunde lang, eine halbe Stunde lang, dann weitere zwanzig Minuten. Als die Stunde voll war, gab sie ihm noch eine letzte Gnadenfrist von fünf Minuten. Nachdem auch die verstrichen war, sprang sie wütend aus dem Bett und beschloss, nie wieder auch nur ein einziges Wort mit ihm zu reden. Aus Florida konnte er sie anrufen, aber hier, wenige hundert Meter von ihr entfernt, tat er so, als ob es sie gar nicht gäbe!
Wirst schon sehen, dachte sie. Was du kannst, kann ich schon lange!
Als sie sich halbwegs beruhigt hatte, meldeten sich Stimmen zu Wort, die für den Angeklagten Partei ergriffen:
Vielleicht glaubt er, dass du immer noch mit Lea und Kim zusammen bist, und will dich vor deinen Freundinnen nicht blamieren.
Oder er selbst findet einfach keine Gelegenheit zu telefonieren, weil Luk ihn nicht lässt.
Oder Gottfried telefoniert die ganze Zeit.
Und gleichzeitig ist der Akku seines Smartphones leer.
Nachdem sie den Entlastungszeugen eine Weile gelauscht hatte, griff sie selbst zum Telefon und wählte erneut Nelsons Nummer. Zehn Mal ließ sie es klingeln. Beim elften Mal knallte sie den Hörer auf die Gabel und stampfte wütend durchs Zimmer. Eine Runde nach der anderen drehte sie, bis sie plötzlich wie angewurzelt am Fenster stehen blieb. War er das nicht? Der da unten? Der mit dem Rücken zu ihr am Hoftor lehnte? Sie war sich nicht sicher, weil sie nicht allzu viel erkennen konnte. Anscheinend war er nicht allein. Er schien sich mit jemandem zu unterhalten, der von der Mauer verdeckt wurde. Du hattest recht, dachte sie, Luk hält ihn noch immer in Beschlag. Einigermaßen besänftigt wollte sie sich gerade wieder abwenden, als Nelsons Gesprächspartner plötzlich aus dem Schatten ins Licht trat. Einen ewigen Moment lang setzte Judiths Herz aus. Nicht Luk war es, der sich dort unten vor Lachen krümmte, sondern Chantal, die hübscheste Rechenmaschine der Schule!
Judith traute ihren Augen nicht. Chantal lachte und lachte, während Nelson dastand und sie offenbar mit Witzen fütterte, auf dass sie ihm noch mehr von ihrem Honigkuchenpferdstrahlen schenke. Es dauerte eine Ewigkeit, bis seine Spaßquelle endlich versiegte. Mit dem Handrücken wischte sich Chantal die Tränen aus dem Gesicht und hakte sich bei Nelson unter. Wie zwei Verliebte schlenderten die beiden zum Eingang der Burg, wo sie Judiths Blicken entschwanden.
3
Es hatte lange gedauert, bis sich Luk endlich wieder einkriegte. Während er über die Weiber im Allgemeinen und die Internatszicken im Besonderen hergezogen war, hatte Nelson die meiste Zeit geschwiegen. Nur einmal war er unvorsichtig gewesen. Als er eingeworfen hatte, dass ja nicht alle Mädchen auf der Welt gleich seien, schließlich gebe es auch noch solche wie Judith und Miriam.
„Auf wessen Seite stehst du eigentlich?“, hatte ihn Luk angepfiffen. „Bist du mein Freund oder ein Frauenversteher?“
Später, als er Luk bei Levent geparkt hatte, war er noch einmal an die frische Luft gegangen, um den Kopf freizubekommen und fern von allen Lauschern Judith anzurufen. Er wollte ihr vorschlagen, mit ihm den Abend bei Enzo, ihrem Lieblingsitaliener, zu verbringen. Sie könnten hinlaufen. Vielleicht würden sie auf dem Rückweg gemeinsam eine Sternschnuppe entdecken.
Am Tor, im Schatten der Burgmauer, blieb er stehen und spähte hinauf zu Judiths Zimmer. Zunächst konnte er nichts erkennen, doch dann sah er hinter der spiegelnden Scheibe einen Schatten, der gleich darauf wieder verschwand. Er zückte sein Smartphone und ...
„Hab ich dich erwischt!“, zischte plötzlich eine Stimme direkt an seinem Ohr.
Nelson fuhr so heftig zusammen, dass er vor Schreck sein Smartphone ins Gebüsch warf. Als er sich umwandte, stand seine Mitschülerin Chantal vor ihm. Einige Sekunden lang blickten sie sich stumm an. Dann entgleisten Chantals Gesichtszüge, und sie wurde von Lachkrämpfen regelrecht durchgeschüttelt. Zwischen Glucksen und Luftholen presste sie einzelne Wortfetzen heraus – „Tschuldi“ und „wollt ja nich“ und „Spann“ und „stör“ – aus denen sich Nelson seinen eigenen Reim machen oder es auch bleiben lassen konnte. Er pickte sein Smartphone aus dem Gebüsch und wartete, bis sich Chantal endlich wieder beruhigt hatte. Sie trocknete ihre Tränen und blickte Nelson um Gnade heischend an.
„Du hast einfach so putzig ausgesehen“, gluckste sie. „Wie ein kleiner Junge, der sich ertappt fühlt. Komm schon! Auf den Schreck lad ich dich ein. Lass uns einen Cappuccino trinken, du hast doch Zeit?“
Noch bevor Nelson zustimmen konnte, hatte sie sich schon bei ihm untergehakt und dirigierte ihn zum Haupteingang. Als er zu Judiths Zimmer hochsah, war ihm, als ob sich der Vorhang bewegte. Er überlegte noch zu winken, doch in der nächsten Sekunde war der Schatten schon wieder verschwunden.
Vor der Cafeteria trafen sie auf Mahmut und Janeck, die ihnen, merkwürdige Blicke tauschend, den Weg versperrten.
„Schalom“, begrüßte ihn Mahmut übertrieben freundlich. „Vorhin war Judith hier. Sie hat dich gesucht.“
Nelson versuchte sich seine Überraschung nicht anmerken zu lassen. „Judith? Wann denn?“
„Ist schon ‘ne Weile her“, antwortete Mahmut, und Janeck grinste blöde.
„Is was?“, zischte Nelson.
„Schien ziemlich verzweifelt zu sein, deine Freundin“, bemerkte Janeck. Sie traten zur Seite, um die beiden durchzulassen.
Nelson zögerte. „Was meinst du mit verzweifelt?“
Janeck war schon weitergegangen. „Weiß nicht. Verzweifelt eben. Am besten, du fragst sie selbst.“
Mit einer aufgesetzt wirkenden Miene des Bedauerns wandte er sich ab und ließ die beiden stehen.
„Seid ihr zusammen?“, fragte Chantal neugierig, als sie sich einen Platz im hintersten Teil der Cafeteria gesucht hatten.
„Fängst du jetzt auch noch an?“, erwiderte Nelson gereizt.
Sie blickte ihn forschend an. Plötzlich blitzte es in ihren Augen.
„Aber ja doch, vorhin, das war ihr Zimmer, zu dem du hochgesehen hast, nicht wahr? Habt ihr euch gestritten?“
Nelson verdrehte die Augen. „Zwischen uns ist nichts!“, schnaubte er wütend. „Du musst nicht alles glauben, was dir irgendwelche Idioten einflüstern!“
Noch im selben Augenblick bereute er seine heftige Reaktion.
Doch Chantal reagierte ganz anders als erwartet. Statt ihn mit seinem Cappuccino einfach sitzen zu lassen, strahlte sie ihn aus ihren rehbraunen Augen an.
„Dann bin ich ja beruhigt“, flötete sie. „Du und Judith, ihr passt einfach nicht zusammen.“
Später konnte er sich an keine Einzelheiten ihres Gesprächs erinnern. Nur daran, dass ihm die ganze Zeit Chantals Satz im Kopf herum gespukt war. Du und Judith, ihr passt einfach nicht zusammen. Irgendwann waren sie auseinandergegangen. Dass sich Chantal bei ihm am Ende für den wunderschönen Nachmittag bedankt hatte, wertete er als ironische Kommentierung seiner Einsilbigkeit.
Auf seinem Zimmer angelangt griff er sofort zum Telefon und wählte Judiths Nummer. Doch kaum ertönte das Freizeichen, drang aus dem Bad das Geräusch der Klospülung an sein Ohr. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass jeden Moment sein Zimmernachbar Gottfried über ihn hereinbrechen würde. Schleunigst machte er sich wieder aus dem Staub, jedoch nicht ohne sich vorher zu vergewissern, dass er sein Smartphone eingesteckt hatte.
Auf dem Gang fand er ein ruhiges Plätzchen und drückte auf die Wahlwiederholung. Er ließ es lange klingeln und wollte schon auflegen, als Judith endlich abnahm und ein genervtes „Was?!“ in die Muschel blaffte.
„Hi! Ich bin’s“, meldete sich Nelson leise.
„Wer?“ Ihre Stimme kam ihm ganz und gar fremd vor.
„Ich, Nelson“, erwiderte er.
„Du Nelson, aber ich nicht Jane!“
Nelson schluckte. Lustig klang anders. Hatte er irgendetwas nicht mitbekommen?
Fürs Erste beschloss er, einfach über ihre seltsame Begrüßung hinwegzusehen.
„Ich dachte, wir könnten Pizza essen gehen“, sagte er bemüht locker. „Ich lad dich auch ein, was häl...“
„So, dachtest du“, unterbrach sie ihn. „Hab aber leider keine Zeit. Musst du dir schon jemand anderen suchen. Aber das fällt dir ja sicher nicht schwer. Und außerdem, bezahlen kann ich allein!“
Ihre Angriffslust brachte ihn völlig aus dem Konzept. Er zögerte. Was war nur mit ihr los?
„Kannst du mir bitte mal erklären, was ...“, begann er, aber sie unterbrach ihn erneut.
„Ich muss dir gar nichts erklären!“, fuhr sie ihn an. „Ich hab keine Zeit, basta! Bin ich dir Rechenschaft schuldig? Wär ja noch schöner! Ich frag dich ja auch nicht, mit wem du deine Freizeit verbringst.“
Nelson verstand überhaupt nichts mehr. „Aber ...“, erwiderte er, doch dann regte sich sein Stolz. „Okay. Sorry“, beendete er das Gespräch in förmlichem Ton. „Vergiss es einfach.“ Damit legte er auf.
Wie betäubt schlich er zurück auf sein Zimmer und legte sich aufs Bett. Was um alles in der Welt war bloß in sie gefahren? Von der Nähe, die er während seiner Anrufe aus Florida verspürt hatte, schien nichts mehr übrig zu sein. Dabei war das doch kaum mehr als eine Woche her. Judith konnte ätzend sein, das schon. Aber so ätzend wie eben hatte er sie noch nie erlebt!
Er stand wieder auf und ging zum Fenster. Von Osten her zogen dunkle Wolken auf.
Gottfried bemerkte er erst, als der ihm seine nasse Pranke auf die Schulter legte.
„Hey, Alter, hörst du schlecht?“
Als sich Nelson umwandte, stieg ihm eine Wolke aus Deo in die Nase, die ihm schier den Atem verschlug.
„Hi“, krächzte er und blickte konsterniert an Gottfried herunter. Sein Zimmernachbar trug knallrote Boxershorts, die mindestens zwei Nummern zu klein waren und nass an seinen prallen Oberschenkeln klebten. Als er näher kam, sah Nelson näher hin. Waren das kotzende Nikoläuse?
„Cool, stimmt‘s?“, strahlte Gottfried. „Kann ich dir auch besorgen, Alter.“
Nelson schluckte. „Nett von dir, aber ich ...“ Plötzlich wurde er von einem Hustenanfall geschüttelt. Keuchend riss er das Fenster auf.
Gottfried verzog das Gesicht. „Muss das sein?“, stöhnte er. „Bei Zug hol ich mir bestimmt wieder ‘n Fips.“
Genervt schlug Nelson das Fenster zu. „Okay“, flüsterte er heiser und zwängte sich an seinem Zimmernachbarn vorbei. „Ich geh ja schon.“
Ohne nachzudenken, schlug er den Weg zu Levents Zimmer ein. Im Unterschied zu den meisten anderen Internatsschülern wohnte Levent allein. Oder besser: fast allein. Denn seit ein paar Monaten hatte er einen blechernen Diener, den er selbst konstruiert und zusammengeschraubt hatte: Loddar, einen Haushaltsroboter im Dress der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.
Daher zeigte sich Nelson auch nicht überrascht, als ihm statt Levent der mechanische Butler die Tür öffnete.
„Hi, Loddar“, begrüßte er ihn müde.
„Wir haben heute das Wunder von Kaiserslautern geschafft, aber ich denke, man sollte das nicht überbewerten“, antwortete Loddar mit hohler Stimme.
Levent hatte seinen Roboter auf Dialog programmiert. Nannte man ihn bei seinem Spitznamen, dann wählte ein Zufallsgenerator die Antwort aus dem großen Zitatenschatz des deutschen Rekordnationalspielers aus – wahlweise auf Deutsch oder Englisch.
Nelson folgte dem Roboter durch den Flur in Levents Wohnreich. Dramatische Musik empfing ihn. Alle Rollläden waren heruntergelassen. Aus dem Dunkeln vernahm er Levents Stimme.
„Hi, setz dich. Getränke gibt’s später. Wir landen gleich. Mach’s dir bequem.“
Auf einem Barhocker in der Mitte des Raumes thronte ein Video-Beamer, dessen Linsen ein nächtliches Panorama an die Zimmerwände zauberten. An einer Wand entdeckte Nelson eine kleine blauweiße Murmel, die er als Fernprojektion der Erde identifizierte. Aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Raumfähre auf. Sie schwebte auf eine helle Fläche zu, die, da die Kapsel näher kam, zu einer kargen, zerklüfteten Landschaft heranwuchs. Bald nahm sie den ganzen Raum ein. Fasziniert beobachtete Nelson, wie sich die Raumfähre zeitlupenhaft senkte und in der Nähe eines Kraters landete. Er kannte die Aufnahmen. Aber dank Levents Anlage war er plötzlich mittendrin. Die Kapsel öffnete sich, und im selben Moment brach die Musik ab. Während einer der Astronauten die Leiter herabstieg und seine ersten Schritte in den butterweichen Mondstaub setzte, erklang eine verzerrte Stimme.
„That’s one small step for man, one giant leap for mankind.“
Im selben Moment klatschte jemand begeistert in die Hände. Als das Licht anging, traute Nelson seinen Augen nicht: Luk und Levent schwebten in einer Art Hängematte in der Mitte des Zimmers und strahlten ihn an.
„Irre, oder?“, rief Luk. „Fast wie echt.“
„Das war echt“, ließ sich Levent vernehmen, während seine Hängematte gemächlich herabschwebte. „Bis auf die Tatsache, dass wir in unserem improvisierten Raumschiff bedauerlicherweise nur Zuschauer waren.“
Als sie sich aus der Matte herausgeschält hatten, wischte sich Levent theatralisch über die Stirn.
„Ziemlich staubig auf dem Mond“, stöhnte er. „Da bekommt man richtig Durst. Loddar!“
Der Roboter mit der Nummer 10 auf dem Trikot wandte sich ihm zu.
„Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man draufdrückt“, krächzte er blechern.
„Ist ja gut, Loddar“, erwiderte Levent und grinste. „Drei Colas tun’s auch.“
„Sehr wohl, Herr“, antwortete der Roboter und schlurfte geräuschvoll zum Kühlschrank.
„Herr? Machst du jetzt einen auf Sklaventreiber?“, fragte Nelson.
„Ich habe Loddar nur ein wenig nachgerüstet“, erläuterte Levent. „Wenn du dich ihm vorstellst, merkt er sich jetzt automatisch dein Gesicht und spricht dich in Zukunft mit deinem Namen an.“
„Und dein Name ist Herr, alles klar!“
Loddar kam mit drei Flaschen Cola zurück und servierte sie den Freunden.
„Bravo!“, lobte ihn Levent und fischte ein Tuch aus seiner Hosentasche. „Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Mund auf!“
Der Roboter gehorchte, während Levent das Tuch auseinanderschlug. Zum Vorschein kam eine platt gedrückte Pampe.
„Leberknödel“, stöhnte Luk angewidert.
„Loddar steht drauf“, entgegnete Levent. „Erinnert ihn an seine bayrische Heimat.“ Er legte den Knödel in Loddars Mund und drückte den metallenen Kiefer nach oben. „Wie sagt man, Loddar?“
„Ein Wort gab das andere, wir hatten uns nichts zu sagen“, antwortete der Roboter. Daraufhin watschelte er zurück in seine Ecke, wo er regungslos verharrte.
„Wäre gern dabei gewesen“, bemerkte Levent wehmütig und deutete auf jene Stelle, wo vorhin die Mondfähre gelandet war. „Den Clip habe ich mir aus den Staaten besorgt. Das Original. Ohne irgendwelchen Schnickschnack.“
Er drückte auf eine Fernbedienung, und die Rollläden surrten leise nach oben. Gleichzeitig ging das Licht aus.
Eine Weile hockten die drei schweigend auf dem Sofa und schlürften ihre Colas.
„Judith ist auch wieder da, höre ich?“, warf Levent irgendwann ein.
Nelson tat unbeteiligt. „Sieht so aus“, antwortete er.
„Und warum hast du sie nicht gleich mitgebracht?“, hakte Levent nach.
Nelson sah ihn schräg von der Seite an. „Warum sollte ich?“
„Keine Ahnung“, antwortete Levent und hob die Brauen. „Weil ihr Freunde seid? Weil Judith immer dabei ist? Was soll die Frage?“
„Was heißt schon Freunde?“, murmelte Nelson.
Doch Levent beschloss, das Thema nicht weiter zu vertiefen.
4
D ie Nacht war kurz. Wie im Fieber wälzte sich Nelson von einer Seite auf die andere und versuchte vergeblich jenen Träumen zu entfliehen, die ihn bis zum frühen Morgen heimsuchten. Schwitzend schlug er um sich, stöhnte und keuchte, wachte zwischendurch für Sekunden auf, bis ihn die Wahnbilder wieder einholten und aufsogen.
Einmal schwebte er im All, um ihn herum nur schwarze Kälte, immerhin in der Gewissheit, an einem Versorgungsschlauch zu hängen, der ihn mit dem Raumschiff verband. Trotz seines Raumanzugs fror er. Schweiß, dachte er noch, vielleicht gefriert er in der Kälte, weil der Anzug nicht dicht ist. Er gab das vereinbarte Zeichen, um der Crew zu bedeuten, ihn zurück ins wohltemperierte Raumschiff zu ziehen. Doch zu seinem Entsetzen erschien am Eingang eine unbekannte schwarze Gestalt mit einem großen Messer in der Hand. Ein schneller Schnitt, und die Verbindung war gekappt. Hilflos mit den Armen rudernd, trudelte Nelson fort in die Tiefen des Weltalls, lautlose Schreie auf den Lippen, die nicht einmal sein eigenes Ohr erreichten.
Ein anderes Mal saß er mit seinen Eltern in einer Strandbar irgendwo in Florida. Es war brüllend heiß, die Luftfeuchtigkeit bewegte sich auf die 100 Prozent zu. Jedenfalls lief ihm der Schweiß in Bächen den Rücken hinunter. Seine Eltern dagegen schienen überhaupt nicht zu schwitzen. Völlig entspannt lästerten sie über diesen und jenen, wobei sie Nelson seltsamerweise wie Luft behandelten. Nur einmal wandte sich sein Vater ihm zu und deutete auf ein verliebtes Paar am Nebentisch, das sich innig küsste. „Ja, ja, die Jugend“, seufzte er lächelnd, „kennt nur sich selbst und den Augenblick.“ Als sich die Verliebten voneinander lösten und zwei Augen in Nelsons Richtung blickten, erstarrte er: Die junge Frau war niemand anderes als Judith, die ihm grinsend die Zunge herausstreckte.
Vielerlei Gestalten und Kreaturen bevölkerten die Schauplätze seiner Träume, wächsern bleiche Mönche und muskelbepackte Gladiatoren, wilde Löwen und blutrünstige Hyänen, Lehrer und Schüler, darunter die Norton-Zwillinge, Mahmut und Janeck, Gottfried, Stanislaus, Dr. Olbrich, Kim und Lea sowie unzählige andere, die er nicht kannte oder an die er sich nicht erinnerte und deren Gesichter genau in jenem Augenblick wieder verblassten, da er schweißgebadet hoch schrak.
Benommen versuchte er sich zu orientieren. Offenbar lag er in seinem Bett. War heute nicht Montag? Er erinnerte sich wieder. Sein erster Schultag in seinem zweiten Jahr im Internat. Auf dem Stundenplan standen Neugriechisch, Astrophysik und Philosophie. Nicht so schlecht. Am meisten freute er sich auf Astrophysik. Professor Winkeleisen hatte ihnen für dieses Jahr verschiedene Exkursionen in Aussicht gestellt. Nelson rechnete fest damit, dass er und seine Mitschüler mithilfe moderner Teleskope bald selbst einen Blick in die Tiefen des Weltraums werfen durften.
Im Zimmer war es merkwürdig still. Er drehte sich zur Seite und blickte auf seinen Radiowecker, dessen Ziffern hinter Tränen der Müdigkeit verschwammen. Als seine Linsen scharf stellten, erschrak er ein zweites Mal an diesem frühen Morgen. Zehn vor acht! Um acht begann der Unterricht!
Nelson hechtete aus dem Bett. Gottfrieds Decke lag auf dem Boden. Seine Schlafstatt war leer. Die Ursache der Stille
In weniger als fünf Minuten hatte er sich angezogen, gekämmt und die Zähne geputzt. Das Frühstück musste ausfallen. Er sprintete los. Am Anfang der Treppe traf er auf den fast blinden Joshua, der sich, an das Geländer geklammert, die Stufen hinunter tastete.
„Hallo, Nelson“, begrüßte er ihn, „hast du schon gehört?“
„Was meinst du?“