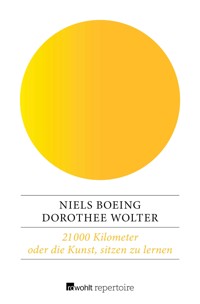
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von der Alster bis zum Tafelberg Die Devise lautete «Maximum Süd»: Warum nicht einmal von Hamburg über Land reisen, so weit es geht – bis nach Kapstadt? Niels Boeing und Dorothee Wolter sind losgefahren. 5 Monate, 18 Länder, 21 000 Kilometer in Zügen, Bussen, Lastern, Taxis und einmal sogar auf einer arabischen Dhau. Eine Begegnung mit einer Welt im Aufbruch. Ein atemberaubender Streifzug durch das Global Village.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Niels Boeing • Dorothee Wolter
21 000 Kilometer oder die Kunst, sitzen zu lernen
Eine Reise von Hamburg nach Kapstadt mit Bus, Bahn und Boot
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Von der Alster bis zum Tafelberg
Die Devise lautete «Maximum Süd»: Warum nicht einmal von Hamburg über Land reisen, so weit es geht – bis nach Kapstadt? Niels Boeing und Dorothee Wolter sind losgefahren. 5 Monate, 18 Länder, 21000 Kilometer in Zügen, Bussen, Lastern, Taxis und einmal sogar auf einer arabischen Dhau.
Eine Begegnung mit einer Welt im Aufbruch. Ein atemberaubender Streifzug durch das Global Village.
Über Niels Boeing • Dorothee Wolter
Niels Boeing, geboren 1967 in Bochum, studierte Physik und Philosophie und arbeitet heute als freier Journalist, u.a. für Die Zeit, Geo und Freitag.
Dorothee Wolter, geboren 1968 in Minden/Westfalen, arbeitete für Werbeagenturen und Filmproduktionen und ist heute TV-Producer.
Inhaltsübersicht
Prolog Was ist Reisen?
Es ist halb vier nachts im Bosporus-Express zwischen Bukarest und Istanbul, und an Schlaf ist nicht zu denken. Anderthalb Stunden haben wir Pässe vorgezeigt, sind vor Grenzschaltern angetreten, nur um im Zug erneut unsere Pässe zu zeigen, als wir gerade wegdämmerten. Aus dem Gang ertönt das nicht enden wollende Gespräch zweier nimmermüder Rumäninnen und befördert uns in diesen Zustand nervöser, kraftloser Schlaflosigkeit. Das Bett des Schlafwagens ist in Ordnung, der Rest eine Farce: die Abteile mit ihren blindgeschrubbten Fenstern und dem abgesprungenen Furnier an den Wänden sind nur Transportzellen, die Klos verdreckte Latrinen …
Das ist so ein Augenblick, in dem einem die Frage durch den Kopf schießt: Warum machen wir das eigentlich? Ist es die perverse Lust eines Wohlstandseuropäers an Komplikationen, Chaos und Schmuddel? «Back to the roots» kann man den Bosporus-Express nicht nennen. Jeder Anfang des Eisenbahnwesens war besser, und Schlafwagen in Indien sind ein Luxus gegen das, was die rumänische Eisenbahngesellschaft CFR heute Nacht zu bieten hat. Warum hat es uns in dieses Abteil verschlagen?
Wir sind im Laufe der Jahre oft unterwegs gewesen, sind wie viele andere auch hierhin und dorthin geflogen, um neue Weltgegenden kennenzulernen oder einfach nur auszuspannen. Sind irgendwo gelandet, haben uns in dem fremden Land Orte herausgepickt und dort umgesehen, versucht, uns der Kultur anzunähern, sie «mit allen Sinnen», wie es in Reiseführern immer heißt, aufzunehmen. Aber letztlich waren das nur Ausflüge aus dem Alltag, denen etwas fehlte: die Freiheit, immer weiterzufahren.
Denn das ist die Essenz des Reisens: das «Erfahren» der Welt im ursprünglichen Sinne dieses Wortes. Eine unaufhörliche Bewegung, die uns herausfordert. Die uns als Reisenden einen Rhythmus aufzwingt aus Bergen, Flüssen, Grenzen, politischen Komplikationen, schlechten Bahnverbindungen, Essen, Krankheiten … Wir wissen nicht, wo wir in einer Woche sein werden, immer weiter tasten wir uns vor, ohne uns zurückziehen zu können. Wir werden zur Schnecke, schutzlos, nur mit einer Tasche als Gehäuse, das wir überallhin mitschleppen, um nicht ganz nackt zu sein. Plötzlich gibt es nur zwei Hosen und ein paar T-Shirts, die für Monate genügen. Der ganze Kleiderschrank zu Hause ist nur ein Fundus, um von Zeit zu Zeit Rollen in der Gesellschaft spielen zu können. Auf solch einer Reise haben wir nur eine Rolle bis zum Ende des Stückes: einfach wir selbst zu sein, dabei wacher und gewitzter als sonst, weil nichts mehr vertraut ist. Ganz allmählich schärfen sich die Sinne, mehr als es auf einem schlichten Ausflug in die Ferne mit dem Rückflugticket im Gepäck je geschieht, geschweige denn im Alltag zu Hause.
Aber handelt es sich hierbei um einen Egotrip oder gar um eine Flucht? Und was ist mit den fremden Kulturen – geht es nicht vor allem darum, sie kennenzulernen? Diese Fragen haben uns manche Freunde gestellt, gerade jene, die selbst nie reisen. Sicher: Wer in die Ferne aufbricht, tut das immer zuerst aus seiner eigenen Neugier, wie intellektuell dieser Drang auch verbrämt sein mag. Am Anfang steht die Entscheidung des Reisenden, fortzugehen und Neues zu entdecken, nicht das Ziel. Wir reisen, weil wir Lust dazu haben, und nicht, weil wir eine «interkulturelle» Pflicht erfüllen wollen. Und dass man einer fremden Kultur überhaupt je gerecht werden kann, wenn man sie in kreisenden Bewegungen von einem Ort aus erkundet, an dem man ankommt – meistens der Hauptstadt –, daran glauben wir nicht. Manchmal verstehen wir selbst unsere eigene Kultur nicht, obwohl wir hier aufgewachsen sind.
Reisen im Sinne einer permanenten Bewegung ist etwas anderes als eine kulturelle Besichtigung oder ein Entspannungsurlaub: Es ist eine eigene Seinsweise, eine moderne Art des Nomadentums, die den beschränkten Horizont des Westlers aufreißt. Erst indem sich der Reisende durch viele Kulturen hindurchbewegt, hat er überhaupt eine Chance, das hyperkomplexe «Global Village» des 21. Jahrhunderts in seiner verwirrenden Vielfalt wahrzunehmen. Die künstliche Klarheit von «Nationalkulturen», die der Bildungsreisende meist zu erkunden versucht, erscheint dagegen immer mehr wie ein Relikt vergangener Zeiten.
Dieses Nomadentum wagen, in die Weite, ins Unbekannte aufbrechen, den Schuss Wahnsinn spüren – dieser Gedanke hat uns irgendwann gepackt. Und so sind wir einfach losgefahren ohne Flugtickets, Fahrpläne oder Hotelreservierungen, mit der Absicht, die Bilder, die uns Medien oder durchgestylte Reisekataloge aufdrücken, gegen unsere eigenen, unmittelbaren Einblicke in eine kaum fassbare Wirklichkeit einzutauschen.
Hamburg – Istanbul
km 0 Aufbruch
Freitagnachmittag am Bahnhof Hamburg-Dammtor. Noch 24 Minuten bis zu dem Augenblick, dem wir so lange entgegengefiebert haben. Immer mehr Freunde trudeln auf dem Bahnsteig ein. Ungläubiges Staunen, als sie unsere beiden Rucksäcke sehen: «Was, mehr nehmt ihr nicht mit? Und das reicht?» Na sicher. Inmitten des Lärms im Wochenendverkehr stehen wir lachend zusammen, trinken ein letztes Mal Astra, das der gute Leon mitgebracht hat, und lassen Studio One Ska auf dem kleinen Ghettoblaster laufen. Eine Flasche Saurer kreist, während die Leute um uns herum irritiert herüberschauen. Wir stoßen ein ums andere Mal an und klopfen dumme Sprüche: Chartert ein Flugzeug, einen Phiesta-Jet nach Sansibar, kommt vorbei. Ihr fehlt uns jetzt schon. Wir können es nicht glauben, dass wir sie alle erst in einem halben Jahr wiedersehen werden – wenn alles gutgeht.
Am Anfang war es nur eine verrückte Idee gewesen. Wie wäre es, von Hamburg die südlichste Metropole anzusteuern, die auf dem Landweg erreichbar ist? Das «Maximum Süd» war schnell gefunden: Kapstadt. Die neue Traumstadt der Neunziger, von der alle verklärt zurückkehrten. Wir hätten auch einfach hinfliegen können. Aber die Idee ließ uns nicht mehr los. Warum eigentlich nicht über Land und die ganze Strecke dazwischen erleben? Wir überlegten, ob wir mit einem eigenen Wagen runterfahren sollen, und sahen im Geiste schon Fetzen eines Roadmovies ablaufen. Aber da wir beide nichts von Autos verstehen, verwarfen wir die Idee wieder. Da wir auch nicht zu den verrückten Extremreisenden gehören, kamen Fahrrad, Motorrad oder gar Laufen ohnehin nicht in Frage. Warum sich also nicht einfach in den Zug setzen und losfahren? Und dann schauen, was kommt.
Noch drei Minuten, wir hören ein letztes Mal I want justice von Delroy Wilson, das wir zuletzt mit den anderen zusammen so gerne auf Partys mitgesungen haben. Dann rauscht der Zug rein, Schulterklopfen, Umarmungen, wir stecken schnell die Ska-CD ein, die nehmen wir doch mit, eine einzige CD, wer weiß, mit wem wir dabei Freundschaft schließen werden. «Wenn euch was passiert, komme ich, ehrlich», sagt der kleine Bruder, der in diesem Moment ganz groß ist. Wir steigen schnell ein, die ganze Bande auf dem Bahnsteig, rufen aus dem Waggon noch einmal: «No sleep – till Kapstadt!» Die Tür geht zu, der Zug setzt sich in Bewegung, Anja und Petra auch, sie laufen neben dem Fenster her. Wir sehen genau, dass Anja Erbsenaugen hat, aber wir erst mal! Dann fällt der Bahnhof zurück. Das Abenteuer kann beginnen.
Ganz mitgenommen von diesem rührenden Abschied setzen wir uns in dem proppenvollen Wochenend-ICE nach Berlin in den Speisewagen. Als wir auf unseren Aufbruch anstoßen, machen wir unsere erste Reisebekanntschaft. Angelika hat neben uns am Tisch Papiere studiert. Wo fahrt ihr hin?, fragt sie. Nach Kapstadt. Dann erklären wir ihr, dass wir nicht in Berlin ins Flugzeug steigen, sondern dass wir Tausende von Kilometern vor uns haben, und schon erzählen wir uns alte Reisegeschichten. So vergehen die ersten zwei Stunden wie im Fluge.
Berlin, unsere erste Station, meint es gut mit uns. Vom Zoo geht’s zum Senefelder Platz, und ein paar Minuten später stehen wir in Mr. Walters Wohnung, unserer ersten Reiseherberge. Ein Apartment mit sehr viel Platz, in dem ein plattes Zebra auf dem Boden liegt. So muss es sein, wir wollen ja schließlich nach Afrika. Das Wohnzimmer ist voll mit Hightech und Filmtrophäen, wie angenehm angesichts des überbordenden Retroquatsches im Kollwitz-Kiez, wo Mr. Walter unbedingt hinziehen musste.
Das Viertel wird immer absurder. Nicht nur Thermopen-Fenster und Yucca-Palmen in den Kneipen – eine regelrechte Verfrankfurtung des inneren Ostens –, nein, jetzt werden auch noch mutwillig die Goldenen Zwanziger herbeizitiert. Alles kommt so kulturell und gediegen rüber. Wohnen hier nur Geisteswissenschaftler? Auch die Kulturbrauerei, in der wir erst mal ins Kino gehen, um etwas runterzukommen von dem aufwühlenden Aufbruch, ist uns ziemlich suspekt. Nicht wiederzuerkennen nach all den Jahren: Ein übler Berliner Themenpark ist daraus geworden, voll amerikanisiert mit all den Neon-Schriftzügen über den Bareingängen. So steril.
Aber Gregor rettet den Prenzlauer Berg, als er uns spätabends ins Bassy auf der Schönhauser Allee führt. Drinnen tobt schon das Nachtleben. Wir nehmen die Seitentür gegenüber der Bar und landen in einem rohen engen Hinterhof mit Schornstein und Ziegelwänden. In der Mitte lodern Flammen aus einer Öltonne, am Ende ist ein Altar mit einem riesigen Saddam-Poster aufgebaut worden. Eine schöne Art und Weise, vermeintlichen Dämonen das irrational Böse zu nehmen. Man funktioniert sie einfach zum Witz um. Hier lebt noch der Spirit des Früh-Neunziger-Berlin – vom neuen Hauptstadt-Kult der Gegenwart ist nichts zu spüren. Ach, Berlin soll roh bleiben, wenn es schön sein will. Alles andere gerät nur zur Farce.
Floating downstream. Bevor es richtig losgeht, steht noch eine Reinigung der besonderen Art an. Vor Jahren habe ich von den Samadhi-Tanks gelesen, die John Lilly in den Fünfzigern für die US-Navy entwickelt hat. Das sind eine Art Meditationstanks, in denen 300 Kilo Salz in 600 Litern Wasser gelöst sind. Unmöglich, darin unterzugehen. Die Tankkapseln beinhalten sozusagen eine Miniatur des Toten Meeres. Die wollen wir im Floatcenter hinter dem Gendarmenmarkt ausprobieren.
Eine schwäbische Frohnatur par excellence bereitet uns dort auf das «Floaten» vor und bringt Dorothee und mich dann in unsere Räume. Wie ein kleiner Wal, lang und bucklig, sieht der Tank aus. Ich steige ein, lege mich ins Wasser und lasse den Deckel runtergleiten. Rotwarme Dunkelheit umfängt mich. Das Salzwasser hat Körpertemperatur. Kein Druck auf der Haut, nirgends. Fast Schwerelosigkeit. Durch die Ohren unter der Wasseroberfläche dringen ab und zu ferne, gedämpfte Geräusche.
Ich schwebe in meiner Kapsel wie in einer anderen Welt. Back to the roots, als ob ich noch einmal dicht an meine Zeit als Fötus herankomme. Körperloses Bewusstsein, die reine Existenz, vor meinen geschlossenen Augen tanzen Kaskaden aus Blautönen, breiten sich aus, ziehen sich wieder zusammen. Nur wenige konkrete Bilder. Totale Ruhe, absoluter Antistress, auch keine Langeweile. Das ist unser Re-Boot: dahintreiben, die Vergangenheit gut sein lassen und etwas Neues beginnen. So können wir aufbrechen.
Am nächsten Morgen nehmen wir den IC nach Krakau. Ab jetzt kommt das Unbekannte. Hinter der Grenze zu Polen ein kurzer Augenblick der Irritation: Der Schaffner fragt uns, ob wir eine Reservierung hätten. Gibt es ein Problem? Nein, der polnische Schaffner stellt uns kurzerhand eine aus: über null Zloty. Wir runzeln die Stirn, weil wir es für nutzlose Bürokratie halten. Von wegen: «Das ist wichtig, damit genug Tee oder Kaffee für alle Reisenden an Bord ist, den gibt es nämlich umsonst», klärt uns eine Polin in der Sitzreihe gegenüber auf. Und ihr Reisebegleiter fügt nicht ohne leisen Spott über die skeptischen Deutschen hinzu: «So sind die Polen.»
km 855 Der Schatten der Geschichte
Als wir abends in Krakau ankommen, steigen wir im Stadtteil Kazimierz ab. Auf unserem Zimmer werfen wir kurz den Fernseher an und landen bei Baywatch. Oder ist das eine Doku? Ständig redet eine polnische Stimme, während im Hintergrund der Film mit gedämpften Dialogen abläuft. Nach ein paar Minuten begreifen wir: In Polen werden ausländische Serien im Fernsehen offenbar nicht synchronisiert, noch nicht einmal untertitelt, sondern übersprochen. Ein monoton sprechender Mann leiert aus dem Off die Übersetzung herunter, ganz egal, ob gerade ein Mann oder eine Frau spricht. Pamela Anderson ist hier also ein gelangweilter Pole. Drei Minuten ist das zum Lachen, danach eher zum Weinen.
Im Café Mlynek am Plac Wolnica, über dem wir wohnen, hängen neue Bilder zum Verkauf. In ihrer Rohheit erinnern sie ein bisschen an die vom Artstore St. Pauli. Auch sonst erscheint Kazimierz irgendwie vertraut. Rund um den Plac Nowy reihen sich die neuen Bars und Cafés aneinander. Aber die Szenerie ist nicht für Touristen hergerichtet. Hier trinkt das neue Krakau, abseits der hochgelobten Altstadt.
Die ist uns am nächsten Tag zu hübsch, zu puppenstubenhaft. Dass Krakau «das München Polens» sei, wie uns jemand vorher gesagt hatte, kann man durchaus so sehen. Ein Kompliment ist es nicht gerade. Es scheint, als sei die Stadt, die einmal die Hauptstadt Polens war, von einem Jahrhunderte währenden Schlaf am Rande von Habsburger Monarchie und Realsozialismus erwacht und putze sich nun heraus. Als wir aus der Altstadt kommend die Dietl-Allee in Richtung Kazimierz überqueren, wird es gleich grauer und großstädtischer. Straßen voller Altbauten, die eher an Berlin-Friedrichshain oder Lichtenberg erinnern. Dann stehen wir vor dem alten jüdischen Friedhof am Platz der Szeroka-Straße. Wir gehen in die Synagoge, die daneben steht.
Ein altes Paar beaufsichtigt streng die ankommenden Touristen. Wir fühlen uns plötzlich nicht wohl in unserer Haut. Der Schatten der Geschichte liegt über diesem Ort, und er wiegt schwer. 65000 Juden haben bis zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust in Kazimierz gelebt. Die Gassen und Fassaden erinnern an die Zimtläden, jenes Theaterstück, das Anfang der Neunziger in Berlin gespielt wurde, in dem die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden in einem melancholischen Gespensterreigen noch einmal lebendig wurde. Außer ein paar Schildern und Zeichen an den Hauswänden ist nichts davon in Kazimierz übriggeblieben.
In einem dieser Versuche, an die alte Zeit anzuknüpfen, im Restaurant Alef, gehen wir abends essen. Am Nachbartisch sitzen vier Alte, drei Männer und eine Frau. Sie sprechen Hebräisch, dessen Klang man in den Backpackern vieler Länder schnell kennenlernt, weil junge Israelis nach ihrem harten Wehrdienst in die Welt ausschwärmen, um etwas anderes zu erleben als den Nahostkonflikt. Was der Weißhaarige wohl 1943/44 erlebt hat? Die Frau mustert uns zwischendurch mit einem Blick, der sich nicht deuten lässt. Es ist ja nicht zu überhören, woher wir kommen. Die Geschichte holt einen immer wieder ein. Am nächsten Tag wird sie uns wie ein nasses, schweres Handtuch ins Gesicht schlagen.
Es ist ein strahlender, wolkenloser Herbsttag, als wir morgens im Bus durch die dörfliche Idylle außerhalb Krakaus schunkeln. Bettwäsche lüftet an Balkongittern, der Futtermais ist noch auf den Feldern, hier ein Zementwerk, da ein Autofriedhof. Eine Gegend, die es so ähnlich auch bei uns gibt. Alles ganz friedlich, polnischer Alltag, bis wir zwei Stunden später am Ziel sind – in Auschwitz. Oh, mag manch einer denken, sie machen eine Betroffenheitstour. Vom Völkermord der Nazis über die Apartheid in Afrika bis zu den bösen Buren am Kap. Nein, darum geht es nicht. Dort, wo uns die Geschichte eines Landes, die auch unsere eigene ist, anspringt, können wir unmöglich wegsehen.
Dann stehen wir in der einstigen Todesfabrik, die heute ein Museum ist. Unzählige Reisegruppen schieben sich durch die früheren KZ-Wege. Japaner schießen entspannt das obligatorische Urlaubsbeweisfoto vor dem Tor, über dem der Spruch «Arbeit macht frei» prangt. Polnische Schulklassen reißen draußen auf eine Zigarettenlänge Witze. Das Grauen scheint an diesem Tag mit seinem strahlend blauen Himmel nicht einmal als Schatten auf den Gebäuden zu liegen. Die Monstrosität des Verbrechens ist kaum begreifbar. Nur in den Baracken, in denen Berge von Schuhen, Koffern oder Haaren der Ermordeten für die Nachwelt aufbewahrt sind, wird es in Ansätzen sichtbar.
Aber es verschlägt uns dennoch die Sprache. Gerade, weil wir aus Deutschland kommen. Schweigend ist der Ort erträglich, alle vernehmlichen deutschen Worte kommen uns schlagartig unglaublich deplatziert vor. Sie sind hier oft genug gefallen. In bürokratischer Kälte starren sie uns aus den zahlreichen SS-Schriftstücken an, die in den Vitrinen ausgestellt sind. Dass die Handlanger des Terrors keinen klaren Kopf gehabt hätten bei dem, was sie taten, lässt sich beim besten Willen nicht sagen. Da wurde «mitgedacht», was das Zeug hält. Einer ereiferte sich etwa, ob man nicht das von den Toten geraubte Zahngold, das die Wehrmachtsärzte nicht brauchten, gegen eine «Quittung» der Reichsbank zuführen solle, wo es «sinnvoller» angelegt sei. Akribisch angelegte Listen von Häftlingen, trockene Paragraphenhuberei, Totenscheine voller Lügen. Sicher, wir haben vorher darüber gelesen, haben wie viele andere irgendwann auch Schindlers Liste gesehen. Aber dies ist der Ort des Verbrechens selbst, nicht mehr von Buchseiten oder Kinoleinwänden auf Distanz gehalten. Hier ist Auschwitz, das schwarze Loch der deutschen und auch der europäischen Geschichte.
Drei Kilometer weiter in Auschwitz-Birkenau, dem zweiten, später angelegten Teil des KZ, weitet sich das ohnehin schon Unfassbare noch einmal in seinen Dimensionen. Eine regelrechte Stadt des Todes öffnet sich kilometerweit hinter jenem Tor, das wir so oft auf alten Aufnahmen gesehen haben. Von vielen Baracken sind nur noch Betonpfeiler übrig, ragen zahllos aus dem Gras, das heute alles überwuchert. Aber die Nachmittagssonne lässt kein Kopfkino zu, unvorstellbar, wie hier 90000 Menschen eingepfercht in der Maschinerie der Vernichtung gelebt haben können.
Erst bei der Lektüre von Anna Pawelczynskas Buch Werte gegen Gewalt, das wir uns im Buchladen der Gedenkstätte kaufen, steigen erste Bilder hoch. Gerade die Nüchternheit ihrer Analyse, in der sie sich – bewusst, wie sie schreibt – ihrer eigenen Auschwitz-Erlebnisse enthält, überwältigt, mehr noch, beunruhigt. Orwells 1984 ist blass im Vergleich zu ihrer Beschreibung des KZ-Systems. Carl Amery hat in seinem bemerkenswerten Buch Hitler als Vorläufer die These aufgestellt, dass das eindimensionale Terror-Weltbild des Nationalsozialismus möglicherweise nur ein erster Testlauf für biopolitische Apokalypsen des 21. Jahrhunderts war, die durch globale Umweltzerstörung, Überbevölkerung und politische Konflikte ausgelöst werden könnten. Es sind Kleinigkeiten wie jene Porzellanisolatoren an den einst unter Starkstrom stehenden Stacheldrahtzäunen oder die schlichten Betonpfeiler, die zeigen, dass es sich hierbei nicht um Relikte einer fernen Epoche handelt, sondern um das technisierte 20. Jahrhundert. Die Vergangenheit ist noch nicht weit entfernt. Man vergisst das heute leicht.
Das Ausmaß des Vernichtungslagers mahnt aber auch: Guantánamo oder der neue Wall am Westjordanland haben nichts mit Auschwitz zu tun. Die Relation der Gräuel verrutscht vielen heutzutage zu leichtfertig im Ereifern über die Weltpolitik. Ein Bild hat sich an diesem Nachmittag eingebrannt, das ein wenig Erleichterung verschafft: Es ist die wehende blau-weiße Flagge mit dem Davidstern, die zwei israelische Schulklassen über ihren Köpfen halten, während sie durch die KZ-Ruinen gehen. Sie sind eine Bestätigung Gandhis, der einmal schrieb: «Es ist meine feste Überzeugung, dass nichts Dauerhaftes auf Gewalt aufgebaut werden kann.»
Auch in «Oświeçim», wie Auschwitz eigentlich heißt, haben die Menschen sich gesagt: Das Leben geht weiter, egal, wie. Manche haben ihre Häuser direkt neben dem früheren KZ-Gelände gebaut, und die Vorgärten liegen Naht an Naht mit dem Stacheldrahtzaun. Zugegebenermaßen nicht gerade der schönste Ausblick vom Balkon. Der Bahnhofsplatz ist im Licht der einbrechenden Dämmerung so trist wie überall in Europa, Passanten eilen vorbei, Autos fahren vor – in diesem Augenblick eine geradezu tröstliche Normalität. In einer leeren Kneipe mit gardinenverhangenen Fenstern trinken wir noch ein Bier und warten auf den Bus, der uns zurück nach Krakau bringt.
km 1275 Der Osten rockt
Bratislava ist nicht gerade eine Stadt, die Schlagzeilen macht. Die meisten wissen vermutlich nicht mal, wo es liegt. Klingt ziemlich nach Osten, dabei sind es nur 40 Kilometer von Wien die Donau stromabwärts bis zur Hauptstadt der Slowakei. Wir staunen nicht schlecht, als der Kellner in Hemd und Weste in einer schlichten Gaststätte in einem unnachahmlichen Tonfall die Bestellung entgegennimmt: «Ist recht, für die Dame ein Viertel, für den Herrn ein Helles», sagt er auf Deutsch. Die aufgehübschte Altstadt ist hier glücklicherweise nicht zur Puppenstube entstellt worden. Die Haupteinkaufsstraße kommt unspektakulär daher, die alten Straßenbahnen rumpeln immer noch durch graue Straßen. Aber abends im Pub merken wir, da will jemand den langen Schatten von Prag, der verklärten Überstadt der einstigen Tschechoslowakei, loswerden. Keine Ahnung, ob die Slowakei dafür unabhängig und Bratislava selbst eine Hauptstadt werden musste.
Dunkles Holz bestimmt die Atmosphäre. Vinyl hängt an den Wänden. Wer was auf sich hält, trägt Pferdeschwanz. Trendglatzen gibt es hier nicht. Auf der Bühne spielt eine Live-Band mit zwei E-Gitarren und einer E-Bratsche die üblichen Schmonzetten von Robbie Williams bis Guns ’n’ Roses. Die drei Jungs haben natürlich auch einen Pferdeschwanz. Knutschende Pärchen, kichernde Bedienung. Weinselige Stimmung. Wir sind mittendrin, lassen uns treiben. Keine Verpflichtungen, nur noch stoffwechseln. Die Musik wird ruppiger. Eine aggressive Version von «Mrs. Robinson». Dann ein lokales Stück. Slowakische Heldengesänge zu rollenden Gitarren, die E-Bratsche zuckt im Stakkato, die Rohirrim aus dem Herrn der Ringe scheinen auszureiten. B wie Bratislava – das muss man sich merken.
Als wir zwei Tage später aus dem Bahnhof in Budapest treten, fallen uns sofort zwei Dinge auf: Die Trendglatzen, die in Bratislava fehlten, sind wieder da, und die mächtigen, geradezu imperialen Altbauten lassen Bratislava provinziell erscheinen. Doch erst einmal müssen wir die Frage klären: Wo können wir übernachten? Wir schauen in eine Herberge in Bahnhofsnähe, die Zimmer mit Etagenbetten und Ikea-Möbeln von vor zwanzig Jahren zu bieten hat. Besser wieder zurück zum Bahnhofsplatz, wo Budapester die Reisenden in ihre Privatzimmer locken wollen. Dort treffen wir auf Piroska Balint, eine sympathische junge Frau in einer weißen Daunenjacke, die noch ein erschwingliches Zimmer zu vergeben hat. Wir fackeln nicht lange und steigen mit ihr in die überfüllte Straßenbahn. Wenige Stationen später sind wir am Ziel: Es ist ihre eigene Wohnung, die in einem Eckhaus in der Rakoczi Ut liegt. Sie hat sie kürzlich für sich und ihren Sohn gekauft. Die große Altbauwohnung ist zwar schon fertig gestrichen, aber noch ganz leer. Wir bekommen das künftige Schlafzimmer mit roten Wänden und Balkon zur Straße hin. Ein paar Meter weiter in derselben Straße betreibt sie noch ein richtiges Guesthouse. Dass das Geschäft mit Privatzimmern so gut läuft, liege daran, dass es noch immer nicht genug Backpacker in Budapest gebe. Wir rauchen eine Zigarette mit ihr, quatschen über das Leben und fühlen uns richtig willkommen in Budapest.
Maniküre einer Stadt. Wie kann ein einzelner Kopf bloß so schwer sein? Mindestens eine gefühlte Kiste Bier trage ich auf meinen Schultern mit mir rum. Seit Tagen nun schon diese blöde Erkältung, genau genommen seit Berlin. Wie ärgerlich. Alles wie in Watte. Trotzdem fällt mir auf, wie sehr sich die Stadt seit meinem letzten Besuch vor acht Jahren gewandelt hat. Keine fliegenden Händler mehr auf den Brücken. Vermutlich sind einige von ihnen in die schicken Läden auf der am Fluss liegenden Seite von Pest gezogen. Eine typische Einkaufsmeile, wie man sie in vielen Großstädten findet. Geschniegelt und geleckt. Die Stadt macht sich den Dreck unter den Nägeln weg.
Wie schade, gerade das Unperfekte gab ihr diesen gewissen Charme. Das Paris des Ostens macht sich heute stadtfein. Man will sich sehen lassen können. Die Frauen mittleren Alters putzen sich raus. Wohlstand rund um die Hüften, von den Schultern bis zum Steißbein. Auf dem Kopf tragen sie eine Frisur à la Rosi Mittermaier, die gesamte Farbpalette, aufgeklebte Fingernägel, Puh-Parfum und natürlich ein Handy am Ohr. Die Innenstadt gibt Vollgas.
Buda und Pest, die zwei Stadtteile, könnten kaum unterschiedlicher sein. Das museale Buda mit Burg und Kathedrale wirkt eher leblos, als wir auch noch ausgerechnet an einem Feiertag hinkommen. Hinter dem Hügel, wo der bronzene Gellert sein Kreuz gen Himmel reckt, tut sich herzlich wenig. Wohnstraßen und heruntergekommene Plattenbauten. Auch die Haupteinkaufsstraße wirkt irgendwie tot. Hier wird nicht gelebt, nur gewohnt. Zumindest heute.
Ganz anders dagegen das quirlige Pest. Rund um den Calvin-Platz tummelt sich die Jugend in den Kneipen und Cafés. Nach achtstündigem Dauerlauf lassen wir uns bei einem Thai nieder. Heute haben wir keine Lust auf Deftiges. Ich freue mich riesig auf meine Kokossuppe, als ich eine Schale Eintopf hingestellt bekomme. Muss wohl ein Irrtum sein, sage ich dem Kellner. Aber nichts da. «It’s not like in Thailand here, different», klärt er mich auf. Klar, so stand es ja auch auf der Karte: «Thai-Cocos Soup». Was hatte ich auch erwartet, same same but different eben. Also dann doch wieder herzhaft. Na, egal. Neben uns nehmen drei Puh-Rosis Platz. Omi, Mutter und wohlgenährte Tochter. Die beiden Frauen diesmal blondbehauptet, die Tochter ist noch nicht alt genug fürs Färben. Ganz Europa diskutiert sich wund über das Nichtrauchen, aber während am Nebentisch die neuesten Düfte sitzen, kommt mir in den Sinn, die Restaurants anders zu unterteilen. Denn wem schmeckt schon ein Rind oder Huhn an Calvin Klein? Mir juckt’s schon wieder im Gehirn, wo ist eigentlich mein Taschentuch?
Am Ende der Raday Utca, der Kneipenstraße am Südende des Zentrums, wird es weniger bunt und schlichter. Dort liegt in einer Seitenstraße das Trafo, ein ehemaliges Kino. Hier kommen offensichtlich die Nachtschwärmer zusammen, die mit gestylten Bars, Pubs und Bumsdiscos nichts am Hut haben. Die Zahl der Turnschuhe, knappen T-Shirts und verwaschenen Jeans nimmt schlagartig zu. Es ist fast wie zu Hause in St. Pauli. Unten im Keller ist ein Club mit Sofas.
In einem weißgekalkten Raum daneben werden künstlerische Versuche ausgestellt, Geldscheine in einen «anderen Zustand zu transformieren». Kurz, sie werden zerstört: mit Schwefelsäure, Edding-Bemalung, Speicheleinwirkung durch 10-minütiges Kauen, Haushaltsbleichmittel oder eine Maus, die an den Scheinen knabbert. Anschließend werden sie in Petrischalen dem Publikum dargeboten. Eine großartige Idee.
Der Haupt-Act des Abends findet aber oben im alten Kinosaal statt: Sex Mob aus New York werden von einem buntgemischten Publikum erwartet, dass zuvor höflich eine ungarische Free-Jazz-Combo hat über sich ergehen lassen. Sex Mob sind anders: nicht einfach ein Jazz-Quartett, sondern eine richtige Band! Besetzung: Posaune, Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug. Das Charisma von Posaunist Stephen Bernstein erfüllt sofort die Bühne. Ein kurzer, energetischer New Yorker, der beim Gehen über den Boden federt. Haare kurzgeschoren im Albert-Camus-Look. Ein breites Grinsen dazu, und dann brennen er und seine Kumpane ein Feuerwerk ab. Jazz auf der Höhe der Zeit. Keine Standards aus der großen Vergangenheit, stilsicher, aber kraftlos wiedergegeben, auch kein akademisches Free-Jazz-Gefrickel. Nein, präzise und reduziert entfachen sie einen richtigen Groove. Der füllige Bassist gibt einfache Loops vor, die eher an Hiphop-Samples erinnern. Wie ein Fels in der Brandung – so muss ein Bassist sein – hält er Kurs, während der Drummer einsteigt. Nun Bernsteins kurze Posaune, sehr akzentuiert. Das Saxophon antwortet, und zwischen beiden entwickelt sich ein musikalisches Gespräch. Dann ein heftiger Ausbruch, eingeleitet von der unglaublichen Kreativität des Schlagzeugers. Der Typ sieht aus wie Woody Allen in jung und hager, aber er lacht öfter. Und die Band geht ab. Wahnsinn.
Der Klassiker St. Louis Blues wird ebenso verwandelt wie Goldfinger aus dem alten Bond-Film oder Nirvanas Smells like teen spirit. Das Publikum tobt, als sie schließlich abtreten. Für die Zugabe bittet Bernstein den DJ an den Plattenteller, der vorher die etwas unglücklich agierenden Free-Jazzer begleitet hatte. Der Mann hat Nerven: legt Hand ans Vinyl und bringt die Jazzer von Sex Mob zum Staunen. Die steigen auf den Beat ein, und würden wir nicht alle auf unseren Konzertstühlen hocken (es ist ja ein Jazz-Konzert – Vorsicht, Kultur), hätten wir sofort losgerockt. Bernstein dirigiert – wie sein großer Namensvetter – und treibt die Band zu Höchstleistungen. Der Woody-Allen-Drummer spielt gar auf seinem Hocker, um dem Schlagzeug-Set neue Töne zu entlocken.
Dazwischen findet Bernstein Zeit für einen Schnack. Im berühmten Gellert-Bad habe er vor zehn Jahren eine Massage bekommen, die «almost homo-erotic» war. Als er wieder im Hotel ankam und sich dort einen Porno ansah, habe dieser im Gellert-Bad im Massageraum gespielt. So hat jeder seinen Budapest-Flash, und das Publikum schreit vor Begeisterung. Sanft und weich wie eine Gellert-Massage geht es ins letzte Stück, fast homoerotisch eben. Dann ist der Sex Mob von der Bühne. Der Jazz ist doch noch nicht verloren.
Die Stadt badet. Das soll ein Badehaus sein? Das Széchenyi Fürdõ im Stadtpark am Ende des Andrássy-Boulevards erinnert eher an ein barockes Stadtschloss. Es ist einfach riesig. Nur mit einer Badehose in der Jackentasche, ohne Handtuch, betrete ich diesen Palast der Sauberkeit. Leider alleine, denn Dorothee kann wegen ihrer Erkältung nicht mit. Ein Bademeister empfängt mich, teilt mir eine der alten Kabinen zu. Als ich in Badehose heraustrete, schließt er hinter mir ab. Welch ein Luxus verglichen mit den Metallspinden in unseren Stadtschwimmbädern.
Vorsichtig betrete ich den ersten Baderaum. Schwefel liegt in der Luft, eine Note von Kakao mischt sich in den Geruch. Die hohe Kuppeldecke ist von einer Patina aus Jahrzehnten überzogen. In den Becken trübes grünes Wasser. Es ist 38 Grad warm wie in einer Winterbadewanne. Nach ein paar Minuten wechsle ich ins Dampfbad. Die Sicht reicht einen Meter weit, der Atem stockt augenblicklich in der brüllend heißen Schwüle. Zwanzig Menschen stehen in dieser feuchtwarmen Hölle herum. Nach vier Minuten muss ich passen, meine Lungen scheinen zu kochen. Ich verlasse das Dampfbad durch eine andere Tür und lande in einer langen Halle mit einem ovalen Pool zum Abkühlen. Die Badenden lassen sich im künstlichen Wirbel herumtrei ben. Wieder heraus, in den nächsten Saal mit einem achteckigen Becken. Es ist ein Labyrinth, durch das sich Unmengen von Badenden bewegen, dicke, dünne, Kinder, Greise, hübsche, hässliche, tätowierte, turtelnde, mit verwachsenen Zehen, mit schönen Füßen, Europäer, Asiaten. Ein babylonisches Sprachengewirr verhallt im Schwefeldunst.
Im weitläufigen Innenhof warten noch größere Becken unter freiem Himmel. Am Rand spielen alte Männer, im warmen Wasser stehend, Schach. Die Schachbretter sind dicke Plastikfolien mit Quadraten, die sie auf ein Mäuerchen gelegt haben. Eine Gruppe schaut zu, alle brüten über dem nächsten Zug und schweigen. Ich lasse mich einen Moment durch die Wärme treiben, dann erkunde ich den anderen Flügel dieses Palastes, vorbei an weiteren Pools, Saunen, Massageräumen und Dampfbädern.
Es ist ein kunstvoller Mikrokosmos der Sauberkeit – den Budapest den Türken verdankt, die hier im 16. und 17. Jahrhundert das Sagen hatten. Währenddessen puderte sich der debile europäische Adel und litt an Krätze. Vielleicht sollte man Stoiber, Koch und Konsorten mal einen Besuch im Széchenyi Fürdõ empfehlen, um im Schwefelbad über das Wesen Europas nachzudenken, das den Türken angeblich so vollständig abgeht.
Sonntagmorgen in Budapest. Das alte Wohnhaus in der Rakoczi Ut 27, in dem wir abgestiegen sind, dreht sich noch einmal auf die Seite. Auf einem Treppenabsatz führt eine Tür auf einen Balkon zum Hinterhof. Noch ist er grün zugewachsen. Die Luft ist feucht und frisch, der Himmel leider immer noch bedeckt. Aus irgendeiner Wohnung plärrt Abbas Honey, honey herüber. Im Café Randevu, ein paar Meter vom Hauseingang entfernt, ist noch nichts los. Erst heult George Michael, dann läuft türkischer Pop und Murder on the dancefloor. Der Cappuccino ist der Bedienung beim Mitwippen des Beats zu dünn geraten. Aber er ist unverzichtbar wie an jedem Morgen.
Draußen auf der Straße stehen Pfützen eines nächtlichen Regengusses auf dem breiten Bürgersteig, der ebenso wie die sechs Spuren der Rakoczi Ut asphaltiert ist. Das gibt ihm etwas Schmuddeliges. Man möchte nicht darauf flanieren. Die Menschen eilen vorbei: eine rothaarige 15-Jährige mit langem, schwarzem Ledermantel und Doc Martens, in der Hand eine Plastiktüte; ein grauhaariger Mittfünfziger, lang, mit Schnurrbart, Brille und hellem Trenchcoat, Typ Arzt; ein Alter mit wollener Schirmmütze und abgetragenem Anzug, auf dem Rücken ein Rucksack, in der Hand eine Art Fototasche, an denen er schwer zu schleppen scheint, die Augen sind halb geschlossen beim Humpeln; ein Ehepaar mit frischgekauften Blumen, sie schaut nochmal auf die Uhr, man ist verabredet; ein Mittvierziger, der kraftvoll, aber gelassen ausschreitet, braune Lederjacke, braune Cordhose, der kurze Bart gepflegt; ein junges Pärchen mit nicht ganz trendigen Klamotten, er schaut angestrengt, sie hält seine Hand und redet, leicht lächelnd; ein alter Herr, jawohl ein Herr, denn er trägt noch einen Ausgehhut und hat den Trenchcoat gegürtet, tappt vornübergebeugt mit unsicheren Schritten, in der rechten Hand scheint er ein Päckchen Graupen zu halten; noch einmal werden Blumen in Papier vorbeigetragen.
Wie sieht es auf der anderen Straßenseite aus? Im Erdgeschoss der vergilbten, mächtigen Altbauten befindet sich eine Ladenzeile. Die durchgezogene Fensterfront erinnert noch ein wenig an vergangene Tage im Sozialismus: Die Auslage ist nicht eben gekonnt drapiert. Um den Sozialismus abzuschütteln, hat man zu knalligen Folien gegriffen und Discount-Slogans auf die Fenster geklebt. Im Csibefarm lacht uns gar eine riesige Henne vom Schaufenster an, deren Stil zwischen Brösels Werner und den Roadrunners von Schweinchen Dick liegt. Schreiend gelb und groß. Ein Laden mit Taschen – drüber steht «fürdöszoba felszereles», oha, die ungarische Sprache! –, daneben einer mit Uhren, ein weiterer mit komischen Klamotten … Eine seltsame Hauptstraße ist diese Rakoczi Ut, zwischen Zentrum und Hauptbahnhof.
Der blaue Kuli und die Fritten. Budapest entlässt uns an einem grauen, feuchten Herbsttag. Auf Gleis sieben des Hauptbahnhofs fährt der IC nach Bukarest ab: rumänische Waggons, braun und angeschmuddelt. Während wir über plattes Land durch den Morgennebel fahren, gibt mein schwarzer Kuli beim Schreiben seinen Dienst auf. Da ich die Marotte habe, nur in Schwarz in mein Tagebuch zu schreiben, versuche ich, im Zug einen schwarzen Kuli aufzutreiben und ihn gegen einen der leuchtend blauen Gauloise-Werbekulis einzutauschen, die uns ein Freund zum Bestechen äthiopischer Grenzbeamter mitgegeben hat. Der bebrillte Kellner im Speisewagen könnte einen haben, denke ich. Ich stehe schließlich vor ihm und erkläre ihm mein Problem auf Englisch. Er scheint kein Wort zu verstehen, nimmt meinen Gauloise-Kuli, kritzelt auf seine Hand – und siehe da, die Tinte ist schwarz. Wie peinlich. Ich nehme ungläubig den Kuli und kritzele nun in meine Handfläche. Kein Zweifel – das Teil schreibt schwarz. Ich bin nicht eine Sekunde auf die Idee gekommen, dass ein Kuli mit leuchtend blauem Gehäuse anders als blau schreiben könnte. Der Speisewagenmann sieht mich mit einem Blick an, als ob er mich für irre hält. Er schleudert mir noch ein ungarisches Wort entgegen, und ich trete schnell den Rückzug an.
An der rumänischen Grenze ist erst einmal Stillstand angesagt. Es ist offensichtlich, dass die EU hier endet: Ein Heer von Grenzbeamten und Bahnpersonal entert den Zug. Der Grenzbeamte macht den ersten Stempel dieser Reise in unseren Pass, der Zöllner fragt uns nach mitgeführten Pistolen, Geschenken und Lei, also dem rumänischen Geld. Die Schaffnerin redet rumänisch auf mich ein, auch dann noch, als ich auf Englisch bekunde, nichts zu verstehen. Dann das Wunder: Hinter der Stadt Arad öffnet sich zum ersten Mal nach 1700 Bahnkilometern eine liebliche Landschaft, die von saftig grünen Hügelketten durchzogen ist. Der Herbst hat noch nicht begonnen, die Luft, die durchs offene Fenster hereinströmt, ist warm.





























