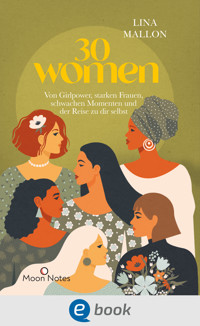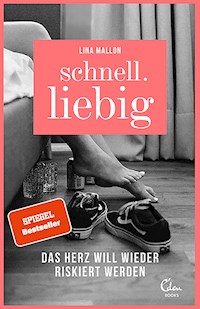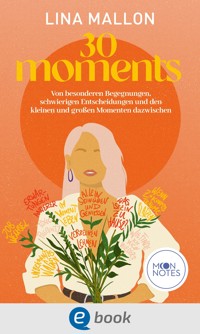
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Vom Lieben, vom Scheitern und vom echten Leben: Influencerin Lina Mallon hautnah. Welche Entscheidungen sind richtungsweisend für unser Leben? Welche Begegnungen ändern unsere Art zu denken? Und was lässt uns eigentlich zu dem Menschen werden, der wir sind? All diesen Fragen geht Lina Mallon auf den Grund und gewährt uns dabei tiefe Einblicke in ihr Innerstes. Ihre Fortsetzung von "30 Women", dem Buch über ihre Freundinnen und die Frauen, die ihr Leben geprägt haben, erzählt von der Liebe, von Fehlschlägen, von den vielen kleinen und den so besonderen, großen Momenten, die eine Reise zu sich selbst bereithalten kann. Erlebe Lina Mallon, die erfolgreiche Influencerin aus nächster Nähe und lerne eine sehr persönliche und intime Seite von ihr kennen. "30 Moments" haben Content Creator und Freigeist Lina Mallon zu dem gemacht, was sie heute ist: erfolgreich und glücklich. - Fotografin, Lifestyle Bloggerin und Influencerin Lina Mallon schreibt offen über die wichtigste Beziehung, die jeder Mensch in seinem Leben führt, die zu sich selbst. - Wie kannst du zu dem Menschen werden, der du sein möchtest? Die junge Autorin versteht es, die Themen Selbstfindung und Achtsamkeit mit echtem Leben zu füllen. - Empowernde Fortsetzung von "30 Women", die jede und jeden auf der Reise zu sich selbst mit klugen Fragen und sehr persönlichen Antworten begleitet. - Lass dich von einer starken Frau der Gen Y inspirieren, deinen eigenen Weg zu finden. Zigtausende Follower*innen auf Insta tun es bereits.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
»Die Beziehung zu uns selbst ist vielleicht die wichtigste von allen.«
WAS UNS AUSMACHT
Welche Entscheidungen sind richtungsweisend für unser Leben? Welche Begegnungen ändern unsere Art zu denken? Und was lässt uns zu dem Menschen werden, der wir sind? All diesen Fragen geht Lina Mallon auf den Grund und erzählt vom Lieben, vom Scheitern, von den kleinen und großen Momenten, die die Reise zu ihr selbst bereithielt – ganz persönlich und intim. Und immer grundehrlich.
Intro
Es gibt nichts zu tun, außer zu springen.
Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, es gibt nicht diesen einen Augenblick, in dem sich alles fügt, es gibt nicht diesen einen Menschen, auf den wir einfach nur warten müssen, der uns dann an die Hand nimmt und endlich ins Glück zieht. Es gibt keinen Trailer, keinen Testlauf – das hier ist unser Leben. Es will nicht vorsichtig abgetastet, sondern ausgekostet, ausgemalt, umarmt und immer wieder geändert werden.
In meinem letzten Buch schrieb ich von 30 Frauen. Von Begegnungen, die mich inspiriert und begleitet haben, die ein Zeichen für mich oder in mir setzten. In diesem Buch vertiefe ich mich in die Eine, die ich immer mitnehme, ganz egal, wohin es mich zieht. Ich erzähle von 30 Momenten, in denen ich sie besser kennenlernte, sie mal euphorisch, mal trotzig, mal verletzlich erlebte, ihr dabei zusah, wie sie sich verlor, mich manchmal sogar vor ihr erschreckte und dann doch immer wieder mit ihr versöhnte.
Es gibt in unserem Leben diese eine sich immer wieder verändernde Reise, die nie zu Ende geht – die zu uns selbst.
Ich hoffe, wir alle finden den Mut, sie zu genießen. Erlauben uns selbst, so kühn und ehrlich zu existieren, wie wir nur können. Nicht auf alle Fragen gibt es eine Antwort, nicht jedes Ziel braucht einen Plan, und nicht jeder Plan wird aufgehen. Nicht jeder Moment wächst zu einer Erinnerung, die wenigsten müssen gejagt oder gesucht werden. Die Kunst vom Glück liegt nicht darin, für den einen Moment zu leben – sondern mit ihnen allen.
#1Ein Moment der Freiheit
Wenn nichts so kommt, wie es kommen sollte, heißt das vielleicht, dass du gerade dabei bist, in eine Richtung zu stolpern, die du sonst nie gefunden hättest.
Das ist ein guter Gedanke, ein guter Satz. Auch wenn ich mich gerade beinahe zwingen muss, ihn zu glauben, ihn beinahe trotzig aufschreibe, um ihn festzuhalten und danach von mir wegschieben zu können. Auf einem losen Zettel finde ich Platz. Zweimal muss ich neu ansetzen, den letzten Rest Tinte an die Spitze des Kugelschreibers schütteln, dessen Label ich kaum noch lesen kann. Am Anfang meiner Reise habe ich mit ihm eine Restaurantrechnung unterschrieben, ihn danach gedankenlos eingesteckt und ein paar Tage später wieder in meiner Jackentasche ertastet. Seitdem hat er mit mir das Western Cape Südafrikas bereist, ist ein paarmal auf dem kleinen Eisentisch meiner Terrasse über Nacht feucht geworden und in der Mittagssonne getrocknet, hat diese eine Nummer auf mein Handgelenk geschrieben, die ich seitdem immer wieder wählte, heftete sich an mein Journal, an meine Ideen, skizzierte meine Pläne und lag neben mir, als ein Gespräch sie auflöste. Mit meinem Daumen drücke ich die Plastikkappe wieder auf seine Spitze, lasse ihn in den Umschlag meines Journals fallen und greife nach dem halb leeren Bier, das ich in meinem Schoß balanciere. Ich puste den Sand vom Flaschenhals und nehme einen Schluck, lasse ihn dann genauso sacken wie die letzten Tage.
Für ein paar Wochen hatte es sich angefühlt, als würde aus einem wilden Traum ein realer Plan werden. Als würde mein rastloses, sich nach immer wieder neuen Orten und Anfängen sehnendes Leben, das sich manchmal so aufregend und manchmal so zerstreut anfühlte, sich auf einmal bündeln und mir damit zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl geben, dass ich wirklich wusste, was ich wollte. Ich gehöre der Generation an, die sich nicht entscheiden kann. Für die das eine zu wählen das andere zu verlieren bedeutet. Eine Generation, die von ihren Eltern beinahe eingebläut bekommen hat, dass sie alles könnte, was sie nur wollte, aber vielleicht trotzdem nicht unbedingt sollte. Niemals einfach so springen, immer noch mit einer Hand den Ast umklammern, den eigenen Weg finden und das Größte aus all den Möglichkeiten machen, aber doch in Sichtweite bleiben. Nie so weit ins Unbekannte laufen, dass man nicht mehr umdrehen könnte. Finde heraus, wer du sein willst, solange du dabei keine falschen Entscheidungen triffst. Ein Plan, der nicht aufgeht. Wir sind die Generation, die nervös und ungeduldig durch ihr Leben stolpert und dabei trotzdem ständig im Flur herumsteht.
Und dennoch – wirklich frei fühlte ich mich in meinem Leben immer nur dann, wenn ich mich entschied. Gegen das Studium, das mir nichts bedeutete, und damit auch gegen die Erwartungen, die niemals meine eigenen waren. Gegen den festen Job, in dem ich gut verdienen, aber niemals wachsen würde. Für das Leben als freiberufliche Fotografin und Autorin. Für ein Leben unterwegs. Für den Plan, irgendwann nach Südafrika auszuwandern. Manchmal sogar einfach nur für das Unbekannte. Eine neue Möglichkeit voll anzunehmen, auszukosten, einen Funken zu einem Ziel zu machen, es zu erreichen und von dort aus auf all das zurückzuschauen, was du währenddessen erlebt, mitgenommen und manchmal ausgehalten oder überwunden hast, ist eine der schönsten Formen von Euphorie, die ich mir selbst schenken kann. Etwas auszuschlagen, abzulehnen, meine Grenzen und Wünsche zu ehren, einen Ort oder eine Erfahrung hinter mir zu lassen, ist eine Bestärkung, die ich mir selbst schuldig bin. Die Entscheidungen in meinem Leben waren bis hierher nicht alle richtig. Wie auch? Sie kamen manchmal zu spät, zu leise, zu trotzig, manchmal waren sie nur ein Anfang, manchmal ein stilles Ende. Aber sie alle haben mich ein bisschen dichter an mich selbst herangebracht. Es ist okay, nicht zu wissen, wohin du willst, wenn du dabei bist, herauszufinden, wer du sein willst.
Ich ziehe den Pullover, den ich um meine Schultern geschlungen habe, über den Kopf und wärme meine Finger in seinen Ärmeln. Der Wind, der schon den ganzen Tag über um die Stadt kreist, hat seit dem Sonnenuntergang gefühlt noch einmal an Stärke gewonnen. In ein paar Minuten wird es dunkel. Das geht schnell hier unten. Während ich auf meinem Balkon in Hamburg manchmal noch bis in die späten Abendstunden den Wolkenfetzen beim Färben und Verblassen zusehen kann, ist das Ende eines Tages so viel dichter am Äquator meistens nur ein paar Minuten lang. Ich muss mich auf den Weg machen, wenn ich die sandigen Treppen zurück zur Hauptstraße nicht im Dunkeln hochsteigen will. Nur noch einen Moment, entscheide ich. Einen Moment länger von hier aus auf den Atlantischen Ozean schauen.
Morgen Nachmittag geht mein Rückflug. Meine Koffer stehen gepackt in meinem kleinen Apartment auf der Kloof Street. Ich habe mir ausgemalt, dass wir einander versprechen würden, uns zu vermissen, uns zum Abschied küssen und beide wissen würden, dass das hier ein kleiner Anfang sein könnte. Ich habe geplant, meinen Arbeitsvertrag erst im Flugzeug zu unterschreiben, symbolisch, zwischen den zwei Welten.
Aber so wird es nicht kommen. Es gibt keinen Arbeitsvertrag, nur eine Absage. Keinen Abschiedskuss, nicht einmal einen letzten. Ich werde uns vermissen. Ich tue es jetzt schon. Aber das ist alles. Wenn ich morgen den Flug LH757 boarde, dann gibt es da keinen Anfang, den ich mir ausmalen könnte. Nur die Gewissheit, dass ich wieder vollkommen neu anfangen muss, neuen Anlauf nehmen muss – und werde.
Ich greife noch einmal nach dem Stift, ziehe ihn aus dem Journal und schreibe unter meine letzte Notiz:
Was bleibt, ist die Freiheit.
Manchmal findest du sie in einer Entscheidung, manchmal im Ungewissen. Darin, nicht zu wissen, was kommen könnte, aber festzuhalten, was du nie wieder verlieren willst.
Ich bleibe mir. Immer.
#2Ein Moment, in dem ich Mut entdecke
Noch fünf Springer stehen vor mir. Ich halte mich mit beiden Händen an den Eisenstangen der rutschigen Treppe fest, verlagere mein Gewicht immer wieder vom einen aufs andere Bein. Mein Kopf sucht nach Entschuldigungen, nach Ausreden, Auswegen. Die Trillerpfeife schrillt, nur noch vier, jetzt sogar schon nur noch drei Springer vor mir. Für die einen ist es die Schwimmsportwoche meiner Grundschulklasse, für mich ist es der allergrößte Albtraum. Ich bin acht Jahre alt, ich kann schwimmen, ich kann tauchen. Aber ich sehe keinerlei Nutzen darin, mich aus einigen Metern Höhe – drei, um genau zu sein – ins Nichts fallen zu lassen. Mein Lehrer, Herr Bischoff, sieht das anders. Seit vier Tagen lässt er uns zum Abschluss eines jeden Schwimmtages antreten. Der Klassenliste nach stehen wir an, springen auf seinen Pfiff vom Turm und dürfen uns umziehen gehen, bevor der schwerfällige Omnibus uns vor dem Freibad wieder einsammelt. Ich bin noch kein einziges Mal gesprungen. Und das macht das Ganze noch schlimmer. Statt des Busses warten heute unsere Eltern auf uns, die mit den Lehrkräften ein Grillfest vorbereitet haben, um gemeinsam unsere bestandenen Schwimmabzeichen zu feiern. Das hier ist meine letzte Chance, mir das silberne Abzeichen zu sichern, der Sprung vom Brett ist die letzte Pflichtaufgabe. Unter dem Applaus der Eltern springt Elena ins Wasser. Nur noch zwei Springer vor mir.
Vor zwei Tagen hatte Herr Bischoff meiner Freundin Sarah, die zögernd am Brettrand gestanden hatte, einen Schubs gegeben. Während sie erst überrascht und dann breit grinsend wieder auftauchte und sich von ihm im Anschluss ihr Abzeichen abholte, machte sich in mir nur noch mehr Panik breit. Nur um sicherzugehen, dass er mich nicht ebenfalls über die Kante stoßen könnte, ließ ich mittlerweile das Geländer am Sprungturm nicht mehr los. Ein paar Minuten stand ich so da, hielt aus, dass die Klasse mich erwartungsvoll anfeuerte, nur um danach enttäuscht zu murren. Johannes aus der Parallelklasse hatte gestern laut »Lasst, die springt eh nicht!« gerufen, und sosehr er mir zuwider war, ich brachte es nicht über mich, ihm das Gegenteil zu beweisen.
Stattdessen wartete ich ab, dass Herr Bischoff mich nach einer gefühlten Ewigkeit mit den bekannten Worten »Na, vielleicht wird es morgen was!« vom Turm winkte, und versteckte mich danach sofort in den Umkleiden.
Jetzt winkt er mich zu sich. Pfeift, als würde er selbst daran glauben, dass dieses Signal mich heute tatsächlich dazu bringen wird, dieses Brett in Richtung Wasseroberfläche zu verlassen.
»Komm, Lina, letzte Chance heute!«, sagt er und sieht mich abwartend an. Unten am Beckenrand beginnen die Eltern, zu klatschen. Auf den ersten Blick erkenne ich ein paar der Mütter meiner Freundinnen. Sarahs Mama winkt mir zu, neben ihr sehe ich meine eigene Mutter. Als wir Blickkontakt haben, formt sie ihre Hände vor dem Mund zu einem O und ruft dann: »Na los, du schaffst das!«
Du schaffst das. Das sagt sie nicht zum ersten Mal. Natürlich habe ich ihr davon erzählt, wie viel Angst es mir macht, von diesem Turm zu springen. Und sie hat mehr als einmal geantwortet: »Du schaffst das schon.«
Und wenn ich fragte: »Wie denn?«, antwortete sie: »Augen zu und durch. Einfach springen.«
»Ich kann nicht«, sage ich leise und schüttle den Kopf.
»Komm, geh wenigstens mal zum Brett, damit du siehst, dass es gar nicht so hoch ist.« Herr Bischoff startet eine vorsichtige Verhandlung. Damit du mich schubsen kannst, denke ich.
Wieder schüttle ich den Kopf.
»Augen zu und springen!«, ruft meine Mama.
Jetzt stimmt meine Klasse ein. Da ist es wieder, das Klatschen, das Rufen, das Hoffen.
»Trau dich!«
»Komm schon!«
»Spring einfach!«
Als ich in der Menschengruppe jetzt auch noch meinen Papa erkenne, der sich einen Weg zu den anderen Eltern bahnt und mir zuwinkt, wird mein Gesicht heiß. Und sosehr ich dagegen ankämpfe, schießen mir Tränen in die Augen. Ich weiß damals noch nicht, dass es Scham ist. Das Gefühl, vor den Menschen, die mir in diesem Moment die Welt bedeuten, zu versagen. Dass ich mich vor meinen Freunden bloßgestellt und wie eine Verliererin fühle und – obwohl alle das Gegenteil behaupten – nichts dagegen machen kann. Alles in mir sträubt sich. Wieder schüttle ich den Kopf. Wieder ein leises, abebbendes »Oooh«, als ich mich umdrehe und die Leiter wieder nach unten steige.
Der Bademeister, der die Situation beobachtet hat, wirft mir einen aufmunternden Blick zu.
»Ganz viele Leute mögen den Sprung nicht. Selbst Erwachsene haben Angst, und das ist okay. Mach dir nichts draus.« Ich nicke halbherzig und wische mir durchs Gesicht, möchte gar nicht, dass ich ihm leidtue, möchte am liebsten vorspulen, raus aus diesem Moment.
Ich wickle mich in ein Handtuch und sehe meine Mutter auf mich zukommen.
»Na, komm her, du kleiner Angsthase«, sagt sie lachend und umarmt mich, versucht, mich aufzumuntern.
»Ich bin kein Angsthase«, murmle ich.
»Na doch, ein bisschen schon.«
Ich habe meine Mutter noch nie auch nur vom Beckenrand springen sehen. Dabei ist sie eine gute Schwimmerin, im Winter trifft sie sich oft mit Freundinnen im Schwimmbad, verabredet sich zu ein paar gemeinsamen Bahnen und einem Saunagang. Wenn wir Urlaub am Meer machen, tobt sie mit mir in den Wellen, wirft an Pooltagen immer wieder einen roten Gummiring ins Wasser und sieht mir dabei zu, wie ich nach ihm tauche, und trainiert mit mir, längere Strecken zu schwimmen. Aber nie üben wir einen Kopfsprung, nie springen wir zusammen von einem Turm oder Startblock. Auf einmal kommt mir der Gedanke, dass sie selbst vielleicht auch nicht ganz so mutig ist, wie ich es gerade sein soll.
»Du würdest da auch nicht runterspringen«, protestiere ich.
»Ich will ja auch kein silbernes Abzeichen machen«, antwortet sie.
Wenn ich heute auf diese Situation zurückschaue, sie noch einmal durchlebe, wünschte ich mir, meine Mutter hätte anders reagiert. Auch wenn ich weiß, dass sie den Moment vermutlich ganz anders als ich wahrgenommen hat, mich liebevoll aufmuntern wollte und ihre Worte vielleicht sogar ein Versuch waren, dem Thema seine Ernsthaftigkeit zu nehmen. Meine Mutter wollte mich schnell über eine unangenehme Situation hinwegtrösten, sie abhaken und nicht weiter bewerten. Aber schon damals als Kind konnte ich besser mit echten Erklärungen, mit einem Gespräch über die eigenen Gefühle umgehen, als mit einem schnellen Überspielen oder dem wortlosen Abhaken einer Situation. Das Frustrierendste für mich war in dem Moment, dass ich meine eigene Angst nicht verstand. Dass ich nicht verstehen konnte, wovor ich mich so fürchtete, und nicht wusste, wie ich anfangen konnte, diese Furcht zu überwinden. Und vielleicht ist das sogar noch heute ein Teil der Dynamik zwischen mir und meiner Mutter. Sie hat oft Angst um mich, sorgt sich um mich, noch immer – möchte aber gleichzeitig, dass ich mutig, stark und unerschrocken bin, meine eigenen Entscheidungen treffe und Wege gehe. Nur um mich manchmal genau dann wieder besorgt zu bremsen, wenn ich gerade dabei bin, meine eigenen Erfahrungen zu machen.
Wenn ich mit meiner Freundin bei meinen Großeltern im Garten nach Kirschen angelte und mich bis auf die letzte Sprosse der Leiter traute, rief sie erschrocken: »Pass bloß auf! Weißt du, was alles passieren kann?!« Wenn ich mir Reitunterricht wünschte, waren ihre Zweifel stärker: »Das ist viel zu gefährlich! Was, wenn du dir etwas brichst?« Aber wenn ich Angst auf dem Sprungturm hatte oder Lampenfieber vor einem Auftritt, schob sie mich an, mutig zu sein und meine Aufregung oder Unsicherheit zu überwinden. »Du bist doch sonst nicht so ängstlich!« Es gab nicht selten Momente in meiner Kindheit, in denen ich nicht ganz sicher war, ob ich mir gerade zu viel oder zu wenig zutraute. Und einem kleinen Teil von mir geht es vielleicht sogar noch immer so. Zu mutig oder zu ängstlich? Wann springen, wann festhalten, wann loslassen? Wenn du acht Jahre alt bist, geht es um ein Dreimeterbrett. Später geht es um die Fragen, wohin wir wollen, wer wir werden, was wir studieren, wo wir leben, wohin wir reisen wollen – was uns glücklich macht.
Es ist eine bekannte Übung in der Meditation und sogar in der Psychotherapie, sich visuell eine Situation aus der Kindheit, die einen noch immer beschäftigt, vorzustellen. Dabei hilft es, unsere Augen zu schließen, unsere rechte Handfläche offen auf unsere Brust zu legen und tief zu atmen, während sich vor uns die Szene Stück für Stück aufbaut. Vorsichtig nähern wir uns unserem jüngeren Ich, setzen uns zu ihm und sagen all das, was wir in dieser Situation gern gehört und gebraucht hätten.
»Hab keine Angst. Der Sprung kribbelt im Bauch, aber so schnell, wie der erste Schreck vorbei ist, verwandelt er sich in Euphorie. Das ist dieses Gefühl, das dich grinsen und lachen und dich ganz frei und leicht fühlen lässt. Das Eintauchen geht so schnell, dass du es kaum bemerkst, bevor deine Arme und Beine instinktiv die Schwimmbewegungen beginnen und du wie ein Korken wieder nach oben schnellst. Hab keine Angst davor, zu fallen. Wenn du selbst entscheidest, wann du springst, fühlt es sich nämlich wie Fliegen an.«
Wir selbst sind nun die Erwachsenen, die wir als Kinder manchmal gebraucht hätten und die unserem inneren Kind noch immer beistehen können. Wir haben auch als Erwachsene noch die Chance, vergangene Situationen zu heilen und besser zu verstehen. Nicht selten haben wir nämlich schon als Kinder, wann immer wir eine Angst überwunden haben, instinktiv gewusst, dass wir stark oder entschlossen genug sind, dass wir uns vergeben, uns fangen und fallen lassen, dass wir für uns selbst da sein können. Unser Mut steckt längst in uns. In unserem Innersten.
Als wir schließlich unsere bronzefarbenen Urkunden überreicht bekommen, sind wir zu dritt.
Unsere Eltern klatschen, lächeln uns zu, nehmen uns aber trotzdem nicht das Gefühl, die Schlusslichter unserer Klasse zu sein und die Trostpreise abgeräumt zu haben. Alle anderen haben mindestens das silberne Abzeichen erreicht, einige sogar Gold. Für einen großen Teil des Nachmittags fühlt es sich so an, als wären alle meine Klassenkameraden ein Team, ein paar von ihnen die Kapitäne und wir drei lediglich Zuschauer. Während wir uns auf dem angrenzenden Spielplatz austoben dürfen, sprechen sie aufgeregt über Saltos und Flops, trainieren auf dem Trampolin Sprünge und Figuren, treten gegeneinander an. Ich sitze dabei, feuere meine beste Freundin Sarah an, teile mir mit ihr eine Bratwurst, halte ihre Jacke, wann immer sie wieder in die Mitte des Trampolins steigt, jubele laut, wenn ihr ein Überschlag gelingt – und bin ein bisschen neidisch. Ich will das auch. Ich will mich auch trauen. Ich will auch mitmachen. Vorsichtig klettere ich auf das Trampolin, federe eine paarmal, bevor ich mich abstoße und dann vom Trampolin wieder auffangen und erneut in die Luft katapultieren lasse. Mein Bauch kribbelt so sehr, dass ich lachen muss. Sarah greift meine Hände und zieht mich in die Mitte, dort, wo die Schwingung am größten ist. »Mach’s mir nach!«, ruft sie mir zu, springt ab, landet im Schneidersitz, nur um offenbar mühelos mit dem nächsten Schub des Trampolins wieder auf ihre Füße zu fallen.
»Tu dir bloß nicht weh!«, warnt mich eine bekannte Stimme in meinem Kopf, aber bevor ich darüber nachdenken kann, lasse ich mich von Sarahs Euphorie anstecken.
Es klappt, einfach so. Und dann noch einmal und noch einmal. Ich springe, lasse mich fallen, lege mich irgendwann sogar flach auf das Trampolin und lasse mich von meinen Freunden in die Luft katapultieren. Irgendwann setzen wir uns vollkommen außer Atem wieder auf den Rand, trinken eine kalte Fanta und lassen unsere müden Beine baumeln. Ein bisschen berauscht von so viel Sonne, so viel Kribbeln und Leichtigkeit, sehe ich Sarah mit einem breiten Grinsen an.
»Kommst du kurz mit?«, frage ich sie und warte kaum ihre Antwort ab, laufe einfach los und höre sie dann direkt hinter mir.
Niemand steht Schlange, die Treppe ist vollkommen leer. Es ist spät geworden, aber der Beton, über den wir laufen, ist immer noch warm, vollgesogen mit Sonne. Das Freibad schließt in einer halben Stunde. Die meisten Familien sind längst dabei, ein letztes Mal auf ihren Handtüchern zu trocknen. Meine Hände finden das Geländer, und ohne zu zögern, steige ich sämtliche Stufen nach oben, drehe mich kein einziges Mal um und stelle mich schließlich mit klopfendem Herzen an die Kante des Brettes. Ich schiele zum Turm des Bademeisters, er hebt den Daumen – und ich mache einen Schritt zurück. Einen Moment habe ich wirklich geglaubt, sie abgehängt zu haben, aber da ist sie wieder: die Angst. Was, wenn ich mir wehtue? Irgendetwas falsch mache? Was, wenn ich falsch aufkomme? Was, wenn die Angst in meinem Bauch nach der Landung nur noch größer wird? Aber was, wenn es genauso kribbelt wie auf dem Trampolin? Was, wenn es genauso viel Spaß macht? Und was, wenn ich gerade dabei bin, es zu verpassen? Ich will mich trauen, beschließe ich, und ohne noch ein weiteres Mal darüber nachzudenken – springe ich. Hunderte Luftblasen prickeln auf meiner Haut, steigen neben mir auf, während ich zurück an die Wasseroberfläche strample. Meine Nase brennt, und ich verschlucke mich mehr als einmal, als ich zum Beckenrand schwimme. Hustend halte ich mich mit einer Hand fest, mit der anderen reibe ich das Wasser aus meinen Augen und sage immer wieder: »Ich bin gesprungen, ich bin echt da runtergesprungen!« Sarah und ich klatschen uns ab.
»Noch mal?«, fragt sie mich.
Ich nicke. »Ein Mal noch, aber nur, damit es auch wirklich passiert ist.«
Ich habe mein silbernes Abzeichen dann übrigens doch noch bekommen. Der Bademeister hat es aus seinem Büro geholt und meinen Namen auf die neue Urkunde geschrieben. Als ich neulich in alten Unterlagen blätterte, fiel sie mir wieder in die Hände. Bis heute sind Dreimeterbretter oder Felsvorsprünge eine kleine Überwindung für mich, die den Mut in mir herausfordert und mich an das Kind in mir erinnert. Daran, dass ich mich nicht einfach mit geschlossenen Augen fallen ließ, sondern den Mut in mir selbst fand, um wirklich abzuspringen. Ich habe mich noch nie dazu drängen lassen, meine Ängste, Fragen, Zweifel und Gefühle einfach loszulassen. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass mir Mut zugesprochen oder zugerufen werden konnte. Ich glaube, er muss viel eher heranwachsen, muss sich so lange in uns sammeln, bis die Aufregung, etwas Unbekanntes zu entdecken, etwas Neues zu wagen, es einfach zu versuchen, so viel größer ist als die Angst, zu scheitern.
Mutig sein bedeutet nicht, dass du dir alles zutraust. Angst zu haben, ist eines der menschlichsten Gefühle überhaupt. Sie gehört zu uns – nur wir niemals ihr.
Wann immer mein Herz zu schnell zu schlagen beginnt, mir die Nervosität in den Magen sinkt und aus einem Kribbeln eine unerträgliche Unruhe wird, erlaube ich mir, einen Schritt zurückzugehen, und erinnere mich daran, dass ich jederzeit wieder die Leiter nach unten steigen kann, wenn es gar nicht anders geht. Und dass es fast keine Entscheidung da draußen gibt, die man nicht auch wieder ändern könnte. Die Wahl des Studiums, eine Trennung, ein Umzug in eine neue Stadt, ein neuer Job, ein neuer Mensch in meinem Leben, so viele Reisen allein, irgendwann Südafrika, das Auswandern, ein Haus bauen, ein Buch schreiben und dann noch eins. All diese Schritte haben mir irgendwann, irgendwie mal Angst gemacht. Und für all das habe ich mich dennoch entschieden. Habe meinem Innersten die Frage gestellt: Wenn ich jetzt und hier die Reißleine ziehe, umdrehe, wie fühlt sich das an?
Wie eine Erleichterung? Wie ein tiefer, ruhiger Atemzug? Dann steige ich vorsichtig wieder herunter.
Aber würde ich etwas verpassen? Aufgeben? Jetzt schon vermissen, obwohl ich es noch nicht einmal versucht habe? Dann springe ich. Greife nach meiner Entscheidung und springe.
#3Ein Moment, der das Fernweh weckt
»Life is a journey and if you fall in love with the journey, you will never not be in love!«, stand auf dem ausgeblichenen Plakat in der Ankunftshalle. Ich verzog den Mund, während ich schon zum dritten Mal den kitschigen Schriftzug in ehemals leuchtendem Orange las. Auf dem Bild darunter war eine Gruppe Backpacker zu sehen, die sich umarmten, lachten und mit den Füßen im Sand standen. Einer hielt einen Volleyball, ein anderer hatte seinen linken Arm in den Himmel gereckt und formte seine Hand zu einem Peace-Zeichen. Gemeinsam sahen sie aus wie eine Casting-Band: austauschbar, aber vielleicht auch gerade generisch genug, um uns das Gefühl zu geben, wir könnten sie sein. Und das in weniger als ein paar Stunden, sobald unser Gepäck in Kofferräumen verteilt und alle Schüler ihren Gasteltern zugeordnet sein würden. Das Plakat diente uns nicht nur als Inspiration für unsere kommenden drei Wochen, sondern auch als Sammelstelle. Schon von Weitem war das große Logo des Anbieters zu erkennen gewesen, bei dem unsere Eltern uns eine Sprachreise nach Brighton gebucht hatten. Meine beste Freundin und ich würden zum ersten Mal ohne unsere Eltern Zeit in einem anderen Land verbringen. Fern von den Badestränden der Kanarischen Inseln oder der RIU-Hotels der späten Neunzigerjahre, die ich mit meiner Familie so oft besucht hatte. Keine Saftcocktails mit Schirmchen in der Poolanlage, keine Schnorchelausflüge, keine langen Abende im Restaurant an der Strandpromenade, das meine Eltern immer zum Anfang einer Reise auswählten und danach wieder und wieder besuchten. Dafür eine Gastfamilie, ein Stundenplan für den Vormittag, Lernziele, aber auch freie Nachmittage, die wir selbst gestalten konnten, geplante Lagerfeuer und Sonnenuntergänge am Strand, 20 Teenager im Alter von 14–17 Jahren und ganz viel Aufregung im Bauch. Für unsere Eltern bedeutete diese Reise, dass sie es uns ermöglichten, unsere Englischkenntnisse zu vertiefen, die Sprache anzuwenden, wirklich zu verinnerlichen. Sie erhofften sich von den drei Wochen, die wir an der Südküste Englands verbringen würden, vor allem, dass sie unsere Chancen für unseren späteren Lebensweg, beim Abi oder im Studium steigern würden. Natürlich wünschten Sarah und ich uns das Gleiche: endlich wirklich Englisch sprechen, uns endlich mit Locals und nicht nur unserer Lehrerin unterhalten. Erleben, wie es sich anfühlt, wenn du in einer Sprache nicht nur Aufsätze schreibst, sondern sie ganz alltäglich anwendest. Aber noch größer als das war die Sehnsucht nach einem ersten eigenen Abenteuer. Zum ersten Mal ein Stück Welt, das wir beide noch nie zuvor gesehen hatten, beinahe ganz allein entdecken zu dürfen.
Unsere Gastmutter stellte sich als Kathleen Warwick vor, war Anfang 50, und ihr blumiges Parfüm kitzelte in meiner Nase, als sie mich zur Begrüßung umarmte. Als wir den Parkplatz erreichten, frischte der Wind auf und wirbelte ihre langen Naturlocken, in denen eine Sonnenbrille steckte, durcheinander. Sie strich sich ein paar Strähnen aus dem Gesicht und zog die Jeansjacke, die sie über ihrem leuchtend gelben Sommerkleid trug, vor der Brust zusammen. »Willkommen in Brighton!«, kommentierte sie das wechselhafte britische Wetter.
Auf ihrer Nase tanzten die Sommersprossen, wenn sie lachte oder sprach. Sie trug ein paar dünne Ketten mit verschiedenen Anhängern um ihren Hals und fast gar kein Make-up. Lediglich ihre Lippen leuchteten in einem hellen Pink. Sie sprach so schnell, dass ihre Stimme sich manchmal fast überschlug, dann entschuldigte sie sich kurz und vergewisserte sich, dass wir sie trotzdem verstanden hatten.
»Verzeiht, wenn ich ein bisschen zu schnell und zu viel rede und euch mit so vielen Informationen überfalle. Ich freue mich einfach jedes Mal so sehr, ein paar neue Gesichter kennenzulernen!«, sagte sie lachend und öffnete den Kofferraum ihres Geländewagens, um unser Gepäck zu verstauen. Auf den ersten Blick wirkte sie ganz anders als unsere Mütter oder eigentlich jede andere Mutter, die ich bisher kennengelernt hatte. Meine Mutter und auch Sarahs strahlten beide Sicherheit aus, waren für uns wie geduldige Ruhepole. Kathleen wirkte im Vergleich dazu wie ein vollkommen neuer Gegensatz voller Farbe und Worte. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, fühlte ich mich in ihrer Gegenwart sofort wohl und ließ mich von ihrer lebendigen Vorfreude auf unsere gemeinsame Zeit anstecken. Während der Fahrt vom Bahnhof zu unserem Zuhause auf Zeit erzählte sie uns von ihrer Familie: von ihrem Mann Alan, mit dem sie schon seit mehreren Sommern Gastschüler aus unterschiedlichsten Ländern aufnahm, von ihren Söhnen, die beide in London studierten, und ihrer jüngsten Tochter Sophie, die als Einzige noch zu Hause wohnte. »Ich mag es einfach nicht, wenn unser Esstisch abends so leer aussieht, wenn wir neben ein paar freien Stühlen sitzen und es nach dem Abendessen direkt still im Haus wird. Ich mag es, wenn unser Haus wie ein Hafen ist. Ein Ort für gute Gespräche und um als Familie zusammenzukommen, aufzutanken, bevor jeder am nächsten Tag wieder loszieht und neue Erfahrungen sammelt.«
Tatsächlich fühlte sich das Reihenhaus im Princess Crescent, das sich schmal und lang in einen anliegenden Garten streckte, auch genau so an. Neben uns hatten die Warwicks noch zwei weitere Mädchen aufgenommen. Jede von uns bekam einen Schlüssel. Wann wir schlafen gingen oder wieder aufstanden, ob wir frühstückten oder morgens nur hastig nach der Lunchbox griffen, bevor wir uns gemeinsam auf den Weg zum Unterricht machten, blieb ganz uns überlassen. Die einzige Regel, die Kathleen und Alan wirklich ernst nahmen, war das gemeinsame Dinner an drei Tagen in der Woche, bei dem wir uns über unseren Tag austauschten und besser kennenlernen konnten. Nach dem Dessert stand es uns frei, uns noch einmal mit Freunden am Strand oder in der Stadt zu treffen, und vor allem Sarah und ich genossen die Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel vor unserer Haustür quasi rund um die Uhr benutzen zu können, sehr. Da wir in Deutschland beide in kleinen Dörfern wohnten, mussten wir für jeden Weg, den wir nicht mit dem Fahrrad zurücklegen konnten, unsere Eltern um einen Lift bitten – hier konnten wir uns auf einmal viel spontaner verabreden und ganz selbstständig entscheiden. Für Teenager und Kinder, die in der Stadt aufwuchsen, war das vielleicht das Normalste der Welt, für uns war es ein Stück unbekannte Freiheit.
Gleich an unserem ersten Tag in der Stadt half Kathleen uns dabei, eine Wochenkarte für den Bus zu kaufen, mit dem wir täglich zwischen Brighton und Hove pendeln würden. Unsere Unterrichtsstunden fühlten sich für uns an wie das, was wir uns unter einem Studium vorstellten. In Gruppen erarbeiteten wir gemeinsam unsere Ziele, übersetzten Buchkapitel oder Filmsequenzen, die wir danach gemeinsam diskutierten. Wir interpretierten Songtexte, konnten in einem Crashkurs endlich unsere Grammatikkenntnisse anwenden und überwanden innerhalb weniger Tage unsere Scheu vor unseren oftmals noch holprigen Akzenten. Niemand von uns arbeitete hier auf irgendeine Note hin, sondern jeder von uns freute sich darauf, sich besser ausdrücken und unterhalten zu können. Englisch war hier kein Fach, das wir bestehen wollten, sondern ein Skill, der uns so viele neue Möglichkeiten eröffnete.
»Um eine Sprache zu lernen, musst du sie sprechen«, sagte unser Lektor James, der selbst gerade erst 20 Jahre alt war, zu uns, als er den Unterricht beendete und die Arbeitsmaterialien nacheinander zuschlug. »Und um eine unbekannte Stadt besser zu verstehen, musst du sie entdecken, musst in sie eintauchen, sie kilometerweit ablaufen, dich in ihr und in ihren vielen Ecken verlieren. Du musst sie anfassen, dich mit ihr und ihren Menschen anfreunden, ihre Küche probieren, mit ihren Drinks anstoßen, dich mal mit ihr streiten und wieder versöhnen.«
Ein paar meines Kurses lachten und verabschiedeten sich von ihm mit den Worten: »Alright, alright, we are already outta here«, als hätte er seine letzten Sätze nur absichtlich überzogen, um uns aus dem Kursraum und sich selbst in den Feierabend zu entlassen.
Vermutlich stimmte das sogar, doch er rief lachend »No man, I mean it!« hinter uns her. Seine Worte blieben an mir hängen. Genau so musste es sich anfühlen, nicht nur in den Urlaub oder einfach wegzufliegen, sondern wirklich zu reisen, wirklich zu erleben.
Als wir gerade das Gelände der Schule verlassen wollen, sehe ich James an eine Laterne gelehnt rauchen. Während wir an ihm vorbeigehen, lasse ich mich zurückfallen und bleibe neben ihm stehen. »Hast du das ernst gemeint eben?«, frage ich ihn.
»Dass ihr Brighton entdecken sollt?«
Ich nicke.
»Klar! Ich meine, ihr seid noch mehr als zwei Wochen hier, ihr habt jeden Nachmittag zur freien Verfügung, und wir stellen euch ja auch ein paar Aktivitäten zur Wahl. Aber da ist noch so viel mehr als Beachvolleyball oder der Paddle Round The Pier[1].«
»Was denn zum Beispiel?«, frage ich, ohne zu zögern.
»Was meinst du?«
»Ich … bin noch nie allein gereist. Bisher bin ich immer mit meinen Eltern unterwegs gewesen oder in der Gruppe. Ich hab noch nie eine Stadt selbst entdeckt, und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nur, dass ich all das ausprobieren und erleben will, was du da gerade aufgezählt hast.«
Er sieht mich einen Moment lang an, dann grinst er. »Okay, dann los«, sagt er und wirft sich seinen Rucksack über die Schulter. »Wir fangen mit einem Klassiker an. Fish and Chips, with vinegar.«
Einen ganzen Nachmittag lang essen wir uns einmal quer über die Promenade. Ich probiere meinen ersten englischen Hotdog, dippe salzige Pommes in scharfen Essig und später Donuts in Schokolade. Wir schlendern an Kunsthändlern und kleinen Ateliers vorbei und bis zum alten West Pier der Stadt. Auf dem Rückweg stöbern wir durch verstaubte Bücherkisten, und ich finde einen Roman von Nick Hornby: About a Boy. James nennt ihn »brilliant«, und ich zahle gerade einmal zwei Pfund für mein erstes Buch in englischer Originalsprache. Als wir am Volleyballfeld vorbeikommen, setzen wir uns zu den anderen, strecken uns auf den Liegestühlen aus, und ich schließe für einen kurzen Moment die Augen, während ich meine Eindrücke und das frittierte Essen verdaue. James schlägt vor, noch ein Bier in einem der Pubs zu trinken. Die meisten von uns sind über 16. Dass ich ein Jahr jünger bin, verschweige ich. Ich bestelle meinen ersten Cider, James zeichnet auf einer Karte der Stadt, die er an der Bar gekauft hat, ein paar Orte ein, die ich unbedingt noch besuchen soll. Wir spielen Darts, versuchen immer wieder, die Grundregeln zu verstehen, scheitern, bestellen noch einen Cider und versinken zu sechst in einem großen Ledersofa – während die Open Mic Night von einem Singer-Songwriter eröffnet wird, der zehn Jahre später als James Bay seinen Durchbruch feiern wird. Als wir zurück zur Bushaltestelle laufen, ist es längst dunkel, aber noch immer so warm, dass ich mir meine Jacke um die Hüften binde und meine aufgewärmte Haut vom Sommerwind kühlen lasse. In den Straßen stehen Hunderte Menschen vor den Pubs, all die Stimmen, die Musik, die durch geöffnete Türen nach draußen dringt, das Lachen, das Tanzen und Mitsingen fühlen sich so ansteckend lebendig an. Es ist einer der besten Abende meines Lebens – bis heute. Es ist der Beginn meiner Reiselust, meiner Sehnsucht nach dem Entdecken.