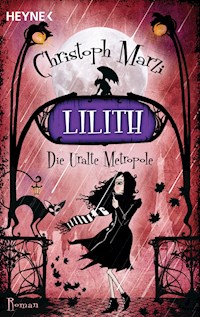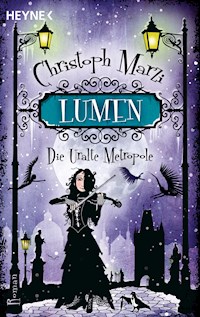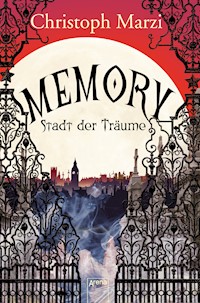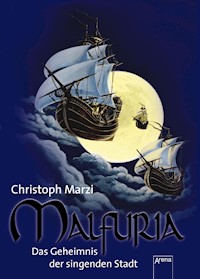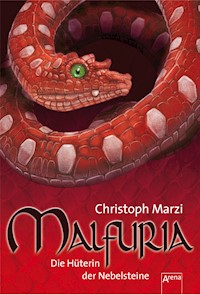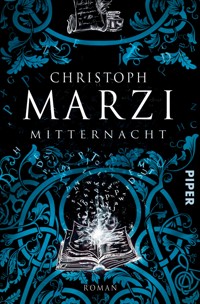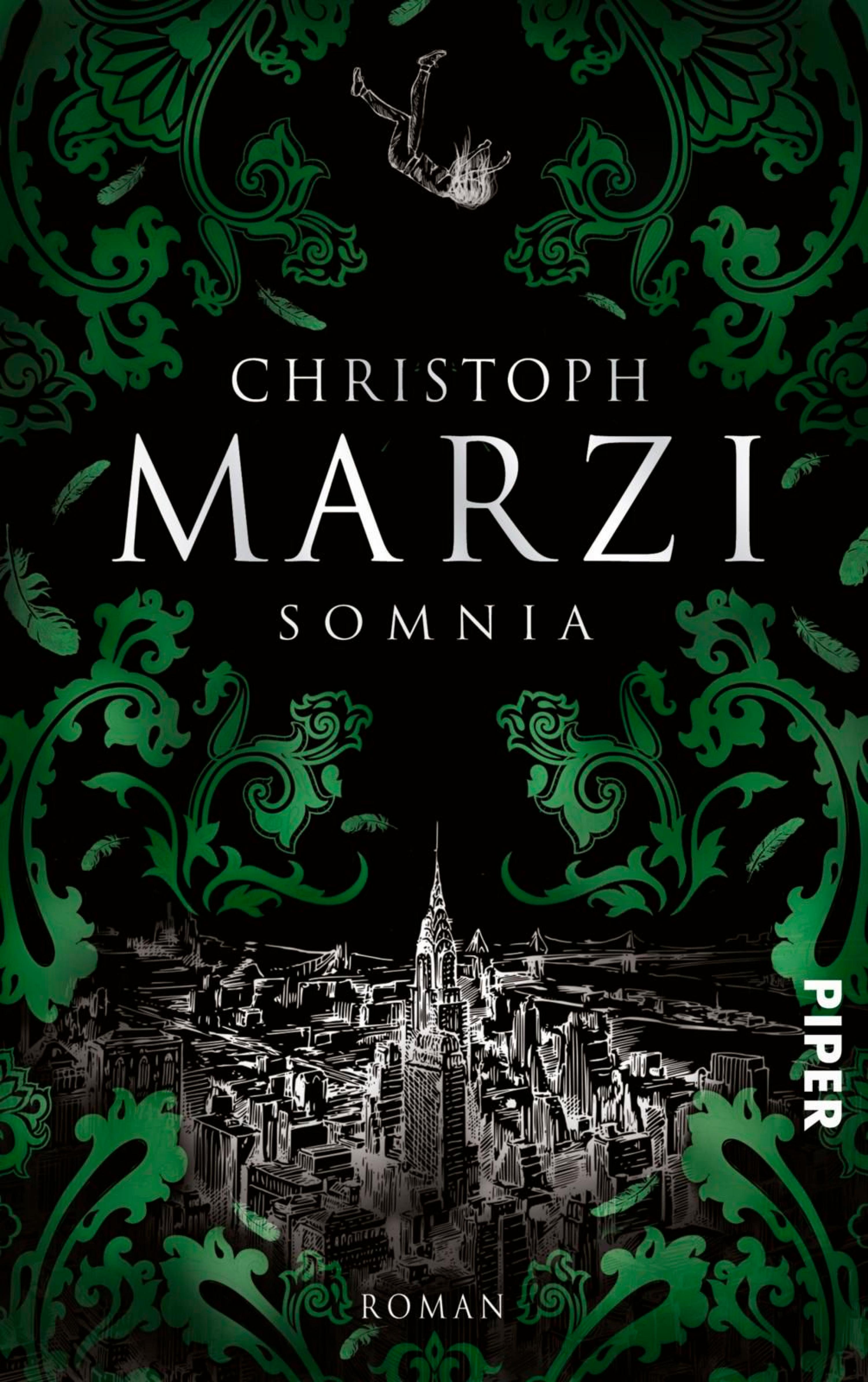11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Jack sich - mit einem rätselhaften Brief in der Tasche - auf den Weg nach Seals Head Harbor macht, ahnt er noch nicht, welches dunkle Geheimnis ihn dort erwartet. Schnell begreift Jack, dass er in dem kleinen Küstenort kein Fremder ist. Auf mysteriöse Weise scheint seine eigene Vergangenheit mit der Legende des Ortes verbunden zu sein. Nach einer Reihe merkwürdiger Ereignisse will Jack bereits die Flucht ergreifen. Da taucht plötzlich Sadie auf, das Mädchen mit den meerblauen Augen. Sie ist die Einzige, die ihm bei der Suche nach Antworten helfen kann. Mit Sadie verbringt Jack fünf Tage, die sein Leben für immer verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Marzi
5 TAGE IM APRIL
Weitere Bücher von Christoph Marzi im Arena Verlag: Malfuria. Die Königin der Schattenstadt Malfuria. Die Hüterin der Nebelsteine Malfuria. Das Geheimnis der singenden Stadt Heaven. Stadt der Feen Memory. Stadt der Träume Helena und die Ratten in den Schatten Gespensterfenster Piper und das Rätsel der letzten Uhr
Christoph Marzi begann bereits im Alter von 15 Jahren zu schreiben. Sein Romandebüt »Lycidas« avancierte 2004 zu einem Überraschungserfolg: 2005 wurde Christoph Marzi mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet. Seitdem schreibt er mit großem Erfolg sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche.
Für Catharina
1. Auflage 2014 © 2014 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80398-2
www.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nachwort
Well, if you’re travelling in the north country fair Where the winds hit heavy on the borderline Remember me to the one who lives there She once was a true love of mine. – Bob Dylan (Girl of the North Country) –
Prolog
Sieh mich an!« Ihre Stimme widersetzte sich dem Sturm. »Schau mir in die Augen und sag mir, was du denkst.«
»Sie werden uns nicht finden.« Eine Lüge kann guttun, manchmal.
Drüben, bei den Klippen, näherten sich Lichter. Taschenlampen. Laternen.
»Sie werden nicht aufhören, nach dir zu suchen.«
Ich betrachtete, was in meiner Hand lag. »Wegen dem hier?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wegen mir.« Das Meer war ein Raubtier, die Nacht ein Dieb. »Wegen uns.« Ihr Flüstern, ganz nah: »Wegen dem, was war.«
»Alles«, dachte ich laut, »wiederholt sich.«
Ihr Haar, salzig wie die See. »Nein«, sagte sie entschlossen, »diesmal nicht.«
1.
Nennt mich Jack. Ein einfacher Name. Jack Fallon. Nicht unbedingt außergewöhnlich. Immerhin, er passt wohl zu mir, das finden die meisten. Und am Ende ist er das Letzte, was einem bleibt, wenn alles andere verloren ist.
»Irgendwie«, das hat meine Mutter oft gesagt, »steckt alles, was uns wirklich ausmacht, in unseren Namen.« Ich habe immer genickt, wenn sie das gesagt hatte. Richtig verstanden habe ich sie aber erst im letzten Sommer, als ich mich dazu entschloss, Spring Hill zu verlassen und einfach so fortzugehen; dorthin, wo der Himmel und das Meer sich treffen, so blaugrau wie ein Tagtraum. Oben an der Westküste der Penobscot Bay, nur ein paar Meilen nördlich von Rockland, gibt es einen kleinen Ort, der Seals Head Harbor heißt. Dort, an der Küste, hat sich alles geändert. Richtig angefangen hat es jedoch unten in Boston, an jenem Nachmittag im April, als ich den Brief fand.
»Der April«, hat mal irgendjemand behauptet, »ist ein verdammt trügerischer Monat.« Ich tippe auf Woodpecker, aber sicher bin ich mir nicht. Woodpecker war ein Obdachloser, der jeden Tag an der Haltestelle vor der Somerville Highschool herumlungerte und hoffte, sich ein paar Münzen zu erbetteln, um davon Zigaretten und billigen Fusel kaufen zu können. Er quasselte viel und ich bezweifle, dass er immer wusste, was er so von sich gab, aber das ist auch nicht wichtig.
Der April, das jedenfalls weiß ich jetzt, ist ein trügerischer Monat. Nur darauf kommt es an.
Der Tag, den ich meine, war einer dieser Frühlingstage, die so umwerfend sind, dass man den nahen Sommer riechen kann; ein Tag, an dem man wirklich nichts anderes tun kann, als sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Sonne schien, es war warm, Insekten flimmerten aufgeregt in der Luft herum und jeder, der draußen war, konnte sich nur gut fühlen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass an einem Tag wie diesem irgendetwas Schreckliches passieren könnte. Ich am allerwenigsten.
Die letzten beiden Stunden, Naturwissenschaften bei Mr Noah, hatte ich mir geschenkt; nach dem Ärger der letzten Woche meldete ich mich diesmal aber ordnungsgemäß im Sekretariat ab. Man sollte sich eben nicht erwischen lassen, wenn man einen Kurs schwänzt. Ich fuhr rüber zum Campus des MIT und hing in einem Café inmitten von Studenten ab, stellte mir vor, wie es wäre dazuzugehören (ich hatte, ganz ehrlich, nicht den blassesten Schimmer, was ich nach der Highschool machen sollte). Ich schaute mir die Studentinnen an und fragte mich, ob sie mich durchschauten und erkannten, dass ich dort eigentlich nichts verloren hatte. Vor mir auf dem Tisch lag demonstrativ ein Notizbuch, gleich daneben ein Kugelschreiber. Beides blieb unangetastet. Die Sonne ließ mich blinzeln und ich genoss es, dort zu sein, so weit weg wie möglich von der Schule und Parker und all dem, was mir sonst noch auf die Nerven ging. Die Welt war ein wunderbarer Ort im Sonnenlicht. Erst als ich die SMS las, hörte der Tag abrupt auf, schön zu sein.
Der April ist ein verdammt trügerischer Monat. Komischerweise fiel mir sofort dieser Satz ein. Ich las die SMS mehrmals hintereinander. Wann mir jemals die Hände so gezittert hatten, wusste ich nicht.
Ich zögerte keine Sekunde und wählte sofort Parkers Nummer. Parker Bracknell war der aktuelle Freund meiner Mutter.
»Das ist nicht dein Ernst.« Sogar meine Stimme zitterte. Es kam mir so vor, als starrten mich alle im Café an.
»Komm schnell her.« Er sagte mir, wohin ich kommen sollte.
»Wie geht es ihr?«
»Komm einfach, so schnell du kannst«, wiederholte er. Dann legte er auf. Auch seine Stimme hatte gezittert. Das tat sie sonst nie. Ich stopfte das Notizbuch und den Kugelschreiber in meinen Rucksack, stand auf und glaubte, dass die Welt sich so schnell drehte, dass alles in verschwommenen Farben explodierte.
Ich machte mich auf den Weg, runter in die U-Bahn, nach zwanzig Minuten wieder ans Tageslicht, weiter zu Fuß. Ich rannte durch die Straßen und fühlte mich wie jemand, der wusste, dass das, was ihm jetzt, in diesem einen Augenblick, hier auf dieser Straße, in dieser Stadt, an diesem Nachmittag, in diesem Sonnenschein passierte, einfach nicht passieren konnte. An Tagen wie diesem, sagte ich mir, passieren keine schlimmen Dinge. Die Welt ist schön und warm und das Glück so duftend und greifbar wie der Frühling selbst. Ich fühlte mich schwach und elend. Ich hatte Angst. Was immer auch geschehen war, es würde gut ausgehen. Schlimme Dinge, die an Tagen wie diesem passierten, mussten einfach gut ausgehen. Außerdem gab es keinen Grund für das, was passiert war. Es war einfach falsch, dass Dinge ohne Grund passierten.
Als ich das Krankenhaus erreichte, erfuhr ich jedenfalls mehr. Parker war schon da und ging nervös auf dem Gang auf und ab. Die Krawatte hatte er gelöst. Parker ist jemand, der in jeder Situation gut aussieht. Selbst jetzt wirkte er gefasst. Als er mich sah, hörte er damit auf, SMS zu schreiben.
»Es war Pech«, sagte er, nachdem er erneut geschildert hatte, was er wusste.
Ich hörte ihm zu, dann ging ich wortlos an ihm vorbei zu einem Fenster, das man nicht öffnen konnte.
Pech.
Keins der wenigen Fenster im Wartezimmer vor der Intensivstation konnte man öffnen.
Die Luft war stickig und der kleine Raum war randvoll mit der Angst der Anwesenden. Für alle, die gerade hier waren, für jeden Einzelnen, der bleich und ungeduldig auf seinem Stuhl herumrutschte oder rastlos hin und her lief, hatte sich der April als ein trügerischer Monat erwiesen.
Ich schaute nach draußen, wo immer noch die Sonne schien und alles schön war. Hier drinnen roch es beißend steril nach Putzmitteln. Die wenigen Grünpflanzen sahen ziemlich krank aus, der Wasserspender war leer.
Das Massachusetts General ist riesig. Bisher war ich noch nie hier gewesen. Ich hatte mich ein paarmal verlaufen, bis ich die Station, auf die sie Mom verlegt hatten, erreicht hatte. Außer Atem, mit pochendem Herzen, voll durch den Wind.
»Es war Pech«, murmelte Parker.
Ja, verdammt noch mal, das war es wohl!
Meine Mutter arbeitete in der Bibliothek. Wohl der sicherste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann. Genau genommen arbeitete sie in der Boston Public Library in der Boylston Street. Das ist fast in Back Bay, ganz in der Nähe des Boston Common, einem großen, alten Park. Man kann mühelos zu Fuß dorthin gehen, aber mit dem Fahrrad ist man natürlich schneller da, gerade in der Mittagspause, die immer kürzer ist, als man sie gerne hätte. Mom liebte den Park. Sie liebte Parkbänke. Sie genoss es, darauf zu sitzen und zu lesen, erst recht, wenn die Sonne so schien wie an diesem Tag. Als ich ganz klein war, hat sie mir oft aus Büchern vorgelesen, und wann immer das Wetter es zuließ, haben wir dazu Parkbänke aufgesucht. Wir hatten uns etwas zum Essen gekauft und es uns dann gemütlich gemacht. Mom hatte Kaffee aus einem Pappbecher getrunken und ich kaltes Wasser aus der Plastikflasche. Es war nicht weiter verwunderlich, dass es sie an einem so schönen Tag wie diesem dorthin zog.
Nutze den Tag war ein anderer Spruch, den sie gern zitierte.
Carpe diem, wie in dem Film.
»Pech«, wiederholte Parker, fassungslos.
Die klägliche Stimme in mir, die viel zu schwach war, um laut zu schreien, winselte nur: »Nein, nein, nein!« Das war alles.
Ich stand wie versteinert am Fenster.
»Pech!«, hörte ich Parker sagen. Alles, was er sagen konnte, schien auf dieses eine Wort reduziert worden zu sein. Er war zu mir gekommen und legte mir eine Hand auf die Schulter.
»Lass mich!«, herrschte ich ihn an und schüttelte die Hand ab. Dann ging ich einen Schritt zur Seite. Wut war besser als Verzweiflung.
Die anderen Anwesenden schauten kurz auf und waren für einen Moment aus ihren Gedanken gerissen. Doch dann kehrten auch sie wieder an einen Ort zurück, der sie das Warten irgendwie ertragen ließ.
»Nein, nein, nein.« Noch immer so leise, dass nicht mal ich selbst die Schreie in mir drinnen wirklich hörte.
Ich schloss die Augen. Einfach nur atmen, selbst das fiel mir schwer. Nichts war jetzt mehr einfach. Alles würde schwieriger werden, vieles unmöglich. Das Leben, das ich gekannt hatte, war explodiert und die Scherbensplitter flogen mir um die Ohren.
Sie hatte sich das Fahrrad eines Kollegen ausgeliehen, um in den Common zu fahren, und hatte dort wohl eine wunderbare Mittagspause verbracht. Ich stellte mir vor, wie sie in der Sonne gesessen und gelesen hatte. Ich fragte mich, in welchem Buch sie gelesen hatte. Unser letzter Streit kam mir in den Sinn, ausgerechnet jetzt. Alles andere auch. Alles, woran ich mich erinnern konnte.
Es gab keinen Grund. Diese Gewissheit war vielleicht das Schlimmste daran.
»Scheiße«, fluchte ich leise.
Ich ließ meinen Blick durch das Wartezimmer streifen. Den anderen ging es kaum besser als mir. Sie alle waren hier, weil sie eine SMS oder einen überraschenden Anruf erhalten hatten. Etwas, das dafür gesorgt hat, dass ihre Welt stehen geblieben war. Ohne Grund.
»Verfluchte Scheiße!«
Und jetzt?
Zu fluchen half nicht. Schweigen ebenso wenig. Nichts würde helfen.
»Dinge passieren manchmal einfach so«, hatte Mom früher oft gesagt, immer dann, wenn ich traurig gewesen bin.
Dinge wie diese.
Zufälle.
Pech.
Ein Mädchen auf dem Rücksitz eines SUVs sagt etwas zu seiner Mutter, der Fahrerin, und für den Bruchteil einer Sekunde, der so winzig ist, dass niemand sich ausmalen kann, wie entscheidend wichtig er ist, dreht sie sich um, einfach nur so, weil sie das tut, was meine Mom auch so oft getan hat, weil sie sich ihrem Kind zuwendet, und als sie den Blick wieder nach vorn auf die Straße richtet, sieht sie ein Fahrrad. Die Frau auf dem Fahrrad reißt die Augen auf – zumindest stellte ich mir vor, dass das so war. Und dann? Keine Zeit, um zu reagieren. Die Bremsen quietschen, die Erde hört auf, sich zu drehen. Nur war es nicht irgendeiner Frau auf einem Fahrrad passiert, sondern meiner Mom, Mary Fallon, mit ihren blonden Locken und dem Lachen, das so laut durchs Haus schallen konnte. Mom, die das wilde Meer mochte und ihre Steine und die Bücher und das Leben selbst, so sehr. Verdammt, so sehr …
Während man sie ins General brachte, war ich auf dem Weg zum Campus, um es mir in einem Café gut gehen zu lassen; als man in der Notaufnahme feststellte, dass ihr Zustand kritisch war, hörte ich gerade laut Veronica Falls über meine Kopfhörer, schaute mir die Studentinnen an, dachte dies und das, alles Mögliche eben, nur unwichtiges Zeug, aber ich dachte nicht an meine Mom und den SUV und das Geräusch des Aufpralls. Natürlich dachte ich nicht daran. Ich schlürfte meinen Kaffee, der lauwarm war wie der Tag, ganz seelenruhig, und blinzelte in die Sonne.
»Mr Fallon?«
Wenn man so aussieht wie ich, die Highschool besucht und von einem Arzt mit Mr Fallon angesprochen wird, ruhig, bestimmt, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten.
Der Arzt kam zu uns, nachdem wir gefühlte tausend Stunden hatten warten müssen.
Parker und ich standen nebeneinander, als seien wir Vater und Sohn. Nicht nur der April kann trügerisch sein.
»Sie ist ins Koma gefallen«, erklärte uns der Arzt. Dr. Geiger stand auf dem Schild an seinem weißen Kittel. Er war freundlich, aber reserviert, sprach ziemlich leise und benutzte erstaunlich wenig Fachbegriffe. Ein Schädel-Hirn-Trauma hatte dazu geführt, dass sie kurz nach der Einlieferung in die Notaufnahme kollabiert und ins Koma gefallen war.
Musste ich mehr erfahren? Was bringen einem in Fällen wie diesem noch medizinische Erklärungen?
Meine Mom war lebenslustig, sie redete viel und hatte immer etwas vor. Koma passte nicht zu ihr. Punkt.
Trotzdem stellte ich panisch eine ganze Reihe von Fragen, genau wie Parker. Dr. Geiger war offen und direkt. Er sagte das, was er dachte, und die Tatsache, dass niemand hören wollte, was er da sagte, hielt ihn nicht davon ab, ehrliche Antworten zu geben.
»Wir wissen es nicht.«
Das war alles.
»Es sieht nicht gut aus.«
Auf den Punkt gebracht. »Wir wissen es nicht.«
Ein Blick in seine Augen genügte, um zu sehen, dass er es sehr wohl wusste. Parker stellte weitere Fragen, Dr. Geiger antwortete ihm. Manchmal sah er mich an, wenn er etwas zu Parker sagte. Dann, mit tief besorgter Miene, fügte er hinzu: »Es tut mir leid.«
Ich glaubte es ihm sogar. Er sah erschöpft aus, wie ein Sportler nach einem Wettkampf; wie jemand, der hart gekämpft und verloren hat.
Ich starrte ihn nur an und sagte etwas. Was das war, weiß ich nicht mehr. Nur eine Floskel, irgendwas. Vielleicht habe ich ihm gedankt, vielleicht habe ich aber auch nur gesagt, dass ich Angst habe. Letzten Endes hatte ich noch nicht wirklich verstanden, was da gerade passiert war. Ich wollte dem trügerischen April noch ein wenig glauben.
Alles andere konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
Mary Fallon, meine Mutter, die morgens noch mit mir über die Schule und nächstes Jahr und meine Pläne und Parker und das Wetter hatten reden wollen, Mary Fallon, die sich, wie so oft in letzter Zeit, anhören musste, dass sie mich verdammt noch mal einfach damit in Ruhe lassen sollte, Mary Fallon, die mich, trotz des Streits, darum gebeten hatte, doch endlich den Wasserhahn in der Küche zu reparieren, eine Sache, die ich ihr seit Tagen schon versprochen hatte; Mary Fallon, die seit Wochen voller Wolken und Regen den Tag herbeigesehnt hatte, an dem endlich wieder die Sonne scheinen würde; meine Mom, der ich mehr als einmal in den letzten Wochen vorgeworfen hatte, ihre Zeit mit einem wie Parker Bracknell zu verschwenden; es hatte sie erwischt.
Ich stellte mir vor, wie sie ihrer Arbeit in der städtischen Bibliothek nachgekommen war. Sogar die Geräusche in der Bibliothek stellte ich mir vor.
Mir war zum Heulen zumute.
Sie war bestimmt froh gewesen, das Fahrrad nehmen zu können.
»Möchten Sie zu ihr?«
Wir nickten beide. Parker ließ mir den Vortritt. Immerhin, das war nett. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Dr. Geiger führte mich durch eine milchglasige Tür, hinein in das Labyrinth der Intensivstation, über Korridore, die alle gleich aussehen, bis in ein Zimmer, das so roch wie der ganze Rest. Steril, sauber, kalt. Die Vorhänge waren zugezogen, alles hier drinnen gehörte den Schatten. Das Zimmer selbst sah richtig verzweifelt aus, wie etwas, dem man die Musik abgedreht hatte.
»Mom?« Meine Lippen bewegten sich, tonlos.
Unsicher, zaghaft, trat ich näher.
Das war der Augenblick, in dem ich zu verstehen begann.
Es sieht nicht gut aus.
Sie lag ruhig da, als würde sie schlafen.
Prellungen verdunkelten ihr Gesicht. Sie war hübsch, selbst jetzt noch. So zerbrochen. Durchsichtige Schläuche hingen ihr aus dem Mund, eine Maschine, die neben dem Bett stand, machte leise Pumpgeräusche. In ihren nackten Armen steckten lange Nadeln und Kanülen und über den Überwachungsmonitor flackerten Anzeigen, die mir wie hämisches Grinsen vorkamen.
»Danke«, sagte ich zu dem Arzt.
Dr. Geiger nickte. »Ein paar Minuten nur.«
Die Antwort blieb mir im Hals stecken.
Ein paar Minuten, das wusste ich, waren zu kurz. Stunden, die Nacht, die Ewigkeit, das alles wäre zu kurz. Die Zeit, die ich gebraucht hätte, um all das zu sagen, was mir durch den Kopf ging, hatte ich nicht. So stand ich nur regungslos neben dem Bett und betrachtete sie.
Was, wenn sie sterben würde?
Es tut mir leid.
Der Gedanke war wie ein schneller Faustschlag, der mich nach Luft ringen ließ. Ich wollte nicht weinen, aber ich tat es. Immerhin war Parker nicht da. Wach auf! Ich berührte ihre Hand, die ganz leblos war, hielt sie fest, ganz vorsichtig. Du wirst wieder gesund werden. Eine Lüge kann guttun, manchmal. Wie ein Messerstich fühlte sich dieser Gedanke an.
Die schrägen, unscharfen Bilder, die ein Leben ausmachten, wirbelten um mich herum, und nichts ergab einen Sinn. Ich fragte mich, ob man einen Abschied, wenn man ihn erlebt, immer erkennt. Die Antwort darauf wollte ich nicht wissen. Nicht hier und jetzt, am besten nie.
Schließlich ging ich nach Hause. Dort fand ich den Brief. Und mit ihm den Entschluss, nach Seals Head Harbor zu gehen.
2.
Die Lowell Street in Spring Hill ahnte nichts von dem Unglück. Als ich aus dem Bus stieg, fürchtete ich mich davor, jemanden zu sehen. Mit jemandem über den Unfall zu reden, war das Letzte, wonach mir der Sinn stand. Die Lowell Street ist eine Straße, in der das Leben in Zeitlupe abläuft. Helle Holzhäuser mit grünen Vorgärten und Einfahrten und sauber aufgereihten Briefkästen, die Menschen kennen einander und sind freundlich – alles hier sieht aus wie der Vorspann eines Films, den sich die ganze Familie bedenkenlos an einem Sonntagnachmittag im Kino anschauen kann. Autos, die sich hierher verirren, werden mit argwöhnischen Blicken bedacht. Boston ist ganz woanders. Die wirklich schlimmen Gegenden der Stadt sind nicht bei uns. Es ändert sich nicht viel. Niemand will das Gewohnte aufgeben und so war es wohl schon damals gewesen, als wir hergezogen sind. Vielleicht hat es meine Mutter damals gerade deswegen hierher verschlagen.
Mit eiligen Schritten brachte ich den Weg von der Haltestelle bis nach Hause hinter mich.
Die Kopfhörer in den Ohren verhinderten, dass mich jemand ansprach. Hier und da sah ich ein bekanntes Gesicht, aber alle hatten zu tun. Vorgartengeschäftigkeit, Familienzeugs.
Mr Koslowski, unser Vermieter, mähte den Rasen, als ich nach Hause kam. Er liebte es einfach, den Rasen zu mähen, so war das schon immer gewesen. Es war sein ganz persönliches Ritual. Sobald die Sonne ihre Nase durch die Wolken steckte, hörte man, manchmal sogar schon frühmorgens, das laut scheppernde Geräusch des sich öffnenden Garagentors, gefolgt vom ebenso nervigen Rumpeln des Rasenmähers in der Einfahrt und dem lauten, tiefen Brummen, wenn der Benzinmäher angelassen wurde. An schönen Tagen begannen meist schon kurze Zeit später überall in der Nachbarschaft die Rasenmäher aufzuheulen. Genau so ist die Lowell Street.
Mr Koslowski jedenfalls war nett. Auch heute trug er die blaue Latzhose, die seinen dicken Bauch zur Geltung brachte, und eine Sonnenbrille. Als er mich sah, machte er den Mäher aus.
Ich teilte ihm mit, was passiert war. »Mom wurde heute angefahren. Sie ist ins Koma gefallen.«
Er nahm die Sonnenbrille ab, seine Hand zitterte dabei. Er war ganz bleich, starrte mich an, aufrichtig schockiert. »Das ist schrecklich!« Damit brachte er es zumindest auf den Punkt. »Oh, Jack«, sagte er. »Oh, Jack.« Dann klopfte er mir auf die Schulter und nickte dabei ernst. »Wir schaffen das schon.« Mr Koslowski war nicht gerade jemand, der viel redete. Er wusste das und ich wusste das. »Sie schafft das schon.« Schon als ich noch ganz klein gewesen war, hatte er mich getröstet. »Wir müssen nur fest daran glauben, weißt du!«
»Ja, vielleicht.«
Er seufzte. »Kopf hoch, Jack.«
Ich erzählte ihm nichts von dem Gesicht, das Dr. Geiger gemacht hatte; auch nichts von dem Tonfall, in dem er mit mir gesprochen hatte. Lügen können einen manchmal trösten.
»Ich geh nach oben«, meinte ich.
Er nickte. »Ist gut. Wenn ich was für dich tun kann … Du weißt, wo du mich findest.«
Wir sahen einander an und dieser Moment war tausendmal angenehmer und ehrlicher als die Zeit mit Parker im Wartezimmer.
Mr Koslowski stand noch immer fassungslos neben seinem Rasenmäher, als ich die Tür hinter mir ins Schloss fallen ließ.
Das Treppenhaus war schattig, auf den Stufen hatte Mr Koslowski Teppichbodenstücke befestigt, damit niemand geweckt wurde, wenn jemand spätnachts nach Hause kam. Die Post lag auf der unteren Treppenstufe; wie es aussah, nur ein paar Rechnungen, ein Katalog für Yoga-Klamotten und der Boston Herald.
Hinter mir knatterte der Rasenmäher wieder los. So war das in der Lowell Street, so war es überall. Schlimme Dinge passieren, aber das Leben geht weiter.
Unsere Wohnung befand sich im ersten Stock. Parker Bracknell wohnte nicht bei uns. Noch nicht. Nie, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ. Die Erinnerung an die unzähligen Gespräche, die Mom und ich deswegen geführt hatten, ließ mich auf der Stelle wieder wütend werden.
Ich schloss die Wohnungstür auf und fühlte mich ohnmächtig und hilflos und immer noch wütend und traurig. Wie oft hatten wir seinetwegen gestritten? Dass ich Parker nicht mochte, war so was wie ein offenes Geheimnis zwischen uns. Sogar Parker hatte das kapiert. Keine Ahnung, was genau da zwischen uns war. Er war immer so beherrscht, so glatt. Ganz anders als Mom. Parker war vernünftig, Mom war emotional. Man konnte mit Parker nicht streiten, er ließ sich nie aus der Reserve locken. Dass er in nächster Zeit bei uns einziehen würde oder die beiden sich eine gemeinsame Wohnung suchen wollten, wahlweise mit mir oder ohne mich, hatte in der letzten Zeit mehr als ein Mal dazu geführt, dass ich die Beherrschung verloren hatte. Die unzähligen Ratschläge, die Parker mir ungefragt bezüglich meiner Zukunft geben zu müssen glaubte, nicht mitgezählt. Jetzt tat es mir einfach nur leid, so viel Zeit mit derart unwichtigem Zeug vergeudet zu haben.
Ich ließ meinen Rucksack im Korridor liegen, ebenso die Post, streifte die Chucks ab und ging in die Küche. Ich trank Leitungswasser vom Wasserhahn und wanderte anschließend ziellos in der Wohnung umher.
Die Stille war lauter als sonst. Alles war auf einmal so anders. Mechanisch räumte ich die Spülmaschine aus und sortierte Geschirr, Gläser, Tassen und Besteck in die Wandschränke und Schubladen ein. Während ich das tat, dachte ich an rein gar nichts. Die Wohnung war plötzlich zu einer Ansammlung von Räumen geworden, in denen jemand fehlte. Von draußen hörte ich den Rasenmäher. Es war verdammt beruhigend, ihn zu hören.
Dann, langsam, fast ehrfürchtig, ging ich in Moms Zimmer. Fast mein ganzes bisheriges Leben hatte ich diese Wohnung mein Zuhause genannt. Vier Zimmer, Küche, Bad plus Dachboden, Keller und Balkon.
Mom war von Portland nach Boston gezogen, nachdem Carter Fallon, mein Vater, eines Tages einfach so abgehauen war – und sie sitzen ließ, im siebten Monat. Das jedenfalls war der Teil der Familiengeschichte, von dem meine Mutter mir erzählt hatte. Der Rest bestand aus nichtssagenden Anekdoten und vagen Andeutungen, keine einzige davon mehr als ein verwackelter Schnappschuss, und, darüber hinaus, gab es nur ein einziges Foto von ihm, das noch nicht einmal besonders scharf war.
»Erzähl mir von ihm«, hatte ich meine Mutter früher nicht nur einmal gebeten.
»Man konnte sich nicht auf ihn verlassen.« Das war alles. Mehr ließ sie sich nie entlocken.
»Wie war er?«, versuchte ich ein andermal nachzuhaken.
»Du bist nicht wie er«, hatte sie lächelnd erklärt.
»Aber ich sehe aus wie er.« Diesmal wollte ich nicht lockerlassen.
Doch sie hatte mich nur auf die Stirn geküsst und geflüstert: »Das hat nichts zu bedeuten.«
Als ich klein war und wenn sie sauer war, weil ich etwas angestellt hatte, war mir manchmal in den Sinn gekommen, dass sie eigentlich auf ihn sauer war.
Pech!
Das brachte alles auf den Punkt.
»Wo hast du ihn kennengelernt?«, wollte ich später wissen.
»Frag nicht.«
»Warum sagst du nie, was passiert ist?«
»Irgendwann erzähle ich dir alles.« Sie war mir immer ausgewichen, wenn es um ihn ging.
Und jetzt?
Ich ging in ihrem Zimmer auf und ab, rastlos. Es war ein Erkerzimmer mit Blick zur Straße. Ich war nicht oft in diesem Zimmer. Hierher zog Mom sich zurück, wenn sie allein sein wollte. Trotzdem war mir das Zimmer vertraut. Es roch noch genau so, wie es früher gerochen hatte, als ich auf dem Boden mit meinen Star-Wars-Figuren und den Transformer-Sachen gespielt und Mom am Schreibtisch gesessen und ihren Kram gemacht hatte.
Ich sah mich um. Ein Regal mit ein paar Büchern und den Steinen, eine alte Couch, ein Plattenspieler. Sie hatte eine Platte von Bruce Springsteen aufgelegt; gestern Abend musste das gewesen sein, heute Morgen hatte sie nur Radio gehört.
Born in the U.S.A.
Beiläufig betrachtete ich das Cover, dann schaltete ich den Plattenspieler ein, setzte die Nadel auf die Platte und ließ sie sich drehen. Sofort füllte sich der Raum mit Musik.
An der Wand hing ein Gemälde, das eine Küste zeigte, schroffe Felsen, auf denen hohe Bäume wuchsen, leichter Dunst lag über allem, man konnte die Kälte spüren, wenn man das Bild lange genug ansah. Auf dem Meer, vor der Küste, fuhren zwei Männer in einem Kanu. Wir hatten die Ferien früher oft in Maine verbracht, an Orten wie Searsport, Port Clyde und Rockland, und später, als ich älter war, auf Mount Desert Island.
Ich seufzte.
Warum war ich hier? Warum hing ich allein in der stillen Wohnung herum? In Moms Zimmer? Ausgerechnet.
Ich hätte mich mit Steve und den anderen Jungs treffen können, um skaten zu gehen oder einfach nur in Mels Drivein abzuhängen. Aber dann hätte ich alles erzählen müssen. Ich könnte Mr Chambers anrufen und ihn bitten, mich für ein paar Schichten in Randy’s Bar einzuteilen. Ich könnte mir ein paar Serien am Laptop reinziehen, bis ich einschlief. Mich betrinken. Elend lange joggen gehen. Die Zeit an den Geräten im Fitnessklub am Prospect Hill totschlagen.
Blieb noch Amanda, mit der ich seit einem halben Jahr nicht mehr zusammen war. Wir sahen uns noch jeden Tag in der Schule und mieden uns nicht unbedingt. Sich bei ihr auszuheulen, kam aber nicht infrage. Niemals! Wir waren über ein Jahr zusammen gewesen, dann hatten wir uns getrennt. Okay, ich hatte mich von ihr getrennt. Sie war einfach nicht die Richtige gewesen.
»Man kann sich einfach nicht auf dich verlassen«, hatte sie mir immer wieder vorgeworfen. Und jedes Mal, wenn sie das sagte, hatte ich an Mom und Carter Fallon denken müssen.
Ich ging zum Fenster.
Eine Zeit lang stand ich einfach nur da und spürte die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht.
Unten schob Mr Koslowski stoisch den Mäher über den Rasen und prüfte sorgfältig jene Stücke, die bereits gemäht worden waren. Wenn er fertig war, würde er noch mit einer Gartenschere die Ränder des Rasens schneiden, damit auch alles ordentlich und symmetrisch aussah.
Alleinsein fühlte sich kalt an.
Stille, trotz der Musik.
Pech!
»Wie sehen deine Zukunftspläne aus?«, hatte Parker mich oft gelöchert.
»Keine Ahnung.«
»Du bist in einem Alter, in dem du langsam eine Ahnung haben solltest.«
»Kann sein.«
»Die Highschool dauert nicht ewig.«
»Schon klar.«
»Deine Mutter macht sich Sorgen.« Ich hasste es, wenn er das sagte. »Das weißt du.« Ich hasste es, wenn er überhaupt etwas sagte. »Wir haben gestern über dich gesprochen.«
Ich fragte mich, wie Mom an einen Typen wie Parker Bracknell hatte geraten können. Er sah gut aus für sein Alter, gab sich sportlich und so, das ja. Das Problem war nur, dass er wusste, dass er gut aussah und sportlich war. Ansprechen durfte man Mom allerdings nicht darauf (ein Fehler, der mir regelmäßig unterlaufen war in den letzten Wochen).
»Wenn ich mit Parker zusammenziehen will, dann ist das, verdammt noch mal, allein meine Sache«, hatte Mom betont und dabei fast geschrien. Sie fluchte selten, normalerweise. »Und wenn ich mich von Parker trennen möchte, dann ist das auch meine Sache. Alles, was ich tue, ist, verdammt, verdammt noch mal, meine Sache.« Manchmal, wenn sie wütend war, warf sie mit Sachen nach mir: einem Kleidungsstück, einer Zeitschrift, einer Scheibe Toast.
»Wenn er bei uns einzieht«, hatte ich wütend geantwortet, »dann ist es auch meine Sache.«
»Du kannst ausziehen.«
»Worauf du dich verlassen kannst …«
Das war meistens der Punkt, an dem sie ruhiger geworden war. »Jack, bitte, sei nicht so …«
»Wie denn?«, herrschte ich sie an.
»Nicht … so.«
»Ist meine Sache, wie ich bin.« Selten hatte ich sie dabei angesehen, nicht direkt, jedenfalls.
Sie versuchte es auf die ruhige Art. »Parker ist okay.«
»Wenn für dich okay ausreicht, bitte«, hatte ich ihr gesagt. »Mir reicht es nicht.«
»Jack!«
Immer dasselbe …
So jedenfalls verliefen unsere Gespräche in letzter Zeit meistens. Jeder von uns sagte etwas, das den anderen verletzte. Und dann tat es uns leid.
»Er kann dir helfen.«
»Wobei?«
»Einen Job zu finden.«
»Hat bisher immer ohne ihn geklappt.«
»Er kennt sich aus.«
»Womit?«
»Mit der Welt da draußen. Der Arbeitswelt.« Das war Parkers Wort dafür.
»Ich brauche ihn nicht. Für nichts. Okay?!«
»Aber ich«, hatte sie gesagt, »ich brauche ihn.«
Ich wusste natürlich, dass sie irgendjemanden brauchte. Parker war nicht der erste Freund, den sie hatte. Einige von ihnen waren richtig nett gewesen. Mehr als nur okay. Parker war das nicht.
Ich schloss die Augen, atmete tief ein und schnell aus, öffnete sie wieder.
Neben mir auf dem Schreibtisch lagen Rechnungen, die alle mit roten Haken versehen waren, ein Briefumschlag, ein Buch, in dem ein Lesezeichen steckte. Caretakers von Tabitha King. Ein Taschenbuch, alt, kaputt und abgegriffen. Tiefblauer Hintergrund, Schnee, der Schattenriss eines Mannes mit Mütze und Holzfällerjacke, eine Frau, hinter ihr ein Haus.
Ich starrte das Buch an und das Lesezeichen und plötzlich musste ich daran denken, wie oft Mom es gelesen hatte. Dann fiel mir ein, dass sie nie wieder lesen würde, und die Tränen, die heiß und brennend waren, überraschten mich selbst. Auf Lügen kann man sich eben nicht immer verlassen. Durch das Buch hindurch sah ich den Schattenriss des Krankenzimmers und die Geräte und Schläuche, ich konnte die Geräusche auf der Intensivstation hören, das stetige leise Piepsen, und ich wusste, dass manche Dinge gewiss waren und dass nichts sie zurückbringen würde. Verdammt, ich wusste es, weil der Arzt mich angesehen hatte wie jemanden, dem er nicht mehr helfen konnte, mit diesen bedauernden Augen, mit denen er schon unzählige Angehörige angeschaut hatte, und …
Dann blieb mein Blick an dem Briefumschlag hängen. Der Moms Handschrift trug.
Normalerweise schrieb meine Mutter keine Briefe; Geschäftspost erledigte sie auf dem Laptop, aber das hier war kein ausgedruckter Briefumschlag.
Laut schluchzend und peinlich berührt, obwohl niemand da war, wischte ich mir die Tränen vom Gesicht.
Ich nahm den Brief in die Hand, drehte ihn hin und her. Er fühlte sich schwer an. Die Buchstaben waren elegant geschwungene Bögen in dunkelblauer Tinte, niedergeschrieben mit dem Füllfederhalter, der auf dem Schreibtisch lag. Ich las den Namen, der darauf stand:
John Gilbert Seals Head
Keine Straße, kein Postfach, keine Postleitzahl.
»Seals Head Harbor.« Meine Stimme klang fremd in meinen Ohren. Und doch war mir der Klang dieses Ortes vertraut.
Schon immer habe ich jeden Hinweis auf Moms Vergangenheit aufgesogen und so wusste ich, dass sie früher wohl einmal dort gelebt hatte. Sie hatte mir erzählt, dass sie auf der Durchreise gewesen sei und nur eine Saison lang dort gearbeitet hätte, um Geld für die Weiterreise zu verdienen. Aber der Name John Gilbert war nie gefallen. Es waren nie Namen gefallen. Keine, an die ich mich erinnern konnte.
»John Gilbert.«
Nein, der Name sagte mir gar nichts.
Ich drehte den Brief hin und her, hielt ihn ins Licht. Er war dick. Es musste ein langer Brief sein. Er hatte ordentlich auf dem Tisch gelegen, wie alles, was schnell zu erledigen war. Warum hatte sie ihn nicht abgeschickt? Sie hätte ihn heute auf dem Weg zur Arbeit einwerfen können.
Sollte ich ihn öffnen?
Durfte ich ihn öffnen?
Nein, das war ihr Brief (oder seiner, John Gilberts). Was immer auch in dem Brief stehen mochte, es war für ihn allein bestimmt. Es gehört sich nicht, einen Brief zu öffnen, der für jemand anders bestimmt ist, so viel war mal klar. Nicht umsonst hatte sie ihn verschlossen.
Ich ließ mich auf die Couch fallen. Den Brief hielt ich noch immer in der Hand.
Okay, und jetzt?
John Gilbert …
Erneut kramte ich in meiner frühen Kindheit herum und suchte den Namen, ohne Erfolg.
Warum hatte sie ihm diesen Brief geschrieben? Wer war er? Was sollte das alles? Ein Brief an jemanden in Seals Head Harbor? Caretakers? Das Album von Bruce Springsteen? Alles gehörte in die Zeit, in der Mom jung gewesen war.
»Erzähl mir doch von meinen Großeltern!«, hatte ich manchmal gefordert.
»Warum?«
»Du hast mir noch nie von ihnen erzählt.«
»Was vergangen ist«, hatte Mom gesagt, »das ist vorüber.«
»Aber …«
»Sie sind tot.«
»Das ist alles?«
»Dein Großvater hatte einen Unfall, deine Großmutter eine Krankheit.«
Als Kind hatte ich oft versucht, in Erfahrung zu bringen, wo sie herkam. Was vor Portland gewesen war.
»Wo haben sie gelebt?«
»An der Küste.«
»Wo?«
»In Maine.«
»Dort, wo wir im Urlaub waren? Zeigst du’s mir mal?«
»Ich bin von dort weggegangen, um nicht mehr darüber reden zu müssen.« Damit waren Gespräche dieser Art meistens beendet gewesen. Es war nie möglich gewesen, ihr mehr zu entlocken.
»Aber wenn ich es wüsste, dann …«
»Was würde das ändern? Wir leben hier.«
»Aber …«
»Hier und jetzt, Jack. Das ist alles, was zählt.«
Ich rieb mir die Augen, weil sie unangenehm brannten. Ich fühlte mich müde, schwach, leer.
Mir wurden mit einem Mal wieder all die Lücken in meiner Vergangenheit bewusst.
Was, wenn John Gilbert ein Teil jener Jahre gewesen war, von denen sie mir nie hatte erzählen wollen?
»Das ist verrückt«, sagte ich laut.
Der April ist ein trügerischer Monat.
Ich sprang auf und ging wieder rüber zum Schreibtisch, setzte mich, legte den Brief neben das Buch und den Laptop.
Draußen verebbte das Rasenmähergeräusch. Ich trat die Flucht nach vorne an.
3.
Ich fuhr den Laptop meiner Mutter hoch, ging online. Ich überprüfte den Browserverlauf – und hatte Glück.
»Wow«, flüsterte ich.
Sie hatte tatsächlich nach ihm gegoogelt. Sie war mir zuvorgekommen.
John Gilbert.
Kein Zweifel …
Ich folgte den Links und eine Homepage öffnete sich:
The Seal and the Lobster.
Ein Gemischtwarenladen, oben in Seals Head Harbor.
Sie suchen es – wir haben es!
Guter Slogan! Man konnte sogar online bestellen. Angelzeug, Klamotten, Werkzeug, Haushaltsbedarf, Nahrungsmittel, alles Mögliche; so wie es aussah, gab es in der Gegend keinen Baumarkt. John Gilbert war im Impressum als Inhaber aufgeführt. Ich klickte weiter und fand eine ganze Reihe Fotos, hauptsächlich von hiesigen Festen. John Gilbert schien in der kleinen Gemeinde einen festen Platz zu haben. Ich studierte die Titel der Fotos. Es gab dort jede Menge Festivals. Typisch Neuengland: Hummer, Blaskapellen, Sommerurlauber, Kutter, Fische. John Gilbert schien in Moms Alter sein.
Die A-Seite der Schallplatte war zu Ende.
Ich stand auf und drehte die Scheibe um, setzte die Nadel auf. Kaum zu glauben, wie umständlich es damals gewesen sein musste, Musik zu hören. No Surrender hieß der nächste Song.
Dann kehrte ich zum Laptop zurück und klickte mich zur Homepage des Ortes vor.
Alles dort sah nach den Sommerferien meiner frühen Kindheit aus. Möwen. Meer. Fischkutter, Boote, Wälder, Klippen, Stege, Holzhäuser. Schön!
Nur was hatte das alles mit meiner Mom zu tun?
Wie oft hatte ich ihr gesagt, sie solle vorsichtig sein, den Browserverlauf löschen und ihre Accounts schließen? Jetzt war ich erleichtert, dass sie nicht auf mich gehört hatte. Ihr Facebookprofil hatte sich automatisch geöffnet, nachdem ich den Laptop hochgefahren hatte. Jetzt sah ich, dass sie auch dort nach John Gilbert gesucht hatte. Und was viel wichtiger war: Sie hatte ihn gefunden. Eine Freundschaftsanfrage hatte sie aber keine versendet.
»Hm.« Außer seinem allgemeinen Profil konnte ich nichts lesen.
Schade …
»Keine Freundschaftsanfrage …«
Warum?
Wäre es nicht einfacher gewesen, ihm eine Mail zu schicken? Normalerweise war Mom dem Chatten und Mailschreiben nicht abgeneigt. Es sei denn …
»Es war so wichtig, dass nur ein Brief infrage kam.« Ich lehnte mich zurück.
I’m goin’ down.
Bruce Springsteen hatte sie schon lange nicht mehr gehört. »Warum hast du gerade jetzt diese Platte gehört?«, fragte ich laut in den Raum hinein. »Hast du sie gehört, als du den Brief geschrieben hast?«
Meine eigene Stimme kam mir unecht vor. Mit ihr zu reden, selbst hier, war besser, als zu schweigen. Ich stand auf und ging zum Plattenspieler, schnappte mir das Album, drehte die Plattenhülle um.
© 1984 Bruce Springsteen stand dort.
Mom hatte damals irgendwann meinen Vater kennengelernt. Irgendwo oben an der Küste. In Seals Head, womöglich? Sie waren nach Portland gegangen und dann … hatte er sie sitzen lassen.
Mehr Puzzlesteine hatte ich nicht. Mehr Puzzlesteine hatte Mom mir nie zugestanden.
Was würde mir John Gilbert erzählen können? Die Geschichte von Mary und Carter Fallon?
Ich ertappte mich dabei, wirklich ernsthaft über die Idee nachzudenken, nach Seals Head Harbor zu fahren. Hier würde mir sowieso nur die Decke auf den Kopf fallen. Hier würden sich meine Freunde jeden Tag in der Schule nach Mom erkundigen.
Ich musste raus aus der Stadt. Eigentlich war es keine Frage. Jeden Tag im General aufzutauchen, würde mich fertigmachen.
Alles andere auch.
Ein paar Tränen versuchten, mir erneut die Kehle zuzuschnüren. Ich holte tief Luft.
»Was soll ich tun?« Ich richtete die Frage hoffnungsvoll an das Bild mit den beiden Kanufahrern.
Beide schwiegen.
Typisch Maine …
Ich schloss die Augen und atmete durch. Ein Rucksack voller Klamotten würde ausreichen. Ein paar Tage fortgehen, einfach so.
Verrückt! Ich konnte doch Mom nicht im Stich lassen. Nur was konnte ich hier für sie tun? Würde Parker meine Hilfe benötigen? Die Frage überraschte mich selbst. Wo war er jetzt? Wie ging er mit der Sache um? Sollte ich ihn anrufen?
Meine Gedanken drehten sich zu Glory Days im Kreis.
Was sollte ich tun?
Am Ende tat ich das, was ich in Situationen wie dieser seit Jahren tat. Ich rief Steve an.
»Alter, du musst mir zuhören.«
»Jack?«
»Hast du Zeit?«
»Ich hab gepennt. Wie spät ist es denn?«
Ich sagte es ihm. Steve jobbte im Schichtdienst als Lagerarbeiter bei einer Baufirma. Wir waren seit der Grundschule befreundet und besuchten die meisten Kurse in der Highschool gemeinsam.
»Was, in aller Welt, hörst du da?«
»Bruce Springsteen.«
»Born in the U.S.A.?«
»Ja.«
»Alles okay bei dir?«
»Nein. Nichts ist okay. Ich verschwinde für ein paar Tage.«
Eine kurze Pause. »Du machst mir Angst.« Ich konnte mir vorstellen, wie er sich die Augen rieb.
Ich machte den Plattenspieler aus. My Hometown stoppte in der Mitte.
»Was heißt das, du verschwindest?«, hakte er nach. »Was heißt das, nichts ist okay?«
»Meine Mom wurde angefahren und liegt im Koma.«
Pause.
»Es sieht nicht gut aus.«
Ich konnte hören, wie er schwieg, so laut war er noch nie gewesen.
»Es sieht sogar ausgesprochen …« Die Stimme versank im Ozean all dessen, was gerade war.
»Scheiße, Mann.« Der Rest war Sprachlosigkeit.
Ohne abzuwarten, erzählte ich ihm von dem Brief und meinem Vorhaben. So fand ich immerhin meine Fassung zurück, irgendwie.
»Du willst nach Maine?«
»Für ein paar Tage.«
»Ohne Scheiß? Nach Maine?«, vergewisserte er sich ungläubig.
»Ja.«
»Du willst da rauf, um den Brief abzuliefern?«
»Du sagst es.«
»Alter, das ist völlig bescheuert. Wie lange bist du weg?«
»Ein paar Tage.«
»Ist das dein Ernst?«
»Vielleicht bleibe ich auch länger.«
Noch ungläubiger: »Länger?«
»Warum denn nicht …?«
Das verschlug ihm die Sprache.
»Vielleicht finde ich da oben einen Job.« Hatte ich das wirklich gerade gesagt?
»Alter, du hörst dich nicht wie der Jack Fallon an, den ich kenne. Du suchst dir einen Job in Maine?«
»Vielleicht.«
»Als Hummerfänger, oder was?« Er versuchte, komisch zu sein, wofür ich ihm dankbar war.
»Wer weiß.«
»Hey, jetzt dreh nicht durch, okay?« Er hörte sich ernsthaft besorgt an und ich fragte mich, wie ich reagiert hätte, wäre er plötzlich mit diesem Anliegen an mich herangetreten.
»Was sagt Parker dazu?«
»Scheiß auf Parker.«
»Und die Schule?«
»Ich meld mich krank.«
»Glaubst du, dass Spooky Mulder das schluckt?« Mr Moldow, mein Tutor, wurde von allen nur Spooky Mulder genannt.
»Ich sage ihm, was los ist. Dass ich mich um Mom kümmern will. Eine Auszeit brauche. Das wird er verstehen. Von Maine sage ich natürlich nichts.«
»Das ist vollkommen verrückt, Jack.«
»Ich dreh durch, wenn ich hierbleibe. Ich bin allein. Ich …«
»Du kannst ein paar Tage zu mir kommen.«
»Wenn Mom stirbt, dann …«
»Sie …«
»Steve-o«, unterbrach ich ihn. »Ich muss das tun.« Dass ich hoffte, dort vielleicht endlich mehr über meinen Vater zu erfahren, verschwieg ich.
»McCluskey wird dich umbringen.«
»Weil ich eine Woche vor dem Wettkampf verschwinde?«
»Trainer sind so.«
»Ich weiß.« Etwas Besseres fiel mir nicht ein.
»Wann willst du los?«
Darüber hatte ich mir, zugegeben, noch keine Gedanken gemacht. Instinktiv sagte ich: »Morgen.« Warum warten?
»Du könntest den Brief zur Post bringen. Du könntest den Typen anrufen.«
»Ich muss das tun«, sagte ich. »Ich will es tun.« In diesem Moment fühlte ich mich wie ein Verräter. Weil ich Mom hier allein zurückließ. Weil ich die erstbeste Gelegenheit ergriff, von hier abzuhauen. Und doch stimmte es, was ich da gerade sagte. Ich musste es tun. Es war das Einzige, was ich im Moment tun konnte.
Steve schwieg eine Weile. Schließlich sagte er: »Ich komme zu dir rüber und wir betrinken uns.«
Ich musste still lächeln. »Es geht nur nach Maine«, erklärte ich ihm. »Wahrscheinlich bin ich in ein, zwei Tagen wieder da.«
»Okay, okay.« Er seufzte.
»Ich wollte bloß nicht abhauen, ohne dir Bescheid zu geben.«
»Das ehrt dich. Ungemein.«
»Weiß ich.«
Stille.
»Hör zu, Steve-o, ich bin fertig. So richtig.« Das war immerhin eine ehrliche Antwort. »Ich kann nicht hierbleiben und den ganzen Tag darauf warten, dass das General anruft. Neben ihrem Bett sitzen kann ich auch nicht. Ich muss etwas tun. Du kennst mich.« Ich wusste, dass er es verstehen würde. Freunde tun das, einfach so, sie verstehen diese Dinge, auch dann, wenn sie sich vollkommen bescheuert anhören und man sie selbst nicht richtig versteht.
»Das General ist immerhin das beste Krankenhaus weit und breit«, sagte er, hörte sich aber nur halb so zuversichtlich an, wie es wohl beabsichtigt war.
»Ja«, stimmte ich ihm zu. »Ich weiß.« Eine Lüge kann guttun, manchmal. Es funktioniert aber leider nicht immer. »Ich weiß.«
Ein paar Sekunden lang schwiegen wir uns an.
»Hier geht’s auch noch um was anderes, oder?«, sagte Steve plötzlich.
»Ja.«
»Vergiss ihn.«
»Ich weiß noch immer nicht, wer er war.« Einmal mussten wir einen Aufsatz über unsere Väter schreiben, über ihre Jobs, so ein Zeug eben. Wir waren elf. Damals habe ich Steve zum ersten Mal von dieser Sache erzählt.
»Also tust du es deswegen.«
»Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hier wegmuss.«
»Okay.«
Schweigen.
»Ich melde mich«, versprach ich.
»Pass auf dich auf«, riet er mir.
»Geht klar.« Nichts anderes hatte ich im Sinn.
»Ich mein es ernst, Jack. Pass auf dich auf.«