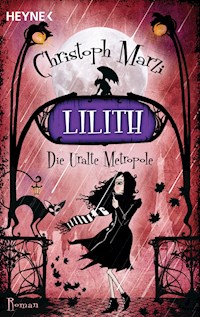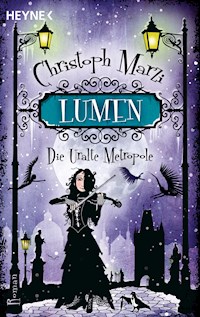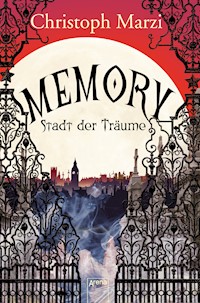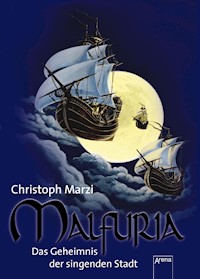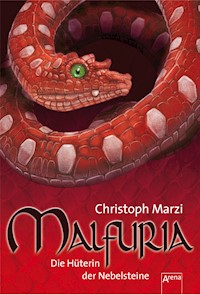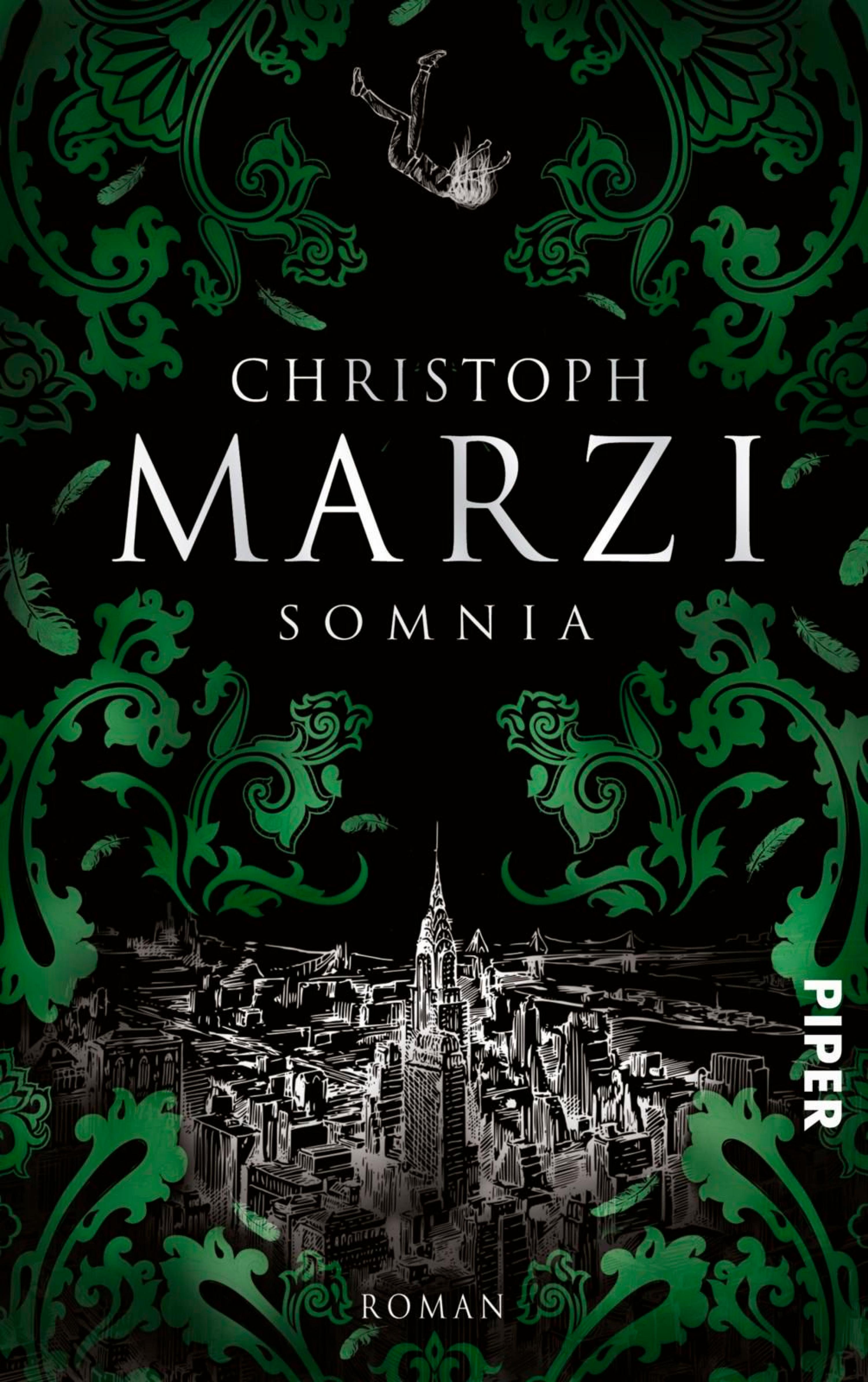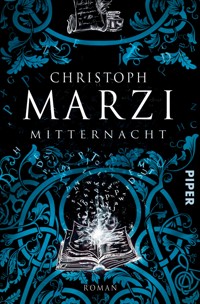
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es gibt einen Ort, an dem die Geister leben, eine Welt, die unsere berührt, eine Stadt, in der mit Geschichten und Alpträumen Handel getrieben wird. Ein Missgeschick lässt Nicholas James, den alle nur den »gewöhnlichen Jungen« nennen, diese Welt betreten – und alles ändert sich: Peter Chesterton, ein reisender Geist, nimmt sich seiner an. Das Findelgeistmädchen Agatha stiehlt sein Herz. Und etwas, das im Dunkeln lauert, gewinnt an Macht. Die Wege, die Nicholas beschreitet, führen ihn dorthin, wo alle Hoffnungen geboren und alle Träume gestorben sind, an einen Ort, den die Geister voller Ehrfurcht »Mitternacht« nennen. Eine Geschichte von der Macht der Bücher und der Gefahr des Vergessens, in einer Welt der Geister.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:www.piper-fantasy.de
© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nachwort
Für Dich, Tamara
(come what may)
»An idea, like a ghost, must be spoke to a little before it will explain itself.«
Charles Dickens
1
Alle Bücher träumen von Geschichten. Diesen Satz dachte Nicholas James, als er erwachte. Sie fürchten sich vor dem Vergessenwerden.
Der Gedanke fühlte sich fremd an, wie etwas, das eigentlich nicht ihm gehörte, aber dennoch zu ihm gekommen war wie ein Fundstück, über das man zufällig stolpert, während man abwesend an etwas ganz anderes denkt. Er öffnete die Augen und blinzelte in die schattenhelle Kajüte, die ihm selbst jetzt, in der Nacht, vertraut war. (Kein Wunder, sie war auch nicht besonders groß.) Das Licht der Straßenlaterne vom Uferweg flutete sanft die Stille und streifte das Durcheinander in der schmalen und engen Behausung gemeinsam mit dem Mondlicht, das sich nicht von den Gardinen einfangen ließ. Durch das gekippte Fenster wehte kühle Luft herein, das leise Plätschern des Wassers im Kanal und die fernen Nachtgeräusche von Camden Town im Schlepptau. Benommen dachte Nicholas zuerst an das Notizbuch, das drüben auf dem Esstisch lag und das er mit einem Roman, seinem zweiten, zu füllen gedachte. Das, was er gerade gedacht hatte, würde bestimmt einen guten Anfang für einen Roman abgeben. Alle Bücher träumen von Geschichten. Er überlegte, ob er aufstehen sollte, um den Satz zu notieren, doch lieber gähnte er und blieb liegen. Dann dachte er an den Traum, den er gerade vergessen hatte. Das tat er eigentlich fast immer: Er träumte – und dann vergaß er, wovon er geträumt hatte, aber er spürte, dass da bis vor wenigen Augenblicken noch ein Traum gewesen war und ihn beschäftigt hatte. Kurz fragte er sich, ob dieser Satz womöglich aus jenem frisch vergessenen Traum stammte. Egal! Er lächelte verschlafen und zufrieden, drehte sich auf dem schmalen Bett zur Seite und knüllte sich das Kopfkissen bequem.
In dem Moment bemerkte er die Silhouette des Mannes, der neben seinem Bett stand und ihn beobachtete. Das war der Augenblick, in dem sich sein Leben änderte und die Dinge ins Rollen kamen.
»Wer sind Sie?« Nicholas setzte sich ruckartig auf. Das Herz schlug ihm auf einmal bis zum Hals.
Der Mann, der nur ein Schatten und darüber hinaus noch sehr dünn war (ein dünner Schatten, könnte man sagen), erschrak ebenfalls. So jedenfalls schien es. Er fuhr zurück, ein wenig nur, machte aber keine Anstalten abzuhauen. »Niemand«, sagte er leise. Eine Stimme wie Honig, Whiskey, Sturm. Er klang überrumpelt. War das etwa ein Akzent? Schottisch? Nicholas James erkannte die Sprache seiner Heimat, auch wenn jemand die Sprachmelodie zu verbergen versuchte.
»Was tun Sie hier?«
Der dünne Schatten kam näher. Er hatte stechend blaue Augen in einem hageren Gesicht, zornig aussehende Brauen, dazu weißes Haar, widerborstig hoch stehend, und dennoch eine elegante Erscheinung, fast ein Gentleman aus dem Fernsehen.
»Das ist wirklich bemerkenswert«, murmelte der Besucher. »Hm, in der Tat.« Er sah sehr streng aus, irgendwie ungeduldig. Und neugierig hinter der Aura des Geheimnisvollen. »Er kann mich sehen?« Die Frage galt wohl ihm selbst. »Nein, das ist nicht möglich.«
Was sollte der Blödsinn?
»Doch, es ist möglich«, betonte Nicholas, noch immer verschlafen, wenngleich ein wenig wacher als vorhin. Der Mann schüttelte energisch den Kopf. »Das muss ein Irrtum sein.« Dann hielt er inne, zweifelnd: »Andererseits ist es offenbar doch möglich. Ein Rätsel.« Er betrachtete Nicholas, als sei der eine Kuriosität, und fuchtelte wie ein Magier mit den Händen vor seinem Gesicht herum.
»Lassen Sie das«, herrschte Nicholas ihn an. »Sie haben hier nichts zu suchen. Wer sind Sie?« Er fühlte sich bedrängt, irgendwie überfallen, dem ungebetenen Eindringling ausgeliefert. Wer war der Kerl und was wollte er von ihm? Hatte er ihn beobachtet? Wie lange stand er schon da neben dem Bett? Wo kam er her? Warum wirkte er so ganz und gar nicht wie ein Einbrecher? Und überhaupt, was sollte er bei ihm stehlen? Zu guter Letzt die wichtigste Frage: War der Kerl gefährlich?
»Noch einmal.« Nicholas versuchte, wütend und beherrscht zu klingen. »Wer sind Sie?«
Der dünne, elegante Schatten nahm Haltung an. »Sie haben sich geirrt«, sagte der Fremde mit fester Stimme.
Nicholas rieb sich die Augen. Das war doch verrückt. Worin sollte er sich geirrt haben?
»Ich bin gar nicht hier.«
Was sollte das denn nun wieder?
»Natürlich sind Sie hier«, sagte Nicholas und gab sich Mühe, hinreichend wütend zu klingen.
»Nein, bin ich nicht.«
»Ich kann Sie sehen.« Nicholas fand, dass dies ein sehr gewichtiges Argument war.
Der Fremde winkte ab. »Sie haben ja noch den Schlaf in den Augen.«
»Was hat das denn damit zu tun?«
»Glauben Sie mir, Sie haben sich geirrt. Ich bin gar nicht hier.«
Nicholas rieb sich noch mal die Augen.
»Nie gewesen …«
»Was …?«
Da war niemand mehr.
Wie konnte das sein?
Nicholas knipste das Licht an, dann sprang er aus dem Bett, stieß sich den Kopf an der niedrigen Decke und fluchte. Sein Atem ging schnell, er zitterte. Er schaute sich um: So schnell konnte niemand aus der Kajüte verschwinden, unmöglich.
Ich bin gar nicht hier.
Die Stimme hallte in der Stille wider wie ein Echo.
Nie gewesen …
Nicholas begutachtete die Kajüte. Die Tür nach draußen war verschlossen. Wie also war der Fremde hier heraus gekommen (und wie hinein)? Die Antwort: Gar nicht! Etwa, weil er gar nicht da gewesen war? Hatte er sich das alles doch nur eingebildet? Wenn ja, dann war dies der intensivste Traum gewesen, den er je gehabt hatte (und zudem auch noch einer, an den er sich erinnerte). Wäre Erika jetzt bei ihm, dann hätte ihr Geschrei ohne Zweifel die Nachbarn in den anderen Booten geweckt und irgendwer würde jetzt von draußen gegen das Fenster klopfen und sich erkundigen, ob alles in Ordnung sei auf der Dorian Gray (das war der Name von Nicholas’ Hausboot). Aber Erika war nicht hier. Sie hasste das Hausboot (»Es ist zu eng für alles«, pflegte sie zu sagen, und: »Das ist kein Bett, sondern ein Sarg; viel zu eng für alles.«). Nicholas rieb sich erneut die Augen. Er könnte sie anrufen und ihr schildern, was er erlebt hatte, aber würde sie ihm glauben? Wohl kaum. Er seufzte noch einmal, diesmal laut in die Stille hinein – weil laut zu seufzen manchmal guttat.
Eine Freundin zu haben, die nicht immer da war, konnte von Vorteil sein. Jetzt aber wünschte er sich, sie wäre hier. Sie hätte den schattenhaften Besucher gesehen und laut geschrien, was nervig gewesen wäre und die Nachbarn alarmiert hätte, aber dafür hätte er die Gewissheit gehabt, dass da wirklich jemand gestanden hatte. Jetzt zweifelte er an sich selbst.
»Du hast dir den Mann nur eingebildet«, würde Erika ihm antworten und nicht ohne einen Hauch von Herablassung hinzufügen: »Das macht nur dein Schriftstellergehirn.« Genau deswegen rief Nicholas sie jetzt nicht an. Es wäre uncool. Sie würde spüren, dass er aufgeregt war, und dann würde sie ihm verkünden, wie unmännlich es ist, sich vor seinen eigenen Träumen zu fürchten und erst recht vor geisterhaft auftauchenden Gestalten. Es könnte eine dieser Reden über ihr Rollenverständnis von Männern und Frauen folgen, die ihn langweilten, seitdem er herausgefunden hatte, wie gerne sie sich selbst reden hörte. Nein, es war gut, dass sie nicht hier war
»Hallo?«
Blöde Frage. Wer sollte denn antworten?
»Whoopie?« Die Katze lag auf ihrem Kissen am Fenster und schlief. Sie hatte also niemanden gehört.
Nicholas rekelte sich und gähnte. Er schlurfte rüber ins Bad, das aus kaum mehr bestand als einer Toilette, einer sehr kleinen (und für ihn etwas zu kurzen) Badewanne und einem Waschbecken, die durch eine Tür vom Rest der Kajüte abgetrennt waren, und zwar am Bug des Hausboots. Dort starrte er in den Spiegel: rotblondes Haar, das wie vom Wind verweht aussah, verdreht und lockig (dabei war Nicholas eindeutig Schotte), hellbraune Augen, müde, aber dennoch wachsam (das Herz schlug ihm noch immer wie wild in der Brust), in den Mundwinkeln ein ungläubiges, skeptisches Hm-tja.
Mit ein wenig Photoshop könnte man aus dem Gesicht den »gewöhnlichen Jungen« zaubern. Er dachte daran, wie sehr Erika sein offizielles Autorenfoto mochte. Bisher gab es nur dieses eine – sehr intellektuell in weich gezeichnetem Schwarz-Weiß.
Nicholas pinkelte und ging dann ins Bett zurück. Sein Herz schlug jetzt nicht mehr ganz so schnell wie vorhin. Er schaute aus dem Fenster. Draußen auf dem Uferweg war alles ruhig. Vermutlich hatte er sich das alles wirklich nur eingebildet. Nur ein Traum
Alle Bücher träumen von Geschichten.
In einem Traum in einem Traum.
Sie fürchten sich vor dem Vergessenwerden.
In einem Traum.
Sie haben sich geirrt.
In einem Traum.
Ich bin gar nicht da.
In einem Traum.
Vergessenwerden.
In einem Traum.
Gar nicht.
Da.
Nicholas knipste das Licht aus und hing noch eine Weile einem wild durcheinandergeratenen Geflecht aus Gedanken nach.
Sie haben sich geirrt.
Irgendwo im Dunkel der Kajüte schnurrte wie von fern die Katze.
Ich bin gar nicht da.
Nicholas wusste genau, welches Gesicht sie dabei machte.
Vergessenwerden.
Schließlich schlief er ein.
Früh am nächsten Morgen. Bevor Camden Town erwachte, schnatterten bereits die Enten auf dem Kanal. Sie waren immer die Ersten, die den Tag begrüßten, paddelten unter dem Fenster vorbei und sahen so aus, als würden sie geheime Pläne für den Tag schmieden. Die Enten waren die heimlichen Herrscher vom Regent’s Park, von Little Venice und überhaupt von all den Kanälen, die London durchzogen. Darüber hinaus herrschten sie auch über die meisten anderen Parks in der Stadt.
Das Hausboot, das Nicholas nun schon seit ein paar Monaten bewohnte, lag direkt am Uferweg hinter St. Martin’s Crescent und hier fühlte er sich daheim. Ein Zuhause, das zwei Meter breit und zwölfeinhalb Meter lang war, ziemlich eng, aber groß genug für das Leben, das er führte (und definitiv zu klein für das Leben, das Erika sich vorstellte). Drinnen war der Raum gerade groß genug für einen Tisch, zwei Stühle, einen Ofen, eine mickrige Küchenzeile mit Gasherd, dazu ein kleines Bad und, hinten im Heck, das Bett. Ein paar Bücher standen auf den wenigen Regalen, recht dürftig für jemanden, der das Lesen mochte (und das Schreiben). Aber seitdem er hier auf dem Hausboot lebte, hatte Nicholas sich angewöhnt, seine Bücher in der Bibliothek auszuleihen. Was es auf dem Hausboot nicht gab, war Platz.
Als er vor drei Jahren nach London gekommen war, hatte er auf einem anderen Hausboot gewohnt, doch Kadir Jones, der das Boot gemietet hatte, besaß keine Lizenz für einen festen Anlegeplatz. So etwas war teuer. Dann musste man alle zwei Wochen den Anker lichten und ein Stück den Kanal rauf- oder runterfahren, um sich einen neuen Platz für die nächsten beiden Wochen zu suchen. Das hatte den Vorteil, dass man sich frei fühlte und ein Vagabund auf den Kanälen war. Andererseits hatte man keinen festen Wohnsitz, was aber eigentlich nur dann zu einem Problem wurde, wenn man ein Päckchen erwartete.
»Wir sind Kanalnomaden«, pflegte Kadir oft zu sagen. »Die Wasserwanderer von London.«
Zugegeben, das klang romantischer, als es war. Aber es war auch romantischer, als man dachte.
Nicholas war aus Edinburgh nach London gekommen, um Sprachwissenschaften zu studieren, nicht ahnend, wie schwierig es sich gestalten würde, ein Dach über dem Kopf zu finden. Nichts von dem, was verfügbar war, konnte er sich leisten. Nichts von dem, was er sich leisten konnte, war verfügbar. Durch eine glückliche Fügung hatte er Kadir Jones kennengelernt, der auf einem Boot in Little Venice lebte. Dort zog Nicholas ein, erst mal nur für den Übergang, bis er eine Bude gefunden hätte. Am Ende hatte der Übergang fast zwei Jahre gedauert, eine Zeit, in der er sich vornehmlich mit diversen Jobs herumgeschlagen hatte und nur selten in den Vorlesungen aufgetaucht war. Kadir war geduldig, sie teilten sich die Miete für das Hausboot, und mit der Enge kamen sie gut zurecht, zumal sie aufgrund ihrer Jobs sowieso selten gleichzeitig da waren.
Dann, eines Nachmittags, hatte Nicholas damit begonnen, einen Roman zu schreiben, und die Geschichte floss ihm leichter von der Hand, als er es sich vorgestellt hatte. Die anderen Studenten, die Schreibkurse belegten, brüsteten sich immer damit, eine extrem schwierige Arbeit erledigt zu haben, aber Nicholas machte das Schreiben Spaß, und es schien weniger anstrengend zu sein als die Stunden, die er als Briefträger, Verkäufer oder Kellner verbrachte. Einen Roman auf einem Hausboot zu schreiben war jedenfalls eine feine Sache gewesen. Es hatte etwas herrlich künstlerisch Abenteuerliches.
»Außerdem kommt es fantastisch bei den Frauen an«, pflegte Kadir Jones zu sagen. Womit er nicht ganz unrecht hatte.
»Ich bin ein richtiger Bohemien«, stellte Nicholas James stolz fest. Es war ein gutes Gefühl, Schriftsteller zu sein.
»Glaubst du, dass du einen Verlag findest?«, wollte Kadir wissen.
»Zuerst muss ich die Geschichte beenden.« Nicholas glaubte fest daran, immer einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Eines Tages jedenfalls (der Roman war noch nicht fertig) legten sie genau hier, am Ufer hinter dem St. Martin’s Crescent an und Nicholas verbrachte die Nachmittage damit, oben an Deck zu sitzen, auf einem recht wackligen Klappstuhl vor einem nicht minder wackligen Gartentisch, und die Geschichte, die ihm nicht mehr aus dem Kopf ging, in ein einfaches Notizbuch zu schreiben. Er wusste, dass es Computer gab, und er hatte nichts gegen Laptops, aber beim Schreiben bevorzugte er das Gefühl, mit einem richtigen Stift auf richtigem Papier zu schreiben. Es wirkte einfach wahrhaftiger. Es tat gut und fühlte sich echt an.
Auf dem Hausboot, neben dem sie angelegt hatten (der Dorian Gray), saß an denselben Nachmittagen ein großer, beleibter Mann mit Laptop. Er schaute hin und wieder zu Nicholas rüber, sagte aber erst nach einer Woche etwas, abgesehen von einem gelegentlichen höflichen, aber knappen nachbarschaftlichen Gruß zwischen Bootsbewohnern.
»Ich habe dich beobachtet, Nachbar.« Genau so begann er das Gespräch. Er wirkte ruhig, nahezu behäbig, und schlau. »Mir ist nicht entgangen«, fuhr er fort, »dass du jeden Tag in ein Notizbuch schreibst.« Er stand auf dem Uferweg vor dem Boot, als Nicholas sein Fahrrad an Bord tragen wollte. »Ich erkenne einen Schriftsteller, wenn ich ihn sehe.« Er lächelte. »Die Geschichten stehen den meisten, denen sie einfallen, ins Gesicht geschrieben. Habe ich recht?« Bevor Nicholas etwas erwidern konnte, stellte der Mann sich ihm vor: »Ich bin Jonathan Fry.« Bereits beim nächsten Satz stellte sich heraus, dass er Lektor bei Pluckley House war. »Ich bin neugierig und immer auf der Suche nach Neuem, könnte man sagen.« Er lachte.
Nicholas wusste nicht so recht, was genau er meinte. Er ahnte natürlich, dass er Romanmanuskripte meinte, wurde das Gefühl aber nicht los, es könnte auch noch etwas anderes sein. »Wenn du möchtest, kann ich es lesen. Dein Manuskript. Wenn es fertig ist. Ganz wie du willst. Ich kann dir aber nichts versprechen, Nachbar. Wenn es schlecht ist, werde ich es dir sagen. Wenn es gut ist …« Wieder grinste er. »Nun ja, wenn es gut ist, dann ist alles möglich.«
Nicholas vertröstete ihn an diesem Tag, und im Lauf der nächsten Woche schrieb er die Geschichte fertig. Sie hieß Malvina und war keine zweihundert Seiten lang (sauber abgetippt in Word).
»Es ist eine Geistergeschichte«, sagte er, als er sie Mr. Fry überreichte. Er war extra mit dem Fahrrad zum Hausboot gefahren, um eine Kopie des Manuskripts zu übergeben, denn Kadir Jones hatte mittlerweile ablegen müssen und war erneut drüben in Little Venice vor Anker gegangen.
»Wie passend«, meinte Mr. Fry, der Zeitung lesend auf dem Dach der Dorian Gray saß.
Nicholas sah ihn fragend an.
»Dein Name. Nicholas James. Wie M. R. James.« Fry betrachtete die erste Seite. »Du weißt schon: Montague Rhodes James.« Er lächelte süffisant. »Nicht zu verwechseln mit E. L. James.« Er zog ein Gesicht wie jemand, der gerade an verdorbenes Essen denken musste. »Außerdem, nenn mich Jonathan.«
»Ist gut«, sagte Nicholas.
Und dann?
Malvina, die Geschichte einer alten Frau aus Schottland, die glaubt, den Geist ihres verstorbenen Mannes zu sehen, wurde veröffentlicht. Sie gefiel den Kritikern und auch einigen Lesern. Sie machte Nicholas zwar nicht reich, aber das Geld, das sie einbrachte, war willkommen und mehr, als er an sechs Tagen die Woche als Briefträger verdiente. »Erfolgreich genug, um an deinem nächsten Buch interessiert zu sein«, drückte es Jonathan aus. Also freute sich Nicholas – nicht zuletzt, weil er sich jetzt wie ein richtiger Schriftsteller fühlte, und das schon im Alter von vierundzwanzig Jahren. Als Jonathan ihm ein Interview beim Guardian besorgte, entfuhr ihm der Satz, der ihn von da an begleiten sollte: »Ich bin nur ein gewöhnlicher Junge.« Mehr brauchte die Presse nicht. Von da an war er der gewöhnliche Junge.
Er beschloss, bald einen weiteren Roman zu schreiben, aber ihm fiel vorerst nichts ein. Nicht, dass ihm das Kopfzerbrechen bereitet hätte.
»Weißt du, was das Wichtigste für einen Schriftsteller ist?«, fragte ihn Jonathan bei einem Glas Wein an Deck.
»Inspiration?«
Der beleibte Lektor schüttelte den Kopf. »Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist es, einen Beruf zu haben, der ihm ein Einkommen verschafft. Wenn du also nicht enden willst wie viele, die Tag für Tag Scheiße schreiben, nur weil sich die Scheiße verkauft, dann beende dein Studium und behalte den Job bei der Post.« Er hob sein Glas. »Wenn dir jemand einen kostenlosen Rat gibt, dann solltest du ihn beherzigen.«
»Ist gut«, sagte Nicholas. Er kündigte den Aushilfsjob bei der Post nicht, sondern reduzierte die Arbeit nur auf vier von sechs Wochentagen. Er besuchte Seminare an der UCL und teilte sich weiterhin die Miete mit Kadir Jones. Und er verliebte sich in Erika Hallberg, die beim Lehrstuhl für Moderne Literatur als studentische Hilfskraft arbeitete. Die beiden wurden schnell ein Paar.
Vor knapp einem halben Jahr, kurz vor Weihnachten, verkündete Jonathan Fry plötzlich, dass er auf Weltreise gehen wolle.
»Es ist an der Zeit, den Spuren Lord Byrons zu folgen. Nun ja, im Geiste.« Ein vielsagendes Lächeln folgte. »Ich werde einen Reiseführer schreiben für Menschen, die das Reisen hassen. Koffer packen, Koffer schleppen, Koffer suchen, wer mag das schon? In den meisten Ländern ist es heiß und es gibt Moskitos. Kurz und gut. Ich werde zwei Jahre fort sein, und ich brauche jemanden, der sich während dieser Zeit um die Dorian Gray kümmert. Den Kräutergarten, die rostigen Stellen und die Katze, du weißt schon, Whoopie.« Er zwinkerte Nicholas zu. Sie saßen im Ye oldeCheshire Cheese bei einem Ale zusammen. »Na, wie sieht’s aus?«
Die Antwort lautete: »Wow!«
»Sehr prägnant, gefällt mir.« Jonathan lachte.
Einen Handschlag später war es beschlossene Sache.
So bezog Nicholas seinen ersten festen Wohnsitz in London. (Sah man vom leichten Schaukeln auf den Wellen ab.) Er wohnte auf der Dorian Gray, kümmerte sich um die Kräuter und die Katze (und die rostigen Stellen am Boot) und wartete auf den Sommer.
»Der Anlegeplatz gehört mir«, hatte Jonathan ihm schon vor einiger Zeit erklärt. »Der Vorteil, wenn man ein gutes Lektorengehalt verdient, hm?«
Jeden Morgen, so wie heute, wenn Nicholas hinaus an Deck ging, sich mit einer Tasse frisch aufgebrühtem Kaffee in den Liegestuhl fallen ließ, die Kräuter, die aus den vielen Holzkisten wucherten, roch, den Uferweg betrachtete – zu dieser Uhrzeit trieben sich meist nur ein paar Jogger dort herum und Anwohner des Crescent, die ihre Hunde ausführten –, dann war er dankbar, genau dieses Leben zu führen. Whoopie, die Katze, kam meist erst am späten Nachmittag vorbei.
Der Mai in London ist wie ein leicht verschlafener Sommer. Nicholas mochte den Mai.
Das Einzige, was ihm den Genuss des Kaffees und die taufrische Morgenstimmung an Bord ein wenig verdarb, war die Erinnerung an den seltsamen Mann mit den zornigen Augenbrauen, der neben seinem Bett gestanden hatte. Andererseits, warum sich grämen und grübeln? Es war ja nichts passiert, außer dass er sich erschrocken hatte. Vermutlich hatte er tatsächlich nur intensiv geträumt, nicht mehr.
Trotzdem wollten ihm die Worte des dünnen Mannes nicht aus dem Sinn gehen: Ich bin gar nicht hier. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass er ihn wiedersehen würde. Keine Ahnung, warum.
Nach dem Frühstück machte sich Nicholas auf den Weg ins Robinson’s Records, wo er zusätzlich einmal die Woche vormittags arbeitete. Er sortierte alte Schallplatten und neue CDs und fragte sich jedes Mal, wie lange das noch gut gehen würde. »Scheiß Downloads«, pflegte Mo, der Inhaber, zu sagen. Nicholas sah das ähnlich, aber auch er hatte keine Lösung bei der Hand.
Den Nachmittag verbrachte er dann in einem Café (dem AccidentalEscapist) in der Delancey Street, wo er draußen im Schatten eines Baums saß und einen Roman von Ray Bradbury las. Vor ihm auf dem Tisch stand eine Tasse Tee. Süßes Nichtstun – manchmal pflegte er diese Momente, die das Leben ausmachten. Den Geruch der Sonne genießen und im Schatten lesen, all die losen Gedanken freilassen, bis sie irgendwann im hellen wolkenlosen Himmel wie Seifenblasen zerplatzten.
Später fragte er sich oft, wie sich das alles weiterentwickelt hätte, wenn er nicht in genau diesem Augenblick von dem Buch aufgeschaut hätte. Wären Erika und er womöglich noch immer ein Paar? Er und die wunderbare Erika Hallberg, die so unverschämt gut aussah. Die er beim Lehrstuhl kennengelernt hatte, als er sich für ein Seminar hatte eintragen wollen. Erika Hallberg, die wie ein Abenteuer gewesen war. Die gleiche Erika Hallberg, die jetzt auf der anderen Straßenseite mit einem Typen auftauchte, den Nicholas noch nie zuvor gesehen hatte. Ein großer Kerl, blond, eitel, sportlich, nach gut betuchten Eltern aussehend, gut einen Kopf größer als Nicholas. Jemand, der die großen Spiegel in den Fitnessstudios mag, die er täglich aufsucht, mehr Selfies als Landschaftsaufnahmen bei Facebook postet und in den zweifelsohne seltenen Stunden, die er nicht vor dem Spiegel verbringt, eiweißhaltige Nahrung zu sich nimmt.
Blieb die Frage: Wer zur Hölle war der Kerl?
Erika und der Eiweißfresser gingen eng umschlungen (seine Hand zu nah an ihrem Hintern) an den Schaufenstern entlang. Was da ablief, war kein Geheimnis, über jeden Zweifel erhaben.
Nicholas seufzte. Er legte das Lesezeichen in das Buch, damit er die Stelle nachher auch sicher wiederfand. Dann nahm er sein Smartphone aus dem Rucksack und rief sie an.
Von seinem Platz im Verborgenen aus sah er, wie Erika ans Telefon ging. »Hey, was gibt’s?« Sie küsste den Eiweißfresser kurz auf den Mund und gab ihm zu verstehen, dass er sich ruhig verhalten sollte.
»Ich wollte nur fragen, was du heute Abend vorhast.«
»Dann frag«, säuselte sie.
Das übliche Spiel. »Was hast du heute Abend vor?«
»Ich muss arbeiten«, sagte sie. »Am Lehrstuhl, du weißt schon.«
Nicholas nahm das zur Kenntnis.
»Wo bist du?«, wollte sie wissen. Sie deutete auf irgendetwas im Schaufenster vor sich. Der Eiweißfresser nickte lässig.
»In der City«, sagte er. »Ich muss beim Verlag vorbeischauen.« Schriftsteller sind meistens gute Lügner. »Dauert aber nicht lange.« In Momenten wie diesem fiel es sogar besonders leicht zu lügen.
»Ich bin am College.« Lehrstuhlarbeit, schon klar.
Der Eiweißfresser fasste ihr an den Hintern. Sie schaute zu ihm auf und lächelte ihn vermutlich an. (Nicholas konnte das Lächeln nicht sehen, hatte aber keine Schwierigkeiten, es sich vorzustellen.)
Er sagte: »Ich ruf dich später an.«
»Ist gut.«
»Okay.«
»Ich liebe, vermisse und begehre dich«, sagte Erika, lachte und legte auf. Drüben auf der anderen Straßenseite zog sie den Eiweißfresser zu sich und knutschte ihn ab. Sie sagte etwas zu ihm und dann verschwanden die beiden in dem Laden. Eine Weile später kamen sie wieder nach draußen; sie trug eine Einkaufstasche, er eine Sonnenbrille. Mit langsamen Schritten schlenderten sie die Delancey Street hinab.
Nicholas fragte sich, was er tun sollte. Seltsamerweise fühlte er sich nicht einmal schlecht und das erschreckte ihn ein wenig. Kadir Jones hatte seine Freundin meist nur Erika Error genannt. »Sie ist von Anfang an ein Fehler gewesen«, hatte er gesagt, als er sie das erste Mal leibhaftig erlebt hatte. »Frauen wie Erika sind immer ein Fehler. Es steht ihnen auf der Stirn geschrieben.«
»Hey, hey, hey, sie ist meine Freundin«, hatte Nicholas zu bedenken gegeben.
»Das«, hatte Kadir festgestellt, »ist dein Problem.«
So viel also dazu.
Jetzt saß Nicholas im Accidental Escapist und fühlte sich wie zufällig auf der Flucht. Kadir hatte recht behalten. Sie war Erika Error, immer schon gewesen. War er blind? Dämlich? Wollte er das wirklich wissen? Der Tag schien die Luft anzuhalten, das Leben ebenso. Und dann sah er drüben auf der anderen Straßenseite, im schattigen Eingang des Geschäfts, das Erika Error und ihr Eiweißfresser vor nur ein paar Augenblicken verlassen hatten, einen dünnen Mann auf den Bürgersteig treten. Er trug dunkle Sachen, ein Sakko, ein bis zum Hals zugeknöpftes Hemd. In der Hand hielt er einen schwarzen Regenschirm, den er wie einen Gehstock benutzte. Er hielt inne, starrte dorthin, wo Nicholas’ frisch gebackene Exfreundin gerade entschwunden war, und dann schaute er über die Straße hinweg zu Nicholas. Er machte ein verwundertes Gesicht, deutete mit dem Zeigefinger in die Richtung von Erika Error und dem Eiweißfresser – so als wollte er sagen: Das ist nicht wirklich deine Freundin gewesen, oder? – und schaute wieder hinüber zu Nicholas. Er schüttelte höchst missbilligend den Kopf, machte etwas mit den zornigen Augenbrauen, setzte sich dann lässig eine schwarze Sonnenbrille auf, grinste irgendwie herausfordernd, tippte mit dem Regenschirm auf den Boden und war nicht mehr da.
»Teufel noch eins!«, entfuhr es Nicholas. Er sprang auf und lief instinktiv auf die Straße.
Ich bin gar nicht hier.
Er hielt inne. Zwei Autos fuhren an ihm vorbei.
Das war der Kerl von letzter Nacht gewesen, er war sich ganz sicher. Was in aller Welt hatte der hier zu suchen?
Eine Frau ging an ihm vorbei, als er auf den Gehweg zurücktrat. Sie trug ein seltsames Kostüm, das nach Mittelalter aussah. Vermutlich jemand vom Straßentheater beim Camden Market, mutmaßte Nicholas. Er begegnete ihrem Blick, sie starrte ihn an, mit einem ähnlich überraschten Ausdruck in den Augen, wie der dünne Mann vorige Nacht es getan hatte. Nicholas lächelte ihr kurz zu, dann schaute er zur anderen Straßenseite.
Der Mann war fort, einfach so.Wie letzte Nacht hatte er sich einfach in Luft aufgelöst.
Nie gewesen …
Nicholas blieb ein paar Augenblicke wie angewurzelt stehen. Die Sonne stand hoch am Himmel. Es hätte alles so einfach sein können – sein Leben, die Arbeit, dieser Tag und die Liebe. Doch auf einmal war alles durcheinandergeraten und Nicholas beschlich das Gefühl, immer mehr die Kontrolle zu verlieren.
Schließlich ging er wieder zu seinem Tisch, blätterte abwesend in dem Roman und dachte an den seltsamen Besucher von letzter Nacht. Konnte es ein Zufall sein, dass er ausgerechnet jetzt an ausgerechnet diesem Ort auftauchte? War er hinter ihm her? Wenn ja, warum?
Nicholas wusste, dass er keine Antworten auf diese Fragen finden würde. Nicht hier, nicht jetzt. Vielleicht nie.
Er zahlte, packte das Taschenbuch in seinen Rucksack und ging zu seinem Fahrrad, das an einer Laterne zwei Häuser weiter angekettet war. Es war ein altmodisches Rad ohne Schnickschnack, schwarz, einfach, praktisch. Nicholas besaß es seit Jahren und es war eines der wenigen Dinge, die er aus Edinburgh mit nach London gebracht hatte. Plötzlich musste er an die See denken, die er allzeit von dem Fenster in seinem Zimmer hatte sehen können: Der Firth of Forth erstreckte sich vor dem Hügel, auf dem das Haus stand, bis zum Horizont in all seiner rauen Schönheit. Vielleicht hatte er deswegen ein Zuhause auf einem Boot gefunden. London war für ihn immer eine Stadt des Wassers gewesen, der Kanäle, Brunnen, Flüsse. Er war meistens mit dem Fahrrad unterwegs, nur bei starkem Regen quälte er sich in die Busse oder die U-Bahn hinunter.
Überrascht bemerkte er die Visitenkarte, die jemand an die Klingel des Fahrrads gesteckt hatte. Er nahm die Karte behutsam in die Hand:
Neugierig wegen letzter Nacht?
Das war alles, was dort stand. Er drehte die Karte um.
Chesterton & ChestertonSchirme und mehr
Eine Anschrift stand dort ebenso: Seven Dials. Keine Straße mit Hausnummer, fast so, als müsse man diesen Laden für Regenschirme kennen.
Nicholas sah sich um. Von dem Mann war jedenfalls nichts zu sehen. Was also sollte er tun? Dort vorbeifahren und spontan und unverbindlich fragen, was in aller Welt der Kerl mitten in der Nacht in seinem Hausboot zu suchen hatte? Und, viel wichtiger, wie es ihm gelang, sich so schnell in Luft aufzulösen. Dass er etwas mit Regenschirmen zu tun hatte, passte irgendwie.
Nicholas öffnete das Fahrradschloss, legte es in den Korb, der hinten auf dem Gepäckträger angebracht war, schulterte den Rucksack und stieg auf.
War die Visitenkarte nicht so etwas wie eine Einladung? Warum also nicht einfach nach Covent Garden fahren und schauen, was passieren würde? Das Leben war für Augenblicke wie diese gemacht. Schriftsteller wissen das. Den Wind im Gesicht, fuhr er also los, an Erika Error dachte er schon gar nicht mehr.
Seven Dials lag mitten in Covent Garden, ein gutes Stück südlich von Camden Town. Mit dem Fahrrad brauchte Nicholas eine knappe Stunde, um dorthin zu gelangen, was in erster Linie dem dichten Verkehr in der Stadt geschuldet war und der Tatsache, dass er nur Radwege und Nebenstraßen und Gassen und andere Schleichwege nutzen konnte. Neben den Flüssen und Kanälen war London für Nicholas James eine Fahrradstadt.
Seven Dials war ein Viertel nahe der Charing Cross Road, wo sich mehrere Straßen sternförmig an einem runden Platz trafen. Da keine genaue Adresse angegeben war, musste Nicholas die Straßen eine nach der anderen nach dem Schirmgeschäft absuchen. In der Earlham Street wurde er schließlich fündig. Das Geschäft befand sich in einem der alten Häuser mit den bunten Backsteinfassaden. Drei Stockwerke, hohe Fenster. Ein uraltes Schild hing über dem Eingang. Im Schaufenster befanden sich nur wenige Schirme, die aber allesamt sehr teuer und handgefertigt aussahen. Preisschilder gab es keine.
Nicholas stellte das Fahrrad ab und sah sich den Laden genauer an. Es war nicht nur ein Geschäft, das Regenschirme und Gehstöcke aller Art verkaufte, nein, es sah aus wie ein Geschäft, in dem Regenschirme und Gehstöcke aller Art nach den traditionellen Techniken in Handarbeit hergestellt wurden, Einzelstücke, deren Preise Nicholas nicht schätzen konnte.
Er spähte durchs Fenster ins Innere, konnte aber wenig erkennen: einen Tisch, auf dem eine riesige alte Registrierkasse stand, an den Wänden Regale, in denen elegante Schirme lagen, Ausstellungsstücke, wie es den Anschein hatte. Das alles wirkte wie ein Salon aus dem vorigen Jahrhundert, dunkel und verhuscht leise und mit jeder Menge Holzvertäfelung an den Wänden.
Nicholas trat zur Seite und stand vor der Tür. Er drückte die Klinke.
Geschlossen. Na toll!
Einen Augenblick zögerte er, dann klopfte er an die Tür. Konnte ja nicht schaden. Eine Klingel sah er jedenfalls keine. Er wartete, lauschte. Nichts. Er klopfte noch einmal.
Wieder nichts.
Erneut betrachtete er die Visitenkarte und beschloss, am nächsten Tag noch einmal hier vorbeizuschauen. Warten hatte keinen Sinn, schließlich wusste er ja nicht einmal, ob der Mann heute hier auftauchen würde. Was jemand, der Regenschirme und Gehstöcke auf traditionelle Art und Weise herstellte, nachts in seinem Hausboot zu suchen hatte, musste also weiter ein Rätsel bleiben.
So machte er sich auf den Heimweg. Genug der Überraschungen für heute.
Unterwegs rief ihn Erika mehrmals an. Er überlegte, ob er sie blockieren sollte, entschied sich aber dagegen, weil sie dann bei ihm zu Hause auftauchen und stundenlang diskutieren würde. Genau das galt es zu vermeiden. Außerdem, das musste er sich jetzt wohl eingestehen, wollte er sie eigentlich überhaupt nicht mehr sehen, und die Leichtigkeit, mit der ihm dies bewusst wurde, erschreckte ihn nicht einmal mehr. Am Soho Square hielt er schließlich an. Es klingelte erneut in seinem Rucksack.
»Hi, Nicky.«
Er hasste es, wenn sie ihn so nannte. Niemand nannte ihn so, nur sie. »Ich bin unterwegs.«
»Wo steckst du gerade?«
Auf der Wiese vor ihm saßen fröhliche Menschen, die den Sonnenschein genossen. Das alte Häuschen in der Mitte des Platzes wirkte wie aus der Zeit gefallen, als würden Shakespeare oder Pepys jeden Moment durch die Tür nach draußen kommen und sich mit einem Buch auf einem Handtuch niederlassen, um den Tag zu genießen. »Ich war heute in der Delancey Street.«
Sie sagte erst mal nichts. Erika und er hatten hier im letzten Herbst ein Konzert von Yamit Mamo und Neil Hannon besucht. Nicholas wusste genau, wo sie damals gestanden und was sie sonst noch so an dem Abend getan hatten.
»Du warst auch da«, sagte er.
Immer noch Schweigen. Dann etwas zögerlich und kleinlaut: »Ich habe dich gar nicht gesehen.« Erika konnte wirklich sehr unschuldig klingen, wenn sie es wollte. Und sie konnte Zeit schinden, wenn es sein musste.
Nicholas sagte: »Dafür habe ich dich gesehen.«
Schweigen.
Nicholas genoss den Anblick der Stadt. London im Mai. Die Wärme im Gesicht wirkte Wunder.
Er seufzte. »Erika, hör zu«, begann er.
Zu seiner Überraschung tat sie das auch.
»Wir könnten jetzt eine Weile reden und ignorieren, was ich gesehen habe«, sagte er. »Wir wären bestimmt nicht die Einzigen, die vorgeben, ein Paar zu sein, obwohl wir genau wissen, was Sache ist.« Er betrachtete die Pärchen auf dem Rasen und dachte ein wenig wehmütig Hm-tja. »Wir könnten diskutieren und lang und breit analysieren, wie es so weit hat kommen können und wer die Schuld trägt und wer nicht und so ein Zeug, du weißt schon, was ich meine. Du bist sehr gut darin.« Er betrachtete die Enten, die es auch hier gab. »Wir könnten«, und das war das, worauf es ankam, »aber auch einfach auflegen und das hier so schnell wie möglich beenden. Das ist der beste Weg, finde ich.« Wobei beenden nicht ganz richtig war, schließlich war es ja schon vorbei. »Du wirst mit dem Eiweißfresser, der dir an den Arsch gegriffen hat, glücklich und ich muss mir dich nicht mehr antun.« Hörte er sich jetzt etwa verletzt an? Nein, das sollte er nicht (manchmal tat ein wenig Herablassung einfach gut). »Es wäre also wirklich sehr schön, wenn du mich einfach in Ruhe lässt. Ich denke, das kriegst du hin.« Damit beendete er das Gespräch, blockierte Erika Errors Nummer überall und steckte das Telefon in den Rucksack zurück.
Dann atmete er tief durch.