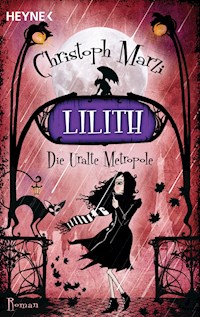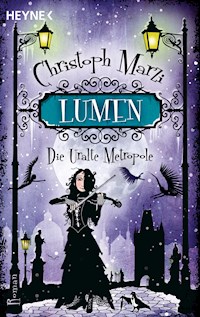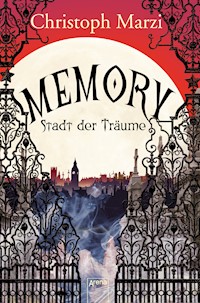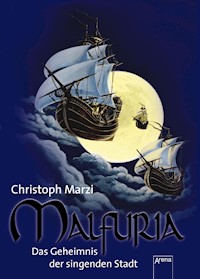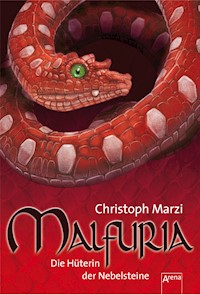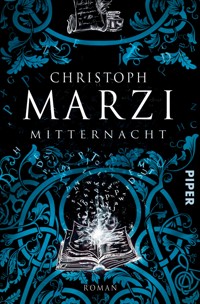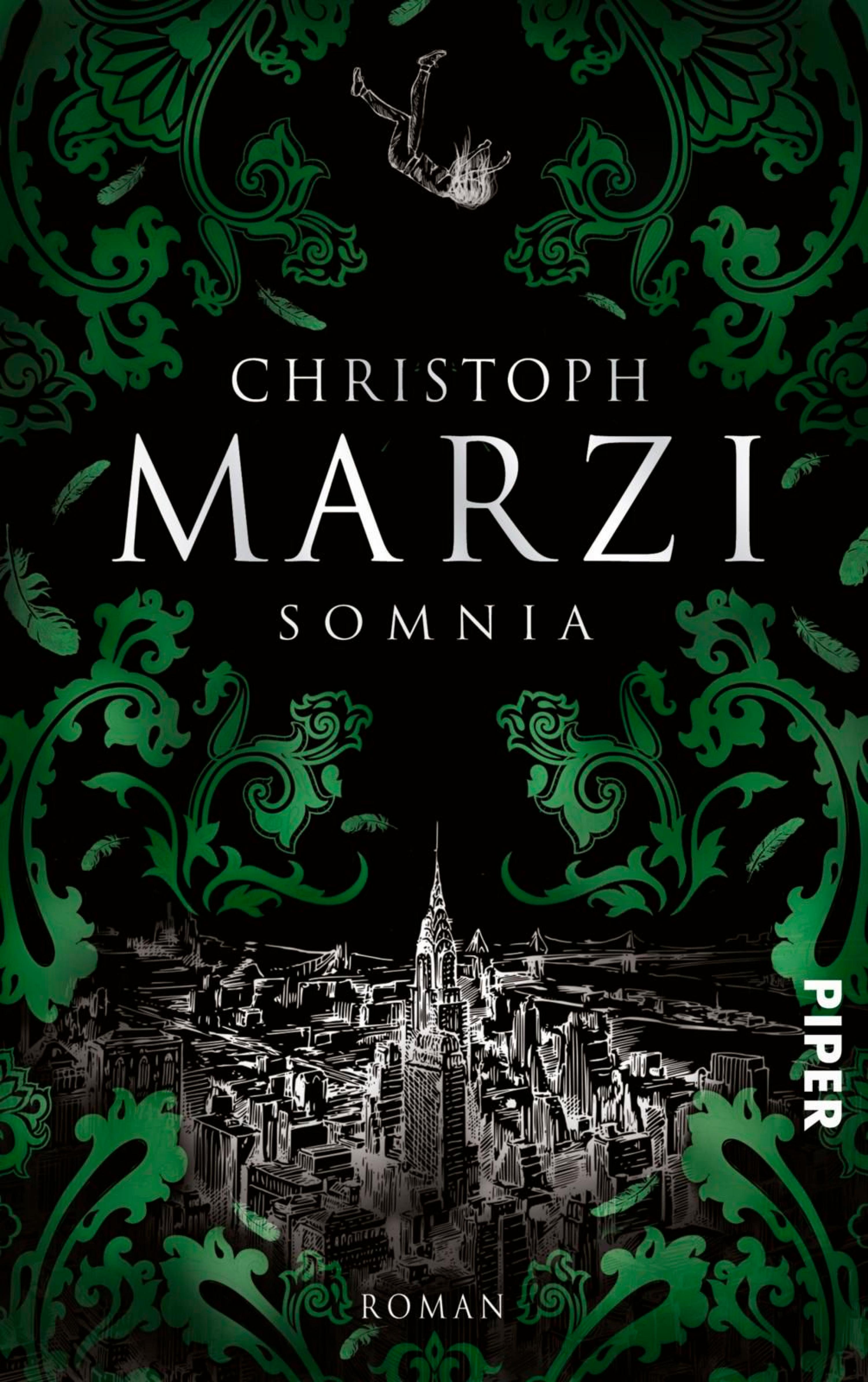12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die uralte Metropole-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Fantasy-Entdeckung des Jahres
Als die kleine Emily eines Nachts Besuch von einer sprechenden Ratte erhält, weiß sie, dass nichts in ihrem Leben so bleiben wird, wie es einmal war. Nicht, dass sie ein gutes Leben in dem kleinen Waisenhaus in einem Armenviertel Londons führen würde. Doch dass sie auf der Suche nach dem Geheimnis ihrer Herkunft eine phantastische Stadt unter den Straßen Londons entdecken würde und schon bald von den seltsamsten Wesen verfolgt wird – das hätte sich Emily selbst in ihren kühnsten Träumen nicht ausgedacht.
Tauchen Sie ein in diese wundervolle Geschichte, die die viktorianische Atmosphäre eines Charles Dickens mit dem Zauber von Harry Potter verwebt.
Für Leser aller Altersschichten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1333
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Christoph Marzi
Lycidas
Roman
Copyright
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2004 by Christoph Marzi
Copyright © 2004 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN 978-3-89480-964-5
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
Buch IKapitel 1Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Buch II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Kapitel 18 Kapitel 19 Buch III Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Kapitel 18 Kapitel 19 Danksagung Über das Buch Über den AutorCopyright
Für dich, Tamara
Good and bad, I define these terms
Quite clear, no doubt, somehow.
Ah, but I was so much older then,
I’m younger than that now.
Bob Dylan, My Back Pages
London calling to the faraway towns
Now that war is declared – and battle come down
London calling to the underworld
Come out of the cupboard, all you boys and girls.
The Clash, London Calling
Buch I
Kapitel 1
Dombey & Son
Die Welt ist gierig, und manchmal verschlingt sie kleine Kinder mit Haut und Haaren. Emily Laing erfuhr dies, bevor ihre Zeit gekommen war. Als sie meinen Weg kreuzte, flüchtete sie vor denen, die ihr eine Zukunft versprochen hatten, jenen, die täuschen und lügen und betrügen und dafür sorgen, dass das Lächeln in Kindergesichtern traurig und unecht wirkt.
Außer Atem kniete das Mädchen am Fuße einer Rolltreppe in der Tottenham Court Road, während der lauwarme Wind eines nahenden Zuges ihr das rote, lockige Haar aus dem schmutzigen Gesicht blies. Ängstlich sah sie mich an, und als ich der Ratte gewahr wurde, die neben dem Mädchen auf dem Boden saß und zutraulich die Schnauze gegen die Hand der Kleinen drückte, um mich sodann mit wachsamen Kulleraugen zu mustern, wusste ich, dass ich die Untergrundbahn nicht alleine verlassen würde.
So lernte ich Emily Laing kennen.
An einem Tag im Winter.
Nicht lange vor Weihnachten.
»Sie sollte längst zurück sein«, höre ich mein Gegenüber sagen.
Die Besorgnis, die nie verschwindet, erwacht zu neuem Leben.
Ich lasse den Blick durch den Raum schweifen. Normalerweise beruhigt mich dieser Raum mit der niedrigen Holzdecke und den vielen Gästen, die laut redend ihr Bier trinken. Nicht jedoch an diesem Abend.
»Sie hat es geschafft«, bemerke ich möglichst zuversichtlich.
»Du spürst es?«, will mein Gegenüber wissen.
Ich nicke nur.
»Ich spüre nichts. Nicht das Geringste.«
Das beunruhigt mich noch mehr.
Ich schaue durch eines der kleinen Fenster in die Nacht hinaus. Draußen hat es wieder zu schneien begonnen. Dicke Flocken wirbeln durch die Dunkelheit. Ich nippe an meinem Kräutertee. Mürrisch und gedankenverloren.
Ein verlorenes Kind irrt gerade durch dieses eisig klirrende Wintermärchen, in das sich London seit bereits zwei Monaten verwandelt hat.
»Wir hätten sie nicht gehen lassen dürfen«, stellt mein Gegenüber fest.
»Hatten wir denn die Wahl?«
Im Grunde genommen wissen wir doch beide, dass es keinen anderen Weg gab.
Doch sollte ich meiner Erzählung nicht vorgreifen.
Schließen Sie die Augen und lauschen Sie meinen Worten. Folgen Sie mir nach Rotherhithe, wo die Luft allzeit salzig nach Meer riecht und die riesigen Lagerhäuser an die alten Zeiten erinnern, als hier noch die Waren aus den Kolonien umgeschlagen wurden. Damals duftete es nach Zimt und Ingwer und Ananas, nach Orient und anderen fernen Ländern; damals zogen Pferde schwere Karren durch die engen Gassen, beladen mit fremden Köstlichkeiten. Doch der Zauber verflog und machte lärmenden Kränen, rostigen Lastern und herumlungernden Gestalten Platz.
Das Kopfsteinpflaster wirkt heute dunkler und schmutziger. Des Nachts ist es unsicher auf den Straßen und in den Gassen. Spärliches Licht aus krummen Laternen lässt die Dinge zur Hälfte im Schatten verschwinden. Gut gesittete Bürger neigen dazu, diese Gegend zu meiden.
Emily Laing kannte sich dort aus.
Drüben am anderen Themse-Ufer.
Ein klappriges Schild aus morschem Holz mit der dahingekritzelten Aufschrift »Dombey & Son – Anstalt für heimatlose Kinder« zierte den Eingang zu ihrem Zuhause. An diesem traurigen Ort soll unsere Geschichte beginnen?, werden Sie sich fragen. Sie wird es! Denn ich werde sie genauso erzählen, wie sie passiert ist. Und sie begann nun einmal in Rotherhithe, hinter den Mauern jenes armseligen Kinderheims, das von Reverend Charles Dombey nebst seinem Sohn Charles Dombey junior geführt wurde, unter Mithilfe eines ständig missgelaunten und dem Alkohol verfallenen Hausmeisters namens Mr. Meeks.
Die Kinder jener Anstalt besaßen nur einen Vornamen, von dem allerdings kaum jemand außer ihnen selbst Gebrauch machte. Für Reverend Dombey waren die Kinder lediglich Nummern, und nur als solche kannte er sie und sprach sie auch nur auf diese Weise an.
»Fünfzehn hat den Kater geärgert«, hörte man Mr. Meeks oft fluchen, der das zerlauste, bissige Monster liebte. »Vierundzwanzig bekommt wegen unzüchtiger Scherze zehn Schläge mit dem Rohrstock«, verhängte der Reverend, wie er von den Kindern genannt wurde, die von ihm bevorzugte Strafe. Entkommen gab es keines und Vergehen gab es viele an der Zahl. »Sieben isst den Teller nicht leer. Dreizehn will nicht einschlafen. Zweiundzwanzig hat sich im Essensraum übergeben.« Selbst banale Missgeschicke wurden bestraft.
Unerbittlich schlug der Reverend zu.
Und nicht wenige der Kinder erkannten die Freude, die in seinen Augen aufblitzte, wenn er den Rohrstock niedersausen ließ.
Das Waisenhaus war in einem alten Backsteinhaus untergebracht, dessen Fassade bröckelte und das einstmals, in den alten Zeiten, als Hafenmeisterhaus gedient hatte. Der Reverend, hager und hakennasig, und sein Sohn, feist und nörgelig, bewohnten das oberste Stockwerk, von wo aus sie einen schönen Ausblick auf das gegenüberliegende Themse-Ufer hatten und des Nachts die hell erleuchtete Kuppel von St. Paul’s bewundern konnten. Wenngleich auch keines der Kinder den beiden genügend Feingefühl zugesprochen hätte, einen solchen Anblick überhaupt bemerken, geschweige denn ihn genießen zu können. Die älteren Kinder munkelten, es gäbe dort oben Reichtümer, die der Reverend von den Eltern der Kinder als Bezahlung erhalten habe dafür, dass diese sich nun nicht mehr mit ihren Bälgern abzugeben brauchten. Doch keines der Kinder hatte je einen Fuß in die Räume des Reverends gesetzt.
Schlimmstenfalls wurde ein Kind ins Büro des Reverends gerufen, wo es entweder eine Bestrafung zu erwarten hatte oder eine neue Aufgabe zugesprochen bekam. Das Büro, von den Kindern nur als »die Kammer« bezeichnet, befand sich im Stockwerk unter der Wohnung der Dombeys. Es roch dort staubig nach schimmligen Akten, die sich in Regalen aus dunklem Holz bis unter die hohe Decke stapelten und die, so munkelte man, die Geheimnisse über die Herkunft der Kinder enthielten. Nur dürftiges Licht fiel durch das schmale, schmutzig milchglasige Fenster ins Innere. Auf dem Schreibtisch lag immer eine dicke Bibel, aus welcher der Reverend mit feuriger Leidenschaft zu zitieren pflegte, bevor der Rohrstock herniederfuhr.
Ein- bis zweimal in der Woche musste jedes Kind eine Aufgabe verrichten.
Oftmals kamen Leute »von draußen« vorbei, die Arbeit offerierten.
Auskehren einer Werkstatt. Handlangerdienste auf einer Baustelle. Botengänge in Rotherhithe und Whitechapel. Blumenverkauf am Blackfriars-Bahnhof. Putzdienste bei den Geschäftsleuten im Norden der Stadt. Bebetteln der Touristen am Parlament und der Westminster Abtei.
»Arbeit vertreibt die unnützen Gedanken«, pflegte der Reverend in seinen Predigten, die er jeden Mittwoch und jeden Sonntag im Speisesaal hielt, zu verkünden. Die kleinen Almosen, die manche Kunden den Kindern zusteckten, flossen jedenfalls in den Geldbeutel der Dombeys und mehrten die Reichtümer im Obergeschoss. Hin und wieder kam es vor, dass eine Frau eines der Kinder gegen Bezahlung abholte und erst nach etlichen Stunden zurückbrachte. Nachher war jedoch keines, weder Junge noch Mädchen, bereit, über das Erlebte zu sprechen.
Ohne Ausnahme fürchteten sich alle Kinder vor dem Besuch jener Frau, die im Waisenhaus nur unter dem Namen Madame Snowhitepink bekannt war.
»Kinder«, pflegte sie zu sagen, »sind eine Plage.«
Ihre hellen Katzenaugen musterten jedes der Kinder eindringlich, bevor sie eines erwählte, mit ihr zu kommen.
Doch kehren wir zurück zu dem kleinen Mädchen, das in eben diesem Augenblick durch die kalte Nacht irrt.
Emily Laing, dem Reverend bekannt als Nummer Neun.
Madame Snowhitepink geläufig als die »einäugige Missgeburt«.
»Kein Mensch wird für sie bezahlen.«
Wie oft schon hatte Emily diese Worte vernommen. Die anderen Kinder beneideten sie darum.
»Sie ist hässlich.«
Madame Snowhitepink, die kein Hehl aus ihrer Meinung machte, war allzeit gut gekleidet. Trug Schwarz und war weiß geschminkt. Lippenstift in Pink, und die hellen Katzenaugen ließen sie wie ein Raubtier erscheinen, das auf Beute aus war.
»Diese Missgeburt!«
Dabei irrte sie in doppelter Weise.
Zum einen besaß Emily zwei Augen.
Ein helles wachsames und eines aus Glas.
Dass sie nur durch eines der beiden Augen sehen konnte, tat ihrer Ansicht nach nichts zur Sache. Sie war keine Missgeburt. Das gläserne Auge verdankte sie dem Hausmeister und nicht ihrer Geburt. Als Emily sechs Jahre alt gewesen war, hatte sie hin und wieder in der Küche aushelfen dürfen. Die Köchin Mrs. Philbrick ließ sie Gemüse schneiden, während einer der älteren Jungen, dessen Name, so glaubte Emily sich zu erinnern, Paul gewesen war, das heiße Wasser vom Herd nehmen sollte. Eines Morgens stolperte der ungeschickte Junge und vergoss kochendes Wasser auf Mr. Biggels, den Kater des Hausmeisters. Jaulend wand sich der verbrühte Mr. Biggels auf dem Boden, als Mr. Meeks seinem Haustier zu Hilfe geeilt kam. Ohne lange nachzudenken erkannte der Hausmeister in Paul den wahren Schuldigen, den er augenblicklich zu züchtigen gedachte. Dummerweise holte er für den ersten Schlag zu weit aus, und der Rohrstock traf die kleine Emily mitten ins Gesicht. Mr. Meeks machte seinem Schrecken über das viele Blut im Gesicht des kleinen Mädchens mit wütendem erschrockenen Geschrei Luft und hieb umso fester auf den armen Paul ein, während sich Mrs. Philbrick um das weinende Mädchen kümmerte, indem sie ein Handtuch auf die Wunde drückte, um die Blutung zu stillen, und tröstende Worte flüsterte.
Das linke Auge jedenfalls konnte sie damit nicht retten.
»Es war wie Feuer im Gesicht«, sollte Emily später ihrer Freundin gestehen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Rotherhithe lebte. Von Engeln hatte sie eines Nachts geträumt, und in ihrem Traum hatten die Gesichter der Engel gebrannt. Als sie das Auge verloren hatte, da war ihr gewesen, als hielten Engel nach ihr Ausschau. Irgendwie, ganz unbestimmt.
»Manchmal«, meinte Emily, »träumt man eben solche Sachen.«
Als die Wunde verheilt war, bekam Emily ein Glasauge, das sich kalt und glatt wie ein schöner Stein anfühlte in ihrer Hand. Zum Trost schenkte Mrs. Philbrick ihr am Tag darauf einen alten Stoffbären, der einmal ihrer Nichte gehört hatte. Dem Bären, dessen hellbraunes Fell nur noch matt glänzte und ganz filzig war, fehlte das rechte Knopfauge.
»Irgendwie«, meinte Mrs. Philbrick, »gehört ihr beiden zusammen.«
Irgendwie hatte sie Recht.
Von da an schlief Emily nie wieder alleine.
Am Hinterteil des Stoffbären baumelte ein Zettel mit einer kaum mehr leserlichen Aufschrift: »Made by D.B. Laing, Singapore«. Sie hielt den Stoffbären fest in ihren Armen und ertastete jedes Mal beim Einschlafen die leere Augenhöhle des Tieres. Er wurde so etwas wie der Bruder, den sie nie gehabt hatte. Und sie wollte den gleichen Namen haben wie er.
So geschah es, dass Nummer Neun im Alter von sechs Jahren nicht nur ihr Glasauge bekam, sondern auch den ersten richtigen Namen.
Emily Laing.
Etliche der Waisenkinder waren durchaus von Interesse für die Belange von Madame Snowhitepink. Nicht so die kleine Emily. Die Leute verabscheuten die einäugige Missgeburt. Wenn die Kinder von den Ausflügen mit Madame Snowhitepink zurückkehrten, war Emily meist froh darüber, ein gläsernes Auge zu haben, das sie hässlich machte. Keines der Kinder sprach jemals über das, was im Beisein Madame Snowhitepinks passiert war.
Emily blieb ein derartiges Schicksal erspart.
Sie wurde vom Reverend dazu abgestellt, der Köchin zur Hand zu gehen.
Mrs. Philbrick war eine gutmütige große Frau, deren Kittelschürzen vor Stärke knarzten, wenn sie sich bewegte. Dennoch duldete sie, wie jedermann im Waisenhaus, weder Schlampigkeit noch Unpünktlichkeit. Die Küche befand sich im Keller des großen Hauses, und dort unten führte sie streng ihr Regiment. Alles hatte dort unten seinen Platz. Emily, die mittlerweile die einzige Küchenhilfe war, musste den Fußboden nach jeder Mahlzeit kehren und schrubben. Paul war nach einem der Ausflüge mit Madame Snowhitepink nicht mehr zurückgekehrt; er sei, so sagte man den Kindern, adoptiert worden.
Der Arbeitstag begann für das Mädchen um fünf Uhr, während die anderen Kinder noch schliefen. Ein klappriger Lieferwagen aus Smithfields brachte Säcke voller harter Brote (meist solche vom Vortag), Kartoffeln und Gemüse (die gesammelten Reste vom Markt in Spitalfields). All das musste von Emily binnen kürzester Zeit in den Keller geschafft werden. Mrs. Philbrick erschien dann gegen sechs Uhr und wollte alles an seinem Platz sehen.
Die tägliche Routine ließ keinerlei Ausnahmen zu. Vorbereiten des Frühstücks, danach Tischabräumen mit anschließendem Abwasch und Küchenbodenputzen. War dies getan, begannen die Vorbereitungen für das Mittagessen. Die anderen Kinder strömten gegen ein Uhr mittags von ihren unterschiedlichen Arbeiten ins Waisenhaus zurück, lieferten den Verdienst des Vormittags bei Mr. Dombey junior ab und durften sich zur Belohnung den Bauch mit den zubereiteten und teilweise vergammelten Speisen füllen.
Am Mittag schuftete Emily erneut in der Küche, und wenn sie ihre Arbeit beendet hatte, was meist gegen vier Uhr der Fall war, begannen die Vorbereitungen für das Abendessen. In den spärlichen Pausen dazwischen kauerte Emily auf ihrer Pritsche im Schlafsaal und las in den staubigen Büchern, die einmal im Monat von einem alten Mann, der die zerfledderten Werke wohl als Mängelexemplare von den städtischen Bibliotheken erworben hatte, vorbeigebracht wurden. In diesen kostbaren Momenten versank sie ganz in den Welten, die sich zwischen den gedruckten Zeilen auftaten. Sie fühlte sich vielen der Gestalten verbunden: Little Nell Trent, David Copperfield, Holden Caulfield, Beverly Rogan, Jack Sawyer und Homer Wells. Sie litt mit ihnen, bis die laute Stimme von Mrs. Philbrick sie aus ihren Gedanken riss und sie in die wirkliche Welt des Waisenhauses zurückkehren musste.
Mit zwölf Jahren, so schien es, hatte das Waisenhaus bereits das Leben der kleinen Emily Laing aufgesogen. Nach dem Verlust ihres Auges waren die Stunden zu Tagen und die Wochen und Monate zu Jahren geworden, ohne dass Emily sich dessen richtig bewusst gewesen wäre. Sie lebte vor sich hin, tat ihre Arbeit, versuchte nicht aufzufallen und hoffte darauf, dass irgendwann ein Ehepaar im Waisenhaus auftauchte und sich für sie entschied.
Es musste in der Welt da draußen doch jemanden geben, der eine Missgeburt, wie sie es angeblich war, mochte. Der vierzehnjährige Charles hatte immerhin einen Klumpfuß, und niemand verdiente beim Betteln in Whitehall und Westminster so viel wie er. Irgendjemandes Herz würde sich doch bestimmt erweichen lassen, hoffte sie inständig.
Vergebens.
Stattdessen gewahrte Emily an einem kalten Wintermorgen eine Ratte.
Die zu ihr sprach.
Einfach so.
Glücklicherweise befand sich Mrs. Philbrick an diesem Morgen noch nicht in der Küche, denn Ratten waren ihr nicht gerade willkommene Gäste.
Emily hatte gerade einen Topf voller Wasser auf den Gasherd gestellt, das Streichholz griffbereit, als sie das kleine Tier bemerkte.
Miss Emily Laing, sagte die Ratte, deren dunkle Äuglein wach funkelten. Bitte haben Sie keine Furcht. Ich komme in einer Angelegenheit von größter Wichtigkeit zu Ihnen.
Ich sollte an dieser Stelle klarstellen, dass es sich hier keinesfalls um eine Halluzination handelte, wenngleich Emily diesbezüglich Zweifel hegte. Es war tatsächlich eine Ratte, die da auf den Kartoffelsäcken hockte. Natürlich sprach sie nicht in jenen Worten, die den Menschen normalerweise geläufig sind. Sie bewegte nicht die dunkle Schnauze, sodass die langen Barthaare lebhaft vibrierten. Auch stand sie nicht aufrecht da.
Emily Laing sah sich einer Ratte mit grauem glänzenden Fell gegenüber, die sich auch wie eine Ratte verhielt.
Sie piepste.
Mit der Ausnahme, dass Emily verstand, was da gepiepst wurde. Für sie ergaben die Laute einen Sinn, die das Tier von sich gab.
Wir benötigen Ihre Hilfe, sagte die Ratte in ihrer Sprache.
Muss man erwähnen, wie sehr Emily erschrak?
Hätte sie den Topf mit Wasser nicht bereits am Herd abgestellt, so wäre ihr sicherlich ein Missgeschick passiert. Ohne zu überlegen, griff sie nach einem langen Küchenmesser und einem großen Holzbrett. Beides hielt sie schützend vor sich und ließ die Ratte nicht aus den Augen.
Es ist wichtig, dass Sie mir genau zuhören, fuhr die Ratte fort.
Emilys nächster Blick galt ängstlich der Tür.
Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte, war Mrs. Philbrick, die in ihrem morgendlichen Eifer in den Raum gestürmt kam.
»Wenn du mich beißt, kleines Wesen«, drohte sie mutig, »dann wirst du es bereuen.«
Sie erschrak sogar beim Klang ihrer eigenen Stimme und zudem angesichts der Tatsache, dass sie mit einem Nager redete.
Nennen Sie mich Hyronimus, erklärte die Ratte, wenn Sie möchten. Aber das tut nichts zur Sache. Es gibt ein Kind in diesem Haus, das auf den Namen Mara hört. Mara Mushroom.
Mara, das wusste Emily, war eine der Neuzugänge.
Seit etwa drei Monaten war sie ein Waisenkind von Rotherhithe und gerade einmal zwei Jahre alt. Ein Taxi hatte sie aus Holborn hergebracht. Wie immer hatten die anderen Kinder die Ankunft des Neuzugangs von ihren Fenstern hoch oben in den Schlafräumen beobachtet. Denn mit jedem neuen Kind, das klein und süß und niedlich war, verringerten sich die Chancen der anderen, jemals eine Familie zu finden.
»Weshalb kann ich dich verstehen?«, flüsterte Emily.
Eine bessere Frage fiel ihr in diesem Augenblick nicht ein.
Warum sollten Sie das nicht können?, stellte die Ratte überrascht die Gegenfrage. Sie drehte den Kopf in Richtung der Tür und schnüffelte in die Luft. Ihre Barthaare stellten sich hoch. Schritte waren zu hören. Haben Sie ein Auge auf das Mädchen, das Mara heißt, piepste sie, und ehe sich Emily versah, war sie auch schon flink hinter dem Kartoffelsack verschwunden. Im gleichen Augenblick wurde die Tür aufgestoßen, und Mrs. Philbrick betrat den Raum. Mit geübtem Blick stellte sie fest, dass Emily nur tatenlos dastand und nicht arbeitete. Heftige Schelte war die Folge, während der Emily schnell dazu überging, die Arbeit fortzusetzen.
Was in aller Welt war das eben gewesen?
Hatte sie sich die Ratte nur eingebildet?
Hinter dem Kartoffelsack befand sich jedenfalls ein kleines Loch in der Mauer.
War die Ratte auf diesem Weg geflüchtet?
Emily spähte hindurch und sah nichts als Leitungen und rostige Rohre, die in der Dunkelheit verschwanden. Müde rieb sie sich die Augen und setzte dann ihr Tagewerk fort.
Als sie am Nachmittag für eine Stunde nichts zu tun hatte, ging sie hinauf in das Kinderzimmer, wo die Neuzugänge friedlich schliefen, und betrachtete die kleine Mara, die in ihrem Bettchen lag, an dessen Vorderseite ein Schild mit der laufenden Nummerierung hing. Mara war Nummer Einunddreißig.
Mara Mushroom hatte die Ratte das kleine Kind genannt.
Was war das nur für ein seltsamer Name? Und weshalb, so überlegte Emily, sollte sie auf das kleine Mädchen achten? Je jünger ein Kind war, umso besser standen doch seine Chancen, von einem kinderlosen Ehepaar adoptiert zu werden. Jedermann mochte süße Babys und niedliche Kleinkinder. Mit zunehmendem Alter schwand die Attraktivität der Kinder für adoptionswillige Ehepaare jedoch zunehmend. An deren Stelle trat dann Madame Snowhitepink mit ihrer Kundschaft. Konnte es Menschen geben, fragte sich Emily, die für die Gesellschaft eines zweijährigen Kindes bezahlen und mit diesem Wunsch an Madame Snowhitepink herantreten würden?
Sie wusste keine Antwort auf diese Frage.
Wollte die Antwort auch gar nicht wissen.
Das Kind in dem Bettchen schlief ruhig. Rotes zerwuseltes Haar hatte die Kleine und Ohren, die spitz aus dem Haar herauslugten. Ein schmales Gesicht, ähnlich dem Emilys. Mit einem Mal musste Emily an das Gesicht einer Frau denken, die streng und herrisch auf sie herniederblickte. In den vergangenen Nächten hatte sie von dieser Frau geträumt, die ein langes pechschwarzes Kleid trug und die ebenso pechschwarzen Haare streng zu einem Zopf nach hinten gebunden hatte. Irgendwie beschlich Emily das Gefühl, als hätte Mara den gleichen Traum wie sie. In eben diesem Moment. Als träume sie von der Frau in Schwarz, von der auch Emily geträumt hatte.
»Unsinn!«
Sie strich dem schlafenden Kind zärtlich über die Wangen und gab ihm einen Kuss. Das tat sie normalerweise nie. Man wusste nie, wann die Kinder zur Adoption freigegeben wurden und das Waisenhaus verlassen mussten. Deshalb durfte man sich nicht allzu sehr um sie sorgen.
Das machte nur Kummer.
Ihren Gedanken nachhängend, verließ Emily Laing den Schlafsaal der Neuzugänge.
Vor dem Einschlafen kehrten ihre Gedanken aber dorthin zurück.
Niemals würde sie Adoptiveltern finden. Und der Reverend würde ihr nicht für alle Zeit Unterkunft gewähren. Was, wenn Madame Snowhitepink doch eine Verwendung für sie in den Sinn käme? Was, wenn sie verrückt würde? Sie erinnerte sich an die Worte der Ratte. Hyronimus. Sie hatte mit einer Ratte gesprochen, die sich ihr als Hyronimus vorgestellt hatte. Vordergründig klang dies wie ein Märchen. Aber verabschiedete sich nicht in Wirklichkeit lediglich ihr kindlicher Verstand? Emily verspürte mit einem Mal eine unbändige Angst, endgültig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Konnte man von verdorbenem Essen verrückt werden? Was bewirkten die Pillen und Tropfen, die der Reverend den kleinen Kindern verabreichte? War ihr Blick auf die Welt ein anderer, weil sie ein Glasauge hatte? Niemand kann verrückte Kinder leiden. Das jedenfalls wusste sie mit Sicherheit. Sie wusste, wie solche Kinder von den anderen gerufen wurden: Spinner, Traumtänzer, Freak oder Schlimmeres. Fest drückte sie sich den Stoffbären ans Gesicht und schloss die Augen. Mit den Träumen hatte es begonnen. Jenen seltsamen Bildern, die sie in der Nacht marterten und schreiend erwachen ließen. Als träume sie die Träume fremder Kinder, so kam es ihr manchmal vor. Erklären konnte sie sich das nicht.
Und wie die Träume, so kamen auch die Tränen.
In jeder Nacht.
Heiß. Brennend.
Sie sagte sich oft vor, dass auf diese Weise alle schlimmen Erinnerungen an den vergangenen Tag aus ihrem Kopf geschwemmt würden. Viele der Kinder im Schlafsaal weinten des Nachts, die meisten heimlich unter der Bettdecke. Sie träumten von einem schönen Zuhause und liebenden Eltern und putzigen Haustieren. Dann erwachten sie und sahen die hölzerne Decke des Schlafsaals, hörten den Wind, der von der Themse her wehte und an den Fensterläden zerrte, spürten die Kälte, wie sie nach ihren Füßen griff, und dachten an den nächsten Tag. Die Träume waren alles, was sie an Glück hatten, und in jenen Momenten des Erwachens verloren sie diese Träume jedes Mal aufs Neue. Wieder und wieder. Nacht für Nacht. Jedes Waisenkind kannte dieses Gefühl. Mit der Enttäuschung kamen die Tränen. Mit den Tränen kam irgendwann der Schlaf. Es war ein Kreislauf, der mit dem Eintritt ins Waisenhaus begann und nie endete. Die Träume, die später in der Nacht kamen, waren schlimm: Bilder der Enttäuschung. Melodien aus Eis.
Jedes der Kinder, das längere Zeit im Waisenhaus verbracht hatte, wusste das.
Es würde immer so sein.
Dennoch fügten sich die meisten Kinder in ihr Schicksal und akzeptierten ihr Los. Oh ja, sie träumten natürlich davon, sich gegen die Herrschaft des Reverends aufzulehnen und eine Revolution anzuzetteln. Doch waren dies nichts als Träume. In Wirklichkeit buckelten sie vor dem strafenden Blick des Reverends, zogen die Schultern hoch und senkten den Blick, wenn der betrunkene Mr. Meeks im Treppenhaus herumschrie.
Emily hingegen hatte einen Plan.
»Es ist an der Zeit!«
Das Auftauchen der Ratte hatte sie darin bestärkt, diesen Plan in die Tat umzusetzen.
»Ich will wissen, wer ich bin«, sagte Emily in dieser Nacht zu ihrer besten Freundin Aurora Fitzrovia, einer Elfjährigen, die man als Kind im Stadtteil gleichen Namens vorgefunden hatte, ausgesetzt vor einem roten Briefkasten und in eine Decke eingeschnürt, die jemand zum Schutz gegen den Herbstregen mit einer grünen Mülltüte umwickelt hatte.
»Du willst in die Kammer des Reverends einbrechen?« Aurora war in Emilys Bett gekrochen, und heimlich tuschelten sie unter der Bettdecke.
Schlaflos hatte sich Emily im Bett gewälzt, bis sie sich dazu durchgerungen hatte, ihre Freundin zu wecken.
Aurora glaubte felsenfest daran, irischer Abstammung zu sein und Tochter eines Postbeamten. Ersteres wegen der grünen Mülltüte, in der man sie gefunden, und Letzteres wegen des roten Briefkastens, vor dem sie gelegen hatte. Selbst die Hinweise auf ihren Lockenkopf und ihre dunkle Hautfarbe brachten sie von dieser Meinung nicht ab.
Trotz dieser Starrköpfigkeit, die man sehr wohl als irische Eigenheit hätte auslegen können, waren Emily und Aurora einander in einem Maße vertraut, um das sie selbst richtige Schwestern beneidet hätten. Die beiden stritten höchst selten und wenn doch, dann vertrugen sie sich schnell wieder.
»Das Waisenhaus ist kein Ort, an dem Kinder sich untereinander streiten sollten.«
Aurora, die Emilys Weisheiten zur Genüge kannte, hatte dem nichts entgegenzusetzen.
»Ich habe einen Plan«, gestand Emily.
Oft schon hatten sich die beiden darüber unterhalten, wie es wohl anzustellen sei, an die Informationen zu kommen, die das Rätsel ihrer Herkunft zu lüften vermochten. Beide Mädchen hatten keine klaren Erinnerungen an ihr Leben vor dem Waisenhaus. Manchmal träumten sie: Emily von starken Händen, die sie hochhoben und an eine Brust drückten, die nach Weihnachtsgebäck duftete, von einer gesummten Melodie, die ihr selbst schlafend die Tränen in die Augen trieb, von Regen, der ihr ins Gesicht fiel, und einer riesigen Tür, die sich langsam öffnete und die Stimmen fremder Menschen preisgab, die sie ängstigten; und Aurora von grünen Wiesen und dem lauten Zirpen naher Grillen, vom Lachen einer alten Frau und bunten Briefen, die vom Himmel regneten, von einem Käfer, der ihr den Arm hinaufkroch und sie schreien ließ, bis jemand sie warm in ein Tuch wickelte und sanft schaukelte.
»Du willst es also wirklich tun?«
Emily nickte. »Worauf soll ich denn warten?«
»Wenn der Reverend dich erwischt!«
»Die Gefahr besteht immer.«
»Er wird dich Snowhitepink überlassen. Oder Mr. Meeks.«
»Und wenn er gar nichts bemerkt?«
Auroras Augen waren zwei Seen in der Dunkelheit des Schlafsaals.
»Wann können wir es wagen?«
Nachdem Emily ihr in allen Einzelheiten von dem Plan berichtet hatte, war Aurora nicht mehr abgeneigt.
»Schon morgen«, flüsterte Emily. »Bist du dabei?«
Aurora lächelte.
Zögerlich.
»Einer muss doch auf dich aufpassen.«
Emily sah zum Fenster hinaus. Betrachtete die Sterne, die durch die Lücken glitzerten, die sich zwischen den Wolken aufgetan hatten, wie Nadelstiche im Mantel der Nacht. Dünne Schneeflocken begannen auf London herabzurieseln. Bald schon würden sie die Straßen in ein Wintermärchen verwandeln. »Danke«, sagte sie, und keine zehn Minuten später war Aurora in ihrem Arm eingeschlafen.
Morgen Nacht würden sie nicht friedlich in ihren Betten liegen.
Einen Plan würden sie in die Tat umsetzen.
Gemeinsam.
Vielleicht hätte Emily gezögert, wenn sie geahnt hätte, was ihr bevorstand.
Doch da sie nicht das Geringste ahnte, zögerte sie in ihrer kindlichen Unbefangenheit nicht einen einzigen winzigen Augenblick. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Beinahe jedenfalls.
Reverend Charles Dombey war ein Mann des Glaubens, ein feuriger Protestant, und als solcher betrachtete er unehelich gezeugte und geborene Kinder als Ausgeburt der Sünde. Folglich hatte er es im Waisenhaus mit einer Vielzahl kleiner Sünder zu tun, die es erst einmal zu bekehren galt. Die dazu geeigneten Instrumente waren Strenge und Disziplin und ein unerschütterlicher Glaube an Gott, Jesus und die Jungfrau Maria.
Der Reverend musste selbst einmal verheiratet gewesen sein, doch fanden sich im ganzen Haus keinerlei Hinweise auf die Existenz einer Gattin. Böse Zungen behaupteten sogar, dass es niemals eine solche Frau gegeben hatte und dass Charles Dombey junior das Ergebnis einer sündigen Vereinigung oder das Resultat eines misslungenen Experiments gewesen sei. Nichts im Verhalten des alten Mannes deutete darauf hin, dass Charles junior sein Sohn war oder er ihm gegenüber väterliche Gefühle hegte. Es gab keinerlei vertraute Gesten. Die beiden verhielten sich wie Geschäftspartner, und manchmal schien es, als gälten die Sympathien des knochig-mageren Reverends eher dem missmutigen Mr. Meeks als seinem eigenen Sohn.
»Der Reverend hasst Kinder!«
Emily hatte es Aurora verkündet, als sie sich zum ersten Mal getroffen hatten.
»Niemals wird er dir helfen.«
Emily hatte Aurora in der Mädchentoilette im zweiten Stock kennen gelernt. Unter einem der Waschbecken hatte Aurora Fitzrovia gekauert, und Tränen waren ihr über das Gesicht gelaufen. Gezittert hatte sie am ganzen Körper.
»Ich bin Emily«, hatte Emily sich vorgestellt.
Von da an waren sie Freundinnen gewesen.
Unzertrennbar.
Vier Jahre war das nunmehr her. Eine Ewigkeit für ein Kind, das nie etwas anderes als die Mauern von Rotherhithe gesehen hat.
Der Reverend, und das erkannte Aurora sehr schnell, mochte Kinder wirklich nicht.
Diejenigen Kinder, die nicht an Ehepaare vermittelt werden konnten, arbeiteten für ihn. So waren sie wenigstens von Nutzen für das Waisenhaus. Die einzige Person, welcher der Reverend Respekt entgegenbrachte, war Madame Snowhitepink. Die beiden führten lange Gespräche in der Kammer und lächelten meistens schmallippig und zufrieden, wenn sie nach ihren Treffen die Kammer verließen. Während dieser Treffen hielten sie die Tür zur Kammer sorgsam verschlossen und niemandem, nicht einmal Mr. Meeks, war es erlaubt, die beiden zu stören. Es gab noch eine Treppe, die in einen Keller unterhalb des Kellers führte. Dort stiegen Reverend Dombey und Madame Snowhitepink oft hinunter und blieben lange Zeit verschwunden. Keines der Kinder wusste, wohin diese Treppe führte oder was die beiden dort unten trieben. Experimente, flüsterten die einen. Hexenkunst, munkelten die anderen. Die Wahrheit, hatte Emily von Anfang an gedacht, liegt wohl irgendwo dazwischen.
Den Schlüssel zur Kammer trug der Reverend allzeit bei sich.
Es war unmöglich, ihm den Schlüssel zu entwenden.
Doch Emily hatte wie gesagt einen Plan.
»Endlich werden wir erfahren, wer unsere Eltern sind«, flüsterte Emily in die Stille des Schlafsaals, »und dann werden wir von hier fliehen und sie suchen.« Der Gedanke an dieses Abenteuer zauberte ein Leuchten in ihr gesundes Auge.
»Wenn sie uns aber gar nicht haben wollen?«, gab Aurora zu bedenken.
»Dann geben sie uns vielleicht Geld, damit wir wieder verschwinden, und mit diesem Geld können wir irgendwo ein neues Leben beginnen.« Mit Geld könnte sie sich eine Fahrkarte kaufen und den nächsten Zug besteigen. Irgendwohin. Jeder Ort wäre besser als dieser hier. Die Welt stünde ihnen offen. Emily Laing und Aurora Fitzrovia, die mutigen und entschlossenen Freundinnen, würden ihr Glück in der Welt da draußen finden, und es würde der Tag kommen, an dem sie auf einer Veranda sitzen und auf das Meer hinausschauen würden, eine Tasse Tee in der Hand und keinen Gedanken mehr an die Zeit verschwendend, als sie Sklavendienste in der Kellerküche im Waisenhaus verrichten mussten.
Doch erst einmal mussten sie in die Kammer hineingelangen.
»Wir schleichen uns weg, sobald Westminster zwölfmal läutet.«
Zwei Schatten stahlen sich nach Mitternacht heimlich aus dem Schlafsaal, huschten leise wie die Mäuse den Korridor entlang, dann durchs Treppenhaus hinab in die Küche. Denn dort befand sich die Schwachstelle der Kammer. Ohne zu zögern schob Emily die kleine Tür des Lastenaufzugs nach oben. Wie lange niemand diese Einrichtung genutzt hatte, konnten die Mädchen nur erahnen. Die rostigen Scharniere ächzten bei jeder Bewegung. Dennoch hofften die beiden, dass das alte Ding noch funktionierte. Früher einmal, so konnte sich Emily erinnern, hatte Mrs. Philbrick dem Reverend oft auf diese Weise seinen Tee mitsamt Gebäck zur Nachmittagszeit nach oben geschickt. Doch dann war der Aufzug nicht mehr in Betrieb genommen worden, denn Reverend Dombey hatte keinen Tee mehr getrunken. Warum auch immer …
Der Plan, den Emily geschmiedet hatte, war denkbar einfach: Sie würde in den Aufzug klettern, und Aurora würde die Mechanik bedienen, eine Kurbel, mit deren Hilfe man den Aufzug per Hand in Bewegung setzen konnte. So würde Emily die beiden Stockwerke bis hinauf in die Kammer des Reverends fahren, aus dem Aufzug krabbeln und die Aktenschränke durchsuchen. Dann käme sie auf eben dem Wege wieder nach unten.
So weit klang es einfach.
»Viel Glück«, wünschte ihr Aurora.
Dann begann sie zu kurbeln, und der Aufzug schob sich mit einem kratzenden Geräusch nach oben. Emily hoffte inständig, dass niemand im Waisenhaus davon geweckt werden würde. Doch Aurora tat ihre Arbeit gewissenhaft und gut. Sie kurbelte gerade so langsam, dass das Geräusch, das die kleinen Rädchen in den rostigen Laufschienen machten, nicht allzu laut wurde. Man würde es für eine Laune des Windes halten, der vom dunklen Fluss herüberwehte und der in manchen wilden Herbstnächten das ganze Haus ächzen ließ.
Die Dunkelheit und die Enge des Aufzuges machten Emily Angst. Sie hatte die ganze Zeit über die Augen leicht geschlossen, als könne sie so die Schwärze der überaus beengenden Befindlichkeit vertreiben. In ihren Träumen fürchtete sie sich vor der Dunkelheit. Manchmal fragte sie sich, wie es wäre, blind zu sein. Nicht einmal lesen würde sie können. Ein Gedanke, der ihr nun, da sie in dem engen, dunklen Aufzug hockte, erneut in den Sinn kam.
Nach einer Ewigkeit, wie es schien, erreichte sie die Kammer.
Schlüpfte vorsichtig nach draußen.
Streckte die Glieder und sah sich um.
Die Kammer war verlassen, und nur ein schmaler Lichtstrahl drang durch das Fenster ins Innere. Die Luft roch muffig und abgestanden. Hohe Regale reichten bis an die gewölbte Decke des Raumes, überquellend vor staubigen Aktenordnern. Emily lauschte bangen Herzens auf etwaige Schritte im Treppenhaus. Kein Geräusch war zu hören. Behutsam ging sie auf das erstbeste Regal zu und las die Aufschriften auf den Akten: Aufwendungen und Einnahmen, säuberlich geordnet nach Jahreszahlen. Steuerbescheide. Einkaufsbelege. Mylady Wilhelmina White. Staatliche Zuwendungen. Neuzugänge.
Emily griff nach dem letzten Aktenordner und öffnete ihn.
Die Datenblätter waren mit Nummern versehen, doch gab es weder Hinweise auf die Anschriften der Eltern noch auf ihre Namen. Einzig die Zeitpunkte, zu denen die Kinder im Waisenhaus eingeliefert worden waren, hatte der Reverend vermerkt. Zusätzlich gab es auf jedem der Blätter eine Nummer: M-23/98b und so weiter. Vermutlich ein Hinweis auf Informationen, die irgendwo im Haus versteckt und nicht so leicht auffindbar waren, vermutete Emily.
Gerade ließ sie ihren Blick erneut über die Regalreihen wandern, als ein tiefes Knurren den Raum erfüllte. Das Herz des Mädchens erstarrte vor Schreck, als sie in ein Paar rot glühende Augen blickte, die draußen vor dem Fenster in der Dunkelheit zu schweben schienen. Instinktiv trat sie einen Schritt zurück und stieß rückwärts gegen den Schreibtisch des Reverends. Ein Stapel Bücher und zusammengerollte Pergamente fielen in sich zusammen und polterten lautstark auf den Dielenboden.
Emily wusste, dass ihre Tarnung aufgeflogen war.
»Auch das noch!«
Jeder im Haus musste von diesem Lärm geweckt worden sein.
Was sie nicht wusste, war, was das für ein Ding gewesen sein mochte, das draußen vor dem Fenster gekauert hatte. Rot glühende Augen, schwarzes Fell, eine lange Schnauze, hochgezogene Lefzen. Sprunghaft kehrten ihre Gedanken zu der Ratte zurück, die sie im Keller getroffen und mit der sie gesprochen hatte. Bevor sie jedoch weitere Mutmaßungen treffen konnte, splitterte das Fensterglas im Stockwerk unter ihr, und die gellenden Schreie von vielen Kindern erfüllten die Nacht. Etwas war in den Schlafraum der Neuzugänge eingedrungen. Das laute Knurren wurde zu einem lang gezogenen Heulen.
Ohne zu überlegen trat Emily ans Fenster, und was sie da sah, hätte unwirklicher nicht sein können.
Eine Gestalt beugte sich aus dem Fenster unter ihr.
Einen großen Rucksack trug sie, der sich bewegte. Etwas zappelte darin, wehrte sich, schrie wie am Spieß. Die langen Krallen des Wesens fanden mühelos Halt in der Mauer, und flink kroch es kopfüber auf allen vieren an der Hauswand hinab, um dann zwei Meter über dem Boden abzuspringen. Es landete sicher auf allen vieren auf dem Kopfsteinpflaster. Als es den Kopf hob, erkannte Emily das Gesicht eines zottigen Wolfes, dessen wilde Augen sie zu mustern schienen. Die Kreatur hielt inne, und dann erhob sie sich, stand aufrecht auf zwei Beinen da und ließ ein schauerliches und siegessicheres Heulen die Nacht zerreißen. Eine Krallenhand deutete hinauf zu dem Fenster, hinter dem Emily bangen Herzens stand, als wolle die Kreatur klarstellen, dass sie Emilys Gesicht nie wieder vergessen und ihr baldigst einen eigenen Besuch abstatten würde. Schließlich drehte die Kreatur dem Waisenhaus den Rücken zu und lief auf allen vieren in den Nebel, der von der Themse aufzog und langsam durch die Gassen und Straßen Rotherhithes kroch.
Es ist Mara, die sich in dem Sack befindet.
Emily wusste es.
Spürte es.
Flüsterte: »Was geht hier nur vor?«
Dann überschlugen sich die Ereignisse.
Die Tür zur Kammer wurde aufgerissen, und Emily, starr vor Schreck, stand wie am Boden festgenagelt da.
»Nummer Neun?«, hörte sie nur die wütende und gleichsam verwirrte Stimme des Reverends, der in wehendem Hausmantel vor ihr stand. »Was in aller Nekir Namen hast du hier zu suchen?«
Die Situation war irgendwie unwirklich.
Im Treppenhaus hinter dem Reverend war Tumult ausgebrochen.
Mr. Meeks versuchte verzweifelt, für Ruhe zu sorgen, indem er die aufgeregt umherrennenden Kinder anschrie. Der Reverend schien nicht zu verstehen, was genau Emily in der Kammer zu suchen hatte, und noch weniger, wie sie dort hineingekommen war. Er warf einen Blick hinüber zum Fenster, und als er sich vergewissert hatte, dass das Fenster verschlossen war, gewann er seine Fassung zurück.
»Du«, herrschte er Emily an und betonte seine Worte mit einem auf sie zeigenden, ausgestreckten knochigen Finger, »du rührst dich nicht von der Stelle, du kleine Missgeburt! Wir sprechen uns später.«
Dann lief er ins Treppenhaus hinaus.
Emily stand immer noch wie angewurzelt da.
Die Kinder im Treppenhaus schrien etwas von einem Werwolf, der sich ein Mädchen aus dem Schlafraum der Neuzugänge geschnappt habe. Der Reverend herrschte sie an, es gäbe keine Werwölfe. Und Mr. Meeks versuchte nebenher Mr. Biggles zu beruhigen, der sich mit Buckel und aufgestelltem Haar wütend und verwirrt fauchend am Treppengeländer festgekrallt hatte.
Das Geschrei der anderen Kinder weckte Emily schließlich aus ihrer Lethargie.
Zögerlich trat sie aus der Kammer und begutachtete das Durcheinander wild umherlaufender Menschen. Der feiste Dombey junior rannte ratlos umher, und schnell bestätigte sich, wen die seltsame Kreatur entführt hatte.
Nummer Einunddreißig.
Die kleine Mara, von der die Ratte gesprochen hatte.
Der Reverend hatte glücklicherweise keine Zeit, sich um Emily zu kümmern. Und diesen Vorteil musste sie nutzen. Während die Dombeys versuchten, dem Chaos Herr zu werden, verließ Emily die Kammer durch die Tür und rannte die Treppe hinunter, wich dem feisten Dombey junior aus, der sie plump zu packen versuchte, und rannte weiter. Immer nur weiter.
Ein Stockwerk tiefer warf sie einen kurzen Blick in den Schlafsaal der Neuzugänge. Das Fenster war zerbrochen, und eines der Kinderbettchen, dasjenige mit der Nummer Einunddreißig, war umgestoßen worden. Der Anblick genügte Emily, um sich erneut der seltsamen Begegnung mit der Ratte zu entsinnen. Was war hier nur geschehen? Wer war diese Kreatur gewesen, die im Nebel verschwunden war? Warum hatte die Ratte sie gebeten, auf Mara aufzupassen?
Dann klärten sich plötzlich ihre Gedanken.
All diese Fragen würde sie später beantworten können – oder auch nicht. Wenn der Tumult sich gelegt hätte, würde der Reverend sich fragen, was sie, Emily Laing, in der Kammer zu suchen gehabt hatte. Man würde sie bestrafen, zweifelsohne. Mr. Meeks würde sie auf Geheiß des Reverends in die Dunkelkammer unten im Kellergewölbe sperren, wo ihre einzige Gesellschaft Spinnen und anderes krabbelndes Getier sein würden, und das für mehrere Tage.
»Nummer Neun!«, hörte sie Dombey junior schreien. Er kam die enge Treppe heruntergepoltert. »Du bist in die Kammer eingebrochen, wie ich gehört habe.« Er war hinter ihr her. »Was hast du dir dabei gedacht, du kleine Missgeburt? Und was hast du mit dem Verschwinden von Nummer Einunddreißig zu tun?«
Emily dachte nicht einmal nach.
Rannte einfach los.
»Bleib stehen, kleines Miststück«, rief ihr Verfolger. »Niemand verlässt das Haus ohne Erlaubnis. Ich verbiete dir abzuhauen!« Gleichzeitig zu schreien und zu laufen fiel ihm sichtlich schwer.
Emily erreichte das Erdgeschoss und rannte zur Tür, rüttelte am Schloss und stellte erschrocken fest, dass sie verriegelt war.
»Steh still!«
Ihr Verfolger war ihr auf den Fersen.
Es gab aber noch einen Weg nach draußen.
Emily flitzte die Kellertreppe hinunter, wo sie auf eine erschrockene Aurora Fitzrovia traf.
»Keine Zeit für Erklärungen«, keuchte Emily. »Ich werde abhauen.«
Ihre Freundin blickte überrascht drein.
»Wo willst du denn hin?«, fragte Aurora.
»Einfach nur weg«, antwortete Emily.
»Was ist da oben passiert?«
Emily war sich bewusst, wie verrückt es klang. »Ein Werwolf hat Mara geraubt.«
»Den Neuzugang?«
Emily war überrascht, weil sie nicht nach dem Werwolf fragte.
»Ja.«
»Was hat das mit dir zu tun?«
»Ich habe keine Ahnung.« Das war die Wahrheit.
»Und du wirst zurückkehren?«
Emily nickte.
Ergriff kurz Auroras Hand.
Drückte sie.
»Ja!«
Aurora schluckte. »Versprochen?«
Emily ergriff nochmals die Hand ihrer Freundin und drückte sie fest.
»Versprochen«, meinte sie.
Der Augenblick endete viel zu früh.
Das wütende Geschrei Dombey juniors wurde lauter. Die beiden Mädchen wussten, dass sie sich nun trennen mussten.
»Lauf«, sagte Aurora zum Abschied, und Emily tat, wie ihr geheißen wurde. Aus dem Waisenhaus zu fliehen beziehungsweise einen Weg hinauszufinden, war niemals das Problem gewesen. Die Entschlossenheit, es zu tun – daran scheiterten die Pläne der meisten Kinder. Jeder hatte Angst vor dem, was nach dem Waisenhaus kommen würde. Doch statt darüber nachzudenken, was ihr wohl bevorstünde, handelte sie; lief, rannte, so schnell ihre Füße sie zu tragen vermochten. Hinab in den Keller. Hinein in die Küche, wo sie sich hastig die alte Jacke überstreifte, die sie immer in den Morgenstunden trug, wenn die ersten Lieferungen eintrafen. Hinauf durch den Lieferanteneingang, dessen Schloss sich jederzeit mit dem Schlüssel öffnen ließ, der neben Mrs. Philbricks Herd an der Wand hing.
Und hinein in die eisig klirrende Nacht.
Emilys Atem vermischte sich mit dem dichten Nebel, der ihr sofort die Orientierung nahm. Da waren die hohen Mauern des Waisenhauses über ihr, die matt glimmenden Straßenlaternen vor ihr. Das Labyrinth des nächtlichen London hieß sie willkommen. Die Angst hatte Besitz von Emilys kleinem Herzen ergriffen und ließ sie schneller und schneller laufen. Natürlich hatte sie noch die Fratze des Wesens vor Augen, das Mara gestohlen hatte. Irgendwo hier draußen musste sich die Kreatur noch herumtreiben.
Doch wollte Emily in diesem Augenblick nur davonlaufen.
Weg vom Reverend und seinem Waisenhaus. Weg von ihrem bisherigen Leben. All das wollte sie hinter sich lassen. Und als sie in den letzten Zug sprang, der Rotherhithe in dieser Nacht verließ, die Türen surrend hinter ihr zugingen und sie nach Luft schnappend und zitternd in dem warmen, menschenleeren Abteil in einen Sitz sank, da schloss sie zum ersten Mal seit Stunden die Augen und hoffte inständig, das Richtige getan zu haben.
Kapitel 2
Wittgenstein
Nicht einmal die Ratten konnten die kleine Emily Laing vor allem Übel bewahren, wenngleich sie es – beherzt wie sie nun einmal sind – versuchten. Die U-Bahn brachte das kleine Mädchen bis nach Whitechapel, wo sie orientierungslos durch die Tunnel irrte und schließlich die grüne Linie bis hinauf nach Notting Hill Gate bestieg. Dort angekommen stand sie verwirrt und zitternd auf dem menschenleeren Bahnsteig.
Ein schwülwarmer Hauch abgestandener Luft wehte ihr ins Gesicht, als der Zug den Bahnhof verließ. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass sie nun endgültig allein war. Noch einsamer, als sie es im Waisenhaus gewesen war. Sie dachte daran, dass sie ihren Teddy in all der Hektik dort zurückgelassen hatte, und hoffte, dass sich Aurora seiner annehmen würde.
An wen sollte sie sich jetzt wenden?
Wo sollte sie die Nacht und, noch viel wichtiger, die nächsten Tage verbringen? Es war Winter und bitterkalt. Mittlerweile machten sich Zweifel in ihrem Herzen breit, dass die Entscheidung, aus dem Waisenhaus zu fliehen, vielleicht doch eine übereilte gewesen war. Die Stadt war mit Sicherheit kein Platz für ein kleines Mädchen wie sie. Unschlüssig, wohin sie sich wenden sollte, stand sie einfach nur da. Schließlich setzte sie sich auf eine der Plastikbänke und fiel gedankenverloren und erschöpft in tiefen Schlaf.
Sie träumte von ihrem Stoffbären und Aurora und der kleinen Mara und dem Werwolf, der sie aus dem Waisenhaus geraubt hatte, von den glühenden Augen und dem tiefen Knurren. Der Geruch erinnerte an das nasse, zottige Fell eines großen Hundes, und als Emily aus dem Schlaf aufschrak, blickte sie in das Gesicht eines Wolfes, der über ihr stand und triumphierend auf sie herabsah.
»Dachtest, du könntest Larry entwischen«, hörte sie eine tiefe Stimme. »Da haste dich aber schwer jetäuscht, kleine Missy!«
Emily riss die Augen auf und kreischte schrill. Das Wesen stand nur da und grinste hämisch. Es war tatsächlich ein Wolf, oder vielmehr ein Junge mit einer langen spitzen Nase und starkem Haarwuchs im Gesicht und auf den Handrücken. Er trug eine alte schmuddelige Jeansjacke mit Pelzkragen.
»Keine Menschenseele entkommt Larry«, knurrte der Junge. »Iss nie nich passiert, dat kannste mir glauben. Iss nich passiert in hunnert Jahrn, sach ich ma.« Er entblößte eine Reihe scharfer Zähne, und wenn er so grinste, dann verschwand alles Menschliche aus dem spitzen Gesicht. »Biss ne Zeugin. Iss nich gut, wenn ma Larry jesehen hat bei dem, wassa so macht. Gar nich gut. Ers rech nich für den, der ’n jesehen hat!«
»Lassen Sie mich in Ruhe!«, schrie Emily und wich ängstlich vor der Gestalt zurück, die ihre Reaktion amüsiert beobachtete.
Der Bahnsteig war verlassen, und Emily hörte nur ihren eigenen Schrei von den Tunnelwänden widerhallen. Dabei war es bereits kurz nach fünf Uhr, wie sie der Anzeigetafel entnehmen konnte, und der Tag war ein Mittwoch. Wo blieben die Passanten, all die Menschen, die auf ihrem Weg zur Arbeit die U-Bahn nahmen? Emily rutschte so weit wie möglich auf der Bank nach hinten und schaute zum nächstgelegenen Ausgang, doch der Wolfsjunge versperrte ihr den Weg dorthin. Sie würde es nicht schaffen, diesem Wesen davonzulaufen. Was sollte sie nur tun? Nun bereute sie es wirklich, aus dem Waisenhaus geflohen zu sein. Sie hatte Angst, und ihr kindlicher Verstand konnte sich in tausend Variationen ausmalen, was dieses Wesen mit ihr anzustellen vermochte.
Dann hörte sie eine vertraute Stimme.
Miss Laing, Sie müssen mir folgen.
»Hyronimus?«, fragte Emily verdutzt und blickte in Richtung der Stimme, die ihren Ursprung unter der Bank zu haben schien.
Der Wolfsjunge tat es ihr gleich und dies mit einer schnellen, ruckartigen Kopfbewegung, die erahnen ließ, wie flink er zu reagieren vermochte.
Tun Sie, was ich sage!
Es wimmelte plötzlich überall von Ratten.
Aus den Öffnungen der Luftschächte oben an der Decke kamen sie und rieselten auf den Bahnsteig herab, krochen raschelnd aus den Mülleimern und ergossen sich aus den Löchern in den gekachelten Wänden. Sie strömten von den Schienen auf den Bahnsteig und bildeten in Windeseile einen Teppich umherwuselnder pelziger Leiber, die quiekten und fauchten und sich wie kleine Helden auf den Wolfsjungen stürzten.
»Dreckige Drecksviechah«, knurrte der Wolfsjunge zornig und sprang instinktiv mit einem Satz in die Höhe. Emily bemerkte, dass er keine Schuhe trug und dass dort, wo normalerweise seine nackten Füße hätten sein müssen, große Pranken mit langen, vergilbten Krallen aus der zerrissenen Jeans lugten. Der Rattenstrom reagierte schnell wie ein Schwarm kleiner Fische und folgte dem Wolfsjungen. Wie wild stürzten sich die Ratten auf ihn. Wütend und mit einem boshaften Heulen hieb der Wolfsjunge auf die angreifenden Ratten ein, riss viele kleine Leiber in Stücke, wirbelte sie tobsüchtig umher, bekam sie an den Schwänzen zu packen und warf sie gegen die Wände, wo sie mit einem dumpfen Geräusch abprallten und leblos oder vor Schmerzen fiepsend zu Boden fielen. Das verzweifelte Quieken vieler verletzter und sterbender Ratten erfüllte den Bahnhof und hallte schauerlich von den Wänden wider.
Folgen Sie mir! Geschwind!
Emily richtete ihre Aufmerksamkeit nun auf jene Ratte, die an ihrem Hosenbein nach oben kletterte. Es war tatsächlich dieselbe Ratte, mit der sie im Waisenhaus kurz gesprochen hatte. Das Tier hatte ein dunkles, fast schwarzes Fell und einen kleinen, hellen Flecken auf der Stirn, dicht über den wachsamen schwarzen Knopfaugen. Laufen Sie dort hinaus, wies die Ratte ihr den Weg. Wir müssen Gleis drei erreichen, in einer halben Minute fährt dort die Central Line ab. Flink war das kleine Tier auf Emilys Schulter geklettert und krallte sich dort mit den kleinen Füßchen an ihrer Schulter fest. Und jetzt laufen Sie los!
Ohne zu überlegen gehorchte Emily.
Der Wolfsjunge kämpfte noch immer mit den Ratten, deren Strom allmählich abebbte. Die kleinen Wesen hatten keine Chance gegen einen ausgewachsenen Werwolf (mittlerweile war Emily davon überzeugt, dass der Wolfsjunge ein solches Wesen sein musste); sie vermochten ihn allenfalls abzulenken und zu beschäftigen – und nur das war schließlich das Ziel ihrer mutigen Attacke gewesen. Emily hatte keine Ahnung, weshalb die Ratten sich derart für sie einsetzten. Was ging hier nur vor? Sprechende Ratten, ein Werwolf, der ihr nachsetzte?
Wie auch immer – sie rannte so schnell sie ihre müden Füße trugen durch die Tunnel, die Ratte Hyronimus auf ihrer Schulter, und dann hörte sie das laute, lang gezogene Heulen. Gefolgt von einem tiefen Keuchen und dem Geräusch, das scharfe Krallen auf dem Asphalt machten. Während des Laufens warf sie einen Blick zurück und wurde des Wolfsjungen gewahr, der ihr mit großen Sprüngen nachsetzte. Mit Schrecken erkannte sie, dass er sich im Laufen veränderte. Sein Gesicht schien sich zu verformen, dehnte sich zu einer langen Schnauze mit triefenden Lefzen, die Augen hatten erneut das rote Glühen bekommen, und er rannte nun auf allen vieren. Er knurrte, fauchte und keuchte.
Pochenden Herzens erreichte Emily Gleis drei, und wie es die Ratte prophezeit hatte, fuhr dort genau in diesem Moment die U-Bahn ein. Die Schiebetüren öffneten sich, und Emily sprang in den ersten Wagen, den sie erreichte. Hinter sich konnte sie keinen Werwolf erkennen. Nach einem Augenblick, der einer Ewigkeit gleichkam, schlossen sich die Türen endlich, und der Zug setzte sich infernalisch kreischend in Bewegung. Heiß war es und stickig. Es roch nach Teer und verschmorten Stromkabeln und dem Schweiß der Fahrgäste vom vergangenen Tag.
Die wenigen bereits im Zug sitzenden und Zeitung lesenden Pendler warfen dem kleinen Mädchen in den schmutzigen Sachen abfällige Blicke zu.
Emily beachtete die anderen Menschen nicht einmal.
Sie fühlte sich keineswegs sicher.
Keiner der Anwesenden würde sie vor dem, was ihr nachsetzte, beschützen können.
Dann erreichte der große Werwolf den Bahnsteig und heulte wütend auf. Ein Passant im Nadelstreifenanzug, der wie der Werwolf den Zug verpasst hatte, blickte das Wesen erstaunt an. Emily glaubte noch zu erkennen, wie der wütende und genervte Werwolf den verdutzten und nunmehr eher ängstlichen als genervten Geschäftsmann mit ausgefahrenen Krallen ansprang, doch dann war der Zug auch schon im Tunnel und der Bahnsteig ihrem Blickfeld entschwunden.
ENDE DER LESEPROBE