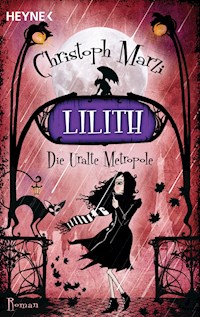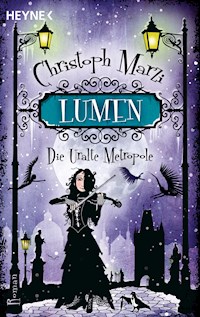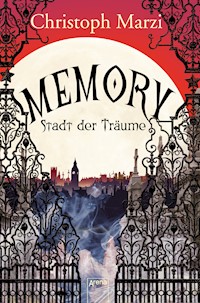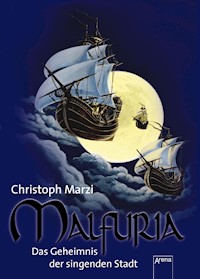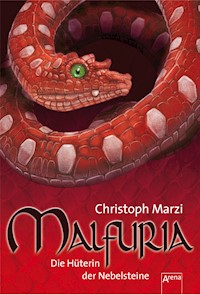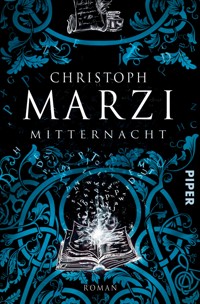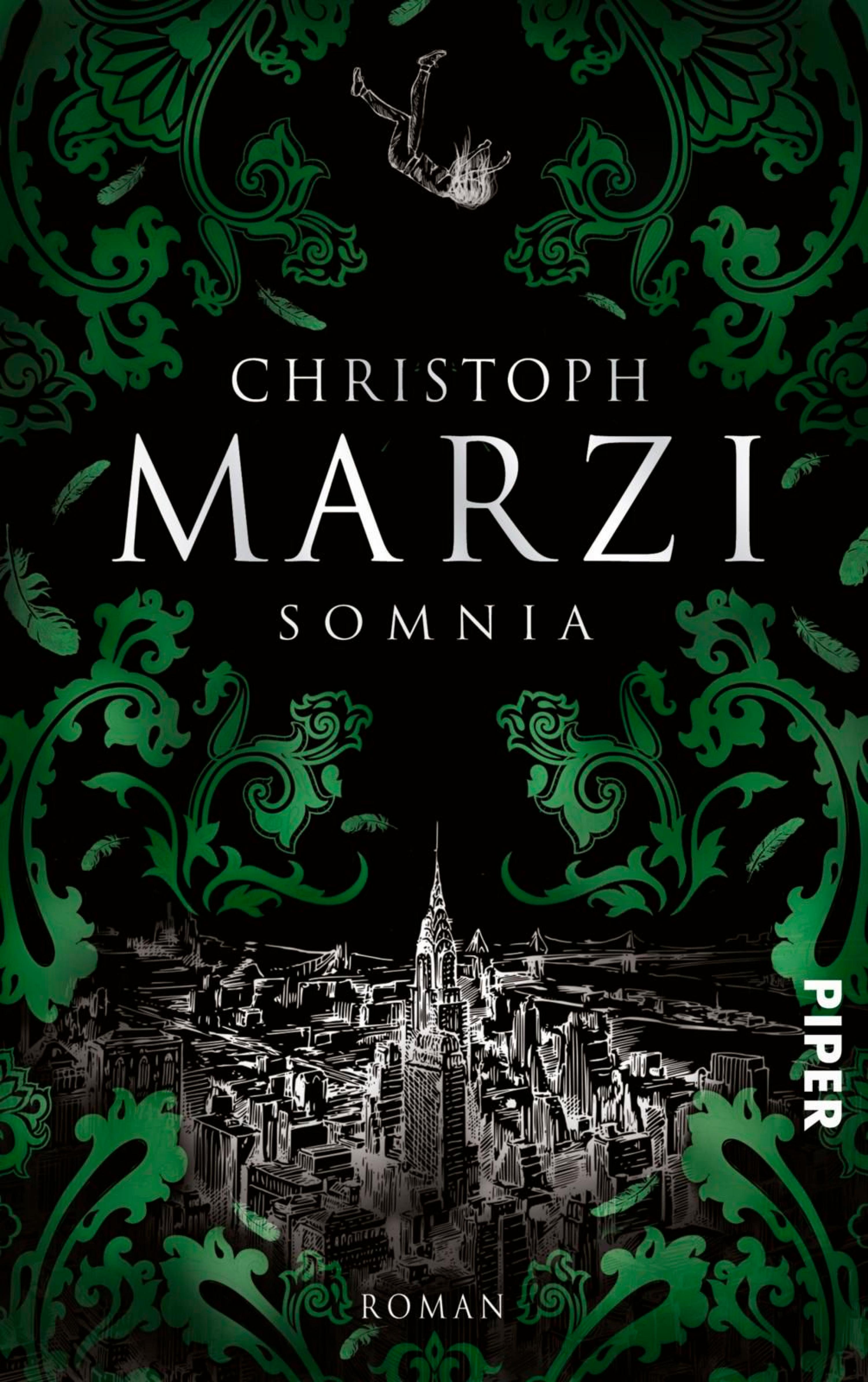11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schwere Schneeflocken tanzen in der Dämmerung, als Emily Laing das erste Mal London nicht mehr findet. Doch wie kann das sein? Eine ganze Stadt verschwindet doch nicht einfach so. Mitsamt all ihren Schornsteinen, Bewohnern und Geheimnissen. Hat das vielleicht etwas mit den beiden seltsamen alten Damen zu tun, die Emily entführen? Oder hängt es mit dem Waisenmädchen zusammen, das plötzlich auf den Stufen einer U-Bahn-Rolltreppe auftaucht? Noch einmal müssen Emily und ihre Gefährten, der Alchemist Wittgenstein, Maurice Micklewhite und die kluge Ratte Minna, in die Tiefen der Uralten Metropole hinabsteigen. Denn hier, in der magischen Stadt unter der Stadt, liegt die Antwort. Und die Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
CHRISTOPH MARZI
London
EIN URALTE-METROPOLE-ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Schwere Schneeflocken tanzen in der Dämmerung über dem Bahnhof von Cambridge. Am Bahnsteig steht eine junge Frau mit leuchtend roten Haaren und wartet auf den Zug nach London: Emily Laing. Doch Emily wartet vergebens. Der Zug kommt und kommt nicht, es erfolgt weder eine Durchsage noch ist auf den Anzeigetafeln etwas über die neue Ankunftszeit des Zuges zu lesen, und was noch viel merkwürdiger ist: Niemand außer Emily scheint die Verspätung zu bemerken. Keine maulenden Fahrgäste, keine schimpfenden Mitreisenden. Als Emily sich schließlich bei einem der anderen Wartenden erkundigt, behauptet dieser, noch nie von diesem London gehört zu haben. Oxford ja, aber London? Eine Stadt dieses Namens gibt es nicht und gab es auch noch nie. Verwirrt stellt Emily weitere Nachforschungen an und stellt fest, dass London tatsächlich verschwunden ist, mitsamt seinen Schornsteinen, Bewohnern und Geheimnissen! Hat das vielleicht etwas mit den beiden seltsamen alten Damen zu tun, die wenig später Emily entführen? Oder hängt es mit dem Waisenmädchen zusammen, das plötzlich am Fuße einer U-Bahn-Rolltreppe auftaucht? Noch einmal müssen Emily und ihre Gefährten, der Alchemist Wittgenstein, Maurice Micklewhite und die kluge Rättin Minna, in die Tiefen der uralten Metropole hinabsteigen. Denn hier, in der magischen Stadt unter der Stadt, liegt die Antwort. Und die Gefahr …
Der Autor
Christoph Marzi, Jahrgang 1970, wuchs in Obermendig nahe der Eifel auf, studierte in Mainz und lebt heute mit seiner Familie im Saarland. Seit dem großen Erfolg seiner Saga um die Uralte Metropole (Lycidas, Lilith, Lumen und Somnia) ist er einer der erfolgreichsten deutschen Fantastik-Autoren.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Originalausgabe 10/2016
Redaktion: Uta Dahnke
Copyright © 2016 by Christoph Marzi
Copyright © 2016 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -illustration: Ann-Kathrin Hahn,
DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung
mehrerer Motive von Shutterstock
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-18428-5V001
www.heyne.de
Für
Erna Bickelmann
(1931 – 2015)
»Die Welt ist voller offensichtlicher Dinge, die nie jemand wahrnimmt.«
ARTHUR CONAN DOYLE,Der Hund der Baskervilles
ERSTES BUCH
Schnee
1. Kapitel
Die verwehte Metropole
Die Welt ist gierig, und viel zu oft entschwindet einem die Zuversicht im Sturm der wankelmütigen Ereignisse, die weder bei Tageslicht noch im Nachtland angesiedelt sind. Emily Laing, die ihren Namen neuerlich trug wie einen alten Mantel, wusste, wie finstere Winterstürme sich anfühlten, wenn man sie nicht kommen sah. Sie wusste genau, was das Leben einem antun konnte, wenn man unvorsichtig war. Nichts aber hatte sie auf das vorbereitet, was an jenem merkwürdigen Tag im Dezember geschehen sollte, als kalte Winde eisig die kleine Stadt berührten und mehr als nur einen kurzen Augenblick im Leben so vieler verwehten.
Die junge Frau wartete auf dem Bahnhof in Cambridge, während sich über ihr der Himmel öffnete und schwere Schneeflocken in die Dämmerung entließ, verlorene Träume wie jene, die sie selbst so oft berührte. Niemand auf dem überfüllten Bahnsteig schenkte ihr Beachtung, und das war gut so. Am liebsten blieb sie unauffällig. Sie war nur eine gewöhnliche Reisende, eine von vielen, die neben Touristen, Studenten, Büro- und Bankangestellten im Feierabendverkehr auf den Zug warteten. Eine junge Frau, deren leuchtend rotes Haar ihr tief ins Gesicht fiel und ein Auge, das linke, vor den Blicken der Passanten schützte. Noch immer, nach all den Jahren, war ihr Mondsteinauge ein Geheimnis, das sie so gut zu verbergen suchte wie nur möglich. Es erinnerte sie an so viele Dinge, an die sie nicht erinnert werden wollte. An die Zeit, in der sie ein Kind gewesen war und sich noch wie ein Kind gefühlt hatte, damals, in dem Waisenhaus in London namens Dombey & Son, dicht am Fluss gelegen, bei den Docks in Rotherhithe.
Sie seufzte wehmütig und zugleich erleichtert. Ein Kind war sie jetzt nicht mehr, ein Mädchen vielleicht doch, noch nicht wirklich eine Erwachsene, gewiss aber kein Teenager mehr. Vierundzwanzig, das war ihr Alter, und so fühlte sie sich; wenn sie daran dachte, dann fragte sie sich, wo all die Jahre nur hin waren. Und ihr Zuhause? Es gab so viele Orte. Kaum einer von ihnen war ihr länger treu geblieben. Hampstead Manor, Streatley Place, Berry Street. Ja, sie gehörte zu jenen, die nicht wirklich wussten, wo sie hingehörten. Aber sie wusste, was sie zu tun vermochte, und deswegen war sie hierhergekommen. Manchmal war zu wissen, was man tun konnte, schon sehr, sehr viel. Manchmal war zu tun, wozu man in der Lage war, einfach nur kräftezehrend.
Die Uhr zeigte 17:40.
Sie rieb sich die Hände.
Lange würde es nicht mehr dauern.
Emily beobachtete ihren Atem, der in kleinen Wolken vor ihrem Gesicht schwebte. Sie sehnte sich nach dem warmen Abteil des Abendzuges. Sie wusste, dass sie nicht unbedingt einen Sitzplatz ergattern würde, aber die Wärme im Zug würde sie für alle Unannehmlichkeiten entschädigen. Sie würde laut Musik hören, dabei die Augen schließen und nach und nach dieses äußerst ungute Gefühl, das sie bei dem Besuch in der Lensfield Road beschlichen hatte, vergessen.
Es war nicht gerade ein außergewöhnlicher Fall gewesen, nur ein kleines Kind, das sich gefürchtet hatte. Im Dunkeln, in der Schule, des Nachts. Ein Junge, der manchmal geschlagen wurde und zu oft die dunklen Winkel im Keller des großen Hauses mit den kleinen Türmen und dem Efeu an den Wänden erblickt hatte.
»Können Sie ihm helfen?« Mrs. Whitmore, die besorgte Mutter, war während der gesamten Sitzung zugegen gewesen. »Er ist ein so lieber Junge«, hatte sie mehrmals betont. Mr. Whitmore, der schattenhaft schrecklich durch die Träume des Jungen geisternde Vater, war geschäftlich unterwegs gewesen.
»Ich werde tun, was ich kann«, hatte Emily versprochen. Das sagte sie immer. Sie hatte festgestellt, dass es die Menschen beruhigte. Sie hatte behutsam die Gedanken des Jungen betreten und ihn dort, in jener seltsamen Welt, die fortwährend in Bewegung war, bei der Hand genommen, ein Stück des Weges geleitet, Timothy Whitmore, gerade acht Jahre alt, blass, still, schüchtern. Tiny Tim hatte sie ihn in jener Welt genannt, als könne schon allein das ihm Schutz und Liebe gewähren, und ihm gezeigt, wie er dem Schatten seines leiblichen Vaters entrinnen konnte. Sie hatte ihn gelehrt, durch die Tür zu gehen, die sie gemeinsam mit ihm gesucht hatte, und hinter sich zu lassen, was ihn bedrückte. Die Tür war gewissermaßen der Schlüssel, um mit den schlimmen Dingen fertigzuwerden.
»Es geht ihm jetzt gut«, hatte Emily der Mutter gesagt. »Er wird keine Angst mehr haben.«
»Sie ahnen ja nicht, wie dankbar ich Ihnen bin.«
»Timothy ist derjenige, dem Sie dankbar sein sollten«, hatte Emily nur festgestellt, mehr war nicht nötig gewesen. Mrs. Whitmore wusste ganz genau, worauf sie anspielte. Es lag wohl in ihrer Natur, nicht nachzufragen. Menschen wie sie, das wusste Emily, taten das nie. Sie stellten keine Fragen, weil sie die Antworten, die sie kannten, nicht hören wollten.
»Wie auch immer, ich danke Ihnen.«
»Seien Sie auf der Hut.«
Mrs. Whitmore hatte nur den Blick gesenkt. »Ja. Das werde ich sein.«
Nichts wird sich ändern, hatte Emily traurig gedacht. Das tat es nie. Zu oft sah sie Dinge wie diese. Mrs. Whitmore hatte einen Mann, der immerzu Macht ausübte. Über alle, die das Pech hatten, ihr Leben mit ihm teilen zu müssen. Macht über seine Frau, den kleinen Jungen, vermutlich auch die Angestellten seiner Firma, der Whitmore Trading Company. Die Angst war sein Verbündeter, so lief das immer im Leben. Nein, wahrlich, nichts würde sich ändern.
»Seien Sie auf der Hut«, hatte Emily erneut betont. Dann hatte sie sich empfohlen und eilig das Haus verlassen, noch bevor Tiny Tim wieder aufgewacht war. So hielt sie es stets. Das war das Beste. Tiny Tim würde sich kaum an sie erinnern und schnell vergessen, dass sie bei ihnen im Haus gewesen war. Mr. Whitmore würde abends heimkehren, und was auch immer sich dort in der Lensfield Road No. 7 normalerweise zutrug, würde sich erneut zutragen. Emily konnte das nicht verhindern, nein, nur Mr. und Mrs. Whitmore konnten das tun. Aber sie hatte dem Jungen gezeigt, welchen Weg er gehen konnte, um dem zu entrinnen, was ihn verfolgte. Würde er das nächste Mal zur Strafe ein paar Stunden allein im dunklen Keller verbringen müssen, würde er zumindest gewappnet sein. Er würde wissen, was zu tun war, und an den Ort gehen, den Emily ihm gezeigt hatte, jenen Ort, den sie vorhin gemeinsam aufgesucht hatten, und dort würde er verweilen und sich ausruhen können, um Kräfte zu sammeln, ja, er würde der Angst die Stirn bieten. Das war alles, was sie tun konnte. Es war vermutlich nicht viel, aber es war ihre besondere Gabe.
Sie erinnerte sich an das düstere Waisenhaus in Rotherhithe, an Mr. Dombey und seinen Sohn, an Mr. Meeks und an die Schläge, die man ihr verabreicht hatte, an den Rohrstock, der das kleine Mädchen, das sie damals gewesen war, mitten ins Gesicht getroffen und sie das linke Auge gekostet hatte. Sie erinnerte sich an das kalte Glasauge, an das sie sich nie hatte gewöhnen können, an die Gemeinheiten der anderen Kinder. »Einäugige Missgeburt«, so hatten manche sie genannt. Zuweilen erinnerte sie sich so sehr an alles, was geschehen war, dass sie sich nichts sehnlicher wünschte, als dass jemand mit ihr tun würde, was sie seit ein paar Jahren mit den Kindern tat, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Sie seufzte, versucht, Tiny Tim zu vergessen, und war doch den Bildern gegenüber machtlos, die sie nach jeder dieser Sitzungen mit sich nahm wie einen Schmerz, den zu teilen sie den Kindern versprochen hatte. Timothys tiefe Seelenängste und die bedrohlichen Schatten aus seinen Träumen würden sich aus ihrem Herzen verflüchtigt haben, noch bevor der Zug in King’s Cross einfuhr, sicherlich, das würden sie. Im Augenblick aber, jetzt und hier, auf dem Bahnsteig, da waren sie noch bei ihr wie ein bitterer Geschmack, den sie nicht loswerden und erst recht keinem anderen aufbürden konnte.
Selbst Professor Nickleby nicht. Obschon der von ihrer Gabe wusste.
»Wie fühlen Sie sich?«, hatte er kaum eine Stunde nach ihrem Besuch bei dem kleinen Timothy wissen wollen.
»Fragen Sie nicht«, hatte sie geantwortet.
Charles Nickleby bekleidete einen Lehrstuhl am Magdalene College in Cambridge. Er war es, der sie im Namen der Familie Whitmore um einen Besuch gebeten hatte; auf sein Anraten hatte man Emily konsultiert. Er besaß einen verwinkelten Buchladen in der Pembroke Street, der allerlei kostbare vergilbte Ausgaben beherbergte und so etwas wie eine inoffizielle Zweigstelle der uralten Bibliothek des Trinity College war. Bevor sie zum Bahnhof gefahren war, hatte Emily einen kurzen Abstecher dorthin gemacht, um eine seltene alte Ausgabe von The History of the Unnamed zu erstehen.
Nickleby hatte ihr den Band sorgsam in Paketpapier eingepackt. »Wittgenstein wird begeistert sein.«
»Ja, er steht auf so was.«
Emily musste bei der Erinnerung daran lächeln. Einerseits voller Zuneigung, weil sie an ihren Mentor dachte, und andererseits voll Melancholie, weil niemand hier auf dem Bahnsteig ahnte, wer sie war und was sie zu tun vermochte. Sie war nur jemand, der auf den Zug wartete, eine Studentin vielleicht, gedankenverloren, unauffällig. Ihre Hände waren in den Taschen des tiefblauen Mantels vergraben, den Kragen mit dem Kunstfellbesatz hatte sie hochgeschlagen, die alte Tasche mit dem Buch hielt sie eng an den Körper gepresst. Sie hörte laut Musik über die Ohrstöpsel, Belle & Sebastian, betrachtete dabei die Welt um sich herum und klammerte sich an den Gedanken, dass alles einen Rhythmus und eine Melodie hatte – auch wenn beides zuweilen ganz und gar verzerrt war und schrecklich entstellt –, sogar die Schneeflocken und die Lokomotiven, die auf den abgelegenen Gleisen Güterwaggons rangierten.
Die Menschen, die mit ihr auf dem Bahnsteig standen, beachteten sie nicht. Sie warteten einfach, wie sie, jeder in das vertieft, was sein Smartphone ihm offerierte. Sie alle flüchteten sich in eine Welt jenseits dieser, ein digitales Land, so anders als alles, was Emily kannte. Keiner schaute den anderen an. Es war gespenstisch, wie wenig Beachtung die Menschen einander schenkten. Jeder trug seine kleine Scheinwirklichkeit mit sich herum und hütete sie wie ein Geheimnis. Anders als Emily, die es bereits wahrlich zur Genüge erfahren hatte, ahnte keiner von ihnen, wie die Welt wirklich war.
Emily blickte die Gleise entlang in die Dunkelheit. Die Lichter der Stadt leuchteten hell, bald würde die Nacht sich überall ausgebreitet haben. Ja, in den Gesichtern vieler Menschen war es schon Nacht, sie konnte es sehen. Es war eine Nacht, die sie in ihren Alltag ließen, eine Nacht, die auch Emily vor einiger Zeit verspürt hatte, tief in ihrem Herzen, als sie nach London zurückgekehrt war.
Sie schaute zur Anzeigetafel hinauf. Dann auf die Zeiger der Uhr daneben.
Noch immer nichts!
Die Zeit verging wieder einmal quälend langsam.
Sie senkte den Blick, lauschte der Musik, wippte mit dem Fuß im Takt, wartete. Mehr konnte sie nicht machen. Die Musik tat gut, denn sie löste andere Gefühle in ihr aus, brachte positive Assoziationen mit sich. Emily fing schon an, Tiny Tim zu vergessen. Denn das musste sie. Gerade so, wie sie all die anderen Kinder vergaß, denen sie zu Hilfe eilte. Sie vergaß die Namen, vergaß die Gesichter, vergaß die Geschichten.
Nur so funktionierte es. Nur so konnte sie mit dem, was sie sah, leben.
Die eisige Luft auf dem Bahnsteig kroch ihr in den Mantel und ließ sie erschauern. Emily wickelte sich ihren langen grünen Schal um den Mund und atmete leise in die warme Wolle. Das half ein wenig, die Kälte abzuwehren.
Ungeduldig ging sie auf dem Bahnsteig auf und ab. Am Morgen war bereits der erste Schnee gefallen, und Emily malte mit der Stiefelspitze ein Muster in das Weiß, das den Bahnsteig an manchen Stellen bedeckte.
Sie schaute erneut auf die Uhr, dann wieder zur Anzeigetafel. Sie schaltete die Musik aus.
Der dämliche Zug müsste längst da sein, aber es wurde nichts angezeigt. Er hatte Verspätung, ganz klar, aber außer ihr schien das niemanden zu kümmern. Was seltsam war, denn normalerweise gehörte Emily zu denen, die sich problemlos in Geduld übten. Die Geschäftsleute waren üblicherweise die Ersten, die übel gelaunt und unruhig wurden und sich beschwerten.
»Entschuldigen Sie«, sprach sie den Mann, der neben ihr stand, an. Er sah aus wie ein Bankangestellter, ungeduldig, mürrisch, gehetzt. Ein Hauch von Arroganz umspielte seinen Mundwinkel wie eine unsichtbare Tätowierung, die er sein Leben lang tragen würde. »Kann es sein, dass der Zug ein wenig Verspätung hat?« Sie wies auf die Anzeigetafel. »Vielleicht habe ich etwas verpasst.« Sie deutete auf die Ohrstöpsel. Höflichkeit brachte einen manchmal weiter.
Der Mann schaute auf. »Sieht aus, als wäre er pünktlich.« Er vergewisserte sich mit einem Blick auf sein iPhone. Dann hakte er nach: »Wohin, sagten Sie, möchten Sie?« Er widmete ihr nur einen möglichst kleinen Teil seiner Aufmerksamkeit. »Vielleicht sind Sie auf dem falschen Gleis.« Die Arroganz selbst hier, zwischen den Worten.
»Nach London.« Teufel, wohin sonst?
Der Mann starrte sie nur an. Und Emily ahnte, dass etwas nicht stimmte. Sie kannte Blicke wie diesen.
»London«, wiederholte sie, diesmal langsamer.
»Nie davon gehört.«
Er sagte das so beiläufig, dass sie zuerst überhaupt nicht verstand, was er ihr da mitgeteilt hatte.
Höflich versuchte sie es ein zweites Mal. »Der Zug nach London. Ist dies hier der richtige Bahnsteig?« Sie rang sich ein zaghaftes Lächeln ab. »Nach London.«
Etwas stimmte nicht. Nein, etwas stimmte hier ganz und gar nicht.
»Lon-don?« Er sprach es unbeholfen aus, zuckte mit den Schultern. »Wie ich Ihnen bereits sagte – ich habe noch nie von einem Ort namens … London … gehört.« Er machte eine bedauernde Geste. »Tut mir leid.« Er wandte sich wieder seinem iPhone zu.
Doch Emily dachte nicht im Geringsten daran, lockerzulassen.
»Sagten Sie gerade, dass Sie noch nie von London gehört haben?« Meine Güte, die Frage klang vollkommen verrückt.
Der Mann ließ sie unbeantwortet, sagte stattdessen: »Hier kommt in genau neun Minuten der Zug nach Dover.«
»Ich muss aber nach London«, sagte Emily laut.
»Wo soll das sein?«
»London?«
»Ja.«
Sie schluckte. Was meinte er? Was war hier los?
»London …«, begann sie und konnte hören, wie sich Aufregung in ihre Stimme einschlich. Natürlich hätte es sein können, dass der Mann sich auf ihre Kosten einen Scherz erlaubte. Aber das tat er nicht. Sie mochte den Kerl nicht, weil er so arrogant war, doch er war aufrichtig. Sie spürte es, sie wusste es. Die Situation war absurd, verkehrt und falsch, einfach vollkommen falsch.
Dass ihr Zug Verspätung hatte, war eine Sache, dass es aber …
»Es tut mir leid«, unterbrach der Mann ihre Gedanken, wahrscheinlich, um die Sache zu einem raschen Ende zu bringen, »aber ich habe noch nie …«
»Sie haben noch nie von London gehört?« Sie konnte es nicht einmal fassen, diese Frage überhaupt gestellt zu haben. »Dies ist doch England, oder nicht?« Der Spott in ihrer Stimme war kaum zu überhören.
Der Mann trat eilig einen Schritt zur Seite. Emily wusste, was das bedeutete. Er hielt sie für verrückt. Eine Spinnerin. Natürlich.
»Ist dieses London eine kleine Ortschaft im Süden?«, fragte er.
Was sollte das jetzt werden?
»London«, wiederholte sie trotzig.
Ihr wurde flau im Magen. Sie zitterte, die Knie wurden ihr weich.
Der Mann zuckte die Achseln, vertiefte sich wieder in sein iPhone.
Emily blieb beharrlich. »Die Hauptstadt.«
Der Mann distanzierte sich weiter von ihr. »Sie meinen Oxford.«
»Nein, ich …«
Oxford?
Sie stockte. Der Mann meinte es ernst. Wollte er ihr gerade mitteilen, dass Oxford die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs war? Was, in aller Welt, dachte er sich dabei?
»Es …« Sie sah, wie sich die Zuganzeige einschaltete. Die Buchstaben flatterten wie aufgeregte Vögel, ehe sie zur Ruhe kamen: Luton. Dover. Alle auf dem Bahnsteig machten sich bereit. Keiner hatte ein Problem mit der Anzeige. Nur sie.
»Ich sagte doch, der Zug ist pünktlich«, hörte sie den mutmaßlichen Bankangestellten sagen.
Emily versuchte, einen klaren, vernünftigen Gedanken zu fassen. »Tut mir leid«, sagte sie zu dem Mann. Das hier führte zu nichts. Der Zug fuhr nicht nach London, und was der Mann ihr gesagt hatte, entbehrte jeglicher Logik.
»Vielleicht sollten Sie …«
Sie ließ den Mann auf dem Bahnsteig stehen und ging zu den Fahrplänen. Schönen, altmodischen Fahrplänen hinter einer Glasscheibe. Sie beugte sich vor und suchte nach der Verbindung, derentwegen sie hier war. Nichts! Eine Stadt namens London wurde dort nirgends erwähnt. Kein einziger Zug fuhr von Cambridge nach London. Ihr Puls ging schneller, und ihre Gedanken überschlugen sich.
Sie trat einen Schritt zurück.
Wie konnte das sein?
Sie begann schneller und schneller zu atmen. Panischer. Sie spürte, wie ihr Herz raste. Sie musste sich dringend beruhigen.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, erkundigte sich höflich eine ältere Dame, die neben ihr stand.
»Fragen Sie nicht«, flüsterte Emily.
Sie kramte ihr Sony aus der Tasche. Für alles gab es eine Erklärung. Jedes Rätsel konnte ergründet werden.
Dann googelte sie London. Doch sie bekam kein einziges Ergebnis. Nichts! Das war verrückt. Es war schlichtweg nicht möglich. Sie schickte die Suchanfrage erneut los, wieder mit demselben Ergebnis.
Kein einziger Treffer!
Was, zur Hölle, war hier los?
Ihre Finger tippten schneller, tauchten ein in die digitale Magie der Landkarten. Doch auch Google Maps zeigte ihr nichts anderes. Nur eine Landschaft, die so nicht wirklich sein konnte. Es stimmte einfach nicht, was sie da sah. Es war falsch, eine Lüge. Völlig unmöglich.
Dort, wo London hätte sein müssen, war … nichts. Gar nichts. Ein Wald, vielleicht, und Wiesen. Ein Fluss. Grüne Flächen jedenfalls, Wildnis, was immer das zu bedeuten hatte.
»Verdammt.«
Mehr als dieses Wort zu stammeln war ihr nicht möglich. Meine Güte. London, verschwunden?
»Das ist verrückt.«
Sie öffnete ihre Kontaktliste und wählte eine Verbindung. Lauschte. Nein, diese Telefonnummer sei leider nicht vergeben. Sie wählte andere Kontakte an. Spürte, wie ihre Hände zu zittern begannen. Keine der Telefonnummern, die sie wählte, existierte. Wittgenstein, Eliza Holland, Aurora Fitzrovia, Neil Trent, Edward Dickens – alle, die sie kannte und die, genau wie sie, in London lebten, schienen soeben zusammen mit der Stadt verschwunden zu sein.
Was ging hier nur vor?
»Kommt schon!« Sie ging ihre Kontaktliste durch, ebenso aufgeregt wie verzweifelt. Einen Kontakt nach dem anderen wählte sie an. Nichts! Restaurants, Geschäfte, Buchläden, Institutionen. Alle Kontakte, die sie gespeichert hatte, probierte sie aus. Kein einziger war registriert. »Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht vergeben.«
Was sollte das?
Die Nummern hatten auf einmal keinen Sinn mehr. Keiner ihrer Kontakte existierte mehr. Das war die Logik, die dahintersteckte. Eine Logik, auf die Emily sich nicht einlassen wollte.
Sie suchte online nach der Hauptstadt Großbritanniens – und fand nichts als Hinweise auf Oxford. Eine Fülle von Informationen, die zu lesen ihr auf die Schnelle nicht möglich war.
»Nicht möglich.« Ihre Stimme war ein krankes Flüstern, in der Kälte begleitet von einem zarten Nebel und ihrem tosenden Herzschlag, geboren aus Furcht und Panik. Die Stadt, in der sie lebte, war verschwunden. Die Menschen, die sie kannte, ebenso.
Und jetzt?
Was sollte sie tun?
Ein lautes Dröhnen riss sie in die Wirklichkeit zurück. Bremsen quietschten. Der Zug nach Dover fuhr ein.
Es gibt keine Zufälle!
Fluchend ging sie ins Bahnhofsgebäude zurück. Doch auch hier herrschte nach wie vor lediglich das übliche Getümmel der Rushhour, gab es nur Menschen, für die, was auch immer hier passierte, anscheinend die Normalität war. Keiner wirkte verunsichert, nicht ein einziger schaute sich, wie sie selbst, fragend um.
Sie seufzte.
Entdeckte schließlich auf der anderen Seite der Bahnhofshalle, gleich neben den Fahrkartenautomaten, eine große Landkarte in einem Schaukasten. Na, immerhin! Doch die Insel, die den Hauptteil Großbritanniens bildete, sah anders aus, als Emily es gewohnt war. London fehlte, das erkannte sie schon von Weitem.
Mit großen Schritten durchquerte sie die Halle, blieb vor der Landkarte stehen.
»Verdammt!«
Dort, wo London hätte sein müssen, gab es nur eine Kleinstadt namens St. Albans, sonst nichts. Gar nichts! Guildford war noch da, Maidstone ebenso, dazwischen aber lag nichts. Da war nur der Fluss, die Themse, mit ihren typischen Windungen, doch das war auch schon alles.
»Ich bin nicht verrückt«, murmelte Emily. »Ich weiß, dass es London gibt.« Wilde Gedanken bestürmten sie, keiner davon in Vernunft verwurzelt, allesamt Mutmaßungen, Befürchtungen, panische Fantasien.
Nein, sie war nicht verrückt.
Oder doch?
Sie musste an ihre Mutter denken, an die Besuche in Moorgate. Ihre Mutter hatte Probleme gehabt. Psychische Probleme. Emily wusste, warum. Sie glaubte jedoch nicht, dass ihr das gleiche Schicksal blühte.
Dummes Zeug!
Beruhige dich, redete sie sich in Gedanken gut zu. Ja, sie musste jetzt ruhig werden. Panik führte zu nichts.
London.
Sie starrte die grüne Fläche auf der Landkarte an. Sie versuchte zu verstehen, was sie dort sah. Tat es aber nicht.
Die Stadt der Schornsteine am dunklen Fluss. Ihre Heimat, irgendwie – auch wenn sie das so oft geleugnet hatte. All die vom Regen ersäuften Gassen und Straßen, wo sich der Nebel, den die Themse so kalt gebar, um die rußig schwarzen Hälse der riesigen Häuser wand. London, mit seiner U-Bahn und dem, was sich dahinter verbarg, den wundersamen Märkten, den magischen Orten voller Gefahren, den sonderbaren Wesen, von denen sie längst nicht alle kannte, den verschlungenen Pfaden, die oft eine Herausforderung waren, und natürlich den Menschen, die dort unten lebten und von denen sie einige ihre Freunde nennen durfte. Das alles sollte verschwunden sein?
Sie wandte sich von der Karte ab, starrte die vielen Menschen in der Bahnhofshalle an, und was sie ahnte, wurde zur lähmenden Gewissheit. Sie würde die Leute nicht noch einmal fragen müssen, nein, das wäre unnötig. Keiner von denen würde sich an eine Stadt namens London erinnern. Der dunkle Fluss war noch da, nicht aber die Stadt.
»Es ist ein Rätsel«, hätte Wittgenstein gesagt. Wittgenstein, der ebenfalls fort war. Wie all die anderen auch.
»Ein Rätsel«, sagte Emily laut, denn manchmal half es, Dinge laut auszusprechen. Insbesondere dann, wenn man Angst hatte. In der Hand hielt sie ihr nutzlos gewordenes Sony. Keine der Nummern, die sie gespeichert hatte, führte irgendwo hin. Also verstaute sie es in ihrer alten Tasche und holte tief Luft.
Cambridge.
Sie war hier gestrandet, einfach so. Nun ja, zumindest fühlte es sich so an.
Emily Laing dachte an ihre Wohnung in Seven Dials, an ihre Freunde, ihr Leben. Es war nicht möglich, dass eine ganze Stadt samt aller Menschen verschwand.
Und das bedeutete … was? Was sollte sie jetzt tun?
Sie beschwor vor ihrem inneren Auge das Bild ihres geistigen Mentors herauf. Schwarzes Haar, stechender Blick, eine lange Nase. Mürrisch, ruhig, allzeit neugierig. Wie eine Fledermaus wirkte er, wenn er den schwarzen Mantel trug, den er am liebsten mochte.
»Nachdenken«, würde Wittgenstein ihr raten. Er würde sie streng anschauen, als wäre sie noch immer das unwissende kleine Mädchen, das er vor Jahren am Fuße einer Rolltreppe in der U-Bahn-Station Tottenham Court Road aufgegabelt hatte. Mit seiner tiefen Stimme würde er langsam, jedes einzelne Wort betonend, sagen: »Denken. Sie. Nach. Miss Laing.«
Denken Sie nach!
Also beschloss sie, genau das zu tun. Denn eine vernünftige Alternative gab es nicht.
Am Ende tat Emily Laing das einzig Sinnvolle. Sie ging zurück in die Pembroke Street zu Charles Nickleby, in der Hoffnung, dass der Gelehrte, sofern er den Laden nicht schon geschlossen und verlassen hatte, um nach Hause zu gehen, ihr vielleicht helfen könnte.
Doch ihre Hoffnung, basierend auf einem Trugschluss, wie sich schnell herausstellte, war vergeblich. – Niemand vermisste die Stadt namens London, weil niemand wusste, dass die Stadt jemals existiert hatte. Der alte Mann war da keine Ausnahme.
»Ehrlich gesagt, Miss Laing, weiß ich nicht, was ich von all dem, was Sie da gerade gesagt haben, halten soll.« Charles Nickleby starrte sie mit seinen kleinen Äuglein verwirrt an. Er kraulte seinen Backenbart, zog ein Gesicht, steckte sich eine Pfeife an, paffte, blies Rauchkringel in die Luft. »Was Sie da behaupten, ergibt, gelinde gesagt, da bin ich ehrlich, überhaupt keinen Sinn.« Der Geruch nach edlem Tabak lag wie eine Farbe auf allem, was sich in dem Buchladen befand. Jedes Buch schien ein Echo dessen zu sein, was Professor Nickleby Genuss bereitete. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Miss Laing, ich neige natürlich dazu, Ihren Ausführungen Glauben zu schenken, und sei es nur, weil Sie ein sehr glaubwürdiger Mensch sind. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, doch …« Hier machte er eine kurze Pause, sog erneut an der Pfeife. »Doch, das müssen Sie mir zugestehen, erscheint Ihre Geschichte mehr als nur seltsam.«
Emily wusste nicht, was daran seltsam sein sollte. »Ich lebe in London«, sagte sie. »Dort gehöre ich hin. Das wissen Sie doch auch. Sie selbst haben mich von dort hierher nach Cambridge gerufen!«
Charles Nickleby, klein und gedrungen, mit einem roten, freundlichen Gesicht, gab höflich und dennoch skeptisch zu bedenken: »Aber es gibt diese Stadt nicht.« Er ging im Laden auf und ab, die Hände auf dem Rücken verschränkt. »Sehen Sie sich alle diese Bücher an«, sagte er ruhig, »in keinem einzigen werden Sie die Stadt, deren Namen Sie mir genannt haben, finden.« Er sah aus wie eine jener lebensprallen und zugleich karikaturhaft anmutenden Figuren aus einem viktorianischen Roman, wie nicht zuletzt John Leech sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts gezeichnet hatte. »Da beißt die Maus keinen Faden ab«, resümierte er. »Ich habe noch nie zuvor von einem Ort namens London gehört.«
Emily schüttelte den Kopf. Das konnte nicht sein.
Sie kannte Charles Nickleby schon seit Jahren. Er war Literaturwissenschaftler, früher Archäologe gewesen, mittlerweile quasi Antiquitätenhändler, ein Vermittler seltener Bücher. Wenn man auf der Suche nach Wissen war, so tat man gut daran, einen Abstecher nach Cambridge ins Quincunx zu machen. Nickleby war ein ruhiger alter Herr, behäbig, seiner Pfeife verfallen, nicht zu zählen die Unmengen von Teesorten, ohne die zu leben ihm wohl unmöglich war. Er war jemand, dem man vertrauen konnte. Jemand, dem man die Weltgewandtheit ansah; jemand, der trotz seiner beruhigenden Behäbigkeit, welche die Farbe von braunem Tweed hatte, im Gespräch erahnen ließ, was für ein abenteuerlustiger junger Mann er einmal gewesen sein musste.
Emily hatte ihn von Anfang an gemocht. Ihn und den Laden mit dem seltsamen Namen.
Quincunx.
Wittgenstein hatte sie einst hierher geführt. Damals, als sie noch seine Schutzbefohlene und Schülerin gewesen war, hatte sie ihn auf einigen seiner zuweilen rätselhaften Reisen begleitet. An einem windigen, regnerischen Apriltag hatte sie das Quincunx zum ersten Mal betreten, leicht verschnupft und vollkommen durchgefroren, und Nickleby hatte ihr sofort die nassen Sachen abgenommen und eine heiße Schokolade für sie zubereitet.
Nichts hatte sich seit damals verändert. Das dachte sie immer, wenn sie den Laden betrat. Und auch jetzt wirkte alles hier drinnen auf sie so real wie vorhin noch – die labyrinthischen Regalreihen, die niedrige Decke, die alten Möbel, das schummrige Licht, das knisternde Kaminfeuer –, und doch fühlte sie sich wie Alice, die gerade in das Kaninchenloch gefallen war und weiter und weiter stürzte, hinab in eine Welt, in der »oben« unten und »unten« oben war, wo alles falsch und nichts richtig wirklich war.
Sie biss die Zähne zusammen und sah den Professor herausfordernd an. »Lassen Sie mich es Ihnen zeigen.«
Dann ging sie zu einem Regal, wo einige der Werke jenes berühmten viktorianischen Autors, den Emily unter Weglassung seines allgemein bekannten ersten Vornamens sowie seines nicht minder bekannten Nachnamens in Gedanken stets nur John Huffam nannte, standen. Eines nach dem anderen nahm sie in die Hand, blätterte darin herum. Fast ausnahmslos hatten diese Romane auch London zum Schauplatz. In den Abgründen der Metropole an der Themse folgte man den Charakteren auf ihren Wegen. Man litt an ihrer Seite, erlebte das Grauen der Kinderarbeit und das Elend in den Armenvierteln. Es waren Klassiker, die fast jedes Kind in England kannte. Der geizige Alte, dem in der dunklen Weihnachtsnacht drei Geister erschienen. Der Junge, der sich unglücklich verliebte. Das Waisenkind, das von einem Gauner das Diebeshandwerk erlernte und sich schlussendlich dann doch für sein Gewissen entschied.
Sogar im Waisenhaus hatten die Kinder sich manchmal diese Geschichten erzählt, nicht zuletzt, weil sie, trotz des Elends, so voller Hoffnung gewesen waren. Doch von einer Stadt namens London war in den Ausgaben, die Emily jetzt und hier in den Händen hielt, nicht die Rede. Kein Wort. Es waren die gleichen Geschichten, aber die Stadt, in der sich so vieles zutrug, war Oxford. Ein Oxford, das, folgte man oberflächlich und eilig den Schilderungen, viel größer und labyrinthischer wirkte als der Ort, den Emily unter dem Namen kannte.
»Das sind nicht die richtigen Geschichten«, flüsterte sie. Das Rätsel, sofern es eines gab, wurde immer komplexer, immer grundlegender. Sie klappte das letzte Buch, das aufgeschlagen in ihrer Hand lag, zu, sodass eine Staubwolke aufwirbelte, ehe sie es in die Höhe hielt. »Das hier ist falsch.« Sie wusste nicht, wie sie es anders hätte erklären können.
Falsch, das war es. Einfach nur falsch.
Nickleby, der gute Ohren hatte, fragte: »Wie meinen Sie das?«
»Es gibt kein London in den Büchern.«
Er schaukelte durch den Raum wie ein Schiff auf See und klatschte, freundlich triumphierend, in die Hände. »Sagte ich doch.« Er ließ sie nicht aus den Augen, auch wenn es so aussah. »London ist keine Stadt, die jemals existiert hat.«
Emily ließ sich nicht beirren. Sie stellte das Buch, das sie noch in der Hand hielt, ins Regal zurück und suchte weiter. Suchte immer hektischer, immer aufgeregter nach Büchern, die sie kannte. Nach Geschichtsbüchern, die von Persönlichkeiten und Ereignissen berichteten, aus denen Kinofilme und Fernsehserien erschaffen worden waren. Elisabeth, die jungfräuliche Königin, Cromwell, der Lordprotektor, Guy Fawkes, der Pulververschwörer, Königin Viktoria, die Galionsfigur des Empire. Es war ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnte. Jack the Ripper, die Whitechapel-Aufstände. Sie blätterte dicke, fette Wälzer durch, warf Folianten um, las, was ihr in die Finger kam.
Nickleby beobachtete sie die ganze Zeit, schwieg aber, wofür sie ihm dankbar war.
Schließlich hielt sie inne. »Wie kann das sein?« Sie klappte das letzte Buch, in dem sie geblättert hatte, resigniert zu.
Nirgends war, soweit sie gesehen hatte, auch nur in einer Randnotiz eine Stadt namens London erwähnt. Als hätte es sie wirklich und wahrhaftig nie gegeben. Alle Ereignisse, die in den Büchern geschildert wurden, hatten an anderen Orten stattgefunden. Die meisten von ihnen in Oxford. Aber keines in London, keines in der Stadt am dunklen Fluss.
»Ich lebe dort«, sagte Emily, als würde diese Beteuerung ihr irgendwie nützen.
»Sie leben in Oxford«, stellte Nickleby trocken fest.
Emily starrte ihn an. »Warum sagen Sie das?«
»Weil es die Wahrheit ist.« Er nannte ihr die Anschrift. »Die Telefonnummer steht in meiner Kundenkartei. Schauen Sie nach, wenn Sie mir nicht glauben.« Er seufzte. »Wählen Sie die Nummer, und Sie hören Ihre eigene Stimme, auf dem Anrufbeantworter.«
Ihr schwindelte. Nein, sie würde nicht nachschauen. Sie würde diese Nummer ganz bestimmt nicht wählen.
Sie schüttelte den Kopf. Nein, das würde sie auf keinen Fall tun.
»Miss Laing, wir kennen uns nun seit vielen Jahren.« Seine Stimme war so warm wie der Tabakgeruch. »Sie leben in Oxford.« Er seufzte ein weiteres Mal, diesmal sogar laut. »Wie kann ich Ihnen nur helfen? Was ist denn geschehen, dass Sie auf einmal so verwirrt sind?«
Sie erwiderte nichts.
»Vorhin waren Sie noch so gefasst.«
Emily versuchte unruhig, sich zu konzentrieren, doch es gelang ihr nicht, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. In ihrem Kopf herrschte ein wildes Durcheinander aus Fragen, Rätseln und Befürchtungen.
»Was tue ich dort?«, brachte sie schließlich mühsam hervor. »In Oxford, meine ich.«
»Sie sind eine Trickster«, stellte der Professor fest, als wäre damit alles gesagt.
Sie musste wieder an Tiny Tim denken. »Ich weiß.« Dann schüttelte sie energisch den Kopf. »Aber das hat nichts mit dem zu tun, was hier passiert. Nein, meine Freunde leben in London.« Auf einmal funkelte sie den Mann in ihrer Verzweiflung wütend an, gerade so, als trüge er die Schuld an dem, was passiert war. »Keiner von ihnen ist erreichbar. Sie sind fort, so sieht es doch aus. Einfach so, vom Erdboden verschluckt. Vergessen und verloren.« Draußen heulte der Wind. »Verweht. Verweht wie die ganze verdammte Stadt.« Nicht einmal der dürftigste Hinweis auf eine Antwort auf dieses Rätsel kam ihr in den Sinn. »Ich kenne Oxford, natürlich, eine kleine Stadt, in keiner Weise mit London zu vergleichen.« Sie dachte an die Londoner U-Bahn und das nicht immer ungefährliche Labyrinth, das es jenseits der U-Bahn zu erkunden gab, jene Wege, die zu den seltsamsten Orten und durch die verrücktesten Gegenden führten. »London.« Sie ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen.
Der Professor blickte nachdenklich zum Fenster hinaus. Draußen schneite es noch immer. Dicke Flocken wehten vor dem Schaufenster aus dem Licht der Straßenlaterne ins Dunkel.
Emily ließ sich in den großen Sessel neben dem Kamin sinken. Das Feuer prasselte, und alles wirkte so gemütlich und unendlich gut. Draußen hatte sie geglaubt, erfrieren zu müssen, so kalt war die Nacht geworden; die Nacht, die sie umgab, und jene, die in ihr war.
Der Winter, dachte Emily, ist wirklich eine seltsame Jahreszeit, das war er schon immer.
Für sie allerdings war er in all den Jahren kaum mehr als eine Kulisse gewesen, ein Hintergrundbild, vor dem sich ihr eigenes Leben entfaltet hatte.
»Was immer auch geschehen mag«, hatte ihr einmal jemand gesagt, »sieh es als ein Abenteuer und niemals als Schicksal.«
Und daran hatte sie sich gehalten.
Jetzt saß sie hier, tatenlos, keinen einzigen Schritt weiter. In dem Laden, den sie schon unzählige Male zuvor besucht und der sich nicht verändert hatte, oder zumindest nicht so wie ihre Welt.
»Wittgenstein lebt in London«, sagte sie unvermittelt, und sogleich fühlte sie sich einsam. Mit ihrem Mentor an ihrer Seite hatte sie so viele Abenteuer bestanden.
Nickleby wirkte verwirrt. »Wer?«
»Wittgenstein.«
»Nie von ihm gehört.«
»Sie scherzen.«
»Nichts liegt mir ferner, Miss Laing. Wer ist er?«
War das die Möglichkeit? »Mortimer Wittgenstein. Sie kennen ihn seit Jahren.« Was redete sie denn? Seit Jahrzehnten!
Der Professor schüttelte, aufrichtig bedauernd, den Kopf. »Miss Laing, es tut mir so leid, das müssen Sie mir glauben, aber ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der diesen Namen trägt.« Er grübelte nach. »Was sollte ich mit ihm zu schaffen haben?«
»Er …« Sie sprang auf, schnappte sich das Buch aus ihrer Tasche. »Hier, das habe ich für ihn erstanden. Er hatte es bei Ihnen geordert.« Sie atmete tief durch, rang um Fassung. »Wie kann es sein, dass Sie sich nicht an ihn erinnern?«
Nickleby zuckte die Achseln und strich sich mit seinen kleinen Fingern durch den Bart. »Ich fürchte, Miss Laing, ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Wie Sie bereits feststellten, haben wir es hier wohl mit einem Rätsel zu tun. Sie müssen mir glauben, dass ich Ihnen die Wahrheit sage. Ich treibe keinen Schabernack mit Ihnen. Es gibt kein London. Und ich kenne keinen Mortimer Wittgenstein.« Jetzt warf er ihr einen äußerst besorgten Blick zu. »Dass Sie, meine gute Miss Laing, so felsenfest überzeugt sind, dass ich derjenige bin, der sich irrt, und nicht Sie selbst, ist, das müssen Sie mir zugestehen, kein Beweis für irgendetwas.«
Emily nickte. »Alle diese Bücher hier«, sagte sie, »erzählen andere Geschichten als die, die ich kenne.«
Alles ist falsch, falsch, falsch.
Nickleby nickte und fragte sie: »Und was sagt uns das?«
Emily schwieg.
Falsch!
»Gar nichts«, schlussfolgerte der alte Mann. »Leider, leider. Gar nichts.« Er wirkte traurig, weil er ihr nicht helfen konnte. Er hielt die Pfeife in der Hand und deutete mit ihr auf die Bücher. »Wenn das, was Sie sagen, wirklich die Wahrheit ist«, murmelte er, »dann geschieht Seltsames um uns herum.« Er nahm ein paar Züge. »All die Bücher in den Regalen sind so, wie sie immer waren. Nichts wurde verändert.« Er ging zu den Büchern, berührte sie. »Sie, Miss Laing, sind, wie es den Anschein hat, bisher der einzige Mensch, der glaubt, dass die Wirklichkeit eine andere ist.« Er schaute sie an. »Das ist seltsam.«
Dass es seltsam war, wusste Emily mittlerweile. Was sie suchte, waren Antworten, keine weiteren Fragen. Der erneute Gedanke an ihre Mutter war dabei wenig hilfreich und alles andere als ermutigend.
Sie sagte: »Ich muss zurück nach London.«
»Das es, soweit ich weiß, nicht gibt.«
»Humbug!«, schimpfte Emily, plötzlich wieder aufbrausend. »London hat es schon immer gegeben.«
Nickleby zog eine Augenbraue hoch.
»Es ist die Stadt, in der ich lebe.«
»Sie sprechen von einem Ort, der nicht existiert. Einem Ort, an dessen Existenz nur Sie glauben.« Er wirkte nun regelrecht irritiert. »Ja, Miss Laing«, sagte er eindringlich, »und Sie sollten sich fragen, warum das so ist!«
Sie schüttelte den Kopf. Nein, es musste noch andere Menschen geben, denen auffiel, dass etwas falsch war. Eine Metropole, so riesig wie London, konnte nicht einfach in der Erinnerung von Hunderttausenden verweht werden, als habe es sie nie gegeben.
»Was soll ich tun?«
Nickleby lächelte zum ersten Mal, seit sie den Laden betreten hatte. »Das ist doch mal eine Frage, die ich gern beantworte.«
»Nun?«
»Sie sollten sich ausruhen, Miss Laing.« Er deutete nach draußen, auf die nächtliche Straße. »Es ist kalt. Sie können gern im Laden übernachten. Bei diesem Wetter fahren die Züge nicht mehr lange. Es fällt zu viel Schnee. Sie können morgen nach Hause fahren.« Emily wusste, dass er Oxford meinte. Absurd! »Ich kann Ihnen die Couch anbieten, die drüben in dem kleinen Hinterzimmer steht. Ein paar Decken sind auch da. Das Feuer hier vorn im Kamin kann ich über Nacht brennen lassen. Ich selbst aber, muss ich gestehen, habe heute eine Verabredung.« Er lächelte in höchstem Maße verschmitzt. »Eine Dame, die ich ins Kino ausführe.« Der Professor wirkte äußerst entspannt und zufrieden. »Wir philosophieren, müssen Sie wissen. Es ist eine späte Liebe, könnte man sagen.«
Irgendwie fand Emily es beruhigend, dass er sich so freute. Solange es noch Liebe gab, war die Welt nicht verloren.
»Das wäre sehr nett«, nahm sie das Angebot an. Das Quincunx zog sie einer Pension oder einem Hotelzimmer vor. Es erinnerte sie an damals, als sie ein Kind gewesen und nach ihrer Flucht aus dem Waisenhaus zum allerersten Mal in Hampstead Manor aufgewacht war. Der Beginn eines neuen Lebens, ja, das war es gewesen, ihr erstes Zuhause, ein Anwesen im Stadtteil Marylebone, erfüllt von wohliger Wärme und einem Licht, das Waisenkinder sonst nur hinter den Fenstern fremder Häuser sahen. »Das wäre wirklich wunderbar.«
»Das, Miss Laing, denke ich auch.« Dann, dezent und ohne ein weiteres Gespräch zu suchen, überreichte er ihr den Zweitschlüssel für die Ladentür, nahm Gehstock und Hut, schlang sich einen Schal um den Hals und schlüpfte in einen braunen Mantel. Mit einem Lächeln empfahl er sich, trat hinaus ins Schneegestöber und in die Nacht, zog die Tür hinter sich zu und schloss sie ab.
Emily Laing blieb allein zurück, müde und erschöpft, ihre Zuversicht so verweht wie die Stadt, deren Verschwinden ihren Verstand und ihr Herz in gleichem Maße marterte.
Es gibt keine Zufälle. So lautete Wittgensteins Motto. Doch wenn dem wirklich so war, welchen Sinn ergab dann das, was gerade passierte? Emily ging die Regalreihen ab und betrachtete die Buchrücken. Sie zog wahllos und gedankenverloren ein Buch aus dem Regal, blätterte darin herum und stellte es zurück ins Regal. Nein, sie wollte gar nicht länger darüber nachdenken. Sie musste Ruhe finden, und morgen war schließlich auch noch ein Tag.
Emily seufzte, machte das letzte Licht im Laden aus und ging ins Hinterzimmer. Dort warf sie ihren Mantel über einen der Sessel und stellte ihre Tasche daneben auf den Boden. Es gab ein kleines Spülbecken, und auf dem Regal darüber standen Gläser, eine Kanne, Becher und Teetassen. Emily füllte sich ein Glas mit Wasser und trank es so schnell aus, dass sie beinah Schluckauf bekommen hätte. Sie stellte das leere Glas in die Spüle. Ein wenig zu schlafen, ja, das würde guttun. Die Couch sah gemütlich aus. Sie ging zu ihr hinüber und setzte sich, streifte die Stiefel ab, bewegte die Zehen.
Das Kaminfeuer vorn im Laden knisterte, und die Wärme, die durch die geöffnete Zwischentür zu ihr nach hinten drang, war wohlig. Emily machte es sich auf der Couch bequem, wickelte sich in eine der Wolldecken, schloss die Augen und fiel bald in einen unruhigen, von seltsam schemenhaften Gestalten heimgesuchten Halbschlaf, in dem viele bekannte Gesichter auftauchten, nicht zuletzt das des jungen Mannes, Tristan Marlowe, der vor einiger Zeit noch ihr Freund gewesen war. Jetzt war er das nicht mehr.
Sie seufzte, als wäre es erst gestern gewesen, dass sie beide in befremdlichem Einvernehmen beschlossen hatten, von nun an getrennter Wege zu gehen, drehte sich auf den Rücken, kam zu sich und schlug die Augen auf. Sie starrte die Zimmerdecke an und ließ ihren Blick dort ruhen, auf der Verkleidung aus dunklem Holz, während sie an damals zurückdachte.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte sie seinen Namen getragen, als wäre es der ihre gewesen. Einfach so, weil ihr danach gewesen war. Wenn jemand sie nach ihrem Namen gefragt hatte, dann hatte sie nicht ihren Nachnamen gesagt, sondern seinen genannt.
Doch das war vorüber. Ein für alle Mal.
Sie hatte in ihrer jugendlichen Verträumtheit geglaubt, dass die Liebe immer so schnell stirbt, dass es einem wie ein Drama vorkommt, aber das war ein Trugschluss gewesen. Die Liebe, das hatte Emily erfahren, stirbt langsam, jeden Tag ein wenig mehr, kaum merklich. Und irgendwann ist sie fort, so, als sei sie nie da gewesen. Danach legt man sich ein neues Leben zu, wie man sich im Laden neue Kleidungsstücke kauft und so jemand anders wird.
Genau das hatte sie getan. Nachdem sie lange genug in New York gelebt hatte, das so völlig anders war, war sie in die Stadt der Schornsteine zurückgekehrt. Ihr Leben hatte neu begonnen. Das einzig Erschreckende daran war die Erkenntnis gewesen, wie einfach es doch war, wieder neu zu beginnen.
Damals hatte sie nicht nur Geld verdienen müssen, sondern sich auch nach einem Sinn gesehnt. Den Kindern zu helfen war in der Situation naheliegend gewesen. Sie konnte ihnen beistehen, wo ihnen sonst niemand zu helfen vermochte, die Grausamkeiten, die das Leben für die Kinder bereithielt, erträglicher machen.
Letzten Endes hatte sie dies alles nach Cambridge geführt.
Sie betrachtete im Halbdunkel des zu ihr nach hinten dringenden Feuerscheins die Habseligkeiten, die ihr geblieben waren. Den Mantel, der dort über dem Sessel hing, neben der Couch. Die abgewetzte Ledertasche, die auf dem Boden stand, mit ihrem persönlichen Kram, den sie allzeit mit sich herumtrug, und dem Buch, das sie für Wittgenstein erstanden hatte.
Sie seufzte.
Hörte ein Klopfen. Das Geräusch riss sie unsanft aus ihren Erinnerungen. Offenbar klopfte jemand an die Ladentür.
Sie schaute auf die Uhr an der Wand. Es war kurz vor acht. Der Laden längst geschlossen. Bekam Nickleby zuweilen noch Gäste um diese Uhrzeit?
Emily, die wusste, dass man allzeit im Leben – und erst recht in Situationen wie dieser – wachsam sein musste, pellte sich aus der Decke, stand leise auf und schlich auf Socken und mit klopfendem Herzen vorbei an all den Bücherregalen durch den Laden. Niemand wusste, dass sie hier war, logisch, denn alle Personen, die sie kannte, waren ja nicht mehr da. Was die Sache um keinen Deut besser machte. Sie mochte keine ungeladenen Gäste, weil sie selten etwas Gutes brachten.
Oder vielleicht wusste doch jemand, dass sie hier war. Womöglich derselbe jemand, der auch wusste, dass sie eine Stadt namens London kannte. Jemand, der nicht wollte, dass sie dem Geheimnis dahinter auf die Schliche kam.
Sie erhaschte einen ersten Blick durch die Scheibe der Tür nach draußen, sah eine dunkle Silhouette vor dem Hintergrund des schummrigen Laternenlichts.
Wer mochte das sein? Jemand mit Beweggründen so dunkel wie die Nacht. Jemand, der hier war, um sie zu finden.
Oder auch nicht.
Emily, die sich in ihrem Leben schon ganz anderen Herausforderungen gestellt hatte, unterdrückte ihre düster lauernde Angst und trat beherzt auf die Tür zu. Die eben noch so bedrohliche Gestalt entpuppte sich als eine kleine alte Dame, die, seelenruhig wartend, dort draußen im dichten Schneegestöber stand, nun noch einmal an die Tür klopfte und sich vorbeugte. Als sie Emily sah, lächelte sie.
»Ich bin Mrs. Pumblechook«, rief sie durch die Glasscheibe, »Charles Nickleby schickt mich.« Dann hielt sie einen Korb in die Höhe. Ein darüber ausgebreitetes rot kariertes Küchentuch verbarg den Inhalt. »Er dachte, Sie seien vielleicht hungrig.« Sie lächelte neuerlich und, wie es schien, gutmütig. »Außerdem meinte er, Sie benötigten unter Umständen ein wenig Beistand.«
Emily erwiderte das Lächeln. Charles Nickleby war zuweilen ein komischer Kauz, aber er hatte das Herz am rechten Fleck. Dass er jemanden schickte, der sich ihrer, an seiner statt, annahm, passte zu ihm.
Sie schnappte sich den Schlüssel, den der Professor ihr dagelassen hatte, und öffnete, als hätte sie nie auch nur die geringsten Bedenken gehabt, die Tür.
Sofort wehte eisig kalte Luft mit ein paar Schneeflocken in den Laden.
»Kommen Sie doch rein.« Sie trat einen Schritt zur Seite.
Die alte Dame tat wie geheißen, und Emily schloss rasch die Tür hinter ihr. Dann besah sie sich die späte Besucherin unauffällig. Sie trug einen altmodischen Mantel, dunkelmausgrau, und auf dem Kopf einen Hut, der bunt, gewagt und lustig zugleich wirkte. »Wir sind Nachbarn, Charles Nickleby und ich«, erklärte die alte Dame fröhlich und deutete hinüber auf die andere Straßenseite. »Und er hat so schnell ein schlechtes Gewissen.« Ihre Wangen waren von der Kälte gerötet wie reife Äpfel. »Er sagte, dass er eigentlich hätte bei Ihnen bleiben müssen, aber er habe diese Verabredung, der er schon seit einiger Zeit entgegenfieberte.« Sie kicherte, wie nur eine alte Lady es tun konnte. »Alter schützt vor Torheit nicht, das sagt man doch?« Sie knöpfte sich den Mantel auf. »Vor der Liebe auch nicht.« Sie trug eine Brille, hinter der ihre Augen größer wirkten, als sie es waren.
»Kann ich mir gut vorstellen.« Emily schmunzelte leise. Sie stellte sich Charles Nickleby bei seinem Rendezvous vor und fragte sich, wie die Dame seines Herzens wohl aussehen mochte. War sie jemand, der zu ihm passte? Eine Akademikerin? Büchernärrin? Eine Frau mit Marotten, die seinen das Wasser reichen konnten?
»Er lebt schon viel zu lange allein, der gute Charles.« Mrs. Pumblechook klopfte sich den Schnee vom Mantel. »Er ist ein so gebildeter Herr. Kaum zu glauben, dass nicht schon vorher jemand zugegriffen hat.« Sie stellte den Korb auf den Boden. Unter dem Tuch war nichts zu erkennen. »Ich wusste ja nicht, was Sie mögen, und da ich selbst nicht die Zeit hatte, etwas zu kochen, bin ich einfach zu Ghaalib um die Ecke gegangen, Ghaalib Ramay, der hat dort einen pakistanischen Imbiss.« Sie bückte sich, griff tief in den Korb und hielt Emily eine Plastikschale hin. »Biryani mit Gemüsecurry«, sagte sie, »und zum Nachtisch etwas Shahi Tukray.«
Emily konnte nicht anders, als dankbar zu lächeln. Sie wusste augenblicklich, was sie so vermisst hatte. Ja, sie hatte Hunger, und es war keine Untertreibung, als sie sagte: »Sie schickt der Himmel.«
Mrs. Pumblechook nickte gütig. »Wenn Sie möchten, dass ich Ihnen beim Essen Gesellschaft leiste, bleibe ich. Ansonsten mache ich mich auf den Weg nach Hause. Das Wetter ist heute Abend wirklich äußerst unwirtlich. Der Schneefall soll bis zum Morgen dauern, sagten sie im Radio. Und Glätte kann ich nicht leiden. Ohne Stock und mit den Schuhen, die ich trage, sind glatte Straßen eine Todesfalle.« Sie seufzte. »So ist das im Alter, Miss Laing. Überall lauern Gefahren.«
Nicht nur, wenn man alt ist, lauern überall Gefahren, dachte Emily.
Trotzdem. Ein Gespräch wäre nicht übel. Es würde sie ein wenig auf andere Ideen bringen. Mrs. Pumblechook wirkte zudem wie jemand, dessen Gesellschaft guttun würde, auf eine ähnliche Art und Weise, wie ein heißer Tee guttut.
»Falls es später glatt ist, begleite ich Sie hinüber zu Ihrem Haus«, versprach Emily also, ohne weiter nachzudenken. Sie führte die Besucherin schweigend durch den Laden nach hinten, knipste dort eine altmodische Stehlampe mit einem vergilbten pergamentfarbenen Schirm an, machte eine einladende Geste und nahm selbst mit dem Biryani und einer Gabel, die Mrs. Pumblechook ihr aus ihrem Korb reichte, auf der Couch Platz, auf der sie vorhin eingenickt war. Mrs. Pumblechook setzte sich ihr gegenüber in den Sessel.
»Sie sind nicht von hier«, stellte Mrs. Pumblechook fest. »Sie kommen aus Oxford, nicht wahr?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Sie wirken wie jemand aus der Hauptstadt.«
Emily nahm, leicht irritiert, zwei Bissen von dem Biryani, ehe sie sich nicht länger zurückzuhalten vermochte. »Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens London gehört?«, platzte sie heraus, selbst auf die Gefahr hin, unhöflich oder verrückt zu wirken, weil sie es einfach nicht lassen konnte, an ihrer Sicht der Dinge festzuhalten.
Ohne zu zögern, erwiderte die alte Dame: »Niemals.«
Emily nickte resigniert. So viel also dazu.
»Wieso fragen Sie?«
»Nur so«, murmelte Emily und aß weiter, versuchte, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Sie war wirklich hungrig, und das Gemüsecurry schmeckte unglaublich gut. Sie spürte, wie die Gewürze sie wärmten.
ENDE DER LESEPROBE