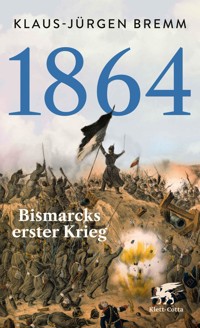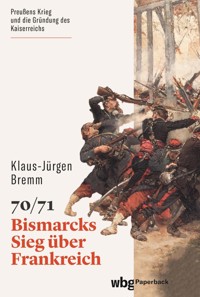
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: wbg Paperback
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Deutsch-Französische Krieg und die Entwicklung Europas Europa änderte sich 1870 grundlegend. Mit der Schlacht von Sedan wurde nicht nur der französische Kaiser Napoleon III. gefangengenommen, sondern im Anschluss fand ausgerechnet im Versailler Spiegelsaal die deutsche Kaiserproklamation statt. Dieses Ereignis war die Grundlage für den deutschen Nationalstaat und ist gleichzeitig eine bedeutende Zäsur in der Militärgeschichte. Klaus-Jürgen Bremm, Publizist und Historiker, legt mit seinem Buch eine umfassende Gesamtdarstellung des Deutsch-Französischen Krieges und eine Neubewertung dieser historischen Ereignisse vor: - Europäische Geschichte von den deutschen Einigungskriegen bis zur deutschen Reichsgründung - Waffengänge, Waffentechnik und militärische Strategien: der dritte deutsche Einigungskrieg gilt als einer der ersten modernen Kriege der Weltgeschichte - Weißenburg, Wörth und Spichern, Metz und Sedan: detaillierte Analyse entscheidender Schlachten - der Einsatz von Propaganda und der Krieg gegen Franctireurs und Zivilisten - Hintergrund-Infos zum Aufbau des preußischen Heeres und zur Einführung der Wehrpflicht Das Ende der Grande Nation: Frankreich tritt in die zweite Reihe Seit dem Krieg sind fast anderthalb Jahrhunderte verstrichen. Kaiserreich und Dritte Republik, die beide aus dem Konflikt von 1870/71 hervorgingen, sind längst wieder aus der Geschichte verschwunden. Doch wie Klaus-Jürgen Bremm aufzeigt, war die Bedeutung des sogenannten dritten »Einigungskrieges« bedeutend: Frankreich, die einstige Grande Nation, verlor seine europäische Hegemonialstellung, Deutschland stieg seit der Reichsgründung zur europäischen Vormacht auf. Wie sich diese Entwicklungen bis in die Katastrophe des 20. Jahrhunderts auswirkten, stellt Klaus Jürgen Bremm kenntnisreich dar - für Historiker und politisch Interessierte spannend und Augen öffnend!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
6. August 1870, nach der Schlacht bei Wörth:Französische Soldaten präsentieren ihre Regimentsfahne.
Abbildungsnachweis:
akg-images: S. 2, 18/19, 21, 78, 111, 123, 126, 129, 135, 162, 233, 236, 256, 267, 269; bpk Berlin: S. 22/23, 83, 109, 184; wbg-Archiv: S. 29, 176, 260, 279; Musen Frederic Marès: S. 68.
Karten: Peter Palm, Berlin: S. 101, 116, 173, 189, 199, 212, 245, Umschlaginnenseiten
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Paperback ist ein Imprint der wbg.
© 2023 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt)
2., durchgesehene Auflage der 2019 bei wbg Theiss erschienenen Ausgabe mit dem Titel 70/71. Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen.
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Satz: TypoGraphik Anette Bernbeck, Gelnhausen
Lektorat: Kristine Althöhn, Mainz
Einbandabbildung: Ausschnitt aus »La Defense de la porte de Longboyau«.
Gemälde (1879) von Alphonse de Neuville (1835–1885) © akg-images/De Agostini Picture Lib./Seemuller
Einbandgestaltung: Andreas Heilmann, Hamburg
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27593-9
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-74732-0
eBook (epub): 978-3-534-74733-7
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhalt
Einleitung – Das Ende der Grande Nation undder Siegeszug der allgemeinen Wehrpflicht
Bis zum ersten Schuss
Paris 1867 – Das Zweite Kaiserreich noch einmal als Mittelpunkt Europas
Preußisches Prävenire – Erzherzog Albrechts geheime Reise nach Paris und die spanische Thronkandidatur
Zwei Nationen und ein überraschender Krieg
Der Weg nach Sedan – Das Preußische Heer und das Militär des Norddeutschen Bundes im Zeitalter von Heeresreorganisation und Einigungskriegen
Der Krieg gegen das Kaiserreich
Frankreich »wurstelt sich durch« – Marschall Edmond Leboeufs großes Aufmarschfiasko
Die Franzosen kommen nicht – Der Aufmarsch der verbündeten deutschen Armeen im Juli 1870
Die ersten Siege – Weißenburg, Wörth und Spichern
Drei Schlachten um Metz – Bazaine in der Falle
Sedan – Der Marsch der Armee von Chalons in den Untergang
Hungrig, frierend, ahnungslos – Die Soldaten im Feld
Finanzmisere, Frauenvereine und Friedenssehnsucht – Die Heimatfront
Der Kampf gegen die Republik
Chaos und Karneval – Paris am 4. September 1870
Paris im Herbst 1870 – Eine Weltmetropole von der Welt abgeschnitten
Exempel an einer alten Reichsstadt – Die Beschießung und Kapitulation von Straßburg
Die letzte Bastion des Kaiserreiches – Die Belagerung von Metz bis zur Übergabe nach 70 Tagen
Drei Schlachten um Orléans – Artenay, Coulmiers und Loigny-Poupry
Auch Faidherbe kann Paris nicht retten – Der Krieg an der Somme
»Man muss mehr Rauch von brennenden Häusern sehen« – Der Krieg gegen Franctireurs und Zivilisten
Das Kaiserreich und die Dritte Republik – Geburt zweier Staaten
»Die deutsche Einheit ist gemacht, und der Kaiser auch« – Bismarcks Reichsgründung in Versailles
Hunger, Kälte und Bombenterror – Paris zwischen Siegesfantasien und Verzweiflung
Der Untergang der Armee Bourbakis – Frankreichs zweites »Sedan«
Waffenstillstand und Wahlen – Frankreich stimmt für das Ende des Krieges
Ersatzrevanche einer geschlagenen Armee – Die Vernichtung der Pariser Kommune
»Nur Faust, kein Kopf, und dennoch siegen wir«
Bismarcks Reichsgründung – Ein europäischer Glücksfall
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
Einleitung –Das Ende der Grande Nation und der Siegeszug der allgemeinen Wehrpflicht
»Die Franzosen haben bis jetzt die erste Rolle in der Welt gespielt. Seit dem vorigen Jahre drohen wir, diese Rolle ihnen abzunehmen. Sie empfinden eine verzeihliche Empfindlichkeit über diese Zumutung. Eitel wie sie sind, gehen sie so weit, ihren Ehrenplatz nicht im Guten zu zedieren. Deswegen suchen sie Händel mit uns, um uns darüber zu belehren, dass wir nur die dummen Österreicher geschlagen haben, und dass sie nach wie vor die große Nation sind.«
Rittmeister Alfred Graf von Schlieffen am 6. Mai 1867 aus Paris an seine Verlobte1
Der Feind habe uns nur äußerlich besiegt, schrieb im Januar 1871 ein verzweifelter Jules Michelet in seinem Florentiner Exil, aber, so fügte der große Historiker der Französischen Revolution mit trotzigem Stolz hinzu, den moralischen Sieg habe der barbarische Gegner dennoch nicht errungen. Obwohl vergewaltigt und geplündert sei Frankreich nicht zu Boden geworfen. Es bleibe Frankreich, stark, Furcht einflößend und groß!2
Der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland, der am 19. Juli 1870 als Krieg zwischen dem Zweiten Kaiserreich und der preußischen Monarchie begonnen hatte, lag, als Michelet seinen pathetischen Appell an ein scheinbar gleichgültig zuschauendes Europa verfasste, in den letzten Zügen. Am 18. Januar 1871 hatten die deutschen Fürsten im Spiegelsaal des Versailler Schlosses Wilhelm I. von Preußen zum Kaiser ausgerufen. Das hungernde Paris stand unmittelbar vor der Kapitulation und von den drei Hauptarmeen der Republik waren zwei bereits bei Le Mans und St. Quentin zerschlagen, die dritte Streitmacht unter General Charles Bourbaki im Juragebirge blockiert, sodass sie sich zehn Tage später im Schweizerischen Grenzort Les Verrières entwaffnen und internieren lassen musste. Mehr als ein halbes Jahr war der Krieg mit aller Härte und zuletzt unter extremer winterlicher Kälte ausgefochten worden. Erst dann sah Frankreichs »Regierung der Nationalen Verteidigung« ein, dass die Niederlage sowie der Verlust von Metz und Straßburg nicht mehr abzuwenden waren, und willigte in einen Waffenstillstand ein, der vier Wochen später zum Abschluss eines Vorfriedens führte.
Seit dem Krieg sind fast anderthalb Jahrhunderte verstrichen. Kaiserreich und Dritte Republik, die beide aus dem Konflikt von 1870/71 hervorgingen, sind längst wieder aus der Geschichte verschwunden. Angesichts zweier Weltkriege und einer inzwischen fortschreitenden europäischen Integration scheint es, dass eine neuerliche Betrachtung der dramatischen Geschehnisse zwischen Emser Depesche und Frankfurter Frieden nur noch antiquarischen Bedürfnissen dienen kann. Von beiden Generalstäben sind die militärischen Operationen bereits vor mehr als einem Jahrhundert mit detailfreudiger Akribie dargestellt worden. Zuletzt hat sie der Brite Michael Howard in seinem Standardwerk ausgewogen und pointiert beschrieben.3 Die Untersuchung der politisch-diplomatischen Vorgeschichte des Krieges brachte allerdings auch nach Freigabe aller Quellen kein eindeutiges Resultat. Bismarcks Verhalten in der Frage der spanischen Kandidatur bleibt bis heute rätselhaft, doch es spricht viel für die Vermutung, dass der Kanzler des Norddeutschen Bundes im Frühjahr 1870 den Krieg mit Frankreich provozieren wollte, um eine scheinbar schon Gestalt annehmende Koalition der Besiegten von 1866 zu verhindern.4
Obwohl dieser letzte für Deutschland siegreiche Krieg sich schon lange dem allgemeinen Gedenken entzogen hat, sind zwei der aus ihm hervorgegangenen Resultate noch bis heute gültig. 1870 war das Jahr, in dem die Grande Nation, die den europäischen Kontinent seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges mit ihrer verfeinerten Kultur befruchtet und zuletzt mit ihren revolutionären Ideen terrorisiert hat, unwiderruflich in die zweite Reihe der Mächte Europas treten musste. Mit seiner für ganz Europa überraschenden und totalen Niederlage gab Frankreich endgültig seinen privilegierten Platz unter den Nationen an die bis dahin gönnerhaft belächelten Deutschen ab.5 Jules Michelet hatte geirrt, wenn auch in großartiger Rhetorik. Nach 1871 war Frankreich nie mehr wirklich groß und Furcht einflößend. Die einst verhockten Deutschen mit ihren wunderlichen Narrheiten, ihrem Mangel an Gewandtheit und ihrer Vorliebe für ein zurückgezogenes Dasein, wie sie während der Herrschaft Napoleons Germaine de Staël-Holstein, eine Tochter des letzten Finanzministers unter Ludwig XVI., Jacques Necker, nicht ohne Sympathie den Franzosen so eingängig beschrieben hatte,6 waren plötzlich zu berechnenden Technokraten mutiert. In allen Dingen, die er studiert habe, sei ihm immer die Überlegenheit des deutschen Verstandes und der deutschen Arbeit aufgefallen, befand der Historiker Ernest Renan nach dem Bekanntwerden der Kapitulation von Sedan im vertrauten Pariser Kreis. Ihre Überlegenheit liege nicht nur in der Kriegskunst, die zwar nur eine untergeordnete, aber doch komplizierte Kunst sei. Die Deutschen seien sogar, so behauptete der Sorbonneprofessor nach dem Zeugnis Edmond de Goncourts, »eine überlegene Rasse«.7
Mit atemberaubender Schnelligkeit hatten seit August 1870 die deutschen Armeen das Kartenhaus französischer Selbstüberschätzung und Realitätsverleugnung zum Einsturz gebracht. Der Botschafter Napoleons in Washington, Lucien Anatol Prévost-Paradol, hatte weitaus mehr Wirklichkeitssinn als der Republikaner Jules Michelet bewiesen und seinen Landsleuten eine empfindliche Niederlage im bevorstehenden Krieg prophezeit. Dem jungen Grafen Maurice de Hérisson versicherte er, dass die Franzosen im eigenen Lande zerschmettert würden, ehe er sich in der Nacht zum 20. Juli 1870 aus Verzweiflung eine Kugel in den Kopf schoss.8 Schon zwei Jahre vor Kriegsausbruch hatte der liberale Publizist in seiner Schrift La France nouvelle, gewarnt, dass ein Waffengang mit den Deutschen die Grande Nation auf den Status einer Mittelmacht reduzieren würde, die nur noch »einfluss- und ehrlos in ihren Ruinen dahinvegetieren« könne.9 Tatsächlich wurde Frankreich bei stagnierender Bevölkerung in Wissenschaft, Technik und Wirtschaftskraft von den seit 1871 vereinigten Deutschen in wenigen Dekaden weit hinter sich gelassen. Der forcierte Ausbau seines afrikanischen Kolonialreiches konnte den politischen Bedeutungsverlust nicht aufhalten und zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt das von der Dreyfus-Affäre sowie von ständigen Unruhen und Streiks gespaltene Land bereits als gescheiterter Staat. Frankreich siegte noch einmal im Ersten Weltkrieg, dem Grande Guerre, über Deutschland, aber nur mithilfe der halben Welt. Im nächsten Krieg siegte es dann gar nicht mehr. Seine Aufnahme in den Kreis der Siegermächte von 1945 war bereits eine politische Farce. Kein Beschwören hoher Prinzipien von Zivilisation und universaler Humanität, keine pompösen militärischen Inszenierungen auf den Champs-Élysées, kein geschenkter Platz im Weltsicherheitsrat, und nicht einmal seine Nuklearbewaffnung haben an der seit 1871 besiegelten Zweitrangigkeit Frankreichs etwas zu ändern vermocht. Dagegen haben selbst zwei verlorene Weltkriege, vier Dekaden der Teilung und zuletzt sogar François Mitterrands fatale Initiative zur Abschaffung der Deutschen Mark den ersten Rang Berlins in Europa bis heute nicht dauerhaft infrage stellen können.
Die historische Forschung in Deutschland hat den Krieg von 1870/71 seit der Weimarer Republik aus nachvollziehbaren Gründen lange vernachlässigt. Das »Zeitalter der Weltkriege« hatte sich zwischen den heutigen Betrachter und ein fernes Ereignis geschoben, von dem gelegentlich noch verwitterte Kriegerdenkmäler und etliche Straßennamen einer gewöhnlich ignoranten Anwohnerschaft Kunde zu geben versuchen. Wer aber noch im Groben oder gar im Detail Kenntnis der Ereignisse von 1870/71 hat, dürfte eher von dem damaligen deutschen Triumphgeheul peinlich berührt sein und die Reichsgründung als Vorstufe zu den Katastrophen des 20. Jahrhunderts deuten. Allenfalls als Vorform einer sich im 20. Jahrhundert entgrenzenden totalen Kriegführung erschien der Krieg Preußens und seiner Verbündeten gegen Frankreich für Historiker noch interessant.10 Hervorgegangen aus einem diplomatischen Tauziehen hinter den Kulissen war er nach dem raschen Sturz des Kaiserreiches vollends zu einer Auseinandersetzung zweier Nationen eskaliert. Die in allen Anfangsschlachten klar geschlagenen Franzosen versuchten verzweifelt mit einer neuen Levée en masse den längst verblassten Geist ihrer ersten Revolution wiederzubeleben. Es reichte immerhin, die Deutschen anfänglich in Verlegenheit zu bringen. Um dem Krieg eine Wende zu geben, fehlten Frankreichs neuen Armeen freilich Disziplin, militärisches Können und vor allem die Zeit.
Gleichwohl sprach Helmuth Graf von Moltke, Chef des Generalstabs der Preußischen Armee und siegreicher Heerführer, im Rückblick von einem »Volkskrieg« als neuer mörderischer Form militärischer Konflikte und warnte 1890 im Reichstag nur wenige Monate vor seinem Tod vor einem neuen Siebenjährigen oder gar Dreißigjährigen Krieg.11
Wo aus den alten Kabinettsarmeen Millionenheere entstanden waren, mussten unweigerlich auch die Bevölkerungen der Konfliktparteien ins Spiel kommen. Erstmals hatten im Krieg von 1870/71 Eisenbahnen und Telegrafie äußere Front und Heimat näher zusammengerückt. Nachrichten vom Kriegsschauplatz trafen, wenn auch in gefilterter Form, gewöhnlich schon am nächsten Tag bei den Lesern zuhause ein und waren sogar eine wichtige Informationsquelle für die kämpfende Truppe, wenn etwa Angehörige Zeitungen oder Zeitungsartikel mit der Feldpost zurück nach Frankreich schickten. Die Daheimgebliebenen hatten dem König oder der Republik nicht allein Soldaten zu stellen. Sie mussten jetzt auch ihren Kämpfern draußen im Feld den Rücken stärken, Kriegsmaterial produzieren, Verwundete in den Reservelazaretten versorgen und unerschüttert alle Verluste ertragen.
Es genügte inzwischen nicht mehr, die Armeen des Feindes zu zerschlagen, auch der Widerstandswille seiner Bevölkerung musste durch Propaganda oder gar physischen Zwang gebrochen werden. Der moderne industrialisierte Krieg erfasste schlagartig sämtliche Lebensbereiche der beteiligten Nationen und drohte zukünftig zu einem jahrelangen verlustreichen Ringen der Kontrahenten zu mutieren. Die letzten fünf Monate des Deutsch-Französischen Krieges gaben auch bereits einen Vorgeschmack, wie zukünftig Krieg gegen die Bevölkerung geführt werden würde.
Mit den Franzosen seien die deutschen Truppen allerdings noch zu nachsichtig gewesen, befand etwa Unionsgeneral Philip Sheridan, der als Kriegsbeobachter aus den Vereinigten Staaten angereist war. Man müsse den Leuten so viel Leid zufügen, dass ihnen nur noch die Augen blieben, um den Krieg zu beweinen, hatte er während einer abendlichen Tischrunde in Reims im Beisein Bismarcks erklärt.12 Der Held des Amerikanischen Bürgerkriegs hatte bereits 1864 mit der Verwüstung des Shenandoa-Tales in Virginia ein klares Zeichen gesetzt, wie man es seiner Ansicht nach anstellen musste. Seine Gastgeber taten sich freilich nicht schwer, den brutalen Empfehlungen des Amerikaners zu folgen. Schon auf dem Vormarsch nach Paris im September brannten entlang der Marschstraßen etliche Ortschaften, aus denen vermutlich Bauern auf deutsche Kolonnen geschossen hatten.13 Französische Zivilisten in den besetzten Gebieten, in denen die Deutschen bislang nur willkommene Lieferanten von Verpflegung und Transportmitteln gesehen hatten, wurden plötzlich selbst zu Feinden, von denen jederzeit Gefahr auszugehen schien. Jeder Bauer oder harmlos wirkende Bürger hinter der durchlässigen Front konnte nun ein Unterstützer von Freischärlern sein oder sogar selbst eine Waffe im Keller versteckt haben. Ungeduldig drängte Bismarck angesichts wachsender Verluste durch sogenannte Franctireurs im Hinterland auf eine fühlbare Verschärfung der Repressalien gegen verdächtige Zivilisten. In einem bemerkenswerten Memoire vom Dezember 1870 empfahl der Kanzler des Norddeutschen Bundes und preußische Ministerpräsident schließlich unverhohlen größere Strenge gegenüber dem Feind, etwa die Einforderung von Geiseln sowie mehr Requisitionen auch von Privatbesitz.14 Fast wörtlich wiederholte er den Gedanken Sheridans, wenn er schrieb, dass das französische Volk jetzt endlich die Härten des Krieges deutlicher spüren müsse. Durch seine verschärften Leiden solle es gezwungen werden, Druck auf die Pariser »Advokatenregierung« auszuüben, den Widerstand einzustellen. Von der Beschießung der Hauptstadt versprachen sich Bismarck und die deutsche Öffentlichkeit allerdings zu viel. Als Anfang Januar 1871 endlich genügend Artillerie und Munition verfügbar waren, beschoss man mit einem Teil der Geschütze auf besondere Veranlassung Moltkes auch die Pariser Zivilbevölkerung.15 Das deutsche Terrorbombardement auf die Wohnbezirke des linken Seineufers verursachte jedoch nur geringe Verluste und wurde zum Erstaunen deutscher Offiziere von den Hauptstädtern anfangs sogar als willkommene Ablenkung betrachtet.16 Gravierender waren dagegen die Folgen der von Moltke und dem Generalstab favorisierten Hungerblockade. Zwischen Oktober 1870 und Februar 1871 starben in Paris rund 42 000 Menschen mehr als sonst in diesen Monaten.17
Im Vergleich zur Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg fehlte auf deutscher Seite allerdings noch der Wille zum Genozid im großen Stil. Zwar hatte Bismarck in seiner berüchtigten Dezemberdenkschrift an den König bereits gefordert, mehr französische Gefangene zu erschießen, da man von ihnen schon so viele in Deutschland unterbringen müsse, doch bei dem ausgeprägten Rechtsgefühl der größtenteils noch in christlichen Denkmustern befangenen deutschen Soldaten war an eine totale Kriegführung nicht zu denken gewesen.18 Repressalien oder Gewaltexzesse kamen zwar vor, ergaben sich aber gewöhnlich aus der konkreten Situation und waren nicht Teil einer Gesamtstrategie gegen die Zivilbevölkerung. Trotz eines abstrakten Abscheus auf die Franzosen als Nation gerade in gebildeten Kreisen, gespeist durch die nationalistische Rhetorik der Befreiungskriege, überwog doch aufseiten der deutschen Soldaten gegenüber den gegnerischen Gefangenen eher Mitleid, Respekt und gelegentlich sogar Sympathie.
Bismarcks Ziele waren im Winter 1870/71 die Kapitulation und der Friede, nicht die Dezimierung der Hauptstädter, sosehr vielen seiner biederen Landsleute das »Babylon an der Seine« auch als verrufener Hort aller Weltübel erscheinen mochte.19 Tatsächlich kam es erst nach dem Abzug der Preußen und der Niederwerfung der Pariser Kommune durch die Truppen der Republik im Mai 1871 zu Massentötungen im Stile des 20. Jahrhunderts, denen fast 20 000 Pariser zum Opfer fielen.20 Der Massenmord an den eigenen Landsleuten aus ideologischen Motiven war seit der Revolution von 1789 ja durchaus kein Novum in der Geschichte Frankreichs.
Wiederholt hatte Moltke nach dem Frankfurter Friedensschluss das Regime der »Pariser Advokaten« angeklagt, den Krieg nach dem Sturz des Kaiserreiches durch die Bewaffnung aller verfügbaren Männer unnötig verlängert zu haben. Doch er übersah, oder wollte es sogar übersehen, dass der Gegner damit nur das preußische Modell des »Volkes in Waffen« zu kopieren versucht hatte.21
Tatsächlich hatten Preußen und später auch seine deutschen Verbündeten mit ihrer allgemeinen Wehrpflicht selbst die Büchse der Pandora geöffnet und ihre Länder zu Kasernen gemacht. Es waren die Deutschen, die 1870 in Europa das erste Millionenheer ins Feld gestellt und damit ein neues Kapitel in der Militärgeschichte aufgeschlagen hatten. Besonders in den beiden Kriegen gegen Österreich und Frankreich über alle Erwartungen erfolgreich agierend, mutierte die zuvor als unprofessionell verachtete preußische Armee mit ihrer allgemeinen Wehrpflicht bei vergleichsweise kurzer Dienstzeit zunächst zum Vorbild für ganz Deutschland und schließlich auch zum Maßstab für etliche andere europäische Staaten. Alternative Konzepte nach dem Vorbild des Schweizer Milizsystems verschwanden ganz aus den Wehrdebatten. Selbst Großbritannien und die Vereinigten Staaten, deren politische Eliten von jeher große stehende Heere mit kritischen Augen betrachtet hatten, würdigten Preußens neue Schlagkraft, während das so stolze Frankreich sich beeilte, mit einer Reihe von Wehrgesetzen das vormals verpönte preußische Modell zu kopieren. Vor 1870 wäre dieser Schritt an der Seine undenkbar gewesen.22 Der weltweite Siegeszug der allgemeinen Wehrpflicht eröffnete das Zeitalter der Millionenheere und des totalen Krieges. Er erreichte sogar das reformierte Kaiserreich Japan und prägte bis in die jüngste Vergangenheit die Wehrverfassung der meisten Staaten in der Welt. Auch dies war eine Folge des vergessenen Krieges von 1870/71.
Bis zum ersten Schuss
Paris 1867 – Das Zweite Kaiserreich noch einmal als Mittelpunkt Europas
»Niemals hat sich das universelle Wohlwollen Frankreichs, trotz Sadowa, deutlicher manifestiert als in der großen Ausstellung von 1867, jenem herausragenden Fest, das Paris ganz Europa gab. Welche Aufnahme bereiteten wir unseren Gästen? Welches blinde Vertrauen zeigten wir ihnen? Welche Gastfreundschaft? Wir rissen Tore und Mauern nieder, damit diese Stadt die Welt empfangen, ja sogar umarmen konnte, und der Geist der Brüderlichkeit bewog einen Dichter sogar zu sagen: Paris ist mehr als nur eine Stadt. Trete ein, Menschheit! Diese Stadt gehört Dir.«
Jules Michelet, La France devant l’Europe, Januar 18711
Im April 1867 öffnete die Pariser Weltausstellung ihre Pforten. Es war bereits das zweite Großereignis im neuen Zeitalter der industriellen Revolution, das nach der Ausstellung von 1855 in der Seinemetropole stattfand. Nach dem Willen Napoleons, ihres obersten Schirmherren, sollte die Exposition universelle eine Schau der Superlative werden. Mit einer gigantischen Mischung aus modernster Technik und Kulturleistungen aller Kontinente wollte sich das Zweite Kaiserreich den Besuchern als Speerspitze einer sich anbahnenden Weltzivilisation präsentieren. Frankreich beanspruchte dann auch mit seinen Exponaten beinahe die Hälfte der Ausstellungsfläche und versuchte in sämtlichen Kategorien seine Überlegenheit gegenüber der übrigen Welt zu dokumentieren.2
Als 1863 mit den Vorbereitungen begonnen worden war, schien Frankreichs Vorrangsanspruch durchaus nicht abwegig. Das Zweite Kaiserreich war damals noch die unbestrittene Vormacht auf dem europäischen Kontinent. Napoleon, der Parvenü und Umstürzler, der nach seinem zweiten gescheiterten Putsch von 1840 sechs Jahre in der nordfranzösischen Festung Ham hatte verbringen müssen, ehe ihm die Flucht nach England gelang, stand auf Augenhöhe mit den alten Kaiserhäusern Österreichs und Russlands. Seine Armee hatte im Krimkrieg gesiegt und 1856 auf dem Pariser Friedenskongress gemeinsam mit Großbritannien der russischen Kriegsflotte die Passage durch die Dardanellen gesperrt. Mit Frankreichs militärischer Hilfe war 1859/61 das Königreich Italien entstanden und im fernen Mexiko kämpften 1863 noch 40 000 Franzosen um die Errichtung eines neuen Kaiserreiches, an dessen Spitze ausgerechnet ein Habsburger stehen sollte.3 In Europa schien keine wesentliche politische Veränderung gegen den Willen Frankreichs möglich. Preußen, das bis dahin unter Mühen seinen Großmachtstatus hatte wahren können, war in den Augen Napoleons – kaum anders als das neue Italien – nur ein politischer Protegé und wurde auch gönnerhaft das »Piemont des Nordens« genannt.
Bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung am 1. April 1867 erstrahlte ein durch Baron Georges Eugène Haussemann verwandeltes Paris im neuen Glanz. An der Stelle seiner mittelalterlichen Gassen teilten nun bis zu 30 Meter breite Boulevards, von Alleebäumen und prächtigen Bürgerhäusern flankiert, die Innenstadt zwischen Gare de l’Est, dem Place de la Concorde und dem Place de la Bastille. Doch mit seiner erneuerten Nationalbibliothek und seiner soeben vollendeten Oper war Paris schon die Kapitale eines vergehenden Imperiums. Innerhalb von nur vier Jahren hatten sich die Machtverhältnisse auf dem Kontinent entschieden gewandelt. Der verachtete preußische Militärstaat, mit seinem angeblichen Untertanengeist und seiner Pedanterie für die feinen Pariser der Inbegriff aller Kulturlosigkeit, war unter der Führung seines anfangs unterschätzten Ministerpräsidenten Otto von Bismarck in die erste Reihe des europäischen Staatensystems vorgerückt. Frankreich sah sich plötzlich zu einer nachrangigen Macht deklassiert. Die Inbesitznahme der seit 1848 umstrittenen Herzogtümer Schleswig und Holstein durch Preußen und Österreich war 1864 nur der Eröffnungscoup gewesen. Zwei Jahre darauf hatte der aufstrebende Hohenzollernstaat den vormaligen österreichischen Alliierten auf den Schlachtfeldern Böhmens in nur sechs Wochen militärisch gedemütigt und seine Grenzsteine bis zur Mainlinie vorverlegt. Den nach dem Sturz Napoleons I. im Jahre 1815 errichteten Deutschen Bund hatte Bismarck kurzerhand aufgelöst und Österreich mit seinen deutschsprachigen und böhmischen Gebieten aus Deutschland verdrängt. Damit war der alte preußisch-österreichische Dualismus, der seit der Epoche des großen Friedrich das Verhältnis beider Mächte vergiftet hatte, zugunsten Preußens entschieden. Hilflos hatte Frankreich dem beängstigenden Aufstieg seines vermeintlichen Schützlings zusehen müssen, ohne für dessen ungeheure Machtzuwächse auch nur die geringste Kompensation erhalten zu haben.
Preußens überraschender Sieg bei Königgrätz am 3. Juli 1866 hatte Frankreichs Politik fast ebenso stark erschüttert wie das damals tatsächlich geschlagene Österreich. Das politische Paris war so konsterniert, dass Presse und Öffentlichkeit fassungslos den böhmischen Schlachtort unter dem Namen »Sadowa« als eigene Niederlage bilanzierten. Damit hatten die Demütigungen der Grande Nation allerdings noch kein Ende.
Noch während im April 1867 die ersten von insgesamt elf Millionen Besuchern über das riesige Ausstellungsgelände auf dem Pariser Marsfeld flanierten, hatte Napoleons dilettantischer Versuch, mit dem Erwerb Luxemburgs doch noch den dringend benötigten Prestigegewinn zu erzielen, Europa in eine schwere politische Krise gestürzt.
Das Kaiserreich sah sich der Lächerlichkeit preisgegeben und begann sogar zu rüsten. In preußischen Offizierkreisen machte schon das Wort vom Krieg die Runde4 und Helmuth von Moltke plädierte als Chef des Generalstabes für ein rasches Zuschlagen. Bismarck aber hatte in dem Streit um Luxemburg keinen ausreichenden Grund für einen Waffengang mit dem Zweiten Kaiserreich gesehen und war dem Vorschlag der britischen Regierung gefolgt, die Zukunft des kleinen Landes, das bis 1866 Teil des Deutschen Bundes gewesen war und immer noch dem Zollverein angehörte, auf einer internationalen Konferenz in London zu klären. Am 11. Mai 1867 unterzeichneten die Teilnehmer einen Vertrag, der das Großherzogtum zu einem souveränen und neutralen Staat erhob. Zur französischen Gesichtswahrung hatte Bismarck sich in London sogar bereit erklärt, die preußische Garnison abzuziehen, und der Schleifung der alten Luxemburger Bundesfestung zugestimmt. Das war allerdings das äußerste Entgegenkommen an Napoleon, das der preußische Ministerpräsident gegenüber der gereizten öffentlichen Meinung in den deutschen Staaten noch vertreten konnte.
»Vue officielle à vol d’oiseau de l’exposition universelle de 1867« – zeitgenössische Lithografie des Ausstellungsgeländes aus der Vogelschau.
Anfang Juni 1867 machte sich Bismarck in angespannter Stimmung an der Seite seines Monarchen auf den Weg, das Pariser Spektakel zu besuchen. Sein Erscheinen in einer Kürassieruniform erregte an der Seine viel Aufsehen, allerdings auch den Spott der zahlreich nach Paris gereisten preußischen Offiziere. Bismarcks erst im Vorjahr erfolgte Ernennung zum Generalmajor und Chef des 7. Landwehr-Kavallerie-Regiments nahm man in militärischen Kreisen nicht wirklich ernst. Seine martialische Gardarobe mochte vielleicht auch dazu gedient haben, mögliche Attentäter abzuschrecken, denn er fürchtete, wie er der Baronin Hildegard von Spitzemberg kurz vor seiner Abreise aus Berlin vertraulich mitgeteilt hatte, dass ihm in Paris etwas zustoßen könne. Angeblich hatte er deswegen sogar ein Testament verfasst. Jedenfalls rechnete der Ministerpräsident seitens der Franzosen mit einer schlechten Behandlung.5 Während der ebenfalls mitgereiste Helmuth von Moltke in einem schauerlich wirkenden schwarzen Habit die Forts von Paris, damals die größte Festung der Welt, in Augenschein nahm, dürfte Bismarck in der Sektion der Essener Firma Krupp mit besonderer Genugtuung das imposante Belagerungsgeschütz aus Stahl betrachtet haben. Die französische Presse sprach ehrfurchtsvoll vom »Mammut« oder dem »Leviathan« unter den Kanonen6 und der preußische Ministerpräsident, der sich entgegen seiner Befürchtung in Paris sogar einer gewissen Popularität erfreute,7 wird vielleicht bei ihrem Anblick schon eine Ahnung gehabt haben, dass das von sich eingenommene Pariser Publikum noch einmal in besonderer Weise mit dieser Kriegsmaschine aus Preußens berühmtester Stahlschmiede Bekanntschaft würde schließen müssen.
Nach dem Willen Napoleons hatte die Pariser Weltausstellung die Bühne zu einem großen Monarchentreffen werden sollen, wobei unter der Schirmherrschaft Frankreichs analog zur großen Friedenskonferenz von 1856 über eine Regelung der wichtigsten europäischen Fragen verhandelt werden konnte. Von der Rolle des Gastgebers und europäischen Vermittlers versprach sich der Kaiser internationale Anerkennung und eine innere Stabilisierung seines erodierenden Regimes. Napoleon ließ sogar ein Ölgemälde anfertigen, das ihn im Kreis der wichtigsten europäischen Potentaten zeigte. Der Kaiser reitet darauf einen Schimmel, zur Linken flankiert von Zar Alexander II., Sultan Abdul Aziz und König Leopold II. von Belgien, zu seiner Rechten sind Kaiser Franz Joseph I. von Österreich, Wilhelm I. und König Luis von Portugal zu erkennen.8 Eigenartigerweise fehlt auf dem Bild Queen Victoria, die noch 1855 begeisterter Gast der ersten Pariser Weltausstellung gewesen war, nun aber schon im Mai ihren ältesten Sohn Albert, den Prince of Wales und späteren König Edward VII., in die französische Hauptstadt entsandt hatte. Tatsächlich war das pompöse Gemälde von Charles Porion eine Fiktion. Das große Monarchentreffen, das sich nach der Idee Napoleons beinahe beiläufig am Rande der Ausstellung hätte konstituieren sollen, hat tatsächlich niemals stattgefunden. Kaum ein Jahr nach dem Krieg in Böhmen war an ein direktes Treffen von österreichischem Kaiser und preußischem König ohnehin nicht zu denken. Zudem hassten Bismarck und Wiens leitender Minister Friedrich Ferdinand Graf von Beust einander aus tiefster Seele. Lediglich der russische Zar besuchte, begleitet von seinem obersten Minister Alexander Gortschakov, zeitgleich mit den Preußen die französische Hauptstadt.
»Die Krupp’sche Riesenkanone« – zeitgenössischer Holzstich aus einer Serie mit Motiven der Weltausstellung.
»Les Souverains venus à Paris en 1867 pour l’exposition universelle«. Gemälde von Charles Porion (1814–1908).
Alexander II. stand allerdings nicht der Sinn nach hoher Politik und langatmigen Konferenzen. Gleich nach Überqueren der französischen Grenze hatte er sich eine Loge für Jacques Offenbachs neue Operette »Die Großherzogin von Gerolstein« reservieren lassen.9 Zu einem Vergnügen wurde seine Reise nach Paris dennoch nicht. Das Pariser Publikum verübelte dem Zaren die Unterdrückung der Polen, die sich 1863 ein weiteres Mal nach 1830 vergeblich gegen ihre russischen Zwingherren erhoben hatten, und schrie bei jeder Gelegenheit: Vive la Pologne. Als der polnische Freischärler Antoni Berezowski am 6. Juni nach einer Militärparade im Bois de Boulogne mit einer Pistole zwei Schüsse auf den in Begleitung Napoleons zurückreitenden Alexander abgeben konnte, blieben beide Herrscher zwar unverletzt, doch die festliche Stimmung war endgültig dahin. Die Bemerkung Napoleons, der um Kaltblütigkeit bemüht war, man habe nunmehr gemeinsam im Feuer gestanden und sei dadurch zu Waffenbrüdern geworden,10 konnte Alexanders Unmut über die ungestörten Umtriebe polnischer Exilanten in der französischen Kapitale kaum mildern. Auch dürfte sie den Zaren in politischer Hinsicht wenig befriedigt haben. Denn Frankreich war weit davon entfernt, der Waffenbruder Russlands zu sein und den Zaren etwa bei seinen Ambitionen auf dem Balkan gegen den Rivalen Österreich unterstützen zu wollen. Nicht einmal ein Entgegenkommen in der Dardanellenfrage hatte ihm Napoleon angedeutet. Verstimmt über die unverhohlene Ablehnung des Pariser Publikums verließ der Zar bereits fünf Tage später die Stadt, in der er beinahe ums Leben gekommen war. Kurz darauf machten sich auch die Preußen am 14. Juni auf den Heimweg. König Wilhelm zeigte sich, obwohl bei allen öffentlichen Kundgebungen vom hauptstädtischen Publikum hartnäckig geschnitten, stets vergnügt und nach der Schilderung des Rittmeisters Alfred Graf von Schlieffen sogar mit einem Ausdruck von anrührender Güte. Selbst bei der Verabschiedung durch Napoleon am Bahnhof rief die Menge zur Brüskierung des hohen preußischen Gastes wie besinnungslos: Vive l’empereur.11 Als beide Monarchen sich das nächste und letzte Mal am 2. September 1870 in dem Schlösschen Bellevue bei Frénois oberhalb der Maas wiedersahen, war das Ende des Zweiten Kaiserreichs bereits besiegelt.
Dass König Wilhelm und sein kaiserlicher Neffe Alexander ihre guten Beziehungen in der Seinemetropole noch einmal bekräftigen konnten, lag weniger an den gegen sie beide gerichteten Schmähungen der Pariser. Das russisch-preußische Einvernehmen verdankte sich vor allem der schlichten Tatsache, dass St. Petersburg und Berlin, anders als die übrigen europäischen Mächte, keine ernsthaften Interessengegensätze trennten.
Gemeinsam beherrschten beide Mächte das 1815 erneut geteilte Polen, gemeinsam hatte man Österreich zum Rivalen und gemeinsam schien man für ein konservatives Politikmodell zu stehen, das als Bollwerk gegen den wachsenden Einfluss des politischen Liberalismus dienen sollte. Zwar kostete dies Preußen die Sympathien der Briten, die sich viel auf ihr parlamentarisches Regierungssystem zugutehielten, doch besaß die von den Liberalen gestellte britische Regierung weder die Mittel noch überhaupt den Willen, den Preußen auf dem Kontinent energisch Einhalt zu gebieten. Europa war für Großbritannien, das traditionell weltweite Ambitionen verfolgte, längst nur noch einer von vielen politischen Schauplätzen. Der Aufstieg der Vereinigten Staaten, die soeben Alaska erworben hatten und damit die kanadische Westküste in die Zange nahmen, bereitete London weitaus mehr Kopfzerbrechen als Preußens Machtzuwächse in Norddeutschland. 1862 hatte Bismarck die britische Hauptstadt besucht und war mit den maßgeblichen Politikern des Inselreiches zusammengekommen, nur um am Ende erstaunt zu bilanzieren, dass Männer wie Palmerston, Russel oder Disraeli mehr über China oder die Türkei wussten als über Preußen.12 Trotz aller Kritik an Bismarcks rüden Methoden und seiner antiliberalen Grundhaltung sah London in dem so überraschend erstarkten Preußen eher den neuen Garanten des Status quo auf dem Kontinent, mit dem sich das unruhige Frankreich besser unter Kontrolle halten ließ. Selbst die zukünftige Vereinigung des Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen Staaten wollte Außenminister George William Villers, der vierte Lord Clarendon, akzeptieren, solange Preußen versprach, diese Entwicklung nicht ungebührlich zu forcieren. Bismarck durfte also weiterhin von jener günstigen politischen Konjunktur profitieren, die seit dem Ende des Krimkrieges das Abrücken der beiden europäischen Flügelmächte Großbritannien und Russland von der Mitte Europas eröffnet hatte.13
Dagegen drohte für Napoleon die politische Bilanz der Weltausstellung mehr als dürftig auszufallen. Nur wenige Wochen nach der vorzeitigen Abreise des Zaren hatte ein neuerlicher Schlag den politischen Horizont des Zweiten Kaiserreiches weiter verdüstert. Am 19. Juni 1867 war im fernen mexikanischen Querétaro Erzherzog Ferdinand Max, der Bruder des österreichischen Kaisers, von den siegreichen Republikanern auf Befehl des Präsidenten Benito Juarez standrechtlich erschossen worden. Es war Napoleons Idee gewesen, den Habsburger als Kaiser Maximilian von Mexiko zu inthronisieren, um damit den französischen Einfluss in Mittelamerika zu stärken. Das Projekt aber hatte die Kräfte Frankreichs rasch überfordert, und als nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges Napoleon seine Truppen auf Druck der siegreichen Unionsregierung zurückziehen musste, war das Schicksal des mexikanischen Kaiserreiches besiegelt. Der gewaltsame Tod des im Stich gelassenen Erzherzogs verletzte die Eitelkeit der Grande Nation mehr, als es Bismarcks politische Winkelzüge je vermocht hätten. Jeder konnte sehen, dass der Neffe des großen Korsen inzwischen ohne Fortune agierte. Gleichwohl schien der fatale Ausgang des überseeischen Abenteuers Napoleons die Beziehungen zu Wien nicht getrübt zu haben. Beiden Höfen war inzwischen bekannt, dass der Erzherzog es abgelehnt hatte, sich seiner Gefangennahme durch eine bis zuletzt mögliche Flucht zu entziehen. So konnte das Pariser Publikum Maximilians Ende vor dem Peloton der Juaristen als durchaus selbst gewählt betrachten. Unbeschwert tanzte es im erstmals elektrisch beleuchteten Garten der österreichischen Botschaft zu den Klängen der Strauss’schen Walzer, die von dem nach Paris angereisten Meister selbst dirigiert wurden.14
Derweil war Napoleon im August 1867 nach Salzburg gereist. Offiziell, um Kaiser Franz Joseph zu kondolieren, tatsächlich aber ging es um europäische Politik und um die Eindämmung Preußens, an der beiden Kaiserreichen in gleicher Weise gelegen war. Keine Einigkeit bestand zwischen beiden Mächten jedoch über den einzuschlagenden Weg. Habsburg konnte unmöglich daran mitwirken, als Preis für die Wiederherstellung seiner alten Position in Deutschland den Franzosen deutschsprachige Gebiete am Rhein zu überlassen. Dies hätten weder die deutschen Untertanen des Kaisers noch die Ungarn gebilligt, die nach dem großen Ausgleich von 1867 an dem Wiederaufleben einer habsburgischen Deutschlandpolitik ohnehin kein Interesse hatten. Napoleon wiederum konnte keinen Vorteil darin sehen, sich an der Seite Österreichs in einen möglichen Balkankonflikt gegen Russland verwickeln zu lassen. Gleichwohl riss der Gesprächsfaden zwischen beiden Mächten nicht ab und im Oktober, wenige Wochen vor dem Ende der siebenmonatigen Ausstellung, erwies endlich auch der habsburgische Kaiser der Seinemetropole seine Referenz. Die neuerliche Begegnung der beiden Monarchen zeigte aber nur, dass sich die Kluft zwischen beiden Mächten nicht geschlossen hatte. Einmal mehr erwies sich Napoleon als die »Sphinx von der Seine«, die sich nun wieder Russland anzunähern schien. Jedenfalls war seine Zusage von Salzburg, zusammen mit Habsburg gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Balkanvölker für die Integrität des Osmanischen Reiches einzutreten, plötzlich kein Thema mehr.15 Irritiert verließen die Österreicher die Hauptstadt Frankreichs, die sich nun beeilte, wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Nach dem Ende der großen Ausstellung entfernte ein Heer von Arbeitern in atemberaubender Schnelligkeit ihre prächtigen Pavillons, Verkaufsbuden und Kioske. Innerhalb von nur 24 Stunden erinnerte kaum noch etwas an das zentrale Ereignis des Jahres und vielen Parisern erschien das rasche Verschwinden der Ausstellung auf dem Marsfeld wie ein Unheil verkündendes Symbol. Würde nicht eines Tages auch das jetzt noch einmal so prächtig erstrahlte Kaiserreich ganz plötzlich von der Bildfläche verschwunden sein?16 Politisch stand Napoleon mit leeren Händen da und nichts signalisierte wohl den Niedergang des Zweiten Kaiserreiches so sehr wie das Gefecht von Mentana bei Rom. Dort hatte am 3. November 1867, am selben Tag, an dem in Paris die Weltausstellung mit einem satten Überschuss von drei Millionen Francs endgültig ihre Pforten schloss, ein französisches Kontingent eine 3000 Mann starke Freischärlertruppe unter dem legendären Guiseppe Garibaldi zerschlagen, die den von Frankreich garantierten Kirchenstaat hatte besetzen wollen. Das Scharmützel von Mentana war zwar der letzte militärische Erfolg des Zweiten Kaiserreiches, doch dass Garibaldi es überhaupt gewagt hatte, Frankreich in dieser Form herauszufordern, verdeutlichte bereits dessen gewaltigen Prestigeverlust in Europa.17
Preußisches Prävenire – Erzherzog Albrechts geheime Reise nach Paris und die spanische Thronkandidatur
»Bismarck nahm die hohenzollernsche Kandidatur in die Hand, so wie wenn jemand mit brennendem Schwefelholz über einen Gashahn fährt, um zu sehen, ob derselbe auf oder zu ist.«
Friedrich von Holstein, Erinnerungen und Denkwürdigkeiten18
Am 4. Januar 1870 bestieg eine kleine Gruppe österreichischer Offiziere in Zivil unter Führung eines Grafen von Friedeck im Wiener Südbahnhof den Zug nach Verona, um zwischen Adda und Ticino die alten Kampfplätze der Kriege von 1848, 1859 und 1866 aufzusuchen. Die Herren nahmen sich dazu viel Zeit und überquerten erst vier Wochen später die französische Grenze bei Nizza, um zunächst ihr umfangreiches Besuchsprogramm in Frankreich fortzusetzen. Am 10. Februar erreichten die geheimnisvollen Reisenden schließlich die Hauptstadt Paris, wo sie nach dem Bezug eines komfortablen Quartiers von Kriegsminister Edmond Leboeuf persönlich durch dessen gesamtes Ministerium in der Rue St. Dominique geführt wurden. Auch das berüchtigte Deuxième Bureau, in dem der französische Nachrichtendienst seinen obskuren Geschäften nachging, sparte der Marschall dabei nicht aus.19 Spätestens der Empfang durch das französische Kaiserpaar am 18. Februar auf Schloss St. Cloud beendete das bis dahin sorgsam gehütete Inkognito der hohen Besucher. Der angebliche Graf von Friedeck war niemand anderes als der damals renommierteste Militär der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, Erzherzog Albrecht, der Onkel Kaiser Franz Josephs I. und Sieger von Custoza.
Den Franzosen erschien der Erzherzog in ihrer verfahrenen Lage wie ein Retter, und das Galadiner, das der Kriegsminister kurz darauf zu Ehren seiner österreichischen Gäste veranstaltete, verlief in sehr gehobener Stimmung. Unter dem Beifall der anwesenden Generale erklärte Leboeuf, dass er glücklich sei, nunmehr den Sieger von Custoza in einem zukünftigen Krieg an der Seite Frankreichs zu wissen.20 Auch wenn der Marschall in seiner Rede Preußen als Gegner gar nicht erwähnt hatte, läuteten in Berlin jetzt erstmals die Alarmglocken. Als sich schließlich Albrechts Aufenthalt in Paris Woche um Woche verlängerte und der Erzherzog Anfang März sogar den Flottenstützpunkt Cherbourg besuchte, erteilte ein inzwischen sehr beunruhigter Otto von Bismarck am 11. März seinem Pressebüro die Anweisung, zunächst in einem regierungsfernen Blatt über Albrechts Reise ausführlich berichten zu lassen und sie besonders den süddeutschen Höfen als bedenkliches Symptom einer französisch-österreichischen Annäherung darzustellen.21 Noch am selben Tag hatten die österreichischen Besucher über Reims und Frankfurt allerdings schon die Rückreise nach Wien angetreten, nicht ohne zuvor noch einem Schießen der französischen Artillerie auf dem Übungsplatz Chalons in der Champagne beizuwohnen. Dass Albrecht tatsächlich für die Franzosen nur wenig Sympathie aufbrachte und ihre militärischen Vorbereitungen nach seiner Reise eher kritisch bewertete,22 konnte der Kanzler des Norddeutschen Bundes vorerst nicht wissen.
Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen in preußischer Marschall-Uniform, (Foto 1895).
Seit der Luxemburgkrise von 1867 hatten Wien und Paris unter Einbeziehung Italiens versucht, ein antipreußisches Bündnis zustande zu bringen. Beide Kaiser hatten sich noch im August desselben Jahres in Salzburg getroffen. Offiziell war Napoleon damals mit der delikaten Aufgabe angereist, Franz Joseph wegen des Todes seines Bruders, des Erzherzogs Ferdinand Maximilian, zu kondolieren. Insgeheim hatten sich beide Monarchen in Salzburg aber mit der Frage befasst, wie der scheinbar stetig wachsenden Macht des Hohenzollernstaates an der Mainlinie gemeinsam Einhalt geboten werden konnte.23 Vielleicht ließen sich sogar, so die von Napoleon genährten Hoffnungen Wiens, die Ergebnisse des verlorenen Krieges von 1866 durch einen erfolgreichen Waffengang noch revidieren. Bismarck hatten diese Bemühungen anfangs nicht übermäßig beunruhigt. Schienen doch die Interessen der beiden Mächte zu gegensätzlich, um jemals zu einer handlungsfähigen Allianz zu amalgamieren. Es war kein Geheimnis, dass das französische Zweite Kaiserreich nach seinem unrühmlichen Rückzug aus Mexiko unter wachsendem innenpolitischen Druck stand und seither mit wenig Geschick nach jedem noch so geringen außenpolitischen Vorteil zu greifen versuchte. Infrage kamen etwa territoriale Gewinne in Belgien oder im Rheinland, um die sich Kaiser Napoleon III. seit dem raschen Vorfrieden von Nikolsburg und dem diplomatischen Desaster um Luxemburg von Bismarck geprellt fühlte.
Österreich wiederum, dessen Politik seit 1867 der Sachse Friedrich Ferdinand Graf von Beust leitete, konnte nicht ohne Gesichtsverlust seine Hand dazu reichen, Frankreich bei der Vereinnahmung deutschen Gebietes zu assistieren. Obwohl aus persönlichen Gründen ein erklärter Feind Bismarcks betrieb von Beust keinen revisionistischen Kurs um jeden Preis. Nur wenn es in Süddeutschland als Befreier wahrgenommen würde, so sein Kalkül, hatte Habsburg überhaupt eine Chance, in Deutschland wieder Fuß zu fassen. Auch die Wünsche Italiens als möglicher Dritter im Bunde schienen kaum mit den Interessen der beiden übrigen Mächte vereinbar. Seit Jahren stieß die Regierung in Florenz mit ihrer Forderung bei Napoleon auf taube Ohren, das französische Schutzkorps für Papst Pius IX. aus Rom abzuziehen, um endlich Italiens wahre Hauptstadt in Besitz nehmen zu können. Mochte der Kaiser auch mit dem Wunsch der Italiener insgeheim sympathisieren, so konnte er doch auf die Unterstützung der französischen Katholiken unmöglich verzichten, die ihm eine Preisgabe des Patrimonium Petri niemals verziehen hätten. Die kaum auflösbare Gemengelage, die noch von den Ansprüchen Italiens auf das österreichische Isonzotal und Triest verschärft wurde, hatte ein wirksames Zusammengehen der drei Mächte bisher verhindert und schien es auch in Zukunft zu tun.
Wenn aber nun der wohl einflussreichste Militär der Doppelmonarchie die Mühe auf sich nahm, auf großen Unwegen und in anfänglichem Inkognito nach Paris zu reisen, mussten die Sondierungen zwischen den beiden Kaiserreichen eine neue Qualität erreicht haben. Bismarck konnte kaum Zweifel daran hegen, dass in der französischen Hauptstadt bereits über konkrete militärische Operationen gegen Preußen verhandelt worden war.24
Selbst ohne diese Besorgnis erregenden Neuigkeiten hatte sich für den Kanzler des Norddeutschen Bundes der politische Horizont zu Beginn des Jahres 1870 erheblich verdunkelt. Bismarcks Pläne einer Einbeziehung der seit 1866 verwaisten süddeutschen Staaten in den neuen Norddeutschen Bund ließen sich kurzfristig kaum noch realisieren. Die Partikularisten südlich des Mains drohten inzwischen die Überhand zu gewinnen und selbst die alten Schutz- und Trutzbündnisse von 1866 schienen in Gefahr, nachdem Preußengegner in Württemberg in kürzester Frist mehr als 150 000 Unterschriften für die Einführung eines Milizsystems nach Schweizer Vorbild gesammelt hatten.25
Längst war die nationale Euphorie, die noch während der Luxemburgkrise von 1867 in München, Stuttgart und Karlsruhe dominiert hatte, einer antiborussischen Haltung gewichen. Die Wahlen zum neuen Zollparlament hatten Anfang 1868 in den drei süddeutschen Staaten unerwartet deutliche Gewinne für die Preußengegner gebracht.26 Im Februar 1870 war schließlich der bayerische Ministerpräsident, Chlodwig Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, stets ein warmer Befürworter des Anschlusses an den Norddeutschen Bund, von seinem Amt zurückgetreten, da bei den Novemberwahlen die Patriotenpartei in der Zweiten Kammer mit 80 von 154 Sitzen die absolute Mehrheit errungen hatte.27 Hohenlohes Nachfolge trat am 8. März der bisherige Gesandte Bayerns am Wiener Hof, Otto Graf von Bray-Steinburg, an. Der neue Kabinettschef in München galt als warmer Befürworter einer großdeutschen revisionistischen Politik und war zudem ein enger Freund des Grafen von Beust. Die Gefahr eines verstärkten bayrisch-österreichischen Zusammengehens lag damit für Bismarck auf der Hand.
Der Kanzler hatte bisher keinen Grund gesehen, den Anschluss der Süddeutschen mit besonderer Eile zu betreiben. Die anschlusswillige Regierung in Karlsruhe hatte er sogar ermuntert, sich an den Beratungen über die Gründung eines unabhängigen Südbundes zu beteiligen.28 Anders als vielen Liberalen in ganz Deutschland war dem eingefleischten Preußen die nationale Einheit nie eine Herzensangelegenheit gewesen. Seit seinem Eintritt in die Politik hatte er mit allen Kräften die Vorherrschaft des Hohenzollernstaates in Norddeutschland angestrebt, und noch in seinen Vorschlägen zur Reform des Deutschen Bundes hatte er im Juni 1866 eine Eigenständigkeit der vereinigten süddeutschen Staaten befürwortet.29 Gelegentlich hatte Bismarck auch durchblicken lassen, dass die kleindeutsche Union unter Führung Preußens wohl erst der folgenden Generation vorbehalten sein würde, und sprach sogar warnend vom Abschlagen »unreifer Früchte«.30 Ohnehin erwies sich die Konsolidierung der preußischen Macht nördlich des Mains als schwierig genug und das bei jeder Gelegenheit von den Partikularisten in Württemberg und Bayern zelebrierte Antipreußentum verschaffte Bismarck eine beunruhigende Ahnung von den zukünftigen Schwierigkeiten, die sich aus dem Beitritt dieser beiden Staaten zum Norddeutschen Bund ergeben mussten. Als politischen Gewinn vermochte Bismarck jedenfalls einen möglichen Beitritt Bayerns und Württembergs nicht zu verbuchen. Mit ihrem selbstgerechten Querulantentum, hinter dem sich oft nur platte Antimodernitätsreflexe oder spießige Anhänglichkeit an einen politischen Katholizismus verbargen, hatten sie ihm schon manche schlaflose Nacht bereitet. Die Geschlagenen des Krieges von 1866 allerdings auf Dauer außerhalb des Norddeutschen Bundes zu belassen, würde nur noch mehr Schaden anrichten. Nicht einmal fähig, sich zu einer kleinen süddeutschen Union zusammenzuschließen, drohten Bayern, Württemberg und auch das der Einheit mit Norddeutschland durchaus zuneigende Baden zur buchstäblich losen Kanone auf dem Deck des europäischen Staatensystems zu werden.
Bismarck hatte sich glaubhaft und wiederholt geäußert, dass er niemals einen Krieg führen würde, um den Anschluss der Süddeutschen zu erzwingen. Jetzt aber sah er sich durch die aktuelle Wendung der Dinge in die Enge gedrängt. Im Falle einer sich nunmehr ganz offenbar konkretisierenden antipreußischen Allianz zwischen Paris und Wien war durchaus nicht mehr auszuschließen, dass Süddeutschland zum Aufmarschgebiet der vereinigten feindlichen Armeen werden würde. Bayern und Württemberger könnten sich vielleicht sogar unter dem Druck der Partikularisten einer Offensive der Franzosen und Österreicher über den Main anschließen.31 Sämtliche Gewinne des siegreichen Jahres 1866 schienen auf dem Spiel zu stehen, wenn Bismarck die Dinge weiter treiben ließ. Allein dafür war der Kanzler bereit Krieg zu führen. Er konnte auch darauf setzen, dass das Heer des Norddeutschen Bundes diesen Konflikt siegreich bestehen würde. Noch im Juli des Vorjahres hatte ihm Generalstabschef Helmuth von Moltke anlässlich eines Frühstückes auf dessen schlesischem Gut Kreisau erneut versichert, dass man besser jetzt als später losschlagen solle.32
Unerwartete Hilfe kam in diesen von politischen Rückschlägen geprägten Wochen von der Madrider Militärjunta. Seit der Vertreibung der Königin Isabella II. aus dem Hause Bourbon im September 1868 suchten die neuen Machthaber um Marschall Juan Prim in ganz Europa nach einem geeigneten Thronkandidaten und konkretisierten nun ihr Angebot an den Hohenzollernprinzen Leopold aus der süddeutschen Nebenlinie. Die Annahme lag nahe, dass die spanische Initiative von Bismarck selbst arrangiert worden sei. Dagegen sprach allerdings, dass der von den Spaniern bisher umworbene Herzog von Genua tatsächlich erst am 1. Februar 1870 seine Thronbewerbung endgültig zurückgezogen hatte. Das neuerlich geäußerte Interesse Madrids an einer Kandidatur des Hohenzollernprinzen könnte also durchaus ein passender Zufall gewesen. Am 26. Februar 1870 überreichte im Auftrag von Prim ein spanischer Sondergesandter in Berlin drei ausführliche Werbebriefe an Bismarck selbst, an König Wilhelm wie auch an den Fürsten Karl Anton, den Chef der Nebenlinie Hohenzollern-Sigmaringen und Vater des umworbenen Thronkandidaten. Der 34-jährige Hohenzollernprinz Leopold war mit der Tochter des portugiesischen Königs Luis I. verheiratet und überdies katholischer Konfession. Durch seine Regentschaft könnte vielleicht auch der alte spanische Traum einer iberischen Gesamtmonarchie in Erfüllung gehen. Paris sah dies jedoch vollkommen anders und fürchtete sogar eine Einkreisung Frankreichs wie zu Zeiten Karls V. Ein Hohenzollernprinz auf dem Madrider Thron war für Napoleon unter keinen Umständen akzeptabel, selbst wenn er nur aus einer Nebenlinie des Hauses kam. Bereits im Mai 1869 hatte die französische Regierung durch ihren langjährigen Botschafter in Berlin, Vincent Graf von Benedetti, Bismarcks Außenstaatssekretär Karl Hermann von Thile unmissverständlich wissen lassen, dass sie sich mit allen Mitteln gegen eine Thronfolge des Sigmaringers wehren würde.33 Wenn nun Bismarck angesichts der bevorstehenden Eröffnung französisch-österreichischer Militärkonsultationen die spanische Karte noch einmal und jetzt mit aller Entschiedenheit aufgriff, schien es ihm vor allem darum zu tun, die Franzosen in Zugzwang zu versetzen und damit weitere Verhandlungen zwischen Paris und Wien zu torpedieren. Tatsächlich war in Paris im Anschluss an Albrechts Besuch beschlossen worden, General Barthélémy Lebrun unter Wahrung strengster Geheimhaltung zu weiteren militärischen Absprachen nach Wien zu schicken. Auch wenn Bismarck die Details dieser Mission nicht kannte, war ihm doch klar, dass er den sich offenbar vertiefenden Verhandlungen zwischen Wien und Paris keine Zeit zum Reifen lassen durfte. Insgeheim hoffte der Kanzler auf eine überzogene Aktion der Franzosen, vielleicht sogar eine überstürzte Kriegserklärung. Wenn schon eine militärische Konfrontation mit Paris unvermeidlich war, wollte er sie lieber sofort und mit Frankreich allein führen. Den sächsischen Staatsminister Richard Freiherr von Friesen stimmte er als engsten Verbündeten Anfang März 1870, anlässlich eines Besuches des Sachsen in Berlin, schon einmal auf einen baldigen Krieg gegen das Kaiserreich als »unabweisbare Notwendigkeit« ein.34
Bismarck begab sich freilich mit der Forcierung der spanischen Frage auf sehr dünnes Eis. Gelang es tatsächlich, den lebenslustigen Prinz Leopold zur Annahme der Thronkandidatur zu bewegen und sie bis zur Bestätigung durch die spanischen Cortes geheim zu halten, wäre Frankreich mit einem fait accompli konfrontiert, das ihm nach den herrschenden Ehrbegriffen nur den Ausweg der sofortigen Kriegserklärung an Preußen ließe.35 Paris stände damit allerdings gegenüber der deutschen und europäischen Öffentlichkeit als alleiniger Aggressor da, da die preußische Regierung offiziell gar nicht im Spiel war. Ganz anders lagen die Dinge bei dem zugleich zur Debatte stehenden sofortigen Beitritt Badens zum Norddeutschen Bund. In demonstrativer Schärfe hatte sich Bismarck noch am 24. Februar 1870 im Norddeutschen Bundestag gegen einen Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Eduard Lasker gewandt, der einem möglichst ungesäumten Beitritt des Großherzogtums den Weg ebnen sollte, und hatte dabei vor allem vor den vermeintlich ungünstigen Folgen für die Patrioten in Württemberg und Bayern gewarnt.36 Auch hätte dieser einseitige Schritt wohl Frankreich zu den Waffen gerufen. Daran hatte Émile Ollivier, der neue Mann in Paris, wenig Zweifel gelassen. Seit Januar 1870 war er der leitende Minister eines zunehmend bedrängten Kaisertums, das sich durch einige Konzessionen an das Corps législatif den Anstrich der Liberalität zu geben versuchte.37 Im Fall eines Beitritts Badens wäre Frankreich tatsächlich in der stärkeren Position einer europäischen Ordnungsmacht und einer Verteidigerin der Prager Friedensbedingungen von 1866 gewesen, die den Anschluss der Süddeutschen ausdrücklich ausgeschlossen hatten.38 Ein militärisches Zusammengehen Bayerns mit Frankreich und Österreich wäre dann keineswegs mehr auszuschließen. Kam es stattdessen aber allein über die Frage der spanischen Thronfolge zu einem Krieg mit Preußen, würde Paris in seinem anachronistischen Zorn über einen Hohenzollern auf dem Madrider Thron politisch völlig isoliert sein, zumal Napoleon selbst seit anderthalb Jahren sämtliche Versuche Prims, einen französischen Kandidaten zu finden, mit Erfolg hintertrieben hatte.
Kam die Bewerbung Leopolds aber vor der Abstimmung der Cortes heraus, würde, und daran konnte Bismarck nicht den geringsten Zweifel hegen, sein überängstlicher Monarch unter französischem Druck die schwäbische Verwandtschaft sofort zu einem Rückzieher drängen. Preußen liefe damit Gefahr, eine schwere diplomatische Niederlage, ja vielleicht sogar ein zweites Olmütz zu erleiden, und selbst der Einwand, dass es sich bei der Thronkandidatur lediglich um eine dynastische Frage gehandelt habe, würde im Triumphgeschrei der Pariser Zeitungen völlig untergehen. Sämtliche Klagen über den maßlosen Expansionsdrang des Hohenzollernstaates hätten mit einem Mal ihre Bestätigung gefunden und Bismarcks Rücktritt wäre dann ebenso unvermeidlich gewesen wie die schimpfliche Aufgabe der spanischen Kandidatur.
Von seinem halsbrecherischen »Alles oder Nichts« fand sich jedoch kein Wort in dem langen Memorandum, mit dem der Kanzler am 9. März 1870 seinem von Anfang an skeptischen Monarchen die Thronbesteigung Leopolds schmackhaft zu machen versuchte.39 Bismarck warnte darin vor einem Ersatzkandidaten aus Bayern, beschwor sogar die Gefahr einer spanischen Republik für die übrigen Throne Europas und behauptete schließlich, dass ein Hohenzoller in Madrid die Franzosen gewiss vorsichtiger stimmen würde, was den Frieden in Europa bewahren half. Dass auch ein Herrscher aus dem Hause Hohenzollern nur noch wenig Einfluss auf den Kurs der spanischen Politik haben würde, nachdem Marschall Prim mit seinen Reformen längst den Weg zu einer konstitutionellen Monarchie eingeschlagen hatte, erwähnte Bismarck nicht.
Es erstaunt, dass der Kanzler bei aller in den Vorgang investierten Mühe nur wenig Aufwand betrieb, die tödlichen Risiken eines vorzeitigen Bekanntwerdens der Kandidatur zu minimieren. Zum Kreis der Eingeweihten gehörten außer dem Monarchen immerhin auch Kronprinz Friedrich Wilhelm. Dessen politisch unbedarfte britische Ehefrau hatte tatsächlich nichts Eiligeres zu tun, als schon am 12. März, noch vor der Zusammenkunft im Familienkreis, ihre königliche Mutter in London in der Angelegenheit zu kontaktieren und deren Rat einzuholen. Dieses Mal hatte Bismarck freilich noch außergewöhnliches Glück, da Außenminister Lord Clarendon der Queen empfahl, sich zu der höchst delikaten Frage auf keinen Fall zu äußern.40
Die am 15. März im großen Kreis im Berliner Stadtschloss tagende Konferenz, zu der Bismarck außer Kanzleramtschef Rudolf Delbrück auch die Generale Helmuth von Moltke und Albrecht von Roon sowie seinen Außenstaatssekretär von Thile hinzugezogen hatte, endete zwar mit einer Mehrheit für die spanische Kandidatur, doch seinen Monarchen hatte der Kanzler auch jetzt nicht überzeugen können.41 Wilhelm blieb bei seiner klaren Ablehnung. Der 73-jährige König wird sich mit seinem nüchternen Sinn gefragt haben, weshalb sein leitender Minister einen derart großen Aufwand betrieb, um einen mittelmäßigen und sein privilegiertes Dasein ungeniert genießenden Hohenzollernprinzen auf einen längst bedeutungslosen Thron am Rande Europas zu bringen.42 Der Monarch dürfte gespürt haben, dass er wieder einmal die Rolle des Bauern in Bismarcks undurchschaubaren Schachzügen abgeben sollte. Gleichwohl war er schließlich bereit, als Chef des Hauses Hohenzollern keine Einwände zu erheben, falls Leopold aus freien Stücken das spanische Angebot annehmen wolle.
Damit schien nun allerdings das Projekt so gut wie gestorben, denn der Hohenzollernprinz war alles andere als eine entschlussfreudige Persönlichkeit und fand, im Gegensatz zu seinem ehrgeizigen Vater Karl Anton, nur wenig Reiz an der durchaus nicht gefahrlosen Aufgabe. Der Thron in Madrid galt als Schleudersitz, die spanischen Staatsfinanzen standen vor dem Zusammenbruch, Prims antiklerikale Gesetzgebung würde gewiss dem neuen König angelastet werden und der drohende Verlust Kubas wäre ein denkbar schlechter Auftakt seiner Regentschaft. Die Erschießung des glücklosen Kaisers Maximilian in Mexiko musste zudem für jeden europäischen Aristokraten, der sich auf einen fernen, exotischen Thron bewarb, ein Menetekel sein. Trotz allem war Leopold, der immerhin als preußischer Offizier im Krieg von 1866 gekämpft hatte, bereit, sich der ungeliebten Aufgabe zu stellen, wenn sie tatsächlich dem Haus Hohenzollern diente und der König ihm die Annahme der Kandidatur ausdrücklich befahl. Das aber war für Wilhelm die rote Linie.
Spätestens jetzt hätte Bismarck bei nüchternder Bewertung aller Risiken das Projekt abbrechen müssen. Das erhoffte fait accompli in Madrid war kaum noch zu erreichen, wenn Kandidat und König, die entscheidenden Figuren in seinem Spiel, gar nicht mitspielen wollten. Doch Bismarck wäre nicht Bismarck gewesen, wenn er jetzt schon klein beigegeben hätte. Mit »unendlicher Zähigkeit« hielt er an seinem abenteuerlichen Plan fest.43 Noch ehe der Absagebrief von Leopold und Karl Anton am 20. April nach Madrid abging, hatte der Kanzler bereits seinen Vertrauten Lothar Bucher nach Spanien geschickt. Der ehemalige Revolutionär von 1848, vor den Preußen nach England geflohen und von König Wilhelm anlässlich seines Regierungsantritts 13 Jahre später amnestiert, sollte in Madrid beruhigende politische Zusagen einholen und Premierminister Prim zur Aufrechterhaltung seines Angebotes bewegen.44 Leopolds schriftliche Ablehnung, der Anfang Mai noch eine zweite folgte, solle der Spanier einfach ignorieren, so Bucher, der längst für Bismarck in vieler Hinsicht zu einer unverzichtbaren Stütze geworden war. In Berlin werde man alles tun, um die Frage offenzuhalten, versicherte er dem bereits ungeduldig gewordenen Spanier.
Der Kanzler selbst hatte sich am 14. April, wieder einmal eine Krankheit vortäuschend, für einige Wochen auf sein erst kürzlich erworbenes Gut im hinterpommerschen Varzin, etwa eine Tagesreise von Berlin, begeben. Damit hoffte er seiner Nichtbeteiligung an der ganzen Affäre halbwegs Glaubwürdigkeit verschaffen zu können, falls dies einmal nötig sein würde. Als der unermüdliche Bucher Anfang Mai mit den erhofften Zusicherungen aus Madrid zurückkehrte und auch der zeitgleich auf Empfehlung Moltkes nach Spanien entsandte Major Maximilian von Versen mit ermutigenden Einschätzungen zur Loyalität der spanischen Armee aufwarten konnte, sah Bismarck den Zeitpunkt für einen neuerlichen Überzeugungsversuch gekommen. Dabei wusste der Kanzler Karl Anton inzwischen auf seiner Seite. Der Chef des Sigmaringer Hohenzollernzweigs bedauerte längst seine Absage an Madrid und sprach in einem Brief an seinen dritten Sohn Karl, dem späteren König von Rumänien, von einem großen historischen Moment, der für das Haus Hohenzollern wohl niemals mehr wiederkehren würde.45 Zeitweilig hatte Karl Anton einer Kandidatur seines jüngsten Sohnes Friedrich den Vorzug gegeben, setzte nun aber wieder auf Leopold, der sich von den beiden zu ihm entsandten Bucher und Versen allmählich auf Bismarcks Linie bringen ließ.46 Zuletzt gelang es dem Kanzler sogar, den über das neuerliche Anrühren der Affäre erbosten König Wilhelm zu beruhigen, indem er auf die jetzt tatsächlich vorhandene Bereitschaft Leopolds zur Kandidatur verwies. Anfang Juni schien die Sache endlich in trockenen Tüchern. Wie wenig Bismarck auf sein scheinbar stärkstes Argument gab, ein Hohenzoller auf dem Madrider Thron könne zur Beruhigung der französischen Politik beitragen, zeigte sein Kommentar zur Ernennung des als hitzköpfig bekannten Herzogs von Gramont zum Außenminister Frankreichs. »Krieg« schrieb er Mitte Mai 1870 auf die Ränder gleich dreier Berichte über die Politik des neuen Chefs am Pariser Quai d’Orsay.47 Unglücklich schien er über den Wechsel nicht gewesen zu sein. Eiskalt ließ er nun die politische Lunte abbrennen. Doch die Flamme zischte nur quälend langsam an das Pariser Pulverfass heran. Einmal mehr verstrich wertvolle Zeit. Der junge Leopold wollte zunächst, man glaubt es kaum, seine Kur in den Reichenhaller Bergen beenden. Als er schließlich Wilhelm schriftlich um seine Einwilligung ersuchte, erteilte sie ihm der König mit erkennbarem Unwillen und etlichen Ermahnungen am 21. Juni. Noch am selben Tag ging das Telegramm mit der ersehnten Nachricht von Berlin nach Madrid. Demnach sollte die entscheidende Abstimmung der Cortes schon am 26. Juni stattfinden. Was nun geschah, ist bis heute in seinen Ursachen obskur geblieben. Nach der Dechiffrierung in der preußischen Gesandtschaft in Madrid war jedoch aus dem 26. Juni der 9. Juli geworden. Auffällig ist dabei die Diskrepanz von genau 13 Tagen. Ob ein in den Vorgang eingebundener spanischer Beamter die geplante Sitzung eigenmächtig um 13 Tage vordatiert hat, vielleicht in der Überzeugung, in Preußen gelte noch wie im Zarenreich der alte julianische Kalender, lässt sich kaum noch klären, wäre aber eine plausible Erklärung. Jedenfalls hinterfragte niemand in der spanischen Regierung das ungewöhnlich späte Datum, das die ohnehin erregten und missmutig gewordenen Abgeordneten für weitere zwei Wochen in der glühenden Hitze der Hauptstadt festhalten würde. Sonderbarerweise schien selbst Premier Prim, bisher stets die treibende Kraft bei der Suche nach einem Thronnachfolger, plötzlich alle Zeit der Welt zu haben und vertagte die nächste Versammlung der Cortes gleich auf den 1. November. Als der Marschall, endlich über den tatsächlichen Sachverhalt orientiert, sich Anfang Juli entschloss, die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückzurufen, gab er zugleich auch den Anlass für seine außergewöhnliche Maßnahme bekannt. Damit war jedoch die spanische Bombe vorzeitig geplatzt und Bismarcks gewagtes Spiel schien auf der Zielgeraden gescheitert.
Über Paris lag in diesen Tagen immer noch der Rauch einer heftigen parlamentarischen Debatte über die Reduzierung des jährlichen Einberufungskontingentes. Zu keiner Zeit sei die Ruhe in Europa mehr gesichert gewesen als eben jetzt, hatte Ministerpräsident Ollivier am 30. Juni seinen umstrittenen Vorschlag einer Reduzierung des Kontingents um 10 000 Wehrpflichtige zu verteidigen versucht und resümiert: Wohin man auch blicken mag, nirgends sei eine Frage zu entdecken, die Gefahr in sich bergen könnte.48 Nun war die Frage doch gestellt. Nach Bekanntwerden der Hohenzollern-Kandidatur herrschte in der französischen Hauptstadt zunächst Schockstarre. Dann aber brach es wie ein Chor los. In seltener Einmütigkeit empörten sich die hauptstädtischen Zeitungen über die neuerliche preußische Intrige und sprachen sogleich von der verletzten Ehre Frankreichs. »Krieg oder Resignation« titelte Le Temps und Charles Delescluze vom Le Réveil bilanzierte süffisant: Die Preußen, die schon hinter dem Rhein und hinter den Alpen säßen, ständen nun auch hinter den Pyrenäen. Falls dies die Revanche für Sadowa (Königgrätz) sei, so wäre sie nun vollständig.49 Delescluze sollte am 25. Mai 1871 als einer der Führer der Pariser Kommune auf einer Barrikade am Place du Château d’Eau mit einer roten Schärpe um seine Taille den Tod finden.50
Für das neue Kabinett unter Émile Ollivier konnte es nicht besser laufen. Erst Anfang Mai hatte ein landesweites Plebiszit das sogenannte Liberale Kaisertum mit einer stattlichen Mehrheit von siebeneinhalb Mio. Stimmen bestätigt und damit Napoleons Regime noch einmal stabilisiert. Politisch gestärkt und vom öffentlichen Geschrei souffliert erhob die Regierung nun mit Nachdruck ihre Forderung nach Rücknahme der Thronkandidatur, und dies konnte nach ihrer Überzeugung tatsächlich allein durch die preußische Regierung selbst geschehen. Kaum jemand in Paris glaubte an den ausschließlich dynastischen Charakter der Angelegenheit und kaum jemand hätte es selbst dann geglaubt, wenn es der Wahrheit entsprochen hätte. Ollivier und Gramont wussten, dass eine derart brillante Gelegenheit, Berlin an den Pranger zu stellen, so rasch nicht wiederkehren würde, und griffen beherzt zu. Am 6. Juli beschloss das Pariser Kabinett, den Gegenschlag zu führen, und niemand schien geeigneter, noch am Nachmittag desselben Tages die anklagende Brandrede in der Gesetzgebenden Versammlung zu halten, als Antoine Alfred Agénor, Herzog von Gramont. Frankreichs neuer Außenminister hatte lange Jahre als Botschafter in Turin und Wien gedient und stand seither mit Minister Beust auf bestem Fuß. Anlässlich seiner Verabschiedung aus Wien hatte ihm der Sachse den bereits unterschriftsreifen Vertragstext zu einer gegen Preußen gerichteten Dreierallianz zwischen Frankreich, Österreich und Italien gezeigt, einschließlich dreier Schreiben, mit denen die beteiligten Monarchen unmissverständlich ihre Absicht zum Vertragsabschluss bekräftigt hatten.51 Nicht zuletzt deshalb auf die militärische Unterstützung wenigstens Österreichs vertrauend, ließ Gramont jede Mäßigung gegenüber Berlin fallen. Ohne einen konkreten Beweis zu haben, bezichtigte der Außenminister in seiner aufpeitschenden Rede die preußische Regierung die treibende Kraft hinter der Kandidatur des Hohenzollernprinzen zu sein. Damit aber habe sie das Gleichgewicht in Europa gefährdet und die Ehre Frankreichs verletzt. Er hoffe jedoch, so Gramont, auf die Klugheit des deutschen Volkes und die Freundschaft der Spanier, um die akute Gefahr abzuwenden. Der Franzose vermied zwar, vom Krieg zu sprechen, aber die Mehrheit der ihm begeistert applaudierenden Abgeordneten konnte keinen Zweifel haben, dass genau dies gemeint war, als Gramont zuletzt ihren Beistand und den der ganzen Nation einforderte, »um ohne zu Zögern und ohne Schwäche unsere Pflicht zu tun.«52