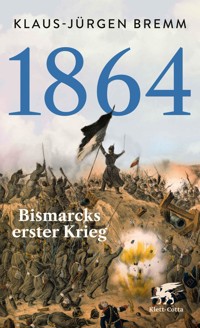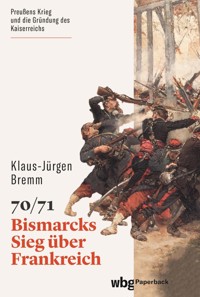22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Zweite Weltkrieg im Westen und die Befreiung Europas durch die Alliierten Im Morgengrauen des 6. Juni 1944 landeten die Alliierten am Omaha-Beach in der Normandie: Die Operation Overlord begann. Acht Monate später kapitulierte Deutschland. Brachte die Invasion die entscheidende Wende im Krieg? Was folgte auf den D-Day, eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs? Wie vollzog sich der Siegeszug der Alliierten bis zum Rhein, während die Sowjetunion die Heeresgruppe ›Mitte‹ zerschlug? Der Militärhistoriker und Bestseller-Autor Klaus-Jürgen Bremm schildert in seinem großen Panorama den Weltkrieg im Westen. In seiner dichten historischen Darstellung analysiert er die ersten geheimen Pläne der Landungsoperation, die Ereignisse am längsten Tag und den anschließenden Vormarsch der Alliierten auf Paris. - Ein umfassendes Panorama der Endphase des Zweiten Weltkriegs im Westen - Kenntnisreiche Analyse von einem der besten Militärhistoriker - Vom Vormarsch der Deutschen und dem Bau des Atlantikwalls an der Westfront bis zur Befreiung Frankreichs durch die Alliierten - Packend erzähltes Sachbuch für alle, die sich für den 2. Weltkrieg interessieren Der lange Kampf um die Freiheit: die Zurückeroberung des Westens durch die Alliierten Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass die Invasion an den Stränden der Normandie scheitern könnte? Welche Überlegungen gab es bei den Alliierten, etwa von General Montgomery? Womit rechnete die deutsche Wehrmacht? Das sind nur einige der Aspekte in der Kriegsgeschichte über den Zweiten Weltkrieg im Westen von Klaus-Jürgen Bremm. Sein Sachbuch ermöglicht wertvolle Einblicke in das Geschehen am bedeutendsten Kriegsschauplatz im 2. Weltkrieg im Westen Europas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
6. Juni 1944: Alliierte Soldaten landen am UTAH-Beach in der Normandie. Links ist ein Landungsboot Landing Craft, Tank (LCT) 779 zu sehen, im Vordergrund ein Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP). Am Himmel schützen Sperrballons vor feindlichen Luftangriffen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überwww.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.
wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.
© 2022 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Lektorat: Christina Kruschwitz, Berlin
Satz: Arnold & Domnick, Leipzig
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4488-5
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4518-9
eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4519-6
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhalt
Einleitung – Verlust der militärischen Führungskunst
Teil IDie Gegner formieren sich
1. In der Hauptstadt der Besiegten – Die Deutschen in Paris
2. Der lange Weg zurück – Großbritanniens Kriegsstrategie nach der Evakuierung von Dünkirchen
3. Das Ende einer Weltmacht – Die vier Tage von Teheran 1943
4. Der erhoffte Sieg an den Stränden – Die Abwehr der anglo-amerikanischen Invasion
5. Von der »Minimalarmee« zum mechanisierten Millionenheer – Amerikas Armee bis zur Landung in Nordafrika
6. Das kühnste Unternehmen aller Zeiten – Von COSSAC bis SHAEF
Teil IIKampf um die Strände
7. Die Nacht vor der Invasion – Die Alliierten verspielen den Überraschungseffekt
8. »Bringen Sie die Männer von diesem verdammten Strand herunter.« – Das Beinahe-Debakel der Amerikaner auf OMAHA
9. Zu wenig, zu spät, zu unentschlossen – Das Scheitern der 21. Panzer-Division am 6. Juni
10. Das Phantom der gepanzerten Gegenoffensive – Die deutsche Führung scheitert an sich selbst
11. Auf dem Schleichweg nach Caen – Die »Wüstenratten« in der Schlacht um Villers-Bocage
12. Angriffsziel Cherbourg – General Joe Collins’ Blitzkrieg auf Cotentin
13.EPSOM – Montgomerys Suche nach dem Sieg
14. Rückkehr nach vier Jahren – De Gaulles Coup d’État in Bayeux
15. Einen Monat nach der Landung – Die Konsolidierung des anglo-amerikanischen Brückenkopfes
16. In der Falle – Soldaten in der Normandieschlacht
Teil IIIDer Ausbruch
17.CHARNWOOD und GOODWOOD – Montgomerys colossal cracks
18. Der 20. Juli 1944 im Westen – Eine schwäbische Verschwörung?
19.COBRA – Der große Ausbruch der Amerikaner
20. Zwischen Mortain und Falaise – Die finale Katastrophe des Westheeres
21. »Wie die Hunde aus der Stadt getrieben« – Paris im Sommer 1944
22. Operation DRAGOON – Die umstrittene Nebenlandung in der Provence
23. »Obéir c’est trahir – Désobéir c’est servir.« – Frankreich unter den Deutschen 1940–1944
24. Von der Seine bis zum Westwall – Der große Rückzug im Westen
Fazit – Die entscheidende Schlacht des Krieges und das verloren gegangene Geheimnis des Sieges
Zeittafel
Anmerkungen
Bibliographie
Bildnachweis
Register
Einleitung
Vom Verlust der militärischen Führungskunst
»Von der Strategie bis hinab zur Taktik und auf sämtlichen Stufen dazwischen war Frankreich der Kriegsschauplatz, wo der ›Genius of War‹ der Wehrmacht wie Asche zerfiel, wo ›Hitlers Legionen‹ zerbröselten und wo die ›Magier des Teufels‹ wie Amateure agierten. An Frankreichs Küsten erlitt die militärische Tradition, die Friedrich den Großen, Carl von Clausewitz und Helmuth von Moltke hervorgebracht hatte, die wohl schmerzlichste und demütigendste Niederlage in ihrer langen Geschichte.«
Robert Michael Citino, The Wehrmacht’s Last Stand, S. 110.
Es war gewiss eine der schlimmsten Niederlagen unserer Geschichte, notierte am 23. Februar 1943 Commander Harry Butcher, der Verbindungsoffizier der US-Navy zum Stab von General Dwight David Eisenhower, ratlos und erschüttert in sein Tagebuch. Zwei Panzerdivisionen aus Rommels Afrikakorps hatten erst wenige Tage zuvor das »stolze und angeberische Amerika«, wie Butcher es sarkastisch ausdrückte, im algerisch-tunesischen Grenzgebiet militärisch gedemütigt.1 Nicht allein waren mehr als 6 000 Mann und fast 300 Panzer des amerikanischen II. Corps bei Sidi Bouzid und am Kasserine-Pass verloren gegangen, teilweise hatten die Männer sogar in Panik ihre Stellungen verlassen und waren kilometerweit ins Hinterland geflohen.2
Lieutenant General Sir Harold Alexander, der britische Oberbefehlshaber in Nordafrika, sah sich in seinem alten Argwohn gegenüber den militärischen Qualitäten des Verbündeten glänzend bestätigt. Die Amerikaner seien zu weich, zu unerfahren und schlecht ausgebildet, klagte er am 3. April 1943 in einem Brief an den Chef des Imperial War Staff, Sir Alan Brooke. Es fehle ihnen nicht nur der Wille zum Kampf, sondern leider auch jeder Hass gegenüber Deutschen und Italienern.3
Tatsächlich hatten eine lange Reihe taktischer Fehler wie auch ein überforderter Korpsbefehlshaber das amerikanische Anfangsdesaster in der Wüste verursacht. Die Niederlage gab auch allen Kritikern aufseiten der Briten Auftrieb, die schon immer Zweifel an General Eisenhowers Führungsqualitäten geäußert hatten und sich kaum vorstellen konnten, dass amerikanische Truppen jemals erfolgreich in Frankreich landen würden. Dagegen zeigte sich der noch einmal siegreiche »Wüstenfuchs« in seinem Urteil über die Amerikaner durchaus nachdenklich. Wenn sie erst einmal genügend Kampferfahrung gesammelt hätten, würden sie bestimmt brauchbare Soldaten abgeben, schrieb Generalfeldmarschall Erwin Rommel am 18. Februar 1943 an seine Frau.4
Dass allerdings die beiden Eröffnungsschlachten im westlichen Tunesien nicht nur die letzten Siege seines alten Afrikakorps sein würden, sondern zugleich auch die einzigen Erfolge der Deutschen Wehrmacht über diesen neuen Gegner überhaupt, ahnte der gefeierte Held der Goebbels’schen Propaganda zu diesem Zeitpunkt wohl nicht. Mehr als 100 Schlachten oder größere Gefechte zwischen Deutschen und Amerikanern zählte der britische Historiker Geoffrey Perret nach Sidi Bouzid und Kasserine bis zum Ende des Krieges in Europa auf, die ausnahmslos mit einer Niederlage der Wehrmacht oder allenfalls mit einem temporären Patt geendet hatten. Dabei konnten sich die Deutschen bei vielen ihrer Misserfolge nicht einmal auf eine personelle oder materielle Unterlegenheit berufen.5 Oft waren die deutschen Waffensysteme wie etwa das MG42, die Panzer vom Typ »Panther« oder »Tiger« sowie die legendäre 8,8-Flakkanone der alliierten Bewaffnung qualitativ derart überlegen, dass auf der Gegenseite gelegentlich sogar Panik ausbrach.6
Auch unter Berücksichtigung der für die Amerikaner äußerst verlustreichen Kämpfe im Hürtgenwald, die schließlich in ihrem Rückzug aus Schmidt und Kommerscheidt gipfelten, wirkt die militärische Bilanz der Wehrmacht gegen die US-Armee geradezu deprimierend. Weder in Italien noch in Frankreich gelangten deutsche Truppen gegenüber ihren amerikanischen Widersachern jemals über temporäre Abwehrerfolge hinaus. Ein nach allen Regeln der operativen Führungskunst unternommener Angriff auf den amerikanischen Brückenkopf bei Anzio-Nettuno schlug im Februar 1944 nicht mehr durch.7 Selbst Phasen beispielloser Schwäche auf Seiten der Amerikaner wie am Strand von OMAHA, in den überfluteten Landezonen der US-Fallschirmjäger auf Cotentin oder später in den verschneiten Wäldern der Ardennen und Vogesen konnten die Deutschen trotz örtlicher numerischer Überlegenheit nicht mehr zu ihren Gunsten nutzen.
Die bis dahin in der ganzen Welt hoch geachtete oder je nach Sicht auch gefürchtete preußisch-deutsche Armee mit ihrem durch Tradition und Kastengeist gefestigten Korps hervorragend geschulter Berufsoffiziere sollte in den letzten drei Kriegsjahren beinahe regelmäßig gegen eine Armee aus Bürgersoldaten und eilig angelernten Offizieren versagen, die erst zwei Jahre zuvor aus dem Nichts geschaffen worden war.
Trotz ihrer mehr als ernüchternden Bilanz gegen amerikanische Truppen ist es deutschen Generalen nach dem Krieg noch lange gelungen, den Mythos ihrer überlegenen operativen Führungskunst und der überragenden kämpferischen Qualitäten des deutschen Soldaten aufrechtzuerhalten. Auch neuere Militärhistoriker wie etwa der Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Martin van Creveld, haben dazu beigetragen, dass das schmeichelhafte Selbstbild der Angehörigen der Deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS trotz ihrer fortgesetzten Niederlagen bis 1945 noch lange im Kern kaum infrage gestellt worden war.8 Nicht nur in Deutschland konnte sich bis in die jüngste Vergangenheit der Mythos einer Armee von Helden und Magiern der Kriegsführung halten, die erst vor dem immensen Materialaufgebot ihrer Gegner die Waffen strecken musste.
In einer ursprünglich für das Pentagon angefertigten Studie war der israelische Kenner der deutschen Militärgeschichte Anfang der 1980er-Jahre der Frage nachgegangen, welche Faktoren zur Verbesserung der Kampfkraft von Armeen beitrugen. Ausgerechnet bei der gründlich geschlagenen Deutschen Wehrmacht glaubte van Creveld besonders fündig geworden zu sein. In beinahe allen Bereichen von der Führerauswahl bis zur Organisation des Personalersatzes, so sein paradoxer Befund, sei die immer wieder geschlagene deutsche Wehrmacht dem amerikanischen System weit überlegen gewesen. Weniger als mittelmäßig stufte er dagegen das amerikanische Offizierkorps im Zweiten Weltkrieg ein. Ein Vergleich mit ihren deutschen Kontrahenten sei sogar schlechterdings kaum möglich.9
Lediglich in ihrer konsequenten Konzentration auf das Operative und damit auf das Gefecht der verbundenen Waffen, glaubte van Creveld eine notorische Blindstelle deutscher Streitkräfte zwischen 1939 und 1945 ausmachen zu können. Militärische Doktrin, Ausbildung und Organisation des Heeres seien nach seinem Urteil mit seltener Konsequenz auf das Kämpfen ausgerichtet gewesen. Logistik, Verwaltung und Management hätten dagegen nur eine nachrangige Rolle gespielt. Die Amerikaner seien genau umgekehrt vorgegangen und schienen sogar alles getan zu haben, um ausgerechnet die Infanterie, immer noch das Rückgrat auch moderner Armeen, zugunsten anderer Truppengattungen zu vernachlässigen. Bei der Zuweisung des besseren Personals sei sie gewöhnlich leer ausgegangen, da die Militärbehörden diesen »Job« jedem Kandidaten zugetraut hätten. An wirklicher Kampfkraft sei den Amerikanern auch gar nicht gelegen gewesen, da nach ihrer Philosophie sämtliche Gefechte hauptsächlich durch die Massierung gewaltiger Feuerkraft entschieden werden sollten. Der Jerusalemer Professor nannte Eisenhowers und Omar Bradleys Methoden sogar verächtlich einen Maschinenkrieg.10
Selbst amerikanische Historiker und ehemalige Militärs sparten im Rückblick nicht mit Kritik am Kampfverhalten der amerikanischen Divisionen in Europa. Der renommierte Militärhistoriker Russel Weigley von der Temple University in Philadelphia beurteilte den Kampfgeist der amerikanischen Infanterie sogar als äußerst gering. Sie habe es praktisch nie gewagt, sich auf ein unmittelbares Gefecht mit Wehrmachtsverbänden einzulassen.11
In das gängige Bild des angeblich kampfscheuen US-Soldaten schien sich auch das erstaunliche Fazit einzufügen, das Lieutenant Colonel Samuel Lymann Marshall nach einer Auswertung von rund 400 Interviews mit amerikanischen Soldaten des Zweiten Weltkrieges zog. Nicht einmal jeder Vierte aus der befragten Gruppe habe im Kampf seine Waffe überhaupt eingesetzt, so resümierte Marshall. Die Herstellung einer infanteristischen Feuerüberlegenheit auf dem Gefechtsfeld sei unter diesen Umständen kaum möglich gewesen.12 Amerikanische Generale hätten es gewöhnlich ganz ihrer Artillerie überlassen müssen, den Gegner zu zerschlagen. Insgesamt seien, so Weigley, die Amerikaner allein dank ihrer materiellen Überlegenheit zum Sieg über die Deutschen »gestolpert«.13 Ähnlich abwertend lautete das Urteil des amerikanischen Colonels und unverbrüchlichen Bewunderers des preußisch-deutschen Generalstabs, Trevor Nevitt Dupuy. Der Veteran des Burmakrieges (1942 – 45) glaubte sogar mittels eines numerischen Modells eine konstante militärische Überlegenheit der Wehrmachtsdivisionen über ihre anglo-amerikanischen Gegner nachweisen zu können. Nach der Analyse einer Reihe von Gefechten zwischen Deutschen und Amerikanern gelangte Dupuy, der selbst allerdings niemals gegen Truppen der Wehrmacht zum Einsatz gekommen war, schließlich zu dem Ergebnis, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg um durchschnittlich 20 Prozent effektiver als ihre amerikanischen Widersacher agiert hätten.14 Im Kampf Mann gegen Mann habe demnach der deutsche Infanterist seinem Gegner sogar um die Hälfte höhere Verluste zugefügt und dies, wie er betonte, unter allen Umständen und in allen Gefechtsarten.15
Doch weder van Creveld noch andere Kritiker der US-Army vermochten eine plausible Erklärung abzugeben, weshalb die in Disziplin und Einsatzwillen ihrem Gegner angeblich so überlegene deutsche Armee seit den Kämpfen in der tunesischen Wüste keinen einzigen militärischen Erfolg mehr gegen die so sehr gescholtenen amerikanischen Truppen erringen konnte. Fast schon ratlos verwies der israelische Historiker wie vor ihm schon die Generale der Wehrmacht auf die strukturelle Unterlegenheit des politischen und industriellen Systems des Dritten Reiches, die letztlich den Krieg entschieden hätten.
Hätte jedoch nicht die »furchteinflößende Kampfkraft« des deutschen Heeres, seine überlegene Bewaffnung und die überragende Qualität seiner Offiziere wenigstens einige örtliche Siege über seine amerikanischen Widersacher ermöglichen müssen? Noch Anfang 1944 hatte sich Hitler davon überzeugt gezeigt, dass es im Falle einer alliierten Landung in Frankreich gerade der Führungskunst deutscher Offiziere und dem unerschütterten Kampfwillen ihrer Soldaten gelingen würde, besonders die unerfahrenen Amerikaner rasch wieder ins Meer zu werfen. »Es mag die plutokratische Welt im Westen ihren Landungsversuch unternehmen, wo sie will, er wird scheitern.« Der Diktator sehnte sogar diesen Tag herbei, da durch das in seinen Augen unvermeidliche Desaster der Anglo-Amerikaner an den Stränden Frankreichs zugleich auch die erhoffte Kriegswende eintreten musste. Noch am Morgen der Invasion zeigte er sich völlig zuversichtlich. »Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können.«16
Tatsächlich aber sollten sich am 6. Juni vor allem die geschmähten Amerikaner als überraschend zähe Gegner erweisen. Während sie noch am Strand von UTAH einen unerwartet leichten Erfolg erzielen konnten, der sie sogar weniger Opfer kostete, als im November 1942 ihre erste Landung in Nordafrika (Operation TORCH) gegen den Widerstand der Vichy-Franzosen, glückte ihnen am benachbarten Strand von OMAHA das beinahe Unmögliche. Innerhalb von nur zehn Stunden machten Soldaten aus New York, Virginia und Texas aus einer Anfangskatastrophe einen nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg, wobei sich vor allem die größtenteils im Kampf unerfahrenen amerikanischen Offiziere ihren deutschen Antipoden als mindestens ebenbürtig erwiesen.
Zwar konnten die Angreifer auf das wirksame Feuer der alliierten Schiffsartillerie und nach Aufklaren des Himmels gegen 11 Uhr auch auf die Unterstützung ihrer Luftwaffe zählen, doch numerisch waren sie den in günstigen Stellungen kämpfenden Deutschen in den ersten Stunden der Landung hoffnungslos unterlegen. Die erste Welle amerikanischer Truppen hätte eigentlich restlos am Strand vernichtet werden müssen. Doch im Abschnitt von Omaha wie auch bei zahllosen noch folgenden Duellen mit den Deutschen in Frankreich, Belgien oder dem Rheinland hatten die Amerikaner stets das längere Ende für sich, und nicht allein materielle Überlegenheit oder pures Glück können das erklären. Außer Frage steht, dass ein hoher Anteil der deutschen Soldaten in beinahe jeder Konfrontation zunächst mit Mut und Elan kämpfte. Beispiele dafür lassen sich nach Belieben aufzählen und selbst nach dem amerikanischen Durchbruch bei Avranches vermochten sie sich noch einmal zu sammeln. Doch im Verlauf der meisten Gefechte gaben sie schließlich auf, zogen sich zurück, wo das noch möglich war, oder ergaben sich einfach.
Mehrere Gründe scheinen sich zur Erklärung dieser ernüchternden Bilanz anzubieten. Das für die deutsche Führung schockierende Versagen der Infanterie auf dem italienischen Kriegsschauplatz erklärte etwa Dietrich von Choltitz, der Kommandierende General des XXV. Armee-Korps vor dem amerikanischen Brückenkopf bei Anzio-Nettuno, mit dem immer häufiger auftretenden Mangel an jenen erfahrenen und nervenstarken Mannschaftsdienstgraden, die auch einer Gruppe von Neulingen besonders in Krisenlagen Rückhalt geben konnten.17 Für die in den letzten beiden Kriegsjahren vermehrt zu beobachtenden Defizite in der Organisation des Gefechts auf deutscher Seite macht der texanische Militärhistoriker Robert Citino vor allem das allmähliche Übergreifen des für die Hitlerdiktatur typischen polykratischen Chaos auch auf die bewährten Strukturen der Wehrmacht verantwortlich. Die deutsche Befehlskette im Westen sei so miserabel gewesen, dass nicht einmal böse Absicht sie noch hätte verschlimmern können.18 Klar geordnete Befehlshierarchien, die hätten sicherstellen müssen, dass vorhandene Reserven rechtzeitig an den Feind gelangten, existierten gerade bei der Wehrmacht im Westen nicht. Der monatelange Disput unter deutschen Generalen, ob die Panzerreserven entgegen der vorherrschenden Doktrin unmittelbar am Strand eingesetzt oder besser aus der Hinterhand schlagen sollten, lieferte ein typisches Beispiel für die notorische deutsche Führungsschwäche. Doch selbst der Kompromiss, auf den sich Rommel und Rundstedt unter Hitlers Moderation schließlich einigten, sollte am Landungstag nicht konsequent umgesetzt werden. Hinzu kamen erstaunliche handwerkliche Mängel in der Stabsarbeit, die sich nach dem Urteil von Sönke Neitzel bereits im Kampf um den Brückenkopf von Anzio-Nettuno gezeigt hatten und sich wenige Monate später in der Normandie wiederholen sollten. Auf einer höheren Ebene habe sich die Wehrmacht, so der Potsdamer Historiker, in der letzten Kriegsphase nur noch als begrenzt lernfähig erwiesen.19 Tatsächlich beruhte etwa der verzettelte Einsatz der zwei vom OKW freigegebenen Panzerdivisionen am 7. und 8. Juni auf einem ungewöhnlichen Mangel an Koordination und Führungskraft auf deutscher Seite. Verächtlich sprach der Befehlshaber der Panzergruppe »West«, General Leo Freiherr Geyr von Schweppenburg, nach dem Krieg von einem »Negerpalaver« sich widersprechender Befehle.20
Die Blaupause zu allem Führungsversagen hatte bereits der verunglückte Angriff der 21. Panzer-Division am Nachmittag des ersten Landungstages geliefert, in den gleich drei hohe deutsche Stäbe von der Heeresgruppe »B« abwärts involviert waren. Obwohl die angespannte Lage den rücksichtslosen Einsatz aller verfügbaren Kräfte für diesen fraglos kriegsentscheidenden Angriff gebot, zeigte sich keiner der beteiligten übergeordneten Stäbe imstande, den Divisionskommandeur, Generalmajor Edgar Feuchtinger, daran zu hindern, einen namhaften Teil seiner Division rechts der Orne gegen britische Fallschirmjäger einzusetzen. Das Nichtzustandekommen einer scharf zusammengefassten Gegenoffensive der drei am 8. Juni verfügbaren deutschen Panzerdivisionen dürfte wiederum die Schlacht um die kanadisch-britischen Landeköpfe endgültig entschieden haben. Befehle und Gegenbefehle von verschiedenen Stäben verunsicherten wiederum nur zwei Wochen später die ohnehin schon angeschlagenen deutschen Divisionen auf der Halbinsel Cotentin und erleichterten den Amerikanern die rasche Einnahme von Cherbourg. Gerade in der Schlacht um die Normandie zeigte sich auf deutscher Seite in sämtlichen Phasen bereits eine erstaunliche Erosion an Führungskunst, Durchsetzungskraft und Organisationvermögen. Ausgerechnet jene geistigen und handwerklichen Kompetenzen, bei denen sich deutsche Generale und Stabsoffiziere trotz aller erdrückenden materiellen Ungleichgewichte immer noch ihren alliierten Gegner überlegen fühlten, waren bei der Wehrmacht im Westen kaum noch vorhanden. Die große Mehrheit der amerikanischen Divisionen, die seit dem 6. Juni 1944 in Frankreich gelandet waren, besaß keine Kampferfahrung, die meisten ihrer Kompaniechefs und Zugführer hatten bis dahin nie gelernt, eine kritische Lage unter mörderischem Beschuss zu meistern und doch zeigten sie sich den Offizieren auf der Gegenseite mindestens ebenbürtig, oft sogar überlegen, und wären mit ihren Männern sogar bis nach Berlin marschiert, wenn nicht politische Erwägungen dies verhindert hätten.
Teil I
Die Gegner formieren sich
1In der Hauptstadt der Besiegten – Die Deutschen in Paris
»War Paris nicht schön? Aber Berlin muss viel schöner werden! Ich habe mir früher oft überlegt, ob man Paris nicht zerstören müsse, aber wenn wir in Berlin fertig sind, wird Paris nur noch ein Schatten sein. Warum sollen wir es zerstören?«
Adolf Hitler am 28. Juni 1940 zu Albert Speer1
Am 14. Juni 1940 rückte die deutsche 87. Infanterie-Division unter Generalleutnant Bogislav von Studnitz kampflos in Paris ein. Nachdem sie der erste Schrecken zunächst in ihre Häuser getrieben hatte, betrachteten die Bewohner der östlichen Vorstädte von Noissy-le-Sec und Montreuil mit unverhohlener Neugier die in hohem Tempo vorbeirollende Panzerjägerabteilung der Division.2 Eine endlose Prozession motorisierter Einheiten auf dem Boulevard de Sébastopol beobachtete am selben Mittag Sylvia Beach, die Inhaberin der bekannten Buchhandlung Shakespeare and Company und erste Verlegerin des Ulysses von James Joyce. Behelmte Männer saßen mit gekreuzten Armen auf den Fahrzeugbänken, gezeichnet von demselben kalten Grau wie ihre über das Pflaster dröhnenden Maschinen.3 Viele in der Stadt gebliebene Pariser dürften sich an diesem sonnigen Freitag noch einmal an die große Parade des 14. Juli 1939 erinnert haben, als anlässlich des 150. Jahrestages des Sturmes auf die Bastille 30 000 französische Soldaten mit 600 Fahrzeugen aller Art über die Champs Élysées paradiert waren.4 Genau auf den Tag elf Monate danach marschierten nun die Deutschen, noch selbst erstaunt über ihren beispiellosen Siegeszug zwischen Maas und Somme, kampflos in Frankreichs Kapitale ein. Im Krieg von 1870/71 hatten deutsche Truppen Paris monatelang belagern müssen, ehe sie wenigstens für zwei Tage in seine westlichen Arrondissements einrücken durften. Im September 1914 dagegen war Paris nur ein zum Greifen naher Traum geblieben. Mit besonderer Genugtuung sahen daher ältere Kriegsteilnehmer wie der aus Strasbourg stammende Volksschullehrer Hermann P. die alte »Schmach von 1918« jetzt endlich getilgt.5 Weniger als fünf Wochen hatten dem deutschen Heer gereicht, um Frankreichs stolze Militärmacht niederzuwerfen und die Briten vom Kontinent zu jagen.
Kein zweites Wunder an der Marne sollte dieses Mal Paris retten. Zwar hatte die französische Heeresleitung durchaus über eine Verteidigung der Hauptstadt nachgedacht und sogar mit etlichen Vorbereitungen begonnen. Doch angesichts der sich überstürzenden Ereignisse war alles nur Stückwerk geblieben. Der Durchbruch von General Hermann Hoths XV. Panzer-Korps am 7. Juni bei Forges-les-Eaux, das nur zwei Autostunden von der Hauptstadt entfernt lag, hatte bereits den Beginn der Auflösung des französischen Heeres markiert. Die meisten Diplomaten der mit Deutschland verfeindeten Mächte waren daraufhin aus Paris geflohen. Nur drei Tage später hatte auch das Kabinett von Premierminister Paul Reynauld die Hauptstadt verlassen. Wie schon ihre Vorgängerregierung ein Vierteljahrhundert zuvor, waren die Minister, unter ihnen auch der erst am 3. Juni von Reynauld zum Unterstaatssekretär für Verteidigung ernannte Général de Brigade Charles de Gaulle, am 10. Juni zunächst nach Tours aufgebrochen. In den dortigen Loireschlössern, später dann in Bordeaux, sollte die Regierung ihre letzten Tage, die zugleich auch nach 70 Jahren die letzten Tage der Dritten Republik waren, in wachsender Agonie fristen. Zusammen mit den Politikern war auch ein großer Teil der fast drei Millionen Pariser in Panik nach Süden aufgebrochen, wo sich ihre pittoresken Kolonnen aus hoffnungslos überladenen Autos, Fuhrwerken und Fahrrädern mit den endlos erscheinenden Flüchtlingszügen aus Nordfrankreich vermischten. Die Angst vor den »barbarischen« Deutschen saß tief und war durch die zwei Bombardements der Stadt, bei denen Görings Luftwaffe am 3. und 11. Juni die Citroënwerke und etliche Regierungsgebäude angegriffen hatte, noch verstärkt worden. Am 12. Juni 1940 hatten die örtlichen Behörden schließlich Paris zur offenen Stadt erklärt und widerstrebend Verhandlungen mit der deutschen 18. Armee des Generalobersten Georg von Küchler begonnen. Mehr Angst als die Franzosen mussten allerdings die deutschen und österreichischen Exilanten haben, von denen schätzungsweise 35 500, meist Kommunisten, Freigeister oder Juden, seit 1933 in Paris eine prekäre Zuflucht vor der Nazidiktatur gefunden hatten. Im Rückblick schrieb Stefan Zweig, der noch Ende April 1940 im Pariser Théâtre Marigny einen Vortrag über »Das Wien von Gestern« gehalten hatte: »Kaum je ein eigenes Unglück hat mich so betroffen, so erschüttert, so verzweifelt gemacht wie die Erniedrigung dieser Stadt, die wie keine begnadet gewesen, jeden, der ihr nahte, glücklich zu machen.«6 Auch der österreichische Exilant Ernst Weiß machte sich keine Illusionen, welche Konsequenzen der militärische Triumph Nazideutschlands für ihn wie für viele andere Schicksalsgenossen haben musste. Noch während die deutschen Kolonnen unter den Fenstern seines Hotels entlangdröhnten, schnitt sich der jüdische Schriftsteller und Arzt die Pulsadern auf.7
Von den Deutschen abgesehen herrschte in diesen ersten Tagen in ganz Paris eine merkwürdige Stille. Nur wenige Fußgänger verloren sich auf seinen riesigen Boulevards und der amerikanische Journalist William Lawrence Shirer will beim Anblick der ihm vertrauten Stadt sogar heftige Magenschmerzen bekommen haben. »Die Straßen sind total verwaist, die Geschäfte geschlossen und alle Jalousien heruntergelassen, notierte er drei Tage nach dem Einmarsch der Deutschen in sein Tagebuch.8 Diese Leere gehe einem ans Herz.
Anscheinend seien nur die ärmeren Pariser in der Stadt geblieben, vermerkte Generaloberst Fedor von Bock, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe »B«, in seinem Tagebuch. Neugierig und keineswegs feindselig standen diese Leute an den Einmarschstraßen herum und weigerten sich auch nicht, auf die Fragen der Deutschen bereitwillig Antwort zu geben. Auch die Pariser Gendarmerie sei in der Stadt geblieben und zeige sich höflich in Gruß und Haltung, wunderte sich der hohe Wehrmachtsoffizier. Dass Pariser Polizisten sogar den Verkehr regelten, der wegen des Benzinmangels fast ausschließlich aus deutschen Militärfahrzeugen bestand, trug sogar bizarre Züge. Doch die stolzen Sieger hatten keine Probleme damit, den Besiegten zu gehorchen, wenn auch nur jeweils für wenige Momente. Schließlich waren die Deutschen in vielen Belangen auf die Mitarbeit der Franzosen angewiesen und taten alles, um deren korrekt-indifferente Haltung gegenüber den Besatzern zu bestärken. Provokationen jeder Art hatten daher zu unterbleiben und eine sichtbare Distanz zwischen Deutschen und Parisern schien das Gebot der Stunde. Die strikte Pflicht zum Tragen der Uniform, die der im noblen Hôtel Meurice an der Rue de Rivoli einquartierte deutsche Stadtkommandant von Groß-Paris, Generalleutnant Ernst Schaumburg, erlassen hatte, galt selbst für die dienstfreie Zeit und sollte den Militärbehörden die Kontrolle erleichtern. Wer als Soldat auf der Straße ohne Papiere, betrunken oder in vorschriftswidriger Uniform angetroffen wurde, musste mit verschärften Arreststrafen rechnen.9 Ohnehin war der Zugang zu den zentralen Arrondissements von Paris für die meisten Unteroffiziere und Mannschaften streng reglementiert und sämtliche Zufahrtstraßen waren sogar abgesperrt. Mit Ausnahme der hohen Stäbe war die Masse der Besatzungstruppe in den Randbezirken von Paris untergebracht und alle dienstlichen Aufträge, die einen ins Zentrum der Stadt führten, waren wegen der damit verbundenen Passierscheine heißbegehrt.10 Militärische Stadtbesichtigungen in Gruppen boten dagegen nur einen begrenzten Ausgleich, zumal dabei den Teilnehmern das Aufsuchen von Lokalen oder Geschäften gewöhnlich untersagt war.11
Manche Ankömmlinge, die noch aus früheren Besuchen die Hauptstadt kannten und sie jetzt wiedersahen, zeigten sich von den neuen Verhältnissen enttäuscht. »Von dem fröhlichen und leichtfertigen Leben, das früher Paris kennzeichnete, sei nichts mehr zu bemerken«, schrieb bedauernd ein Artilleriesoldat Anfang Juli 1940 nach Hause. Die vor den Läden Schlange stehenden Leute weckten bei ihm sogar traurige Kindheitserinnerungen an die Weimarer Inflationszeit.12 Die Seinemetropole, die immer mehr sein wollte als nur die Hauptstadt Frankreichs und es wohl auch war, erschien vielen Deutschen nur noch wie eine Kulisse. Zu einem Schatten seiner selbst sei das Paris dieser Junitage geworden, ohne jeden Charme und vollgestopft von grauen Flüchtlingsmassen, schrieb ein Soldat der 87. Infanterie-Division. Ein »Landserherz« könne sie nicht mehr erfreuen.13 Grundsätzlich dominierte unter den Besatzungssoldaten aller Dienstgrade eine positive Sicht auf die Stadt. Paris müsse man einfach gesehen haben, lautete das überwiegende Stimmungsbild unter den Deutschen im Zeitalter des beginnenden Massentourismus. Es gab allerdings auch Ausnahmen wie den völkischen Schriftsteller Ernst von Salomon, der bekannte, dass er sich als »stolzer Boche« selbst da wehrte, wo ihm das »Französische« gefällig gegenübertrat.14
Adolf Hitler besichtigt das besetzte Paris (28. Juni 1940), hier mit Albert Speer (li.) und dem Bildhauer Arno Breker am Trocadéro.
Einer der wenigen Besucher der Stadt in diesen Tagen, der an ihrer anfänglichen Verlassenheit keinen Anstoß nahm, war Adolf Hitler. Als der Diktator am 28. Juni 1940 frühmorgens mit seinem Flugzeug in Le Bourget bei Paris eintraf, gestand er seinen Begleitern, darunter Albert Speer sowie sein Lieblingsbildhauer Arno Breker, dass dieser Besuch seit Jahren sein leidenschaftlicher Wunsch gewesen sei. Die Bewohner der Stadt und das Leben auf den Straßen interessierten den »Führer« allerdings nicht. Er war nach Paris gekommen, um seine Bauwerke zu besichtigen und der auf drei Wagen verteilten Entourage seinen »Kunstverstand« zu demonstrieren. Besonders ergriffen verharrte Hitler vor dem Grabmal Napoleons im Invalidendom. Es sei der größte und schönste Augenblick seines Lebens gewesen, bekannte er kurz darauf seinen Begleitern.15 Ausgerechnet jener Persönlichkeit galt seine ungespielte Verehrung, dessen Herrschaft die Pariser im April 1814 so überdrüssig gewesen waren, dass das feine hauptstädtische Publikum sogar den russischen Zaren Alexander I. und seine Kosaken als Befreier und neue Schutzherren begrüßt hatte. Fest entschlossen, Paris und seinen großen Präfekten, Baron Eugène Haussmann, zu übertrumpfen und Berlin mit noch prächtigeren Alleen auszustatten, kehrte der Diktator nach nur drei Stunden der französischen Hauptstadt für immer den Rücken. »Paris werde nur noch ein Schatten sein, wenn wir mit Berlin fertig sind«, bemerkte er damals zu Albert Speer. »Warum also sollen wir es zerstören?«16
Wenn auch Paris das grausame Schicksal erspart blieb, das der rachsüchtige Weltkriegsgefreite Adolf Hitler ihm ursprünglich zugedacht hatte, so scheuten sich die Besatzer doch nicht, das Straßenbild der besetzten Stadt mit einer »unzählbaren Menge« von »Totenpfählen« gründlich zu verschandeln. An jeder Ecke von Paris stießen Passanten jetzt auf schmucklose Holzpfähle, auf denen bis zu 30 sorgfältig beschriftete Brettchen dem Unkundigen Auskunft geben sollten, wie er diesen Truppenteil oder jene Dienststelle der Wehrmacht in Paris finden konnte. Offenbar waren sie selbst für Deutsche eher verwirrend als hilfreich.17 Als schlimmer noch empfanden viele Pariser jedoch die Verunstaltung des Palais Bourbon, des vormaligen Sitzes der Nationalversammlung. Auf einem riesigen, über die gesamte von Säulen getragene Front des Gebäudes gespannten Transparent brüsteten sich die Deutschen, dass sie an allen Fronten siegten. Solange diese provozierende Aufschneiderei halbwegs den Tatsachen entsprach, schien die Mehrheit der Pariser bereit, ihren Frieden mit den Besatzern zu machen. Man suchte nach Normalität auch unter den neuen Bedingungen und zum Erstaunen des eidgenössischen Gesandten Walter Stucki bevölkerten nur wenige Wochen nach dem Einmarsch der Deutschen die Hauptstädter schon wieder die Cafés und öffentlichen Plätze.18 Nicht vielen Franzosen sei es gegeben, die große Verzweiflung des Landes zu spüren, klagte der damals 71-jährige Dichter André Gide am 9. Juli 1940 in seinem Tagebuch. Würde die deutsche Herrschaft uns den Überfluss sichern, neun von zehn Franzosen ließen sie sich gefallen.19
Für Deutsche wie für Franzosen war die Stadt seit ihrer Besetzung zu einem besonderen Ort und zu einer Art neutralen Zone mutiert. Während die Franzosen dankbar dafür waren, dass ihre Stadt vor Krieg und Zerstörung verschont geblieben war, verbanden die deutschen Soldaten mit der Inbesitznahme von Paris die Hoffnung auf einen baldigen Frieden. Selbst nachdem Großbritannien wider Erwarten den Kampf fortsetzte und Hitler im Jahr darauf die Sowjetunion angriff, blieb die französische Hauptstadt für viele Deutsche eine kriegsfreie Zone, in der manche Hoffnung blühte, die Zeit bis zum Ende aller Kämpfe ebenso komfortabel wie unbeschadet zu überstehen. Jetzt im letzten Moment noch nach Russland wäre doch ein Blödsinn, erklärte ein im vornehmen Palais Eiffel einquartierter adliger Offizier dem im November 1942 von der Ostfront als Dolmetscher nach Paris kommandierten Fritz Molden, auch er wie der erstaunte Ankömmling und spätere namhafte Verleger ein Österreicher.20
Allerdings verschärfte sich auch in Paris die Sicherheitslage nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Zwar hatte der Sicherheitsdienst im Zusammenwirken mit der Pariser Polizei schon kurz nach dem Überfall auf die Sowjetunion rund 600 französische Kommunisten verhaftet, doch die im Untergrund verteilte L’Humanité forderte jetzt zum bewaffneten Kampf gegen die Deutschen auf.21 Tatsächlich nahm die Zahl ihrer Anschläge auf deutsche Soldaten spürbar zu, sollte aber bis zu den Tagen vor der »Befreiung« im August 1944 nie ein bedrohliches Ausmaß erreichen. Gleichwohl antworteten die Deutschen von Anfang an mit harten Repressalien bis hin zur Erschießung von Geiseln. Zu der sich jetzt verschärfenden Gewaltspirale gehörte auch die im Mai 1941 angeordnete Deportation von zunächst 4 000 in Paris wohnenden Juden ohne französische Staatsbürgerschaft in besondere Internierungslager. Ein Jahr darauf mussten auch die Franzosen jüdischer Konfession, die bis dahin noch vergleichsweise unbehelligt in Paris hatten leben können, den sogenannten Judenstern tragen. Dies war jedoch nur ein Vorspiel zu der schließlich im August 1942 einsetzenden Verfolgung und Deportation der französischen Juden in die osteuropäischen Vernichtungslager. Zwar nahmen nur wenige Deutsche, wie etwa der Dichter und Archetyp des Weltkriegskämpfers, Ernst Jünger, wenigstens insgeheim daran Anstoß22. Doch die grausamen Szenen gewaltsam getrennter Familien verunsicherten viele Pariser. Immer weniger glaubten jetzt noch daran, dass es für die Dauer des Krieges mit den Besatzern ein halbwegs erträgliches Auskommen geben könnte.
Spätestens mit dem ersten großen Luftangriff der Royal Air Force auf die französische Hauptstadt in der Nacht zum 4. März 1942 endete die Illusion von Paris als einem kriegsfreien Idyll, das bisher Besatzer und Besetzte in einer ungeliebten Zweckallianz vereinigt hatte. Die Deutschen hatten nicht verhindern können, dass 222 britische Bomber rund 400 Tonnen Bomben auf die Pariser Renaultwerke und die angrenzenden Arbeiterviertel warfen. 500 Menschen füllten am Morgen die Opferlisten.23 Ob Deutschland wirklich an allen Fronten siegte, war für die Pariser seit diesem schockierenden Angriff fraglicher denn je.
2Der lange Weg zurück – Großbritanniens Kriegsstrategie nach der Evakuierung von Dünkirchen
»Der vollständige Hang zur Defensive, der den Franzosen so sehr zum Verhängnis geworden ist, darf uns nicht ebenso aller Initiative berauben. Es ist daher von allergrößter Wichtigkeit, eine möglichst große Zahl von Deutschen an den Küsten jener Länder, die sie erobert haben, zu binden. […] Wie wunderbar wäre es, wenn wir sie dazu bringen könnten, sich ständig zu fragen, wo sie als nächstes angegriffen werden könnten, anstatt sie uns zwingen lassen, uns auf unserer Insel einzugraben.«
Winston Spencer Churchill, Der Zweite Weltkrieg1
Am Morgen des 4. Juni 1940 verließ Major General Harold Alexander als Befehlshaber der Nachhut des britischen Expeditionskorps (BEF) auf der HMS Venomous, dem letzten ablegenden Zerstörer der Royal Navy, den mit unzähligen Fahrzeugtrümmern und Waffen übersäten Strand von Dünkirchen. Damit endete die erst acht Tage zuvor begonnene Operation DYNAMO, die insgesamt 338 826 britische und französische Soldaten vor der deutschen Gefangenschaft bewahrt hatte.
Die anfangs im britischen Marineministerium gehegte Hoffnung, wenigstens 45 000 Mann über See retten zu können, war damit zwar weit übertroffen worden. Doch von den ursprünglich in Frankreich gelandeten 260 000 Soldaten des britischen Expeditionskorps füllte nach Abschluss von DYNAMO ein Viertel die Verlustlisten des War Office im Londoner Whitehall.2
Mit Evakuierungen könne man keinen Krieg gewinnen, musste Premierminister Winston Spencer Churchill noch am selben Tag in seiner berühmten Rede vor dem Unterhaus des Parlaments einräumen.3 Erst vier Wochen zuvor, am 10. Mai 1940, hatte der Nachfahre von John Churchill, dem siegreichen Feldherrn im Spanischen Erbfolgekrieg (1700–1713), der auch der erste Herzog von Malborough gewesen war, das höchste britische Regierungsamt erlangt. In den 1930er-Jahren hatte die beachtliche politische Karriere des Amateurhistorikers und Erfolgsautoren bereits vor dem Ende gestanden. Konservative Parteigenossen wie etwa Sir Harry Goschen betrachteten Churchill mit seiner martialischen Kritik an der Appeasement-Politik der Regierung gegenüber Hitlerdeutschland längst als verpönten »Störer der Harmonie« im Parlament4 und der Daily Express hatte im Oktober 1938 sogar von Panikmache gesprochen.5 Der Veteran der Kriege gegen die sudanischen Mahdisten und die Buren in Südafrika schien längst aus der Zeit gefallen. Erst nach dem deutschen Überfall auf Polen durfte der inzwischen 64-Jährige wieder als Erster Seelord am Kabinettstisch der Regierung Ihrer Majestät Platz nehmen. Schon im Ersten Weltkrieg hatte er das prestigeträchtige Amt bekleidet und damals gehofft, Premierminister Herbert Asquith einmal beerben zu können. Das Dardenellendesaster von 1915 hatte seine Pläne jedoch durchkreuzt und ihn sogar zum Rücktritt gezwungen. Erst ein Vierteljahrhundert später sollte für Churchill die große Stunde schlagen. Genau an dem Tag, als deutsche Truppen auf breiter Front die Grenzen zu Belgien, Luxemburg und den Niederlanden überschritten hatten, war er von König Georg VI. mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden.
Dass die britischen Truppen ihr gesamtes Kriegsmaterial am Strand von Dünkirchen hatten zurücklassen müssen, machte die Aufgabe für den neuen Hausherrn in der Downing Street nicht einfacher. Fast 60 000 Fahrzeuge, darunter Hunderte von Panzern sowie 2 000 Geschütze waren unwiederbringlich verloren. Churchills nach dem Ende von DYNAMO im Parlament demonstrierte Entschlossenheit, den Krieg gegen Hitlerdeutschland gleichwohl unbeirrt fortzusetzen und selbst im Falle einer deutschen Landung an Englands Stränden, auf seinen Feldern und Hügeln, in seinen Straßen und notfalls sogar jenseits der Meere weiterzukämpfen, war eine rhetorische Meisterleistung und vermochte für den Augenblick die politischen Reihen zu schließen.6
Der Kriegspremier sah jedoch genau, dass Großbritannien den Kampf gegen die Deutschen nicht nur überleben, sondern auch gewinnen musste. Wie kein anderer britischer Politiker war Churchill überzeugt, dass Freiheit und Zivilisation erst dann wieder ihren Platz in Europa finden konnten, wenn das Naziimperium ausgelöscht sein würde. Das aber konnte nur gelingen, wenn britische Truppen in bedeutender Zahl möglichst bald auf den Kontinent zurückkehrten. In den Tagen und Wochen nach der Evakuierung von Dünkirchen wurde er daher nicht müde, sämtliche Optionen auszuloten, um die angeschlagenen Franzosen im Krieg zu halten. Schon unmittelbar nach dem Abschluss von DYNAMO überraschte Churchill seinen persönlichen Stabschef Lord Hastings (Pug) Ismay mit der kühnen Idee, so rasch wie möglich besondere Kommandos aus Spezialkräften aufstellen zu lassen. Diese Elitetruppen sollten an der französischen Küste landen und im überraschenden Zugriff Städte wie Calais oder Boulogne im Rücken der deutschen Front besetzen, die Besatzungen niedermachen und die eroberten Positionen halten, bis die Deutschen mit stärkeren Kräften einen Gegenangriff führten.7
Am 6. Juni 1940 und damit auf den Tag genau vier Jahre vor dem Beginn von OVERLORD, beauftragte der Premierminister die britischen Chiefs of Staff (COS), geeignete Transportschiffe zu entwickeln, um auch mit Panzern an günstigen Stellen der französischen Küste landen zu können.8 Wegen seiner oft übersprudelnden militärischen Fantasien genoss Churchill schon seit dem Ersten Weltkrieg unter britischen Admiralen und Generalen einen fürchterlichen Ruf. Der Premierminister war sich dessen durchaus bewusst und scherzte gelegentlich, dass er wegen seiner zahlreichen spontanen Einfälle eigentlich zwei Generalstäbe bräuchte. Doch die aus seinen Überlegungen am 22. Juli 1940 hervorgegangene SOE (Special Operations Executive) sollte sich tatsächlich als beachtlicher Erfolg erweisen. Die neue Truppe setzte zwar nicht Europa in Flammen, wie es Churchill launig ihrem ersten Direktor Hugh Dalton auftrug, doch zahlreiche riskante Aktionen zwischen Norwegen und Jugoslawien sollten in den kommenden vier Jahren dazu beitragen, dass das vorerst zarte Pflänzchen des antideutschen Widerstandes im besetzten Europa nicht zugrunde ging.9
Alle Überlegungen Churchills richteten sich jedoch in diesen dramatischen Junitagen, während deutsche Panzer beinahe nach Belieben durch Frankreich rollten, zunächst noch darauf, die schon kampfmüden Franzosen zu unterstützen. Noch befanden sich drei voll ausgerüstete britische Divisionen auf dem Kontinent und der Kriegspremier beauftragte am 12. Juni Major General Alan Brooke, den späteren Chef des Imperial General Staff, mit der Führung dieser Truppen. Seite an Seite mit der 10. Französischen Armee sollte der General einen Brückenkopf in der Bretagne so lange verteidigen, bis die Amerikaner in den Krieg eintraten, was, wie Churchill damals hoffte, nur eine Frage von Wochen sein würde. Amerikas Präsident Franklin Delano Roosevelt war allerdings, obwohl er wie der Brite Hitlerdeutschland zutiefst verabscheute, noch weit davon entfernt, sich militärisch in Europa engagieren zu können. Im bevorstehenden Herbst strebte er seine zweite Wiederwahl an und musste noch Rücksicht auf den ausgeprägten Isolationismus vieler Amerikaner nehmen. Nicht einmal zur Lieferung der dringend von London erbetenen 50 Jagdflugzeuge vom Typ Curtiss sah sich das Weiße Haus vorerst imstande.
Enttäuschender als Amerikas Zurückhaltung war jedoch für die Briten der rasch schwindende Widerstandswille der Dritten Republik. Anlässlich seiner letzten Unterredung mit Frankreichs Premierminister Paul Reynaud am 13. Juni 1940 in Tours zeigte sich Churchill vom demoralisierten Zustand seiner Gesprächspartner zutiefst erschüttert. Ernüchtert kehrte der britische Premier noch am selben Tag nach London zurück. Gefahrlos war sein vorerst letzter Besuch auf dem Kontinent nicht. Görings Jagdflieger dominierten bereits den Luftraum über dem Kanal, weswegen Churchills Maschine teilweise im Tiefflug die Heimatinsel ansteuern musste.10
Nur einen Tag später marschierten deutsche Truppen in das zur offenen Stadt erklärte Paris ein, während die neue französische Regierung unter dem greisen Helden des Ersten Weltkrieges, Marschall Philippe Pétain, bereits unverblümt von einem Waffenstillstand mit den Deutschen sprach. Churchill sah sich somit gezwungen, General Alan Brookes dringenden Rat endlich zu beherzigen und den letzten noch in der Bretagne stehenden britischen Divisionen den Evakuierungsbefehl zu erteilen. Der Abzug war ein zweites »Dünkirchen«, das allerdings schon bald in Vergessenheit geraten sollte. Zwar glückte es der britischen Flotte noch einmal, zwei Divisionen mit rund 60 000 Mann einschließlich des meisten Materials von der bretonischen Küste aufzunehmen. Allerdings wurde dabei am 17. Juni das Paketboot Lancastria der Cunard-Linie mit rund 6 000 Soldaten an Bord von deutschen Fliegern vor der Mündung der Loire versenkt. 900 Schiffbrüchige konnte der Trawler, auf dem General Alan Brooke mit seinem Stab nach England zurückkehrte, noch aus der See bergen.11
Die dritte noch in Frankreich verbliebene Division der Briten, die 51stHighlander, hatte bereits am 12. Juni mit 10 000 Mann im Hafen von St.-Valery-en-Caux vor den Deutschen kapitulieren müssen. Der Kommandeur der Panzerdivision, die den etwa zwei Dutzend Kilometer westlich von Dieppe gelegenen Ort nach rücksichtslosem Vormarsch umstellt hatte, hieß Erwin Rommel. Damit besaß Großbritannien nur noch eine einzige voll ausgerüstete Division zur Verteidigung des Mutterlandes.
Das einseitige und überstürzte Ausscheiden der Dritten Republik aus dem Krieg empfand Churchill seither als Verrat. Nach seiner riskanten Visite in Frankreich zeigte er sich trotz aller Abschiedstränen beim letzten Händeschütteln mit Reynaud entschlossen, den Krieg gegen Hitlerdeutschland nunmehr ohne Rücksicht auf den einstigen Verbündeten fortzusetzen. Wenn er sich am 20. Juni 1940, zwei Tage vor der französischen Kapitulation, mit dem Plan beschäftigte, ein Korps von wenigstens 5 000 Fallschirmjägern aufzustellen, war er zwar immer noch von der Notwendigkeit überzeugt, baldmöglichst auf den Kontinent zurückzukehren. Frankreich betrachtete er aber bereits als ein feindliches Land.
Wohl nichts verdeutlichte Churchills Sinneswandel mehr, als sein am 2. Juli 1940 an Admiral James Sommerville erteilter Befehl, die im Hafen von Mers el Kébir an der algerischen Küste versammelte französische Flotte zu versenken, nachdem deren Befehlshaber die Auslieferung seiner Schiffe an Großbritannien strikt abgelehnt hatte. Dass bei diesem Überfall fast 1300 französische Seeleute den Tod fanden, quittierte der Premierminister im kleinen Kreis mit der sarkastischen Bemerkung, dass die Franzosen jetzt zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wirklich gekämpft hätten.12
Über die Kampfmoral der Briten musste sich Churchill dagegen weniger Sorgen machen. Die verbreitete Angst vor einer deutschen Invasion hatte die Bevölkerung des Königreiches wider Erwarten nicht gelähmt, sondern ihren Widerstandswillen sogar erkennbar gesteigert. Vorsichtshalber aber hielt Churchill die nützliche Bedrohungskulisse auch noch aufrecht, nachdem ihm im September 1940 die Bestätigung durch seine Funkaufklärung (ULTRA) vorlag, dass Hitler nach dem offensichtlichen Scheitern seiner Luftwaffe über England die befürchtete Invasion der Insel auf unbestimmte Zeit vertagt hatte.13 Allein unter den Flammenzeichen einer vermeintlich existenziellen Bedrohung ließ sich das Land nach Churchills Überzeugung im Krieg halten. Hohe Zustimmungswerte von fast 90 Prozent, die das Gallup-Institut im Juli 1940 ermittelt hatte, schienen seinen Kurs zu bestätigen.14
Hitlerdeutschlands bevorstehender Angriff auf die Sowjetunion sollte dem Vereinigten Königreich zudem die notwendige Atempause verschaffen. Jetzt konnte es seine Kräfte sammeln und schließlich auch die Vereinigten Staaten in den Krieg hineinziehen. An einen britischen Sieg vor 1942 glaubte Churchill gleichwohl nicht. Auch wenn Großbritannien dann wieder, wie er den Generalen Bernard Paget und Claude Auchinleck anlässlich einer Besichtigung der Verteidigungsanlagen im Südwesten der Insel versprach, eine Armee von 55 Divisionen unter Waffen haben konnte, wäre die Rückkehr auf den Kontinent immer noch mit großen Risiken verbunden. 15 Mit einem militärischen Erfolg könne überhaupt nur dann gerechnet werden, wenn Nazideutschland – möglicherweise durch eine schwere Niederlage im Osten – bereits deutlich angeschlagen sei.
Zwar mochte es Churchill durchaus nicht, von der »Festung Europa« zu reden, die nach dem militärischen Zusammenbruch Frankreichs entstanden war und er konnte sogar in Rage geraten, wenn andere es taten. Freilich war er Realist genug, um zu wissen, dass dieser Begriff doch einen wahren Kern enthielt.16 Das alte Trauma von »Gallipolli«, wo die Marine im Jahr 1915 die australischen und neuseeländischen Landungstruppen nach horrenden Verlusten wieder von den Küsten der Dardanellenhalbinsel hatte evakuieren müssen, steckte noch allen britischen Generalen in den Gliedern. Am meisten aber beschäftigten Churchill selbst seither die traurigen Bilder der an den mit Toten übersäten Stränden festsitzenden Soldaten.
In den folgenden zwei Jahren verlor der britische Kriegspremier die Perspektive einer Rückkehr auf den Kontinent nie aus den Augen, glaubte aber seit der Kapitulation Frankreichs immer weniger daran, dass eine direkte Überquerung des Kanals gegen den erwartbaren starken deutschen Widerstand Erfolg haben könnte. Schon im Ersten Weltkrieg war Churchill, von den vergeblichen Gemetzeln an der Westfront abgeschreckt, ein engagierter Befürworter von Schlägen gegen die vermeintlich schwachen Stellen des Gegners gewesen. Abseits des kontinentalen Hauptkriegsschauplatzes faszinierte ihn seither vor allem der Balkan. Doch das Engagement britischer Truppen in Griechenland endete schon im April 1941 mit einem erneuten Rückzug. Von den 58 000 Mann des Landungskorps ging ein Viertel verloren. Wieder mussten unter dem Druck der überlegenen deutschen Luftwaffe alle Fahrzeuge und Geschütze an den Stränden zurückgelassen werden.17 Weitere 15 000 Soldaten des Vereinigten Königreiches gerieten in Gefangenschaft, als britische Schiffe nur einen Monat später auch das von deutschen Fallschirmjägern angegriffene Kreta evakuieren mussten.
Einzig die seit August 1940 vom Bomber Command der Royal Air Force unternommenen Einflüge auf Reichsgebiet halfen, Großbritanniens ernüchternde militärische Bilanz der ersten beiden Kriegsjahre aufzubessern. Luftangriffe gegen Deutschland wie jener in der Nacht zum 22. September 1940 mit 80 Wellington-Bombern unternommene Raid auf Berlin ließen sich zudem der britischen Bevölkerung, die schwer unter den fortgesetzten deutschen Bombenangriffen litt, als willkommene Revanche darstellen. Andere militärische Erfolgsmeldungen wie etwa die Versenkung der »Bismarck«, des größten deutschen Schlachtschiffes, am 27. Mai 1941 rund 400 Seemeilen westlich von Brest, blieben in den folgenden zwei Kriegsjahren die Ausnahme.
Als im Februar 1942 Singapur vor den Japanern und vier Monate später auch das libysche Tobruk vor Rommels Afrikakorps kapitulieren mussten, waren Großbritannien nicht nur zwei wichtige Festungen mit zusammen mehr als 100 000 Soldaten verloren gegangen. Besondere Schmerzen bereitete Churchill, der die Hiobsbotschaft aus der Wüste während eines Besuchs im Weißen Haus erhielt, der dabei erneut offenbar gewordene niedrige Kampfgeist der britischen Truppen und ihrer Kommandeure. Eine Niederlage sei das eine, die Schande das andere, bemerkte der britische Premier sichtlich erschüttert zu seinem Gastgeber Roosevelt.18 Obwohl er noch im Besitz von Vorräten für mindestens vier Wochen gewesen war, hatte der aus Südafrika stammende General Hendrik Klopper die Festung Tobruk am 22. Juni 1942, nur zwei Tage nach Beginn des Angriffes, an die Deutschen übergeben.19
Politisch hingegen waren Großbritanniens fortgesetzte militärische Desaster durch den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Dezember 1941 weit aufgewogen worden. Wie glücklich sich die Briten nach ihrem langen und einsam geführten Kampf schätzten, zeigte sich auch daran, dass sie die erste gemeinsame Konferenz in Washington im Januar 1942 nach der antiken Traumlandschaft ARCARDIA benannten.20 Churchills Hoffnungen auf die Amerikaner sollten nicht enttäuscht werden. Trotz der das ganze Land schockierenden Demütigung von »Pearl Harbor« machte Präsident Roosevelt gegenüber seinen Gästen deutlich, dass er nicht die »heimtückischen Japaner«, sondern Hitlerdeutschland als Hauptgegner ansehen würde. Es störte den Kriegspremier auch nicht, dass hinter Amerikas Priorität für den Kampf gegen das Deutsche Reich natürlich auch das nüchterne strategische Kalkül steckte, diesen Gegner in einer Dreierkoalition mit Stalin und Großbritannien leichter niederwerfen zu können als den fernöstlichen Rivalen.21
Inzwischen war Hitlers Plan, mit einem weiteren Blitzkrieg Stalins Sowjetunion niederzuwerfen und damit endlich auch Großbritannien friedensbereit zu machen, im Dezember 1941 vor den Toren Moskaus gescheitert. Die beiden großen, im Spätsommer 1942 begonnenen deutschen Offensiven in den Kaukasus und nach Ägypten sollten nur allzu rasch die hoffnungslose Überbeanspruchung der Ressourcen des Dritten Reiches deutlich machen.
Da Premierminister Churchill wegen der vielen militärischen Rückschläge im eigenen Land unter Druck stand und seine Umfragewerte erstmals deutlich gesunken waren, war er anders als die Amerikaner zu großen Risiken vorerst nicht mehr bereit. Es kostete ihn und seinen Stabschef Alan Brooke jedoch erhebliche Mühe, die im Sommer 1942 unter Führung ihres höchsten Militärs, George Catlett Marshall, nach London gereisten Stabschefs der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, die große Invasion Frankreichs (Codename ROUNDUP) zunächst zurückzustellen.
Stattdessen sollte mit einer Landung in Marokko und Algerien (Operation TORCH) ein alliiertes Übergewicht im Mittelmeerraum geschaffen werden. Waren die Achsentruppen erst einmal aus Nordafrika vertrieben, so die Argumentation Churchills und seiner Generale, konnte man leicht in Italien Fuß fassen oder sogar nach Griechenland zurückkehren.
Anfangs hatte sich der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General George Cattlet Marshall, noch ausdrücklich für eine alliierte Landung zwischen Calais und Dünkirchen spätestens im Frühjahr 1943 ausgesprochen. Die Amerikaner waren sogar für die sofortige Bildung eines Brückenkopfes in der Bretagne oder auf Cotentin (Operation SLEGDEHAMMER) eingetreten, falls die damals über den Don zurückweichende Sowjetarmee schon in den nächsten Wochen zusammenbrechen würde. SLEGDEHAMMER könnte dann als erste Phase der größeren Hauptlandung im Folgejahr dienen.22 Doch Washington besaß vorerst nicht einmal die dafür veranschlagten fünf Divisionen, geschweige denn die notwendige Zahl von Verbänden für die große Lösung. Gerade einmal zwei amerikanische Divisionen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Nordirland, während die deutschen U-Boote den Transport weiterer Divisionen über den Atlantik zu einem unkalkulierbaren Risiko machten. Es fehlten außerdem geeignete Landungsboote, vor allem Fahrzeuge, die Panzer und schweres Gerät bis nah an den Strand bringen konnten. Zudem war Görings Luftwaffe noch längst nicht marginalisiert und wäre für die Landungstruppen am deckungslosen Strand eine tödliche Gefahr.
Anders als die stets optimistischen Amerikaner sahen Churchill und Alan Brooke vor allem das politische Risiko eines Scheiterns der Landung. Ein Rückzug von den Stränden Frankreichs würde unweigerlich zu einer unbestimmbaren Verlängerung des Kriegs führen und allein der Sowjetunion nutzen. Dagegen ließen sich durch eine Offensive im Mittelmeer, mit der man in Italien und vielleicht sogar auf dem Balkan Fuß fassen konnte, noch am ehesten Stalins wachsende Ambitionen in Mitteleuropa eindämmen. Seinem Außenminister Anthony Eden vertraute der Kriegspremier damals an, dass es eine gewaltige Katastrophe sein würde, wenn es dem barbarischen sowjetischen System tatsächlich gelänge, die alten Staaten Europas mit ihrer Unabhängigkeit und Kultur unter seiner primitiven Tyrannei zu ersticken.23
Noch im August 1942 machte er sich über Gibraltar und Kairo auf den Weg nach Moskau, um dem misstrauischen roten Zaren, der sich mit seiner wiederholten Forderung nach einer zweiten Front in Europa wieder einmal hintergangen sah, die Vorteile der britischen Mittelmeerstrategie schmackhaft zu machen.
Churchills Flug über Gibraltar, Kairo und Teheran zählte wohl zu seinen schwierigsten und strapaziösesten politischen Missionen. Als er mit seiner Delegation am 12. August 1942 in Moskau eintraf, waren die deutschen Panzerspitzen nur noch wenige Dutzend Kilometer von der Wolga entfernt. Ein Zusammenbruch der sowjetischen Südfront war nicht mehr auszuschließen und der unter großer Anspannung stehende Kremlherr nahm die Erklärungen seines Gastes sehr übel auf. Unverblümt erwiderte er Churchill, dass er keineswegs von den Vorzügen der geplanten anglo-amerikanischen Landung in Nordafrika überzeugt sei. Vor allem aber brachten ihn der kürzlich eingetretene Verlust des britischen Nachschubkonvois PQ17 im Nordmeer und mehr noch Churchills Ankündigung auf, dass es im August keinen weiteren Konvoi geben werde. Es sei wohl das erste Mal, dass die britische Flotte einem Kampf ausweichen würde, spottete Stalin voller Sarkasmus. Gleichwohl konnte Churchill, als er sich drei Tage später auf den Rückweg machte, sicher sein, dass es vorerst zu keiner Neuauflage des Hitler-Stalin-Paktes kommen würde. Der missgelaunte Kremlherr musste gegen die Deutschen weiterkämpfen und hatte dazu die Hilfe der Briten mehr denn je nötig. Das abschließende Bankett im Kreml mit zahllos ausgebrachten Toasts und die Unmengen von Wodka, die seinen Gästen am kommenden Morgen schwer zu schaffen machen würden, waren Stalins kleine Revanche für die ihm von Churchill aufgetischte Kröte namens TORCH .24
Operation JUBILEE, 19. August 1942. Das Bild aus der nationalsozialistischen Propaganda zeigt gefallene alliierte Soldaten an einem zerstörten britischen Landungsboot im französischen Dieppe.
Als der Kriegspremier nach dreiwöchiger Abwesenheit am 25. August 1942 auf dem Flugfeld von Lyneham bei Schloss Blenheim landete, erwartete ihn bereits eine neuerliche Hiobsbotschaft. Ein Landungsversuch von sechs Bataillonen der kanadischen 2ndDivision an der französischen Küste bei Dieppe (Operation JUBILEE) war nur sechs Tage vor Churchills Rückkehr vollkommen gescheitert. Taktische Fehler, ein zu geringer Kräfteansatz und mangelhafte Luftunterstützung hatten den schmerzvollen Fehlschlag nur zwei Jahre nach »Dünkirchen« verursacht. Die kanadische Infanterie war bereits beim Verlassen der Landungsboote zerschlagen worden. Außerdem hatten die Deutschen sämtliche 29 an Land gesetzten Panzer vom Typ »Churchill« bei ihrem ersten Kampfeinsatz außer Gefecht gesetzt.25 Von den beteiligten 6 000 Soldaten konnte drei Stunden später nur noch ein Drittel wieder eingeschifft werden, der Rest war gefallen oder in deutsche Gefangenschaft geraten. Stolz ließ Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, der verantwortliche O.B.West, nach Berlin melden, dass sich kein bewaffneter Engländer mehr an Land befinde. Sämtliche Zweifel, dass die Deutschen bei einer großen Landung hart und effektiv zurückschlagen würden, waren damit vom Tisch. Churchill und Alan Brooke konnten das Desaster immerhin als nachträglichen Beleg für ihre Bedenken gegenüber den allzu optimistischen amerikanischen Vorstellungen verbuchen.
Dagegen schien das Konzept der Briten, sich über das Mittelmeer Zutritt zu Europa zu verschaffen, im Spätherbst 1942 tatsächlich aufzugehen. Nach einer zwölftägigen Abnutzungsschlacht konnte die britische 8thArmy unter ihrem neuen Oberbefehlshaber Bernard Montgomery am 3. November die deutsch-italienische Panzerarmee unter Generalfeldmarschall Erwin Rommel aus ihrer Stellung bei El-Alamein zurückwerfen und zum Rückzug nach Tunesien zwingen. Stolz meldete der Londoner Daily Telegraph die Gefangennahme von 9 000 Soldaten der »Achse« und 260 zerstörte Feindpanzer. Es war der einzige Erfolg im Zweiten Weltkrieg, den eine britische Armee allein gegen die Deutsche Wehrmacht erringen sollte. Der Mythos von der Unbesiegbarkeit des »Wüstenfuchses« war damit gebrochen. Nur fünf Tage später hatte auch die Landung alliierter Truppen in Marokko und Algerien den erhofften Erfolg, wenn auch der überraschend hartnäckige Widerstand der französischen Küstenverteidigung Briten und Amerikaner mehr als 2 000 Tote und Verwundete kostete.26
Aber die Tage der Achsenmächte in Nordafrika waren jetzt gezählt. Zwischen dem Rückzug vom Dünkirchener Strand und dem Sieg in der Wüste hatte für Großbritannien ein langer Weg voller Blut, Schweiß und Tränen gelegen. Im Rückblick waren für Churchill gerade die beiden letzten Monate vor der militärischen Wende, als Großbritannien der Niederlage sogar näher war als im Sommer 1940, die qualvollsten des gesamten Kriegs gewesen.27 »Wir haben eine neue Erfahrung gemacht, auf die das Land so lange gewartet hat«, verkündete ein wohlgelaunter Kriegspremier am 10. November 1942 in seiner Rede im Londoner Mansion House. »Wir haben einen Sieg errungen.« Doch einschränkend fügte er hinzu. »Dies ist nicht das Ende. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber vielleicht das Ende des Anfangs.«28
3Das Ende einer Weltmacht – Die vier Tage von Teheran 1943
»Es war das erste Mal im Krieg, dass Stalin, Roosevelt und Churchill an einem Tisch saßen, um Probleme der gemeinsamen Kriegführung zu diskutieren. Ich empfand es als außergewöhnlich fesselnd, ihre Gesichter zu beobachten und einzuschätzen, welche Gedanken sich dahinter verbargen. Churchill kannte ich ja bereits recht gut und nach etlichen Zusammenkünften begann ich auch zu verstehen, wie Roosevelts Verstand arbeitete, doch Stalin war für mich immer noch ein großes Geheimnis.«
Field Marshal Sir Alan Brooke über den Auftakt der Konferenz von Teheran am 28.11.19431
Am 13. Mai 1943 kapitulierten bei Kap Le Bon nahe Tunis die letzten Truppen der deutsch-italienischen Panzerarmee. Der Krieg in Afrika war beendet. 170 000 Soldaten der »Achse« mussten den Weg in alliierte Gefangenschaft antreten. »Tunis« war nach den empfindlichen Rückschlägen bei Sidi Bouzid und am Kasserine-Pass im vorangegangenen Februar der erste gemeinsame Sieg der Anglo-Amerikaner über die Deutsche Wehrmacht und schien zunächst Churchills Mittelmeer-Strategie glänzend bestätigt zu haben. Dass sich der nächste militärische Schlag der Verbündeten gegen das schon schwankende faschistische Italien richten würde, hatten Amerikaner und Briten bereits auf der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 beschlossen.2
Nur zwei Monate nach der Kapitulation der Achsenmächte in Nordafrika landeten am 10. Juli 1943 die ersten Truppen einer anglo-amerikanischen Heeresgruppe von 200 000 Mann an der sizilianischen Südküste zwischen Gela und Syrakus (Operation HUSKY