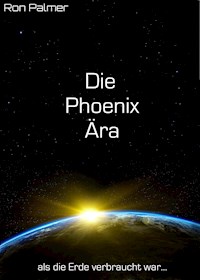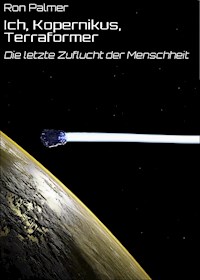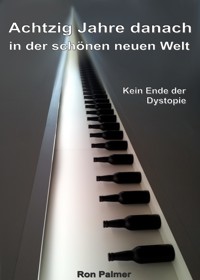
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist aus Huxleys "Schöner neuer Welt" 80 Jahre danach geworden? Aldous Huxley wurde mehrfach für den Literatur-Nobelpreis vorgeschlagen, seine "Schöne neue Welt" landete auf Platz 56 der Top 100 Novellen. Dies ist eine hypothetische Fortsetzung des Romans des berühmten Sozialphilosophen und Schriftstellers. Eine kritische Betrachtung der Gesellschaftsentwicklung lieferte Huxley bereits knapp 30 Jahre nach Veröffentlichung seines Jahrhundertwerks mit "Dreißig Jahre danach". Wie sehr wir uns heute, 80 Jahre danach, seiner skizzierten Dytopie angenähert haben zeigt "80 Jahre danach in der schönen neuen Welt" mit seinem einleitenden Sachbuchteil und seinem Hauptteil als spannender Roman. Wenn Huxley geahnt hätte, was heute alles möglich ist. Professor Arnold Wankel stellt Ungereimtheiten und Widersprüche in der erneuerten schönen neuen Welt fest. Als Privilegierter kann er recherchieren wie es sonst nur wenige können. Er zieht weitere Personen ins Vertrauen. Durch seine ungewöhnlichen Kontakte baut er ein Netzwerk an Helfern auf und erfährt die entsetzliche Wahrheit: Auch die gefälschte neue Geschichte wurde eine Kulisse zur Beruhigung der Massen aufgebaut. Vor knapp 80 Jahren wurde die Gesellschaft in einer Weise verändert, die heute den Menschen auf infame Weise mehr Freiheiten vorgaukelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ron Palmer
80 Jahre danach in der schönen neuen Welt
Kein Ende der Dystopie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1 – Ich bin stolz ein Zweier zu sein
Kapitel 2 – Große und kleine Wahrheiten
Kapitel 3 – Geschichte ist kein Mumpitz
Kapitel 4 – Besondere Veranlagungen
Kapitel 5 – Normabweichler
Kapitel 6 – Im Reich der Vierer
Kapitel 7 – Parallelgesellschaft
Kapitel 8 – Die schöne freie Welt schlägt zurück
Kapitel 9 – Flucht in die Katakombe
Kapitel 10 – Rekonditionierung
Kapitel 11 - Expedition zur alten Hauptstadt
Kapitel 12 – Regressionsalarm
Kapitel 13 – Revolution
Kapitel 14 – Die Tage danach
Kapitel 15 – Fünf Jahre danach
Nachbemerkung des Autors
Liste der Wortübertragungen und Zeitrechnung
Quellen, Literatur und Filme
Impressum neobooks
Vorwort
„Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel.“
Aldous Huxley
Aldous Huxleys Roman “Brave New World“ oder „Schöne neue Welt“1 aus dem Jahr 1932 gehört zu den am häufigsten diskutierten literarischen Werken des 20. Jahrhunderts. Was damals erschreckend, fremdartig und fern wirkte, kommt uns heute ernüchternd alltäglich vor. Viele der aktuellen Entwicklungen hätten es bis heute schon beinahe möglich gemacht Huxleys Dystopie der 1930er-Jahre Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Huxleys leicht verständlicher Sprache wird „Schöne neue Welt“ gern als ein Standardwerk im Schulunterricht genutzt. Der subtile Tiefgang des Romans wird aber auch noch höheren Ansprüchen gerecht. Einige Literaturexperten waren der Meinung, man solle Huxley für den Roman „Schöne neue Welt“ den Literaturnobelpreis verleihen. Das Buch wurde im Dritten Reich und in anderen Staaten verboten. Huxley beschrieb damals eine Gesellschaft die aus genormten und konditionierten Menschen besteht. Die notwendigen Technologien dafür deutet er nur schemenhaft an, weil sie noch in ihren Anfängen standen. In den ersten Jahren nach der Veröffentlichung seines Romans nahm Huxley kaum Stellung zu der Frage, ob der Roman eine Warnung oder womöglich sogar seine Wunschvorstellung künftiger Möglichkeiten sei. Erst Jahre später beschrieb er sein Werk als Mahnung. Huxleys Roman ist reich an Metaphern, die sogar heute noch mehr als damals beklemmend real wirken.
Vieles, was Huxley in seinem totalitären Zukunftsstaat nur skizzierte, ist für uns heute zur Gewissheit geworden. Wir wissen mehr als 80 Jahre nach der Veröffentlichung seines Romans, wie sehr Menschen technisch und psychologisch manipuliert werden können und wie weit die heutigen Möglichkeiten sogar Huxleys Darstellung übertreffen können.
Bereits im Jahr 1959 veröffentlichte Huxley seine Studie “Brave New World Revisited“2, in Deutschland unter dem Titel „Dreißig Jahre danach“. Darin untersuchte er, welche seiner Vorhersagen bereits Wirklichkeit geworden waren. Die Studie ist eine ernüchternde Zwischenbilanz, die bestätigt, dass viele der befürchteten Entwicklungen keine 30 Jahre nach der Romanveröffentlichung bereits eingetreten waren oder kurz davor standen sich durchzusetzen.
Im Roman „Achtzig Jahre danach in der schönen neuen Welt“ spiegelt der Autor einige Motive aus Huxleys Roman im Licht der heutigen Zeit wider. Die Einleitung, die auch als separate Abhandlung veröffentlicht wird, beruht auf dem Wissensstand der beginnenden 2020er-Jahre. Nicht jeder der Huxleys „Schöne neuen Welt“ schätzt mag sich brennend für eine Sachabhandlung interessieren. Dann sollte man sich besser vom Roman „Achtzig Jahre danach in der schönen neuen Welt“
überraschen lassen. Diese gedachte Fortsetzung von Huxley Werk ist sicher unterhaltsamer und spannender. Leser, die weniger an Schachtexten interessiert sind, sollten gleich weiterspringen und mit dem Romanteil beginnen.
In der folgenden Sachabhandlung werden die damaligen Befürchtungen Huxleys mit den heutigen Entwicklungen abgeglichen und somit auf den neuesten Stand gebracht. Es wurde seitdem erstaunlich viel möglich. Doch die Veränderungen und Fortschritte hätten viele Menschen der 1930er Jahre wahrscheinlich ebenso erschreckt, wie sich heute viele von uns dafür begeistern. Wir sind mit diesen Entwicklungen aufgewachsen und hatten Zeit uns daran zu gewöhnen, oft ohne jeden Zweifel. Wir bedenken kaum noch, dass wir uns im weltweiten Datennetz, oft unfreiwillig, einer weltweiten Überwachung aussetzen. Wir lassen uns sogar oft freiwillig überwachen indem wir im Internet unbekannten Fragestellern Fragen beantworten, Marketingprofile über uns erstellen lassen oder auf andere Wiese zustimmen unsere Daten unkontrolliert weiterzuleiten.
Wie deutlich wir in den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrtausends auf eine „Schöne neue Welt“ hinsteuern, erläutert die Abhandlung mit Beispielen. In den fast fünf Jahren, in denen diese Sachabhandlung und der Roman „Achtzig Jahre danach in der schönen neuen Welt“ verfasst wurden, haben sich sogar einige der genannten Probleme weiter verschärft. Was wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch verändern?
Es ist zwar keine Voraussetzung Huxleys „Schöne neue Welt“ oder das englische Original “Brave New World“ gelesen zu haben, um „Achtzig Jahre danach...“ zu verstehen, es sicher ein wenig sich in das Szenario des neueren Romans hineinzuversetzen. Daher empfehle ich Lesern von „Achtzig Jahre danach...“ vorher Huxleys „Schöne neue Welt“ zu lesen. Huxleys akademische Weiterführung „30 Jahre danach“ (Original: “Brave New World Revisited“) ist, nach der Lektüre von Huxleys Standardwerk, äußerst interessant. Diese Arbeit Huxleys greift die aktuelle Gesellschaftsentwicklung der 1950er Jahre in ähnlicher Wiese auf, wie es der einleitende Sachbuchteil in Bezug auf die heutige Zeit und besonders für „Achtzig Jahre danach...“ tut.
Gute Unterhaltung!
Frank Röder (Herausgeber)
Einleitung
Zehn Aspekte damals und heute...
ÜberbevölkerungHuxley rechtfertigte den Weltstaat der „Schönen neuen Welt“ mit der bereits in der 1930er-Jahren deutlich erkennbaren Bevölkerungsexplosion auf der Erde. Nur eine konstante Bevölkerung schien den friedlichen Fortbestand und den Wohlstand der Menschheit zu sichern. In Huxleys Roman wird noch von einer Weltbevölkerung von zwei Milliarden Menschen ausgegangen. Inzwischen wissen wir, dass unser Planet im 21. Jahrhundert vielfach mehr Menschen ernähren kann. Die Agrarwirtschaft ist produktiver geworden und die Weltbevölkerung ist sogar etwas weniger dramatisch gewachsen, als man es noch vor fast einhundert Jahren befürchtete. Die hohe Bevölkerung scheint heute nicht mehr die größte Bedrohung des Planeten zu sein. Den ersten Rang hat dabei eindeutig der Klimawandel übernommen. Doch Huxley war einer der ersten, der die Überbevölkerung über Unterhaltungsliteratur publik gemacht hat.
Auch heute bleibt die Gefahr durch zu viel Bevölkerung groß, auch wenn etwa seit den 1990er-Jahren das Bevölkerungswachstum etwas langsamer wurde. Dies gibt uns einige Jahrzehnte mehr Zeit, in denen wir handeln sollten. In Asien, Australien und Europa ist in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts mit keiner bedenklichen Veränderung der Bevölkerungszahl und der Bevölkerungsdichte mehr zu rechnen. Es kann sogar zu einem leichten Rückgang der Einwohnerzahlen kommen.
Anders ist es in Afrika, wo die Bevölkerung noch viele Jahre länger wachsen wird. Aber auch dort wird zumindest das Wachstum langsamer werden. Auf allen Kontinenten wird sich voraussichtlich gegen Ende des 21. Jahrhunderts eine konstante Bevölkerungszahl zwischen zehn und zwölf Milliarden einpendeln. Die höhere Zahl wird nur erreicht, wenn die weltweite Lebenserwartung noch deutlich zunimmt. Neun Milliarden Menschen kann unser Planet schon heute ernähren. Voraussetzung dafür ist, dass keine weiteren Ökosysteme und landwirtschaftliche Nutzflächen zerstört werden. Würden die Nahrungsressourcen erheblich gerechter verteilt werden als heute, wäre unser Planet sogar in der Lage etwa zwölf Milliarden Menschen zu ernähren. Das würde deutlich schwerer werden, wenn weitere Konflikte wie Terror, militärische und wirtschaftliche Kriege ausbrechen. Dann könnten Hunger und sehr ungleicher Wohlstand noch bis weit ins 22. Jahrhundert bestehen. Eine weltweite Abschaffung der Überernährung und der Verschwendung von Lebensmitteln würde alleinschon die Ernährung von einer halben bis einer Milliarde Menschen sichern. Ohne mehr Nahrung produzieren zu müssen, könnten so heute schon die derzeit etwa 900 Millionen hungernden Menschen auf der Erde sofort satt werden. Die Herausforderung, in der Zukunft bis zu zwölf Milliarden Menschen ausreichend und besser zu ernähren, ist sehr groß. Die heutigen Möglichkeiten reichen aber bereits aus, diese Aufgabe zu bewältigen.
Die Lösung besteht nicht allein in Huxleys Methoden: die Bevölkerung durch Geburtenkontrolle konstant zu halten, der Kunstdüngung und der chemischen Schädlingsbekämpfung. Nach heutigen Erkenntnissen wäre das allein viel zu kurzfristig gedacht und würde langfristig größere Probleme nach sich ziehen. Wesentlich krisenfester und umweltfreundlicher ist es, Lebensmittel in den Regionen herzustellen, wo sie verbraucht und deutlich unabhängiger vom Einfluss entfernter ausländischer Konzerne produziert werden. Dies würde dem derzeitigen Trend der Globalisierung klar entgegen stehen. Viele Versuche, Nahrungsmittel dezentraler und autonomer zu produzieren, werden jedoch schon seit Jahrzehnten von einigen internationalen Lebensmittel- und Chemiekonzernen hartnäckig bekämpft und oft erfolgreich verhindert.
Nur wenige Jahre bevor Huxley „Schöne neue Welt“ veröffentlicht hatte, überschritt die Weltbevölkerung die damals unvorstellbare Zahl von zwei Milliarden3. Als „Dreißig Jahre danach“ veröffentlicht wurde, waren es schon fast drei Milliarden. Zum Beginn der 2020er Jahre muss unser Planet schon fast die vierfache Bevölkerung, nämlich knapp acht Milliarden, statt bekommen. Für alle genügend Lebensmittel herzustellen, ist aber heute leichter, als es Huxley damals annahm. Das größte Problem scheint heute dabei eine zu unmoralisch betriebene Weltwirtschaft zu sein, die rein wirtschaftliche Interessen über das Grundbedürfnis nach Nahrung stellt. Es wird sogar in einigen Ländern versucht, das gesamte Nutzwasser, Trinkwasser wie auch Regenwasser, unter das Monopol eines Konzerns zu stellen.
Anwendung der Gentechnik, der pränatalen Prägung und der Eugenik
Gentechnik bestand auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts noch überwiegend aus der Auslese für die Zucht. Erbschädigende und mutagene Wirkungen auf die Erbsubstanz waren damals bereits entdeckt worden, konnten aber noch nicht gezielt eingesetzt werden, um gewünschte Ergebnisse zu erreichen. So erschien es Huxley naheliegend Embryos pränatal in vitro zu prägen. Pränatal bedeutet vor der Geburt; in vitro bedeutet außerhalb des Mutterleibes, in Brutbehältern.
Durch veränderte physikalische Umwelteinflüsse und chemische Zusätze werden in Huxleys Roman die künftigen Bürger ihren geplanten Aufgaben angepasst. In diesem Sinne hat Huxley nach dem damaligen Stand der Wissens alle Register eines gründlich recherchierenden Science-Fiction-Autors gezogen. Die heutigen Möglichkeiten, die Erbsubstanz direkt zu manipulieren, waren damals bestenfalls theoretisch denkbar, praktisch allerdingsnoch in weiter Ferne.
Bald oder schon heute mögliche Gentherapien bei Schwerkranken werden derzeit noch durch ethische Einwände in Zaum gehalten. Das menschliche Genom gilt seit 2003 als entschlüsselt und seine Manipulation scheint inzwischen weniger aus technischen Gründen, als viel mehr durch Gesetze und einer gewissen Moral in der Wissenschaft gebremst zu werden. Was in geheimen Laboratorien skrupelloser Staaten oder super reicher Oligarchen schon stattgefunden haben mag, möchte man sich gar nicht ausmalen. Schon heute wäre es möglich die Augenfarbe oder das Geschlecht ungeborener Kinder zu bestimmen. Wahrscheinlich wurde diese Technologie jedoch bis heute noch nicht angewendet. Im Science-Fiction-Film „Gattaca“4 können Eltern in einem Familienplanungsbüro bestimmte Eigenschaften ihrer Kinder auswählen, so selbstverständlich, wie heute die Ausstattung beim Kauf eines Autos.
In bestimmten Kulturen ist bereits die Abtreibung von Kindern mit unerwünschten Eigenschaften üblich. In den so genannten westlichen Kulturen gilt heute als legitimer Grund für eine Abtreibung schon eine festgestellte Erbkrankheit oder eine Behinderung. In Indien dürfen weibliche Nachkommen oft gar nicht auf die Welt kommen, weil sie als Stammhalter der Familie nicht in Frage kommen oder als Belastung für die Familie empfunden werden. Diese aktuellen Beispiele überschreiten bereits die Grenze zur Eugenik, der Vernichtung unerwünschten Lebens. Die Kernfrage dieses Themas ist immer, wer die Maßstäbe dafür festgelegt und wer dann danach handeln darf. Es fällt natürlich schwer das Überleben bereits geborener Menschen unter das Wohl oder Leiden noch nicht Geborener zu stellen. Hier soll keine moralische Diskussion darüber geführt werden. Natürlich gefährdet eine unerwünscht hohe Anzahl von Kindern den Wohlstand oder auch das Überleben einer Familie. Huxley bewegt sich bereits in der „Schönen neuen Welt“ in Extremen. Einerseits entstehen in den so genannten Bokanovsky-Gruppen bis zu 96 identische Dutzendlinge, auf der anderen Seite ist die überwiegende Mehrheit der Frauen in der „Schönen neuen Welt“ von Geburt an steril und wäre damit gar nicht mehr in der Lage, den Genpool der Menschheit durch Neukombinationen zu bereichern.
Pränatale und postnatale ideologische PrägungIn der „Schönen neuen Welt“ werden die Menschen zu einem großen Teil schon vor der Geburt konditioniert. Nach der Geburt geht diese Konditionierung in Schlafschulen und auch in konventionellen Schulen gezielt weiter. Nicht vergessen darf man aber auch die weitere Verstärkung der Prägung durch den ideologisch gelenkten Alltag. Alltägliche Wiederholung von Schlafschulweisheiten, offene und unbewusste Beeinflussung in den Fühlkinos sowie Rituale wie die Eintrachtsandacht erschweren es in der „Schönen neuen Welt“ auch den Erwachsenen, ideologisch abweichende oder in anderer Weise unerwünschte Gedanken zu entwickeln. Im Roman „Achtzig Jahre danach...“ heißen die weiter entwickelten Kinos Emo-Kinos, obwohl der Fortschritt ausgerechnet in der noch stärkeren Kontrolle der Emotionen der Kinobesucher liegt.
Heute werden viele energisch leugnen, dass dies auch in unseren modernen und aufgeklärten Gesellschaften der Fall ist. Zu sehr schrecken uns die historischen Beispiele ab, in denen Völker, von blindem Gehorsam getrieben, aufeinander losgingen. Unser Bedürfnis nach Freiheit scheint erheblich durch diese Erfahrungen beeinflusst zu sein. Selten wurden aber unmittelbar nach einem gescheiterten totalitären Regime die Menschen auf die gleiche Weise gefügig gemacht. Subtilere Methoden wurden danach notwendig, denn die potentiellen Opfer waren bereits vorgewarnt. Die bewährten alten Methoden wurden trotzdem in späteren Epochen übernommen, nur eben schwerer zu entdecken oder einfach nur einige Generationen später. Geschichte wiederholt sich leider immer wieder auf erschreckende Weise.
Die Methoden, mit denen man andere gefügig macht, werden in heutigen Diktaturen ebenso wie in den freien Gesellschaften angewendet: getarnt mit Technologie oder auch versteckt hinter Konsumanreizen. Dazu werden oft Feindbilder, Lebensziele oder Weltanschauungen aufgebaut. Für viele dieser zweifelhaften moralischen Werte werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene dann während ihres gesamten Lebens mit einer gesellschaftlichen Erziehung geprägt. Doch allen Menschen, die sich so fühlen, als lebten sie in einer freien Gesellschaft, sei gesagt: Auch das Konsumverhalten wird anerzogen.
Zweiundsechzigtausendvierhundert Wiederholungen, schreibt Huxleys in seinem Roman, ergeben eine Wahrheit. Damit spielt er an auf Propaganda, Werbung und manipulative Medien, die ebenso auf viele Wiederholungen setzen. Was sich einprägt, wird zur Gewissheit und damit für viele zum Wissen. Quasi: „Ich erinnere mich, also weiß ich.“ Glaube und Lügen werden so in den Köpfen zu gefühltem Wissen. Früher wie auch heute.
Diese Fixierung kann in ganz verschiedenen Bereichen stattfinden: Sei es die Bindung an bestimmte Personen, in Form eines Führerkults oder an bestimmte Parteien und Ideologien bis hin zum ganz bestimmtem Kaufverhalten oder einer festgelegten Sichtweise für soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge. Manches davon kann durchaus moralisch und ethisch wünschenswert sein. Manchmal werden aber auch Moral und Ethik missbraucht, um weiterführende Ziele zu maskieren. So werden wir zwar heute nicht pränatal ideologisch geprägt, aber doch sehr eindeutig postnatal. Unterbewusste Einflüsse werden dabei immer mehr dazu genutzt, dieses Ziel zu erreichen. Jeder kennt Beispiele wie PayBack-Punkte oder Flugmeilen, die mehr Konsum belohnen. So hat das „Sparen“ solcher Boni heute kaum noch etwas mit Verzicht zu tun, sondern mit einem Mehr, das ich als Belohnung für noch mehr Konsum erhalte. Beim letzten Thema der Abhandlung „Was Huxley nicht ahnen konnte – wir hängen im Netz“ wird die Brücke zum chinesischen Bürgerindex geschlagen, der ja auch in „Achtzig Jahre danach...“ angewendet wird.
Kasten, Schubladendenken und die scheinbare Freiheit der Wahl
Vielfalt ist, als kreative Spielart der Natur, in der „Schönen neuen Welt“ äußerst unerwünscht. Das Ergebnis einer jeden Handlung, und sei es die Fortpflanzung, soll jederzeit in seinen Ergebnissen vorhersehbar sein. Für dieses Ziel scheint menschliche Konfektionsware die praktische Antwort zu sein.
Auch heute werden wir in Konfektionsgrößen gedrängt und das nicht nur in der Mode, wo besonders dicke, große oder kleine Menschen ernste Probleme bekommen. Wir sollen auch politisch in Schubladen denken: Unsere Meinungsvielfalt kann unmöglich von der kleinen Anzahl der politischen Parteien vertreten werden, zwischen denen wir uns entscheiden müssen.
Spätestens wenn nach den Wahlen Koalitionen zwischen gegensätzlichen Parteien eingegangen werden, fühlen sich die Wähler betrogen. Es stellt sich dann heraus, dass man trotz der oft schon geringen Auswahl von nur zwei oder drei Wahloptionen am Ende doch nur eine Wahl hatte. Große Koalitionen stellen sich dann als Ein-Partei-System heraus, die nicht mehr die Meinungsvielfalt der Bevölkerung vertreten. Die Wahl an sich wird damit ad absurdum geführt. Aber auch die Tatsache, nur etwa alle vier Jahre bei einer Wahl politisch mitbestimmen zu dürfen, kann nicht als große demokratische Einflussnahme gelten. Sich so selten zu entscheiden geht an der Praxis der Gesellschaft vorbei. Jede angebliche oder tatsächlich Demokratie zelebriert sich bei Wahlen in sehr großen Abständen von mehreren Jahren. Nur in diesen mehrjährigenIntervallen dürfen die Bürger mitbestimmen! Doch diese groben Zeitraster ermöglichen nur einen Eindruck von Mitbestimmung. Kurzfristige Volksabstimmungen sind seltene Ausnahmen und womöglich auch nur eine Strategie zur Ruhigstellung der Bevölkerung, wenn sie dabei nur über unbedeutende Dinge entscheidet. Wirkliche Demokratie, also tatsächlich die direkte Regierung eines Staates durch seine Bevölkerung, ist bis heute ein unerreichtes Ideal geblieben. Viele Wähler resignieren angesichts ihres geringen politischen Einflusses und verzichten auf ihr Wahlrecht, werden demokratieträge oder sogar demokratiefeindlich.
Aber auch Konsumenten wählen wiraus einem großen Angebot von Waren. Die scheinbar individuelle Auswahl wird dabei durch bestimmte Produktkategorien oder auf andere Weise vereinfacht. Unser Konsumverhalten wird dann nicht nur über das Was?, sondern auch über das Wo?, Wie oft? und Wie teuer? aufgezeichnet. Der Verbraucher tappt heute dabei manchmal unfreiwillig, aber oft sogar freiwillig in die Überwachungsfalle: mit PayBack-Cards, beim Kreditkarteneinkauf oder Käufen über Smartphones und mit ähnlichen Kontrollinstrumenten.
Im Internet geschieht dies fast unbemerkt und ganz automatisch beim jedem Online-Shopping: Unpersönliche Algorithmen erstellen über uns Benutzerprofile und teilen uns dabei in Konsumenten-Schubladen ein. Diese sagen dann über uns aus, ob wir es wert sind bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder wie kreditwürdig wir sind. Es wurden schon Kontrollinstrumente entlarvt, die eindeutig rassistische oder sexistische Kriterien bei der Beurteilung anlegten.
Aber auch in sozialen Bereichen, die noch nicht automatisiert sind, wird durchaus mechanisiertes Denken und unkreatives Schubladendenken angewendet. Der Mensch denkt gern einfach, denn das Gehirn verbraucht viel Energie. Ökonomisch zu denken brachte daher in der Evolution gewisse Vorteile, wenn der größte Teil der Bevölkerung angepasst oder in sehr einfachen Bahnen dachte.
Auch der Arbeitsmarkt kennt nur ganz bestimmte, oft viel zu wenige Berufsbilder. Bewerbungen werden dementsprechend in Kategorien eingeteilt, bewertet und ausgewählt. Oft geht es nur noch darum, ob bestimmte Fähigkeiten in Form von standardisierten Schlüsselwörtern genannt werden. Wo das noch nicht automatisiert geschieht, beurteilen Personal-Experten andere nach bestimmten Schlagwörtern, die in ihrem Lebenslauf, in ihren Zeugnissen oder im Bewerbungsgespräch auftauchen. Schublade auf, Mensch hinein, Schublade zu!
Auch Ärzte diagnostizieren unsere Krankheiten nach bestimmten Kriterien und kategorisieren sie nach Checklisten, ähnlich einer Fahrzeug-Inspektion. So funktioniert wissenschaftliches Arbeiten, aber ebenso ökonomische Arbeit, wie sie der Taylorismus seit über hundert Jahren lehrt. Doch so bleiben manche Erkrankungen oder deren Ursachen unentdeckt. Menschliche Faktoren entziehen sich oft einer rein ökonomischen Beurteilung.
Der Wohlstand der Reichen wurde in den letzten Jahrzehnten mehr als je zuvor auf den Schultern der Ärmeren aufgebaut. Der Unterschied zwischen Arm und Reich war weder in der Steinzeit noch in der Antike oder im Mittelalter so groß wie heute weltweit. Abgesehen davon, dass es immer noch Sklaven gibt, arbeiten außerdem heute mehr Lohnsklaven als je zuvor. Also Menschen, denen nichts anderes übrig bleibt, als für das eigene Einkommen und das ihrer Familie auf praktisch alle Rechte zu verzichten. Es ist eine Kaste, die dem Sklaventum sehr nahe kommt, oft noch schlechter gestellt als die Kaste der „Deltas“ in Huxleys Roman oder der „Vierer“ in „Achtzig Jahre danach...“. Eine Haushaltshilfe in Singapur, einem der reichsten Staaten der Welt, verdient im Monat etwa 400 Singapur-Dollar, was derzeit etwa 250 Euro entspricht. Dafür stehen diese Hausbediensteten von früh bis spät dem Arbeitgeber zur Verfügung und wohnen in fensterlosen Zehn-Quadratmeter-Zimmern. Der Vergleich zur Sklaverei ist daher naheliegend.
Kasten und Schubladen erleichtern den Umgang mit der schematisierten Ware Mensch. In Schubladen zu denken erleichtert es uns aber andererseits, wesentlich schneller oder überhaupt den nächsten Schritt zu tun. Auch wenn es nicht immer der richtige ist. Somit gehören Kasten und Schubladen mehr denn je zu unserem heutigen Alltag. Standardisierte Menschen ermöglichen noch genauere Vorhersagen und damit eine präzisere Kontrolle der Bevölkerung. Wenn zwischen exakt definierten Kasten keine wahrnehmbaren Zwischenstufen mehr auftauchen, gibt es auch keine unklaren Entscheidungen mehr über die Kastenangehörigen. Heute entscheiden meistens Algorithmen aufgrund unseres Konsumverhaltens, wie wir eingestuft werden und in welche Konsumentenkaste wir daher gehören. Der Konsum wird im neueren Roman „Achtzig Jahre danach...“ noch stärker betont. Die Kasten wurden zur Unterstützung der Geschichtsfälschung in dem weiterführenden Roman umbenannt.
Zentralisierung
Huxley hat einen ausgesprochen zentralisierten Staat beschrieben, angeführt von einer kaum wahrnehmbaren Regierung, die ihre Marionetten auf kaum bekannte Weise steuert. Extreme Beispiele von Zentralisierung fand und findet man in in der ehemaligen UdSSR und in China. Die Verwaltungsapparate dieser Regierungen blähten sich auf, machtensieoft träge und undurchsichtig in ihren Entscheidungen. Einige Entwicklungen wurden dadurch völlig unmöglich. Übermäßig viel Personal war in der Verwaltung gebunden statt es in der Produktion dieser Staaten einzusetzen.
Ähnlich war es auch in vielen staatlichen oder öffentlichen Betrieben der so genannten kapitalistischen Länder. Administrative Hoheitsgebiete wie zum Beispiel die Europäische Gemeinschaft oder die Bundesrepublik Deutschland spürten die negativen Auswirkungen von zunehmender Zentralisierung immer mehr. Die Probleme sollten durch eine wirtschaftliche Liberalisierungswelle gelöst werden. Als Wundermedizin gegen kränkelnde Bilanzen sollte jetzt die Privatisierung viele öffentliche und staatliche Betriebe sanieren: Bahn, Post, Telekommunikation, Autobahnen, Fernsehen, Krankenhäuser, die Energieversorgung und viele andere Bereiche waren davon betroffen. Versprochen wurde die Beseitigung alter Probleme, allein durch die Abgabe der Verantwortung in private Hände. Die Anhänger des Taylorismus überzeugten viele, die es nicht besser konnten. Eine sich selbst regulierende, denkende Marktwirtschaft sollte sowohl die Misswirtschaft wie auch die sozialen Probleme in diesen Betrieben aus der Welt schaffen. Gelöst wurden die Probleme damit aber nicht. Auf der anderen Seite wurden den Konsumenten erheblich bessere Leistungen für weniger Geld versprochen, was in einigen Fällen auch zunächst zutraf, aber nicht für immer oder für lange Zeit. Der nur wenige Jahre lange Kampf auf den geöffneten Märkten ruinierte viele kleine und mittlere Unternehmen und verbesserte dafür die Chancen und Umsätze von Großkonzernen und Kartellen.
Leider förderte der Konkurrenzkampf der Unternehmen oft überhöhte Werbeversprechen und provozierte viele verbraucherrechtliche Probleme wie Knebelverträge. Mittelfristig entstanden immer größere Monopol-Betriebe. Es gab auch illegale Absprachen, eingeschränkte Verbraucherrechte und verdeckte Kartelle. Die Auswirkungen waren oft nicht besser als die einer schlechten Planwirtschaft. Besonders in Demokratien erlagen immer mehr Politiker den Angeboten der neuen Konzerne und entschieden, statt eine gewisse Grundversorgung in den Händen des Staates zu behalten, sie an große Privatfirmen zu veräußern . Der Kampf gegen ursprünglich zu viel Bürokratismus war bald in einen Kampf gegen Kartelle umgeschlagen. Diese Kartelle trugen, auf Grund ihrer Größe, führten ebenfalls wieder zu viel Bürokratie und zu einen überbezahlten und verantwortungslosen Wasserkopf an Managern an ihrer Spitze.
Vorteile waren für die Bürger durch diese Art der Zentralisierung immer weniger zu spüren. Gescheitere private Konzerne hinterließen häufig einen Scherbenhaufen an ruinierten Strukturen und Märkten, wenn sie Konkurs gingen. Bereiche, die wichtig für die Versorgung der Bevölkerung waren, mussten dann vom Staat wieder aufgebaut werden. Die Rechnung zahlten, wie so oft in solchen Fällen, die Bürger über ihre Steuern.
Ein weiteres Instrument der Zentralisierung ist das Internet, obwohl dieses inzwischen fast überall erhältliche Medium ja oft genaue Gegenteil suggeriert. Von Zentralisierung muss man im Internet deswegen sprechen, weil man von wenigen Dingen abhängig gemacht wird, wenn man es benutzt.
Es ist ein Medium, in dem man oft nur eine Suchmaschine, nur ein Nachschlagewerk benutzt. Und auch der Konsum läuft über nur wenige Verkaufsplattformen, und es werden immer weniger. Wer glaubt, bei Ebay von einem unabhängigen Händler gekauft zu haben, wundert sich oft über das Amazon-Paket, das er einen Tag später erhält. Auch die Auswahl und die zahlreichen Vergleichsmöglichkeiten sind inzwischen viel mehr eine Illusion geworden, als es die meisten Internetnutzer glauben. Und das Schlimmste daran ist die erstaunlich dichte Überwachung der Konsumenten. Huxley wäre nicht darauf gekommen! Sogar Konsumverweigerer entgehen dieser Überwachung nicht, wenn sie das Internet nutzen, um sich zu informieren. Autoritäre Staaten missbrauchen das Internet natürlich, um die Bevölkerung zu überwachen.
Die breite Anwendung eines solches Mediums auf die Bevölkerung hatte Huxley noch nicht einmal in Erwägung gezogen. Damals gab es bestenfalls erste seltene Denkvorstöße in diese Richtung, aber noch keine praktischen Ansätze. Huxleys Einwand, dass Menschen nicht das in vielen Utopien dargestellte Ameisenverhalten besitzen, sondern viel mehr ein eher lockeres Herdenbewusstsein zeigen, ist absolut richtig. Wir funktionieren nicht wie Insektenstaaten. Wir suchen, mit Ausnahme von Einzelgängern, den Anschluss an eine mehr oder weniger große Gruppe. Dieses Herdendenken wird von denen, die heute die Medien kontrollieren, genutzt. Das hohe Ideal des Individualismus wird dabei oft betont, damit man das falsche Gefühlder freien Entscheidung behält und weniger wahrnimmt wie sehr man beeinflusst wird. Dies wird durch freiwillige Selbsteinordnung in Gruppen, quasi Herden, genutzt: „Schau, was deine Herde heute tut, wo sie hingeht, was sie kauft, was sie mag - auch liken genannt. Deine Herde ist nett zu dir, in der Herde macht alles mehr Spaß, sei nett zu ihr, empfehle ihr Produkte, die sie kaufen soll oder gibt ihr Tipps, damit sie zusammen bleibt und vor allem: Folge deiner Herde!“ Diese Herde zu dirigieren ist für die im Hintergrund arbeitenden Administratoren des Internets ein Leichtes. In der Summe ist es egal, ob ein Ameisenstaat aus drei Sorten Ameisen, aus fünf Kasten einer „Schönen neuen Welt“, aus zwanzig Konsumentenkategorien oder aus ein Tausend Gruppen eines sozialen Mediums besteht. Diese Gruppen sind leichter steuerbar als Individuen und deren Verhalten dann mitunter so leicht vorhersehbar wie das von Ameisen.
Eine weitere Eigenschaft, die Huxley Menschenmengen in seinem Buch „Dreißig Jahre danach“ (“Brave New World Revisited“) nachsagt, ist die Herdenvergiftung, wie er sie nennt. Als Herde reagiere der Mensch erheblich irrationaler und sei rein emotionalen Anspornen viel leichter zugänglich. Somit bekomme der Manipulator noch mehr Fäden zur Steuerung einer Gruppe in die Hand. Auch das scheint die Geschichte zu bestätigen. Menschen können sich offenbar nur schwer gegen diese Art zentraler Steuerung wehren. Erinnern wir uns an den Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 und seine Ursache, nämlich mediengestützte Volksverhetzung.
Propaganda in Demokratien und Diktaturen
Beides hat Huxley in “Brave New World Revisited“ in zwei Abschnitten abgehandelt. Trotz noch vorhandener Unterschiede in der Propaganda sind diese aber in Demokratien und Diktaturen erheblich geschrumpft und inzwischen kaum noch zu unterscheiden. Zum großen Teil hat dies mit der so genannten Globalisierung der Medien zu tun, insbesondere dem Internet, das in Demokratien ebenso wie in Diktaturen zur Verfügung steht. Die Medien ähneln sich heute in praktisch allen Ländern in ihrer äußeren Erscheinung. Oft unterscheiden sie sich aber im Inhalt, außerdem ist der Zugang zum Medium nicht für alle gleichermaßen möglich. Der Eindruck, sich selbstbestimmt objektive Informationen zu beschaffen, bleibt aber in den meisten Ländern erhalten. So lange der Konsument nicht bemerkt, wie seine Anfragen gefiltert und gelenkt werden, wird er zufrieden mit den Resultaten sein. Durch gezielte Einspeisung oder Filterung bestimmter Inhalte können natürlich enorm unterschiedliche Wirkungen erzielt werden.
Im Gegensatz zu solchen Propagandaeinflüsterungen totalitärer Staaten steht ein ganz anderes Ziel: In einigen demokratischen Staaten wird versucht solche Manipulationen aufzudecken und zu unterbinden. Leider geschieht dies auch in Demokratien noch zu selten und ist häufig nicht ausreichend möglich. Einerseits, weil es das schnelle Wachstum des Internets erschwert, andererseits, weil falsch verstandene Liberalität oder hohe Kosten dem entgegen stehen. Somit schleicht sich politische Propaganda ebenso wie Konsumpropaganda auch in das Internet demokratischer Staaten ein.
Wie wirksam beeindruckende Bilder sein können, haben gleichermaßen Goebbels, Huxley, heutige Despoten und die Betreiber des Internets erkannt. Im Dritten Reich wurden die ersten pompösen und bildgewaltigen Propaganda-Shows veranstaltet. Der demokratisch gewählte, aber autoritär regierende russische Präsident Wladimir Putin hat pompöse Olympiaden austragen lassen und eine Art von „Putin-Jugend“ aufgestellt, die ihn in den Medien feiert. Damit eifert er der Manipulation von Nachrichten der Propaganda des Dritten Reiches erschreckend nach. Huxley hat die Wirkung des damals schnell wachsenden Mediums Kino als Opium für’s Volk erkannt und in seiner Dystopie treffend angewendet. Zusätzlich werden in Huxleys Vision in den Fühlkinos weitere Sinne angesprochen. In „Achtzig Jahre danach...“ wurden diese Kinos sogar weiter entwickelt.
Die breite Bevölkerung wird in Huxleys „Schöner neuer Welt“ praktisch gar nicht mehr über Printmedien gebildet oder informiert. Statt dessen dominieren einfache Slogans und anschauliche Bilder. Unsere modernen Medien verfahren ganz ähnlich: Im Internet wie im Fernsehen, was inzwischen fast das Gleiche ist, werden immer mehr kurzweilige, anschauliche und emotional einprägsame Bilder gezeigt, zunehmend im Filmformat. Dabei werden immer mehr Sinne sowie die Gefühlsebene angesprochen. Sich kritisch mit der tatsächlichen Realität zu befassen, wird immer schwerer und scheint auch von vielen Zuschauern immer weniger gewünscht zu sein. Sich von der Wirklichkeit zu entfernen scheint in Huxleys Dystopie, wie inzwischen auch heute, mehr Befriedigung hervorzurufen.
Auch die Manipulation des Egos durch Internet und Medien hat Methode. So haben die Kanäle größeren Zuspruch, die das Selbstwertgefühl des Users am meisten steigern, was teilweise zu einer völlig unrealistischen Selbstüberschätzung und sozialem Realitätsverlust führt. Jeder hat schon Beispiele erlebt, in denen ganz offensichtlich sehr dumme und weltfremde Menschen mit unglaublichem Selbstbewusstsein ihr Können oder ihr Aussehen vielfach besser einschätzen als das anderer. Solche Personen sind zufrieden und werden nicht wegen Zweifeln an sich selbst oder am System in deprimierte Passivität verfallen, sondern brav als Arbeitskraft und Konsument weitermachen.
Die Gleichschaltung der Massen wurde schon lange über die vorhandenen Kommunikationskanäle und später über die Massenmedien und das Internet versucht. Nur an sehr wenigen Stellen der Erde ist es bisher gelungen, das Internet völlig abzuschirmen, zum Beispiel in Nordkorea. Doch auch in solchen Ländern sickern äußere Informationen, Weltanschauungen und Werte zu den Bürgern und Konsumenten durch. Wenn die Auswahl an Informationen groß genug ist, gelingt es dem meisten Menschen sich eine eigene Meinung zu bilden, so zum Beispiel auch in China oder in der Türkei. Somit haben heute Menschen weltweit doch eine recht ähnliche Einschätzung, was Gerechtigkeit, Menschenrechte und gesellschaftliche Grundwerte betrifft. Es gibt dabei noch große lokale Unterschiede und viele Menschen können noch nicht aktiv an der Definition dieser Werte teilhaben. Trotzdem sind sich dich die Menschen der Welt über bestimmte ethisch-moralische Grundbegriffe noch niemals in der Geschichte so einig gewesen wie heute. Dafür sprechen viele Protestbewegungen, Aufstände und Revolutionen, die seit Beginn des Jahrtausends stattfanden und sich auf diese nun weltweiten Wertvorstellungen stützen. Die Machthaber in autoritären Staaten versuchen solche Gefahren einzudämmen, indem sie die Kommunikation im Internet und in der Telekommunikation überwachen. So werden Verdächtige gefunden oder das Internet und Mobilnetze rechtzeitig abgestellt. Da es den modernen Telefonen aber möglich ist untereinander per Bluetooth oder WLAN über kurze Distanzen Informationen auszutauschen, kann damit auch in unfreien Ländern unentdeckt kommuniziert werden, oft sogar verschlüsselt. Kontrollmaßnahmen der despotischen Herrscher werden so umgangen. In so genannten Mesh-Networks schließen dann Programme wie Briar oder Bridgefy alle Nutzer in der Nähe zusammen, was im Roman „Achtzig Jahre danach...“ auch ein Rolle spielt.
Ebenso sollten wir hoffen, dass sich das Internet gegen zivilisationsfeindliche Lobbyisten, wie zum Beispiel die Terror-Organisation „Islamischer Staat“ verteidigen kann. Der Schutz des Weltkulturerbes, kann nur durch weltweit wachsenden Respekt und dem Interesse daran, unterstützt werden. Huxley deutet im Roman an, dass in einer Art von „Kulturrevolution“, eine gründliche Säuberung von unerwünschten Kulturgütern aus der Vergangenheit der „Schönen neuen Welt“ stattgefunden habe. Diese Gesellschaft scheint danach fast völlig frei zu sein von Hinweisen auf Werte oder Wissen aus vergangenen Kulturen. Nur wenige Artefakte oder Indizien existieren noch in den Reservaten oder in den Arbeitszimmern weniger Privilegierter, wie den Weltaufsichtsratsmitgliedern. Diese werden dann oft als abschreckende Beispiele präsentiert, die dann mit der Schulpropaganda der „Schönen Neuen Welt“ Hand in Hand gehen. Nur wenige Errungenschaften, wie die Fließbandfertigung, wurden mit religiösem Eifer aus der Vergangenheit übernommen. Die gezielte Auswahl von Episoden und Anekdoten der Geschichte und auch die Geschichtsfälschung werden ebenfalls von totalitären Systeme als Werkzeuge eingesetzt.
Gehirnwäsche und Konditionierung
Seit den Experimenten von Pawlow waren nicht nur jedem Psychologen, sondern auch vielen Verkaufsexperten die interessanten Zusammenhänge dieser Versuche bekannt. Verkauf soll hier als weit gefasster Begriff verstanden werden, denn im weitesten Sinne, verkaufen auch Propagandisten, Sektenführer, Politiker und sogar Lehrer ihre Produkte.
Der Schlüsselreiz war im Fall von Pawlows Hund ein Klingelton, er kann aber durch andere bewusste oder unbewusste Sinnesreize ersetzt werden. Viele Religionen nutzen diese Effekte ohne den Wirkungsmechanismus jemals systematisch untersucht zu haben. Bestimmte Symbole, Farben, Gebete, Gerüche oder Rituale verursachen, bei routinierter Einübung, bei Menschen massive körperliche und emotionale Reaktionen.
Hilfreich ist dabei in Huxleys Schöner Neuen Welt die Fixierung auf das Ford’sche T-Symbol oder pseudo-religiösen Rituale, wie Eintrachtssitzungen. In der Konsumwelt funktioniert das durch Markenlogos, musikalische Werbe-Eintrichterungen und ähnliche Verfahren ebenso gut. Das wusste man schon zu Huxleys Zeiten. Heute ist es noch schwerer geworden sich diesen Wirkungen zu entziehen, da wir fast ständig durch Werbemedien erreicht werden können.
Erstaunt kann man als Leser der „Schönen Neuen Welt“ feststellen, dass trotz der Erziehung zur Zufriedenheit und Bescheidenheit, Statussymbole für die Menschen immer noch wertvoll sind. Statussymbole als solche zu erkennen und auf eine bestimmte Weise darauf zu reagieren scheint eine Frage der Erziehung zu sein. Gegen Statussymbole sind die Bürger der „Schönen Neuen Welt“ also nicht immun und sie wurden sogar gezielt als Werkzeug benutzt, den Willen der Menschen zu steuern. Die im Roman beschriebene Orientierung an Statussymbolen, insbesondere in Form von beruflichen Positionen und dem Status mit Prominenten bekannt zu sein, öffnet sogar ein gewisses Potenzial zum Klassenkampf. Bis heute konnte sich noch kein Staat von Statussymbolen befreien. Es hat sicher auch noch niemand ernsthaft versucht und Statussymbole scheinen als eine Art von Reviermarke von den Menschen selbst gerne genutzt zu werden. So zeigt man, was man hat oder wo man steht.
Die offenen und unterschwelligen Manipulationsversuche von Lobbyisten rechne ich ebenfalls zu den modernen Techniken der Konditionierung. Das ist der Fall, wenn beispielsweise religiöse Interessengruppen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio, kostenlose Sendezeiten bekommen, um auf angehörige anderer Religionen und auf Atheisten Einfluss zu nehmen. Dies sind dann eindeutig Konditionierungsmaßnahmen. Auch die Vorstellung neuer Technologien in den Medien soll häufig die öffentliche Meinung positiv beeinflussen und womöglich Kritik abschwächen oder sogar Börsenkurse manipulieren.
Chemische Beeinflussung
Schon seit Jahrhunderten werden bei Verhören oder zum Erpressen von Geständnissen Drogen verabreicht. Freiwillig eingenommene Volksdrogen, wie Alkohol, Tabak, Medikamente oder Kokablätter haben zwar weniger starke Wirkungen, aber sie sind weit verfügbar. Sie werden also viel häufiger angewendet und sind oft auch noch legal. In der Summe sind deren negativen Folgen für Gesundheit und Volkswirtschaft noch größer als die Schäden durch harte oder „schmutzige“ Drogen, zum Beispiel wie Heroin. Aufputsch- oder Beruhigungsmittel, oft in Form von Tabletten, mussten lange Zeit durch Ärzte verordnet werden. Sie nehmen eine mittlere Stellung zwischen harten und weichen Drogen ein, auch was ihren Ruf betraf. Psychopharmaka wie Ritalin, Prozac oder Antidepressiva waren ursprünglich nur Mittel die man entweder therapeutisch mehr oder weniger „Bekloppten“ verabreichte. In der modernen Leistungsgesellschaft haben diese Mittel jedoch inzwischen einen gewissen Aufstieg erlebt. Freiwillig oder mit etwas Überredungskunst gegenüber ihrem Arzt lassen heute viele Berufstätige diese Drogen, sich oder ihren Kindern verschreiben, auch ohne Krankheitsdiagnose. So werden der Arbeitsalltag oder die Schule erträglicher oder man kann dort mehr leisten. Ob dadurch, wie bei Huxley, die „Lebensuhr“ mit dem sechzigsten Lebensjahr abläuft, hängt sicher auch davon ab, wie intensiv die Drogen missbraucht werden, Doch der Vergleich dazu ist berechtigt, denn jede Droge hat ihren Preis für die Gesundheit.
Überwachungsstaat und Denunziantentum
Die gefühlte Freiheit der Einzelnen wird in den so genannten demokratischen Staaten immer größer. Allein die Möglichkeit bei nahezu allen Handlungen mehr Auswahloptionen zu erhalten wird von vielen als Freiheit und Fortschritt empfunden. Die Diskussion, ob das Ein oder das Andere nur gefühlte Freiheit oder tatsächliche Freiheit bedeutet, scheitert regelmäßig an der philosophischen Definition des Begriffes Freiheit. Allein die Möglichkeit vieler Millionen Menschen in fast jede Region der Erde reisen zu können, bedeutet für diesen Teil der Erdbevölkerung durchaus mehr erlebte Freiheit sprechen. Doch was uns in der Werbung als Freiheit verkauft wird, birgt die Gefahr, dass die Menschen heute wieder viel von ihrer Freiheit einbüßen können. Heute ist es leichter als je zuvor die ganze Erde zu bereisen, viele Vorgänge auf der Welt zu beobachten oder Geldtransfers und die Aufenthaltsorte anderer Menschen zu überwachen. Ermöglicht wird dies besonders durch die gefühlte Freiheit der Nutzer moderner Medien, wie dem Internet. Spielerisch motiviert durch bestimmte Anreize, geben Smartphone-Benutzer ihren Standort oder ihre täglichen Wege preis. Wer das nicht freiwillig tut, kann trotzdem mit einem normalen Handy einer Standort-Ortung unterzogen werden und zwar nicht nur durch die Polizei.
Auch das Denunziantentum erlebt eine erneute Renaissance, die vergleichbar ist mit der Zeit der Inquisition. Besonders deutlich wird das in Staaten die zum Anfang des dritten Jahrtausends von Demokratien zu Diktaturen oder Autokratien abrutschten, Russland, Ungarn, Weißrussland, die USA unter Trump oder die Türkei 5. Doch in den so genannten sozialen Netzwerken ist es leicht geworden, sogar in freien Staaten, andere zu denunzieren ohne bestraft zu werden. Das können auch Staaten für eigene Interessen ausnutzen. Die Bewohner der „Schönen Neuen Welt“ sind auf eine gewisse Weise zwar kultiviert und domestiziert, die sensationslüsterne Bestie des finstersten Mittelalters lauert aber immer noch in ihnen. Das zeigt sich, zum Beispiel im Tratsch über die Gerüchte und den Rufmord um die Alkoholschädigung des Embryos von Sigmund Marx in Huxleys Roman. Und auch achtzig Jahre danach haben sich die Menschen in dieser Hinsicht nicht geändert. Im aktuellen Roman finden es viele Bürger unterhaltsam und zufriedenstellend, wenn sie Videos anschauen in denen andere Personen scheitern.
Was Huxley nicht ahnen konnte – wir hängen im Netz
Aus Huxleys Sicht betrachtet wäre vielleicht eine der schrecklichsten Erfindungen das Internet. Schwer vorhersehbar waren damals die Entwicklungen in kabelloser Elektronik und in der Mikrotechnologie. Der kostengünstige Zugang zu kabellosen Telefonen war Ende des 20. Jahrhunderts nur der erste kleine Schritt, der zweite größere Schritt sind die vielfältigen Spielarten mobiler Kommunikation. Wenn in der „Schönen neuen Welt“ Feline bei ihrem Unfall im Reservat per Handy hätte Hilfe holen können, wäre das in jedem Roman viel zu einfach für eine dramaturgisch wertvolle Handlung gewesen. Viel interessanter erscheint die heutige Möglichkeit sich an fast jedem Ort auf der Erdoberfläche per GPS orten zu lassen. Dies machen heutige Konsumenten oft recht pragmatisch zur bloßen Orientierung oder mehr oder weniger spielerisch mit GPS-basierten „Apps“, die den Standort oder eigene Sportaktivitäten in sozialen Netzwerken oder auf Internetplattformen veröffentlichen. Absichtlich geschieht die Ortung per GPS durch den Einbau der entsprechenden Technologie in Kraftfahrzeuge oder andere Gegenstände, die gestohlen werden können. Natürlich ist dies auch mit Menschen möglich. Aktuell lassen sich schon Freiwillige einen Chip implantieren, der ihnen im Alltag bei persönlicher Identifikation, beim bargeldlosen Bezahlen oder dem Öffnen der eigenen Wohnungstür, behilflich sein soll. Das öffnet Möglichkeiten den Chipträger von außen zu überwachen und mitunter zu kontrollieren. Weltweite Ortung und die globale Kommunikation sind sicher die größten Einflüsse, den die bisherige Raumfahrt auf unser tägliches Leben hat. Mehr als jede Teflonpfanne.
China hat 2018 das Überwachungsinstrument des „Sozialkredits“ oder „Social Score“ eingeführt. Zunächst nur als Pilotprojekt, doch die landesweite Einführung wird inzwischen schrittweise voran getrieben. Ein Punktesystem das erwünschtes und unerwünschtes Verhalten bewertet, soll aus den Chinesen bessere Menschen machen. So können sich schon mehrere kleinere Lappalien, wie Hundekot auf dem Gehweg, zu einem ewigen Hindernis aufbauen, für bestimmte berufliche Karrieren oder bei der die Erlaubnis Kinder zu bekommen. Auch Konsum wird mit diesem System bewertet. In „Achtzig Jahre danach“ hat die Gesellschaft, den Bürgerindex und die Konsumpunkte eingeführt, die genau diese Idee widerspiegeln.
In der schönen neuen Welt hat Huxley seine Figuren in bedrückender Weise messbar gemacht und durch einen staatlichen Zahlenkult terrorisiert. Die Effizienz und die Konsumlaune von Menschen messbar zumachen ist aber auch die Dokrin des Taylorismus, der seit der 1930er-Jahren einen erschreckenden Aufschwung erlebt hat. Ich halte es für möglich, dass schon Huxley dies bereits mit seinem Roman kritisieren wollte. In „Achtzig Jahre danach...“ lebt dieser Zahlenkult auch in der Gesellschaft das Romans noch stärker fort.
Wenn sich Huxleys schöne neue Welt in wenigen Jahren erheblich verändert hätte, wäre sie sich selbst nicht treu geblieben. Beständigkeit war in seiner schönen neuen Welt Prämisse, schnelle und offensichtliche Veränderung war dort unerwünscht. Huxley hat 27 Jahre nach seinem Roman mit „Brave New World Revisited“ eine ernüchternde Zwischenbilanz unserer Welt gezogen.
Hätte die Welt in Huxleys Roman aber dreimal soviel Zeit gehabt sich zu verändern, wären die Veränderungen weniger wahrnehmbar gewesen. Kenner von Huxleys Meisterwerk werden diese Unterscheide der alten schönen neuen Welt zur Gesellschaft im aktuellen Roman „Achtzig Jahre danach...“ sofort erkennen. Die Veränderungen in „Achtzig Jahre danach...“ zu Huxleys „Schöner Neuen Welt“ sind zum Teil erheblich, teilweise aber auch nur unwesentlich. Der neue Roman soll nicht als zweiter Teil von Huxleys Romans verstanden werden. Eine Fortsetzung hätte Huxley persönlich in den drei Jahrzehnten nach dem Roman schreiben müssen, um authentisch nah am Original zu bleiben. „Achtzig Jahre danach...“ ist als Alternative von vielen denkbaren Alternativen zu verstehen, eine gesellschaftliche Fantasie, die mit Hilfe der heute greifbaren Möglichkeiten geschaffen wurde, die aber in den 1930er Jahren noch nicht einmal denkbar gewesen war.
Wer erleben möchte, wie sich die hier erwähnten Entwicklungen auf Huxleys „Schöne neue Welt“ ausgewirkt haben könnten, dem empfehle ich meinen folgenden Roman „Achtzig Jahre danach in der schönen neuen Welt" gründlich zu lesen. Der Leser wird darin willkommen geheißen im Jahr 760 Jahre nach den Stock Yards von Chicago, wo die Schlachtung am Fließband erfunden wurde!
Ron Palmer
Diese Einleitung wurde auch als separate Abhandlung veröffentlicht.
Kapitel 1 – Ich bin stolz ein Zweier zu sein
Die schwarze Flaschenreihe klimperte auf der Förderanlage. Putina erinnerte das entfernt an die Geräusche, die sie vor sechs Monaten in den oberen Stockwerken der Schule gehört hatte. Statt in den Pausengarten zu gehen, stieg sie damals die Treppe hinauf bis in die Etage, wo nur die Einser-Kinder der Grundschule unterrichtet wurden. Eine Tür stand offen. Das interessante Klimpern zog Putina unwiderstehlich an, sie ging ihm entgegen und bliebt im Türrahmen stehen. Sie sah einen etwa gleich alten Jungen vor einem hölzernen Kasten sitzen. Er drückte am Kasten auf eine Reihe schwarzer und weißer Tasten und entlockte ihm so die faszinierend klingenden Töne. Am Türrahmen entzifferte sie K-L-A-V-I-E-R-Z-I-M-M-E-R und wollte eintreten. Bohrend durchfuhr sie plötzlich ein automatischer Elektroschock aus ihrem Erziehungshalsband. Das hatte sie noch nie gefühlt, wusste aber sofort, dass dieser Bereich für Zweierinnen wie sie tabu war. Weinend rannte sie in den Pausengarten hinunter. Sie wischte ihre Tränen weg. Niemand hatte ihren Fehltritt bemerkt und sie ging danach nie wieder in die oberen Stockwerke der Schule.
Noch mehr schwarze Flaschen zogen auf dem weißen Förderband an Putina vorbei, während der uniformierte Mann erklärte, dass darin kleine Kinder heranwuchsen. Sie kippte ihren Kopf auf die rechte Schulter. Jetzt sah sie plötzlich vor sich eine endlose Klaviertastatur in der Weite der Bruthalle verschwinden. Das Klimpern war nicht so schön wie das Klimpern, das der Junge mit den Tasten am Klavier gemacht hatte. Sie hielt den Kopf wieder aufrecht und sah erneut die schwarz getönten Brutflaschen mit den zehnwöchigen Embryos darin. Man konnte sie nur gegen das Licht als erdbeergroße Schatten erkennen. Langsamer als eine Schnecke krochen die Brutflaschen auf der Förderanlage vorwärts. Klaviertastatur - Brutflaschen - Klaviertastatur - Brutflaschen, das erkannte Putina vor sich, je nachdem, wie sie ihren Kopf hielt. Die Lehrerin stieß sie unwirsch an: "He, was soll das? Du sollst zuhören, was uns der stellvertretende Klon- und Prägungsdirektor zu sagen hat."Das Mädchen lief rot an. Noch nie zuvor wurde die unauffällige Putina von ihrer Lehrerin zurechtgewiesen. Sie wusste nicht, ob sie vielleicht gegen das Traumverbot verstoßen hatte und spürte Panik. Ihr hatte vorher niemand gesagt, dass sie die Brutflaschen nicht schräg betrachten durfte, und sie hatte dabei doch gleichzeitig dem stellvertretenden Klon- und Prägungsdirektor gehorsam zugehört, wie es von ihr verlangt wurde. An dieser Stelle der Förderanlage wurden die Hormone zugesetzt, mit denen die Körpergröße der späteren Erwachsenen bestimmt wurde.
Obwohl sie gut zugehört hatte, widersprach Putina der Lehrerin nicht. Sie wollte nicht noch mehr auffallen. Seitdem wusste sie, dass sie die Dinge anders wahrnahm, als sie wahrgenommen werden sollten, und mit jedem Monat, den sie älter wurde, spürte sieeinen inneren Widerstand dagegen in sich heranwachsen. Das machte ihr Angst.
Vor noch nicht einmal einem Jahr hatte sie erlebt, wie der siebenjährige Slobodan aus ihrer Klasse abgeholt wurde. Wegen abweichender Prägung, so versuchte es die Lehrerin zu erklären. Putina konnte sich noch daran erinnern, wie er nur einen Tag davor zunächst dem Sport-Lehrer und in der nächsten Stunde auch noch der Einheitskunde-Lehrerin widersprochen hatte. Ziemlich höflich hatte er seine Lehrer auf einen Widerspruch in ihrem Unterricht hingewiesen und ihn sogar als Frage formuliert. Doch Putina hatte Slobodan seitdem nie wieder gesehen.
Sie glaubte jetzt krank zu werden, wenigstens ein wenig. Sie hoffte, dass es nicht so schlimm wie bei Slobodan werden würde und es mit der Zeit von alleine wieder verschwinden werde. So verhielt sie sich weiter unauffällig.
Arnold Wankel goss sich ein großes Glas kaltes Leitungswasser ein, um Klarheit in seinen noch immer dröhnenden Kopf zu bekommen. Er hätte nur ein Gramm Isodol-Zwei nehmen müssen und keine zehn Minuten später wäre er gut gelaunt und voller Elan an seine Arbeit gegangen. Aber Arnold hatte keine Lust auf das neue, aufputschende, schmerzstillende und stimmungsaufhellende Kügelchen. Isodol-Zwei - alle schworen jetzt auf Isodol-Zwei. Und die Psychologen verordneten Isodol-Drei, das medizische Isodol, wenn nichts mehr half. Gaga-Isodol nannten es viele hinter vorgehaltener Hand. Arnold überzeugten auch die neuen Isodol-Sorten nur wenig und mit jedem Tag immer weniger. Wenn er Isodol-Vier nahm, litt er meistens unter dem Gefühl, dass es irgend einen wichtigen Teil seines Gehirns einschläferte statt ihn aufzuwecken. Aber Isodol-Vier sollte doch glücklich und wach machen und nicht glücklich und entspannt wie Isodol-Drei. Vielleicht war das bisher nur ihm aufgefallen, denn er hatte nie jemanden darüber reden hören. Viel angenehmer als Isodol-Vier fand er es, nach einer lauwarmen Dusche einen Spaziergang zu machen und zu spüren, wie sich der Kater des Vortages von allein verzog. Dieser Kater war nicht wirklich schmerzhaft, lediglich ein leichtes Rauschen zwischen den Ohren mit einem leichten Schwindel und keine Folge des Alkohols. Dieser hatte schon lange keine Nebenwirkungen mehr. Es war heute vielmehr ein gestörter Flüssigkeitshaushalt, Muskelverspannungen und der Schlafmangel der langen Neujahrsfeier, die ganze zwanzig Stunden gedauert hatte. Er konnte sich nicht mehr an alles erinnern.
Immerhin wusste er noch, dass nun die Sechzigerjahre begonnen hatten, das Jahr 760 nach Chicago. So hieß die neue Zeitrechnung. Chicaco war für Arnold ein sehr abstrakter Begriff. Er wusste natürlich aus der Nachtschule, dass die Fließbandarbeit damals in den Chicagoer Schlachthöfen erfunden wurde. Es war eben nicht jener Herr Ford, wie dies die Anhänger der Geschichtsfälschung noch viele Jahre lang behauptet hatten. Zum Glück wurde dieser Irrtum in der großen Kulturrevolution vor fast achtzig Jahren korrigiert.
Die Sechzigerjahre begannen jetzt also. Als Kind hatte er bestimmte Vorstellungen über die Zukunft und die Sechzigerjahre waren für ihn immer ferne Zukunft gewesen – unerreichbar fern. Die meisten seiner Vorstellungen der Zukunft stammten aus den Science-Fiction-Filmen, die er in Emo-Kinos erlebt hatte. Er sah dort die gleiche schöne Welt, in der er bereits lebte, jedoch in vielen kleinen Details noch ein wenig perfekter und schöner. An viele seiner damaligen Visionen der Zukunft konnte er sich nur noch verschwommen erinnern. Woran er sich aber jedes Mal ganz deutlich erinnern konnte, war ein dumpfes Gefühl in seinem Kopf, und das nach jedem Kinobesuch, ganz ähnlich wie sein momentaner Kater.
Damals waren die Beruhigungswellen-Emitter noch nicht in allen Emo-Kinos eingebaut. Die Emitter sorgten während der Filmvorführung dafür, dass die Emotionen der Zuschauer nicht zu stark wurden. Niemand sollte zu begeistert, womöglich deprimiert oder nachdenklich das Kino wieder verlassen. Am Anfang funktionierten die Beruhigungswellen-Emitter noch nicht so zuverlässig wie heute. Aber man erzählte sich, wie gefährlich es sein konnte eins der älteren Kinos zu besuchen, die nur schwache Beruhigungswellen-Emitter besaßen. Eines Tages soll nach einem sehr aktionsgeladenen Film ein junger Zweier-Minus geglaubt haben, er könne unverletzt sechs Stockwerke tief auf eine Aussichtsplattform herunterspringen. So hatte er es im Film gesehen. Ein breitschultriger Eins-Plus rettete im Film unzählige Einser, Zweier und Dreier, indem er von Hochhaus zu Hochhaus sprang und dabei blaue Invasoren aus dem Weltall mit bloßen Händen erschlug. Der Zweier starb bei seinem Versuch den Filmhelden nachzuahmen.
Seitdem die Beruhigungswellen-Emitter vorgeschrieben waren, hatte es keinen solcher Unfälle mehr gegeben. Zumindest war keiner mehr bekannt geworden. Gut bekannt war aber jedem die Wirkung der Wellen in Filmen, in denen die Emitter besonders intensiv arbeiteten. Das war immer während sehr emotionalen oder Fantasie anregenden Filmen der Fall. Die Besucher kamen dann angeheitert und entspannt aus den Kinosälen, sodass sie oft noch Stunden danach kein Verlangen nach Isodol verspürten. Die Wellen behindern das Kurzzeitgedächtnis und erzeugen eine sehr zufriedenstellende Euphorie bei den Kinogästen. Sie können dann nicht länger als einige Sekunden über das Erlebte nachdenken und die Erinnerungen an den Film verdunkelten sich in ihrem Langzeitgedächtnis zu Erinnerungen wie aus sehr früher Kindheit. Ein Actionfilm war ein Actionfilm, eine Komödie eine Komödie. Die Kinobesucher wollten gute Unterhaltung und Ablenkung, keine Details, über die sie noch lange nachgrübeln oder sogar streiten mussten. Die Beruhigungswellen-Emitter zerstreuten regelrecht die Gedanken und Erinnerungen.
Science-Fiction wurde in den Emo-Kinos nicht sehr häufig gespielt. Doch Arnold erinnerte sich immer an seine gespannte Neugier am Anfang dieser Filme.Doch je länger die Wellen einwirkten, desto mehr nahm diese Neugier ab. Nur selten konnte er sich nachher an die Handlung in der Mitte des Films erinnern. Meistens blieb ihm die erste Szene im Gedächtnis und vielleicht noch das Happy-End, weil die Wellen am Ende etwas reduziert wurden. So bekam man zwar den Eindruck den Film bei vollem Bewusstsein erlebt zu haben, sich mit anderen über Filme zu unterhalten war dadurch aber nur sehr oberflächlich möglich. Oft blieb es bei einem „Hast du den Film auch gesehen?“ - „Ja, schöner Film.“ Ganz selten mehr.