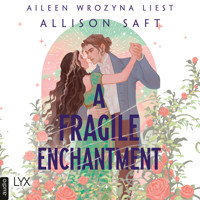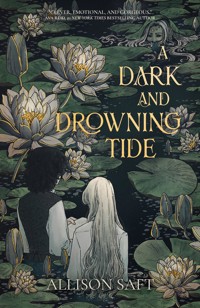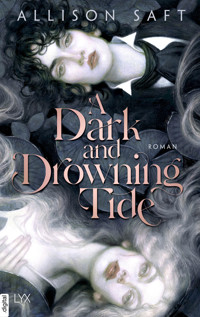
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ich wollte nur, dass du mich ansiehst. Es macht mir Angst. Es ist aufregend. Du bist wie etwas aus einem Albtraum.«
Lorelei Kaskel und Sylvia von Wolff könnten unterschiedlicher nicht sein. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie beide an der Universität zu Ruhigburg als Schützlinge der renommierten Professorin Ziegler studieren. Immer wieder geraten die akademischen Rivalinnen aneinander, doch da ist auch etwas zwischen ihnen, das ihre Herzen bei jedem hitzigen Wortgefecht schneller schlagen lässt. Als sie gemeinsam mit Ziegler und vier weiteren Studierenden zu einer Expedition zum Ursprung, einer sagenumwobenen Quelle, aufbrechen, passiert das Unfassbare: Ziegler wird ermordet, und Sylvia und Lorelei müssen zusammenarbeiten, um den Mörder ausfindig zu machen und die Expedition erfolgreich zu Ende zu bringen ...
»Allison Safts poetische Sprache verbindet sich mit ihrem cleveren Worldbuilding, um uns alle mit dieser atmosphärischen Fantasy voller märchenhafter Erzählungen, packender Intrigen und romantischer Spannung umzuhauen!« THEA GUANZON
Der neue Roman von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Allison Saft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Leser:innenhinweis
Teil eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Teil zwei
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Teil drei
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil vier
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Danksagungen
Die Autorin
Die Romane von Allison Saft bei LYX
Impressum
Allison Saft
A Dark and Drowning Tide
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anne-Sophie Ritscher
Zu diesem Buch
Niemals hätte die angehende Folkloristin Lorelei Kaskel damit gerechnet, dass sie die vom König persönlich ausgerufene Expedition zum Ursprung, einer sagenumwobenen Quelle, mitanführen würde. Sie wird nicht nur von ihrer Mentorin Ziegler, der renommiertesten Professorin der gesamten Universität zu Ruhigburg, begleitet, sondern auch die sogenannten »Ruhigburger Fünf« werden für die Reise einberufen: eine Gruppe adeliger Studierende, zu denen auch Loreleis gleichermaßen irritierende wie faszinierende akademische Rivalin Sylvia von Wolff gehört. Die beiden Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein, denn während Lorelei in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und eine verschlossene Einzelgängerin ist, stammt Sylvia einer royalen Linie ab, ist emotional und impulsiv und besitzt eine natürliche Affinität für magische Wesen. Immer wieder geraten sie aneinander, doch da ist auch etwas zwischen ihnen, das ihre Herzen bei jedem hitzigen Wortgefecht schneller schlagen lässt. Doch kaum brechen sie auf, passiert das Unfassbare: Ziegler wird ermordet, und es liegt an Lorelei und Sylvia, den Mörder zu finden und die Expedition erfolgreich zu Ende zu bringen – und dabei bringen sie nicht nur ihre Leben in Gefahr …
Für Moses, Gilbert und Alexander
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
TEIL EINS
Die Yeva im Dorn
1. Kapitel
Sylvia war schon wieder im Fluss. Lorelei musste sie nicht erst mit eigenen Augen sehen, um sich dessen sicher zu sein. Menschenmengen bildeten schließlich den Rauch um Sylvias Feuer.
Lorelei trotzte dem Wind mit hochgezogenen Schultern und konnte die Abscheu, die in ihr aufstieg, nicht unterdrücken. Im Laufe von nur einer Stunde hatte sich die gesamte Studierendenschaft der Universität zu Ruhigburg am Flussufer versammelt. Sie stritten sich laut rufend und einander anrempelnd um die Plätze, die den besten Blick aufs Wasser boten – oder vielmehr auf das Spektakel, das ihnen versprochen worden war. Wie zu erwarten, hatten die meisten ihre mitgebrachten Weinflaschen bereits geöffnet.
Als sie sich der Menge näherte, sah sie silbernes Glitzern die Hälse umspielen und Eisenketten an den Handgelenken baumeln. Sie trugen ihre Jacken mit dem Innenfutter nach außen und hatten sich Hufeisen um die Hälse gelegt. Einige – zweifellos Sylvias ergebenste Anhänger – trugen Kränze aus Eschenzweigen auf den Köpfen und hatten sich Kleeblätter ins Haar geflochten. Sie rechneten eindeutig mit Blut. Lorelei hatte noch nie in ihrem Leben so viele Schutzvorkehrungen gesehen.
Einfach nur lächerlich. Wennsie sich tatsächlich vor Magie schützen wollten, sollten sie sich vom Fluss fernhalten, anstatt ihn wie Dummköpfe anzustarren. Warum überraschte sie das überhaupt? Gesunder Menschenverstand machte sich normalerweise aus dem Staub, sobald Sylvia von Wolff sich näherte.
Irgendein armer Trottel war angeblich vor einer Stunde beinahe ertrunken – nachdem ihn das Lied einer verirrten Nixe in die abgründigen Tiefen des Flusses gelockt hatte. In Anbetracht der Tatsache, dass seit zehn Jahren keine Nixe mehr in der Nähe der Stadt gesichtet worden war, grenzte das an ein Wunder. Sie hatte belauscht, wie ein Mädchen seine Freunde mit den grausamen Details unterhielt – und wie es mit ekelerregend verklärtem Blick verkündete: »Sylvia von Wolff hat versprochen, die Nixe zu zähmen.«
Lorelei wäre fast auf der Stelle in Flammen aufgegangen.
Lorelei und Sylvia hätten Professorin Ziegler bereits vor einer Viertelstunde treffen sollen – darum hatte Ziegler sie gebeten. Am heutigen Abend richtete der leibhaftige König von Brunnestaad einen Abschiedsball zu Ehren der Expedition aus, und von den dreien wurde ein großer Auftritt erwartet: die hochverehrte Professorin und ihre beiden brillanten Studentinnen. Wenn Ziegler ihretwegen zu spät käme … Nein, darüber konnte sie nicht einmal nachdenken.
Lorelei schob sich durch die Menge. »Aus dem Weg.«
Ihre Worte wirkten unmittelbar. Ein Mann sprang zur Seite und ließ dabei sein Opernglas fallen. Ein anderer schrie auf, als der Saum ihres schwarzen Wintermantels sein Bein streifte. Eine weitere unglückselige Person hatte das Pech, von Lorelei im Vorbeigehen an der Schulter gestreift zu werden und zu stolpern.
Dann hörte Lorelei, wie jemand hinter ihr »Schlange« zischte.
Hätte sie auch nur einen Augenblick zu verschwenden gehabt, wäre sie auf diese Provokation eingegangen. Ab und zu mussten die Leute daran erinnert werden, wie genau sie zu ihrem Namen gekommen war.
Sie drängte sich durch die Menge bis ganz nach vorn und ließ den Blick über das Flussufer schweifen. Selbst im fahlen Licht der Abenddämmerung war das Wasser des Vereist von einem unheimlichen, lichtlosen Schwarz. Der Fluss schlängelte sich wie ein unauslöschlicher Tintenfleck quer über den Campus. Und dort, verborgen in den Zweigen einer Trauerweide, entdeckte sie Sylvia.
Von ihrem Aussichtspunkt aus konnte sie Sylvias Gesicht nicht sehen, sehr wohl aber ihr Haar. Obwohl sie Sylvia seit fünf Jahren kannte, erschrak es sie immer noch – sein reines, totengleiches Weiß. Sie hatte ihre unbändige Mähne im Nacken mit einer blutroten Seidenschleife zusammengebunden, aber ein paar widerspenstige Locken waren entkommen. Lorelei stellte sich in ihren schwachen Momenten manchmal vor, wie es sich wohl anfühlte, dieses Haar zu packen: als würde sie die Hände in kühles Wasser tauchen.
Sie pirschte sich an Sylvia heran. »Von Wolff«, zischte sie, so giftig sie konnte.
Sylvia keuchte und wirbelte zu ihr herum. Sobald sich ihre Blicke trafen, nahm ihr Gesicht den bezaubernden Farbton von saurer Milch an. Einen Augenblick lang erlaubte sich Lorelei, beim Anblick ihrer erschrockenen Miene Freude zu empfinden, ehe Sylvia wieder ihre liebenswürdige Maske aufsetzte. Irgendwie hatte Sylvia sich in all der Zeit nicht daran gewöhnt, verachtet zu werden.
Und oh, wie sehr Lorelei sie verachtete.
»Lorelei!« Die Duellnarbe, die ihre Wange zierte, verzog sich unter ihrem gequälten Lächeln. »Welch angenehme Überraschung.«
Sylvia saß am Flussufer, ihre Füße baumelten im Wasser, und der Damaststoff ihres Abendkleides bauschte sich um sie herum. Die schlammverschmierten Schuhe lagen achtlos neben ihr, und im Schoß hielt sie ausgerechnet eine Gitarre.
Schmerz durchzuckte Loreleis Schläfen. Plötzlich war ihr, als beherrschte sie die brunnische Sprache nicht länger – oder als wäre sie in eine wunderliche Welt versetzt worden, in der man einem der tödlichsten Wesen von ganz Brunnestaad einfach so im Abendkleid gegenübertreten konnte. Andererseits erweckte Sylvia den Eindruck, als hätte sie sich in großer Eile fertiggemacht und wäre dann durch einen Wald gestreift. Den verirrten Blütenblättern in ihrem Haar nach zu urteilen, hatte sie genau das getan. Kirschblüten, wie Lorelei am Rande wahrnahm. Der Frühling war in diesem Jahr früh gekommen, aber eine feuchte Kälte hielt sich wie Fieber, das nicht abklingen wollte.
»Du bist spät dran.«
Sylvia besaß genug Verstand, um zusammenzuzucken, stimmte aber weiterhin ihre Gitarre. »Ich bin mir sicher, dass Ziegler es verstehen wird. Du hast vom Angriff der Nixe gehört, nehme ich an? Irgendjemand musste etwas tun.«
Mörderische Entschlossenheit durchströmte Lorelei. »Das heißt aber nicht, dass du das sein musstest, du arroganter Dummkopf.«
Sylvia schreckte beleidigt zurück. »Entschuldige bitte? Arrogant?«
Lorelei warf einen vielsagenden Blick auf die Menge hinter ihnen – auf die Hunderten Augenpaare, die auf Sylvia gerichtet waren. Sie konnte den Hunger, der in der Luft lag, beinahe schmecken. Lorelei wusste nicht, ob sie hier waren, um Sylvia dabei zuzusehen, wie sie ihre seltsame Magie ausübte, oder um dabei zu sein, wenn ihr Blut das Wasser rot färbte. Es spielte keine Rolle. So oder so würden sie bekommen, was sie wollten.
»Dann bist du also unersättlich«, höhnte Lorelei. »In wenigen Stunden wird dich eine Horde Gratulanten umzingeln, und trotzdem hungerst du nach Aufmerksamkeit.«
Unwillkürlich hatte sich ein bitterer Unterton in ihre Stimme geschlichen. Vor einem halben Jahr hatte Ziegler angekündigt, eine ihrer Studierenden zu ihrer Co-Leiterin der Expedition zu ernennen, und heute Abend würde sie auf dem Abschiedsball ihre Wahl endlich bekannt geben. Lorelei erwartete keinesfalls, ausgewählt zu werden. Mit ihren fünfundzwanzig Jahren war Sylvia bereits eine der berühmtesten und beliebtesten Naturkundlerinnen des Landes. Und Lorelei war ein Niemand, die Tochter eines Schusters aus der Yevanverte.
Und trotzdem hatte sie Träume.
Wenn sie diese Bekanntheit erlangte, würden sich sämtliche Verleger darum reißen, ihre Forschungsberichte zu veröffentlichen. Besser noch, der König würde dazu gezwungen, sie anzuerkennen. Frühere Herrscher hatten Yevani nur als Bankiers und Finanziers am Hof gehalten, aber König Wilhelm umgab sich mit Künstlerinnen und Gelehrten. Lorelei war nicht schön genug, um dem König ihre Herzensangelegenheiten ins Ohr flüstern und glauben zu können, er würde ihr zuhören. Sie besaß weder Charme noch Einfluss, der ihre Feinde dazu bringen würde, sich ihr zu Füßen zu werfen. Alles, was sie hatte, war ihr Verstand. Wenn sie die von ihm beauftragte Expedition mitanführen würde, läge es in ihrer Macht, ihn zu bitten, sie zur Shutzyeva zu ernennen: eine Yeva, die unter dem direkten Schutz des Königs stand.
Sie hatte gelernt, in der Schlangengrube der Universität zu Ruhigburg zu überleben, indem sie die Schlimmste von ihnen geworden war. Aber außerhalb der Universität bedeutete ihr Ruf nichts. Als Shutzyeva stünden ihr die vollen Rechte einer Bürgerin zu. Dann könnte sie unbehelligt und unangreifbar außerhalb der Mauern der Yevanverte leben. Sie könnte ihren direkten Kontakt zum König nutzen, um sich für ihre Leute einzusetzen. Aber ihr geheimster, egoistischster Wunsch war einfach. Als Bürgerin wäre sie in der Lage, einen Pass zu besitzen, ihre Eintrittskarte in eine Welt, von der sie bislang nur gelesen hatte. Das war alles, was sie sich jemals gewünscht hatte, die einzige Sache, nach der zu sehnen sie sich erlaubt hatte: die Freiheit, eine echte Naturkundlerin zu sein.
Im Laufe seiner kurzen Regentschaft hatte Wilhelm niemanden zur Shutzyeva ernannt. Es war eine äußerst seltene Ehre – von der sie sicher war, sie sich verdienen zu können.
»Es geht mir nicht um Aufmerksamkeit«, sagte Sylvia verärgert. »Ich bin hier, um …«
»Um unsere Zeit zu verschwenden«, unterbrach Lorelei sie brüsk. Sie hatte im Laufe der Jahre zu viele Vorträge über die Pflichten des Adels ertragen müssen, um Sylvia einfach so fortfahren zu lassen. »Meine, Zieglers … und auch die Seiner Majestät. Du hast dich mit deiner Forschung viel zu lange als fahrende Ritterin aufgespielt. Es ist höchste Zeit, dass du deine Verantwortung gegenüber der Expedition ernst nimmst.«
Sylvia errötete. In ihren hellen Augen leuchtete ein Feuer. Loreleis Puls schoss erwartungsvoll in die Höhe, und ihr Mund wurde trocken. »Beschuldige mich noch einmal, meine Pflichten Wilhelm gegenüber zu vernachlässigen, und ich stoße dich in den Fluss.«
Lorelei wusste, dass sie einen Nerv getroffen hatte. Die meisten Provinzen hatten Widerstand gegen die Vereinigung des wild zusammengestückelten Königreichs Brunnestaad geleistet – und niemand hatte erbitterter gekämpft als die Bewohner von Sylvias Heimatland Albe. Selbst zwanzig Jahre nach der Annektierung wurde unter Aufständen die Unabhängigkeit gefordert. Die albische Bevölkerung praktizierte ihre eigene Religion, sprach ihren eigenen Dialekt, und die Größe ihres Landes allein übertraf den gesamten Rest von Brunnestaad. Die Bevölkerung des restlichen Königreichs hielt sie für ketzerische, in den Bergen lebende Tölpel, die jederzeit zur Revolte bereit waren. Sylvia war die rechtmäßige Erbin des Herzogssitzes.
»Außerdem«, fuhr Sylvia gereizt fort, »wird es schnell gehen. Ich weiß inzwischen genau, wie man mit Nixen umgeht.«
Lorelei hatte nie zuvor eine Nixe gesehen, aber als Folkloristin der Expedition hatte sie im Laufe der Jahre unzählige Geschichten über die Wildeleute zusammengetragen. Die meisten der einfachen Leute, mit denen sie gesprochen hatte, hielten sie für Ungeheuer, manchmal sogar für Götter. Tatsächlich waren die meisten Arten von Wildeleute nichts weiter als lästig. Die erträglicheren unter ihnen zogen sich an entlegene Orte zurück und amüsierten sich damit, Reisende in die Irre zu führen. Andere liefen auf dem Lande Amok, trieben Unfug in den Dörfern und tauschten belanglose Zaubereien gegen Brotkrusten oder Krüge voller Sahne ein.
Und dann gab es noch Wesen wie die Nixen. Einer solchen gegenüberzutreten, nur mit einer Gitarre und drei Kilo Seide bewaffnet, erschien Lorelei eine ziemlich dumme Idee. »Und wie genau gedenkst du, mit ihr fertigzuwerden? Willst du sie verprügeln? Oder sie vielleicht zum Tee einladen?«
»Mach dich nicht lächerlich«, erwiderte Sylvia verärgert. »Ich werde ihr vorsingen. Ich arbeite seit Monaten an dieser Technik.«
»Ihr vorsingen?«,brachte Lorelei hervor. »Das ist das Albernste, was ich jemals gehört habe.«
Sylvia hob das Kinn. »Und wie viele Bücher über Nixen hast du veröffentlicht?«
Eisige Stille legte sich über sie. Sie wussten beide ganz genau, dass Lorelei kein einziges Wort veröffentlicht hatte.
»Du kannst dich so viel über mich lustig machen, wie du willst«, sagte Sylvia. »Aber meine Forschungsergebnisse besagen, dass sich Nixen um magische Quellen versammeln. Wenn wir lernen, mit ihnen zu kommunizieren, kann das von unschätzbarem Wert für die Expedition sein.«
Daran hatte Lorelei starke Zweifel. Debatten über den genauen Ursprung und die Beschaffenheit von Magie zogen noch immer durch die Hallen der Universität. Die am weitesten verbreitete Theorie jedoch besagte, dass Magie Aether war, ein natürlicher Stoff, der ausschließlich in Wasser vorkam. Thaumatologen, die Spezialisten im Bereich der Magiekunde, hatten bereits Instrumente entwickelt, um Magie zu messen, und diese waren bei weitem nicht so tödlich und viel präziser als ausgerechnet Nixen.
Gehässig deutete Lorelei auf die leere Wasserfläche vor ihnen. »Na gut, dann stelle deine bahnbrechende Forschung unter Beweis. Oder können sich Nixen inzwischen so gut tarnen wie Alpe?«
Die Menge wurde unruhig. Flussaufwärts konnte sie eine Gruppe junger Männer erkennen, die unter lautem Johlen einen ihrer Gefährten hochhob. Sie waren eindeutig kurz davor, ihn in den Fluss zu werfen. Lorelei verdrehte die Augen. Es gab einen Grund, warum niemand jemals im Vereist schwamm. Unter der Oberfläche, in völliger Dunkelheit, war es unmöglich, die Orientierung zu behalten. Nixe oder nicht, jemand würde heute sterben.
Empörung färbte Sylvias Wangen. »Sie wird auftauchen.«
»Na dann los. Es läge mir fern, dich abzulenken.«
Sylvia lächelte glückselig. »Wunderbar! Dann sei bitte still.«
Obwohl Lorelei versucht war, Sylvia in den Fluss zu stoßen, gehorchte sie.
Sylvia zupfte ein verstimmtes kleines Arpeggio und begann zu singen. Lorelei beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Das Abendlicht fiel durch die Zweige und zeichnete ein verwobenes Schattenmuster auf Sylvias Gesicht. Sie grinste, während ihre Finger unbeholfen die Akkorde formten. Nie zuvor hatte Lorelei jemanden getroffen, der so demonstrativwar. Die meiste Zeit ihres Lebens war sie von Menschen aus dem Norden umgeben gewesen und hatte sich an deren kühle, kurz angebundene Effizienz gewöhnt. Aber in Albe pflegten die Menschen seltsame Bräuche: So sangen sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, oder – schlimmer noch – sie umarmten sich zur Begrüßung. Sylvias ungezwungene Herzlichkeit und ihr Überschwang trieben Lorelei meist zur Weißglut. Manchmal erinnerte es sie jedoch auch zu sehr an die Dinge, die sie zurückgelassen hatte.
Sie wandte den Blick ab und legte die Hände um den Hals ihres Heimwehs. Vor ihr glänzte der Vereist wie eine schwarze Glasplatte. Der Fluss machte sie grundsätzlich nervös, obwohl er bei weitem nicht das seltsamste Gewässer in Brunnestaad war. Im Norden lag die Salz, auf deren tosender Oberfläche man einfach von Ufer zu Ufer laufen konnte. Im Westen konnte man in der Heilen waten, deren Wasser jede Wunde verschloss. Und irgendwo tief im Innern dieses heimtückischen, ausgedehnten Königreichs lag das Ziel der Ruhigburg-Expedition: der Ursprung, die sagenumwobene Quelle aller Magie, von der König Wilhelm zurzeit besessen war.
Sylvia packte sie am Arm. »Sieh nur!«
Ehe Lorelei sich aus ihrem Klammergriff lösen konnte, kräuselte sich das Wasser. Langsam stieg etwas aus der Dunkelheit des Flusses empor. Der Nebel teilte sich, und ein ausgemergeltes Gesicht wandte sich ihnen zu. Es schimmerte grau wie der Vollmond vor einer Wolkendecke.
Die Menge hinter ihnen schnappte hörbar nach Luft. Lorelei brachte es nicht über sich, sich zu ärgern. Zugegebenermaßen war es eine Art hinterwäldlerisches Novum, einen der Wildeleute hier in der Stadt zu sehen – als wäre ein Märchen oder ein idyllisches Landschaftsgemälde zum Leben erwacht. All die Zeichnungen, die Lorelei in den Reiseberichten gefunden hatte, verblassten im Vergleich zu diesem wirklichen, furchtbaren Anblick. Die Haut der Nixe funkelte, und wie ein Tintenfleck ergoss sich ihr Haar über die Wasseroberfläche. Ihre Augen erfüllten Lorelei mit einer kalten, instinktiven Furcht. Sie waren vom gleichen undurchdringlichen, bodenlosen Schwarz wie der Vereist – und beklemmend reptilienhaft. Wenn sie blinzelte, legte sich ein dünner, durchscheinender Film über ihre Augäpfel.
»Sieh sie dir an«, sagte Sylvia voll ehrlicher Bewunderung. »Ist sie nicht wunderschön?«
Nein, wollte Lorelei entgegnen. Sie ist grauenhaft.
Ein heller Ton erregte ihre Aufmerksamkeit. Ein Gewirr von Kettenanhängern ruhte auf Sylvias Schlüsselbein, wobei in jeden die Ikone eines Heiligen eingraviert war. Lorelei konnte sich nicht erinnern, ob sie Sylvia jemals ohne ihre Ketten gesehen hatte. Sie waren ihr immer ungewöhnlich vorgekommen. Hier in der Provinz Neide waren alle, die keine Yevani waren, eher zurückhaltend mit ihrem Glauben. Aber Sylvia, die durch und durch albisch war, betete so auffällig, wie sie auch alles andere tat. Sie löste eine Kette nach der anderen, bis sie neben ihr einen Haufen bildeten. Damit hatte sie sämtlichen Schutz abgelegt, der die Magie der Nixe schwächen konnte.
Gegen ihren Willen verstand Lorelei die morbide Faszination, mit der die Menschenmenge Sylvia beobachtete. Nie zuvor hatte sie ihr bei der Arbeit zugesehen. Zugegebenermaßen verspürte auch sie einen makabren Nervenkitzel, während sie verfolgte, wie sich jemand Hals über Kopf in Gefahr brachte. In den letzten Jahren hatte Sylvia sich dank ihrer … unorthodoxen Methoden einen Namen gemacht. Sie veröffentlichte kleine, banale Abenteuergeschichten über ihre Zeit mit den Wildeleuten, in denen sie sich absichtlich in Zaubereien verstrickte, um ihre Erfahrungen festzuhalten. Mit diesen Reiseberichten fesselte Sylvia ihre Leserschaft und verleitete sie dazu, sie eine Visionärin zu nennen. Wissenschaftlich waren die Berichte jedoch völlig wertlos. Sie waren eine Beleidigung für die Empirie, basierten sie doch auf fadenscheinigen anekdotischen Angaben und, schlimmer noch, auf Hirngespinsten. Lorelei wusste inzwischen, dass Sylvia nur außergewöhnlich viel Glück hatte – und unglaublich dumm war. Der Gesang einer Nixe hatte einen starken hypnotischen Zauber – unzählige Menschen waren in seinem Bann ertrunken.
Die Nixe glitt auf einen Stein, der aus dem Wasser ragte, und Lorelei gab sich alle Mühe, nicht zurückzuweichen. Lotusblüten hatten sich im Haar der Nixe verfangen, das schleimig wie ein Bündel Rohrkolben glänzte. Es ergoss sich über die knochigen Schultern bis in ihren Schoß. Dort, wo bei einem Menschen Beine waren, bedeckten schillernde Schuppen ihre Hüften und formten einen langen, gewundenen Schwanz. Sie öffnete die blauen Lippen gerade genug, um ihre scharfen, gezackten Zähne zu entblößen. Angst durchzuckte Lorelei wie ein Blitzschlag.
»Von Wolff«, mahnte sie.
»Immer mit der Ruhe, Lorelei.« Indem Sylvia ihre Worte sang, verletzte sie Lorelei nicht nur, sondern beleidigte sie auch. »Sie ist nur neugierig.«
Dieser Gedanke beruhigte Lorelei kein bisschen. Hinter ihnen wurde es laut. Lorelei warf einen Blick über die Schulter und nahm wahr, dass ihr Publikum größer und übermütiger geworden war. Schwatzend und mit den Fingern auf sie deutend rückte die Menge immer näher an sie heran.
Dummköpfe, alle zusammen.
»Haltet Abstand«, fauchte Lorelei. »Außer, ihr wollt heute ertrinken.«
Ein Zischen lenkte ihre Aufmerksamkeit zurück aufs Wasser. Die Nixe holte Atem, wobei sich die Kiemenhäutchen entlang ihres Brustkorbs blähten und zitterten. Dann begann sie zu singen, und die ganze Welt verstummte.
Das Lied war wie der Ozean selbst – die schönste Melodie, die Lorelei je gehört hatte. Sie schwoll an und schwang sich in die Höhe hinauf. Mit unaufhaltsamer, unwiderstehlicher Harmonie umspielte Sylvias Lied sie. In einem Moment stand Lorelei mit beiden Füßen fest auf dem Boden, im nächsten schon stieg sie federleicht in die Luft. Noch nie zuvor hatte sie sich so … vollkommen gefühlt, als atmete sie im Gleichklang mit allen anderen Wesen auf der Erde. Einen wunderbaren, strahlenden Augenblick lang erkannte sie die leuchtende, wilde Schönheit der Welt. Aether war in ihnen allen – in allem. Er schimmerte im Nebel, und im Vereist funkelten Tausende Farben so hell, dass ihr beinahe die Tränen kamen. Wieso war ihr der Fluss jemals dunkel vorgekommen?
Sie machte einen Schritt auf das Wasser zu, dann noch einen. Gerade, als sie den Uferrand erreicht hatte, spürte sie die sengende Hitze der Eisenkette um ihren Hals – als würde sie von weißglühenden Kohlen berührt werden. Mit einem Keuchen kam Lorelei wieder zur Besinnung. Der Fluss – nun wieder schwarz und stumpf wie Stahl – zwinkerte ihr tosend zu. Beinahe hätte sie laut geflucht. Wenn sie sich nicht zusammenriss, würde sie wie eine tattrige Närrin im seichten Wasser ertrinken.
Konzentrier dich, verdammt.
Sie biss sich auf die Lippe. Der Geschmack von Kupfer vertrieb den letzten Rest des Nixenzaubers. Ein schrecklicher Klagelaut durchdrang den Nebel, der ihre Gedanken umhüllte, und ließ ihr Blut gefrieren.
So also klang ihr Lied wirklich.
Aber Sylvia stand immer noch in seinem Bann. Sie war ganz still, und in ihren Augen glänzte eine seltsame Verzückung. Nur selten konnte man sie aus der Nähe betrachten, da sie normalerweise immer in Bewegung war. Ihre Augen waren von so hellem Grau, dass sie fast violett schimmerten. Wie bei den meisten Adeligen zierte ein feines Geflecht aus Duellnarben ihre Schläfen: jede einzelne ein zweifelhaftes Ehrabzeichen dafür, dass sie einen Schlag ins Gesicht ertragen hatte. Die dickste Narbe, die sich über ihre Wange zog, schimmerte wie ein Eiszapfen, auf den das Sonnenlicht fiel. Sylvia legte die Gitarre beiseite, während sie noch immer ihre unheimliche, schräge Melodie summte. Der Lärm der Menge schwoll erneut an.
Von irgendwoher konnte Lorelei hören, wie jemand »Sie tut es!« rief.
Der Schreck traf sie blitzartig. »Was machst du da?«
Sylvia ignorierte sie und ging weiter auf den Fluss zu. Ihre unbändigen Haarsträhnen tanzten im Wind, das letzte rote Aufglühen des Tages ließ sie wie weißes Feuer lodern. Die Nixe streckte eine mit Schwimmhäuten besetzte Hand nach ihr aus. Sylvia schritt ihr entgegen, und es war ein Leichtes, sich vorzustellen, wie sie unter der Wasseroberfläche verschwand. Ihr zartes, pflaumenfarbenes Abendkleid, das sich wie eine Rose um ihren Körper entfaltete. Ihr silbernes Haar, knochenbleich gegen das tiefe Schwarz des Flusses. Leider würde Ziegler es Lorelei nie verzeihen, wenn sie tatenlos dabei zusah, wie ihre Naturkundlerin in den Tod watete. Sie musste etwas unternehmen.
In der Regel setzte Lorelei Magie niemals dort ein, wo sie gesehen werden konnte. Aber im Laufe der Jahre hatte sie gelernt, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Sie holte tief Luft und konzentrierte sich auf ihre magischen Kräfte. Energie breitete sich in ihrer Brust aus und durchströmte sie bis in die Fingerspitzen. Sie stellte sich vor, wie sie die Faust um den Aether ballte, der das Wasser durchzog, und – da. Einen Moment lang glaubte sie, vom Fluss überwältigt zu werden, während ihr Wille wirkungslos an ihm zog. Aber dann stellte sich die Verbindung ein, und sie empfand den Vereist wie eine Verlängerung ihrer selbst, wie ein Phantomglied. Seine Strömung dröhnte ihr in den Ohren wie das Rauschen ihres eigenen Bluts. Schweiß trat ihr auf die Stirn. Ihr blieb nicht viel Zeit, ehe er ihr ganz entglitt, aber sie brauchte nicht viel.
Mit einem Atemzug lenkte sie das Wasser aus seiner Bahn – gerade genug, um die Nixe von ihrem Stein zu stürzen. Sylvia zuckte zusammen, als wären ihre Fäden durchtrennt worden. Lorelei ließ ihre Magie los. Erleichterung und Erschöpfung legten sich schwer auf sie.
Einen Augenblick später schoss die Nixe aus dem Wasser und bedachte Lorelei mit einem beinahe empörten Blick. Sie warf ihr Haar in den Nacken und verschwand unter der Oberfläche. Die Geste war so verblüffend menschlich, dass es Lorelei die Sprache verschlug.
»Warte!«, rief Sylvia hilflos.
Bei Gott, wenn Sylvia versuchte, diesem Biest zu folgen …
Ehe Lorelei es sich anders überlegen konnte, war sie neben Sylvia getreten und packte sie am Ellbogen. »Hast du den Verstand verloren? Komm sofort zurück.«
Sylvia drehte sich mit offenem Mund zu ihr um, zweifellos, um etwas Gemeines und Wütendes zu sagen, aber Lorelei blieb keine Gelegenheit, es zu hören. Sylvia löste sich so heftig aus ihrem Griff, dass sie den Halt verlor – und Lorelei mit sich riss. Für eine schreckliche Sekunde schien die Zeit stillzustehen. Die Schreie erreichten sie aus tausend Kilometern Entfernung.
Dann stürzten sie ins Wasser.
Schwärze umgab sie, so vollständig, dass sie die eigene Hand vor dem Gesicht nicht mehr sehen konnte. Die Kälte raubte ihr gierig den Atem. Lorelei kämpfte sich an die Oberfläche und schnappte nach Luft.
Sylvia war bereits ans Ufer gekrabbelt. Sie sah aus wie eine nasse Katze. Sie zitterte, das Kleid klebte ihr am Körper, und das Haar hing schlaff um ihre Schultern. Die Menschenmenge zerstreute sich bereits, wobei sich Enttäuschung auf den Gesichtern abzeichnete.
»Sieh nur, was du angerichtet hast«, sagte Sylvia vorwurfsvoll. »Sie hat mit mir gesprochen.«
»Was ich angerichtet habe?« Es fiel ihr schwer, darauf zu bestehen, das Richtige getan zu haben, während ihr das Haar im Gesicht klebte. Der Geschmack von Flusswasser und Schlamm füllte ihren Mund. Irgendwie schaffte sie es, sich trotz des Gewichts ihres nassen Mantels ans Ufer zu schleppen. »Das alles ist ganz allein deine Schuld.«
Sylvia fuchtelte mit einem Finger vor Loreleis Gesicht. Wie absurd, von einer Person bedroht zu werden, die einen ganzen Kopf kleiner war als sie. »Ich hatte die Situation vollkommen unter Kontrolle. Deinetwegen wirke ich jetzt wie eine Idiotin.«
»Das schaffst du auch allein gut genug.« Lorelei zog ihre Uhr aus der Brusttasche. »Wir müssen uns beeilen, wenn …«
Der Sekundenzeiger tick, tick, tickte kraftlos auf der Stelle, ruiniert. Der Minutenzeiger hatte sein vorzeitiges Ende fünf Minuten nach ihrer geplanten Abfahrtszeit gefunden.
Sie waren zu spät, und Ziegler würde sie umbringen.
2. Kapitel
Als sie den Treffpunkt schließlich erreichten, gab es nichts mehr zu sagen. Lorelei hatte der brunnischen Sprache so viel Gift wie nur möglich abgerungen, um dann auch noch auf Yevanisch weiterzuschimpfen. Sylvia hatte das Ganze, einer Märtyrerin gleich, mit gehässiger Miene ertragen und schwieg nun mürrisch.
Ziegler lehnte an der Kutsche und strahlte spürbares Missfallen aus. Als sich die beiden ihr näherten, bedachte sie sie mit einem leeren, unbeeindruckten Blick.
»Steigt ein«, befahl sie und kletterte in den Wagen.
Sie folgten ihr gehorsam. Lorelei setzte sich ihr gegenüber, aber Sylvia ließ sich ärgerlicherweise neben Lorelei nieder und rückte die durchweichte Schleppe ihres Kleides zurecht. Um nicht mit den Zähnen zu klappern, presste Lorelei die Lippen zusammen.
Der Fluss hatte die Stärke aus ihrem Hemd gewaschen, und irgendwie ärgerte sie das genauso sehr wie ihre Unpünktlichkeit. Eitelkeit konnte sie sich nicht leisten, aber hier ging es um Anstand und Ordnung. Sie hatte ihr Halstuch sorgfältig geknotet, und die Kragenspitzen hatten einst eine klare, scharfe Linie an ihrem Kinn entlang gezeichnet. Beides hing nun schlaff und traurig herunter. Noch schlimmer war das schreckliche Gefühl von nassem Stoff auf ihrer Haut. Sylvia hingegen … Selbst halb ertrunken und in einem schlammverschmierten Kleid schaffte sie es, märchenhaft schön auszusehen, so perfekt wie eine Prinzessin in einem gläsernen Sarg. Bei ihrem Anblick befiel Lorelei ein übles Gefühl, über das sie lieber gar nicht erst nachdenken wollte.
Bitterkeit hatte vor langer Zeit schon in Lorelei Wurzeln geschlagen. Im Laufe der Jahre war sie verwildert und hatte Dornen hervorgebracht, die sich um Loreleis Herz schlossen. Lorelei beneidete Sylvia nicht wirklich – Schönheit war ihr nie wichtig gewesen. Und trotzdem tat es manchmal weh, dass sie nicht einmal behaupten konnte, auf herkömmliche Weise gut auszusehen – oder zumindest klassisch brunnisch, mit blondem Haar und hellen, blauen Augen. Ihre dunklen Locken waren kurz geschnitten, bis auf einen widerspenstigen Schopf, der ihr über die Stirn fiel, wie es bei Männern derzeit in Mode war. Aber mit den scharfen Wangenknochen und der markanten Nase wirkte Lorelei eher streng und mürrisch als schneidig. Auch ihre Worte milderten diese Wirkung nicht.
Die Kutsche setzte sich in Bewegung, und Ziegler eröffnete das Feuer. »Steht euch der Sinn danach, eure Verspätung zu erklären?«
Oh, niemals. Lorelei richtete sich auf. »Ich …«
»Oder warum ihr ausseht wie ersoffene Ratten?«
Sylvia sackte in sich zusammen. »Nun ja …«
»Oder warum ihr mir ausgerechnet heute Ärger machen müsst?« Mit jeder Frage wurde ihre Stimme schärfer, ihre Worte schneller.
»Wenn Ihr uns nur …«
»Welchen Teil von ›unser aller Leben hängt vom Erfolg dieser Expedition ab‹ habt ihr nicht verstanden?« Es dauerte einen Moment, bis Lorelei begriff, dass Ziegler ins Javenische gewechselt war. Sie hatte die meiste Zeit ihres Berufslebens in Javenor verbracht, bevor der letzte König sie vor etwa fünfzehn Jahren zurück nach Hause berufen hatte. Sie war verbittert zurückgekehrt, aber in vielerlei Hinsicht – ihr affektierter javenischer Akzent, ihre Verachtung für alles Brunnische – tat sie so, als hätte sie Javenor nie verlassen. »Muss ich noch deutlicher werden?«, fügte sie hinzu, als beide nicht antworteten.
»Nein?«, versuchte es Sylvia.
»Nein? Warum versucht ihr dann, sie zu sabotieren? Wenn ich so spät auftauche, noch dazu mit euch beiden in diesem Zustand – das ist eine totale Blamage!«
»Der König und ich sind alte Freunde«, warf Sylvia unglücklich ein. »Er hat schon viel Schlimmeres gesehen, das versichere ich Euch.«
»Und ich berate Politiker schon länger, als du auf der Welt bist«, entgegnete Ziegler. »Bei dieser Veranstaltung geht es darum, Stabilität zu vermitteln. Einheit. Stärke. Was glaubst du, wie es aussieht, wenn seine überzeugendste politische Rivalin den Raum betritt, als sei das alles ein Witz für sie?«
»Ich habe kein Interesse daran, seine Marionette zu sein!«
»So ein Pech. Heute Abend sind wir das alle.« Ziegler ließ sich tiefer in ihren Sitz sinken und verschränkte die Arme. Mit eisernem Blick und einem Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen genervt und angewidert lag, sah sie aus dem Fenster. »Es ist mir egal, wie lange du den Mann kennst oder wie gutherzig er ist. Das alles bedeutet nichts, wenn er die Stabilität seiner Herrschaft in Gefahr sieht.«
Damit hatte sie recht. Kein Mann, der sich seiner Herrschaft sicher war, würde Mittel für die Suche nach dem Ursprung verschwenden. Nur wenige Menschen glaubten an seine Existenz außerhalb der Welt der Märchen.
Auf die eine oder andere Weise hatten die meisten Menschen magische Fähigkeiten. Die geschicktesten unter ihnen konnten mit einer Handbewegung Feuchtigkeit aus der Luft ziehen oder die Oberfläche eines Teiches gefrieren lassen. Der Ursprung aber verlieh unglaubliche Kräfte – natürlich nur, wenn man gewillt war, den Preis dafür zu zahlen. Die Legenden, die Lorelei im Laufe der Jahre zusammengetragen hatte, schienen nie darin übereinzustimmen, wie genau die Kraft des Ursprungs funktionierte oder welches schreckliche Schicksal denjenigen erwartete, der nach ihr strebte.
»Fünfzehn Jahre«, sagte Ziegler mit deutlichem Unmut. »Fünfzehn Jahre hat mich die königliche Familie an einer goldenen Kette im Palast gehalten. Diese verdammte Quelle zu finden ist der allerletzte Dienst, den ich ihm schulde.«
Ziegler hatte einst jahrelange Expeditionen unternommen und ihre freie Zeit in einer gut ausgestatteten Wohnung in der angesehensten Stadt Javenors verbracht. Jetzt diente sie Wilhelm als Haushofmeisterin, was ihr missfiel, sie aber nicht ändern konnte. Er nannte sie seine wandelnde Enzyklopädie.
Eher sein tanzendes Äffchen, murrte Ziegler oft.
»Ich brauche frische Luft. Ich brauche interessante Leute«, fuhr sie fort. »Ich habe viel zu hart dafür gearbeitet, als dass ihr zwei Emporkömmlinge mir das kaputt machen könntet.«
Emporkömmlinge. Das schmerzte mehr, als Lorelei erwartet hatte. Natürlich meinte Ziegler es nicht wirklich ernst. Wenn sie wütend war, teilte sie oft aus. Dennoch kam Lorelei nicht umhin, sich wieder wie die verlorene Zwölfjährige zu fühlen, die Ziegler damals unter ihre Fittiche genommen hatte: genauso verzweifelt bemüht, zu gefallen, wie zu entkommen.
»Das alles ist allein von Wolffs Schuld.« Lorelei verabscheute ihren trotzigen Tonfall, aber sie konnte sich nicht beherrschen. »Ich war pünktlich.«
Sylvia warf ihr einen vernichtenden Blick zu. »Ich habe eine Theorie ausprobiert, die sich als unschätzbar erweisen wird …«
»Das reicht. Ihr bereitet mir Kopfschmerzen.« Ziegler kniff sich in den Nasenrücken und stieß einen langen, frustrierten Seufzer aus. »Ich ertrage euer beider Anblick gerade nicht.«
Zuerst überkam Lorelei ein Anflug heißer Scham. Aber als sie Sylvia ansah, wurde sie von einem stetigen, brennenden Hass erfasst. Nichts war sicher. Nicht ihr Stolz, nicht ihre Stellung, nicht einmal die Zuneigung ihrer Mentorin. Bis sie ihren Abschluss machten, würde Sylvia von Wolff ihr alles genommen haben.
Lorelei drehte sich brüsk zum Fenster, um die vorbeiziehende Stadt zu betrachten. Während die Sonne wie ein glühendes Kohlestück hinter dem Horizont versank, fiel ihr ein, dass es der Vorabend des Tags der Ruhe war. Ihre Eltern und ihre kleine Schwester Rahel würden sich bald auf den Weg zum Abendgottesdienst machen. Lorelei konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal gebetet hatte oder wann genau sie aufgehört hatte, sich deswegen schuldig zu fühlen. Trotzdem konnte sie die in ihr aufsteigende Sehnsucht nicht unterdrücken, als sie die Spitzen des Tempels aus der Dämmerung ragen sah.
Sie vermisste die geschäftigen Stunden vor Sonnenuntergang, wenn ihre Familie kochte und putzte, als würden sie den König selbst in ihrem Zuhause empfangen. Sie vermisste den beruhigenden Rhythmus der Stimme ihres Vaters, wenn er beim Abendessen den Wein segnete. Den süßen Duft des geflochtenen Brots. Manchmal vermisste sie sogar den endlosen Morgengottesdienst. Lorelei trauerte nicht um ihren Glauben, nur um das Mädchen, das sie gewesen war, bevor sie Ingrid Ziegler getroffen hatte – das Mädchen, das noch zur Yevanverte gehörte. Jeden Abend kehrte sie ein wenig fremder zu ihrer Familie zurück als zuvor: mehr Brunnestaaderin als Yeva.
Natürlich sagten ihre Eltern nichts, aber Lorelei bemerkte ihren Schmerz, wenn sie, ohne darüber nachzudenken, mit ihnen brunnisch sprach oder wenn sie sich nicht daran erinnern konnte, welches Nachbarskind im letzten Monat geheiratet hatte, oder wenn sie noch eine Kerze abbrennen ließ, weil sie lange, nachdem alle anderen schon schlafen gegangen waren, noch gearbeitet hatte. Und trotzdem fand sie jeden Morgen Kaffee und ein Stück Apfelkuchen vor. Jeden Abend kehrte sie zu dem für sie gedeckten Platz am Esstisch zurück. Sie ertrug die Sticheleien über ihr Wohlbefinden, ihr Glück und ihre Heiratschancen. Auch wenn sie sie nicht mehr verstanden, liebten sie sie. Wenn Lorelei nur behaupten könnte, dass sie das alles allein für ihre Eltern tat.
Eines Tages würde ihr Egoismus ihnen vielleicht zugutekommen.
Bald schon erhob sich der Palast vor ihnen. Bis heute hatte sie ihn nur aus der Ferne gesehen: ein blasser Fleck auf der anderen Seite von Zieglers einsamem Bürofenster. Aus der Nähe betrachtet war es ein pompöses Gebäude aus weißem Stein, gekrönt mit einer Kupferkuppel. Der Mond balancierte auf der höchsten Turmspitze und versilberte die Gärten mit weichem Pinselstrich. Die Luft war vom süßen Duft der Rosen erfüllt. Dank des regelrechten Heeres königlicher Botaniker blühten sie in jeder erdenklichen Farbe, von dunklem Gold bis zu reinstem Weiß. Doch am meisten bewunderte Lorelei ihre Dornen, von denen jede einzelne wie ein silberner Blitz in der Dunkelheit leuchtete.
Der Kutscher hielt am Ende einer Reihe von Fuhrwerken an. Ein Diener eilte herbei, um Sylvia aus dem Wagen zu helfen. Lorelei verdrehte die Augen und öffnete ihre eigene Tür.
Ein weiterer Diener tauchte an ihrer Seite auf. »Fass mich nicht an«, fauchte sie, ehe er den Mund aufmachen konnte.
Zu dritt erklommen sie die Marmortreppe des Palasts. Die Türen, die sich vor ihnen auftaten, hätten Ehrfurcht gebieten können, wären sie nicht so geschmacklos gewesen. Die Holzvertäfelung war mit Gold beschlagen, und der Türsturz war ausgerechnet mit aus dem Meeresschaum auftauchenden Nixen verziert. Dankenswerterweise verlor Sylvia kein Wort darüber.
In ihren Träumen war sie am heutigen Abend triumphierend über diese Türschwelle getreten: am Ende eines langen und brutalen Weges. Der König höchstpersönlich hätte sie begrüßt. Sie wäre den angesehensten Naturkundlern des Landes vorgestellt worden. Die Realität war schlimmer als alles, was sie sich hätte ausdenken können.
Wortlos hielt Ziegler dem Wächter ihre Einladungen entgegen, der erst die Briefe und dann ihre Gesichter abschätzig musterte. »Willkommen.«
Er öffnete die Türen, und der Klang von Unterhaltungen und Gelächter drang nach draußen. Er räusperte sich, dann rief er: »Professorin Ingrid Ziegler, Leiterin der Ruhigburg-Expedition, Fräulein Sylvia von Wolff, Naturkundlerin der Ruhigburg-Expedition, und Lorelei Kaskel, Folkloristin der Ruhigburg-Expedition.«
Es war, als hätte er eine Glasglocke über sie gestülpt. Alle Geräusche klangen plötzlich dumpf und undeutlich. Manche Gäste wirkten erheitert, andere schämten sich eindeutig für sie. Wieder andere zeigten sich zutiefst unbeeindruckt. Lorelei kam sich vor wie ein Insekt, das aufgespießt auf dem Tisch eines Forschers bereitlag, um seziert zu werden.
Ihr Gesichtsausdruck musste sie verraten haben, denn Sylvia beugte sich vor und rammte ihr einen Ellbogen in die Rippen. Lorelei rang sich ein Lächeln ab, das den Adeligen, der ihnen am nächsten stand, zurückschrecken ließ, als hätte sie ihm heißes Öl vor die Füße gegossen.
»Guten Abend«, sagte Sylvia mit wenig überzeugend wirkender heiterer Miene. »Danke, dass Ihr alle heute Abend gekommen seid.«
Und damit war der Bann gebrochen. Unterhaltungen wurden wieder aufgenommen, Musik tönte über sie hinweg, und Lorelei nutzte die Chance, um in der Menschenmenge zu verschwinden.
Der Glanz der Kronleuchter und das unaufhörliche Stimmengewirr zerrten an den Kopfschmerzen, die sie noch nicht ganz losgeworden war. Eine Nacht guten Schlafs würde das wieder in Ordnung bringen, aber sie kam nicht umhin, sich über sich selbst zu ärgern. Sie hätte ihre Magie nicht so leichtfertig einsetzen dürfen – oder leichtsinnig, um genau zu sein. Magie erschöpfte die Person, die sich ihrer befähigte. Wie stark, hing von der Menge und der Geschwindigkeit des Wassers sowie vom Können der jeweiligen Person ab. Demnach hätte sie das, was sie getan hatte, nicht tun sollen, aber der hungrige, gefährliche Ausdruck in den Augen der Nixe hatte einen selbstlosen Impuls in ihr geweckt. Lorelei unterdrückte ein wütendes Stöhnen.
Das nächste Mal würde sie Sylvia in ihren eigenen sinnlosen Tod waten lassen.
Mit erhobenem Kinn schob sie sich durch das Gedränge von Körpern. Inmitten all dieser Pracht fiel sie durch ihre Unauffälligkeit auf. Wie üblich trug sie Schwarz. Ihre Mutter hatte darauf bestanden, ihr Jackett zum Schneider zu bringen, der die Aufschläge und Manschetten mit Rosen aus glänzendem schwarzen Garn bestickt hatte. Lorelei wünschte sich jetzt, sie hätte nicht nachgegeben. Die ruinierte Extravaganz war ihr noch unangenehmer als ihr unordentliches Auftreten. Und außerdem hatte sie heute Abend nichts zu feiern.
Es dauerte nicht länger als eine Minute, bis sie die abgelegene Ecke entdeckt hatte, in der sich die restlichen Außenseiter herumdrückten. So weit war sie gekommen. Es gab keine Würde und keine Erwartungen mehr, die ihr noch genommen werden konnten. Jetzt musste sie nur noch bis zum Ende des Abends überleben. Als ein Bediensteter mit einem Silbertablett voller Weingläser vorbeilief, nahm sie eines und leerte es auf der Stelle.
»Kaskel«, ertönte eine vertraute Stimme.
Als wäre ihr Abend nicht schon verdorben genug.
Sie drehte sich um. Johann zu Wittelsbach, Arzt der Expedition und zukünftiger Graf von Herzin, stand in voller militärischer Uniform vor ihr. Die Hälfte seines Haars trug er zusammengebunden, der Rest ergoss sich als goldener Schwall über seine Schultern. Er trug einen Prunksäbel und einen Gesichtsausdruck, der vermuten ließ, dass er sowohl überrascht als auch brüskiert war, sie hier anzutreffen.
Dieses Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit.
»Johann«, sagte sie knapp. »Du bist offensichtlich aus gutem Grund hier. Welcher wäre das?«
»Feindselig«, bemerkte er. »Ich bin hier, um dich im Auge zu behalten.«
»Und was habe ich getan, das eine Beaufsichtigung nötig macht?«
Er kam ihr so nahe, dass er bedrohlich über ihr aufragte, aber sie blieb standhaft. Sie konnte den Schnaps in seinem Atem riechen. Halb vergessenes Grauen jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Alkohol und Männer wie Johann vertrugen sich nie. Er stachelte sie auf.
Hinter seiner Brille waren seine Augen von einem matten, eisigen Blau. »Du bist hier.«
Sie verstand sehr gut, was er ungesagt ließ: Und das solltest du nicht sein, dreckige Yeva. Lorelei unterdrückte ihre Wut, so gut sie konnte, und antwortete: »Auf Einladung Seiner Königlichen Majestät.«
Kurz wirkte er verärgert. »Ein Versehen seinerseits. Wilhelm hatte schon immer die bedauerliche Angewohnheit, das Beste in anderen zu sehen.«
Er musste es wissen. Er und der Rest der Expeditionsgruppe – die Ruhigburger Fünf, wie sie auf dem Campus genannt wurden – hatten die Sommer ihrer Kindheit miteinander verbracht und waren durch eben diese Hallen getobt. Sie pflegten all die Rangeleien und halb unterdrückten Spannungen, die auch echte Geschwister verband. Sie alle waren Mitte zwanzig, aber Lorelei hatte begriffen, dass Johann die Rolle des Ältesten übernommen hatte: Tyrann oder Beschützer, je nach Stimmung.
Es würde nichts Gutes dabei herauskommen, wenn sie ihn provozierte. Aber sie war zu sehr in Rage, um sich zurückzuhalten. »Was für ein Glück, dass er einen so gut erzogenen Wachhund hat.«
Sein Blick wurde hart, als er ihren Spott spürte. »Ich weiß, wie du dich für seine Gastfreundschaft zu bedanken planst.«
»Ach ja?«, zischte sie.
Er lächelte sie seinerseits unfreundlich an. Das war Antwort genug.
Als folgte sie einem Instinkt, fiel ihr Blick auf die Kette um seinen Hals. Daran hing der versilberte Reißzahn eines Roggenwolfs: das Zeichen eines inzwischen untergegangenen heiligen Ordens, dessen Mitglieder sich als Hunde bezeichneten. Mit geweihtem Silber hatten sie vor Hunderten von Jahren mit der Jagd auf gefährliche Wildeleute (oder »Dämonen«, wie sie sie nannten) begonnen. Aber vor einigen Jahrzehnten hatten sie sich zum Ziel gesetzt, Herzin von »Ungeziefer« zu säubern: Menschen wie Lorelei – und Sylvia, deren abweichende religiöse Praktiken die spirituelle Reinheit ihres Landes verdarben. Nachdem Johann die Macht von seinem Vater übernommen hatte, glaubte Lorelei kaum, dass es lange dauern würde, bis sie zurückkehrten.
»Ich beobachte dich schon eine ganze Weile, Kaskel. Ich habe das Ausmaß deines intriganten, habgierigen Strebens gesehen.« Er beugte sich zu ihr hinunter und murmelte: »Ich freue mich darauf, heute Abend dabei zu sein, wenn es vereitelt wird.«
Damit ging er davon.
Lorelei kochte vor Wut und konnte nichts anderes tun, als ihm hinterherzusehen. Sein Verhalten überraschte sie kein bisschen. Einmal hatte sie Johanns erstes Buch aus der Bibliothek ausgeliehen – und es prompt zurückgegeben, nachdem sie auf der ersten Seite den Satz gelesen hatte: »Diejenigen, die einem höheren Zweig der Menschheit angehören, sind morphologisch besser dafür geeignet, Aether einzusetzen.«
Seither hatte sie ihn als Wissenschaftler nicht ernst genommen. Im Widerspruch zu den lächerlichen Menschentypen, die er und seinesgleichen entwickelt hatten, konnten Yevani sehr wohl Magie anwenden.
Als Lorelei es zum ersten Mal getan hatte, hatte ihr Vater ihr eine Ohrfeige verpasst. Das tat er zum ersten und letzten Mal. Einen Moment lang hatte sie nur mit klingelnden Ohren zu ihm aufschauen können. Er hatte sie entsetzt angestarrt, bleich und zitternd. Nachdem er aufgehört hatte, sich zu entschuldigen, und ihrer beider Tränen getrocknet waren, hatte er sich zu ihren Füßen gekniet und ihr Gesicht sanft in beide Hände genommen.
Das darfst du niemals tun, hatte er gesagt, wenn sie dich dabei sehen können. Sie glauben, dass wir diese Kräfte nicht besitzen. Es macht sie wütend, wenn wir sie eines Besseren belehren. Verstehst du das?
Selbst damals hatte sie verstanden. Jetzt fragte sie sich nur noch, ob ihr Gehorsam Aaron das Leben gekostet hatte.
Die Flammen der Kerzen brachen sich in den Kristallleuchtern und ließen den Raum wirken, als läge er unter Wasser. Von ihrem Aussichtspunkt aus konnte sie die ganze hohle Pracht sehen, die sich vor ihr ausbreitete. Die Gäste des Fests kühlten ihre Getränke mit einer abwesenden Berührung und wischten sich den Schweiß mit einer gedankenlosen Geste von der Stirn. Eisperlen glitzerten kalt wie Sterne an den Säumen ihrer Jacken, und Nebel waberte um die Schleppen ihrer Kleider. Magie bedeutete diesen Menschen wirklich nichts.
An dem glitzernden Wirbel von Röcken und Fräcken vorbei entdeckte Lorelei Ziegler, die mit Sylvias Mutter, Anja von Wolff, sprach. Im Gegensatz zu ihrer Tochter war die Gräfin eine schmächtige Frau: zerbrechlich, hohläugig und leichenblass. Abgesehen von den entschlossenen Kiefern gab es keine Ähnlichkeit zwischen ihnen. Sylvia schien ihr knochenweißes Haar nicht von ihrer Mutter geerbt zu haben.
Was hatten die beiden bloß miteinander zu tun? Ziegler beriet oft Politiker in Fragen des Naturschutzes und der Kolonisierung, die sie rundheraus ablehnte, aber Anja von Wolff war für ihre militärische Strategie bekannt, nicht für ihren wachen Geist.
Da Loreleis Neugier ihren Selbstschutz überwog, beobachtete sie das Gespräch. Während sich die beiden unterhielten – oder vielleicht stritten –, richtete Anja einen Finger auf Ziegler. Ohne es zu wollen, empfand Lorelei einen Anflug von Mitgefühl ob der Vertrautheit dieser Geste. Sylvia hatte also doch etwas von ihrer Mutter geerbt.
Nachdem sie ihr Anliegen deutlich gemacht hatte, drehte Anja sich auf der Stelle um und verschwand in der Menge. Einen Moment lang stand Ziegler verblüfft da. Als hätte Lorelei ihren Namen gerufen, trafen sich ihre Blicke. Zieglers Überraschung verwandelte sich in etwas Unlesbares. Im nächsten Augenblick wandte sie den Blick entschlossen ab, als wären sie einander völlig fremd.
Ehe die Enttäuschung sie ganz erfassen konnte, ertönte neben ihr klirrendes Gelächter. »Arme Lori. Du bist wie ein Hündchen, das immer noch überrascht ist, wenn es getreten wird.«
Heike van der Kaas: die Astronomin der Expedition, die verwöhnte Erbin der Küstenprovinz Sorvig und Gerüchten zufolge die schönste Frau in Brunnestaad. Angesichts ihres tiefroten Haars und ihrer auffallend grünen Augen war das schwer zu bestreiten. Lorelei war jedoch nie in der Lage gewesen, über ihre kleinliche Grausamkeit hinwegzusehen.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, erwiderte sie.
»Kein Grund, mir zuliebe die Fassade aufrechtzuerhalten.« Heike wedelte mit einem Elfenbeinfächer vor ihrem Gesicht. »Wenn Ziegler sauer auf dich ist, verheißt das nichts Gutes für die Ankündigung, oder?«
»Was kümmert mich das?«, gab Lorelei kühl zurück. »Es war nie ein Wettbewerb.«
Zumindest keiner, von dem sie jemals geglaubt hatte, ihn gewinnen zu können.
»Nun«, sagte Heike, sichtlich enttäuscht darüber, Lorelei nicht verletzen zu können. »Meine Hoffnung ruht jedenfalls immer noch auf dir, und sei es nur, um Sylvias Gesichtsausdruck zu sehen.«
Die Boshaftigkeit in Heikes Stimme überraschte Lorelei nicht länger. In den Monaten, in denen sich die Gruppe auf die Expedition vorbereitet hatte, hatte Lorelei beobachtet, wie sich fast täglich zahllose Risse zwischen den Mitgliedern auftaten und wieder schlossen. Aber die Spannungen, die zwischen Heike und Sylvia schwelten, wirkten wie etwas Altes und Unvergessenes, wie ein Knochen, der nie richtig zusammengewachsen war.
Nach einer Pause beugte sich Heike verschwörerisch zu ihr. »Und um Johanns Miene zu sehen. Kannst du dir vorstellen, dass er deinen Anweisungen folgt? Ich würde lachen!«
Lorelei hatte am heutigen Tag schon zu viele Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen, um diese Bemerkung ungestraft hinzunehmen. Bevor sie es sich anders überlegen konnte, sagte sie: »Auch für dich gebe ich die Hoffnung nicht auf.«
Heikes neckisches Lächeln verblasste. »Wie lieb von dir«, erwiderte sie giftig.
Fast zwei Jahre lang hatten alle Mitglieder ihre eigenen Expeditionen unternommen, um Daten für Ziegler zu erheben. Messwerte, die sie genutzt hatte, um den ungefähren Standort des Ursprungs zu ermitteln. Lorelei kannte Ziegler seit zwölf Jahren, und inzwischen verstand sie die Theorie gut genug. Die Pflanzendichte und ihre Arten, das Verhalten der Wildeleute, sogar die Anzahl derer, die innerhalb einer bestimmten Population der Magie kundig waren … All das stand in Zusammenhang mit der Aetherkonzentration in nahegelegenen Gewässern. Wenn der Ursprung tatsächlich die Quelle sämtlicher Magie war, mussten sie nur den Werten wie einer Spur aus Brotkrumen durch den Wald folgen. Ziegler hatte ihre Erkenntnisse mit niemandem geteilt – außer mit Heike, die sie vor ein paar Wochen dazu verpflichtet hatte, ihren Kurs zu kartieren. Seitdem war Heike übel und rachsüchtig gelaunt. Lorelei konnte sich denken, warum.
Wilhelm hatte versprochen, jemanden aus der Provinz zu heiraten, in der der Ursprung gefunden würde. Heike hatte nie ein Geheimnis aus ihren Ambitionen gemacht: Wilhelms Hand und der Thron an seiner Seite. Offenkundig lag der Ursprung nicht in Sorvig.
Eine Stimme drang durch die eisige Stille: »Entschuldigung, Fräulein van der Kaas?«
Ein junger Mann – nach seinem hoffnungsvollen Gesichtsausdruck und dem angelaufenen Glas Punsch in seiner Hand zu urteilen, einer von Heikes unzähligen Verehrern – näherte sich ihnen.
»Ah, mein Getränk!« Sie nahm ihm das Glas ab. »Danke, Walter.«
»Werner«, korrigierte er.
»Richtig.« Heike starrte ihn an, als wunderte sie sich darüber, dass er noch nicht längst verschwunden war. »Kann ich noch etwas für dich tun?«
Er trat von einem Bein aufs andere. »Ihr hattet mir Euren nächsten Tanz versprochen.«
»Hatte ich das?«, fragte sie in gespielter Verwunderung. »Ich fürchte, ich bin schrecklich müde. Ah, aber Fräulein Kaskel hat den ganzen Abend noch nicht getanzt.«
»Und das werde ich auch nicht«, sagte Lorelei.
Wie zu erwarten, wich der junge Fürst zurück. Sosehr sie sich auch bemühte, es zu verbergen, entlarvte ihr Akzent sie doch als das, was sie war. Vor fünfzig Jahren hatten die Yevani mit goldenem Faden Ringe auf ihre Mäntel genäht, aber das war inzwischen überflüssig. Ihre Zunge brandmarkte sie genauso wie der Nachname, den ihr die Regierung verliehen hatte.
»Sie ist nur schüchtern.« Heikes Lächeln wurde raubtierhaft. »Na los. Frag sie.«
»Wenn ich das tue«, brachte er hervor, »reden die Leute.«
»Frag sie«, wiederholte Heike, und alle süße Verstellung wich aus ihrer Stimme. »Wenn du galant genug bist, finde ich vielleicht noch ein wenig Kraft in mir.«
Jetzt verstand Lorelei, welches Spiel Heike spielte. Beinahe hätte sie einen Hauch von Verbundenheit – oder zumindest Mitleid – mit dem armen Kerl empfunden, hätte er sie nicht angestarrt, als spiele sie ihm einen teuflischen Streich. Mit verbissener Resignation streckte er ihr eine Hand entgegen. Lorelei konnte sie nur fassungslos anstarren.
Heike musterte ihre Fingernägel. »Ist das alles, was du an Liebenswürdigkeit aufbringen kannst?«
Er erwiderte Loreleis Blick mit hitziger, gedemütigter Abscheu. »Fräulein Kaskel, würdet Ihr mir die große Ehre dieses Tanzes erweisen?«
Empörung stieg in ihr auf. »Das werde ich nicht.«
Heike lachte. »In Ordnung, das reicht. Du hast mich überzeugt. Ich will dir diesen Tanz gewähren.«
Werner sank vor Erleichterung in sich zusammen. Als Heike sich bei ihm einhakte, zwinkerte sie Lorelei zu. »Viel Glück.«
Sie brauchte kein Glück. Sie brauchte noch ein Glas Wein.
Kurz bevor das Orchester ein neues Lied anstimmte, durchbrach die klare Stimme eines Herolds das Stimmengewirr: »Seine Kaiserliche und Königliche Majestät, Wilhelm der Zweite.«
Die Menge verfiel in atemloses Schweigen. Die Türen der Empore oberhalb der Tanzfläche schwangen auf, und der leibhaftige König Wilhelm trat ins Licht der Kronleuchter. Er trug, wie immer zu öffentlichen Anlässen, einen scharlachroten Militärfrack, der mit goldglänzenden Orden geschmückt war. Offensichtlich hatte er jeden einzelnen davon selbst verdient. Als er zu Beginn seiner Herrschaft den Einigungskrieg seines Vaters wieder aufgenommen hatte, hatte er seine Armee selbst in die Schlacht geführt. Die Legende besagte, dass nicht weniger als drei Pferde unter ihm fielen, ehe er begann, junge Drachen zu zähmen. Er machte eine beeindruckende Figur: groß und breit, mit dunkelbraunem Haar, das ordentlich nach hinten gekämmt war.
Niemand wagte, sich zu bewegen, während er die Menge in Augenschein nahm.
»Guten Abend, allseits.« Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Es war immer eine seltsame Verwandlung, wenn aus einem König ein Mann wurde. »Vielen Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Mir ist bewusst, dass die meisten von euch wegen des Essens hier sind, aber wenn ihr mir gestattet, möchte ich über einen Traum sprechen. Den Traum meines Vaters, um genau zu sein.«
Das Publikum johlte gutmütig, und Wilhelms Lächeln wurde fast verlegen.
Einen Traum konnte man es sicherlich nennen. Wilhelms Vater, König Friedrich der Zweite, hatte sich zum Ziel gesetzt, alle Länder, in denen Brunnisch gesprochen wurde, unter einem Banner zu vereinen: unter seinem eigenen. Lorelei kam nicht umhin, seine unbarmherzige Effizienz zu bewundern. Vor seinem Tod annektierte Friedrich in einem ehrgeizigen militärischen Feldzug fast alle Länder und ließ dann jeden hinrichten, der sich weigerte, ihm die Treue zu schwören. Sobald die Straßen vom Blut der Verräter rot glänzten, bemächtigte er sich ihrer Länder und teilte sie unter jenen auf, die er für würdiger erachtete – oder zumindest für fügsamer.
Mit achtzehn hatte Wilhelm sowohl die Krone als auch den Traum seines Vaters geerbt. Mit zwanzig hatte er die letzten freien Länder erobert. Fünf Jahre später stand er nun vor ihnen: der König eines notdürftig vereinten Brunnestaads.
»Was mich die Vereinigung unseres Königreichs gelehrt hat, ist Folgendes: Wir Brunnestaader, egal, aus welcher Provinz wir auch kommen, egal welchen Standes oder Glaubens, haben Kampfgeist. Wir sind verdammt sturköpfig. Wenige sind es mehr als meine Freunde, und das allein ist Grund genug, warum ich sie für diese Expedition ausgewählt habe. Natürlich bedarf keiner von ihnen einer Vorstellung, aber der Förmlichkeit halber will ich sie in Verlegenheit bringen. Zuerst haben wir die reizende Heike van der Kaas, die Astronomin und Navigatorin der Expedition.« Wilhelm zwinkerte und reichte ihr die Hand. »Komm doch bitte zu mir herauf.«
Heike stieg demonstrativ die Treppe empor, wobei sie ihr Haar über die nackte Schulter und die behandschuhten Finger sinnlich über das Geländer gleiten ließ. Als sie schließlich an Wilhelms Seite trat, nahm er ihre Hand und drückte ihr einen Kuss auf die Knöchel. Sie legte ihm eine Hand auf den Arm, erhob sich auf die Zehenspitzen und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er unterdrückte ein Lachen und schob sie von sich.
Nachdem er sich wieder gefasst hatte, fuhr er fort. »Adelheid de Mohl, unsere Thaumatologin.«
Wilhelm sprach Adelheids Namen mit erstaunlich unverhohlener Begierde aus. Es war töricht, dachte Lorelei, dass ein Mann wie er eine Schwäche so offen zur Schau stellte. Adelheid ihrerseits begegnete seinem Blick mit kühler Gleichgültigkeit.
Als sie nach vorne schritt, teilte sich die Menge, als machte sie einer Königin Platz. Adelheid glich einer Statue – sie war nicht ganz so groß wie Lorelei, aber ihre Figur war stark und entschlossen: breite Schultern, kräftige Muskeln und scharfe, wie in Stein gehauene Gesichtszüge. Ihr Haar, gelb wie ein eintöniger Sommernachmittag, lag ihr zur Krone geflochten um den Kopf. Adelheid war auf eine Weise pragmatisch, wie es keiner der anderen war, von ihrem einfachen weißen Kleid bis hin zu ihrer schlichten Art. In der Provinz Ebul aufzuwachsen, in der nur die zähesten Dinge gediehen, härtete selbst eine Adelige ab. Sobald Adelheid den Balkon erreichte, hakte Heike sich bei ihr ein.
»Johann zu Wittelsbach, Held der Schlacht von Neide und unser Arzt.«
Johann schritt grimmig die Treppe hinauf, wobei sein Schatten hart über den Marmor glitt. Wilhelm schlug ihm auf die Schulter und drückte sie – ob zärtlich oder besitzergreifend oder beides, konnte Lorelei nicht sagen. Johann bewegte sich nicht, bis der König ihn wieder losließ.
Johann positionierte sich zu Adelheids rechter Seite. Eine Hand ruhte auf dem Griff seines Säbels, als wäre er bereit, ihn beim kleinsten Anzeichen von Gefahr zu ziehen. Johann und Adelheid waren beinahe unzertrennlich, er folgte ihr wie ein Schatten.
»Ludwig von Meyer, unser Botaniker.«
Ludwig tauchte aus der Menge auf, gekleidet wie eine giftige Pflanze: aufdringlich grell. Oder vielleicht eher wie ein Mann, der etwas zu beweisen hatte. Nachdem er den König mit Handschlag begrüßt hatte, drückte er sich neben Heike. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, und sie kniff ihn wie zur Vergeltung. Adelheid starrte die beiden ausdruckslos an.
»Und zu guter Letzt unsere Naturkundlerin, Sylvia von Wolff.« Als sie die Empore erklomm, musterte Wilhelm sie mit hochgezogenen Augenbrauen. »Die direkt vom Feld zu uns stößt, wie ich sehe.«
Die Menge kicherte.
Lorelei nahm Sylvias gereizten Gesichtsausdruck wahr. Dem Rest der Gruppe fiel er eindeutig ebenfalls auf. Sie sahen mit unbehaglichen Mienen zu. Sylvia jedoch ergriff ihre durchnässten Röcke mit beiden Händen und knickste vor dem König. Es schien, als besäße selbst sie den gesunden Menschenverstand, sich vor Publikum nicht mit Seiner Majestät zu streiten.
Sie erhob sich und schritt mit erhobenem Kinn an den anderen vorbei. Johann musterte sie mit einem seltsamen, lauernden Lächeln, das Lorelei einen Schauer über den Rücken jagte. Sylvia ignorierte ihn bewusst und nahm ihren Platz neben Ludwig ein. Er stupste sie ermutigend mit der Schulter an.
Eine ehrfürchtige Stille senkte sich über den Ballsaal. Nicht einmal Lorelei schaffte es, wütend zu sein. Zugegebenermaßen war es ein ergreifender Anblick. Sie alle waren so fremd und strahlend wie ferne Sterne. Als Lorelei an die Universität gekommen war, war ihr die glitzernde Pracht völlig fremd gewesen. Aber das Auffälligste auf dem Campus waren die Ruhigburger Fünf.
Sie waren ein Jahr älter als sie und trieben wie eine Einheit über den Campus – wie eine Hydra mit Köpfen, die sich stritten, oder wie eine Gruppe von Helden, die direkt einem Mythos entsprungen zu sein schienen. Es gab unzählige Gerüchte über sie, von lächerlich banalen bis hin zu absolut absurden. Dass sie alle zusammen im Krieg gekämpft hatten (wahr, bis auf Ludwig und Heike), dass Johann der einzig Überlebende der Schlacht von Neide war (fraglich), dass Adelheid nicht weniger als zehn Studenten wegen Betrugs hatte rausschmeißen lassen (möglich), dass Sylvia einmal kurzerhand den Platz einer Sopranistin eingenommen hatte, die sich kurz vor ihrem Auftritt verletzt hatte (um Gottes willen, falsch).
Bis letztes Jahr, als Ziegler Lorelei in die Gruppe holte, hätte sie niemals gedacht, dass sie sich dazu herablassen würden, mit ihr zu sprechen.
»Unser Volk ist zahlreich«, fuhr Wilhelm fort. »Aber egal, aus welcher Provinz wir kommen, ob wir von adeligem oder einfachem Blut sind – wir sind durch einen unsichtbaren Faden miteinander verbunden. Unsere Magie, unsere Sprache und, was am wichtigsten ist, unsere Geschichten. Wer von uns ist nicht mit dem Märchen vom Ursprung aufgewachsen?«
Er machte eine Pause, und ein Raunen ging durch den Saal. »Verkündet allen, dass es nicht länger nur eine Geschichte ist. Wir haben ihn gefunden.«
Seine Stimme tönte über den anschwellenden Lärm der Menge: »Die Inanspruchnahme seiner Kräfte wird Brunnestaad zu einem geeinten Königreich machen – und noch dazu zu einem unangreifbaren. Nichts wird uns mehr trennen, weder innerhalb noch außerhalb unserer Grenzen.«
Anspannung lag schwer in der Luft. Lorelei ließ den Blick über die Menge schweifen. Viele starrten hungrig zu Wilhelm hinauf, aber ebenso viele hatten seine Worte eindeutig als die Drohung verstanden, die sie waren.
»Dieser Abend ist nur der Anfang.« Seine Stimme wurde wieder sanfter. »Aber bevor wir tanzen und fröhlich sind, möchte ich die Leiterin der Expedition und meine wandelnde Enzyklopädie nach vorn bitten – Professorin Ingrid Ziegler!«
Ihr Lächeln war angespannt, als sie die Treppe emporstieg und ihren Platz auf der Empore einnahm. Zum ersten Mal an diesem Abend sah Lorelei sie wirklich. Obwohl sie wusste, dass Ziegler siebenundvierzig Jahre alt war, wirkte sie mit ihrem faltenlosen Gesicht und ihrem übermütigen Gesichtsausdruck irgendwie alterslos. Ziegler erklärte es damit, dass sie viel zu Fuß ging. Lorelei hatte ihre Zweifel, obwohl sie keine andere Antwort darauf wusste. Ingrid Ziegler war eine kräftige, rosige Frau mit klaren, blauen Augen. Ihr kastanienfarbenes Haar war von grauen Strähnen durchsetzt. Sie trug ein Kleid aus leuchtend rotem Satin, das mit Bändern und Perlen verziert war. Obwohl der brunnische Hof über die neuesten Moden informiert war, hinkte er doch deutlich hinter dem Rest des Kontinents her. Ziegler stand wie ein exotischer Vogel über ihnen.
»Guten Abend«, begann sie. »Ich möchte König Wilhelm meinen tiefsten Dank dafür aussprechen, dass er während seiner Regierungszeit als Mäzen der Künste und Wissenschaften wirkt – und dass er mich für dieses Unternehmen großzügig von meinen höfischen Pflichten entbunden hat. Es ist mir eine große Ehre, heute Abend die Universität zu Ruhigburg zu vertreten. Nun möchte ich euch die Co-Leiterin der Expedition vorstellen. Sie wird mir im Feld als rechte Hand dienen.«
Das war er: der Moment, vor dem sich Lorelei seit Monaten gefürchtet hatte. Sie wusste nicht, ob sie es ertragen würde, Sylvia dabei zuzusehen, wie sie sich im Licht ihrer aller Bewunderung sonnte. Sie konnte es nicht ertragen, noch eine weitere Nacht als der Schatten zu verbringen, der knapp außerhalb ihres Glanzes wandelte.
Sie ertrug es nicht.
»Sie ist in den Wissenschaften versiert«, fuhr Ziegler fort, »als Akademikerin angesehen, verfügt über einen ausgezeichneten Charakter und eine hervorragende Verfassung sowie großzügigen Geist und Verstand, was für dieses Projekt unabdingbar ist. Es ist mir eine große Freude, sie euch allen vorzustellen.«
Sylvia schien leicht wie Luft, bereit, abzuheben.
»Lorelei Kaskel«, verkündete Ziegler. »Würdest du bitte zu mir kommen und einige Worte sagen?«
»Was?«, fragten Lorelei und Sylvia einstimmig.
Es drang durch die brüchige Stille im Raum. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Ein Raunen ging durch die Menge, aber von irgendwo außerhalb ihrer selbst hörte sie, wie ein Ausruf wieder und wieder durch ihren Schädel hallte.
Yevanische Schlange.
Yevanische Diebin.
3. Kapitel
Die Dunkelheit ließ sich schwer zwischen den Mauern der Yevanverte nieder.