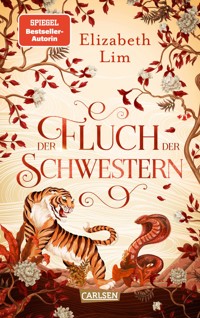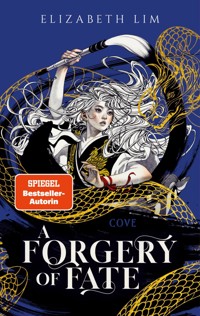
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cove
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Märchenhafte Enemies to Lovers/Forced Marriage Romantasy! Tru Saigas wollte nie eine Betrügerin werden – doch seit ihr Vater verschollen ist, wird die Familie von Schuldeneintreibern verfolgt. Tru hat keine Wahl, sie muss ihr Talent als Kunstfälscherin zu Geld machen. Noch dazu hat sie eine einzigartige magische Fähigkeit: Sie kann die Zukunft malen! Aber nicht einmal ihre Zauberkraft reicht aus, um die Familie vor den Feinden zu schützen, die sie sich in den dunklen Gassen der Stadt gemacht hat. Als die Situation ausweglos wird, stimmt Tru einem Ehevertrag mit einem geheimnisvollen Drachenlord zu, der ihr einen Neuanfang verspricht. Tru muss zu ihm in seinen verlassenen Unterwasserpalast ziehen – und eine Vision malen, die so viel verrät, dass es sie beide das Leben kosten könnte ... *** Ein Must Have für alle Fans asiatisch inspirierter Fantasy Romance **
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elizabeth Lim
A Forgery of Fate
Aus dem Englischen von Beate und Ute Brammertz
Tru Saigas wollte nie eine Betrügerin werden – doch seit ihr Vater verschollen ist, wird die Familie von Schuldeneintreibern verfolgt. Tru hat keine Wahl, sie muss ihr Talent als Kunstfälscherin zu Geld machen. Noch dazu hat sie eine einzigartige magische Fähigkeit: Sie kann die Zukunft malen!
Aber nicht einmal ihre Zauberkraft reicht aus, um die Familie vor den Feinden zu schützen, die sie sich in den dunklen Gassen der Stadt gemacht hat. Als die Situation ausweglos wird, stimmt Tru einem Ehevertrag mit einem geheimnisvollen Drachenlord zu, der ihr einen Neuanfang verspricht. Tru muss zu ihm in seinen verlassenen Unterwasserpalast ziehen – und eine Vision malen, die so viel verrät, dass es sie beide das Leben kosten könnte …
Märchenhafte Enemies to Lovers/Forced Marriage Romantasy – perfekt für alle Fans asiatisch inspirierter Fantasy Romance!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Für meine Lieblingsmädchen.Ein Buch über drei Schwestern für drei Schwestern:Charlotte, Olivia und Penelope.
1. Kapitel
Früher hielt Mama sich immer für die beste Wahrsagerin von ganz Gangsun – jedenfalls bis zu dem Tag, als Baba auf hoher See verschwand.
Ihr großes Talent lag im Lesen von Gesichtern. Anhand der Beschaffenheit der Haare konnte sie die Lebensdauer eines Menschen prophezeien, der Schwung des Mundes verriet ihr, ob jemand in der Liebe treu sein würde. Viel zu oft stellte sie sich vor Fremde und zwickte sie in die Ohrläppchen, denn dank dieser Methode konnte sie abschätzen, wie wohlhabend sie werden würden. Es gab nichts, was Mama mehr liebte als Geld.
Mit einer solchen Gabe würde man meinen, dass Mama den reichsten Kaufmann weit und breit geheiratet hätte. Ganz gewiss nicht Baba – einen leidlich erfolgreichen Händler mit blauen Haaren, hochfliegenden Träumen und gerade einmal neun Kupfermünzen. Doch so flehentlich meine Schwestern und ich auch bettelten, keiner von beiden wollte uns je ihre Liebesgeschichte erzählen. Mama erklärte lediglich mit gerümpfter Nase: »Ausländische Gesichter lassen sich schwieriger lesen. Hätte ich gewusst, dass euer Vater lieber Abenteuern als Reichtümern hinterherjagt …«
»Dann hätte sie sich trotzdem für mich entschieden«, beendete Baba den Satz an einem Herbstmorgen für sie. Seine Augen funkelten. »Eure Mutter hat von Anfang an gewusst, was ich bin.«
»Ein Pirat«, murmelte Mama. »Ein Dieb.«
»Ein Abenteurer«, sagte ich zeitgleich mit Baba. Grinsend senkte er die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. »Und früher, in einem anderen Leben, war eure Mama das auch – eine Abenteurerin.«
Fest überzeugt, dass er flunkerte, starrte ich ihn an. Es war einfach unvorstellbar, dass meine sittsame Mama Anstandsregeln brach, geschweige denn dass sie Banditen verfolgte oder sich mit Seeleuten den Reiswein teilte.
Sie bemerkte meine Skepsis und winkte ab. »Das waren damals verzweifelte Zeiten. Bevor ich meine drei Mädchen bekommen habe.«
Am liebsten hätte ich mehr erfahren, doch Baba und Mama tauschten einen Blick aus, der einen Riegel vor ihre Vergangenheit schob.
Mama hob mich auf ihren Schoß und ihr Tonfall wurde sanfter. »Zum Glück sieht dein Schicksal anders aus, Tru.« Sie berührte das Muttermal neben meinem rechten Mundwinkel. »Das hier bedeutet, dass du niemals Hunger leiden wirst, und du hast ein Talent dafür, Geld zu machen.«
»Hat sie auch ein Talent dafür, es zusammenzuhalten?«, neckte Baba sie. Argwöhnisch betrachtete er das Seidentuch um Mamas Schultern und die neuen Armreife an ihren Handgelenken. »Denn diese Fähigkeit fehlt ihrer Mutter definitiv.«
Mama sah ihn finster an, doch ihren Mund umspielte ein verräterisches Lächeln. »Mit einem Balardanen verheiratet zu sein, macht es schwieriger, das Vertrauen der Leute zu gewinnen«, erwiderte sie. Ihr Blick glitt über Babas Haare, die im sommerlichen Sonnenschein dunkelblau schimmerten. »Ich muss respektabel aussehen, damit du mir nicht all meine Kundschaft vergraulst.«
»Deine Tochter ist aber keine Kundin. Sie hat nicht darum gebeten, ihre Zukunft vorhergesagt zu bekommen.«
»Das macht mir nichts aus«, sagte ich rasch. »Ich finde es schön, wenn Mama mich liest.«
Damals entsprach das der Wahrheit. Ich war jung und naiv und niemand glaubte mehr an Mamas Fähigkeiten als ich.
Baba schnalzte mit der Zunge. Nachdem Mama aufgestanden und außer Hörweite war, beugte er sich nach unten, sodass wir auf Augenhöhe waren. »Niemand kann die Zukunft voraussehen, Tru. Nicht mal deine Mutter.«
»Aber sie sagt …«
»Mama … tut gern so«, flüsterte Baba ganz leise.
Ich runzelte die Stirn. »Das verstehe ich nicht.«
»Erinnerst du dich noch an das alte Märchen vom Fisch und dem Drachen?«, fragte er, statt mir eine Erklärung zu geben. »Das Schicksal ist den Mutigen hold, die den Sprung wagen, meine Tru. Was auch immer dein Schicksal sein mag – Reichtümer oder Liebe oder Abenteuer –, du bist deines Glückes Schmied. Nichts ist vorherbestimmt. Weder von den Göttern noch von den Linien in deiner Handfläche oder den Falten auf deiner Stirn.« Mit den Fingern zählte er meine Sorgenfalten. »Andernfalls wirst du laut diesen Linien siebzehn Kinder bekommen.«
Das brachte mich zum Kichern.
»Siehst du? Es ist Unsinn.« Baba zerzauste mir die Haare. Dann zog er – wie von Zauberhand – ein hölzernes Schiff hinter meinem Kragen hervor.
»Oh«, hauchte ich, als Baba das Kleinod in meine Hand gleiten ließ. Es war nicht größer als eine Teetasse und noch nicht fertig geschnitzt, aber die glatt geschmirgelten Segel und der Umriss eines prächtigen Phönix am Bug ließen erahnen, wie kunstvoll es einmal sein könnte. »Das wird deine schönste Schnitzerei.«
»Ich glaube auch«, stimmte Baba mir zu.
Die große Liebe meines Vaters galt nach seiner Familie der Kunst und dem Meer. Wenn er fort war, schnitzte er uns kleine Holzfiguren von wundersamen Dingen, denen er auf seinen Reisen begegnete: Affen und Tiger, Schattentheater, halbmondförmig geschwungene Brücken – meine kleinen Schwestern und ich hatten eine ganze Sammlung unter dem Bett. Doch zum ersten Mal zeigte er mir ein Kunstwerk, an dem er immer noch arbeitete.
»Wenn es fertig ist, möchte ich, dass du es für mich anmalst.«
Ich riss die Augen auf. »Ich?«
»Ja. Falina sagt, du machst dich in meiner Abwesenheit heimlich an meinem Schrank zu schaffen. Der mit den ganzen Farben und Pinseln.«
Verdammter Dämonenmist, natürlich hatte sie mich verpetzt. Insgeheim wünschte ich mir missmutig, meine kleine Schwester wäre niemals geboren worden.
Am liebsten hätte ich den Diebstahl abgestritten, aber bei uns zu Hause gab es eine unumstößliche Regel: Familienmitglieder durften nicht angelogen werden. »Das war nur ein Mal«, räumte ich ein. »Vielleicht zweimal.«
»Warum?«
»Aus Neugier. In der Bäckerei von Tante Lili hab ich ein Bild der Zwillingsberge gesehen und sie haben ausgesehen wie zwei nebeneinanderliegende Birnen. Sie hat gesagt, dass sie die Zeichnung für dreißig Jen gekauft hat.« Ich fuchtelte mit den Armen herum. »Dreißig Jen! Ich wollte ihr sagen, dass ich sie besser zeichnen kann, und zwar für zwanzig.«
»Konntest du das denn?«
Ich verzog die Mundwinkel zu einem Lächeln. Mein Stolz wäre eines Tages noch mein Ruin. »Ja.«
Aus Babas Kehle drang herzhaftes Gelächter. »Genau das wollte ich hören. Balardanen liegt die Kunst im Blut, Tru. Ich hatte gehofft, dass eines meiner Mädchen einmal zum Pinsel greifen würde.« Er entrollte die Ledertasche, die er am Gürtel trug, und seine Finger verharrten über mehreren Schnitzmessern, bevor sie nach einem schmalen Pinsel griffen. »Hier, damit kannst du anfangen.«
Als ich den Pinsel zwischen zwei Fingern hielt, war ich über seine Leichtigkeit überrascht. Er war weiß und lief spitz zu, wie das Ende eines Pferdeschweifs. Der Griff bestand aus Bambus. Solche Pinsel hatte ich schon zu Dutzenden auf dem Marktplatz gesehen, doch dass Baba ihn für mich gekauft hatte, machte ihn zu etwas ganz Besonderem.
»Die Borsten sind aus Wieselhaar.« Baba wirkte ein wenig verlegen. »Nicht sehr elegant, aber mit ihnen kann man die saubersten Linien zeichnen. Das ist bei einem Zauberpinsel unverzichtbar.«
»Ein Zauberpinsel?«
»Ein Spiel, das ich als Junge gespielt habe. Früher habe ich immer alles gemalt, was mir in den Sinn kam: fliegende Segelschiffe, Vögel, die Geschichten erzählen, und Laternen, die nie erlöschen.« Er beugte sich vor und flüsterte verstohlen: »Dann habe ich jedes Mal ›Zauberpinsel‹ gesagt und sie sind alle zum Leben erwacht.«
»Wirklich?«, hauchte ich.
»Nun, nicht wirklich«, gestand Baba. »Es ist ein Spiel mit der Fantasie. Ein Spiel, bei dem die einzigen Regeln und Beschränkungen von hier kommen.« Er tippte an meine Stirn.
Staunend stieß ich den Atem aus. »Woher weiß man dann, wer gewinnt?«
»Bei den besten Spielen gibt es keine Sieger oder Verlierer.«
Ich stellte mir vor, wie ich zusammen mit meinen Schwestern spielte. Fal würde sich nur Kleider und Juwelen wünschen, und Nomi – in meine Gedanken mischte sich Zärtlichkeit – würde sich einen berghohen Bücherstapel erträumen. Meine jüngste Schwester war ein Genie. Mit gerade einmal vier Jahren konnte sie schon besser lesen als Fal und ich.
»Mal mit dem Pinsel etwas Reales oder mal etwas, das es nicht gibt«, sagte Baba. »Solange dich das Malen eines Motivs glücklich macht, ist es die beste Übung.«
Mein Herz quoll über. »Danke, Baba.«
»Meine Farben gehören jetzt dir.« Er hielt mir das Holzschiff vor die Nase. »Denk darüber nach, welche Farben du dafür verwenden willst. So es das Schicksal will, wird es eines Tages ein echtes Schiff sein, auf dem wir gemeinsam in See stechen.«
»So es das Schicksal will?« Ich zog eine Augenbraue hoch. »Wir schmieden unser eigenes Schicksal, schon vergessen?«
Er lachte. »In der Tat, Tru. Das machen wir.«
In den folgenden Wochen entwickelte sich der »Zauberpinsel« rasch zu meinem Lieblingsspiel. Jeden Nachmittag vertrieben wir uns damit die Zeit, während Mama in der Küche Menschen das Schicksal an der Stirn ablas.
Nomi liebte unsere Spiele. Fal ging es genauso, selbst wenn sie es niemals zugegeben hätte. Sie stand über meine Schulter gebeugt da, während ich den sprechenden Fischen und singenden Bäumen aus Nomis Geschichten Leben einhauchte, und verfolgte jeden Pinselstrich mit kritischem Blick. Abends zankten wir uns dann wegen des Schiffs, das ich für Baba bemalen würde. Fal wollte es rosa haben, Nomi hingegen lila. In meinen Träumen war es immer blau – wie der endlose Himmel über der See – mit von Sternenlicht angetriebenen Phönixschwingen. Sobald ich erst einmal erwachsen war, würde ich zusammen mit Baba lossegeln und es mit der ganzen Welt aufnehmen.
Damals hatte ich nicht die leiseste Ahnung, dass das Schicksal anderes mit mir vorhatte.
Mit meinem Haar fing es an. Kurz nach meinem zehnten Geburtstag veränderte es über Nacht die Farbe. »Banditenblau«, zischte meine Mutter, als sie es sah. Mein Anblick sorgte überall in der Stadt für Entsetzen – genauso gut hätte ich mit drei Köpfen oder einem zusätzlichen Paar Arme auf die Welt kommen können.
Mama war am Boden zerstört. Sie machte sich auf die Suche nach Zaubertränken, um das Schwarz meiner Haare wiederherzustellen, aber Magie war kostspielig und außerdem schwer zu beschaffen. Deshalb bereitete sie selbst alle möglichen Gebräue zu, die ich trinken sollte.
Nichts erzielte die gewünschte Wirkung. Kein Elixier, kein Färbemittel, noch nicht einmal ein Hut konnte das elektrisierende Blau meiner Haare vollständig kaschieren, und schnitt man sie ab, wuchsen sie bloß umso schneller nach. Insgeheim fand ich sie toll. Im Gegensatz zu Falina, die sowohl von Mama als auch Baba die jeweils schönsten Merkmale geerbt hatte, hätte mich niemand eines zweiten Blickes gewürdigt, wäre da nicht mein Haar gewesen. Das Getuschel, das es heraufbeschwor, betrübte Fal, die am liebsten nichts mit mir zu tun gehabt hätte. Selbstverständlich sorgte das lediglich dafür, dass ich meine blaue Haarfarbe noch grandioser fand.
Als ich dreizehn Jahre alt war, war das Blau so intensiv, dass Baba scherzte, wenn er einen Farbstoff daraus entwickeln könnte, wären wir reich genug, um ein Haus in der Oyang-Straße zu erstehen, wo nur die reichsten Kaufleute Anwesen besaßen.
»Wie kannst du über eine solche Katastrophe auch noch scherzen?«, klagte Mama. »Ihre Heiratsaussichten sind ruiniert.«
»Wunderbar«, sagte Baba. »Dann kann sie mit mir zur See fahren.«
Entsetzt starrte Mama ihn an. »In Balar würdet ihr Barbaren aus einem Mädchen vielleicht eine Abenteurerin machen, aber hier …«
»Hier in Gangsun darf eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns kein Geschäft führen«, unterbrach Baba sie. »Sie kann noch nicht mal ihr eigenes Haus besitzen. Meinen Mädchen soll es später anders ergehen.«
»Ja, denn sie werden reich heiraten«, sagte Mama, die immer das letzte Wort haben musste.
Danach waren meine Haare kein Thema mehr, denn ein paar Tage darauf verkündete Baba, dass er in See stechen würde. Er hatte sich zu einer dringenden Reise um die halbe Welt bereit erklärt. Genaueres konnte er uns nicht sagen. Doch seine geheimen Missionen waren nichts Neues.
»Wirst du über die Taijin-See fahren?«, wollte Nomi wissen, während Baba seine wärmsten Mäntel in seinen Reisekoffer packte. Meine Schwester hielt einen halben Schmalzkuchen – der Rest des Frühstücks – in der Hand und sprach mit vollem Mund. »Dort sollen Drachen hausen. Wirst du dich mit einem anfreunden, falls du einen siehst? Versprich es mir, Baba! Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als im Laufe meines Lebens die Bekanntschaft eines Drachen zu machen.«
Baba lachte leise. »Ich habe die Taijin-See schon dreizehnmal überquert, Nomi, und einem Drachen bin ich noch kein einziges Mal begegnet. Aber wenn mir einer über den Weg laufen sollte, werde ich ihn ganz bestimmt von dir grüßen.«
»Und gib ihm auch das hier.« Nomi holte den letzten Schmalzkuchen aus Mamas Pfanne. Mit geschlossenen Augen atmete sie den Duft ein und reichte das Gebäckteil daraufhin Baba, als wäre es ihr wertvollster Schatz. »Freundschaft geht durch den Magen.«
Da umarmte Baba sie und ich schmiegte mich ebenfalls an die beiden. Selbst wenn ich hundert Schwestern hätte, wäre Nomi mir immer die allerliebste.
»Wohin fährst du, Baba?«, bohrte Falina nach. »Musst du denn immer so geheimniskrämerisch sein?«
»Es ist bloß ein Geheimnis, weil ich die Einzelheiten meines Auftrags noch nicht kenne«, erwiderte Baba. »Ich weiß nur, dass man im Norden einen Schatz gefunden hat und ich ihn in die Hauptstadt schaffen soll.«
»Wie lange wirst du fort sein?«, fragte ich.
»Ich hoffe, ich bin spätestens im Winter wieder da.«
»Im Winter!« Falina war missmutig und ausnahmsweise konnte ich es ihr nicht verdenken. »Bis dahin sind es noch Monate.«
»Gerade rechtzeitig zum ersten Schneefall«, antwortete Baba. »Und lieben wir – meine Kiefer, meine Pflaume, mein Bambus – den Schnee denn nicht alle sehr?«
Auf Babas Worte hin verkniffen meine Schwestern und ich uns jegliche weiteren Klagen. Zu den Namen hatte ihn sein Lieblingsgemälde mit drei schneebedeckten Bäumen inspiriert: Nomi war der Bambus, Falina die Pflaume und ich die Kiefer. Trotz der Kälte überlebten diese Bäume nicht nur, sondern sie gediehen prächtig. Es war seine Art, uns zu ermahnen, dass wir stark sein sollten.
»Keine langen Gesichter mehr«, sagte Baba. »Eure Mutter ist die Einzige, die lächelt.«
Mama war geradezu selig, was man allein schon aus dem Frühstück hatte schließen können. Gewöhnlich bestand unsere morgendliche Kost aus dünner Gemüsebrühe und angebranntem Reis, doch heute hatte uns ein Festmahl erwartet. Es gab Fisch-Congee mit sämtlichen Toppings – Schnittlauch und getrocknete Krabben und gesalzene Eier – und eine Riesenpfanne mit ihrer Spezialität: Schmalzgebäck. Schmalzkuchen gab es bei Mama nur, wenn sie gute Aussichten für unsere Zukunft vorhersah.
»Diese Reise wird alles verändern«, hatte sie gesagt und ein Gebäckteil in Nomis Schüssel mit Congee fallen lassen. »Das spüre ich.« Nach dem Essen rief sie uns zu Baba. »Kommt und sagt eurem Vater, welche Geschenke er euch mitbringen soll.«
»Perlen und Opale«, platzte Falina heraus, die immer als Erste an die Reihe kommen musste. »Für jeden Wochentag ein neues Seidenkleid mit passendem Jäckchen – und Pantoffeln! Bestickte Pantoffeln mit nach oben gebogenen Spitzen.« Sie hielt inne und warf mir einen Blick zu. »Malst du auch alles mit, Tru? Baba soll meine Wünsche nicht vergessen.«
Fals Lieblingsbeschäftigung bestand darin, mir auf die Nerven zu gehen. Während ich mir große Mühe gab, nicht die Augen zu verdrehen, hielt ich zögerlich den Pinsel über das kostbare Stück Leinenpergament, das ich mir für den heutigen Tag aufgespart hatte. »Mehr nicht?«, fragte ich ironisch und machte mich an ein Porträt von Falina mit Opalohrringen und einem perlenbesetzten Kopfschmuck. Zwar war es verlockend, sämtliche Kleider zerlumpt und fleckig zu malen, aber ich widerstand der Versuchung. Auch wenn sie alles andere als meine Lieblingsschwester war, brachte es Unglück, mit meinem Zauberpinsel etwas Trauriges zu malen.
»Mal noch einen Bronzespiegel dazu«, verlangte sie, »wie ihn die Prinzessinnen in Jappor haben.«
»Woher weißt du, was die Prinzessinnen in Jappor haben?«, wollte Baba wissen.
»Mama hat es mir erzählt.«
»Aber natürlich.« Baba tauschte ein Lächeln mit unserer Mutter. »Spiegel sind teuer, Falina, aber ich werde sehen, was sich machen lässt.«
»Danke, Baba.« Fal küsste ihn auf die Wange. Als Nächstes war Nomi an der Reihe, die sich jedes Mal das Gleiche wünschte.
»Ich hätte gern einen Sack voller Bücher.« Sie sprach mit betont tiefer Stimme und legte so viel Ernst hinein, wie es ihr mit ihren acht Jahren möglich war. »Und wenn du keinen Drachen findest, genügt mir auch eine Meerjungfrau.«
»Eine mit grünen Locken und einem lila, aus Zwielicht gemalten Schwanz?« Ich wusste bereits Bescheid.
»Und Perlen unter den Augen«, fügte Nomi aufgeregt hinzu. »Ich habe gelesen, dass Meerjungfrauen Perlen weinen. Die reinsten Perlen im ganzen Meer.«
»Das hört sich schmerzhaft an«, stellte Falina fest.
»Nicht für eine Meerjungfrau«, sagte Nomi. »Es ist genauso natürlich, wie wenn Bienen Honig herstellen.«
Während Fal die romantischen Vorstellungen unserer Schwester mit einem abschätzigen Zungenschnalzen quittierte, ließ ich Nomi ihren Willen und fügte einen Drachen und eine Meerjungfrau zu meinem Bild hinzu. Dank Fals Kleidern war kaum noch Platz auf dem Papier, aber ich war ausgesprochen stolz auf meinen Drachen. Da ich nicht wusste, wie Drachenschuppen oder ihre Schnauzen aussahen, hatte ich etliche spitz zulaufende Ovale gezeichnet, die am Ende eher wie Tränen aussahen, und eine gerade und stolze Schnauze – die Art Nase, die laut Mama einen Geldregen bedeutete – sowie einen Schwanz, der wie eine Flamme ausfranste.
»Ich glaube nicht, dass Drachen solche Beine haben.« Fal rümpfte die Nase. »Er sieht aus, als würde er gehen und nicht schwimmen.«
»Mir gefällt er«, ergriff Nomi Partei für mich. »Er sieht majestätisch aus. Beinahe echt.«
Er wirkte tatsächlich echt, allerdings hatte ich ihm noch keine Pupillen gemalt. Baba meinte, die Augen eines Drachen seien sein Geist, und wenn man ein so unberechenbares Wesen wie einen Drachen zeichnete, sollte man sie immer erst ganz zum Schluss hinzufügen – damit er nicht aus dem Papier heraussprang und einen mit sich nahm.
»Vergiss nicht, Platz für deinen eigenen Wunsch übrig zu lassen, Tru«, ermahnte mich Baba. »Was hättest du gern?«
Ich musste nicht lange überlegen. »Ich möchte, dass du das hier fertig schnitzt.« Ich reichte ihm das kleine Holzschiff, das er mir vor Jahren gemacht hatte. »Ich bin so weit, es anzumalen.«
Baba lächelte, doch als er mir das Schiff aus den Händen nahm, lag Wehmut in seinem Blick.
»Habe ich was Falsches gesagt?«, fragte ich besorgt.
»Nein, gar nicht.« Er steckte das Holzschiffchen in seine Tasche. »Mir ist nur gerade in den Sinn gekommen, wie viel größer meine Mädchen sein werden, wenn ich sie das nächste Mal sehe.«
Mit diesen Worten umarmte er Nomi, verwuschelte mir das blaue Haar und tätschelte Falinas Zopf, dann legte er den Arm um Mamas Taille. Sie verzog das Gesicht, doch als sie sich von uns unbeobachtet wähnte, schmiegte sie sich enger an ihn.
Meine Zeichnung war fertig. Ich hatte uns fünf vor Babas Schiff gezeichnet, in der Luft tanzten Fals Kleider unter den skeptischen Blicken von Nomis Drachen. In der Mitte prangte als Glücksbringer eine extragroße Pfanne mit Schmalzgebäck. Gemeinsam bliesen wir das Bild trocken, dann sangen meine Schwestern und ich einstimmig, als wären wir Priesterinnen, die ein Amulett segneten: »Zauberpinsel.«
Baba umarmte eine von uns nach der anderen. Als ich an die Reihe kam, wollte ich ihn nicht loslassen.
»Vergiss das Holzschiff«, flüsterte ich ihm ins Ohr. »Oder Fals Kleider und Nomis Meerjungfrauen. Versprich nur, dass wir nächstes Mal alle mitkommen dürfen.«
Mit funkelnden Augen legte Baba den Kopf schräg. »Bist du dir sicher, dass Fal das wollen würde?«
»Dann eben Nomi und ich.« Lächelnd schob ich ihm die Enden seines grünen Schals über die Schultern. »Sie kann nach Drachen Ausschau halten, während ich unseren Schatz zähle.«
»Du bist mein Schatz.« Baba gab mir einen Kuss auf die Stirn. »Du und deine Schwestern und deine Mutter.« Zärtlich berührte er mein Haar. »Und diese Fahrt wird das letzte Mal sein, dass ich meine Schätze zurücklasse.«
Dann brach er zum Hafen auf, seine Reisetruhe unter dem einen Arm, während am anderen eine Ledertasche baumelte. Unter der halb offenen Klappe lugte eine Ecke meines Bildes hervor. Nomi und ich liefen zum Fenster und beobachteten, wie er sich durch die Menschenmenge auf der Straße schlängelte. Zum Glück war er dank seines balardanischen Blutes von großer Statur, sodass ich ihn mit den Augen verfolgen konnte, bis er um die Ecke bog.
Als er außer Sicht war, schloss ich die Fensterläden und begann mit dem Abwasch. Baba hatte uns schon unzählige Male verlassen. Es bestand kein Grund zu der Annahme, dass diesmal irgendetwas anders sein würde.
Wie sehr ich mich doch täuschte.
***
Vier Monate später, am grauen winterlichen Morgen vor Neujahr, ging in der Küche eine Kanne zu Bruch.
Nomi hörte es, da sie den leichtesten Schlaf von uns dreien hatte. Sie fuhr hoch und weckte mich mit einem Tritt. »Was war das?«
Ich regte mich nicht und lauschte auf das Nachhallen des Geräuschs. Stille.
»Keine Ahnung«, flüsterte ich zurück. »Vielleicht eine Ratte.«
Nomi riss entsetzt den Mund auf. »Eine Ratte?«
»Sie sind aus ihren Löchern gekrochen, um feiernd das neue Jahr zu begehen«, neckte ich sie, während ich mich aufrecht hinsetzte, um aus dem Fenster zu spähen. An den Lärchen hingen Laternen und über Nacht waren Wasserglockenblumen aufgeblüht. Die sternförmigen Blumen mit ihren blauen Blüten waren die ersten Vorboten des Frühlings – und meine Lieblingsblumen. »Schau nur, die ganzen Geschäfte haben Rattenbanner aufgehängt. Morgen beginnt ihr Jahr.«
Nomi rieb sich die Augen. »Ich hasse das Jahr der Ratte.«
»Sag das nicht. Es ist das erste Jahr eines neuen Zyklus.«
»In Balar gibt es kein Jahr der Ratte. Dort werden die Jahre bloß mit Ziffern gezählt. Das ist sinnvoller, um den Überblick zu behalten, findest du nicht?«
Nomi, sie war so jung und leider schon voll praktischer Vernunft.
Da riss sie den Kopf herum und setzte sich ruckartig im Bett auf. »Ich höre Mama.«
Ich ebenfalls. »Bleib du hier im Warmen«, befahl ich ihr und begann, über Falina zu klettern – die Watte in den Ohren hatte und einen Monsun verschlafen konnte. »Ich schaue nach, was los ist.«
In der Küche fand ich Mama schluchzend vor. Erst dachte ich, sie weinte wegen der zerbrochenen Vase mit Wasserglocken – die geknickten Blumen und orangefarbenen Tonscherben lagen über den gefliesten Boden verstreut.
Dann erblickte ich den Brief in ihrer Hand.
Mein Herz wurde immer schwerer, bis ich kaum noch atmen konnte. Ich brachte bloß ein einziges gekrächztes Wort heraus: »Baba.«
Niemals sollte ich vergessen, wie die Luft schlagartig aus Mama entwich, als sie zu mir herumwirbelte. Wie ein Muskelstrang in ihrer Wange zuckte und sie die Lippen fest zusammenpresste, als wünschte sie sich um meinetwillen, dass ich noch schliefe. Sie sackte gegen die Wand und der Brief entglitt ihrer Hand. Ich fing ihn auf, bevor er in die schmutzige Wasserlache fiel.
Das Papier war an den Falzen feucht, die knallrote Tinte von Regen verlaufen. Bei den Schriftzeichen in Babas Namen fehlten ein paar Pinselstriche – Bürokraten wussten nie, wie man seinen Namen ins A’landanische übersetzte –, aber dennoch bestand kein Zweifel: ANDIEFAMILIEVONARBANSAIGAS.
Meine Augen brannten, und während ich las, verschwamm die Tinte. Babas Schiff war in ein Unwetter geraten. Dank ihm hatte der Großteil der Besatzung überlebt. Doch Baba selbst war verschollen.
Verschollen. Das Wort explodierte in meinem Kopf und auf einmal hatte ich das Gefühl, in den Seiten von Nomis Wörterbuch zu schwimmen und nach einer Bedeutung des Wortes zu suchen, die nicht vermisst, verschwunden, fort lautete.
Tot.
Nein, nein, das durfte nicht sein.
»Ist Baba …« Ich brachte den Rest des Satzes nicht über die Lippen. Meine Knie gaben nach und anstelle der Wörter entrang sich meiner Kehle ein erstickter Schrei. Mama hielt mir mit der Hand den Mund zu.
»Weck deine Schwestern nicht auf. Lass sie noch ein wenig schlafen.«
Doch dafür war es zu spät. Mit halb zugeknöpfter Jacke stand Nomi hinter der Tür und schlüpfte nun aus den Schatten. Sie hatte alles mit angehört. Falina ebenfalls.
Falina nahm Nomi in die Arme. Die Lippen meiner jüngsten Schwester hatten sich bläulich verfärbt und sie fasste sich hustend an die Brust, da ihre Lunge vor Schreck krampfte.
Mit Tränen in den Augen klopfte Fal unserer Schwester auf den Rücken. »Hör auf, Nomi.«
Da mir nichts Besseres einfiel, griff ich nach Nomis Hand und wischte ihr mit meinem Ärmel die Nase ab. Alles wird gut, wollte ich ihr sagen. Fal und ich werden uns um dich kümmern.
Doch die Worte wollten nicht kommen. Nur Tränen.
Ich schlang die Arme um meine Schwestern und dichtete den Morgen in Gedanken verzweifelt um. Ein Morgen, an dem Baba heimkehrte, wie er es immer tat. Mit Geschenken, mit kleinen geschnitzten Tieren, mit in Bananenblätter gewickelten Süßigkeiten und neuen Geschichten. Jeden Augenblick würde er forschen Schrittes durch die Tür kommen.
Doch während die Sekunden verstrichen, wurde immer deutlicher, dass jede von mir heraufbeschworene Szene eine Illusion war. Ein fantastischer Traum, nichts weiter. Nichts kam gegen die schmerzhafte Realität an, dass Mama zusammengesackt an der Wand lehnte und Babas Name in Rot die Halbmonde ihrer Fingernägel verschmierte. Baba, tot.
Da platzte es aus Mama heraus: »Euer Vater ist nicht tot.«
Nomi japste nach Luft. »Was?«
»Er ist nicht tot«, wiederholte Mama.
Unsicher hob Fal den Blick. »Aber dieser Brief … Baba … Baba ist auf hoher See verschollen.«
»Verschollen bedeutet nur, dass man ihn noch nicht gefunden hat«, sagte Mama. »Ich bin die beste Wahrsagerin in ganz Gangsun. Das heißt, ich bin praktisch die beste auf der ganzen Welt.«
»Kannst du ihn finden?«, wagte Nomi zu fragen.
»Ja«, antwortete sie. »Aber zuerst brauche ich Geld.« Ihre Kiefer pressten sich aufeinander. »Davon hat uns euer Vater nicht viel dagelassen.«
Ihr Tonfall war angespannt, aber nicht aus Verbitterung, sondern aus Sorge. Diese Seite kannte ich gar nicht an Mama. Sie zog sich ihre Handschuhe an und griff nach ihrem Korb. »Fegt den Boden. Ich bin in einer Stunde wieder zurück.«
»Wohin gehst du?«
Mama zögerte. »Reis kaufen.«
Der Reis war bloß ein Vorwand, das wusste ich. Sie würde Babas Geschäftspartner aufsuchen und Antworten einfordern – und Geld. Da er nun nicht zurückkommen würde …
Ich tupfte Nomi mit meinem Ärmel die Tränen weg. »Wein, so viel du willst«, sagte ich und hielt sie eng umschlungen.
Während Nomi in meinen Armen schluchzte, verließ Mama ohne ein weiteres Wort das Haus.
Fal berührte Nomi an der Schulter. Nomi war auch ihre Lieblingsschwester und wir stritten uns nur nicht, wenn es um sie ging. »Hast du nicht gehört, was Mama gesagt hat?«, fragte sie. »Sie wird ihn finden.«
Die Überzeugung in Fals Stimme ließ Nomi aufblicken.
»Ihr … ihr glaubt wirklich, dass er … dass er am L-Leben ist?«, wollte sie zitternd wissen. Sie atmete tief ein. »Ihr glaubt … ihr glaubt, dass Mama ihn finden kann?«
Fal sah mich an und in ihren blutunterlaufenen Augen spiegelte sich die gleiche verzweifelte Hoffnung wider wie in Nomis.
Der Brief hing mittlerweile schlaff in meiner Hand, das grobe Papier war tränenbefleckt. Rote Tinte hatte Flecken an meinen Fingerspitzen hinterlassen, ein Anblick, der sich mir für immer ins Gedächtnis brennen sollte, selbst nachdem ich mir die Hände längst abgewischt hatte.
Nein, hätte ich sagen sollen. Ich glaube nicht, dass sie das kann.
Das wäre die Wahrheit gewesen. Doch zum ersten Mal hatte ich die Risse in Mamas steinerner Fassade gesehen. Ich wusste, dass sie sich verstellte. Sie hatte keine andere Wahl. Unseretwegen.
Und da unser Schicksal zu Asche geworden war, ließ auch ich mir nichts anmerken.
»Ja«, log ich meine Schwestern an. »Das glaube ich.«
2. Kapitel
Fünf Jahre später
Ich war nicht in der Stimmung für Diebe.
An jedem anderen Tag hätte ich mich vielleicht geschmeichelt gefühlt, dass sie es auf mich abgesehen hatten. Heute allerdings nicht.
Es hatte mich einen ganzen Monat gekostet – meistens mit leerem Magen –, das Bild zu fälschen, das ich zusammengerollt unter dem Arm trug, und ich wollte das verdammte Ding einfach verkaufen und endlich etwas anderes als gedämpften Kohl und Teigtaschen zu essen bekommen. Tagein, tagaus kohlgefüllte Teigtaschen. Weiß Gott, heute Abend würde ich vier Hühnchen mit nach Hause bringen. Und einen Topf voll gebratener Nudeln.
Wenn ich das Bild verkaufen könnte, wäre das mein bislang größtes Geschäft. Mein Ziel war, mindestens dreitausend Jen rauszuschlagen. Das Auktionshaus bekäme ein Drittel, und Gaari und ich würden uns den Rest teilen. Die Übereinkunft wurmte mich gewaltig, aber das war unser Deal, seit wir das erste Mal zusammengearbeitet hatten, und so ungern ich es auch zugab, sein Anteil war redlich verdient. Es war nicht leicht, einen Händler wie ihn zu finden, der Wort hielt. Oder dem ich vertrauen konnte … zumindest meistens.
Bohrender Hunger nagte an mir und ich klemmte mir die kostbare Fracht fester unter den Arm, während ich Haken schlagend nach links abbog und mit aller Gewalt versuchte, keinen Blick über die Schulter zu werfen. Zwanzig Schritte hinter mir verfolgte mich ein Trio aus Gangsuns niederträchtigsten Kunstdieben.
Jeden anderen hätten sie mit ihrer ganz passablen Verkleidung als Gelehrte hinters Licht geführt. Sie trugen die typischen geknöpften Jacken in stumpfem Blau, mit passenden schiffchenförmigen Hüten und eidottergelben Fächern. Doch Gelehrte, denen die Adern am Hals hervorstanden und Messer aus den Ärmeln lugten, schlichen normalerweise nicht am Marktplatz herum. Diese Diebe hier bräuchten mehr Schauspielunterricht.
Und Gangsun bräuchte staatliche Präfekten, die tatsächlich für Recht und Ordnung sorgten, grummelte ich still in mich hinein. Ich warf den zwei Präfekten mit ihren elfenbeinfarbenen Kragen, an denen ich vorbeikam, einen finsteren Blick zu, doch die waren viel zu sehr damit beschäftigt, einem Heuschreckenrennen zuzusehen, um mich zu bemerken, eine angebliche Adlige, die versuchte, nicht über ihr tückisches Kleid zu stolpern.
Um ehrlich zu sein, kam mir das allerdings gelegen. Obwohl die Diebe hinter mir eine gehörige Tracht Prügel mit Gouverneur Renhais Rohrstock verdient hätten, war ich selbst ebenfalls nicht die gesetzestreueste Bürgerin. Wenn ich darüber nachdachte, stand auf meine Verbrechen wohl eine längere Gefängnisstrafe.
Um möglichst einen Zahn zuzulegen, hob ich meinen Rock an und verfluchte Gaaris Ratschlag, mich an diesem Tag als Adlige auszugeben.
Deine Kunst wird einen höheren Preis einbringen, wenn du reich aussiehst, hatte er gesagt.
Wehe, wenn er sich täuschte.
Normalerweise waren die Sommer in Gangsun kühl, heute herrschten allerdings ausgesprochen hohe Temperaturen. Schweiß sammelte sich an meinem Haaransatz und – Mist! – meine Perücke juckte. Doch ich wagte nicht, mich zu kratzen. Meine eigenen blauen Locken waren unter einem hohen Berg an schwarzen Knoten und Zöpfen versteckt, die Fal den ganzen Vormittag über zusammengebastelt und mit Pfauenfedern und seidenen Chrysanthemen festgesteckt hatte.
»Bist du sicher, dass mich das reich aussehen lässt?«, hatte ich meine Schwester gefragt. »Es ist wie ein Turm aus Brötchen und wiegt auch so viel.« Ich wollte den Kopf drehen, konnte mich aber kaum bewegen, ohne dass meine Perücke bedrohlich verrutscht wäre.
»Hör auf damit!«, rief Fal. »Ich bin noch nicht fertig.«
Während Fal die Perücke mit zwei weiteren Haarnadeln an meinen Schläfen fixierte, machte auch ich mich ans Werk. Ich sog die Wangen ein und fuhr großzügig Konturen nach, damit mein Gesicht voller und weniger hungrig aussah, dünnte meine dichten Augenbrauen mit hautfarbener Creme aus und sorgte mit Farbe für einen zarteren Nasenrücken. Innerhalb weniger Minuten sah ich vollkommen anders aus. Wohlgenährt und reich, nicht mehr eine Bäuerin von der Straße. Meine Haare hingegen …
»Ich finde trotzdem, dass es wie ein Turm aus Brötchen aussieht«, murmelte ich. »Überdimensionale Brötchen, findest du nicht, Nomi?«
»Um Sainos willen, du bist doch Porträtmalerin«, schnaubte Fal, bevor Nomi eine Antwort geben konnte. »Bekommst du denn gar nichts mit? Alle Damen ersten Ranges tragen ihre Haare genau so.«
»Warum sollte ich wie eine Dame ersten Ranges aussehen wollen?«, fragte ich und überpinselte geschickt mein Muttermal. Stattdessen malte ich mir ein neues direkt neben mein Auge. »Bestenfalls gehöre ich dem achten an.«
Fal steckte eine Feder in meine Perücke. Und zwar fest. Als ich schmerzgepeinigt zusammenzuckte, erwiderte sie: »Trotzdem reich. Jeder, der reich ist, will aussehen, als gehörte er dem ersten Rang an.«
»Jeder, der reich ist, trägt aber nicht solche Schuhe«, gab Nomi zu bedenken, die von ihrem Buch hochsah und mit einem Nicken auf meine Füße zeigte. »Du hättest dich lieber wieder als Mönch verkleiden sollen.«
Mein Blick schoss nach unten. Verdammter Dämonenmist, sie hatte recht. Adlige trugen keine flachen Strohsandalen, die ebenso gut als Pferdefrühstück durchgingen. Sie besaßen Seidenpantoffeln mit gestickten Pfingstrosen und kleinen, nach oben gebogenen Schuhspitzen, deren Zweck sich mir einfach nicht erschloss.
»Kannst du den Saum an meinem Kleid auslassen, Fal?«, fragte ich.
»Es ist nicht dein Kleid«, entgegnete sie. »Sondern das der Änderungsschneiderei, die mich rausschmeißen wird, wenn ich schon wieder nicht rechtzeitig liefere …«
»Ich kann so nicht rausgehen. Außer du willst den Rest deines diesjährigen Lohns darauf verwenden, mich aus dem Gefängnis zu holen.«
Mit einem leisen Murren machte sich meine Schwester an die Arbeit. »Pass bloß auf, dass das Kleid nicht schmutzig wird«, warnte sie mich, als sie fertig war. »Mrs Su ist bereits argwöhnisch wegen des Risses, den ich das letzte Mal wegen dir zunähen musste.«
»Ich gebe mein Bestes.«
»Und, Tru?« Fal verschränkte die Arme vor der Brust, doch die Besorgnis in ihren Augen war aufrichtig. »Pass auf, nicht ausgeraubt – oder umgebracht – zu werden.«
Oh, und ob ich aufpasste!
Manchmal wünschte ich, Fal müsste in diese Rollen schlüpfen. Wenn meine kleine Schwester etwas Gutes besaß, dann war es ihr Charme, mit dem sie selbst einen Spatz in ein Schlangennest locken konnte. Ganz bestimmt könnte sie die Halunken hinter mir dazu bringen, dass sie sie ins Auktionshaus eskortierten – und später auch für ihre Sänfte zurück nach Hause bezahlten. Aber unsere zwielichtigen Geschäfte waren gefährlich und ich würde meine Schwestern niemals einem Risiko aussetzen. Mama tat das mittlerweile schon oft genug.
Ich hastete quer über den Südmarkt und bahnte mir einen Weg durch die Menschenmenge. Amana sei Dank lag das Auktionshaus jetzt direkt vor mir.
Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter, als ich einen letzten Blick über die Schulter zu den Dieben warf, wobei ich den mit den langen Ohren eine Sekunde länger musterte. Von irgendwoher kannte ich ihn.
Dann stürzte ich durch das Tor des Auktionshauses. Dahinter erstreckte sich ein langer und friedvoller Innenhof mit einem großen Bronzebecken genau in der Mitte, in dessen Wasser sich der Himmel spiegelte. Als ich an meinem Spiegelbild vorbeischritt, zauberte mir der Effekt von Fals Perücke und meinem Make-up ein Lächeln ins Gesicht. Ich war so gut wie nicht wiederzuerkennen. Eine richtige Dame achten oder neunten Ranges, solange man meine Schuhe nicht zu Gesicht bekam.
Mit den Augen suchte ich den Innenhof nach einem buckligen Mann mit weißen Haaren ab. Gaari war immer leicht zu erspähen, aber noch leichter zu hören. Meine Ohren machten seine tiefe, raue Stimme links von mir aus, wo er sich gerade lautstark mit zwei Kunstliebhabern unterhielt.
Ich klopfte ihm auf die Schulter und unterbrach ein Gespräch, das sich wie ein hitziger Streit darüber anhörte, wo in Gangsun die besten Nudeln zu bekommen waren. »Ich bin da.«
»Lady Vee?«, sagte Gaari und blinzelte mit seinem einen Auge. Es dauerte einen Moment, bis er mich erkannt hatte. »Gelobt seien die Weisen! Ich war schon in Sorge, Ihr könntet Euch verlaufen haben.«
Er verneigte sich, zischte jedoch im Flüsterton, damit nur ich ihn hören konnte: »Du bist spät dran.«
»Da waren Diebe«, wisperte ich zurück und garnierte meine Erwiderung mit einem bösen Blick. Ich hab dir doch gesagt, ich hätte als Mönch gehen sollen.
Gaari verschwendete keine Sekunde. »Diebe?«, wiederholte er, laut genug, dass jeder uns hören konnte. »Diebe sagt Ihr? Dann ist es ja nicht verwunderlich, dass Ihr so sorgenvoll ausseht, Lady Vee.« Übertrieben theatralisch zeigte er zu den offenen Toren. »Wachen, haltet Ausschau nach Lumpenpack, das in diese ehrbare Institution eindringen will. Kommt, Lady Vee, lasst uns zu Mr Jisan gehen. Er erwartet uns bereits.«
Mein Freund Gaari war nicht gerade für seine Zurückhaltung bekannt. Aber bei ihm funktionierte es. Augenblicklich strafften die Wachen die Schultern und ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf die Straße statt auf meine Strohsandalen oder fehlenden Papiere. Rasch – und Gaaris Beine waren so lang, dass ich fast laufen musste, um mit ihm Schritt zu halten – führte er mich einen Korridor hinab in ein Büro, in dem der Kunstgutachter uns erwartete.
Wie alle Regierungsbeamten trug Mr Jisan Kleidung, die so dunkelblau war, dass sie fast schwarz wirkte. Sein Gesicht war lang wie das einer Gottesanbeterin. Er war über seinen Schreibtisch gebeugt, wo er über einen fein säuberlich gestapelten Turm aus Pamphleten und Schriftrollen, unzählige runde Vergrößerungsgläser zum genauen Begutachten von Kunst und ein schweres rotes Siegel zur Beglaubigung verfügte.
Ich hatte ihn schon zwei Mal getroffen, doch er erkannte mich nicht wieder. Was im Grunde eine Ironie war, denn seine Lebensaufgabe bestand darin, zu erkennen, ob etwas authentisch oder falsch war. Doch einem Mann wie ihm würde niemals in den Sinn kommen, dass eine Frau klug genug sein könnte, ihn zu täuschen. Genau das war das Schöne an der Gaunerei, die Gaari und ich ausgeklügelt hatten, und bei allen Göttern, es bereitete mir die größte Genugtuung.
»Nur mit der Ruhe«, sagte Gaari und tätschelte die Luft über meiner Schulter, während wir das Büro betraten. »Sie haben also tatsächlich Eure Sänfte angegriffen? Diese Schurken sind unverschämt dreist!«
Unsere Vorstellung begann und ich biss mir fest in die Wange, um für eine hübsche rosa Farbe zu sorgen. »Die Diebe sind mir den ganzen Weg vom Hansun-Park gefolgt«, sagte ich und meine Stimme hob sich in gespielter Kränkung um eine Oktave. »Ich musste quer über den Markt laufen, um hierherzugelangen! Und meine arme Zofe … sie war zu Tode erschrocken. Sie hat versucht, das Pack von mir wegzulocken, aber …«
»Sie sind Euch trotzdem gefolgt«, beendete Gaari meinen Satz. »Wie grässlich. Waren es viele?«
Ich spähte zu Mr Jisan. Sein Kopf war immer noch über seine Arbeit gebeugt, doch seine Hände bewegten sich nicht mehr. Er lauschte unserem Gespräch. Und dachte nach.
Diebe bedeuteten, dass jemand Interesse an meiner Pergamentrolle hatte. Interesse bedeutete, dass ein Profit zu holen war, und wer hatte schon etwas gegen Profit einzuwenden?
»Mindestens fünf«, erwiderte ich schließlich mit zitternder Stimme. »Vielleicht sogar mehr. Sie sind immer noch dort draußen – als Gelehrte verkleidet.«
»Ban Nus Halunken, wenn Ihr mich fragt.« Mit einem Räuspern drehte Gaari sich zu Mr Jisan. »Euer Ehren, könntet Ihr Eure Wachen schicken, damit sie nachsehen? Wir dürfen doch nicht zulassen, dass Diebe sich in Gangsuns ältestem und ehrenwertestem Auktionshaus herumtreiben …«
Mr Jisan legte sein Vergrößerungsglas mit einem Klirren beiseite, was Gaari augenblicklich verstummen ließ. »Kein Dieb wird es wagen, ein Gebäude zu betreten, das unter Gouverneur Renhais Schutz steht«, sagte er kurz angebunden. »Ihre Rolle, wenn sie denn tatsächlich von Wert sein sollte, ist hier in Sicherheit.«
»Oh, welch eine Erleichterung, Euer Ehren.« Ich holte meinen Fächer heraus und klappte ihn auf. »Vielen Dank, Ihr habt mir meine Sorgen genommen.«
»Meine Güte kennt Grenzen.« Mr Jisan warf mir durch seine dicke Brille einen abschätzigen Blick zu und mir wurde bewusst, dass er mich als eine Dame von niederem Rang eingestuft hatte. Kaum jemand, der ihm das Geschäft des Tages einbringen würde.
»Euer Termin war vor einer Stunde«, rügte er mich, »und ich bin ein viel beschäftigter Mann.«
»Ihr werdet froh sein, uns doch noch empfangen zu haben«, sagte Gaari und wedelte mit der Pergamentrolle. »Lady Vee ist eine passionierte Porträtsammlerin. Sie besitzt eine der kostbarsten Sammlungen in West-Gangsun.«
Mr Jisan schnaubte verächtlich. »Das zu bewerkstelligen, ist nicht besonders schwer. Heutzutage gibt es kein großes Interesse an Porträts. Gesichter altern, Königreiche fallen, aber Landschaften sind für die Ewigkeit.«
Es war ein Zitat des Weisen, den ich am wenigsten mochte und der für die Besessenheit der A’landaner von Landschaftsmalerei verantwortlich war. Gebirge und Flüsse und Wälder und Dörfer – das verkaufte sich neuerdings für Tausende Jen. Leider hatte ich mich beim Fälschen nicht darauf spezialisiert.
»Ich bin von Gesichtern fasziniert«, entgegnete ich und gab vor, ihn überhaupt nicht gehört zu haben, »und was sie über den Charakter offenbaren.«
»Jeder Straßenkünstler kann Porträts malen«, sagte Mr Jisan. »Die wenigsten Meister vergeuden ihre Zeit mit diesen Sujets. Selten verkaufen sie sich für mehr als ein paar Hundert …«
»Wahrlich, die wenigsten Meister«, unterbrach ihn Gaari. »Doch unter ihnen wäre Meister Lei Wing. Wollt Ihr es Euch nicht ansehen, bevor Ihr es ablehnt? Es ist eines seiner Originalwerke. Datiert mehrere Jahre vor seinem mysteriösen Verschwinden.«
Bei diesen Worten hob Mr Jisan den Kopf. Interesse flammte in seinen dunklen Augen auf und er streckte die Hand nach dem Bild aus. »Zeigt es mir.«
Während Gaari ihm die Pergamentrolle reichte, wich ich in eine Ecke zurück und verbarg die Schuhe unter meinem Rock. Meine Perücke juckte wieder, und wegen der Sonne, die durch die Fenster strömte, sammelte sich Schweiß auf meiner Nase und unter meinen Achseln. Wie ärgerlich! Sobald das hier vorüber war, würde ich mich nie mehr als Dame ausgeben.
Ich hoffte nur, dass niemand mein Herz hämmern hörte. Das war der Teil der Transaktion, den ich am meisten hasste. Entweder würde ich den Tag mit einem fetten Beutel Münzen in der Tasche beschließen, oder Mr Jisan läutete die winzige Bronzeglocke, die neben ihm hing, und seine Wachen würden schadenfroh hereinstürzen und mir die rechte Hand abhacken, damit ich nie wieder malen konnte, bevor sie Gaari das verbliebene Auge ausstachen. Dann würden sie uns ins Gefängnis werfen.
Genug, Tru, ermahnte ich mich. Der Gutachter hat mit seiner Arbeit noch nicht mal begonnen!
Mr Jisan entrollte das Bild. Als Erstes inspizierte er das Siegel des Künstlers in der rechten Papierecke. Es war Gaaris Werk und der eigentliche Grund, weshalb er die Hälfte meines Verdiensts einstrich. Gaari besaß nämlich ein höchst kriminelles Talent für das Schnitzen von Ausweisstempeln, was die erste Regel erklärte, die er mir am Anfang unserer Zusammenarbeit eingebläut hatte: Such nur Künstler aus, die verstorben sind.
Tote konnten die unrechtmäßige Benutzung ihrer Siegel nicht anfechten. Selbst so fiel meine Wahl normalerweise auf Künstler, die jung gestorben und bekannt, aber nicht berühmt waren. Zwar brachten sie weniger ein, allerdings war die Sache auch weniger gefährlich. Außerdem gab ich mich keinen Illusionen über mein eigenes Talent als Malerin hin – ich war besser als der Durchschnitt, aber reichte keineswegs an einen Meister heran.
Solltest du jemals geschnappt werden, stehen unser beider Hälse auf dem Spiel, rief Gaari mir häufig ins Gedächtnis. Und obwohl meiner keine Augenweide ist, hänge ich doch sehr an ihm.
An meinem hing ich auch, selbst an dem schmerzhaften Pochen seiner Adern, als eine weitere Sekunde verstrich, ohne dass Mr Jisan einen Laut von sich gab. Manchmal war eine lebhafte Fantasie ein wahrer Fluch.
Die zweite Regel:
Kopiere nie das Werk eines Künstlers. Male ein neues im gleichen Stil.
Das besagte auch der gesunde Menschenverstand. Ich selbst besaß keine persönliche Bibliothek an Bänden mit klassischen Kunstwerken, weshalb ich sie sowieso nicht Strich für Strich hätte nachmachen können.
Und die dritte Regel …
Mr Jisan schob seine Brille die Nase hoch und unterbrach meinen Gedankengang. »Hmm.«
Mein Puls schnellte in die Höhe. »Hmm?«, wiederholte ich.
Gaari warf einen warnenden Blick in meine Richtung. Ich übernehme das Reden.
»Erzählt mir von diesem Bild«, sagte Mr Jisan.
»Es ist ein Original von Lei Wing«, erwiderte Gaari. Er strich beim Reden die Brokataufschläge seiner Ärmel glatt, dann beugte er sich näher zum Gutachter, um ihm eine detailreichere Einführung zu geben. »Ein Frühwerk, aber seine typisch akribische Methode ist bereits ansatzweise zu erkennen und er hat schon seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Wenn ich Euren Blick auf die charakteristischen Wolken und die sanft geschwungenen Hügel im Hintergrund lenken darf? Sie umschließen seine Heimatstadt, die er während seines Militärdiensts für den Kaiser schmerzlich vermisst hat.«
Gaari sagte nichts über das eigentliche Porträt: ein Fischer, der gerade dabei war, einen Katzenfisch mit einem Netz zu fangen. Das Gesicht hatte ich einem älteren Korbflechter nachempfunden, der jeden Tag tief in Gedanken versunken an einer Ecke der Dattu-Straße bei der Arbeit saß. Jemand, von dem ich sicher war, dass Mr Jisan ihn niemals bemerken würde, selbst wenn er jeden Tag an ihm vorbeiginge.
»Was ist mit dem Fluss?«, erkundigte sich der Gutachter. »So hat Lei Wing keine Flüsse gemalt. Der Pinselschwung, die Komposition – das stimmt alles nicht.«
Mein Blick glitt zum Wasser, das sich zwischen den Beinen des Fischers entlangschlängelte. Zwei Katzenfische schwammen im Vordergrund, einer hell, der andere dunkel. Ihre Augen und Schwänze wirkten so naturgetreu, dass sie regelrecht aus dem Pergament hätten schwimmen können. Doch das war nicht der Grund, weshalb es mir den Atem verschlug. Es war die gewundene Form des Flusses. Wenn man einen Schritt zurücktrat und den Blick konzentriert genug darauf richtete, sah er wie ein Drache aus, mit den beiden Fischen als Augen.
Meine Fingerspitzen kribbelten und ich hielt sie still, indem ich den Stoff meines Rocks raffte. »Mir fällt nichts Sonderbares auf«, log ich. »Ich habe schon viele Flüsse wie diesen in Lei Wings Gemälden gesehen.«
»Ich nicht«, erklärte Mr Jisan unumwunden.
»Was dieses Meisterwerk zu etwas noch Außergewöhnlicherem macht«, säuselte Gaari in seidenweichem Tonfall. »Seht Euch nur die Kraft in den Fingern des Fischers an. Diese Knöchel und Knoten. Wer sonst könnte Hände wie Lei Wing malen? Und dieser Gesichtsausdruck! Sieht er nicht aus, als würde er jeden Moment etwas sagen? Das Bild wird einen stattlichen Preis erzielen.«
Ich starrte untröstlich auf den Fluss, während Gaari mir aus der Patsche half. Wenn ich ehrlich war, erinnerte ich mich kaum daran, ihn gemalt zu haben. Aber andererseits passierte das immer, wenn ich bis spätnachts und mit leerem Magen arbeitete. Es war ein solcher Anfängerfehler, doch er könnte mein Ende bedeuten.
Von nun an müsste ich mich besser in Acht nehmen.
»Einige Details sind klar zu erkennen«, erkannte Mr Jisan an. »Die Körperhaltung erinnert an die vom Reisbauern.«
»Ganz genau«, pflichtete Gaari ihm bei und verzog die Lippen. Nun folgte ein Spielzug, den ich nur allzu gut kannte. Mit einem Gespür für das perfekte Timing begann er, das Bild zusammenzurollen.
»Was tut Ihr da?«, wollte Mr Jisan wissen. »Ich war mit meiner Begutachtung noch nicht fertig …«
»Ich bin ein ehrlicher Mensch, Sir«, sagte Gaari. »Mir ist nicht entgangen, dass Ihr, was Porträts betrifft, nicht gerade enthusiastisch seid, und ich bin nicht hier, um irgendjemandes Zeit zu vergeuden. Wenn Ihr nicht zuschlagen wollt, müsst Ihr es nur sagen. Ich habe einen Termin mit Lady Vee bei Mr Wan und wir sind schon recht spät dran …«
»Mr Wan?«
»Ja. Er hat schon des Öfteren Interesse an Lei Wings Werken geäußert. Doch wir wollten uns zuerst an Euch wenden, da Ihr Euch so gütig bei der Chuli-Landschaft gezeigt habt, die mein Klient Euch kürzlich verkauft hat.«
»Das war durch Euch, Mr Gaari?«
»Jawohl.« Gaari verneigte sich.
Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie Mr Jisan Gaari zu sich winkte und dieser mein Bild erneut auf seinem Schreibtisch entrollte. Mir schnürte es die Brust schmerzhaft zusammen, meine Lunge zwickte und verlangte nach frischer Luft, als Mr Jisan endlich zufrieden nickte. »Ich nehme es.«
»Wundervolle Neuigkeiten!«, rief Gaari. »Ihr werdet es nicht bereuen …«
»Aber zuerst«, sagte Mr Jisan und wedelte Gaari mit einer Handbewegung fort, »klärt mich auf, Lady Vee. Wie seid Ihr nur in den Besitz eines Meisterwerks von Lei Wing gekommen?«
Ich schloss meinen Fächer und ließ ihn an meiner Seite baumeln. In den besten Lügen steckte immer ein Fünkchen Wahrheit und der Grund, weshalb Lei Wing der Maler war, den ich am liebsten fälschte …
»Er ist auf hoher See verschollen«, erklärte ich ruhig. Genau wie Baba. »Mein Vater hat ein kleines Import-Export-Geschäft und traf zufällig einen Kaufmann, der Lei Wings Werke aus Kiata geschmuggelt hatte. Als ich von diesem Bild hörte, wollte ich es unbedingt haben.«
»Es ist eine echte Rarität«, stimmte Mr Jisan mir zu, doch sein Blick war immer noch unerbittlich. »Warum verkauft Ihr es jetzt?«
Wäre ich Tru, würde ich ihm an den Kopf werfen, er solle sich zum Drachen scheren. Natürlich brauchte ich Geld. Meine Familie hatte sich von nichts als Teigtaschen mit gedünstetem Kohl ernährt und ich hätte eine Ratte geküsst, wenn ich dann etwas Würziges und Knuspriges zwischen die Zähne bekommen hätte. Aber ich war nicht Tru. Ich war Lady Vee.
Und als Lady Vee hob ich meinen Ärmel und wischte mir eine imaginäre Träne aus dem Augenwinkel. »Mein Vater ist häufig auf See und meine Mutter ist abergläubisch. Sie fürchtet, Lei Wings Gemälde bringe unserer Familie Unglück.«
Es war das erste Mal, dass mir Mr Jisan sympathisch war, so, wie er die Augen wegen meiner erfundenen Mutter verdrehte. »Dann seid versichert, wir werden dem Meisterwerk ein gutes Zuhause finden.«
Endlich – gelobt seien die Weisen! – unterschrieb er die Beglaubigungspapiere und drückte sein Siegel darauf.
»Es ist echt«, erklärte Mr Jisan einem herbeigeläuteten Untergebenen. »Fügt es der Liste für die nächste Auktion heute hinzu.«
Ich war so erleichtert, dass ich vergaß, nicht an meiner Perücke zu kratzen. Bevor irgendjemand etwas bemerkte, blies ich rasch die blaue Strähne weg, die mir über die Augen gefallen war.
Gaari musste mich regelrecht in den Innenhof schubsen. Ich kannte das Prozedere: Er kam nicht mit mir mit. Er würde die Transaktion zu Ende führen und mich anschließend treffen.
»Gut gemacht«, flüsterte er. »Das Mittagessen geht auf mich.«
Amana sei Dank, ich war am Verhungern. »Im Luk?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Lust auf Nudeln?«
»Ich hab immer Lust auf Nudeln.«
»Gut. Ich auch.« Gaari grinste und seine grauen Augen leuchteten. »Wir treffen uns dort.«
3. Kapitel
Gaari hatte den einen großen Vorzug: Er kam nie zu spät. Exakt eine Stunde nach Mittag erspähte ich ihn, wie er die Straße herunterschlenderte, dank seines weißen Eiszapfens von einem Bart und der Augenklappe leicht zu erkennen. Ebenso wie ich mit meinen blauen Haaren – wir fielen auf wie Spinnen in einer Zuckerdose.
»Du siehst erholt aus«, begrüßte er mich. »Wo hast du dein Kostüm verstaut?«
Ich tätschelte den Rucksack an meiner Schulter. »Fal macht mich einen Kopf kürzer, wenn ich ihr Kleid mit Suppe vollkleckere«, sagte ich trocken. »Hast du die Garnelen bekommen?«
Garnelen. Unser Codewort für Geld.
»So große hatten wir noch nie.«
Meine Brust schwoll an. »Gut. Das ist sehr gut. Kein Ärger mit den Dieben?«
Gaari blinzelte, als wüsste er nicht, wovon ich sprach. Dann schienen ihm meine Verfolger wieder einzufallen. »Ach, die! Nein, kein einziger Gauner in Sicht.« Er lachte glucksend. »Vielleicht sind sie auch zum Nudelessen hergekommen. Sieh dir diese Schlange an!«
Vor uns warteten über zwanzig Leute auf Einlass. Ich stieß einen betrübten Seufzer aus. »Ich warte schon, seit ich das Auktionshaus verlassen habe. Sollen wir es woanders probieren?«
»Auf gar keinen Fall«, sagte Gaari und zog mich aus der Warteschlange. »Überlass das nur mir.«
»Wir verlieren unseren Platz …«
»Vertrau mir, Saigas. Komm mit.« Gaari holte schwungvoll einen hölzernen Fächer aus der Tasche und stieß und stupste damit andere Gäste beiseite. Wir ernteten unzählige wütende Blicke, während wir uns ins Luk drängten und die Treppe in der Ecke ansteuerten. Wie durch ein Wunder trat uns niemand in den Weg. Kein einziger Angestellter zuckte auch nur mit der Wimper.
Im Obergeschoss schob Gaari den Perlenvorhang auseinander und deutete auf den Ecktisch. Ein Kellner stellte bereits eine Kanne mit frischem Tee und zwei Tassen für uns hin. Bei Gaaris Anblick machte er eine tiefe Verbeugung.
Interessant.
»Mit wie viel hast du ihn bestochen?«, flüsterte ich, als der Kellner davonhuschte.
Gaari ließ sich auf seinen Schemel plumpsen. Er sah müde aus und klappte seinen Fächer zusammen. »Für so was würde ich deine hart verdienten Münzen nicht verschwenden.«
»Was dann?«
Eine Pause. »Man könnte vielleicht sagen, dass er ein ehemaliger Helfershelfer von mir ist. Er schuldet mir einen Gefallen.«
»Ein ehemaliger Helfershelfer?« Neugierig zog ich eine Augenbraue hoch. Gaari gab bekanntermaßen nicht das kleinste Detail über sich preis und ich war noch nie einem anderen Menschen begegnet, der ebenfalls mit ihm zusammenarbeitete. »Sollen wir ihn an unseren Tisch bitten?«
»Bild dir bloß nichts ein«, warnte mich mein Freund. »Er hält sich ebenfalls an die dritte Regel.«
Die dritte Regel: Keine Fragen, die über die Arbeit hinausgehen.
Ich runzelte die Stirn. »Du hast da einiges am Laufen, mit all diesen Menschen, die Geheimnisse für dich bewahren. Du weißt immer, wo und wie du mich finden kannst, während ich … noch nicht mal weiß, ob dein Bart echt ist.«
»Selbstverständlich ist er echt!« Meine gegenteilige Unterstellung schien Gaari zu kränken. Mit Nachdruck strich er sich übers Kinn. »Mein Leben ist nicht interessant. Ich bin bloß ein alter Mann mit einer Vorliebe für Nudeln, der zufälligerweise hin und wieder Erfolg mit kleinen Betrügereien hat.«
»Betrügereien kannst du laut sagen«, murmelte ich. »Pass lieber auf, dass du dich nicht verrätst, alter Mann. Jedes Mal, wenn du lügst, findest du einen Weg, um auf Nudeln zu sprechen zu kommen.«
»Siehst du, Saigas? Du kennst mich besser als irgendwer sonst.« Er prostete mir mit seiner Teetasse zu, bevor er weiter von ihr nippte. »Ich trinke auf deine wunderbare Beobachtungsgabe. Sie finanziert unser heutiges Mittagessen.«
Ich verdrehte die Augen, trank jedoch ebenfalls. Der Kellner kehrte zurück, um unsere Bestellung aufzunehmen, und unter meinem langen Pony hervor musterte ich verstohlen sein Gesicht. Eine glockenförmige Nase, Wangen, so rundlich wie Eier, lange Ohren und schwarzes, ordentlich unter eine Mütze gekämmtes Haar. Den Mann hatte ich schon einmal gesehen, aber wo? Gesichter vergaß ich niemals.
Ach. Die Antwort regte sich ganz hinten in meinem Kopf und ich stellte die Teetasse zurück auf den Tisch.
»Weißt du, es ist schon komisch«, sagte ich langsam, den Blick fest auf Gaari geheftet, »diese Diebe heute sind aus dem Nichts gekommen. Es gab reichlich andere reiche Frauen, denen sie hätten folgen können. Aber trotzdem hatten sie es auf mich abgesehen.«
Gaari wusch unsere Löffel in einer weiteren Tasse Tee. »Worauf willst du hinaus?«
»Sind es deine Leute gewesen?«, fragte ich eindringlich. »Hast du diese Diebe zu meiner Verfolgung angeheuert?«
Er schob sich den langen Bart über die Schulter. »Wir sind zum Feiern hier. Müssen wir über solche Unannehmlichkeiten sprechen?«
»Dieser Kellner ist dort gewesen. Dein Helfershelfer.«
Gaaris Wange zuckte. Es war eine winzige Regung, kaum wahrzunehmen, aber ich wusste, worauf ich achten musste. »Sein Name lautet Tangyor«, murmelte er. Mit einem Löffel deutete er auf mich. »Zu meiner Schande habe ich vergessen, wie aufmerksam du bist.«
»Die Wahrheit, Gaari. Raus damit.«
»Gelegentlich heuere ich tatsächlich ein paar Raufbolde an.« Gaari überschlug die Beine. »Je mehr Interesse ein Werk weckt, desto höher ist der Preis, der sich damit erzielen lässt. Manchmal braucht dieses Interesse einen kleinen Schubs.«
»Und dir ist nicht in den Sinn gekommen, mich einzuweihen?«
»Ahnungslosigkeit verleiht deinem Schauspiel eine authentischere Note.« Er zuckte die Achseln. »Nur so eine Beobachtung.«
Wenn ich meine Tasse nicht schon leer getrunken hätte, hätte ich ihm den Tee ins Gesicht geschüttet. »Ich würde dir den Hals umdrehen, wenn er nicht so dick wäre. Hintergeh mich nie wieder!«
»Immer mit der Ruhe, Saigas.« Gaari wischte sich über den Mundwinkel. »Schließlich habe ich dir zusätzlich tausend Jen eingebracht, nicht wahr?«
Unwillkürlich japste ich nach Luft. »Tausend Jen?«
Er nickte mir selbstgefällig zu. »Hab dir doch gesagt, dass die Garnelen heute besonders fett waren.«
Eigentlich wollte ich mich nicht so leicht auf seine Seite ziehen lassen, aber was für ein Segen! Ein zusätzlicher Tausender würde mich etliche Wochen näher an mein Ziel bringen. Nur mit allergrößter Mühe konnte ich mit ruhiger Stimme sprechen. »Verrate mir wenigstens, wer die Auktion für sich entschieden hat.«
»Je weniger du weißt, desto besser. Du bist das künstlerische Talent, ich kümmere mich um alles andere.«
»Die dritte Regel«, murmelte ich, auch wenn sie mir verhasst war. Innerlich über meinen Arbeitgeber zeternd sank ich in meinen Stuhl zurück. Inzwischen machte ich schon drei Jahre lang gemeinsame Sache mit Gaari, aber ich wusste so gut wie nichts über ihn. Etwa wie er sein Auge verloren hatte oder wie alt er war. Ich wusste noch nicht einmal, ob Gaari sein echter Name war.
Allerdings hatte ich da meine Zweifel. Ein Mann wie er, der das Schauspiel genauso wertschätzte wie die Kunst, würde sich selbstverständlich in mehrere Schichten Geheimnisse hüllen. Das respektierte ich. Mich störten nur die kleinen Risse in seiner Fassade, die mir dank meiner ausgeprägten Beobachtungsgabe gelegentlich auffielen. Vielleicht waren der Bart und das weiße Haar tatsächlich ein Schwindel – denn einmal, in der Anfangszeit unserer Bekanntschaft, hatte ich bemerkt, dass die Haut an seinem Hals im Gegensatz zu seinem Gesicht glatt war. Manchmal hatte auch sein Auge einen hellen, beinahe jugendlichen Glanz. Ein verschlagenes Funkeln.
»Keine Ahnung, warum ich dir vertraue«, sagte ich laut und meine Worte waren sowohl für seine als auch meine Ohren bestimmt.
»Weil du ohne mich niemals einen Tisch im Luk ergattern würdest«, erwiderte Gaari unbekümmert. »Jetzt, wo ich dir diesen Laden gezeigt habe, wirst du erkennen, dass jedes andere Nudellokal zweitklassig ist.«
Ich wischte meinen frisch abgespülten Löffel an einem Tuch ab. Nur Gaari hörte ein Kompliment heraus, wo gar keines gemacht worden war. Allerdings stimmte es. Der Mann hatte einen ausgezeichneten Geschmack in Sachen Nudeln.
»Dieses Restaurant muss von Küchendämonen geführt werden, das könnte ich schwören.« Mit dem Kinn deutete er in Richtung Erdgeschoss, wo immer noch reger Trubel herrschte. »Apropos, unser Mittagessen ist hier.«
Sobald er die Worte ausgesprochen hatte, stieg mir eine verführerische Gewürzmischung in die Nase. Zimt und weißer Kardamom, Nelke und Sternanis sowie Bergingwer. Ich war im siebten Himmel. Eine dampfende Schüssel frischer handgerollter Nudeln mit sehnigen Rindfleischstücken und Spinatblättern, die in der bräunlich roten Brühe trieben, landete vor mir.
Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Von allen Speisen auf der Welt machten Nudeln meinen Bauch am glücklichsten. Gaari und ich hatten unsere Differenzen – er mochte Landschaftsmalerei lieber als Porträts, zog Heiltees meinem schwarzen Tee vor und gab Knoblauch den Vorzug vor Chilis –, doch es gab eine Sache, bei der er und ich uns einig waren und auf der unsere Freundschaft praktisch beruhte: Es gab nichts Besseres als Nudeln.
Und die Nudeln im Luk waren … göttlich.
Sie waren so unglaublich lecker, dass ich vorübergehend sogar meine Wut auf Gaari vergaß. Ich tunkte einen Holzlöffel in die Nudelsuppe, schöpfte ein prachtvolles Fettauge ab und atmete den würzigen Dampf ein, der davon aufstieg. Doch zuerst, bevor ich losschlemmen konnte, schraubte ich das kleine Glas an der Tischseite auf und schüttete ein Häufchen getrockneter Chiliflocken in meine Suppe. Meine Schüssel nahm einen grellen Rotton an.
Dann erst legte ich los.
Bei jedem Bissen brannte meine Zunge vor köstlicher Schärfe. Ich hielt beim Essen nicht inne, um etwas zu trinken, um mich mit Gaari zu unterhalten oder auch nur um Atem zu holen. Gutes Essen genoss man schweigend – jegliche zusätzliche Luft käme nur meinen Geschmacksknospen in die Quere. Deshalb saß ich über meine Schüssel gebeugt da, während mir Schweißperlen die Wangen hinunterrannen und ich meine Nudeln in mich hineinschaufelte.
Mit amüsierter Miene beobachtete Gaari mein kleines Ritual.
»Was?«, wollte ich wissen.
»Ich habe mich immer gefragt, wer dich gelehrt hat, deine Speisen so stark zu würzen. Das ist kein Brauch aus dem Süden.«
Ich setzte mich auf und tupfte mir den Schweiß aus dem Gesicht. In Gedanken antwortete ich stumm: Baba. In Balar war es kalt, hatte er erklärt, und die scharfen Gewürze sorgten für freie Atemwege und einen warmen Bauch. Früher fand ich es schrecklich und schrie schon, wenn meinem Reis auch nur die kleinste Prise Paprika beigefügt wurde. Doch mit der Zeit vertrug ich immer mehr. Nach fünf langen Wintern, in denen ich in der Kälte gehungert hatte, war ich zu den schärfsten Chilis übergegangen, die ich finden konnte. Und inzwischen aß ich sie sogar roh.
Diese Geschichte behielt ich selbstverständlich für mich. »Mein Vater«, war alles, was ich sagte.
»Dein Vater«, wiederholte Gaari. »Von dem du die blauen Haare geerbt hast? Du erzählst nie von ihm.«
»Er ist tot. Mehr gibt es da nicht zu wissen.« Ich löffelte mir weitere Nudeln in den Mund, um zu unterstreichen, dass das Thema damit erledigt war. »Dritte Regel.«