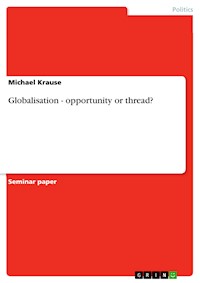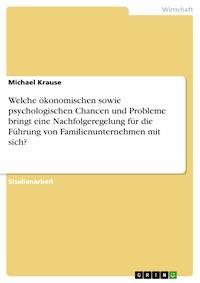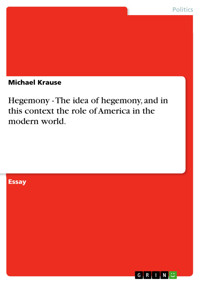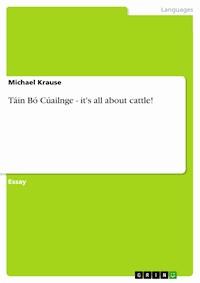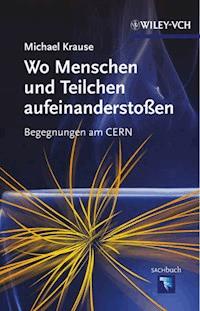Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Gib jedem Tag die Chance, zum schönsten Deines Lebens zu werden! (Mark Twain) Drei Dinge sind es im Wesentlichen, die das Leben glücklich machen: gute Beziehungen, erfüllende Tätigkeiten und eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Der Supervisor und Coach Michael Krause begleitet seit über fünfzehn Jahren Menschen durch Lebenskrisen und Umbruchsituationen. Die Tipps und Anregungen für ein glückliches Leben, die er hier gibt, haben allesamt ihre Anwendbarkeit im Alltag unter Beweis gestellt. Er macht uns Mut, die Verantwortung für ein glückliches Leben in die eigene Hand zu nehmen. Schritt für Schritt führt er uns zu den Grundlagen eines Lebens voller Glück und Wohlbefinden. Die Erfahrung zeigt: Jeder Mensch kann glücklicher werden. Die Entscheidung dazu liegt bei Ihnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Krause
Ab heute ist mein Glückstag
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einleitung
Was ist Glück?
Das Glück im Spiegel der Zeit
Wie funktioniert Glück?
Was macht glücklich?
Stolpersteine auf dem Weg zum Glück
Wie glücklich sind Sie?
Packen Sie es an!
Glücklich Sein
Glücklich leben
Der Sinn des Lebens
Noch ein Glückstest
Zum guten Schluss
Verzeichnis der Fußnoten
Impressum neobooks
Einleitung
Wollen Sie glücklich sein? Nun, sicher wollen Sie das, denn zum einen möchte jeder Mensch glücklich sein und zum anderen hätten Sie sonst sicher nicht in dieses Buch geschaut.
Was aber ist Glück eigentlich? Wie entsteht Glück? Und noch viel wichtiger: Was können Sie tun, damit Sie selbst glücklicher werden? Davon handelt dieses Buch.
Es ist geschrieben für Menschen, die bereit sind, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen, die „ihres Glückes Schmied“ sein möchten. Dazu stellt es Ihnen das Handwerkszeug bereit.
Nun gibt es ja schon sehr viele Glücksbücher. Warum also noch ein weiteres? Weil es vor allem deshalb geschrieben wurde, damit Sie glücklicher werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, kratzt dieses Buch nicht nur an der Oberfläche des Themas. Vielmehr führt es Sie in die Tiefe, sodass Sie die Gesetzmäßigkeiten des Glücks erkennen und in Ihrem Leben die notwendigen Voraussetzungen für ihr persönliches Wohlbefinden schaffen können.
Das Buch gliedert sich in zwei Bereiche. Im ersten, theoretischen Teil machen wir gemeinsam einen Abstecher in so spannende Gebiete wie die Hirnforschung, die Psychologie oder die Kommunikationslehre. Dabei erfahren Sie, was die jeweiligen Disziplinen zu unserem Thema, dem Glück, zu bieten haben. Diese Informationen verbinden wir dann mit den Erkenntnissen der anderen Forschungsgebiete. Auf diese Weise gewinnen Sie ein umfassendes Basiswissen zu allen relevanten Bereichen der modernen Glücksforschung.
Doch was nützt die beste Theorie, wenn es mit der Anwendung in der Praxis hapert? Im zweiten Teil des Buches werden Sie deshalb in die Lage versetzt, dieses Wissen in Ihrem Alltag anzuwenden. Erfahrungen aus über 15 Jahren Beratung und Begleitung von Menschen in Lebenskrisen und Veränderungsprozessen sind in dieses Buch eingeflossen.
Der praktische Teil beginnt mit einem Selbsttest, anhand dessen Sie ermitteln können, wie glücklich Sie persönlich aktuell sind und wo genau Sie weiteres Steigerungspotential finden können.
Dann geht es an die konkrete Umsetzung. Drei große Bereiche sind es, die auch für unser Glücksempfinden ausschlaggebend sind:
Unsere Einstellung zu uns und unserem Leben,
Wie und womit wir unsere Zeit verbringen und
Welchen Sinn wir unserem Leben geben.
Jedem dieser drei Lebensbereiche sind entsprechende Kapitel gewidmet.
Damit Sie die Erkenntnisse über das Glück im Allgemeinen konkret in Ihrem eigenen Leben anwenden können, finden Sie zu jedem Abschnitt etliche, in der Beratungspraxis bestens bewährte Glückstipps. Sie werden erstaunt sein, wie einfach es sein kann, sich glücklich zu fühlen, wenn man an den richtigen „Stellschrauben dreht“.
Natürlich ist jeder Mensch einzigartig und jede Lebenssituation unterschiedlich. Daher sind die Tipps gestaltet, wie ein Buffet: dem einen schmeckt dieses, dem anderen jenes. Sie sind daher eingeladen, von allem zu kosten, hier und da zu naschen und das auszuwählen, was Ihnen mundet.
Die Tipps sind in drei Kategorien gegliedert.
Zum einen finden Sie grundlegende Tipps. Nur wenn Sie diese Tipps befolgen, macht es Sinn, die anderen Tipps zu versuchen, denn Sie bilden die Grundlage, um wirkliche Erfolge zu erzielen. Diese grundlegenden Tipps sind mit einem Ausrufezeichen versehen.
Andere Tipps wirken eher langfristig. Sie sind darauf ausgelegt Ihr persönliches Glücksempfinden auf ein höheres Niveau zu heben und dort zu halten. Diese sind mit einer Glühbirne gekennzeichnet.
Und dann gibt es noch Tipps, die relativ schnell wirken. Diese dienen dazu, ihr aktuelles Glücksempfinden zügig zu steigern. Sie können diese beispielsweise nutzen, wenn Sie schnell Ihre derzeitige Stimmung heben möchten. Solche Tipps erkennen Sie an dem Smiley.
Die Tipps funktionieren natürlich nur, wenn Sie diese auch anwenden. Bloßes Wissen allein nützt bekanntlich wenig. Unterbrechen Sie hin und wieder die Lektüre und versuchen Sie, einen der gelesenen Tipps umzusetzen. Auch hier ist es wieder wie beim Buffet: Lieber mal eine Pause machen und sacken lassen - Sie haben wirklich mehr davon...
Der Weg zum Glück kann mitunter steinig und anstrengend sein. Aber wer sich auf das Abenteuer einzulassen wagt, den erwartet ein Leben voller Freude. Haben Sie Lust? Dann los! Ich freue mich schon auf die gemeinsame Reise mit Ihnen.
Was ist Glück?
Der Versuch einer Begriffsdefinition
Bevor wir uns mit den Wegen zum Glück beschäftigen, lassen Sie uns eine grundlegende Begriffsdefinition versuchen. Denn nur, wenn wir beide, Sie und ich, uns darüber verständigt haben, was in diesem Buch unter Glück zu verstehen ist, macht es Sinn, den gemeinsamen Weg weiter zu beschreiten. Dazu ist es notwendig, dass wir möglichst eindeutig klären, was im Rahmen dieses Buches unter Glück zu verstehen ist. Ansonsten kommt es zu Missverständnissen und in der Folge unweigerlich zu einem Glücksverlust. Bei Ihnen, weil Sie von dem Buch enttäuscht sein werden und bei mir, weil ich das Ziel – Ihnen zu mehr Glück zu verhelfen – verfehlt habe.
Der Begriff „Glück“ hat im Deutschen zwei ziemlich unterschiedliche Bedeutungen.
Zum einen bezeichnet er Glück im Sinne von „Glück haben“, was heißt, durch einen Zufall begünstigt zu sein (englisch: luck), etwa bei einer Lotterie oder einem Gewinnspiel. Diese Form des Glücks spielt in diesem Buch keine Rolle, obwohl zufälliges Glück durchaus einen Einfluss auf das Glücksempfinden hat.
In der zweiten Bedeutung bezieht sich „Glück“ auf den Zustand, Glück zu empfinden.
Das Empfinden von Glück kann einen mehr oder weniger langen Zeitraum anhalten, etwa wenn wir etwas sehr Schönes erleben (engl. pleasure) oder aber ein dauerhaftes Gefühl beschreiben (engl. happiness). Hiermit werden wir uns in diesem Buch ausführlich beschäftigen.
Der Duden definiert Glück u.a. als „angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat; Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung“
Interessanterweise sind beim Glückserleben weniger objektive Tatsachen als viel mehr das subjektive Empfinden von entscheidender Bedeutung. Auf diesen wichtigen Punkt werden wir im Laufe des Buches noch zurückkommen.
Aber es gibt noch eine weitere, wichtige Unterscheidung des Glücksempfindens, die nach meiner Erfahrung viel zu wenig Beachtung findet: Uns kann etwas glücklich machen - meist ein Erlebnis, also etwas das „von außen“ kommt und das wir „empfangen“ - oder wir können glücklich sein. Dann liegt die Quelle des Glücks in uns und wir sind der Verursacher.
Wie wir dieses Glücklich-Sein erreichen können? Die Antworten auf diese Frage bilden den Kern dieses Buches. Denn wenn wir erkennen, wie wir uns selbst glücklich machen - also in den Zustand des Glücklichseins versetzen - können, dann haben wir den Schlüssel in der Hand, der uns in die Lage versetzt, unser Wohlbefinden unabhängig von den äußeren Umständen zu steigern und auf einem hohen Niveau zu halten.
Dabei geht es keineswegs darum, ständig und ohne Unterbrechung auf „Wolke 7“ zu schweben. Das ist auch kaum möglich, denn das Glück lebt quasi von den Gegensätzen. So wie wir „hell“ nur im Kontrast zu „dunkel“ wahrnehmen können, braucht das Glück auch Phasen, in denen es weniger ausgeprägt ist, damit wir es erkennen. Auf diesen wichtigen Punkt werden wir bei unserem Ausflug in die Hirnforschung noch einmal zurück kommen.
Fragt man Menschen nach ihrer Definition des Begriffes „Glück“, bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Zufriedenheit, Wohlfühlen oder innerer Frieden werden ebenso genannt wie Extase oder der Zustand des Verliebtseins.
Glück scheint also etwas zu sein, was von verschiedenen Menschen unterschiedlich empfunden und wahrgenommen wird: Jeder empfindet Glück anders und jeder empfindet etwas anderes als Glück.
Glücksforschung
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten wird in der Glücksforschung anstelle des Begriffes „Glück“ meist der Begriff „Subjektives Wohlempfinden“ verwendet.
Als relativ junge Forschungsrichtung beschäftigt sich die Glücksforschung seit den 1980er Jahren mit der Erforschung der Bedingungen, die Menschen glücklich machen. Hier arbeiten Psychologen, Hirnforscher, Philosophen, Sozialforscher, Wirtschaftswissenschaftler, Biologen, Politikwissenschaftler und Fachleute aus anderen Gebieten intensiv und interdisziplinär zusammen.
Ein wesentliches Werkzeug der Glücksforscher ist die Befragung. Mittels mehr oder weniger ausgeklügelter und umfangreicher Fragebögen werden die Menschen nach ihrem aktuellen oder zurückliegenden Glückserleben befragt. Dabei zeigen sich trotz aller kultureller Unterschiede auch einige grundlegende Gemeinsamkeiten, die anscheinend auf der ganzen Welt Menschen glücklich machen. Im Kapitel „Was macht glücklich?“ werden wir ausführlich darauf eingehen.
Einen anderen Weg geht die Hirnforschung, die mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) und Hirnstrommessung (EEG) die Aktivität des Gehirns während bestimmter Experimente beobachtet. Die Forscher erlangen so Aufschluss darüber, wie ein Glücksgefühl im Kopf entsteht und welche Hirnbereiche und Botenstoffe dabei beteiligt sind. Das Kapitel „Wie funktioniert Glück?“ berichtet von den aktuellen Erkenntnissen der Hirnforscher.
Glücksfaktoren
Im Laufe der Zeit haben die Glücksforscher drei Faktoren herausgefunden, die maßgeblichen Einfluss auf das subjektive Glücksempfinden eines Menschen haben.
Der wichtigste dieser drei Faktoren – und das mag Sie jetzt erst einmal deprimieren, lieber Leser – sind anscheinend unsere genetischen Veranlagungen.
Forschungen, welche die beiden amerikanischen Zwillingsforscher David T. Lykken und Auke Tellegen ab dem Jahr 1994 durchführten, ergaben, dass unsere generelle Fähigkeit, Glück zu empfinden, zu etwa 50% von unseren Veranlagungen abhängt1. Dabei spielen sowohl genetische Faktoren als auch angeborene Persönlichkeitseigenschaften eine wichtige Rolle.
Bei den genetischen Faktoren handelt es sich vor allem um die Fähigkeit, die auch als Glücksbotenstoffe bezeichneten NeurotransmitterDopamin, Oxytocin und Serotonin zu produzieren. Menschen unterscheiden sich aufgrund ihrer Erbanlagen sowohl hinsichtlich der Menge der Botenstoffe, die vom Körper produziert werden können, als auch der hinsichtlich der Rezeptoren, die diese Glücksbotenstoffe aufnehmen und entsprechende Reaktionen im Körper auslösen. Rezeptoren sind Zellen, die chemische oder physikalische Reize in eine für das Nervensystem verständliche Form bringen.
Auf die genetischen Faktoren haben wir leider keinen Einfluss. Aber glücklicherweise ist es weniger dramatisch, als es sich anhört. Eine erhöhte Menge an Glücksbotenstoffen führt nämlich keineswegs automatisch zu einem erhöhten Glücksempfinden, da im Laufe der Zeit ein „Gewöhnungseffekt“ auftritt, der den Vorteil einer erhöhten Menge ausgleicht. Und da das Glück sehr individuell wahrgenommen wird, ist fraglich, ob alle Menschen für gleiches Glücksempfinden die gleiche Menge an Neurotransmittern benötigen.
Neurotische Menschen hingegen, die von ihrem Wesen her eher ängstlich, reizbar, nervös und launisch sind, haben es verständlicherweise schwerer damit, Glück zu erleben. Aber auch hier ist es so, dass es für diese Menschen vielleicht schwerer aber keinesfalls unmöglich ist.
Wie gesagt, machen diese beiden Faktoren etwa 50% unserer Fähigkeiten aus, Glück zu erleben. Von den verbleibenden 50% bestimmen zu weiteren 10% unsere Lebensbedingungen das persönliche Glücksempfinden. Ob wir in einem armen oder einem reichen Land leben, in welcher sozialen Schicht wir geboren wurden, welche Bildung wir erfahren durften oder ob wir gesund oder krank sind, gehören beispielsweise dazu. Auch auf diese Faktoren haben wir relativ wenig direkten Einfluss.
„Na prima, dann kann ich das Buch ja gleich zuklappen“, mögen Sie jetzt denken. Langsam, langsam, denn nun kommt die gute Nachricht: Es bleiben immerhin noch 40%, die dem direkten Einfluss unseres freien Willens unterliegen! 40%! Stellen Sie sich vor, was für ein gewaltiges Glückspotential darin steckt. Und dieses liegt in ihrer Hand und steht größtenteils unter Ihrer Kontrolle!
Bevor wir jedoch dazu kommen, wie Sie für sich dieses riesengroße Potential erschließen können, ist es notwendig, dass wir uns noch etwas vertiefter mit den verschiedenen Gesichtspunkten des Glücks beschäftigen. Nur so können wir stabile Grundlagen für dauerhaften Glücks-Erfolg schaffen. Haben Sie also bitte noch etwas Geduld.
Unser subjektives Glücksempfinden ist zu einem Teil immer auch gesellschaftlich geprägt. Daher werden wir im nächsten Kapitel zuerst der Frage nachgehen, welche Gedanken sich die Menschen im Europa früherer Zeiten über das Glück gemacht haben.
Das Glück im Spiegel der Zeit
Die großen Denker
Das Streben nach Glück hat zu allen Zeiten im Bewusstsein der Menschheit einen bedeutenden Raum eingenommen. Da ist es selbstverständlich, dass sich schon die Philosophen der Antike zu diesem großen Thema Gedanken gemacht haben.
Da Glück individuell sehr verschieden aufgefasst wird, ist es verständlich, dass auch die Philosophen zu sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Glück kamen und ebenso unterschiedliche Wege erdachten, wie dieses Glück zu erreichen sei. Vieles von dem, was die antiken Denker in ihren Werken beschrieben, findet auch heute noch seine Anhängerschaft.
So lag für Aristippos von Kyrene (435 - 355 v. Chr.) und in der von ihm entwickelten hedonistischen Lehre das Glück darin, möglichst viel Lust zu erleben. Um welche Lüste es dabei ging, war ihm nebensächlich. In vielen Punkten ist der Hedonismus dem heutigen, exzessiven Konsumverhalten vergleichbar.
Ganz anders sieht Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) das Glück. Demnach sei Glück oder Glückseligkeit das Höchste, was der Mensch um seiner selbst willen anstrebt und nicht als Mittel etwas anderes damit zu erreichen. Glück sei eine Tätigkeit der Seele aufgrund der ihr gegebenen Vernunft. Um Glück zu erreichen empfiehlt er die Einhaltung der rechten Mitte zwischen zwei Extremen. Aristoteles weist auch schon darauf hin, dass ein Mindestmaß an äußeren Glücksgütern wie Besitz oder Gesundheit für die Erreichung des Glücks unerlässlich sei.
Epikur (341 – 270 v. Chr.) hingegen definierte Glück einfach als Abwesenheit von Schmerz und Bedürfnissen. Das Glück der epikureischen Philosophie besteht in einem einfachen Leben, das es dem Menschen ermöglicht, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen und schweren Schicksalsschlägen mit Gleichmut zu begegnen. Dabei soll der Mensch Erlebnisse vermeiden, die zwar ein momentanes – also kurzfristiges - Glück ermöglichen, jedoch Schmerz und Unglück zur Folge haben könnten.
Die durch Zenon von Kition um 300 v. Chr. gegründete Schule der Stoiker betrachtete das Glück als das Ziel des Menschen, welches darin bestehe, ein Leben im Einklang mit sich selbst und mit der Natur zu führen. Dies erreiche man, indem man die Gesetze der Natur erforscht und sich konsequent an der Vernunft orientiert, Vorurteile und Neigungen sowie das Streben nach bloß äußeren Gütern überwindet und nur die Tugend als Richtschur für das Handeln zulässt. Die von den Stoikern gepflegte Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen ist als „stoische Ruhe“ sprichwörtlich geworden.
Für die Philosophen des Mittelalters, deren christlich-mystisches Weltbild stark von dem in Kürze erwarteten Weltuntergang geprägt war, schien das Glück für den Menschen auf Erden unerreichbar und erst nach dem Tod im Himmel zu finden. So findet sich die Hoffnung auf „Erlösung von der irdischen Qual“ und die „Aufnahme in die Glückseeligkeit der Heiligen“ auch in den Gemälden des Mittelalters wieder.
Im 18ten und 19ten Jahrhundert prägten Jeremy Bentham und John Stuart Mill, die als Begründer des Utilitarismus gelten, die Idee vom „maximalen Glück für möglichst viele Menschen“ als Staatsziel.2
Diese Gedanken fanden weitgehende Berücksichtigung bei der Gründung der USA. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt es:
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed, by their Creator, with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.
(„Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; …“)
Wohlgemerkt ist keineswegs vom Recht auf „glücklich sein“, sondern vom Recht auf das „Streben nach Glück“ die Rede.
Neue Wertmaßstäbe
Viel Aufmerksamkeit hat – auch über die Kreise der Glücksforschung hinaus - die Verfassung des Himalaya-Staates Bhutan gefunden. Während westliche Staaten vermehrt auf die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes – also der Erhöhung des Wohlstandes durch Wirtschaftswachstum – setzten, geht das kleine Entwicklungsland bereits seit den 1970er Jahren andere Wege. In der 2008 erstellten Verfassung ist die Erhöhung des „Bruttoinlandsglücks“, also die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung, als Staatsziel verankert. In einem ersten Schritt sorgte der damalige König dafür, dass Bildung und ärztliche Versorgung kostenfrei sind. So steigerte er die durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 40 auf über 65 Jahre und erreichte, dass inzwischen etwa 60% der Bevölkerung lesen und schreiben können. Zu den Kriterien zur Ermittlung des individuellen Glücks gehören neben einer „guten Regierungsführung“ ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftswachstum, der Erhalt der bhutanischen Kultur, Umweltschutz sowie Gesundheit und Lebensstandard aber auch spirituelle Bedürfnisse und die Verwendung von Zeit.
Angeregt durch die Erkenntnis, dass das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung eines Landes, die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung immer unzutreffender darstellt, hat die OECD, die Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit, einen neuen Index zur Messung der Lebenszufriedenheit entwickelt. Im Better life Index finden Wohnverhältnisse, Einkommen, Arbeit, Gemeinwesen, Bildung, Umweltschutz, Bürgerschaftliches Engagement, Gesundheit, Lebensverhältnisse, Sicherheit und die sog. Work-Life-Balance, also die Ausgeglichenheit von Arbeitsbelastung und Freizeit, eine stärkere Berücksichtigung.
Glück hängt also von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber was bewirkt eigentlich, dass wir Glück empfinden? Darum wird es gehen, wenn wir im nächsten Kapitel einen Abstecher in die faszinierende Welt der Hirnforschung unternehmen.
Wie funktioniert Glück?
Gemeinhin gilt das Gehirn als Schaltzentrale des Körpers. Hier werden unsere Wahrnehmungen koordiniert und entsprechende Reaktionen veranlasst. Also muss hier auch der Ort sein, wo Glück empfunden wird.3 Grund genug, diesem Organ ein wenig Aufmerksamkeit zu widmen. Das soll an dieser Stelle geschehen. Das sollte es uns erleichtern, in der Folge einige Glücksmechanismen besser zu verstehen und auch viele Stolpersteine auf dem Weg zum Glück erfolgreicher zu umgehen.
Das Gehirn - Wunder der Schöpfung
Beginnen wir mit ein paar beeindruckenden Fakten zu diesem faszinierenden Organ.
Das Gehirn eines Mannes wiegt durchschnittlich etwa 1400 Gramm, das einer Frau durchschnittlich 100 Gramm weniger4. Das bedeutet umgerechnet, dass das Gehirn etwa 2% des Körpergewichtes eines Erwachsenen ausmacht. Dabei verbraucht es aber mit 20 Watt etwa 20% der Ruheenergie. Beim Neugeborenen sind es sogar 50 - 70%.
Wenn ein Mensch geboren wird, verfügt das Gehirn bereits über etwa 100 bis 120 Milliarden Nervenzellen, die sog. Neuronen. Diese sind über einzelne Kontaktstellen, die Synapsen, jeweils mit durchschnittlich 1000 anderen Neuronen verbunden und tauschen mit ihnen Informationen aus. Daraus ergibt sich die unvorstellbare Zahl von etwa 100 Billionen (das ist eine 1 mit 14 Nullen!) Nervenverbindungen im Gehirn.
Diese ungeheuere Anzahl an Verbindungen ermöglicht es unserem Gehirn in einer Sekunde bis zu 10 Milliarden Informationseinheiten zu verarbeiten. Um diese Informationsflut zu speichern verfügt unser Gehirn über eine geschätzte Speicherkapazität von bis zu 1000 Terabyte.
Alle diese Leistungen erbringt unser geniales Gehirn mit einer unvergleichlichen Effizienz. Moderne Supercomputer benötigen für eine annähernd ähnliche Rechenleistung bis zu 5000-mal soviel Energie.
In der Zeitschrift GEO5 hieß es in einem Artikel zur Hirnentwicklung: „Erlaubt man sich für einen Augenblick, die Natur zu vermenschlichen, dann ging sie im Verlauf der Evolution vor wie ein etwas verschrobener Baumeister, der im Laufe seines Lebens ein Gartenhäuschen nach und nach zu einer Villa ausbaut: Kaum etwas wurde weggeworfen, nur selten eine Wand eingerissen, stattdessen immer wieder an und umgebaut. Neue Raumfluchten entstanden, während alte Kämmerchen weiterhin genutzt wurden und der Keller fast unverändert blieb. So nahm nach und nach ein Prachtbau Gestalt an, der zu vielerlei Zwecken taugt.“
Das menschliche Gehirn besteht - grob gegliedert - aus vier Bereichen, dem Hirnstamm, dem Zwischenhirn, dem Kleinhirn und dem Großhirn. Diesen Bereichen können bestimmte Funktionen zugeordnet werden. Dabei sind aber oftmals an einer Funktion mehrere Bereiche in einem komplexen Zusammenspiel und aktivem Informationsaustausch beteiligt. Hier steht die Forschung noch ziemlich am Anfang, aber einige wesentliche Funktionen lassen sich doch schon ungefähr zuordnen.
Der Hirnstamm ist der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil des Gehirns. Schon Reptilien besitzen ein solches Areal. Es sitzt direkt im Anschluss an das Rückenmark. Zuständig ist dieser Teil für die Steuerung von Reflexen und Instinkten, also von meist unwillkürlichen, unbewussten Handlungen.
Als nächstes folgt – sowohl anatomisch als auch von der Entwicklung her – das Zwischenhirn, das auch schon bei niederen Säugetieren vorhanden ist. Seine Aufgaben sind die Steuerung vieler Körperfunktionen, wie etwa der Körpertemperatur oder des Hungergefühls aber auch des Sexualtriebes. Auch unsere Grobmotorik – die grundsätzliche Fähigkeit, die Muskeln zu bewegen – hat hier ihre Steuerung. Eine weitere, in unserem Zusammenhang sehr wichtige Funktion des Zwischenhirns ist die Auswahl der eingehenden Informationen: Hier wird entschieden, welche Sinneswahrnehmungen zur Weiterverarbeitung an unser Großhirn gesandt werden und welche nicht.
Das Kleinhirn, das im Hinterkopf liegt und in der Entwicklung zeitgleich mit dem Großhirn vor etwa 400 Mio. Jahren entstand, hat die Aufgabe der Planung, Koordination und Feinabstimmung von Bewegungsabläufen, wie etwa dem Greifen eines Gegenstandes oder dem Halten des Gleichgewichtes beim Laufen oder Radfahren. Auch an Lernvorgängen ist das Kleinhirn maßgeblich beteiligt.
Das Großhirn schließlich ist die vierte Region des Gehirns. Es ist wiederum in vier große Bereiche, sog. Lappen, eingeteilt, die unterschiedliche Funktionen ausüben. Seine etwa 2-4mm dicke Außenschicht wird Cortex genannt. In ihm werden höhere Funktionen wie Verstand, Vernunft und Logik verarbeitet. Aber auch die komplexeren Sinneswahrnehmungen, wie Tasten, Sehen, Hören, Riechen und Schmecken sowie deren Verbindung zu konkreten Wahrnehmungen und Erinnerungen werden hier koordiniert.
Wahrnehmung
Bei der Betrachtung der Gehirnfunktion mag manches kompliziert und umständlich aussehen. Aber wir wollen hier von der Grundannahme ausgehen, dass diese Funktionsweise die beste aller Möglichkeiten darstellt und immer einen Sinn macht, auch wenn er uns mitunter noch verborgen ist. Losgelöst von allen moralischen Vorschriften ist das oberste Ziel die Lebenserhaltung. Diesem Ziel werden alle anderen Ziele untergeordnet. Wenn also etwas von unserem Gehirn als wichtig erachtet wird, dann können wir davon ausgehen, dass es einen Überlebensvorteil bietet.6
Dabei müssen wir allerdings berücksichtigen, dass Veränderungen in der Evolution eine lange Zeit benötigen. Eine Zeitspanne von vielen tausend Jahren ist erforderlich, um Anpassungen an veränderte Lebensbedingungen genetisch zu verankern. Wie jeder beobachten kann, hat sich das Leben des Menschen in den vergangenen 20.000 Jahren rasant verändert. Viele Verhaltensstrategien, die bei unseren Vorfahren beim Zusammentreffen mit einem Säbelzahntiger sehr viel Sinn machten, sind in heutigen Zusammenhängen ziemlich kontraproduktiv. Welche Folgen das hat, werden wir gleich sehen. Zuvor wollen wir aber noch einmal genauer betrachten, was im Einzelnen geschieht, wenn wir etwas wahrnehmen? Zuerst erreicht ein Sinneseindruck in Form eines elektrischen Impulses durch das Rückenmark unseren Hirnstamm. Hier liegt, wie oben erwähnt, die Schaltzentrale für Reflexe. Wenn wir also beispielsweise stolpern, melden verschiedene Sinnesorgane den Reiz. So meldet unser Gleichgewichtsorgan im Ohr die plötzliche Verlagerung des Gleichgewichtes, unser Fuß meldet den Kontakt mit einem Stein, unser Auge meldet den auf uns zurasenden Erdboden und vieles mehr. Aber bevor wir dies alles bewusst wahrgenommen haben, hat unser Körper schon reagiert und durch entsprechende Muskelimpulse an die Beine oder Arme den Fall gestoppt. Reflexartig haben wir unseren Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht und einen Sturz und damit mögliche Verletzungen verhindert. Ein eindeutiger Überlebensvorteil.
Möglich wurde dies, weil unser Stammhirn die typische Kombination der ankommenden Reize auswerten und so entsprechend reagieren konnte.7
Ergibt die Reizauswertung im Hirnstamm keinen Handlungsbedarf an Reflexbewegungen oder instinktgesteuerten Handlungen, werden die Reize ans Zwischenhirn weitergeleitet.
Hier werden die Impulse sortiert und ggf. an die entsprechenden Regionen im Kleinhirn und Großhirn weitergeleitet. Dabei wird gleichzeitig entschieden, welche Information unbewusst verarbeitet wird und welche so wichtig ist, dass sie in unser Bewusstsein dringen soll.
Auch dies ist eine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Erinnern wir uns, wie viele Informationen jede Sekunde unser Gehirn erreichen. Ohne einen solchen Filter würden wir in der Informationsflut untergehen. Stellen Sie sich beispielsweise vor, sie sitzen in einem Sessel und lesen gerade dieses Buch. Von ihrem Rücken aus melden die Tastsensoren den Druck der Rückenlehne und von Ihrem Gesäß die Berührung mit der Sitzfläche. Das sind Informationen, die sie, wenn alles in Ordnung ist, eigentlich jetzt nicht weiter interessieren. Ebenso ihr gleichmäßiger Herzschlag oder die angenehme Raumtemperatur. All diese Meldungen erregen erst unsere Aufmerksamkeit (im wahrsten Sinne des Wortes), wenn etwas ungewohnt ist.
Das ist die erste Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit zu wecken. Unsere Wahrnehmung reagiert auf Veränderung. Das ist - so ganz nebenbei bemerkt - auch der Grund, warum Werbestrategen bewegte Gegenstände oder blinkende Lichter in Schaufenstern platzieren. Sie nutzen so unseren angeborenen Instinkt, auf Veränderungen zu reagieren.
Dass wir dies tun, hat natürlich auch einen guten Grund: Für unsere Vorfahren war es überlebensnotwendig, einen heranspringenden Säbelzahntiger möglichst schnell zu bemerken und sich in Sicherheit zu bringen. Wer den Tiger übersehen hat, gehört höchstwahrscheinlich nicht zu unseren Vorfahren.
Eine zweite Möglichkeit unsere Aufmerksamkeit zu wecken ist die sog. Konditionierung.
Nur etwa 10% der Informationen, die in unserem Gehirn ankommen, erreichen unser Bewusstsein. Welche 10% dies sind, können wir mit unserem Willen beeinflussen.
Vom Großhirn ergeht quasi ein Auftrag, auf diese Reize besonders zu achten.
Auch hierfür ein Beispiel. Sie interessieren sich für einen bestimmten Autotyp. Sie informieren sich, schauen sich Prospekte an, beschäftigen sich mit diesem Auto. Was geschieht? Plötzlich sehen sie diesen Wagen an fast jeder Straßenecke. Sicher war er in den vergangenen Wochen genauso häufig zu sehen, aber sie hatten ihn nicht wahrgenommen.
Durch die intensive Beschäftigung damit haben Sie ihrem Zwischenhirn den Auftrag erteilt: „Das ist jetzt wichtig. Wenn dieser Gegenstand auftaucht, bitte sofort an das Bewusstsein melden.“ Ihr Zwischenhirn hat also gelernt, was wichtig ist.
Auch diese Fähigkeit bot unschätzbare Überlebensvorteile, wenn es darum ging, sich an neue Lebensräume anzupassen, Nahrung zu finden oder neue Gefahren zu erkennen.
Unser Gehirn arbeitet also in drei Stufen:
Wahrnehmung – über die Sinnesorgane
Interpretation – durch Vergleich der aktuellen Wahrnehmung mit früheren Wahrnehmungen
Bewertung – ist etwas „bedrohlich“ oder ist es „vorteilhaft“?
Die Bohnen in der Tasche
Bei diesem Tipp geht es um das Training unserer Wahrnehmung. Und zwar geht es darum, den Blick für all das Schöne, das uns im Leben umgibt, zu schärfen. Dafür benötigen Sie eine gute Hand voll Bohnen oder Glasperlen. Diese stecken Sie in ihre rechte Hosentasche. Bei jeder Situation über die Sie sich freuen können, nehmen Sie eine Bohne und lassen sie von der rechten in die linke Hosentasche wandern. Wertschätzen Sie auch hier ganz besonders die so genannten „kleinen Dinge“ all das, was uns so selbstverständlich geworden ist, denn sie machen einen Großteil unseres Lebens aus. Am Abend leeren Sie dann Ihre linke Tasche. Na, hätten Sie gedacht, dass es so viel Schönes in Ihrem Leben gibt? Erinnern sich an die einzelnen Situationen. So können Sie sich erneut darüber freuen.
Ob wir etwas als „gut“ oder „schlecht“ empfinden, ist also Ergebnis unserer Bewertung, die auf unserer Erfahrung basiert. Dies können wir uns auch im Alltag zunutze machen, wie der nächste Glückstipp zeigt.
Alles hat zwei Seiten!
Versuchen Sie einmal ganz bewusst, an allem, was Ihnen widerfährt, etwas Positives zu finden.
Machen Sie beispielsweise einen Fehler, dann suchen Sie danach, was Sie trotzdem alles richtig gemacht haben. Meckert Sie jemand an, dann freuen Sie sich darüber, dass Sie selber besser gelaunt sind. Verlieren Sie 10 Euro, dann freuen Sie sich darüber, dass es keine 20 Euro waren. Und so weiter.
Mit etwas Phantasie und ein wenig Übung lässt sich in jeder Situation ein „Goldstückchen“ finden.
Das glückliche Gehirn
Ein für unser Thema besonderer Bereich des Gehirns ist das Limbische System