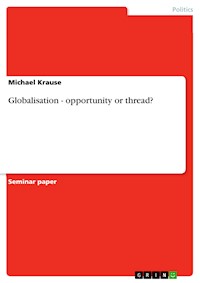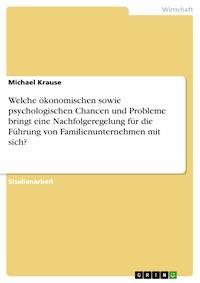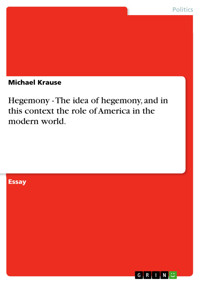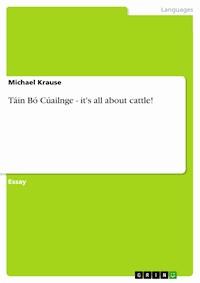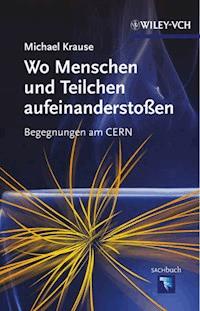
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Begegnungen am CERN - Menschen, die die Geheimnisse des Universums entschlüsseln/Michael Krause stellt sie uns vor Eine »wissenschaftliche Sensation«, ein »historischer Meilenstein«, historisch so bedeutend wie die Mondlandung: Als Wissenschaftler des CERN im Juli 2012 die Existenz eines »Gottesteilchens«, das allen anderen Teilchen Masse verleiht, mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 99,999 Prozent bestätigten, waren die Reaktionen überwältigend. Schließlich arbeiten die Forscher hier an nichts Geringerem als an der Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums. Die Suche nach dem Grund des Daseins und dem Ursprung aller Materie ist auch das Thema dieses Buches. Träume, Visionen, Forschungen: die Menschen stehen im Mittelpunkt Das »Gottesteilchen«, die Erforschung der »Dunklen Materie« und der »Dunklen Energie« und der stärkste je gebaute Teilchenbeschleuniger der Welt - all das sind die spannenden Bestandteile des Buches. In den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt Krause jedoch die Menschen am CERN, ihren Hintergrund, ihre Geschichte, ihre Arbeit, ihre Forschungen, Träume und Visionen - sie sind das Hauptthema des Buches. Krause verleiht den wissenschaftlichen Forschungen am CERN somit ein persönliches Gesicht und schreibt das Portrait einer ganzen Generation von Wissenschaftlern, die in den vergangenen Jahrzehnten an der sogenannten »Neuen Physik« gearbeitet haben. Eine Auswahl an Interviewpartnern von Michael Krause -- Top-Wissenschaftler am CERN, die einen großen Anteil am Nachweis des Higgs-Boson und damit zum Physik-Nobelpreis 2013 beigetragen haben. Rolf-Dieter Heuer, als Generaldirektor des CERN dafür zuständig, dass das CERN mit all seinen verschiedenen Experimenten und den 10000 Mitarbeitern, reibungslos funktioniert Tejinder Virdee, Chefarchitekt des sogenannten "CMS-Experiments", eines "Allround-Apparats, der der Suche nach dem Higgs-Boson und Dunkler Materie" dient (Zitat aus dem Buch) Lyndon Evans, Projektleiter für den Bau des LHC (Large Hadron Collider), an dem die Kernexperimente stattfanden, um das Higgs-Boson nachzuweisen Tara Shears, im Rahmen des sogenannten LHCb-Experiments hauptsächlich damit befasst, das Standardmodell der Teilchenphysik, zu dem das Higgs-Boson gehört, zu testen John Ellis, der meistzitierte Physiker aller Zeiten, hat die Bezeichnung "Theory of Everything" (Theorie für alles) geprägt; er hat viel zum theoretischen Verständnis des Standardmodells beigetragen, zu dem das Higgs-Boson gehört, und befasst sich auch mit Theorien jenseits des Standardmodells Jonathan Butterworth leitet einen Teil des sogenannten ATLAS-Experiments, das ebenfalls zum Nachweis des Higgs-Bosons durchgeführt wurde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
CERN – In den Kathedralen der Technologie
Danksagung
Liste der CERN-Generaldirektoren (CERN Director-General)
1 Geschichte des CERN
Der Geist Europas – die Züricher Rede Churchills
CERN – die Vorgeschichte
Geburtsstunde des CERN
Aufbau des CERN
CERN heute
Zukunft des CERN
2 Der Praktiker: Rolf-Dieter Heuer
3 Der Beginn der modernen Physik
4 Der Experimentalist: Tejinder Virdee
5 Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr
6 Der Erbauer des LHC: Lyn Evans
7 Physik, Musik, Kunst: Tara Shears
8 Der Theoretiker: John Ellis
9 Oersted, Ampère, Faraday, Maxwell
Michael Faraday (1791–1867)
10 Der Kommunikator: Rolf Landua
11 Albert Einstein
12 Der japanische Weg: Masaki Hori
13 Der Nobelpreisträger: Carlo Rubbia
14 Der amerikanische Freund: Sebastian White
15 Die freundlichen Konkurrenten: Sebastian White und Albert De Roeck
ATLAS-Experiment und CMS-Experiment
ATLAS und CMS – gesunder Wettbewerb
16 Rock ’n’ Roll, Bier, Billard und Musik: Jonathan Butterworth
ATLAS Experiment
Schönheit ist dort, wo man sie findet
17 Das Higgs – und wie weiter?
Literaturnachweis
Glossar
Stichwortverzeichnis
Weitere Sachbücher und Titel aus der Erlebnis Wissenschaft Reihe von Wiley-VCH:
Ganteför, G.
Alles NANO oder was?Nanotechnologie für Neugierige
2013
ISBN: 978-3-527-32961-8
Schwedt, G.
Plastisch, elastisch, fantastischOhne Kunststoffe geht es nicht
2013
ISBN: 978-3-527-33362-2
Synwoldt, C.
UmdenkenClevere Lösungen für die Energiezukunft
2013
ISBN: 978-3-527-33392-9
Böddeker, K. W.
Denkbar, machbar, wünschenswert?Wie Technik und Kultur die Welt verändern
2013
ISBN: 978-3-527-33471-1
Kricheldorf, H.R.
Menschen und ihre MaterialienVon der Steinzeit bis heute
2012
ISBN: 978-3-527-33082-9
Heuer, A.
Der perfekte TippStatistik des Fußballspiels
2012
ISBN: 978-3-527-33103-1
Lutzke, D.
Surfen in die digitale Zukunft
2012
ISBN: 978-3-527-32931-1
Bührke, T., Wengenmayr, R. (Hrsg.)
Erneuerbare EnergieKonzepte für die Energiewende3. Auflage
2012
ISBN: 978-3-527-41108-5
Autor
Michael KrauseKnesebeckstraße 9210623 Berlin
UmschlagbildDie Gestaltung erfolgte auf derGrundlage von Bildern von Fotolia.
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-33398-1ePDF ISBN 978-3-527-67009-3ePub ISBN 978-3-527-67008-6Mobi ISBN 978-3-527-67007-9
Umschlaggestaltung Simone BenjaminSatz le-tex Publishing Services GmbHDruck und Bindung CPI Ebner & Spiegel, Ulm
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Über den Autor
Michael Krause, geboren 1956, studierte Geschichte. Er arbeitet heute als Autor, Regisseur und Schauspieler. In seinen Büchern über Naturwissenschaft und Technik interessiert er sich vor allem für die Menschen, die hinter bahnbrechenden Entdeckungen, spektakulären Misserfolgen oder auch kleinen, aber wichtigen Fortschritten stehen und die, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, mit ihren Forschungen zu einem besseren Verständnis dessen beitragen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Von Michael Krause ist bei Wiley auf Deutsch außerdem erschienen: »Wie Nikola Tesla das 20. Jahrhundert erfand«.
CERN – In den Kathedralen der Technologie
Auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält
Die moderne Welt erfüllt die Zeit der Menschen mit immer mehr Ereignissen, Aufgaben und Informationen. Alles ist schnelllebiger geworden und es gibt kaum noch Freiräume zum Innehalten und Nachdenken. Doch gerade die kontemplative Reflexion, die eigene Suche nach den Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens ist eine der Grundlagen des menschlichen Daseins. Der Mensch sucht und forscht, er findet und erfindet – Neugier ist ein großer Teil seines Wesens. Diese ewige Suche des Menschen nach dem Grund des Daseins, dem Beginn der Welt und dem Ursprung aller Materie ist Thema dieses Buches, das sich den Menschen am CERN widmet. Wie, was und warum sucht der Mensch – und was bringt manche Menschen dazu, ihr gesamtes Leben nach der faustischen Frage auszurichten: Was ist es, das die Welt im Innersten zusammenhält?
CERN ist eines der größten wissenschaftlichen Forschungszentren der Welt. Der stärkste jemals gebaute Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider (LHC) ist hier seit Ende 2008 in Betrieb. In einem Tunnel in 100 Metern Tiefe unter der Erdoberfläche, die Staatsgrenze zwischen Schweiz und Frankreich durchquerend, werden mit dieser riesigen Maschine Zustände erzeugt, wie sie kurz nach dem Big Bang, dem Beginn des Universums geherrscht haben. Die Experimente am CERN – ATLAS, CMS, ALICE, LHCb und mehrere Dutzend weitere – sind darauf ausgerichtet, unser momentan gültiges Modell des Universums in Frage zu stellen, zu vervollständigen und möglicherweise zu erweitern. Das allgemein gebräuchliche und anerkannte sogenannte Standardmodell der Physik hat nämlich fundamentale Lücken. In diesem physikalischen Gesamtbild unserer Welt sind unter anderem zwei Fragen bisher ungeklärt:
Welcher Mechanismus und welches Teilchen verleiht den bislang bekannten kleinsten Bausteinen der Welt, den Elementarteilchen, ihre Masse?
Welcher Mechanismus und/oder welches Teilchen ist für die Schwerkraft verantwortlich?
Im Standardmodell gibt es auf diese beiden Fragen auch schon Antworten, zumindest teilweise. Überträger der Masse eines Teilchens ist demnach das unter anderen vom schottischen Physiker Peter Higgs theoretisch vorhergesagte Higgs-Boson. Für die Schwerkraft wiederum sucht man nach einem noch nicht nachgewiesenen »Graviton«. Bei der Suche nach dem Higgs-Boson ist man sich am CERN inzwischen relativ sicher, dass es wirklich existiert. Die Schwerkraft und das damit verbundene Graviton ist bis jetzt nur innerhalb eines weitgehend ungesicherten »Anbaus« an das Standardmodell skizziert, aber keineswegs theoretisch und schon gar nicht praktisch nachgewiesen.
Neben diesen beiden fundamentalen Eigenschaften (Masse, Schwerkraft) des uns umgebenden Kosmos fehlen in der gängigen wissenschaftlichen Erklärung die mit Abstand größten Anteile des Massen- und Energiegehalts des Universums: Dunkle Materie und Dunkle Energie. Die Dunkle Materie ist dafür verantwortlich, dass rotierende Systeme wie zum Beispiel Galaxien nicht auseinanderfliegen. Sie ist so etwas wie ein zäher Brei, der diese Systeme zu umgeben scheint. Dunkle Energie wiederum soll dafür verantwortlich sein, dass sich unser Universum seit einigen Milliarden Jahren immer schneller ausdehnt. Was diese allergrößten Anteile des Universums, immerhin 96 Prozent, ausmacht, ist nach dem jetzigen Stand der Physik noch völlig unbekannt. Was die Welt also – außer selbstverständlich der für die Menschen so wichtigen Liebe – im Innersten zusammenhält bzw. auseinandertreibt, ist weiterhin und immer noch größtenteils Terra incognita. Der LHC, der größte und energiereichste Teilchenbeschleuniger der Welt, wurde erbaut, um dieses bis heute unbekannte Terrain zu erkunden. Mit der hohen Arbeitsenergie des LHC, dieser riesigen, komplexen physikalischen Arbeitsmaschine, wird man die Türen zu diesem Neuland aufstoßen und Licht in das dahinterliegende neue physikalische Gebiet bringen können.
Allerneueste Technologien, wissenschaftliche Monster-Maschinen und die abenteuerliche Reise jenseits der uns bekannten physikalischen Welt sind die spannenden Ingredienzien – doch der Mensch, Triebfeder, Initiator und staunender Beobachter steht im Mittelpunkt dieses Buches. Nicht die Technologie ist wichtig, sondern derjenige, der sie beherrscht. Nicht alles ist wichtig, sondern das, was man versteht. Unter diesen beiden Maximen entstand dieses Buch, das hauptsächlich anhand von Interviews mit den am CERN arbeitenden Menschen ein Bild des CERN-Kosmos liefern soll – das Bild des modernen Wissenschaftlers in der bahnbrechend innovativen Epoche des beginnenden 21. Jahrhunderts. Diese Epoche scheint ähnliche Bedingungen wie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zu erfüllen, als die Welt um 1900 gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Quantensprünge erlebte: Atomphysik, politische Krisen und gewaltige gesellschaftliche Umbrüche – und die unendliche Neugier des Menschen an der Schwelle eines neuen Zeitalters zu immer weitergehenden Entdeckungen anspornte.
Die Protagonisten dieses Buchs sind am CERN arbeitende Wissenschaftler. Sie leiten Projekte und Experimente, erforschen bisher Unbekanntes, verfolgen neue Theorien und scheinen doch alle Teil eines Ganzen zu sein, das sich zielgerichtet und dabei dennoch unspezifisch mehreren spannenden Fragen annähert: Was ist es, das die Welt im Innersten zusammenhält? Wie sieht das Terrain, zu dem der LHC die Tür aufschlägt, aus? Was sind die nächsten Fragen, um die nächsten wichtigen Antworten zu erhalten? In den über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstandenen Interviews geht es dabei in erster Linie um die Person und die Persönlichkeit der Menschen, anhand derer wir durch die einzigartige Welt des CERN geführt werden. Ihre beruflichen und menschlichen Erfahrungen, Wünsche und Überlegungen sollen uns die Welt dieser manchmal »kuriosen Spezies des Menschen« (New York Times) näher bringen und einen Einblick in die menschlichen Voraussetzungen für fundamentale Forschungen und neue Entdeckungen ermöglichen.
Die Interviews sind darüber hinaus Anlass und Leitfaden für inhaltliche Einschübe, die bestimmte Begriffe erklären, historische Beispiele benennen und thematische Zusammenhänge und grundsätzliche Fragen erläutern. Die historischen Einschübe bestehen zu einem gewissen Teil aus Zitaten. Es sind grundlegende wissenschaftliche Aussagen oder Sentenzen, die ihre Kraft und Bedeutung als Grundlage des wissenschaftlichen Denkens und Forschens bis heute behalten haben. Sie behandeln die Grundlagen und Methoden der wissenschaftlichen Forschung im Lauf der Jahrtausende. Dabei ist erstaunlich, wie sich der menschliche Geist im Lauf seiner Entwicklung immer mehr zu Klarheit und gesicherter Eindeutigkeit hin entwickelt. Die moderne Forschung spekuliert nicht, sie rechnet – immer auf den Schultern ihrer Vorgänger stehend, die schon seit der Vorzeit an der Erforschung und wissenschaftlichen Erklärung des uns umgebenden Kosmos arbeiten.
Dieses Buch begibt sich auf eine spannende Reise, um anhand des CERN und der dort forschenden Menschen Lauf, Sinn, Ziel und Zweck der ewigen menschlichen Suche nach dem Innersten der Welt darzustellen. Es interessiert uns alle, woher wir kommen und wohin wir gehen. Was ist es, aus dem wir geschaffen sind? Wie ist diese Welt wirklich, die uns umgibt? Gibt es Ewigkeit oder Endlichkeit? Was ist Energie? Welchen Platz nehme ich als Mensch im riesigen Weltrad von Kreation und Vergänglichkeit ein? All diese Fragen, die Ur-Fragen der Menschheit werden in diesem Buch angesprochen und vielleicht zu einem kleinen Teil beantwortet werden können.
»Wo Menschen und Teilchen aufeinanderstoßen« dokumentiert darüber hinaus einen historischen Moment in der Geschichte der Menschheit. Die Wissenschaftler am CERN suchen nach eindeutigen Beweisen für die Existenz des Higgs-Bosons, das von Leon Lederman, dem ehemaligen Direktor der amerikanischen Konkurrenz-Anlage Tevatron, als »Gottesteilchen« bezeichnet wurde, und seitdem in der Presse weiterhin gerne so genannt wird. Das Higgs-Boson ist der letzte fehlende Baustein des Standardmodells, in dem alle fundamentalen Teilchen und Kräfte der uns bekannten Natur beschrieben sind. Das Higgs-Boson hat der Theorie nach die Funktion, den Elementarteilchen Masse zu geben. Ob das Higgs-Boson wirklich existiert und ob es tatsächlich so ist, wie es theoretisch sein soll, ist bis jetzt nicht sicher nachgewiesen. Es ist auch möglich, dass noch weitere Mechanismen bei der Erzeugung von Masse und Gravitation gelten – oder, dass das Higgs-Teilchen nur ein Vertreter einer ganzen Reihe bisher unbekannter Teilchen ist.
»Wissenschaft ist menschlich und Menschen sind nie cool. Menschliche Dinge sind voller Emotionen und Tragödien.«
Victor Weisskopf (1908–2002, Generaldirektor CERN 1961–1966)
Danksagung
Professor Dr. Rolf-Dieter Heuer, CERN Generaldirektor (DG CERN)
Professor Dr. Tejinder Virdee, CMS Collaboration, Imperial College London, FRS (Fellow Royal Society London)
Dr. Lyndon Rees Evans, LHC Project Leader, CBE (Commander of the British Empire), FRS
Dr. Tara Shears, Reader University of Liverpool, LHCb Experiment
Professor Dr. John Ellis, CERN Theory Division, CBE, FRS
Dr. Rolf Landua, Leiter Education and Public Outreach, CERN
Professor Dr. Masaki Hori, ASACUSA-Experiment, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching
Professor Dr. Carlo Rubbia, Nobelpreis für Physik 1984, Wissenschaftlicher Direktor IASS Potsdam
Dr. Sebastian White, ATLAS-Experiment, Zero-Degree-Calorimeter-(ZDC) Experiment, Rockefeller Universität, New York
Professor Dr. Albert De Roeck, CMS-Experiment, Universität Antwerpen
Professor Dr. Jonathan Butterworth, ATLAS-Experiment, UCL Group, Professor der Fakultät für Physik und Astronomie University College London (UCL)
Liste der CERN-Generaldirektoren (CERN Director-General)
Edoardo Amaldi 1952–1954 (Generalsekretär)
Felix Bloch 1954–1955
Cornelis Jan Bakker 1955–1960
John Adams 1960–1961 (Interim)
Victor Frederick Weisskopf 1961–1965
Bernard Gregory 1966–1970
Willibald Jentschke 1971–1975
John Adams 1976–1980
Léon van Hove 1976–1980 (Theorieabteilung)
Herwig Schopper 1981–1988
Carlo Rubbia 1989–1993
Christopher Llewellyn Smith 1994–1998
Luciano Maiani 1999–2003
Robert Aymar 2004–2008
Rolf-Dieter Heuer seit 2009
1Geschichte des CERN
»Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen.«
Winston Spencer Churchill (1874–1965, Nobelpreis für Literatur 1953)
Die Gründungsgeschichte des CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, enthüllt in vielen historisch und wissenschaftlich interessanten Details die Einzigartigkeit dieses Projekts. CERN ist das erste Joint Venture eines nach dem Zweiten Weltkrieg langsam wieder zusammenwachsenden Europa und ein Sinnbild für die Fruchtbarkeit des europäischen Gedankens, der sich in der Geschichte des CERN als eine der überzeugendsten Grundideen bewiesen hat. Viele der Strukturen des heutigen CERN lassen sich auf die Geschichte seiner Gründung zurückverfolgen und dadurch verständlich machen. In der Gründungsphase des CERN entsteht der Geist, der noch heute an diesem auf der ganzen Welt einzigartigen Wissenschaftsstandort zu verspüren ist.
Der Geist Europas – die Züricher Rede Churchills
Winston Churchill, seit dem Jahr 1900 Mitglied des englischen Unterhauses und Premierminister Englands ab 1940, war nochwährend der Potsdamer Konferenz, auf der wichtige Entscheidungen über das weitere Vorgehen der Alliierten USA, Russland und Großbritannien in Deutschland und gegen Japan entschieden wurden, bei den Wahlen zum britischen Unterhaus abgewählt worden. Er musste seinen Posten als Premierminister an den Labour-Politiker Clemens Attlee abgeben. Churchill blieb weiterhin politisch aktiv und präsentierte im März 1946 seine Idee vom Eisernen Vorhang, die während des Kalten Krieges das Bild Europas und die Politik zwischen Ost und West bestimmen sollte.
Am 19. September 1946 hielt Churchill vor Studenten der Züricher Universität seine berühmt gewordene Züricher Rede. Churchill skizzierte darin vor der akademischen Jugend der neutralen Schweiz seine Ideen für die Zukunft Europas. Unter dem wenig verheißungsvollen Titel »Über die Tragödie Europas« stellte Churchill den Weg Europas in die Zukunft dann doch durchaus positiv und verheißungsvoll dar. Churchills visionäre Skizze sollte seinen Realitätscharakter bis heute behalten. Damals war sie überraschend, geradezu revolutionär. Churchill malt das Bild eines wiedererstarkenden Europa, das im Kern weiterhin auf den beiden stärksten europäischen Staaten, Frankreich und Deutschland beruhen sollte. Doch Churchill besteht nicht nur auf der Wiederannäherung dieser beiden Staaten, die als Kriegsgegner noch bis vor kurzem gegeneinander gekämpft hatten. Er plädiert darüber hinaus für ein neues, höheres Ziel, die Errichtung einer Art Vereinigte Staaten von Europa (»… a kind of United States of Europe«).
Winston Churchill:
»Dieser edle Kontinent, der alles in allem die schönsten und kultiviertesten Regionen der Erde umfasst [… ] ist die Heimat aller großen Muttervölker der westlichen Welt. Hier liegen die Quellen des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik, hier ist der Ursprung der meisten Kulturen, Künste, der Philosophie und Wissenschaften sowohl des Altertums wie auch der Neuzeit. Wäre Europa jemals darin vereint, dieses gemeinsame Erbe teilen zu können, wären Glück, Wohlstand und Ehre seiner drei- oder vierhundert Millionen Einwohner keine Grenzen gesetzt. [… ]Man muss die europäische Familie wieder erschaffen – oder so viel davon wie uns möglich ist – und ihr eine Struktur geben, in der sie in Frieden, Sicherheit und Freiheit bestehen kann. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. [… ] Wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa erschaffen wollen – welchen Namen oder welche Form auch immer dazu nötig ist – dann müssen wir jetzt damit beginnen.«
(EU-Archiv, Übersetzung CVCE)
Churchills Züricher Rede wurde viel beachtet, sie wird oft zitiert und sehr oft missverstanden. Im Kern beschäftigt sie sich mit der Identität und der Basis Europas, die auf Gerechtigkeit, Freiheit und Kultur beruht und nicht mit der Schaffung eines staatlich vereinigten Europa. Als Churchill seine visionäre Rede hielt, lagen große Teile Europas noch in Trümmern. Von den europäischen Tugenden hatte die Kultur am ehesten und am meisten gelitten. Aber genauso widerstandsfähig wie Kultur nun einmal ist kam sie auch am ehesten wieder zu Tage. Churchills Idee war, Europa kulturell in der Familie der europäischen Völker wieder zu vereinen. Diesem grundlegenden Gedanken folgend reifte innerhalb der wissenschaftlichen Forschungsgemeinde Europas ein großes, gemeinsames europäisches Projekt heran.
CERN – die Vorgeschichte
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs hatte die europäische Wissenschaft keineswegs mehr die führende Position wie vor dem Krieg. Ihre Vorrangstellung als ehemaliges Zentrum der Grundlagenforschung war verloren. Die Lage hatte sich durch den brain drain, den Exodus einer ganzen Generation von Wissenschaftlern vor dem Naziregime und aus Europa grundlegend geändert. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA, gaben jetzt den Ton an, besonders in der Nuklear- und Teilchenphysik. Die Vereinigten Staaten von Europa – wie von Churchill ersonnen – existierten real nicht und waren politisch auch kaum vorstellbar.
Europas Physiker suchten dennoch einen Weg, um wieder Anschluss an die internationale Forschung zu bekommen. Die Ursprungsidee war, die europäische Wissenschaft wieder dorthin zu bringen, wo sie vor dem Zweiten Weltkrieg gestanden hatte. Man wollte – frei nach Churchill – die europäische Völkerfamilie wieder zusammenbringen und ein Zentrum für die Bündelung der kreativen Energie forschender Wissenschaftler erschaffen. Der Entschluss, sich zusammenzutun und eine gemeinsame, europäische Forschungsinstitution ins Leben zu rufen, war dazu der erste Schritt.
Initiativen
CERN geht auf die Initiativen zweier Kräfte zurück, die in der Phase der Neuorientierung Europas nach 1945 zusammenkamen: europäisch denkende Kulturpolitiker und aus ganz Europa stammende Teilchenphysiker. Die Kulturpolitiker suchten nach Ideen für den nötigen Wiederaufbau; den in eigener Sache oftmals sehr praktisch veranlagten Physikpionieren war klar, dass man die nationalen Kräfte bündeln musste, um die europäische Teilchenphysik auf ein Niveau zu heben, das sie gegenüber den Vereinigten Staaten wieder konkurrenzfähig machen würde. Nur eine gemeinsame, transnationale und politisch sanktionierte Anstrengung würde die hohen Investitionen aufbringen können, die für den Bau eines neuen Kernforschungslabors benötigt wurden.
Nach diesem und mehreren folgenden Fachtreffen reichte der französische Physiker Louis de Broglie (1892–1987, Nobelpreis für Physik 1929) schließlich im Dezember 1949 den ersten offiziellen Vorschlag für ein europäisches Kernforschungslabor zur Diskussion auf der Europäischen Konferenz für Kultur (European Cultural Conference) in Lausanne ein. Die Konferenz von Lausanne verfolgte die Fragestellung, wie man die friedliche Zusammenarbeit auf verschiedensten Gebieten innerhalb Europas befördern könne. Physiker, Diplomaten und Vertreter wissenschaftlicher Institutionen, insgesamt 170 Teilnehmer aus 22 Staaten, befassten sich intensiv mit den Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur Lösung europäischer Fragen. Die Konferenz machte es möglich, dass in der Schweiz – auf neutralem Boden also – eine transnationale Ebene der Diskussion und des Gedanken-austauschs entstand.
In Lausanne traf die bereits bestehende Initiative der europäischen Kernphysik auf die zur Umsetzung nötigen politischen Kräfte, denn bis jetzt fehlte der Idee noch die Unterstützung offizieller Institutionen, von Staaten und Regierungen. Nach Lausanne, einem Initialmoment der europäischen Geschichte, waren auch deutsche Diplomaten und Physiker eingeladen worden, um die Kooperation mit ihnen wieder zu ermöglichen. Die Deutschen erkannten im gemeinsamen europäischen Projekt sicherlich die Chance, das durch die Vergangenheit stark geschädigte Ansehen aufpolieren zu können und sich so allmählich wieder in die zusammenfindende Völkergemeinschaft einzugliedern. Der deutsche Vertreter auf der Konferenz in Lausanne war Carlo Schmid (1896–1979), einer der Väter des Deutschen Grundgesetzes und des Godesberger Programms der SPD. Schmids Rede trug den programmatischen Titel: »Der kreative Geist ist europäisch!«
Der Initiator der Konferenz von Lausanne war der nach mehrjährigem Aufenthalt aus den USA zurückgekehrte Schweizer Schriftsteller Denis de Rougemont (1906–1985). Europa war für de Rougemont keine Utopie mehr, sondern eine Notwendigkeit, und er setzte sich in den folgenden Jahren unermüdlich für das Entstehen und die Weiterentwickelung einer neuen europäischen Identität ein. Auf seine Initiative hin wurde im Oktober 1950 das Centre Européen de la Culture (CEC, Europäisches Kulturzentrum) in Genf gegründet, das maßgeblich an der weiteren Entwicklung eines paneuropäischen Labors für Kernphysik, dem späteren CERN, beteiligt war. De Rougemonts tiefe Überzeugung für die europäische Idee und ihrer kulturellen Werte lässt sich mit seinen eigenen Worten am besten nachempfinden. Ein Hauch dieses europäischen Geistes ist bis heute am CERN zu verspüren.
»Zu welchem Zweck wollen wir diese Mittel für Kultur und eine Erziehung zu einem gemeinsamen europäischen Bewusstsein eigentlich? Seit ewigen Zeiten schon hat sich Europa der ganzen Welt geöffnet. Ob richtig oder falsch, durch Idealismus oder Unwissen, durch die Kraft seines Geistes oder für imperialistische Ziele hat es seine Zivilisation immer als eine Ansammlung universeller Werte empfunden. Wir wollen keine europäische Nation als Gegner der großen Nationen in Ost und West und keine künstliche europäische Kultur, die nur für uns gilt und nur auf uns abgestimmt ist. Unser Ziel ist es, eine Union unserer Länder zu fördern, denn das wird die einzige Lösung sein: die Wiedergeburt unserer Kultur in der Freiheit des Geistes.«
Denis de Rougemont, Gesammelte Werke, 1994
Während der Konferenz in Lausanne wies de Rougemont auf die zunehmende Geheimhaltung innerhalb der Nuklearphysik hin. Die USA und das Vereinigte Königreich monopolisierten die Atomforschung. Nach der Entwicklung der Atombombe und den verheerenden Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki waren die europäischen Staaten in der Nuklearforschung weit abgeschlagen. De Rougemont plädierte ausdrücklich für ein gemeinsames europäisches Zentrum für Atomforschung, um den Anschluss auf diesem wichtigen Gebiet nicht zu verlieren. Als nächster Tagesordnungspunkt wurde der Vorschlag de Broglies von Raoul Dautry, dem Generalverwalter des Französischen Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) vorgebracht. De Broglies Beitrag wies vor allem darauf hin, dass eine Kollaboration der europäischen Staaten Projekte ermöglichen würde, die auf rein nationaler Ebene nicht zu verwirklichen waren. Von dieser Tatsache konnte Dautry den ebenfalls an der Konferenz von Lausanne teilnehmenden französischen Nuklearphysiker Pierre Auger (1899–1993) überzeugen, der inzwischen Wissenschaftsdirektor der 1945 gegründeten UNESCO war.
Die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, deutsch: Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) bildete den internationalen politischen Rahmen, in dem eine gemeinsame europäische Atomforschungsinstitution möglich erschien, die von den USA und Großbritannien akzeptiert werden würde. Ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung fand auf der fünften UNESCO-Generalversammlung im Mai 1950 in Florenz statt. Die weltweite politische Situation hatte sich seit der Konferenz von Lausanne radikal verändert: Im August 1949 hatte die UdSSR ihre erste Atombombe gezündet. Nachdem nun klar geworden war, dass die UdSSR ebenfalls über umfangreiches Knowhow in der Nuklearphysik verfügte, musste die Position der europäischen Nuklearforschung gestärkt werden – durch die USA.
»Ich denke, dass Physiker die Peter Pans der Menschheit sind. Sie werden niemals erwachsen und sie sind immer neugierig.«
Isidor I. Rabi
Auf der UNESCO-Generalversammlung in Florenz setzte der amerikanische Teilchenphysiker Isidor Isaac Rabi (1898–1988, Nobelpreis für Physik 1944) die von seinen europäischen Kollegen entwickelten Ideen für ein Labor für Teilchenphysik kurzerhand neu auf die Tagesordnung. Rabi hatte bei einem Treffen mit dem italienischen Experimentalphysiker Edoardo Amaldi (1908–1989) von den europäischen Plänen erfahren und sah in dem Vorschlag für ein europäisches Forschungszentrum eine unterstützenswerte Idee. Nach einem ähnlichen Modell wurde unter Rabis federführender Beteiligung der neue amerikanische Teilchenbeschleuniger (»Cosmotron«) in Brookhaven, dem amerikanischen Nuklearforschungszentrum in der Nähe von New York als Gemeinschaftsprojekt von neun wichtigen Universitäten des Landes (Columbia, MIT, Harvard etc.) gebaut. Rabi war maßgeblich am Manhattan-Projekt, dem Bau der amerikanischen Atombombe, beteiligt gewesen und hatte als Mitglied der amerikanischen Atomic Energy Commission immensen Einfluss im US-Wissenschaftsbusiness.
Pierre Auger, Edoardo Amaldi und Isidor Rabi verfassten einen schriftlichen Antrag an die UNESCO, der die Weltorganisation dazu aufforderte, »die Bildung und die Organisation regionaler Forschungszentren und Labore zu fördern, um die internationale Zusammenarbeit der Wissenschaftler zu steigern und ertragreicher zu machen, gerade wenn es um neues Wissen in Gebieten geht, deren Erforschung für ein Land nur unzureichend möglich wäre.« Dieser Antrag wurde von den Konferenzteilnehmern einstimmig verabschiedet – damit war der Idee eines europäischen Physik-Großlabors der politische Rahmen gegeben, der die nötige Stabilität für ein solches, noch nie dagewesenes Projekt geben konnte.
Rabis Motivation, europäischen Physikern in einem politisch so heiklen Bereich wie der Atomphysik mit Rat und Tat behilflich zu sein, liegt möglicherweise auch darin begründet, dass Rabi die Detonation der ersten Atombombe »Little Boy« über Hiroshima miterlebt hatte und ihm die friedliche Grundlagenforschung wichtiger erschien als die militärische Nutzung der Kernenergie. Rabi selbst hat seine tiefere Motivation später so ausgedrückt:
Isidor Isaac Rabi (Nobel Foundation 1944).
»Das Recht des Menschen auf Wissen ist nicht dasselbe wie sein Recht auf die Luft, die er atmet. Wissen muss man sich erwerben, man muss es erlernen, man muss es für sich entdecken. Sogar Lernen ist eine Art von Entdeckung. Deshalb kann das Recht des Menschen auf Wissen nur bedeuten, dass er ein Recht darauf hat, zu lernen und zu entdecken.«
Das Recht des Menschen auf Wissen, (Engineering and Science, 17/1954)
Pierre Auger hatte vor seiner im Jahr 1948 angetreten Tätigkeit bei der UNESCO – wie Rabi und Amaldi – für die amerikanische Atomic Energy Commission gearbeitet. Auger und Amaldi kannten Rabi deshalb sehr gut. Auger hatte als ehemaliger Direktor der französischen Atomenergie-Kommission (CEA) gute Verbindungen sowohl in die europäischen und amerikanischen Fachkreise wie auch als UNESCO-Direktor umfassende politische Beziehungen, die er nun mit dem eindeutigen Auftrag der Konferenz von Florenz zu nutzen begann. Amaldi reiste in den folgenden Wochen in die USA, um den Bau des neuen Cosmotron in Brookhaven zu begutachten, einem Teilchenbeschleuniger mit einer bis dahin unerreichten Teilchenenergie von 3 Gigaelektronenvolt (GeV). Mit dieser Maschine würde man in Zukunft viele Phänomene innerhalb der Teilchenphysik erheblich einfacher untersuchen und bessere Einblicke in den inneren Aufbau der Kernteilchen (Nukleonen) bekommen können. Beim Besuch der mit 23 Meter Durchmesser imposanten Anlage in Brookhaven soll Amaldi nur mit einem Wort reagiert haben: »Kolossal!«
CERN-Vorgeschichte
Ausgangspunkt: Fortschritt und Weiterentwicklung der Kernphysik benötigt große Teilchenbeschleuniger, die enorme Kosten verursachen.Europäische Physiker entwickeln Plan für ein europäisches Forschungszentrum zur Förderung der europäischen Zusammenarbeit, inklusive Deutschland.Gründerväter sind Isidor Rabi, Pierre Auger, Edoardo Amaldi, Raoul Dautry, Louis de Broglie und Lew Kowarski.Ziel ist das bessere Verständnis des Aufbaus der Atome und der Elementarteilchen.Im Dezember 1950 organisierte das Centre Européen de la Culture ein weiteres Treffen in Genf, auf dem Pierre Auger einen noch nicht detaillierten Vorschlag zum Bau eines europäischen Labors für Elementarteilchenphysik präsentierte. Das neue Labor sollte nicht mit Atomreaktoren zur Erforschung der inneren Struktur der Atome arbeiten, sondern wie die Anlage in Brookhaven, die schwedische Anlage in Uppsala und die britischen Maschinen in der Nuklearforschungsanlage Harwell mit einem Teilchenbeschleuniger.
Großbritannien hatte zwar das nötige Knowhow, zeigte aber trotz zahlreicher inoffizieller Kontakte kein Interesse an der europäischen Initiative; britische Physiker nahmen bisher nicht an den gemeinsamen Treffen teil. Im Inselreich favorisierte man Pläne mit eigenen Anlagen und war deshalb gegenüber dem UNESCO-Projekt skeptisch eingestellt. Herbert W. B. Skinner (1900–1960), Professor an der Universität von Liverpool und am Bau eines eigenen Beschleunigers interessiert, sprach sogar von »hochfliegenden und verrückten Ideen«. War die politische Haltung Großbritanniens zwar allgemein ablehnend, gab es aber auch genügend hochrangige englische Wissenschaftler, die Interesse an einem europäischen Großlabor für Teilchenphysik hatten. Sir John Cockcroft, Direktor der britischen Atomforschungsbehörde Atomic Energy Research Establishment (AERE), schickte sogar seinen jungen Kollegen Frank Goward (1919–1954) als Beobachter (Observer) nach Genf – Goward wurde später stellvertretender Leiter der Expertengruppe für das Proton-Synchrotron am CERN.
Pierre Auger, Edoardo Amaldi und Lew Kowarski 1952 in Paris (© 1952 CERN, CERN-HI-5202016).
Trotz der britischen Gegenposition verfasste man in Genf eine Resolution, die die Errichtung eines neuen Labors zum Bau eines Teilchenbeschleunigers vorschlug, dessen Energie größer sein sollte als die der Anlage in Brookhaven – oder des sogar doppelt so leistungsstarken, ebenfalls im Bau befindlichen Beschleunigers in Berkeley (USA, »Bevatron«). Die Vertreter Italiens, Frankreichs und Belgiens gewährtem dem Projekt 10 000 Dollar Startkapital und legten damit den finanziellen Grundstein für die noch zu gründende europäische Institution für Teilchenphysik. Pierre Auger konnte mit Hilfe dieses Geldes ein kleines Büro bei der UNESCO einrichten, und im Mai 1951 rief er eine Expertengruppe zusammen, die einen detaillierteren Plan zur Vorlage auf der nächsten UNESCO-Konferenz ausarbeiten sollte. Mitglieder der Projekt-Beratergruppe (Board of Consultants) waren: Edoardo Amaldi (Italien), Paul Capron (Belgien), Odd Dahl (Norwegen), Frans Heyn (Niederlande), Lew Kowarski und Francis Perrin (Frankreich), Peter Preiswerk (Schweiz) sowie Hannes Alfvén (Schweden).
Odd Dahl (1898–1994), Zeit seines Lebens ein auf vielen wissenschaftlichen Gebieten forschender Pionier – er war Pilot bei Roald Amundsens Nordpol-Expeditionen gewesen, bevor er in den USA am Carnegie Institute arbeitete – unterstrich eine wichtige Funktion des geplanten Laboratoriums, das neben den großen Forschungsvorhaben noch andere wichtige akademische Aufgaben erfüllen werde. Diese Funktion innerhalb der akademischen Welt Europas erfüllt CERN noch heute:
»Ein modernes physikalisches Labor ist von seiner Auslegung her ein Universallabor, auch wenn das letztendliche Ziel sehr spezialisiertes Wissen ist. Das vorgeschlagene Labor wird deshalb als Trainingscenter koordinierter Forschung dienen [… ] und damit eine Art Forschungsarbeiter ausbilden, der für die industrielle Forschung in seinem Heimatland eingesetzt werden kann.«
Die ambivalente britische Rolle
In Großbritannien favorisierte man den Ausbau eigener, kleinerer Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Institut von Niels Bohr in Kopenhagen. Viele britische Wissenschaftler standen in engem Kontakt mit dem Kopenhagener Institut und die Pläne zu einer britischdänischen Zusammenarbeit nahmen immer konkretere Formen an. Der Plan der Gruppe um Auger (UNESCO) und das CEC traf deshalb hier auf skeptische Reaktionen. Die Idee eines gemeinsamen europäischen Labors fußte nach Meinung der offen um ihren Forschungsvorsprung besorgten britischen Fachleute nicht auf wirklicher Erfahrung und Expertise der Beteiligten, sondern man wolle diesen fachlichen Mangel mit »Mut zum Wagnis und Enthusiasmus« (Herbert W. B. Skinner) ersetzen.
Einer der Hauptfiguren auf britischer Seite war Sir James Chadwick (1891–1974). Chadwick hatte 1935 den Nobelpreis für Physik für seine Entdeckung des Neutrons erhalten. Diese Entdeckung war Grundlage der erfolgreichen Atomkernspaltung durch den deutschen Physiker Otto Hahn. Chadwick war während des Kriegs Mitarbeiter des Manhattan-Projektes gewesen. Er sah das Projekt der Gruppe um Auger auch durch die geplante Beteiligung Deutschlands äußerst skeptisch. Die britischen Forschungsanlagen für Nuklearphysik waren seiner einflussreichen Meinung nach »sowohl in ihrer Zahl wie auch ihrer Leistung nach durchaus angemessen, um unseren eigenen Forschern die gesamte Bandbreite an Forschungsmöglichkeiten innerhalb der Nuklearphysik zu gewährleisten.« In einem Brief an seinen Kollegen Dr. King, datiert auf den 23. April 1951, umreißt Chadwick klar die ambivalente britische Position bezüglich des europäischen Projekts:
[Es herrscht] »… Klarheit darüber, dass sich dieses Land nicht direkt an der Errichtung eines solchen Labors beteiligen und auch keine Unterstützung weder in personeller noch in finanzieller Hinsicht leisten sollte. Doch es herrscht auch das Bedürfnis, sich nicht vollständig von diesem Plan zurückzuziehen. Wir sollten informelle Hilfe leisten durch Rat und Tat, wenn das angefordert werden sollte – speziell hinsichtlich vorläufiger Studien zur technischen Auslegung des Labors und zum Design der Maschinen.«
Chadwicks Bild der Situation macht das Verhalten der britischen Nuklearphysiker hinsichtlich der aufkeimenden europäischen Konkurrenz verständlich und bezieht durch die geplante Zusammenarbeit mit dem Niels-Bohr-Institut die ambivalente Rolle der dänischen Seite mit ein. Auf der Achse London-Kopenhagen wollte man durchaus einen eigenen Weg gehen, jedoch gleichzeitig die europäische Entwicklung nicht verschlafen – und die Kollegen nicht im Stich lassen. Dieser internationale Kodex der Wissenschaften hatte sich nach dem 1. Weltkrieg weltweit etabliert und manifestierte sich nach wie vor über alle Grenzen hinweg in umfassendem fachlichem Austausch, informellen Vereinbarungen und allgemeiner technischer Unterstützung.
Aber warum waren die Briten bis jetzt nicht wirklich bereit gewesen, über die fachliche, informelle Zusammenarbeit hinaus das europäische Projekt zu unterstützen? James Chadwick führt in seinem Brief an King weiter aus, dass es eben nicht im wissenschaftlichen Interesse Englands liegen könne, am Projekt Augers et al. teilzunehmen. In Harwell, der britischen Atomforschungseinrichtung in Oxfordshire, arbeitete man bereits mit einem 170 MeV (Megaelektronenvolt) Synchro-Cyclotron, einem Elektron-Synchrotron und einem Linearbeschleuniger. An anderen Universitäten des Landes, in Glasgow, Liverpool und Birmingham waren ähnliche Anlagen im Entstehen begriffen. Zu Recht sah man in England, dass die große Unterstützung Frankreichs für das gemeinsame europäische Projekt eher darauf zurückzuführen war, dass bis jetzt weder technologisches Knowhow noch in der Praxis funktionierende Anlagen zur angestrebten Atomkernforschung vorhanden waren.
Gründe für die britische Ablehnung der Idee eines gemeinsamen europäischen Labors für Teilchenphysik:
Die englische Nuklearphysik war der auf dem Kontinent existierenden weit überlegen, und man wollte auf diesem wichtigen Forschungsgebiet führend bleiben: »Wenn die Franzosen ein Forschungslabor für Nuklearphysik haben wollen, warum machen sie dann nicht mit irgendeiner daran interessierten Nation weiter?« (Skinner)
Innenpolitische Überlegungen: In England zog man es nach dem 2. Weltkrieg weitgehend vor, mit existierenden, einheimischen Instituten zusammenzuarbeiten und nicht mit neuen, internationalen Institutionen. Der Faktor Tradition und Scheu vor fremden, nichtbritischen Kräften scheint hier Hauptmotivation gewesen zu sein.
Die Labour Party hatte die Wahlen 1945 überraschenderweise gegen Winston Churchill gewonnen. Labour war europäischen Ideen und europäischer Politik gegenüber sehr skeptisch. Darüber hinaus wollte man das während des Kriegs entstandene spezielle Verhältnis zu den USA aufrechterhalten, gerade was die nationalen Forschungen im Nuklearbereich betraf.
Die Idee nimmt Gestalt an
Die nächste Generalkonferenz der UNESCO fand im Juli 1951 in Paris statt. Während der gesamten Konferenz favorisierte man deutlich den Auger-Plan vor dem Vorschlag aus Großbritannien und Dänemark. Die mit den UNESCO-Geldern finanzierte Studiengruppe (Cornelis Bakker, Odd Dahl, Frank Goward u. a.) hatte zwischenzeitlich – und mit englischer Hilfe (!) – die bestehenden Pläne überarbeitet. Man hatte sich in Anbetracht der hohen Kosten darauf geeinigt, nicht sofort den größten Teilchenbeschleuniger der Welt bauen zu wollen. Nach den Plänen der Studiengruppe sollten jetzt zwei kleinere Maschinen gebaut werden, als mögliche Standorte wurden Kopenhagen und Genf genannt. Darüber hinaus schlug man die Gründung einer Interimsorganisation vor, die die erforderlichen Konstruktionsund Budgetpläne für das Laboratorium ausarbeiten sollte, um das Projekt der UNESCO in angemessener Zeit wieder vorlegen zu können.
Niels Bohr (1885–1962, Nobelpreis für Physik 1922) war bisher nicht an Treffen des UNESCO-Kreises unter Auger beteiligt gewesen. Am 9. Juni 1950, kurz nach der Konferenz von Florenz, hatte Bohr jedoch in einem offenen Brief an die UN Stellung bezogen und seine Skepsis und Hoffnung zum Ausdruck gebracht, »in vollkommen eigener Verantwortlichkeit und ohne Hinzuziehen irgendeiner Regierung«:
»Ich finde es schwierig die großen Hoffnungen nachzuvollziehen, dass der Fortschritt der Wissenschaften eine neue Ära harmonischer Kooperation zwischen den Nationen hervorbringen wird. [… ]Das Ideal einer offenen Welt mit gemeinsamem Wissen über die sozialen Bedingungen und technischen Unternehmungen, auch militärischer Art, in jedem Land scheint nur eine weit entfernte Chance in der momentanen Situation der Welt zu sein. [… ]Dennoch wird eine solche Beziehung zwischen den Nationen offensichtlich nötig sein, um den Fortschritt unserer Zivilisation in gemeinsamer Zusammenarbeit zu erreichen; sogar eine gemeinsame Erklärung zur Verpflichtung auf einen solchen Kurs würde einen sehr günstigen Hintergrund schaffen.«
Im Spätsommer 1951 reiste Pierre Auger zu Niels Bohr nach Kopenhagen, um den Doyen der europäischen Nuklearphysik »mit ins Boot« zu holen. Bohr äußerte prinzipiell Bedenken gegen die europäische Initiative: Einerseits sah er die finanziellen Dimensionen eines großen Beschleunigerprogramms und bezweifelte dessen Finanzierbarkeit. Andererseits könne ein gemeinsames internationales Labor ganz natürlich aus einer bestehenden Institution heraus wachsen – Bohr meinte damit das von ihm geleitete, seit 1920 bestehende Institut für Theoretische Physik in Kopenhagen. Während des Kriegs war ein Erweiterungsbau entstanden, der sich als Sitz des zukünftigen europäischen Forschungszentrums anbieten würde.
Augers Interimsgruppe kam in der Standortfrage zu einem weiteren Modell der zukünftigen europäischen Zusammenarbeit. Auf einem Treffen im November 1951 in Paris kursierte der Vorschlag, die einzelnen Forschungsgruppen an ihren jeweiligen Heimatinstituten und Universitäten weiterarbeiten zu lassen: Bakker in den Niederlanden, Kowarski in Frankreich, Dahl in Norwegen, Bohr in Kopenhagen und Amaldi in Rom. Wie unpraktisch dieser Vorschlag in seiner Umsetzung in die Praxis geworden wäre, kann man sich heute vielleicht am besten angesichts des tatsächlich existierenden CERN vorstellen: Das CERN würde es nicht geben.
Trotz aller bisherigen Bedenken schien nun gerade von britischer Seite Bewegung in die Diskussion zu kommen. Nach dem Treffen Augers mit Bohr versuchte James Chadwick die Ideen Bohrs – ein von Großbritannien und dem Niels-Bohr-Institut gemeinsam betriebenes Labor mit Sitz in Kopenhagen – bei seinen Kollegen in England populär zu machen. Die Reaktionen waren jedoch verhalten, wollte man doch die einheimischen Anlagen (Harwell, Glasgow etc.) weiter betreiben und eher noch ausbauen als eine neue ausländische Großanlage aufzubauen. Sir George Thomson (1892–1975; Nobelpreis für Physik 1937) zeigte hingegen Interesse an der Auger/UNESCO-Gruppe. Thomson, Professor am Imperial College London wurde daraufhin eingeladen, an der nächsten Sitzung der Interimsgruppe als Beobachter teilzunehmen.
Die UNESCO-Konferenz im Dezember 1951
Die vom 17. bis 21. Dezember 1951 in Paris stattfindende 6. UNESCO-Generalkonferenz ist vielleicht die inhaltlich wichtigste in der ereignisreichen Vorgeschichte des CERN. Sie wurde von Vertretern aus 21 Staaten besucht, brachte zwar keine endgültigen Entscheidungen, aber man erzielte große Übereinstimmungen für den Bau eines neuen, paneuropäischen Labors für Teilchenphysik, und das Projekt erhielt konkrete Finanzierungszusagen.
Der Vertreter Italiens, Bruno Ferretti (1913–2010), ein ehemaliger Mitarbeiter des 1938 in die USA ausgewanderten Enrico Fermi und ein enger Freund Edoardo Amaldis, brachte während der Konferenz einen konkreten Plan für »ein europäisches Labor für Nuklearphysik auf der Basis eines großen Beschleunigers für Elementarteilchen« ein, der heftig und kontrovers diskutiert wurde. Sir George Thomson, der taktisch wenig überraschend rein britische Interessen vertrat, wies in seinem Redebeitrag darauf hin, dass Großbritannien seit Kriegsende, in »mageren Zeiten«, bereits große Summen in die geplante Art von Forschung und in den Bau großer Maschinen investiert habe. Thomson schlug deshalb vor, anstatt eines teuren Neubaus für die europäische Forschung die im Bau befindliche Synchrotron-Anlage in Liverpool (England) für weitere, gemeinsame Forschungen zu nutzen. Der französische Delegierte, Francis Perrin, widersprach; der Neubau eines gemeinsamen Labors sollte in Angesicht der europäischen Lage nicht verzögert werden, sonst würden junge Forscher reihenweise in die USA abwandern.
Der deutsche Vertreter auf der Pariser Konferenz war Werner Heisenberg (1901–1976, Nobelpreis für Physik 1932). Er war wegen seiner Rolle im zweiten Weltkrieg nicht unumstritten. Als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik hatte er an führender Stelle am Uranprojekt der Nationalsozialisten mitgearbeitet. Auch Heisenbergs persönliches Verhältnis zu Niels Bohr war nicht unbelastet. Heisenbergs ominöser Besuch in Kopenhagen während des Kriegs im September 1941 hatte bei beiden Wissenschaftlern unterschiedliche Erinnerungen hinterlassen. Es existieren keine Aufzeichnungen über dieses historische Treffen, bei dem Heisenberg Bohr die Mitarbeit am deutschen Projekt angeboten haben soll. Bohr verließ wenig später, 1943, das von Deutschland besetzte Dänemark Richtung England und USA, um als Berater am amerikanischen Atombombenprogramm tätig zu werden. Erst viel später (1958) äußerte sich Bohr über das Treffen mit Heisenberg – zu dessen Vorschlägen er damals geschwiegen habe, denn »es ging um ein großes Thema der Menschheit, in dem wir, obwohl persönlich befreundet, Vertreter zweier Seiten waren, die im mörderischen Kampf miteinander lagen.«
Heisenberg, ein früherer Assistent Bohrs, war in Nachkriegsdeutschland Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in Göttingen geworden. Auf der Konferenz 1951 in Paris war Heisenberg offizieller Vertreter der noch jungen Bundesrepublik Deutschland – und einem gemeinsamen, aufwändigen europäischen Kernphysiklabor durchaus skeptisch gegenüber eingestellt. Heisenberg wies auf die finanzielle Lage Deutschlands und die ihn bis jetzt wenig überzeugende Planungslage hin:
»Unser Land ist in einer extrem schlechten finanziellen Situation. Ich bin von meiner Regierung nicht damit beauftragt worden, irgendeine Art von finanzieller Zusage zu machen. Darüber hinaus sollte man nicht hingehen und einfach eine der großen amerikanischen Maschinen kopieren.«
Im Lauf der Pariser UNESCO-Konferenz wurde trotz aller Gegensätze und Widersprüche klar, dass die Mehrheit der Beteiligten für die Gründung eines gemeinsamen europäischen Labors war. Im Schlussdokument vereinbarten die 12 offiziell teilnehmenden Nationen, den von der niederländischen Delegation eingebrachten Vorschlag zur Bildung einer Interimsorganisation zur Errichtung eines zukünftigen europäischen Labors anzunehmen. Mit diesem formellen Akt hatte das große europäische Projekt für Nuklearphysik einen gewaltigen, offiziellen Sprung nach vorn getan; ein eingängiger Name für das neue Labor fehlte allerdings noch. Die Initiative firmierte momentan unter der – sicherlich zu langen und umständlich präzisen – Bezeichnung Council of Representatives of European States for Planning an International Laboratory and Organizing other Forms of Co-operation in Nuclear Research (Rat der Repräsentanten europäischer Staaten zur Planung eines internationalen Labors und anderer Formen der Kooperation in der Nuklearforschung).
Mit dem Schlussdokument der Pariser Konferenz 1951 wurde aus einer freien wissenschaftlichen Initiative ein ernsthaft diskutiertes Realisierungskonzept, das Unterstützung von der UNESCO und auch auf den nationalen Ebenen hatte. Am Ende der Konferenz waren Frankreich, die Schweiz, Italien, Belgien und Jugoslawien bereit, dem Projekt 150 000 Dollar zur weiteren Vorbereitung und Planung zur Verfügung zu stellen. Das Potenzial zur Realisierung des ambitionierten europäischen Konzepts wuchs damit ungemein – und selbst die internationale Presse hatte angebissen. Die New York Herald Tribune schrieb am 21.12.1951 unter der Überschrift »Europe Laboratory May Get Five-Billion-Volt Cyclotron«, dass man nun ein europäisches Atomforschungslabor mit einem 5-GeV-Cyclotron zu bauen gedachte, das in seiner Leistung dem Bevatron in Berkeley (USA) entsprach. Der besonders für die US-amerikanische Leserschaft der Zeitung wichtige Teil der Meldung war: Man wolle mit der neuen Maschine zur Erforschung des Atomkerninneren auf keinen Fall militärischen Nutzen erlangen.
UNESCO-Konferenz Dezember 1951 in Paris
Konkretes Konzept (Ferretti) für einen »großen Beschleuniger für Elementarteilchen«.12 Teilnehmerstaaten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Bundesrepublik Deutschland, Jugoslawien.Die von der UNESCO beauftragte Interimsorganisation erhält finanzielle Zusagen. Vereinbart wird eine Vorbereitungszeit von 12 bis 18 Monaten, um die Pläne für die Beschleunigeranlagen auszuarbeiten und fertigzustellen.Geburtsstunde des CERN
Zwei Monate später, auf einer weiteren UNESCO-Tagung vom 12. bis 15. Februar 1952 in Genf, bekam die ehemalige Interimsorganisation ihre original französische Bezeichnung Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire (Europäischer Rat für Nuklearforschung), abgekürzt CERN. Mit diesem politischen Akt erhielt das europäische Großprojekt endlich eine offizielle Form und einen offiziellen Namen – das Akronym CERN war geboren.
Der 15.2.1952 ist das offizielle »Geburtsdatum« des CERN.
Erstes Treffen des CERN-Rats im Februar 1952 in Genf: Sir Ben Lockspeiser, Edoardo Amaldi, Felix Bloch, Lew Kowarski, Cornelis Jan Bakker, Niels Bohr (© 1952 CERN, CERN-HI-5201001).