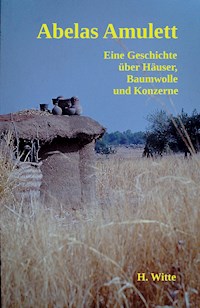
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigene Erfahrungen bilden die Grundlage für eine Geschichte, die so in den 1970-80-gern in der Sahelzone hätte stattfinden können. Die großen und kleinen Probleme mit denen sich die Helfer herumschlagen mussten sind auch heute noch nicht gelöst. Entwicklungspolitik einmal außerhalb von Zahlen und Fakten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1251
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort4
Ein paar Worte zu Text und Bildern6
Zurück in Deutschland7
Ferieneinsatz in Yaoundé12
Gastland Tunesien22
Die ersten Wochen22
Entscheidung für den Tschad27
Ein Flug mit Hindernissen33
Ankunft in Schwarzafrika39
Wiedersehen in Garoua41
Die erste Zeit50
Einreise in den Tschad50
Die Landwirtschaftsschule58
Die ersten Baustellen64
Besuch der Chefs74
Eine Wand bricht ein77
Besuch in Kali87
Gespräch mit dem Vorarbeiter101
Die Baustelle Torrok103
Geburt auf der Piste108
Nach Fort Lamy über Waza113
Die Beratungsprojekte beginnen121
Die ersten Kollegen121
Wochenende in Waza125
Die neuen für Torrok129
Leo M’bassa, ein neues Projekt132
Besuch aus Yaoundé134
Maritas Besuch in Fort Lamy142
Erster Baumwollmarkt152
Ankunft der Kollegen für Torrok155
Douala hin und zurück161
Ein Gespräch im Zug164
Zurück nach Fort Lamy166
Anmeldung des Rovers172
Abela, das einheimische Mädchen187
Beginn in Manomajibe191
Kein Saatgut für Pont Carol193
Urlaub in Deutschland197
Hähnchentransport202
Kein Zement für die Baustellen203
Gepanschte Medikamente206
Das Reisprojekt213
Zement, ein Transport217
Gebrannte Ziegel, ein Experiment221
Abelas Zuhause228
Begegnung im Wald231
Richtig krank241
Eine Krankenschwester für Karoual245
Abela in Pont Carol247
Buschfeuer250
Ein Diebstahl255
Kollegen für Manomajibe256
Manomajibe wird fertig257
Den Diebstahl aufklären?263
Eine Besprechung in Fort Lamy273
Der Arm muss ab288
Utes Geburtstag294
Vertrocknete Bäume301
Ein Nachfolger ist gefunden311
Der Pferdekauf312
Der Nachfolger328
Aufklärung des Diebstahls?334
Der Neue für den Bau342
Der Neue gibt auf345
Die Botschaftssekretärin354
Den Dienst verlängern?358
Die Entscheidung366
Abschied von Ilse374
Projektprüfung im Norden381
Die Reise des Botschafters387
Eine neue Aufgabe395
Die verlorenen Filme396
Folgen eines Erfahrungsberichts397
Zweiter Urlaub in Deutschland405
Wieder zurück414
Im Lkw zurück415
Besuch in der Reismühle417
Nähmaschinen und mehr423
Abholen der Nähmaschinen425
Der Camion neben der Straße454
Ein Unfall?457
Abela, das erste Mal in Fort Lamy485
Eine kleine Lektion für Abela499
Abelas Pass502
Neues vom Lkw505
Fußballturnier505
Uwes Hochzeit511
Ein Wächter wird gesucht514
Die Zeit vergeht517
Ein Entschluss524
Die Journalisten528
Treffen im Wazapark528
Der Baumwollmarkt541
Eine Warnung553
Die Journalisten in Fort Lamy555
Weihnachtsurlaub in Deutschland562
Eine Ankündigung590
Die Reaktion auf den Bericht vom Baumwoll592
Aus für eine Rückkehr607
Nachgang615
Wer andere besucht, soll seine Augen öffnen und nicht den Mund.
Vorwort
Schon kurz nach meinem Aufenthalt in Afrika hatte ich überlegt, meine Erlebnisse in einem Buch festzuhalten. Bis zu einer handschriftlichen Kladde bin ich damals auch gekommen. Doch wen interessierten die kleinen Erlebnisse, die ich da aufgeschrieben hatte? Die Kladde blieb jahrelang in einem Schrank liegen. Die Zeit in Afrika hatte sich aber in meinem Kopf festgesetzt. Als ich die Fotos mal wieder hervor kramte, fiel mir diese Geschichte dazu ein. Auch sie hat einige Zeit im Regal gelegen. Da sich aber in den Jahren nichts wesentliches, und ich meine nicht die Technik, geändert hat, kann eine Geschichte einige Dinge vielleicht anschaulicher machen.
Der nachfolgende Text verarbeitet eigene Erfahrungen, ist aber frei erfunden. Sollten sich dennoch Personen darin wiederfinden, dann ist es keinesfalls meine Absicht gewesen, sie ungefragt in den Text einzubeziehen. Einige Orte sind real, damit man sich geografisch zurechtfindet. Ortsnamen für größere Orte entsprechen den damals aktuellen Namen und kleinere sind teilweise erfunden. Die offiziellen Bezeichnungen wie AA, GAWI, DED usw. sind zwar real, die handelnden Personen hat es jedoch so nie gegeben. Die Firmennamen sind ebenfalls nicht real. Falls ich Irgendjemandem mit diesem Text zu Nahe getreten sein sollte, bitte ich um Verzeihung.
Einige Dinge sind so oder ähnlich tatsächlich geschehen. Die Entführung im Tibestigebirge gab es und nach der Erfüllung der Forderungen durch die damalige Bundesregierung wurden alle Westdeutschen aus dem Tschad ausgewiesen.
Die Verknüpfung der Wirtschaft ist heute, im Zeichen knapper werdender Ressourcen, eher noch größer geworden, die Methoden der Gewinnmaximierung sind vielleicht subtiler, aber deswegen nicht weniger hart. Konzerne bestimmen auch heute noch weitgehend die Geschicke eines Landes, wie den Tschad, mit. Davon bin ich fest überzeugt, besonders seit man dort Öl fördert. Ich hatte gehofft, dass wir in Europa vor Ähnlichem wie beim Baumwollanbau verschont bleiben, doch heute forschen Konzerne an Saatgut, dass nur nach einer Spezialhandlung keimt oder fruchtet.
Der Tschad ist auch heute noch eines der ärmsten Länder der Welt. Das heute ausgebeutete Ölvorkommen, von dem im Text nur durch die Anwesenheit von Geologen die Rede sein wird, hat daran nichts geändert. Im Gegenteil, die Situation der Menschen in diesem Fördergebiet hat sich durch negative Einflüsse auf Umwelt und Sozialsysteme stark verschlechtert. Viele soziale Beziehungen besonders im Fördergebiet sind zerbrochen oder mindestens gestört. Der Klimawandel sorgt zudem für weitere Probleme, man vergleiche nur die Ausdehnung des Tschadsees bei Google Earth von vor fünfzig Jahren mit heute.
Den Helfern, die heute im Tschad arbeiteten, wird eine Menge mehr zugemutet als mir damals. Ihnen gebührt besondere Hochachtung für ihren Einsatz.
In den siebziger Jahren, in denen die Geschichte spielt, galten junge Männer, die den Entwicklungsdienst statt Bundeswehr wählten, zuhause oft als Drückeberger, die ein angenehmes Leben führen wollten. Sie waren aber, wie ihre Altersgenossen bei der Bundeswehr, Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland. Ob es wirklich ein angenehmeres, leichteres Leben war, möge der Leser selbst entscheiden. Ich jedenfalls möchte die Zeit in Afrika trotz aller Beschwernisse auf keinen Fall missen.
So nun habe ich eigentlich alles wichtige vorweg gesagt und wünsche viel Spaß beim lesen.
Ach so, fasst hätte ich es vergessen, diesen Text widme ich meiner Frau, die mich damals wieder in die deutsche Gesellschaft integrierte und auch heute noch gelegentlich unter meinen Eigenheiten leiden muss. Erinnerungen an die afrikanische Zeit stehen heute noch als ‘Staubfänger’ im Wohnzimmer. Vergessen kann ich den afrikanischen Kontinent nicht. Er hätte ein besseres Verhältnis zu Europa verdient.
Hubert Witte
Es war auch für mich nicht immer einfach mit den Gegensätzen zurecht zukommen. Wie schwer muss es erst für diese beiden gewesen sein.
Ein paar Worte zu Text und Bildern
In dem Text sind einige Fotos eingefügt. Es sind über 40 Jahre alte Dias oder Schwarzweissfotos und daher nicht immer von bester Qualitätd. Es wurde alles mit analogem Material aufgenommen, das es gerade gab. Einge Filme verschwanden, wie auch immer, auf dem Weg zwischen Busch und den Entwicklungsfirmen in Europa.
Die Fotos sind autentisch, und ich habe versucht, sie an passender Stelle in die Geschichte einzubinden.
Zurück in Deutschland
Den Tschad, drei Mal so groß wie Deutschland, das Land aus dem ich vor einigen Monaten zurückgekehrt war, kannte hier in meiner Heimat kaum jemand. Afrika war für viele ein unbekannter, exotischer und von Befreiungskriegen geschwächter Kontinent. In Südafrika herrschte das Apartheidsregime und nicht erst seit ich wieder zurück war, gehörte Miriam Makeba’s Klicksong und das Lied Patapata zu meinen Favoriten. Ein Sprachforscher hatte mir im Tschad die Originalversion von The Leon sleep to night aus dem Jahr 1939 auf mein Tonband gespielt, die Sprache: Zulu. Das dieses Lied so alt war und aus Südafrika stammte, wusste hier niemand.
Die Grenzen des Landes waren von den Kolonialmächten gesteckt, nicht an vorhandenen kulturellen Strukturen ausgerichtet und Ursache für viele kleine und große Konflikte. Die verschiedenen Regionen dieses Landes, von der Zentralsahara im Norden bis kurz vor den tropischen Regenwald, hatte ich natürlich nicht alle kennengelernt, aber das was ich kennenlernen durfte, war beeindruckend. Die Menschen waren trotz ihrer Armut freundlich und fröhlich. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen, aber fast nur mit Firmen.
Dass in der Sahelzone Reis angebaut wird und der Rohstoff für unsere Baumwollhemden möglicher Weise aus dem Tchad stammt, wen interessierte das hier.
Ich steckte noch ganz in den Erinnerungen fest. Fast fünf Jahre hatte ich als Entwicklungshelfer im Tschad gearbeitet, dort meine Frau Abela, eine Tschadderin, kennengelernt und sterben sehen. Nach ihrem gewaltsamen Tod wollte ich etwas Abstand gewinnen von dem, was sich in den letzten Wochen ereignet hatte. Nach den Vorstellungen ihrer Vorfahren, lebte sie jetzt in der Welt der Ahnen, und ich konnte mir ihrer Hilfe in der hiesigen Welt sicher sein. Sie war Christin, die Verbindung zu den Ahnen hatte sie aber nie aufgegeben.
Abela hätte bestimmt gewollt, dass ich meine Arbeit fortsetze und ich hatte mich auch darauf eingestellt, doch zurück konnte ich nicht mehr. Die Regierung der BRD hatte den Neffen, des Bundespräsidenten, der zu den drei Geiseln der Frolinat gehörte, mit 2,2 Millionen DM und mit einem an drei Tagen über die Deutschen Welle ausgestrahlten Manifest der Geiselnehmer, freigekauft. Aus humanitären Gründen, wie man erklärte. Die Ausweisung aller Deutschen aus dem Tschad und der Abbruch der diplomatischen Beziehungen war aus Sicht des Tschad unumgänglich. Die französische Regierung blieb hart und ließ sich auf keinen Handel ein. 1 Dort lagen die Interessen anders. Man brauchte den Tschad als Militärbasis und die dort vermuteten Rohstoffe, Uran und Erdöl. Die beiden französischen Geißeln blieben über Monate als Gefangene im Norden.
Ich fragte mich immer wieder, ob meine Regierung für ‘normale’ Helfer, wie meine Kollegen und mich, auch so gehandelt hätte. Meine Meinung: wohl eher nicht.
Madame Leconte, die Betreuerin meines Projektes bei der UNORD 2 in Paris, hatte für mich einen Einsatz in einem anderen Land ermöglicht, denn mein Vertrag lief ja noch. Ich hatte abgelehnt. Entweder machte ich dort weiter, wo ich aufgehört hatte, und es gab noch reichlich zu tun, oder ich kümmerte mich um meine weitere Berufsausbildung. Mein Berufsziel, Bauingenieur, war durch die eingetretene Änderung der Zugangsvoraussetzungen für Fachhochschulen nur noch über den Umweg der Techniker Ausbildung oder mit dem Abschluss der Fachoberschule zu erreichen. Erst 26 Jahre alt, fühlte ich mich an der Fachoberschule als alter Mann, und so blieb ich in meinem Heimatort und begann die zweijährige Ausbildung zum Bautechniker. Bei den Leuten mit Berufserfahrung fühlte ich mich wohler. Ich hatte eine Lehre als Bauzeichner und Maurer abgeschlossen als ich zum DED kam. Meine Zeit in Afrika hatte man zum Glück als Praxiszeit nach der Ausbildung anerkannt, obwohl die Baumethoden sich doch sehr unterschieden.
♦
Dass ich mich nach Ablauf meiner regulären Dienstzeit beim DED entschlossen hatte, weiter im Tschad zu bleiben, stand immer noch als stiller Vorwurf meiner Eltern und meiner Freundin Elke im Raum. Sie hatte inzwischen ihren Lehrer geheiratet und von meiner Kollegin Ilse aus Kali in Kamerun hatte ich seit über einem Jahr keine Adresse.
Es fiel mir schwer, mich in Deutschland wieder zurecht zu finden. Die Zeit bis zum Beginn des ersten Semesters war schwierig. Meinem Hobby, die Ornithologie, half mir, mich abzulenken. Was ich erlebt hatte, stieß daheim auf wenig Interesse. Dabei hatte ich so vieles, über dass es sich meiner Meinung lohnte, nach nachzudenken. Manchen Abend saß ich allein in meiner kleinen Wohnung, Kopf und Wohnung voll gestopft mit Erinnerungen. Von Abela waren mir nur Fotos und das Amulett geblieben, das sie mir bei unserem ersten Zusammentreffen geschenkt hatte. Ich hatte ihr damals versprechen müssen, es immer bei mir zu tragen.
♦
Dieses Amulett, ein kleines, mit schwarzem Leder ummanteltes Kästchen unbestimmten Inhalts, lag auf meinem Schreibtisch. Auf dem Plattenspieler drehte sich mal wieder die LP von Miriam Makeba, und ich fragte mich, ob Abela meine Entscheidung, nicht in ein anderes Land zu gehen, richtig gefunden hätte. Auf dem Tisch lagen die Fotos für einen Vortrag über meine Arbeit, den ich am nächsten Abend vor einer kleinen kirchlichen Gruppe halten sollte. Ich ärgerte mich mal wieder über den Mann, der meine Rückkehr in die Heimat meiner Frau verhindert hatte und darüber, dass der Mord an meiner Frau, einfach als Stammesfehde abgetan wurde. Ich sah da ganz andere Gründe. Bisher wussten nur einige meiner Freunde, meine Eltern und Verwandten, dass ich einmal mit einer Tschadderin verheiratet war. Bei den wenigen Vorträgen hatte ich diese persönlichen Dinge ausgespart. Dazu wollte ich keine Fragen beantworten. Für die meisten Zuhörer waren die bunten Bilder wichtig. Was sich dahinter verbarg, erfassten die meisten Zuhörer nicht. Davon war ich überzeugt. Aber ich wollte nicht nur Anekdoten und Geschichten aus diesem Land berichten, denn damit allein könnte man Bücher füllen. Vom Missionar, der mit seinem 203 unter eine Elefanten fuhr, vom Kollegen, der zwei Stunden auf der Polizeiwache verbrachte, weil er einen Leichenzug überholt hatte, vom Gefangenen, dessen Französisch gerade für „Bon jour“ reichte, der uns aber die Tore zur Sous-préfecture bereitwillig öffnete und uns aufforderte, das zu suchen, weswegen wir gekommen waren, von verschwundenen Geldern und Bocksprüngen des afrikanischen Amtsschimmels. Es konnten auch keine Erfolgsberichte sein, denn im eigentlichen Sinne hatte ich ja kein Projekt. Ich sollte nur Häuser für meine Kollegen bauen. Natürlich, Erfolge gibt es immer, es ist nur eine Frage des Maßstabs. Eine Landwirtschaftsschule bildete pro Jahr etwa 40 Bauern aus. Ist das ein Erfolg? - Ja, könnte man meinen. Aber wenn nach drei Jahren nur noch vier junge Männer nach dem gelernten arbeiteten auch noch? Die Frage nach den Gründen stellte sich. Und die Antwort? Sie war nicht in den Bildern.
Die Probleme die mir begegneten waren vielschichtig verknüpft. Es gibt viele Vorschläge die sich gut anhören, aber oft an Verhältnissen scheitern, die nicht nur in Afrika liegen. Unsere Lebensweise und Lebenseinstellung den Menschen dort nahe zubringen und ihnen wie ein Mantel von der Stange überzustülpen, kann das richtig sein?
♦
In diesem Vortrag wollte ich zum Abschluss das erste Mal die Entführung ansprechen und dass durch den Rausschmiss der Deutschen die Projekte nicht weitergeführt werden konnten. Ich hoffte, so meinen Ärger über meine Regierung los zu werden.
Die Zuhörer reagierten anders als ich es erhofft hatte. Sie brachten kaum Verständnis für das Verhalten der tschaddischen Seite auf, die die Hilfe aus Deutschland einfach abgewürgt hatte. War es nicht die Pflicht unserer Regierung alles für die Freilassung der Geisel zu tun? Dass sich der Mann selber in eine gefährliche Situation gebracht hatte, konnte kaum jemand nachvollziehen. Er hatte mit den zwei Franzosen und zwei hohen Regierungsbeamten eine Feier besucht. In einem Gebiet in dem Rebellen aktiv sind, eine riskante Sache. Doch so wurde es in Deutschland nicht dargestellt.
Nach dem Vortrag, sprach mich eine Frau, um die vierzig, an. Sie hatte geduldig gewartet, bis alle Fragen zu den Pisten und den Schwierigkeiten mit der Bauweise beantwortet waren und ich meine Utensilien zusammenpackte. Sie fragte, ob ich nicht Lust hätte, wieder nach Afrika zugehen. Ich unterbrach das Aufwickeln der Verlängerungskabel und sah sie erstaunt an. In der Stimme dieser Frau lag etwas ernsthaftes. Etwas verlegen antwortete ich: „Ja, vielleicht, wenn sich was ergibt.“
„Ich kann sie verstehen. Ich weiß wie es ist, wenn man ein Projekt aufgeben muss. Was machen sie eigentlich jetzt beruflich?“ wollte sie wissen.
„Ich mache eine Ausbildung zum Bautechniker hier in Osnabrück.“ legte ein Kabel in den Koffer und fragte: „Sie waren auch als Entwicklungshelferin tätig?“
„Nein, nicht so wie sie. Ich arbeite hier bei ‘Kinder der Welt’ und komme nur selten raus. Glauben sie mir, ein Projekt aufzugeben, fällt auch uns hier schwer. Wir wissen, wie viel Energie die Leute vor Ort da reingesteckt haben. - Wo kommt die Leinwand hin?“
„Die kann stehen bleiben.“
„Ich würde sie gern noch auf ein Bier einladen. Wie wär’s, dann könnten wir uns noch gemütlich unterhalten.“
Der Verantwortliche des Abends, ein älterer Herr, hatte seine Gäste vor der Tür verabschiedet und war wieder in die kleine Aula der Grundschule gekommen. „Na Marion, habe ich dir zu viel versprochen?“
„Nein. Es war sehr interessant was Herr Winter über seine Arbeit erzählt hat. Ich weiß nur nicht, ob die Leute morgen auch noch daran denken. Ich habe Herrn Winter noch zu einem Bier eingeladen, kommst du noch mit?“
„Ja, hat Herr Winter denn schon zugesagt, oder will er jetzt lieber nach Hause?“
„Sie haben meine Neugier geweckt, ich komme mit.“ sagte ich.
An diesem Abend bot Marion mir an, in den Sommerferien für vier Wochen beim Aufbau eines Waisenheims in der Hauptstadt Kameruns zu helfen. Dort würde dringend jemand gebraucht, der sich mit Bauen auskennt. Ich musste zugeben, es reizte mich schon. An diesem Abend erhielt Marion nur die Zusage zu einem weiteren Treffen.
Die Aussicht wieder nach Afrika zu kommen, war verlockend. Ich stimmte schließlich zu. Das Projekt in dem ich helfen sollte, die Gebäude fertig zu stellen, nahm Straßenkinder auf. Kinder, die von ihren Eltern an große Plantagen verkauft worden waren, weil sie sonst keine Möglichkeit sahen, die Kinder durchzubringen. Einige der Kinder hatten sich dann in die große Stadt davon gestohlen, und hofften dort auf ein besseres Leben. Bevor sie in dem Heim aufgenommen wurden, bestritten sie ihren Lebensunterhalt mit dem Durchsuchen von Abfällen und Diebstählen.
Es war bestimmt im Sinn von Abela, denn Kinder waren für sie das Größte. Nur in meinem Umfeld stieß ich mit meiner Entscheidung wieder auf wenig Verständnis. War man doch gerade dabei, mich von einem Broussard, jemandem der im Busch lebt wieder zu einem ordentlichen jungen Mann zu machen.
Ferieneinsatz in Yaoundé
Yaoundé kannte ich von einigen früheren Aufenthalten. Es hatte sich nicht wesentlich verändert. Ich war jetzt einige Tage hier und bisher hatte man es akzeptiert, dass ich nicht viel über meinen früheren Aufenthalt in Afrika redete. Es war schön wieder in Afrika zu sein, jedoch meine Erinnerungen an die letzten Jahre kamen auch immer wieder hoch.
Nach Feierabend saß ich jetzt vor einem Rohbau, hatte meine Pfeife gestopft und hing meinen Gedanken nach. Mein Projekt in Fort Lamy, was ist wohl daraus geworden? Ich hatte mich nicht einmal richtig von meinen Mitarbeitern verabschieden können. Die Leiterin des Waisenhauses, eine Deutsche, Mitte vierzig, kam zu mir herüber. „Hier steckst du. Ich wollte dir sagen, das Essen ist fertig. Komm doch mit rüber zu den Kindern.“
Ich schaute zu ihr auf. „Danke aber ich bleibe noch einen Augenblick hier.“ und lies das Amulett wieder über meine Finger gleiten.
„Komm mit, die Kinder werden deine trübsinnigen Gedanken schon zerstreuen.“
Ich stand auf, klopfte meine Pfeife aus und ging mit. Doch so fröhlich die Kinder auch waren, ich musste immer wieder an die Waisen denken, die meine Frau einige Zeit in der Mission Mai Bada betreut hatte. Es war wohl doch keine gute Entscheidung hierher zu kommen. Zu viele Erinnerungen an ein glücklichere Zeiten.
Nach dem Essen setzte ich mich auf eine der von mir gebauten Schaukeln und zündete mir erneut eine Pfeife an. Das half beim Denken, redete ich mir ein. Ich dachte darüber nach, ob ich von hier einen Brief an Jean, dem tschaddischen Betreuer meines Projektes, schreiben sollte. Aus Deutschland hatte ich ihm nie geschrieben, weil ich befürchtete, dass man den Brief abfangen und ihm eventuell Nachteile entstehen könnten.
„Darf ich?“ Ich hatte die Leiterin des Heimes nicht kommen gehört.
Sie setzte sich auf den freien Platz der Schaukel ohne eine Antwort abzuwarten und nach einigen Augenblicken des Schweigens sah sie mich an: „Man hat uns im Vorfeld mitgeteilt, dass du einige Jahre Entwicklungshelfer im Tschad warst. Das du nicht das erste Mal in Afrika bist merkt man. Mit den Arbeitern kommst du ja gut zurecht. Sie haben dich schnell akzeptiert. Aber über deine Zeit im Tschad hast du noch nicht viel erzählt. Was ist da passiert? Ich merke doch, dass du dich mit etwas herum quälst.“
„Kann schon sein.“ antwortete ich, ohne den Blick vom Boden zu erheben.
„Du hast vorhin so ein Amulett in der Hand gehabt. Hat es eine besondere Bedeutung. Es sieht aus wie eines dieser einheimischen Zauberdinger.“
„Ist auch eins. Es hat mich bis jetzt auch wohl immer beschützt.“ und nach einer Pause ergänzte ich: „Nur mich.“ Die letzten beiden Worte hätte ich nicht sagen sollen. Sie brachten mich in Erklärungsnöte.
„Wie meinst du das, nur Dich?“
„Ach, das ist eine lange Geschichte, damit will ich euch nicht belasten. In ein paar Wochen seit ihr mich wieder los und bis dahin haben wir noch einiges zu schaffen.“
„Du hast Zeit, mir die Geschichte zu erzählen. Wenn du jetzt anfängst, schaffen wir es in der Zeit.“
„Lass gut sein, das ist etwas, mit dem muss ich allein fertig werden. Lass uns die Häuser soweit es geht fertig stellen und dann fahre ich wieder.“
„Du scheinst zwar andere aber genau so große Probleme zu haben, wie einige unserer Kinder. Ich habe sie noch alle zum Reden gebracht und glaub mir, es hat ihnen geholfen. Wenn nicht heute, dann reden wir ein anderes Mal.“ Sie stand auf und ging.
♦
Wir waren mit dem klapprigen R4 in die Stadt gefahren, um die Einkäufe zu erledigen. An einem der modernen Wohnhäuser rutschte mir ganz automatisch die Bemerkung heraus: „Hier hat Marita gewohnt, eine Kollegin aus dem Büro des DED.“
Dass ich mehrfach in Yaoundé und verheiratet gewesen war, hatte man offenbar nicht weitergegeben und ich hatte es auch noch nicht erwähnt. „Es war wohl eine sehr nette Kollegin, wenn du dich sogar noch daran erinnerst, wo sie gewohnt hat. Ich dachte du warst im Tschad.“
„Ja, ich war aber auch mehrfach hier.“
„Und da hast dich in diese Marita verliebt.“ sagte sie lächelnd, als wäre es das selbstverständlichste von der Welt.
„Nein, sie war eine tolle Kollegin, verliebt war ich nicht in sie. Da gab es andere.“
„Ich dachte schon, ich hätte den Grund für deine Grübeleien gefunden.“
Wir parkten den Wagen und jeder erledigte seine Besorgungen. Sie hatte irgendwelche Medikamente zu besorgen und ich einige Teile für die Wasserleitungen. Wir verabredeten uns nach den Einkäufen in dem gegenüberliegenden Café.
Ich wartete schon eine geraume Zeit auf meine Mitfahrerin. Als sie endlich kam, saß ich vor meinem leeren Colaglas, die Tasche mit den paar Leitungsteilen, die ich ergattert hatte, auf dem Nachbarstuhl abgestellt. Ursel Pascheck klappte auf der gegenüberliegenden Seite die Wagentür zu und riss mich aus meinen Gedanken. Ich wusste jetzt, was meine Unzufriedenheit mit der Situation hier verursachte. Sie kam langsam herüber.
„Na, wieder am Grübeln?“ Sie hatte gesehen, wie ich mein Amulett wieder in der Hand drehte.
„Ja, ich weiß jetzt, warum ich bei euch so unzufrieden bin.“
Sie nahm meine Tasche vom Stuhl und setzte sich. „Da bin ich aber auf das Ergebnis gespannt.“
„Was ihr hier macht hat mit Entwicklungshilfe nicht viel zu tun. Euer Projekt ist rein humanitär. Ihr kuriert hier nur am Symptom. Versteh mich nicht falsch, solche Projekte muss es auch geben, nur, ich habe im Tschad etwas anderes gemacht.“
„Das musst du mir näher erklären.“ sagte Ursel und sah mich an, als hätte ich gesagt, was ihr macht ist alles Mist. „Was gefällt dir denn nicht an dem Projekt?“
„Es ist schon richtig, dass ihr die Kinder aufnehmt. Ich habe ja die Geschichten gehört. Dass sie von ihren Eltern an Farmbesitzer verkauft wurden und dort ohne Lohn arbeiten mussten, dass sie dann von dort abgehauen sind und glaubten, in der Stadt ein besseres Leben zu finden und sich hier mit stehlen und wühlen im Abfall der Reichen über Wasser gehalten haben. Wie vielen Kindern könnt ihr hier helfen? Ein, zwei Prozent? An den Gründen für dieses Übel ändert ihr doch mit diesen Projekten nichts. Ich glaube, nur die wenigsten Menschen in Deutschland, die dieses Projekt unterstützen, sind wirklich bereit, etwas grundlegendes zu ändern. Die meisten beruhigen mit ihrer Hilfe nur ihr schlechtes Gewissen.“
„Du meinst, wir sollen die Arbeit hier aufgeben und alles laufen lassen? Dann haben die Kinder doch gar keine Chance mehr.“
„Nein, Ursel ihr sollt nicht aufgeben, gebt den Kindern eine Chance. Es ist eben nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Meine Frau hat auf der Mission auch Waisenkinder betreut, deren Eltern waren aber gestorben und die Verwandten konnten sie nicht auch noch durchbringen. Was führt denn dazu, dass Kinder so behandelt werden?“
Ursel sah mich erstaunt an. „Du bist verheiratet? Warum ist deine Frau nicht mitgekommen?“ Sie wich damit einer Antwort auf meine Frage aus.
„Ich habe sie vor fast einem Jahr verloren.“
„Was heißt verloren? Du bist geschieden?“ als ich nicht antwortete und mein Amulette wieder einsteckte, hakte sie nach: „Sie ist gestorben?“
„Ja, und ich kann nicht einmal ihr Grab und meine Schwiegereltern besuchen.“
„Wieso nicht? Das verstehe ich nicht.“ Sie ging wohl davon aus, dass ich mit einer Weißen verheiratet war.
„Abela war Tschadderin. Ich kann dort als Deutscher nicht wieder einreisen. Alle Deutschen mussten das Land verlassen.“
„Das tut mir leid. Sie war Tschadderin? Deshalb hast du dieses Amulett?“
„Ja, sie hat es mir bei unserer ersten Begegnung geschenkt. Ich dachte, es sei in ihrem Sinne, wenn ich euch ein bisschen Unterstütze.“
„Das ist es doch sicher auch, wenn sie Kinder so gern hatte. Willst du mir nicht sagen, woran sie gestorben ist?“
„Du lässt mir ja doch keine Ruhe, bis du es herausgefunden hast. Sie wurde erschossen.“
„Im Tschad?“
„Ja.“ war meine knappe Antwort.
„Du willst nicht darüber reden?“
„Nein, nicht jetzt. Lass uns zurück fahren. Man wird schon auf uns warten.“
„Aber du erzählst mir deine Geschichte?“
„Ja, ganz bestimmt von Anfang an.“
♦
Ursel nahm sich richtig viel Zeit für meine Geschichte, und ich musste mit meiner Entscheidung, in den Entwicklungsdienst zu gehen, beginnen. So saßen wir an den nächsten Abenden vor unserem Haus und ich erzählte.
Was mich hier in Yaoundé hielt, waren wirklich die Kinder. Natürlich hatten die nach den ersten Tagen gefragt, ob ich auch aus Deutschland komme, ob ich schon einmal in Afrika war und dann musste ich aus dem Tschad erzählen. Auch meine Bauarbeiter wollten natürlich wissen, wo ich vorher in Afrika war. Ich verhielt mich wohl nicht wie jemand, der das erste Mal in einem afrikanischen Land arbeitete. Mittags aßen wir oft zusammen und ich stellte Fragen nach ihren herkömmlichen Bauweisen und skizzierte mit dem Zollstock meine Bauweise in die harte Erde. Dabei blieb ihnen auch nicht verborgen, dass ich mit den aus Zementsteinen errichteten Häusern nicht einverstanden war. Ursel musste uns manches Mal nach der Mittagspause daran erinnern, dass wir ja eigentlich zum Arbeiten hier waren und nicht zum Geschichten erzählen und Erfahrungen auszutauschen. Doch auch sie hörte aufmerksam zu, wenn ich die Vorzüge der herkömmlichen Lehmbauweise beschrieb.
Sie wollte unbedingt wissen, wie man mit Lehmziegeln und selbst gebrannten Steinen arbeitet. Eines der nächsten Häuser wollte sie in der herkömmlichen Bauweise errichten lassen. Es würde erheblich billiger sein als mit den in der Fabrik hergestellten Hohlkammersteinen aus Zement und Kies. „Für das Geld eines Hauses hätten wir ja zwei bauen können.“ sagte sie eines Tages als wir wieder abends zusammensaßen. Die Steine für das nächste Haus machen wir selber. Es muss für die Kinder eine wahre Freude sein, denn wann dürfen die so im Lehm matschen.
Und noch etwas erfuhr ich während meines Aufenthaltes. Das Ölvorkommen im Süden des Tschad, lag in der Region um Doba und man plante, eine Pipeline von dort an die Küste Kameruns. Ich wusste nicht, ob ich mich darüber freuen sollte. Dieser Region stand ein gewaltiger Umbruch bevor. Wie würde die Bevölkerung damit umgehen? Vielleicht war es gut, dass ich jetzt nicht dort war, denn zu was Konzerne fähig waren, hatte ich ja schon erlebt.
Am Ende meiner Zeit in dem Kinderheim, war es dann doch ein Abschied mit dem Versprechen, wieder zu kommen. Es war zwar kein Projekt, wie ich es aus meiner früheren Zeit kannte, aber immerhin doch eine Möglichkeit, wenigstens ein wenig zu helfen und wieder in Afrika zu sein. Wenn meine Gespräche mit den Bauleuten nur dazu geführt hatten, dass sie ihre herkömmliche Art zu bauen, nicht als unmodern und altmodisch ansahen, war das für mich schon ein kleiner Erfolg. Sie auf ihre eigenen Stärken und Möglichkeiten hinzuweisen, war mir wichtig.
Ursel hatte mir schon mehrfach gesagt, dass ich mein Leben im Tschad doch in einem Buch beschreiben sollte. In das Innenleben eines Entwicklungshelfers könnten sich die meisten Leute wohl nicht hinein fühlen und meine Arbeit im Tschad sei viel aufregender gewesen, als ihre Arbeit hier. Ich hatte ihr darauf nur gesagt, dann solle sie die Geschichten der Kinder auf schreiben, denn auch das Leben der Kinder sei es wert, bekannt gemacht zu werden.
Am Tag meiner Abreise nahmen wir uns das Versprechen ab, uns gegenseitig die Manuskripte zu zuschicken.
♦
Ich war zurück und im Winter schrieb ich alles auf, wie ich es Ursel versprochen hatte. Ich saß an meinem Schreibtisch in Osnabrück und faltete den Brief an Ursel zusammen.
Liebe Ursel.
Ich habe es geschafft. Mein Leben als Entwicklungshelfer liegt jetzt in diesem dicken Paket für dich zum Lesen bereit. Ich habe mein Versprechen eingehalten und warte nun auf die Geschichten der Kinder. Das Schreiben hat mir gut getan. Es war eine schwere Zeit, beim Schreiben noch einmal alles vor sich zu sehen und ich war froh, an manchem Abend über meinen Zeichnungen und Berechnungen zu sitzen und die Erinnerungen zu verdrängen. Das Amulett habe ich immer noch und ein Bild von Abela im Schnee steht immer noch neben meinem Bett. Aber ich komme jetzt besser mit ihrem Tod zurecht. Ihr Foto liegt irgendwo zwischen den Seiten.
Natürlich hatte ich an manchem Abend auch richtig Wut im Bauch, weil manches wieder hochkam, dass mich schon damals wütend machte. Das ich von meinen Leuten dort bisher nichts gehört habe, schmerzt auch. Darüber tröstete auch der gelegentliche Briefkontakt zu den ehemaligen Kollegen, die alle noch in Deutschland sind, nicht hinweg. Allerdings, von der Journalistin und meiner Freundin aus Kali habe ich bisher nichts gehört. Eigentlich Schade, denn meine ehemaligen Kollegin kann ich auch nicht vergessen. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich an Ilse und ihr Hospital denke. Vielleicht sollte ich Abelas Rat annehmen und Ilse suchen oder das Amulett bringt mir wieder einmal Glück und ich treffe sie irgendwo wieder.
Für heute habe ich genug von mir geschrieben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und warte auf deine Kritik und deine Geschichten über die Kinder.
Schreib mal, wie es mit weiteren Häusern aussieht und ob ihr wieder einen Bauhelfer braucht.
Es grüßt Dich und Deine Helfer
Herbert
PS: Viele Grüße an die Kinder und an die Bauleute die noch bei Euch sind.
Das Schreiben hatte mir wirklich geholfen. Ich legte den Brief auf die erste Seite des gehefteten Schriftstücks und brachte das Paket zur Post. Auf die Reaktion war ich wirklich gespannt.
Die Ausbildung
Vor dem Einsatz beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) musste ich einen zweitägigen Eignungstest in Bad Godesberg durchlaufen. Den medizinischen Test hatte ich bestanden und saß nun mit etwa 20 Personen in einem Besprechungsraum der Zentrale beim psychologischen Test. An zwei Dinge erinnere ich mich besonders, an den mehrseitigen Fragebogen, dessen Fragen man innerhalb von 15 Minuten mit ja oder nein beantworten musste, mit Fragen wie: ‘Geben sie ihre Briefe immer gleich zur Post?‘ und einige Seiten weiter die Frage: ‘Lassen sie einen Brief auch schon mal ein paar Tage liegen, bevor sie ihn zur Post bringen?‘ Und daran, eine Geschichte nach vier Postkartenmotiven, die nach einer Minute wieder eingesammelt wurden, zu entwickeln. Natürlich hatte ich ein Motiv vergessen. So ließ ich mir eine Geschichte einfallen, in der einfach das Motiv einer Postkarte vergessen wurde. Einige Tage später erhielt ich meinen Vertrag nach § 22 EhfG (Entwicklungshelfergesetz) und man teilte mir mit, dass ich voraussichtlich in Tunesien eingesetzt werde.
♦
Ich auf den blaugrünen Briefumschlag, Absender „Kreiswehrersatzamt Osnabrück, 4500 Osnabrück, Meller Str. 228“ den ich gerade erhalten hatte. Ich ahnte, das ist mein Einberufungsbescheid. Also, was tun? Ein Telefongespräch mit dem DED am nächsten Tag brachte Klarheit. Den Einberufungsbescheid und den Wehrpass sollte ich einfach zurückgeben und darauf verweisen, dass am 1. Juli, also am Einberufungstermin meine Ausbildung als Entwicklungshelfer in Berlin beginnt. Der Vertrag mit dem DED sei rechtskräftig und im Gesetz stehe, dass bei unterschriebenen Verträgen die Bundeswehr auf die Einberufung verzichten muss.
Der Termin beim Kreiswehrersatzamt verlief alles andere als erfreulich. Die Beamten nahmen den unterschriebenen Vertrag mit dem DED und meinen Hinweis auf das Entwicklungshelfergesetz nicht ernst. Den Wehrpass nahmen sie auch nicht zurück. Für den Fall, dass ich nicht antreten sollte, drohte man mir den Einsatz der Feldjäger an.
Für mich stand fest: Am 01.07. bin ich in Berlin. Berlin war eine gute Wahl, denn dort hatten die Feldjäger wegen des besonderen Status der Stadt keine Befugnis.
Am 01.07. fuhr per Bahn nach Hannover und flog nach Berlin. So konnte man unangenehme Fragen und Aufenthalte an den Grenzkontrollstellen der DDR ausschließen. Von einer Bahnfahrt oder der Fahrt mit dem eigenen Pkw hatte der DED abgeraten. Man ging davon aus, dass die andere Seite wusste, wer beim DED den Dienst begann. Soweit dachte ich allerdings damals nicht. Meinen Wehrpass hatte ich am Tag zuvor per Einschreiben an das Kreiswehrersatzamt geschickt.
♦
Die Ausbildungsstelle war in einer ehemaligen Villa untergebracht, unweit des Zentrums. Hier sollte ich mit den Kollegen, die in den französischsprachigen Ländern Afrikas arbeiten sollten, die nächsten drei Monate verbringen. Die Gruppe war, wie das Haus vermuten lies, nicht sehr groß. Am Abend waren einundzwanzig junge Leute und das Hauspersonal beisammen.
Die Ausbildung bestand aus theoretischem Unterricht, vor allem Sprachunterricht und hier lagen meine besonderen Schwierigkeiten. Meine schulische Vorbildung bestand aus einem Jahr Berufsaufbauschule mit Englisch als Fremdsprache und da hatte es nur zu einem Ausreichend gereicht. In der Abschlussprüfung hatte ich das Diktat total versiebt, aber die Übersetzung mit einer zwei bis drei hingelegt, so dass meine Lehrer mich anschließend fragten: „Wie hast Du dass gemacht?“ Das war ganz einfach, immer wenn ich nicht wusste wie ein Wort geschrieben wurde, schrieb ich es so, wie ich es gehört hatte. Die Aussprache war mir geläufig und ich verlor so keine Zeit mit Nachdenken über die richtige Schreibweise. Diese Schwäche sollte mir in Berlin noch zu schaffen machen.
♦
Jetzt wird es aber Zeit zu erklären, welche Aufgabe ich übernehmen sollte. Mein Gastland war Tunesien, ein Glücksfall für mich. Zum Einen weil ich meinem Hobby, der Vogelkunde hier ohne große Umstellung weiter betreiben konnte, zum Andern konnten meine Bekannten und Freunde mich hier leicht besuchen. In Gedanken war ich schon bei den internationalen Wasservogelzählungen am Lac Tunis. Doch zurück zu meiner Aufgabe. Ich sollte an einer berufsbildenden Schule die Ausbildung junger Tunesier zu Maurern übernehmen. Meine Vorbildung als gelernter Maurer und Bauzeichner war offenbar gut genug. Nur die Sprache machte mir zu schaffen. Und eine weitere Entscheidung viel in Berlin. Ich werde in Deutschland kein Berufsschullehrer. Während der drei Monate absolvierte ich ein Praktikum an einer Berufsschule in einer Klasse mit Schülern ohne Schulabschluss. Sicherlich als gute Vorbereitung gedacht, doch zumindest in Deutschland nicht mein späteres Berufsziel.
Die „Franzosen“, so wurde die kleine Gruppe in Berlin intern genannt, wuchsen als Gruppe zusammen. Die Krankenschwestern lernten Moped fahren und reparieren, die Handwerker Verbände anlegen, und nach einem medizinischen Kurs, wenn es um Parasiten und Co ging, waren alle leicht angeekelt. In der Freizeit wurde Berlin erkundet, manchmal bis spät in die Nacht.
Natürlich war auch ein Besuch in Osten angesagt. Dazu gab es die Anweisung: Geht bitte nicht als Gruppe über die Grenze, möglichst nur zu zweit, höchstens zu dritt. Damit sollte es den DDR-Grenzern erschwert werden, uns unter den Besuchern ausfindig zu machen. Allerdings schafften sie es trotzdem. Unsere Gruppe fand sich fast komplett vor dem Tresen in einer abseits stehenden Garage wieder.
Nach einigen Wochen fuhr ich doch mit meinem VW Käfer vom Heimatbesuch nach Berlin. Die Brüder und Schwestern im Osten wussten ja eh, was ich machte und es war ja nicht verboten, es wurde nur nicht empfohlen. 400 km Autobahn, Fahrzeit 4,5 Std. So konnte ich ein Wochenende auch mal bei Eltern und Freunden verbringen, denn Flüge konnte ich mir nicht leisten. Montag morgens um 8:00 begann der erste Kurs und so wurde manche Fahrt zur Nervenprobe. Wann ist die Grenze auf, ist die Grenze noch auf, wenn ich am Checkpoint bin? Schwierig wurde es immer, wenn die Grenzer nur wenige Fahrzeuge abfertigten und danach einige Minuten Pause einlegten. Dann bildeten sich Staus bis zu 30 km, und es ging nur im Stop and Go vorwärts. An schlafen war dann nicht zu denken.
An einem solchen Tag überkam mich auf der Interzonenautobahn die Müdigkeit so stark, dass ich trotz Verbots meinen Käfer auf einen Parkplatz lenkte und mir eine Mütze voll Schlaf gönnte. Am Grenzpunkt in Berlin wurde ich daraufhin prompt gefragt, wieso ich fast eineinhalb Stunden länger für die Strecke gebraucht hätte. Meine Antwort: „Wenn Ihre Kollegen nur wenige Autos abfertigen und so lange Wartezeiten verursachen, wird man irgendwann müde, und bevor ich auf der Interzonenautobahn einen Unfall baue, halte ich es für besser, auf einen Parkplatz zu fahren und eine Mütze voll Schlaf zu nehmen.“ Der Grenzer war offenbar der gleichen Ansicht, denn er kommentierte nur: „Beim nächsten mal fahren Sie durch.“ Er blickte noch einmal in meinen Pass und ließ mich fahren.
Die kleine Gruppe in Berlin wuchs immer mehr zusammen. Trotzdem bildeten sich natürlich Grüppchen, die ihre Freizeit gemeinsam verbrachten. Ich hatte mich mit Kollegen für Kamerun, Dahomey und der Elfenbeinküste zusammengetan. Unser Clübchen bestand aus Krankenschwester Ilse, der Ärztin Ingrid, beide mit dem Ziel Nordkamerun, Elisabeth, einer Kinderkrankenschwester und Frank, einem Telefonfachmann für die Elfenbeinküste, Klaus, ein Schlosser, und Anja einer Krankenschwester für Dahomey.
Wir drei Maurer für Tunesien hatten alle unsere Probleme mit der Sprache. Mit Ilse verstand ich mich sehr gut und lernte mit ihr auch in der freien Zeit. Es half nur bedingt. Meine Schwierigkeiten, beim freien Sprechen, vor allem Schreiben, blieben. Dass mir dieses Problem noch einmal Schwierigkeiten bereiten könnte, hatte ich verdrängt. Ich wollte unbedingt nach Tunesien.
Während der Vorbereitung hatte sich die Schar der potenziellen Helfer verkleinert. Einige waren freiwillig ausgeschieden und einmal wurde der Vertrag vom DED beendet. Vierzehn Tage vor Ende der Ausbildung erhielt ich einen Termin beim Betreuerteam. Eine Anhörung über meinen Einsatz oder mein Ausscheiden war angesetzt. Für meine Stellungnahme durfte ich mir einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin wählen. Meine Wahl fiel auf Ilse, mit ihr hatte ich viel Zeit verbracht.
Bei der Anhörung durch das Leitungsteam und einem Psychologen ging es nur um die Sprache. Ilse hielt, wie erwartet zu mir und brachte ein, dass, wenn ich nicht anders könne, als mich französisch zu verständigen, dies auch schaffen würde. Im übrigen seien die Sprachkenntnisse der beiden anderen Maurer auch nicht besser. Wir wurden entlassen und warteten gemeinsam auf die Entscheidung.
Riesigr Erleichterung als man mir mitteilte, dass ich bleiben könne. Diese Entscheidung wurde mit einem ordentlichen Glas Rotwein gefeiert. Die Kursleitung hatte sich zu einem intensiven zusätzlichen Sprachkurs für alle Maurer im Gastland entschieden. Ich war glücklich und verbrachte vor der Ausreise noch einmal einige Tage bei meinen Eltern. Verabschiedete mich von meinen Freunden, meiner Freundin Elke und besuchte Ilse, die nur 70 km entfernt zu hause war. Unsere Wege sollten sich ja nun trennen. Zweitausend Kilometer und der größte Teil davon Wüste, lag zwischen unseren Einsatzorten. Wir verabredeten in Verbindung bleiben. Wie das funktionieren sollte, war uns nicht klar. Wir waren aber sicher, einen Weg zu finden.
Gastland Tunesien
Die ersten Wochen
Ich saß im Flieger nach Frankfurt, denn das Urlaubsland Tunesien wartete auf mich. Mit im Handgepäck meine Kameraausrüstung, ein 400 mm Teleobjektiv in einer speziell angefertigten Tragetasche aus der das Schulterstativ weit herausragte. So hatte das Ding Ähnlichkeit mit einem Maschinengewehr. Bei jeder Kontrolle durfte ich alles auspacken.
In Frankfurt traf ich meine Kollegen wieder. Der Flug über die Alpen und das Mittelmeer dauerte nur ca. zwei Stunden. Wir waren gespannt, was uns in Tunis erwartete.
♦
Am Flughafen in Tunis setzte die Maschine gegen 14:30 zur Landung an. Der Pilot verabschiedete sich von seinen Gästen mit der Durchsage: „Meine Damen und Herren, in Kürze werden wir in Tunis landen. Die Lufttemperatur beträgt 28,5°C, es ist leicht bewölkt und der Wind weht in Stärke 2 aus West. Kapitän Wesseler und seine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Tunesien.“
Natürlich musste ich auch hier meine Kameraausrüstung vorführen und hielt damit alle auf. Dann stand unser Grüppchen mit suchenden Blicken in der Empfangshalle. Was kam jetzt?
Es war nicht viel Betrieb und so fiel es leicht, den jungen Mann mit dem Schild DED, ausfindig zu machen. Er stellte sich mit Erhard vor. Erhard war etwa 25 Jahre, trug eine typische tunesischen Burka und war sonnen gebräunt. Unser Gepäck wurde in seinem VW Bus verstaut und ab ging es zum Regionalbüro des DED. Dabei bekamen wir einen ersten Eindruck von dem nach unseren Vorstellungen chaotischem Verkehr. Erhard umkurvte Eselkarren, alte Citroen und viele rote Renault Dauphine und erzählte dabei seelenruhig von seinen Aufgaben in der Werkstatt, wo er Fahrzeuge der Forstverwaltung reparierte und als Ausbilder tätig war. Nach gut einer halben Stunde erreichten wir das Büro. Der Regionalvertreter, so nannte man die Leiter der Regionalbüros, begrüßte uns Neulinge und lud zu einem Kaffee ein. Nach der Vorstellungsrunde ging er kurz auf unsere Aufgaben und Einsatzorte ein und verabschiedete uns dann in die Quartiere. Erhard übernahm mit seinem VW-Bus die Verteilung. Unser Einruck über das Verkehrsverhalten der Tunesier wurde dabei nicht verbesser. Er beruhigte uns: „Ihr werdet euch dran gewöhnen, das dauert nicht lange.“
Wir drei Maurer bezogen unsere Zimmer in einen eingeschossigen Haus in einem ruhigen Wohnviertel. Das Grundstück verfügte über einen Vorgarten mit einigen älteren Apfelsinenbäumen und einer niedrigen Mauer mit schmiedeeisernem Zaun zur Straße. Wir stiegen die fünf Stufen zur Haustür hoch und klopften. Eine junge Frau öffnete und begrüßte uns freundlich auf deutsch. Sie erklärte, dass hier bereits zwei DED’ler wohnten und verteilte uns auf die Räume. Wir erfuhren, dass unsere Gastgeberinnen in zwei Monaten ihren Dienst beenden werden und wir dann das Haus für uns hätten.
Waltraud, so hieß die Kollegin, erklärte auch die weiteren Umstände in der Wohngemeinschaft. Es gab ein gemeinsames Bad, eine gemeinsame große Küche mit Blick in den Garten und ganz wichtig Zina7, den guten Geist des Hauses. Sie war von den Bewohnern, nicht vom DED, angestellt, um den Haushalt aufrecht zu halten und auch mal die Mahlzeiten zuzubereiten. Zina 3 sollten wir am nächsten Tag kennen lernen.
Spät am Abend kam die zweite Hausbewohnerin heim und wir saßen bei einem Glas Rotwein im gemeinschaftlichen Wohnraum und hörten den Geschichten der beiden jungen Frauen gespannt zu. Irgendwann am Abend ging jeder in sein Zimmer. Der Tag war lang und das Bett wartete mit einer sehr weichen Matratze.
♦
Am nächsten Morgen klingelte mein Wecker, wie gewohnt, bereits um sieben Uhr. Der Muizim hatte bereits zum Morgengebet gerufen. An dieses Ritual musste ich mich gewöhnen, die Glocken von Sankt Seppel, Entschuldigung Sankt Josef, in Osnabrück läuteten nur am Sonntag und zu besonderen Anlässen.
Ich ging ins Bad, ein kleiner Raum mit einem hoch angesetzten Fenster, der Boden gefliest, hinter dem Waschbecken ein kleiner Fliesenspiegel, daneben ein selbstgebautes Regal mit den Utensilien der bisherigen Hausbewohner und an der gegenüberliegenden Wand eine freistehende Badewanne. Eine Dusche gab es nicht. Die Toilette war separat in einem Raum daneben. Nach der Morgentoilette ging ich zurück in mein Zimmer, verstaute meine Badetasche im Schrank und ging in die Küche. Ich setzte mich an den Tisch und hörte, wie die anderen Bewohner das Bad aufsuchten.
Waltraud erschien als nächste in der Küche. Sie stellte Teewasser in einem elektrischen Wasserkocher auf, ja es gab Strom in dem Haus, und holte aus dem älteren Schrank Tassen und Teller. Das Brot, ein weiches, weißes Brot, lag in einem Schrank neben der Spüle, daneben der Kühlschrank. Gegen viertel vor acht hörte man die Haustür knarren. Waltraud stand auf und ging in den Flur.
„Zina lebes?“
„Lebes, lebes. Walli, lebes?“ Ich hörte eine freundliche Frauenstimme auf dem Flur.
„Lebes, lebes.“
„Ich bin heute etwas früher gekommen, sind die Neuen denn schon da?“
Zina, geschätzte 45, etwas rundlich, mit sehr offenem, freundlichen Gesicht, westlich gekleidet und ohne Kopftuch, betrat mit Walli die Küche. „Sie hätte meine Mutter sein können“, dachte ich, als ich sie sah. Sie lächelte. Die Freude über die Neuen stand ihr ins Gesicht geschrieben. Die Begrüßungsrunde mit „lebes, lebes“ schien kein Ende zu nehmen. Walli erklärte, dass sei eigentlich immer so. Dass man nicht noch gefragt werde, wie es Hund und Katze gehe, sei ein Wunder. Zina sei sehr zuverlässig, fleißig und sie nehme die Bewohner fast wie eigene Kinder. Sie hätte schon gefragt, ob sie am Sonntag für die Neuen kochen könne, Kuskus tunisien a la mama Zina.
Nachdem man sich ausreichend versichert hatte, dass es allen gut geht, verschwand Zina hinter einen Vorhang im Flur. Dort waren die Reinigungsutensilien in einem Regal untergebracht und Zinas Arbeitskleidung hing ebenfalls dort. Sie begann ihre Arbeit und die Hausbewohner teilten sich auf. Zwei gingen zur Arbeit und wir Maurer warteten auf Erhard, der uns gegen 9:30 Uhr abholen und zum Büro bringen sollte.
Erhard war fast pünktlich. Die Fahrt ins Büro schien heute durch ein Gewirr von kleinen Gassen zu gehen. Straßen fast wie in Deutschland. Kopfsteinpflaster in der Fahrbahn, Bordsteine aus Granit und auf dem Bürgersteig diagonal verlegte Betonplatten. Nur die Holzmasten mit den Laternen und die Oberleitung der Stromversorgung passten, abgesehen vom den Flachdächern der Häuser, nicht so recht ins Bild. Mein erster Eindruck heute, der Unterschied ist gar nicht so groß.
Im Regionalbüro wurden wir wieder in das Besprechungszimmer geführt, in dem uns der Regionaldirektor in Begleitung eines etwa 30 Jahre alten, schlanken Mannes, den er als Herr Reinders, seinen Stellvertreter, vorstellte, empfing. Sein Stellvertreter sei seit drei Monaten im Land und werde die nächste Zeit unser Hauptansprechpartner sein. Herr Reinders übernahm das Gespräch und verabschiedete den Regionaldirektor.
Wir Neuen erfuhren näheres über unseren Aufgaben. Die Maurer sollten in Gafsa in einer Art Berufsschule jungen Tunesiern die neuesten Techniken im Bauhandwerk erklären und dabei vor allem auf Sicherheitsaspekte eingehen, die hier wohl nicht so sehr ernst genommen wurden. Was ich hier auf Baustellen sah, sollte allerdings später durch noch abenteuerlichere Konstruktionen auf meinen eigenen Baustellen übertroffen werden. Gabi, die Krankenschwester, sollte in Medenin im Krankenhaus arbeiten.
♦
In drei Tagen musste Erhard wieder an seinen Einsatzort zurückkehren und bis dahin sollte sich die Truppe mit den Verkehrs- und Wegverhältnissen vertraut gemacht haben. Am nächsten Tag sollte jeder zur Erlangung einer gewissen Mobilität einen zweirädrigen motorisierten Untersatz bekommen.
Gegen 11:30 Uhr wurde das Gespräch durch Klopfen an der Tür unterbrochen. Eine Frau um die dreißig betrat den Raum und begrüßte Monsieur Reinders auf französisch. Er stelle Madame Leconte als unsere französisch Tutorin vor und die Sprache wechselte ins französische. Sie erklärte, sie verstehe und spreche zwar sehr gut deutsch, in ihrer Anwesenheit solle jedoch nur französisch gesprochen werden. Nur wenn es gar nicht mehr ginge, dürften deutsche Vokabeln verwendet werden.
Madame Leconte war Frankokanadierin, sie war seit zwei Jahren in Tunis und ihr Mann arbeitete in der Kanadischen Botschaft. Die Stadt gefalle ihr sehr gut und sie hoffe, noch einige Zeit hier bleiben zu können. Wir versuchten, mit unterschiedlichem Erfolg, die Vorstellungsrunde in französisch über die Bühne zu bringen. Als der letzte fertig war, schaute Monsieur Reinders auf die Uhr, Zeit für die Mittagspause. Der Vorschlag von Madame Leconte, ein Restaurant in der Nähe aufzusuchen, wurde allseits angenommen und so begab sich die Gruppe auf den ersten Besuch in die Stadt.
Das Lokal lag etwa 10 Minuten vom Büro entfernt, zentral in der Innenstadt. Ich war erstaunt, wie viele alte Citroen 11 CV, diese Gangsterlimousinen aus alten Spielfilmen, hier noch unterwegs waren, und es wimmelte nur so von roten Renault Dauphin, die als Taxi eingesetzt waren. Das Gewirr der Sprachen um mich herum war ein Gemisch aus arabisch und französisch. Es schien mir, als sei es für einen Deutschen einfacher, arabisch als das weiche Französisch zu lernen, wenn da nicht die ganz andere Schrift wäre. Ich nahm mir vor, in der Schule von meinen Schülern mindestens arabisch sprechen zu lernen.
Die Unterhaltung beim Essen klappte mal mehr mal weniger gut. Die Tutorin achtete streng darauf, dass auch untereinander kein Deutsch gesprochen wurde. Schließlich stand die Frage an: Was machen wir am Nachmittag? Madame Leconte schlug eine kurze Führung durch die Stadt vor und Monsieur Reinders stimmte zu und verabschiedete sich ins Büro. Am nächsten Morgen um acht wollten wir uns wieder im Büro treffen.
Am späten Nachmittag kamen wir voller neuer Eindrücke wieder ins Büro und verabredeten uns mit Madame Leconte für den nächsten Tag 15:00 im Besprechungsraum.
Ungeduldig hatte Erhard gewartet, denn er hatte für den Abend noch eine Verabredung getroffen und wollte nicht zu spät kommen. Die Fahrt zu den einzelnen Unterkünften verlief daher sehr hektisch. Eigentlich nichts ungewöhnliches für Tunis.
Am nächsten Morgen wurde erst einmal für die Mobilität der Gruppe gesorgt. Irgendwie musste ja der Weg zwischen Büro und Wohnung geschafft werden. Fußläufig war es für mich eine halbe Stunde Weg. Erhard chauffierte uns zu einer kleinen Werkstatt am Stadtrand. Hier sah es schon nicht mehr europäisch aus. Keine Bordsteine, ausgefranster Asphalt am Straßenrand und eine staubige Schotterfläche bis zu den gemauerten Grundstückseinfassungen.
Durch ein großes, mit Blechplatten gefülltes Stahltor fuhr Erhard auf einen Hof und hielt vor einem halbfertigen Haus mit großen Garagentor. Der Bewehrungsstahl reckte sich weit aus den in den Ecken verbauten Betonsäulen in den Himmel. Gebaut hatte hier offenbar lange Zeit niemand mehr. Die nächste Etage war wohl geplant, es fehlte aber offenbar an Geld.
Im Innern der Garage war es angenehm kühl. Erhard begrüßte einen jungen Mann, wieder die Prozedur mit „Lebes, lebes“. In einer Nische standen unsere Gefährte. Vier 50 ccm Motorräder, aber schneller als 45 km/h und eine kleine Vespa. Ich entschied sich für die Vespa, denn da konnte ich meine Kameraausrüstung einigermaßen regen- und staubsicher verstauen. Außerdem hatte das Frontblech den Vorteil, dass bei Regen, denn auch damit war in den nächsten Monaten zu rechnen, die Beine nicht so nasse wurden.
Nun hieß es erst einmal mit den neuen Geräten auf dem Hof üben. Nachdem Erhard die Fahrzeugpapiere verteilt hatte, ging es seinem Bully hinterher, zurück zum Unterricht und danach mit der neuen Mobilität zur Wohnung.
Die nächsten Tage verliefen immer gleich. Morgens zwei Stunden französisch und weitere Einweisungen in die Projekte und nachmittags wieder zwei Stunden französisch, Landeskunde und Bürokram. Ja den gab es auch.
Das erste Wochenende wurde, wie die übrige Freizeit, zur Erkundung der Stadt genutzt. Man musste Karthago gesehen haben und das Nationalmuseum mit seinen wunderschönen Mosaiken. Auch die Souks wurden immer wieder gerne besucht. Die alten Hasen hatten uns dorthin mit genommen und gesagt: „Verlaufen kannste dich hier nicht. Bergauf kommste zur Porte de France.“
Nach zwei Wochen starteten wir die erste große Ausfahrt mit den Motorrädern. In der Zeit hatten wir uns gewaltig verschätzt, denn erst weit nach Sonnenuntergang erreichten wir wieder Tunis. Ich fühlte mich richtig wohl und war auch schon gelegentlich allein unterwegs, am Lac Tunis die Flamingos suchen oder die Seeschwalben und Enten zählen.
Heimweh kam gar nicht erst auf. Briefe mit Ilse auszutauschen, war über die Regionalbüros in Yaoundé und Tunis kein Problem. Wenn wir in unseren Projekten arbeiteten, dann würde es eine Frage der Zeit sein, wann jeweils zugestellt würde. Auch Briefe nach Deutschland waren von Tunis per Luftpost nur drei, höchstens vier Tage unterwegs.
Nach drei Wochen französisch Unterricht war Madame Leconte mit dem Ergebnis nicht so recht zufrieden. Ihr musste etwas einfallen. Ihre Lösung: Sie lud die ganze Gruppe zu einem abendlichen Bummel durch Tunis ein. Es wurde gegessen und in einem der Lokale blieben wir schließlich beim Rotwein hängen. Es schien, dass sich mit steigendem Rotweinkonsum die Zungen lösten. Als wir das Lokal verließen, konnte Madame Leconte feststellen, die können es doch. Es fehlte nur die letzte Überwindung nach dem Motto „Ist doch egal, ob da vielleicht noch ein Fehler in der Aussprache ist. Hauptsache, das Gegenüber weiß, was ich will.”
Nach diesem Abend fiel es mir nicht mehr schwer, mich mit meinem mageren Französisch verständlich zu machen. Offenbar konnte mich ja jeder verstehen.
♦
Natürlich gab es auch offizielle Veranstaltungen an denen ich teilnehmen musste. So ein Termin war der Besuch einer deutschen Kleiderfabrik in Suliman. An dem Abend schrieb ich in mein Tagebuch:
Die Firmenleitung war sogar der Meinung, dass der Vorteil des Standortes durch das größere Risiko nicht voll zur Geltung käme. Der Zoll usw. arbeite hier doch sehr langsam. Auf Steuer- und andere Vorteile angesprochen sagte man: Die Tunesier verstehen schon, alles wieder hereinzuholen und vom Personal komme alle halbe Jahr jemand und sagt: Die ist jetzt drei Jahre da und gut eingearbeitet, die müsste jetzt wohl mehr verdienen.
Ich hatte den Eindruck, dass Löhne nur ungern gezahlt wurden und dass man oft sehr hart durchgreift. Soweit der Besuch.“
An diesem Tag wurde mir klar, worum es bei wirtschaftlicher Zusammenarbeit wirklich geht. Zusammenarbeit setzte nach meinem Verständnis ein großes Maß an gegenseitiger Anerkennung und Gleichwertigkeit voraus. Dass diese Denkweise mich später noch häufiger in Konflikte bringen sollte, war mir nicht bewusst.
Entscheidung für den Tschad
Die vier Wochen Vorbereitung in Tunesien gingen zu Ende. Sprachlich fühlte ich mich einigermaßen fit, was mir noch fehlte, waren Fachausdrücke aus meinem Beruf. Madame Leconte hatte sich dafür Fachliteratur besorgt, die sie in einem Sonderkurs mit uns Maurern durch arbeitete.
Eine Überraschung gab es einige Tage vor Ende der Vorbereitung. Der Regionaldirektor musste uns Maurern erklären, dass wir noch nicht in unser Projekt fahren konnten. Es gebe noch Verhandlungsbedarf. Wir mussten weiter in Tunis bleiben. Doch was tun mit der vielen Freizeit? Die Vespa war ja nicht besonders zur Erkundung des Landes geeignet.
Im Büro wurde eine Versorgungsfahrt mit dem Bully in den Süden vorbereitet. Für die Rückfahrt gab es noch keinen Fahrer. Dies war meine Chance. Ich bot mich bei Herrn Reinders für die Fahrt an und er stimmte zu.
Zugegeben, ein bisschen aufgeregt war ich schon, als ich mit Barbara, einer Laborantin aus dem Krankenhaus in Medenin, den Bully mit allerlei Gerät voll stopfte. Barbara war mit der Louage, einem Streckentaxi, nach Tunis gekommen, um neues Gerät abzuholen.
Der beladene Bully stand abfahrt bereit auf dem Hof des Regionalbüros. Die letzten Formalitäten wurden erledigt und dann ging es ab Richtung Süden. Auf dem Rückweg sollte ich in Gafsa ein kleines Paket persönlich abgeben und die Frachtkoffer eines ausscheidenden Helfers nach Tunis bringen. Die Übernachtungsfrage war geklärt. In der Wohnung von Barbara konnte ich ein Notbett benutzen. Wieder mit von der Partie mein Teleobjektiv und die Kameraausrüstung.
„Was willst du denn damit?“ fragte Barbara erstaunt, als sie die Tasche mit dem herausragenden Schulterstativ sah.
„Ach, dass ist für meine Verteidigung. Ist die Kamera angeschraubt, was meinste, wie ich damit zuschlagen kann.“
Barbara navigierte den Bully aus der Stadt und fuhr das erste Stück über Land. Das gab mir Gelegenheit in Ruhe die Landschaft auf mich wirken lassen. Es ging immer wieder vorbei an den Zeugen einer sehr alten Zivilisation, die gelegentlich als Schuppen oder Stall herhalten musste. Ich konnte die Fahrt genießen. Die Unterhaltung drehte sich vor allem um unsere persönlichen Geschichten. Irgendwie waren wir schnell miteinander vertraut geworden.
Der Verkehr auf der Straße Nr. 4 war ruhig. Alte, klapprige Lkw, Pritschenwagen jeden Alters und jeder Marke und Eselskarren, oft so hoch beladen, dass man von hinten den Lenker nicht erkennen konnte. Diese Esel taten mir leid.
In den kleinen Ortschaften ging es vorbei an Märkten, auf denen es von Menschen wimmelte und neben den Märkten, die Plätze der Louage, den Streckentaxis, auf beziehungsweise in denen sich ebenfalls die Menschen drängten. Viele der meist alten Kombis oder Pick-ups waren bereits stark beladen. Barbara erklärte mir, warum die Taxis trotzdem nicht abfuhren. Nur wenn möglichst alle Plätze besetzt sind, wird das Taxi die Fahrt antreten. Mit viel Geld könnte man die Fahrer natürlich auch dazu bringen, sofort ab zufahren. Dann sei aber der Preis für alle noch freien Plätze fällig.
Ein wichtiges arabisches Wort lernte ich, als wir auf einem der Märkte eine Pause einlegten. Der Bully war durch das Kennzeichens, als ein von Ausländern benutztes Fahrzeug zu erkennen. Nicht nur im Land arbeitende Ausländer benutzten Fahrzeuge mit diesen Nummern, auch die Touristen. Die Kinder hatten gelernt, dass man von den Touristen schnell ein Cadeau, ein Geschenk, bekommen konnte und so wurde auch unser Bully von Kindern belagert. Barbara öffnete die Tür und schon schrie die ganze Bande „Cadeau, Cadeau“ und streckte ihr die Hände entgegen. Nach einem scharf gesprochenen “Baraua“ verstummte die Bande, sah Barbara erstaunt an und zog sich zurück. Als die Kinder bemerkten, dass wir den Markt besuchen wollten, unternahmen drei ältere Jungen einen neuen Versuch an etwas Geld zu kommen. Sie boten sich an, auf das Fahrzeug aufzupassen, damit nichts geklaut werde. Barbara erklärte ihnen, dass Tunesien ein ehrliches Land sei und im übrigen würden Diebe nur das eigene Land bestehlen, denn alles was in dem Wagen von Wert sei, gehöre der Regierung.
Wir besuchten den Markt und deckten uns mit frischen Datteln und Obst ein. Als wir zum Auto zurück kamen, stand die Jungentruppe wieder oder noch am Bully und erklärte, sie hätte auf das Auto aufgepasst. Natürlich in der Hoffnung auf ein paar Dinar 4 oder Milim. Barbara bedankte sich nur höflich bei Ihnen und wir setzten die Fahrt fort.
Die Möglichkeit, kreuz und quer durch das Land zu reisen, gefiel mir. So konnte ich das Land in kurzer Zeit kennen lernen. Den Kollegen in den Projekten blieben dazu nur die freien Tage. Es dauerte nicht lange und ich hatte den Job als „Versorger“. Wann immer möglich legte ich die Fahrten auf ein Wochenende, so blieben mir meistens zwei zusätzliche Tage am jeweiligen Ort. Die Kollegen kannten sich aus, und ich kam in Bereiche, die den Touristen verborgen blieben. Natürlich erfuhr ich auf diesen Fahrten auch viel privates, nicht alles zur Verbreitung bestimmt. Dass ich in dieser Hinsicht verlässlich war und vieles für mich behielt, schätzten die Kollegen besonders.
Neben dem Job als „Versorger“ hatte ich auch weiterhin mit Madame Leconte französisch zu lernen und aus dieser Arbeitsgemeinschaft entwickelte sich langsam mehr als eine Lehrer-Schüler-Beziehung.
Ich war weitgehendst mein eigener Herr und niemand redete mir drein. Doch fragte ich mich immer häufiger, wie lange das wohl so weitergehen sollte. Die Verhandlungen über das Projekt schleppten sich hin. Meine Maurerkollegen wurden unruhig und bei ihnen kam Frust auf. Ihnen fehlte eine Aufgabe.
♦
Nach nunmehr über zwei Monaten warten, hatten wir Maurer einen Termin beim Regionaldirektor und erfuhren, dass unser Projekt nicht weitergeführt werde. Wie es für uns drei weitergehen könne, erklärte man uns auch. Der DED würde die Verträge auflösen und die Heimreise buchen. Allerdings gebe es für eine Person die Möglichkeit, ein Projekt beim Aufbau von landwirtschaftlichen Beratungsprojekten im Tschad zu übernehmen. Der Haken dabei, in diesem Land gab es noch keine Organisationsstruktur des DED. Wer dort hinging, wäre der erste DED’ler, der dort dauerhaft eingesetzt wird. Die Entscheidung, das Land zu wechseln, sei freiwillig, niemand würde bei Nichtannahme irgendwelche Nachteile erfahren. Es gebe etwa zwei Wochen Zeit, sich über das Land zu informieren und eine Entscheidung zu treffen. Alle Möglichkeiten des Regionalbüros stünden in vollem Umfang zur Verfügung. Meinem Tagebuch vertraute ich meinen Frust an.
“Heute gab es den großen Knall. Tunesien ist fini !!! Scheiße!!! Nun hocke ich da und muss mich entscheiden, für Tschad oder Heimreise. Was ist die kleinere Scheiße? Blöd, dass ich mit keinem darüber sprechen kann. Gerade heute habe ich einen Brief von Elke erhalten, und sie schreibt, dass sie alles in Bewegung setzen will, um hierher zu kommen. Ich will mal sehen, vielleicht rufe ich in Deutschland an. Das Projekt im Tschad ist schon interessant, es bietet mehr Selbstständigkeit, ich muss alles selbst erledigen.





























