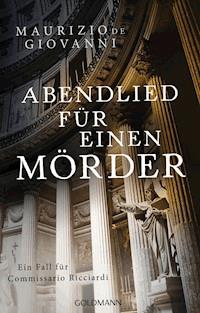
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissario Ricciardi
- Sprache: Deutsch
Neapel in den 30er Jahren: In einer dunklen Gasse wird der gutsituierte Signor Irace zu Tode geprügelt. Seine Witwe, die hübsche Concetta, ist untröstlich. Schon bald gibt es einen Verdächtigen: Vincenzo Sannino, einst ein armer Straßenjunge, der unsterblich in Concetta verliebt war, aber keine Chance hatte, sie zu heiraten. Er wanderte nach New York aus, machte Karriere als Boxer. Nun ist er nach Neapel zurückgekehrt, und seine Liebe zu Concetta ist ungebrochen. Der Fall scheint damit klar, zumal Vincenzo kein Alibi hat, und der Justizminister verlangt seine Festnahme. Doch für Commissario Ricciardi ist das eine allzu einfache Lösung. Und sein Kampfgeist ist erwacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Neapel in den 30er-Jahren: In einer dunklen Gasse wird der gutsituierte Signor Irace zu Tode geprügelt. Seine Witwe, die hübsche Concetta, ist untröstlich. Schon bald gibt es einen Verdächtigen: Vincenzo Sannino, einst ein armer Straßenjunge, der unsterblich in Concetta verliebt war, aber keine Chance hatte, sie zu heiraten. Er wanderte nach New York aus, machte Karriere als Boxer. Nun ist er nach Neapel zurückgekehrt, und seine Liebe zu Concetta ist ungebrochen. Der Fall scheint damit klar, zumal Vincenzo kein Alibi hat, und der Justizminister verlangt seine Festnahme. Doch für Commissario Ricciardi ist das eine allzu einfache Lösung. Und sein Kampfgeist ist erwacht.
Weitere Informationen zu Maurizio de Giovannisowie zu lieferbaren Titeln des Autorsfinden Sie am Ende des Buches.
Maurizio de Giovanni
Abendlied für einen Mörder
Ein Fall für Commissario Ricciardi
Aus dem Italienischen von Judith Schwaab
Die italienische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Serenata senza nome« bei Einaudi, Turin.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2017
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Maurizio de Giovanni
All rights reserved
This edition published in arrangement with The Italian Literary Agency and book@literary agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Dallas Stribley / getty images
Redaktion: Sigrun Zühlke
BH · Herstellung: han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-21225-4V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Severino, meinen geliebten Severino.Aus tiefstem Herzen.Und in jeder einzelnen Geschichte.
Prolog
Es gibt nicht genug Licht. Das hat der Junge schon von Anfang an gedacht, seit dem allerersten Mal. In diesem Zimmer gibt es nicht genug Licht.
Zu Beginn dachte er, der alte Mann brauche kein Licht, weil er fast blind ist, denn seine Augäpfel sind milchig weiß überzogen. Doch inzwischen ist er sich da nicht mehr so sicher. Gewiss, ein Mensch, der wenig sieht, kann sich in einer vertrauten Umgebung gut zurechtfinden und bewegt sich im Dunkeln scheinbar müheloser als jemand, der gut sehen kann. Doch dieser alte Mann, das weiß der Junge mittlerweile, ist etwas Besonderes. Und zwar in vielerlei Hinsicht.
Er empfängt ihn stets am Nachmittag und bittet ihn dann sofort, die Läden zu öffnen, die für gewöhnlich angelehnt sind. Der Junge kennt ihn mittlerweile wie im Schlaf – den Weg zum Fenster, zwischen Bücherstapeln und alten Zeitungen hindurch, an Schallplatten und Schachteln mit mysteriösem Inhalt vorbei, die sich ohne jegliche Ordnung in dem Zimmer türmen – und kommt folglich an, ohne großen Schaden anzurichten. Trotzdem denkt er immer noch, dass es in dem Zimmer nicht hell genug ist.
Die Nachricht erreichte ihn, als er gerade mit dem Spielen fertig war. Während er unter dem Applaus der Zuschauer und mit all denen im Schlepptau, die ihn um ein Autogramm bitten oder einfach nur begrüßen wollten, auf dem Weg in die Garderobe war, bemerkte er die Frau im Halbschatten, mit einem Briefchen in der Hand. Er erkannte sie nicht gleich, wie es häufig vorkommt, wenn man jemanden außerhalb eines gewohnten Zusammenhangs sieht. Dann jedoch glaubte er zu begreifen, und sein Herz setzte um einen Schlag aus. Denn der Maestro ist alt. Sehr alt.
Vorbei an den sich ihm entgegenstreckenden Händen, den lächelnden Gesichtern ging er auf sie zu. Jedes Mal öffnet sie ihm die Tür und lässt ihn herein, doch erst in jenem Moment kam es dem Jungen in den Sinn, dass er sie nie wirklich angeschaut hatte. Sie war eine kleine, unscheinbare Frau mit aufgestecktem Haar und gesenktem Blick. Sie trug einen dunklen Mantel und stand in der finsteren Ecke des Flurs, der von der Bühne in die Kulissen führte.
Der Junge wartete, den Kopf voll düsterer Vorahnungen. Die Frau reichte ihm das Briefchen. In schiefer, etwas zittriger Schrift stand da: »Morgen, achtzehn Uhr.«
Der Junge geht schon seit Monaten zu dem alten Mann. Immer hat er den Anstoß zu diesen Treffen gegeben, hat wieder und wieder hartnäckig darauf bestanden, von ihm empfangen zu werden. Und es kam nicht selten vor, dass er hinging und nur die Frau vorfand, die ihm zumurmelte: »Der Maestro kann nicht, kommen Sie morgen wieder.« Nun jedoch wurde er von ihm einbestellt; ungewöhnlich. Der Junge fragte, ob etwas passiert sei, ob es dem Maestro gut gehe, doch die Frau zuckte nur mit den Achseln und ging ohne einen Gruß davon.
Heute ist der vereinbarte Tag, und der Junge kneift an der Tür die Augen zusammen, weil das Licht ihn blendet.
Das Fenster ist offen. Der Alte steht davor, mit verschränkten Armen; sein dünnes langes, weißes Haar bewegt sich sanft im Wind. Dem Jungen läuft ein Schauder über den Rücken.
»Guten Abend, Maestro«, sagt er und zieht das Revers seines Mantels enger zusammen. Die Luft hier oben scheint ganz anders zu sein als unten auf der Straße: schneidend, kalt. Die Sonne geht unter, bald wird es dunkel, der Himmel überzieht sich mit Wolken. Das Meer, das kann der Junge von der Schwelle aus erkennen, ist aufgewühlt.
Ihm fällt auf, dass er den Alten die letzten Male, all die Monate, nie aufrecht stehen gesehen hat. Immer saß er in dem unförmigen Sessel, scheinbar versunken im Halbschlaf, bis er dann urplötzlich zu sprechen begann, als könnte er die Gedanken des Jungen lesen. Und gewöhnlich war er auch warm angezogen, selbst an den heißesten Sommertagen, das Hemd bis zum Hals zugeknöpft, dazu eine Weste und eine leichte Decke über den Beinen. Jetzt jedoch steht er dort am Fenster, mitten in dem Wind, der ins Zimmer hereinweht. Ein paar Blätter Papier von dem Stapel hinter seinem Rücken segeln zu Boden. Der Junge hüstelt, macht einen Schritt nach vorn und sagt: »Maestro, ich bitte Sie, es ist kalt. Schließen wir das Fenster, und setzen Sie sich doch. Spüren Sie denn nicht den Wind?«
Der Alte dreht sich nicht einmal um; die milchigen Augen scheinen einen Punkt zwischen Himmel und Meer zu fixieren. Ernst sagt er: »Das ist nicht der Wind. Das ist der Herbst. Du kennst ihn, den Herbst?«
Der Junge hat gelernt, dass es auf gewisse Fragen des Alten, die dem ersten Anschein nach unverständlich sind, keine richtige oder falsche Antwort gibt. Eine Weile dachte er, der alte Mann sei ein wenig senil, habe keinen rechten Kontakt mehr zur Wirklichkeit und könne ihm nichts beibringen. Bis er dann erkannte, dass er in der einen Stunde, die er in diesem Zimmer voller alter Dinge zubringt, mehr lernt als in hundert Unterrichtsstunden bei berühmten Musikprofessoren.
»Ich weiß, was alle wissen, Maestro. Es ist eine Jahreszeit des Übergangs, zwischen Sommer und Winter. Oft regnet es, und es gibt heiße Tage und kalte Tage. Die Schule fängt wieder an. Das weiß ich.«
Aber die Musik? Wann reden wir endlich über Musik? Dafür bin ich hier. Warum hast du mich rufen lassen?
Der Alte dreht sich halb um.
»Eine Jahreszeit des Übergangs, sagst du. Nein. Das ist nicht so. Der Herbst ist der Anfang. Der Herbst ist das Ende. Und weißt du, warum?«
Endlich. Endlich redet er wieder über Musik, denkt der Junge und erschaudert. Er erinnert sich an etwas, das mit Musik zu tun hat. Einmal, als es noch heiß war und durch das angelehnte Fenster der Geruch des Meeres hereinkam, hat der Alte zu ihm gesagt: »Wenn wir über Gefühle sprechen, sprechen wir über Musik; das darfst du niemals vergessen.« Und der Junge vergisst es auch nicht.
»Denn der Herbst steht für Verlust. Deshalb.«
Der Alte schlägt einen anderen Ton an, als er das sagt. Einen Ton voller Geschichten, voller Erinnerungen. Einen Ton voller Aufbruch, aber ohne Rückkehr. Doch auch der Junge ist Künstler, und seine Seele erschaudert.
»Verlust, Maestro? Was für ein Verlust denn?«
Jetzt dreht sich der Maestro ganz um und schaut ihn zum ersten Mal an. Der Wind ändert die Richtung, in der die langen weißen Haare wehen. Die Hälfte des Gesichts ist vom Sonnenuntergang beleuchtet, rötlich wie Blut, die andere Hälfte liegt im Dunkeln; ein Antlitz voller Schatten und Niederlagen und Falten. Erst jetzt bemerkt der Junge das Instrument, das der Alte in den Händen hält, oben am Griff, wodurch es wie eine Verlängerung seines Arms aussieht: eine Prothese aus Fichtenholz, bauchig und mit vier Saitenpaaren bespannt.
Als er die Mandoline erblickt, trifft es den Jungen wie ein Peitschenschlag. Seine Muskeln erstarren, ein Beben durchläuft ihn, während seine ausgehungerte Seele sich bereitmacht, jeden Akkord, jede Variation, jeden Ton in sich aufzunehmen, die jene verkrümmten Finger dem Instrument wie durch Zauber entlocken. Dafür ist er hier, der Junge. Um genau diesen einzigartigen Klang zu erlernen. Denn all die Menschen, die kommen, um seine Stimme zu hören, die ihn anbeten wie einen kleinen Gott, wissen nicht, dass die wahre Musik, für die er ein Bein opfern würde, wenn er sie spielen könnte, dass diese Musik in einem kleinen Zimmer in einem Haus am Hügel zu Hause ist, und dass sie den gichtigen Händen eines alten Mannes entspringt, der sie mit niemandem teilen will. Und der Junge geht dorthin, um sie ihm zu entringen, Note für Note und immer in der Hoffnung, dass der Zauber eines Tages auf ihn übergeht.
Der Junge spricht voller Behutsamkeit, die Augen wie gebannt auf das Instrument gerichtet, als fürchtete er, der Alte könnte einem plötzlichen Impuls folgen und es aus dem Fenster werfen.
»Der Verlust, ja. Erzählen Sie mir von dem Verlust, Maestro, der mit dem Herbst kommt?«
Der Alte lächelt ihn an und sieht auf einmal aus, als wäre er verrückt, auf eine liebenswerte, verzweifelte Weise verrückt. »Aber ich werde dir doch nicht davon erzählen, vom Verlust. Denn der Verlust, weißt du, steckt in dem Lied.«
»Welchem Lied?«, fragt der Junge. Er hofft, dass der alte Mann ein unbekanntes Lied aus dem Ärmel schüttelt; es wäre wundervoll, wenn er es in sein Repertoire aufnehmen könnte. Den Leuten würde der Mund offen stehen bleiben.
Statt einer Antwort nimmt der Alte in einer einzigen fließenden und entschlossenen Bewegung und mit absoluter Sicherheit die Mandoline zur Hand. Der Junge erkennt, dass es eine Bewegung ist, die er schon Tausende, vielleicht Millionen von Malen gemacht hat, eine schlichte und endgültige Geste. Spielen hat er den Alten immer im Sitzen gesehen; niemals hätte er gedacht, er könne das Instrument halten, ohne es auf dem Knie abzustützen. Und doch tut er jetzt genau das, dort im Licht des Sonnenuntergangs und im Herbstwind, ohne zu schwanken und ohne sich festzuhalten. Normalerweise schaut der Alte nicht auf seine Hände, nicht auf die Saiten. Gewöhnlich ist sein Blick irgendwo in die Ferne gerichtet, auf einen Punkt weit entfernt in Zeit und Raum, als wäre er irgendeiner verlorenen Erinnerung, einem irrlichternden Gedanken auf der Spur. Jetzt hingegen sind die verschleierten Augen direkt auf den Jungen gerichtet, begleitet von einem verhaltenen, traurigen Lächeln.
Der Alte schlägt ein paar Akkorde an, und der Junge erkennt sofort die Melodie. Er tut es mit einer gewissen Enttäuschung, denn das Lied ist nicht nur bekannt – es gehört zu den bekanntesten, ist vielleicht das berühmteste überhaupt.
Doch wie immer in diesem staubigen Zimmerchen, in dem die Musik zu Hause ist, zerreißt schon der erste Ton ihm das Herz. Und die berühmte Einleitung wird zu etwas, das neu und alt zugleich ist, etwas, das man mit bittersüßer Wehmut wiedererkennt und doch so noch nie gehört hat.
Plötzlich hält der alte Mann inne, als hätte ihm jemand etwas ins Ohr geflüstert. Er dreht sich zum Wind um. »Ja«, sagt er. »Hier ist der Verlust. Die Verzweiflung des Verlusts.«
Der Junge schüttelt den Kopf. »Maestro, aber wieso Verlust? Das ist doch eine Serenade, oder? Es ist eine Klage, ein Lied über Kummer und Leid, das verstehe ich. Aber Verlust?«
Der Alte seufzt. Er tritt ans Fenster, wo aus dem Sonnenuntergang Abend geworden ist. Dann schlurft er zu seinem Sessel, setzt sich und legt sich die Decke über die Beine, doch das Instrument lässt er nicht los.
Er spricht leise.
»Dieses Lied«, sagt er, »dieses Lied spielst du gut, und du singst es gut. Und doch ist es das Lied, bei dem du den größten Fehler machst.«
Der Junge denkt an den Applaus, an die gebannte Stille im Publikum, an den Jubel, wenn er zu Ende gespielt hat. An die Tatsache, dass es genau das Stück ist, das am häufigsten gewünscht wird und das er sich immer als letzte Zugabe aufhebt. Und wieder einmal fragt er sich, wann der Alte ihn singen gehört hat.
»Maestro«, fragt er, »wo mache ich einen Fehler? Ich halte mich doch genau an die Original-Partitur, und ich singe sie komplett … Es gibt Kollegen, die nur zwei Strophen singen. Wenn Sie mir erklären könnten …«
»Du machst einen Fehler. Weil du den Verlust außer Acht lässt, der darin steckt. Der Schlüssel zu der Geschichte, die da erzählt wird, ist der Verlust. Er steht unter ihrem Fenster und singt, weil er sie verloren hat.«
Der Junge flüstert: »Aber nein, Maestro. Er hat sie nicht verloren. Sie werden doch heiraten, und in Wirklichkeit …«
Der Alte schlägt mit der flachen Hand auf das Gehäuse der Mandoline; ein harter, wütender Schlag. Wie ein Schuss.
»Nein! In dem Moment, wo er das Lied schreibt, hat er sie verloren. Du machst immer wieder den gleichen Fehler, weil du glaubst, ein Lied sei ein Lied und würde nur geschrieben, um gesungen zu werden. Aber so ist es nicht. Das Lied ist eine Botschaft, verstehst du das nicht? Eine Botschaft. Sie hat geheiratet, und er hat sie verloren. Und es ist Herbst, und falls es das nicht ist, fühlt es sich jedenfalls so an. Es ist vorbei, verstehst du das nicht? Vorbei!«
Der Junge zieht den Kopf ein, überrascht von der Heftigkeit dieser Stimme, die in dem kleinen Zimmer widerhallt, voller Wut und Groll. Was will der eigentlich?, fragt er sich. Ich hätte gute Lust, einfach hinzuschmeißen und zu gehen, mir reicht’s allmählich! Wer glaubt er denn, dass er ist?
Doch der Alte wettert weiter.
»Das ist doch der Grund, warum du singst, willst du das nicht endlich begreifen? Du singst, um bis in alle Ewigkeit diese Geschichte zu erzählen. Du singst jeden Abend, um den Menschen dieses Gefühl zu vermitteln. Sie zählen nichts, die jungen Dinger, die ins Konzert kommen, um dich singen zu hören, und auch die Männer und Frauen nicht, die dir stehend applaudieren. An diesem Lied ändert sich nichts, ob du es allein singst, ob auf dem Abort oder eben auf jener Bühne. Die Geschichte ist nicht deine, aber du sollst sie erzählen. Er steht auf der Straße, mitten in der Nacht; sie steht hinter einem Fenster, zusammen mit dem Mann, den sie hat heiraten müssen. Er weiß von ihrem Schmerz, weiß, dass sie sich damit abfinden muss; er will ihr nicht wehtun, aber schweigen kann er auch nicht. Er kommt nicht von ihr los. Er kann sie nicht loslassen.
Er hat das Lied in nur einer Stunde geschrieben, wie in hohem Fieber, und sein Freund hat in einer einzigen Stunde dazu die Musik geschrieben. Dort in der dunklen Stille des Abends, im kalten Herbstwind, ist derjenige, der singt, wie ein geblendeter Vogel, der seine Gefährtin verloren hat. Für immer, daran zweifelt er nicht. Er wird nie mehr glücklich sein. Er ist ein zum Tode Verurteilter, der mit diesem Lied seinem Leben nachweint. Er wartet darauf, dass das Licht im Fenster erlischt, was der Anfang ewiger Verdammnis für ihn sein wird, und dann sagt er ihr, warum er dort steht. Er singt ihr vom Verlust. Er singt ihr vom Herbst.
Hör mir zu.«
Der Alte greift erneut das Instrument, und der Junge spitzt unwillkürlich die Ohren und lauscht. Wie Schmetterlinge huschen die Finger des Alten über den Griff der Mandoline, in seltsamen Positionen, weil sie so krumm und deformiert sind. Während er spielt, schaut er ihm ins Gesicht, als hätte er das Erzählen ganz der Mandoline überlassen und müsste es nur noch unterstreichen, das wogende Auf und Ab der Musik, die in Richtung Meer strömt wie der unberechenbarste aller Flüsse.
Dann beginnt er flüsternd den Text zu sprechen. Und der Junge flüstert ihn mit, die Augen weit aufgerissen in der Dämmerung, die durch das Fenster hereinflutet.
Si ’sta voce te scéta ’int’a nuttata,
mentre t’astrigne ’o sposo tujo vicino,
statte scetata, si vuó’ stá scetata,
ma fa’ vedé ca duorme a suonno chino.
Nun ghí vicino ê llastre pe’ fá ’a spia,
pecché nun puó’ sbagliá ’sta voce è ’a mia …
E’ ’a stessa voce ’e quanno tutt’e duje,
scurnuse, nce parlávamo cu ’o »vvuje«.
(Wenn diese Stimme dich des Nachts weckt,
Während du dich an deinen Bräutigam schmiegst,
So bleibe wach, wenn du wachbleiben willst,
Doch gib vor, tief zu schlafen.
Geh nicht ans Fenster, um hinauszuspähen,
Denn irren kannst du nicht: Diese Stimme ist meine.
Es ist dieselbe Stimme wie damals
Als wir uns vor Scheu noch siezten.)
Die Stimme des Alten ist voller Wärme, voller Schmerz. Es ist eine Stimme ohne Alter und doch uralt, vibrierend, schwebend, in Nächten voller Schmerz. Nächten ohne Schlaf.
Herbstnächten.
I
Cettina wich keinen Augenblick vom Fenster. Er hatte ihr gesagt, dass er kommen würde, und noch nie hatte er ein Versprechen nicht gehalten. Doch jetzt hatte er sich bereits verspätet, und sie fürchtete, ihre Eltern würden aus dem Geschäft nach Hause kommen; dann könnte sie nicht mehr mit ihm reden.
Sie war mit dem Abwasch fertig und hatte das Abendessen gekocht. Dann hatte sie sich gekämmt, das lange Haar zu einem Zopf geflochten und ihn am Hinterkopf festgesteckt; das Hütchen lag griffbereit.
Das Wetter verhieß nichts Gutes, doch noch regnete es nicht. So ist das im Oktober, dachte Cettina, ein Tag schön, ein Tag schlecht.
Wohl zum hundersten Mal ging sie vor den großen Spiegel im Flur und überprüfte, ob alles in Ordnung war. Das Kleid aus braunem Musselin, die weiße Bluse. Schlicht genug, damit es nicht aussah, als wollte sie ausgehen, falls die Eltern vor seinem Eintreffen nach Hause kamen, aber elegant genug, um nach draußen zu gehen und ihn zu treffen.
Cettina war fünfzehn und machte sich Sorgen. Denn Cettina war verliebt und fürchtete, ihren Liebsten schon bald zu verlieren. Doch sie war entschlossen, um ihn zu kämpfen.
In den vergangenen anderthalb Jahren hatte der Krieg schon viele Männer von zu Hause weggeholt, und viele andere würde er noch in den Tod reißen. Damit war nicht zu scherzen. Viele würden nie zurückkehren, andere kamen verwundet nach Hause, ob von Granatsplittern oder Mörsern zerfetzt. Für Cettina war dieser Krieg unbegreiflich. Das war er für fast alle Frauen, die zu Hause geblieben waren, um ein halbwegs normales Leben aufrechtzuerhalten, und mit bis zum Halse klopfendem Herzen auf einen bekannten Schritt oder ein Telegramm warteten. In diesem Krieg ging es um ein Land, das viel zu weit entfernt war, um es Heimat nennen zu können, um Orte, für die es sich womöglich gar nicht lohnte, sein Leben zu lassen; und nur die Alten, die einen anderen König und eine andere Nation in Erinnerung hatten, schwärmten in ihren Erzählungen von einer längst verblichenen Größe, was es nur noch schwerer machte, die Gründe für einen Konflikt zu begreifen, der für viele kaum mehr hinnehmbar war.
Cettinas Vater war lungenkrank und deshalb nicht einberufen worden. Ihr Bruder war jünger als sie und folglich ebenfalls nicht in Gefahr, weshalb es Cettina bislang erspart geblieben war, mit vor Angst klopfendem Herzen auf ein Telegramm zu warten.
Vincenzo jedoch war siebzehn. Er war kerngesund, seine schwarzen Augen blickten lebhaft und kühn, und sein sehniger Körper war stark genug, um schwere Getreidesäcke von Karren zu laden oder ganze Schiffsladungen Stoffballen zu löschen. Vincenzo lief Gefahr, an die Front geschickt zu werden, wenn der Krieg noch länger dauerte. Dieser verfluchte Krieg, der einfach nicht enden wollte.
Vincenzo, den sie vor einem Jahr im Sommer kennengelernt hatte, an einem Brunnen, an dem er sich erfrischt hatte, während sie einer Freundin beim Wäschewaschen geholfen hatte. Vincenzo, der sie dort in der Sonne angelacht und mit seinen schneeweißen Zähnen und der dunklen Haut gleich verzaubert hatte. Vincenzo, an den sie auf der Stelle und für immer ihr Herz verloren hatte.
Sie hatten viel geredet. Er hatte ihr versprochen, zu ihrem Vater zu gehen, sobald er die Mittel hätte, um ihr ein Leben zu ermöglichen, wie sie es jetzt führte. Cettina hatte ihm gesagt, sie schere sich um nichts und niemanden und wolle einzig und allein mit ihm zusammen sein, Hand in Hand unter einem Himmel voller Sterne, die des Nachts das Meer zu einer weichen Decke machten. Er hatte sie gebeten zu warten, und sie hatte ihn gebeten, sich zu beeilen.
Und dann jetzt diese Sache mit Amerika.
Diese Geschichten über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Diese Hirngespinste von Reichtum, für jeden greifbar, der Lust hatte zu arbeiten …
Lass mir Zeit bis zum Ende des Krieges, sagte er wieder und wieder. Und sie sah sich selbst warten, das Herz bis zum Halse klopfend.
Denn genau dieser Gedanke war der schlimmste von allen. Wer bin ich schon?, fragte sie ihn. Wenn du in den Krieg ziehen würdest, müsste ich deine Mutter vor dem Haus abpassen, um zu erfahren, ob dir etwas zugestoßen ist. Niemand würde zu mir kommen und es mir sagen. Der Gedanke, ausgeschlossen zu sein und niemals etwas zu erfahren, war für sie so schrecklich, dass sie schließlich dieser Idee mit Amerika zugestimmt hatte.
Zum zigsten Mal ging sie zum Fenster und schaute auf die Straße hinaus. Nichts. Immer noch nichts.
Cettina spürte die Blicke ihres Bruders und des Vetters auf sich, die am Tisch saßen und Karten spielten. Sie tat unbeschwert, doch Michelangelo und Guido durchschauten sie.
Mit gespieltem Desinteresse fragte ihr Vetter: »Wartest du auf jemanden, Cettina?«
»Aber nein, wo denkst du hin? Ich schaue, ob Mama und Papa kommen.«
Michelangelo, ihr Bruder, zeigte kichernd auf die Pendeluhr, die an der Wand hing. »Aber dafür ist es noch zu früh. Um sieben machen sie das Geschäft zu, und du weißt ja, dass sie mindestens eine halbe Stunde für die Abrechnung brauchen. Vor acht sind sie nicht zu Hause.«
Guido schaute sie ausdruckslos an und sagte: »Cettina wartet ja gar nicht auf eure Eltern. Wer weiß, auf wen sie wartet.«
Manchmal war ihr Guido unheimlich. Er war ein guter Junge, zwei Jahre älter als sie; erst hatte er seinen Vater verloren, dann die Mutter, Cettinas Tante mütterlicherseits, und seither lebte er bei ihnen. Doch er war schweigsam, immer in Gedanken und mit einem Buch in der Hand; in der Schule war er einer der Besten, aber Freunde hatte er keine.
»Auf niemanden. Ich warte wirklich auf niemanden. Höchstens Maddalena, meine Freundin; sie hat gesagt, sie kommt vielleicht kurz vorbei. Schauen wir mal, ob sie es noch schafft.«
Von einem Moment auf den nächsten. Vincenzo konnte von einem Moment auf den nächsten fort sein. Er hatte ihr gesagt, ein älterer Freund von ihm würde als Matrose auf einem Amerikadampfer anheuern und könne ihn an Bord in die dritte Klasse schmuggeln, sodass er nicht einmal bezahlen müsse. Gewiss, er müsse sich die ganze Überfahrt verstecken, doch der Freund würde ihm zu essen bringen, und so würde er es schaffen. Diese großen Dampfschiffe seien immer überfüllt, niemand würde einen blinden Passagier bemerken.
Jetzt, wo die Abreise in den Bereich des Möglichen gerückt war, wurde sich Cettina bewusst, dass sie nie wirklich daran geglaubt hatte. Es konnte einfach nicht sein, dass Vincenzo wegging. Dass sie ihn monatelang, ja vielleicht jahrelang nicht mehr sehen würde. Und wer garantierte ihr, dass es in Amerika nicht genauso gefährlich war wie im Krieg? Und wenn er in schlechte Kreise geriet? Wenn man ihn zwang, dort zu bleiben, und er nie mehr zurückkonnte? Wenn er auf Indianer traf, von denen es hieß, sie seien blutrünstige Wilde oder, wie manche sagten, sogar Kannibalen?
Und wenn er, was am allerschlimmsten wäre, eine Frau traf, die ihm besser gefiel als sie?
Ein scharfer Pfiff unterbrach sie in genau diesem Gedanken. Cettina konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. In aller Seelenruhe griff sie nach ihrem Hütchen und sagte: »Ich gehe Maddalena schon mal entgegen. In fünf Minuten bin ich wieder da, sie soll mir nur den Titel eines Buches sagen, das ich lesen will. Guido, du bleibst bei Michelangelo, ja?«
Sie öffnete die Tür, ohne sich um die Blicke des Bruders und des Vetters zu scheren, die ihr folgten.
Vincenzo nahm ihre Hände. Es pfiff ein eisiger Wind in der Toreinfahrt. Cettina weinte und weinte.
»Cettina, warum weinst du denn so? Waren wir uns denn nicht einig?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Nein, wir waren uns nicht einig! Du hast das ganz allein beschlossen. Und jetzt kommst du und sagst mir, dass es heute Nacht ist. Wir haben doch so lange über all das geredet, was wir machen wollen: über unsere Träume, ein Haus, Kinder …«
Er unterbrach sie lebhaft: »Und? Das gilt doch alles immer noch, und wie das gilt! Und wir machen alles zusammen, so wie wir gesagt haben, wie wir es uns geschworen haben. Ich geh doch aus genau diesem Grund dorthin, oder? Um Geld zu verdienen, damit wir …«
»Aber es gibt doch viele andere Möglichkeiten! Ich kann mit Papa reden, du kannst bei uns im Laden arbeiten, und …«
Vincenzo lachte. »Ja, ja, Stoffkarren beladen und entladen. Sklavenarbeit.«
»Erst mal ja, aber dann könntest du Verkäufer werden, und in ein paar Jahren vielleicht …«
Vincenzo drückte ihre Hände noch fester. »Ich werde das Geschäft deines Vaters kaufen. Ich gehe nach Amerika, mache jede Menge Geld, und dann komme ich zurück und übernehme es. Dafür kämpfe ich – um reich zu sein und deiner würdig.«
Cettina schüttelte den Kopf. »Aber begreifst du denn nicht, dass mir Geld überhaupt nicht wichtig ist? Was soll ich denn hier ganz allein machen, ohne dich?«
»Du wartest auf mich. Das machst du. Oder ist es dir lieber, wenn sie mich in den Krieg schicken, und ich komme in einem Sarg zurück oder im Rollstuhl, ohne Beine? Willst du das etwa?«
Cettina schluchzte. »Vielleicht geht der Krieg ja zu Ende. Vielleicht ziehen sie dich nicht ein. Oder sie ziehen dich ein, und es passiert nichts. Don Arturo, der Mann von Rosina, schreibt ihr jede Woche, und es geht ihm blendend; er sagt, so gut hat er noch nie gegessen.«
Vincenzo schnaubte. »Vielen Dank auch, der ist in Bologna stationiert und sieht die Front nicht einmal aus der Ferne, weil er schon alt ist. Solche wie mich schicken sie direkt in den Schützengraben, wo sie von österreichischen Kanonen beschossen werden. Ich verstehe dich einfach nicht. Du sagst, dass du mich gernhast, und willst mich trotzdem in den Tod schicken.«
Unter Tränen schüttelte das Mädchen heftig den Kopf. »Nein, das will ich nicht. Aber ich will auch nicht, dass du weggehst.«
»Dann komm mit mir. Geh mit mir zusammen weg.«
Cettina fuhr erschrocken hoch. »Bist du verrückt? Wie soll ich das denn meiner Mutter und meinem Vater beibringen? Die würden daran zugrunde gehen.«
Der junge Mann lächelte bitter. »Klar. Weil es dir gut geht. Ihr habt das Geschäft, seid reiche Leute. Du und dein Bruder und dein Vetter, dieser Holzkopf, ihr werdet noch genug haben, wenn dein Vater, irgendwann in hundert Jahren, unter der Erde ist. Aber ich? Was kriege ich denn, wo mein Vater schon gestorben ist, als ich zwei Jahre alt war, und ich meine Mutter durchbringen muss?«
Er schwieg einen Moment und fuhr dann mit ernster Miene fort: »Ich schwöre dir, eines Tages komme ich und hole dich. Das schwöre ich dir. Aber du musst mir sagen, dass du auf mich wartest.«
Cettina schaute ihn mit großen, verweinten Augen an.
»Ich weiß nicht, ob ich auf dich warte, Vincenzo. Ich will ein Zuhause, Kinder. Ich will nicht meine ganze Jugend damit verbringen, aufs Meer hinauszuschauen und auf einen Brief zu warten. Wenn du jetzt gehst, weiß ich nicht, ob du mich noch vorfindest, wenn du zurückkommst.«
Vincenzo biss sich auf die Lippen und wich vor ihr zurück, als hätte sie ihn geohrfeigt. Dann nickte er und sagte: »Ich komme zurück und hole dich, Cettina. Ich komme wieder. Und du wartest besser auf mich.«
Er nahm sie an den Schultern und gab ihr einen Kuss, mit der ganzen verzweifelten Wut eines Menschen, der dabei ist, jemanden zu verlieren.
Dann lief er davon.
II
Für den Jungen war es eine freudige Überraschung gewesen, als Alfonso ihn gerufen hatte, denn Ständchen brachte man normalerweise im Spätfrühling oder im Sommer, wenn die Nächte warm waren und die Fenster offen standen.
Im Sommer war es einfach. Man ging durch die Straßen und Gassen, wo die Frauen selbst zu vorgerückter Stunde vor den ebenerdigen Wohnungen saßen, um zu plaudern und der schrecklichen Hitze zu entfliehen, nur allzu bereit, ihm zuzulächeln, wenn sie die beiden Musikanten mit den Instrumenten in der Hand vorbeigehen sahen. »Na, junger Mann, wohin des Wegs? Wer ist denn die Glückliche? Wer hat dich gerufen?« Und dann suchte man sich eine Ecke, hielt die Nase in die Luft, um Wind und Akustik zu prüfen und dafür zu sorgen, dass das Lärmen der vorbeifahrenden Droschken und andere Geräusche weit genug weg waren. Denn es war wichtig, dass die Klänge und Worte genau zu dem Menschen getragen wurden, der sie hören sollte, ohne Missverständnisse oder Zweifel.
Der Sommer ist der richtige Moment, überlegte der Junge. Wenn die Nachtluft nach Blüten und Meer duftet, wenn die Sterne am Himmel stehen wie ein andächtiges Publikum, und sich niemand über ein bisschen Musik beschwert, weil am nächsten Morgen nur ein weiterer, träger Tag dämmert. Der Auftraggeber beschließt, etwas zu tun, was er noch nie getan hat, außer in den eigenen vier Wänden, und legt alles, was er sagen will, in ein Lied, das irgendwann von irgendjemandem geschrieben wurde, liest beim schummrigen Licht einer Laterne, die in der leichten Brise hin und her schaukelt, die Worte von einem mehrfach gefalteten Blatt Papier ab. Oder er vertraut sich gleich einer anderen Stimme an, weil er nicht singen kann oder sich nicht lächerlich machen will, oder weil er weiß, dass die Bedeutsamkeit eines Textes durch eine Stimme, die vor Erregung brüchig ist, zunichtegemacht werden kann.
Eine Serenade hat das Recht auf Perfektion, oder zumindest auf das Bemühen darum.
Und so hatte sich der Junge eigentlich bereits damit abgefunden, mit dem Ende der schönen Jahreszeit diese lukrative Möglichkeit zu verlieren, denn der Wind, die Kälte, die geschlossenen Fenster ebenso wie der Kampf ums tägliche Brot, der die Menschen am nächsten Tag erwartete, würden ihnen die Freude über ein paar gedichtete Worte verleiden. Um über die Runden zu kommen, spielte er dann wieder in Restaurants und Cafés, wie die anderen Musiker, trat als fahrender Sänger oder als Begleitprogramm in kleinen Theatern auf; alles Tätigkeiten, für die man immerhin eine warme Mahlzeit und ein wenig Trinkgeld bekam. Doch in Gedanken war er viel lieber zu den Serenaden unterwegs, denn es machte ihm Freude, die Aufregung eines Verliebten zu teilen und ein zartes Gefühl auf seinem Weg von einem Herzen zum anderen zu begleiten.
Was ihn dabei immer erstaunt hatte, war der ganz besondere Zauber der Sprache, der in diesem Ritual des Ständchens lag. Es war wunderschön zu sagen, dass man ein Ständchen »bringt«, nicht etwa singt. Man bringt es. Ja, denn es ist eine Botschaft. Wie ein Brief, den man mit einem langen Gänsekiel auf cremefarbenes Papier schreibt und eben nicht dem Briefträger anvertraut, sondern der Musik.
Für eine Serenade wandte man sich an eine Gruppe von Musikern, die man concertino nannte, oft ein Terzett. Eine Gitarre, vielleicht zwei, und eine Mandoline. Wenn der Absender der Botschaft sich nicht dazu in der Lage sah, selbst zu singen, lieh ihm einer der Gitarristen seine Stimme. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts und noch bis vor etwa zwanzig Jahren, als die Gassen und Plätze der Stadt allabendlich von Serenaden widergehallt hatten, als würde überall etwas gefeiert. Heute jedoch war das Geld knapp geworden, und wie der Junge leider sehr wohl wusste, ging das zu Lasten der Musik. Mittlerweile beschränkte man sich auf die traditionelle Serenade, die einer Hochzeit vorausging und für die ein Nachmittag Proben im Hause des Bräutigams genügte, bevor er sich zum Singen vor das Haus seiner Angebeteten stellte, während Nachbarn und Familienmitglieder an die Fenster traten, um der Darbietung zu lauschen: ein kurzes Stimmen der Instrumente, dann eine fröhliche Einleitung und schließlich das eigentliche Lied, das mit Jubelrufen und Applaus der ganzen Straße quittiert wurde. Dann regnete es Geldscheine, Süßigkeiten und Konfekt auf die kleine Kapelle sowie allerlei doppeldeutige Anspielungen und derbe Witze über die bevorstehende Hochzeitsnacht.
Meistens gehörten den Musikkapellen alte und erfahrene Musiker an. Für solch heikle Aufführungen mit oft unvorhersehbarem Ausgang bedurfte es der Fähigkeit, sich an die Gegebenheiten anzupassen, weshalb es besser war, auf mit allen Wassern gewaschene Leute zurückzugreifen. Und das war durchaus wörtlich zu nehmen: Nicht selten hatte man von Eimern eiskalten Wassers gehört, die über den Köpfen der armen Musiker ausgeleert wurden, nur weil diese keine Ahnung hatten, dass sie im Dienste längst treubrüchig gewordener Liebhaber auftraten; von Vätern, die mit Keulen und Hämmern bewaffnet auf sie losgingen; ja, gar von rivalisierenden Freiern, die einander mit Messern oder Fäusten duellierten. Der Junge jedoch verfügte über ein bereits ausgereiftes Talent und war deshalb trotz seines jungen Alters in den Dienst Alfonsos getreten, eines der besten und bekanntesten posteggiatori, der fahrenden Sänger der Stadt. Und so kam es, dass er des Öfteren zu Serenaden gerufen wurde, ein Ruf, dem er wegen der oft saftigen Entlohnung nur allzu gerne folgte. Außerdem war der Oktober für einen Musiker der schwierigste Monat. Im Oktober hatten die Leute nur wenig Lust, sich zu amüsieren, aber er und seine Mutter brauchten trotzdem etwas zu leben, auch wenn es regnete und stürmte.
Aus all diesen Gründen lag dem Jungen besonders viel daran, dass an diesem Abend alles gut ging.
Während er den leichten Anstieg hinter sich brachte, der zu seinem Ziel führte, hatte er wieder Alfonsos aufgeregtes Gesicht vor Augen, als dieser ihn am Vorabend aufgesucht hatte. Die Gage war so gewaltig, dass er vor Staunen den Mund nicht mehr zubekommen hatte, als der alte Musikerkollege ihm erzählte, der Auftraggeber sei ein Ausländer, der auf so ungewöhnliche Weise gesprochen habe, dass er ihn anfangs für minderbemittelt gehalten hatte, bis er dann ein Bündel Geldscheine aus der Manteltasche gezogen und damit unverzüglich seine ungeteilte Aufmerksamkeit errungen hatte.
Ein Lied. Nur ein einziges Lied. Und sie würden nicht singen müssen, sondern nur begleiten. Nein, ich werde nicht singen, hatte der Mann gesagt. Da ist ein Freund von mir. Er singt. Wir erwarten euch an dieser Adresse, heute Abend um elf. Und seid pünktlich.
Der Junge hatte zwar den Verdacht, dass Alfonso ihn angelogen und den Betrag, den sie für ihre Dienste erhalten würden, heruntergespielt hatte, doch es würde immer noch doppelt so viel sein wie sonst, womit er mehr als zufrieden war. Es lohnte sich, auch wenn die Luft eisig war und das Fehlen der Sterne am Himmel darauf hindeutete, dass jederzeit mit einem Wolkenbruch zu rechnen war.
Allerdings stellte er sich die Frage, warum jemand an einem Tag wie diesem überhaupt ein solch aufwendiges Ständchen plante. Eine Hochzeit war auszuschließen, es sei denn, es handelte sich um eine Blitztrauung, die in Windeseile und ohne Vorbereitung vollzogen werden musste, weil es galt, ein verdächtiges Bäuchlein der Braut unter einem etwas weiter geschnittenen Kleid zu verbergen. Doch dann hätte eine Serenade wenig Sinn gehabt, weil in solchen Fällen alles mit größtmöglicher Diskretion geplant wurde. Wie auch immer: Ohne durch die Umstände gezwungen zu sein, heiratete wohl kaum jemand Mitte Oktober, so kurz vor der düsteren Zeit des Totensonntags. Außerdem hatte sich Alfonso klar ausgedrückt: nur ein einziges Lied. Und die berühmteste Serenade von allen.
Sobald sie sich am verabredeten Ort einfanden, so hatte der Mann mit der sonderbaren Aussprache ihm mitgeteilt, würden sie denjenigen treffen, der singen würde, und die zweite Hälfte der vereinbarten Summe ausgehändigt bekommen.
In Ordnung, paisà? In Ordnung, Landsmann. Und wie das in Ordnung war.
Und doch war die Wahl des Liedes seltsam. Es war ein quälender, ja qualvoller Text, kein glücklicher, aus dem eine rosige und strahlende Zukunft sprach. So traurig, dass man dem Lied meistens noch ein weiteres, hoffnungsvolleres Stück folgen ließ. Wer weiß, warum ihr Auftraggeber nur ein einziges Lied wünschte, und ausgerechnet dieses. Der Junge zuckte mit den Achseln, während er um die Ecke bog; wen kümmert’s, sagte er sich, Hauptsache, er zahlt, und wir können uns morgen satt essen, statt in aller Herrgottsfrühe aufstehen und uns um ein Engagement bemühen zu müssen.
Die Nacht war bereits weit fortgeschritten, und es wurde allmählich kalt, weshalb der Junge die Hände tief in die Taschen vergraben hatte. Alfonso hatte ihm erklärt, es solle eine schnelle Sache werden, darauf habe ihr Auftraggeber bestanden, deshalb würde ihm auch keine Zeit bleiben, sich die Finger mit ein paar Akkorden warmzuspielen. Die Pflastersteine auf der Straße glänzten feucht, und selbst die streunenden Hunde drängten sich in den Hauseingängen, um ein wenig Schutz vor der Kälte zu finden. Ruhig und geduldig wartete sein Instrument im Gehäuse, das er sich unter den Arm geklemmt hatte.
Alfonso war gedrungen und dicklich, ein Mann, der ständig in Bewegung war, gerne lächelte und viel schwitzte. Der Junge war groß und hager, schweigsam und nach innen gekehrt, seine langen Finger knotig. Wenn man die beiden zusammen sah, dachte man wohl eher an zwei Witzfiguren als an Musiker, doch das änderte sich sofort, wenn sie zu spielen begannen. Dann tilgte die Musik jede Äußerlichkeit, und das Herz öffnete sich anderen Sinnen, die auf einmal überhaupt nichts Komisches mehr wahrnahmen. Gewiss, die beiden verstanden es auch, andere zum Lachen zu bringen, doch am allerbesten waren sie, wenn es darum ging, von Gefühlen zu erzählen.
Im Schatten, außerhalb des schwachen Lichtkegels einer Laterne, warteten zwei rauchende Gestalten. Bei seinem Eintreffen löste sich eine davon und kam ihnen entgegen. Der Junge zuckte erschrocken zusammen, als sein Blick auf das fiel, was er bei der dürftigen Beleuchtung zunächst für eine Maske hielt: eine riesige, stumpfe und krumme Nase; eine gespaltene und offenbar mehrfach notdürftig geflickte Oberlippe; diverse Narben auf den Wangen; eine fehlende Augenbraue, an deren Stelle eine lange, rötliche Kerbe klaffte. Der Mann hatte breite Schultern, war eher groß und schien keinen Hals zu haben. Andererseits war er gut gekleidet, trug einen eleganten Hut modernen Schnitts und einen funkelnagelneuen Mantel, der leicht feucht schimmerte.
Barsch richtete der Mann das Wort an Alfonso: »Guten Abend, paisà. Danke für … für pünktlich. Danke für pünktlich sein.«
Vermutlich war die seltsame Redeweise des Mannes darauf zurückzuführen, dass er in einer anderen Sprache dachte, ging es dem Jungen durch den Kopf. Und er war so weit mit den Touristen vertraut, die in der schönen Jahreszeit die Restaurants am Meer bevölkerten, dass er einen deutlichen amerikanischen Akzent ausmachen konnte.
Alfonso grüßte den Mann mit einer knappen Verbeugung und stellte den Jungen vor.
»Das ist mein Kollege, und er spielt Mandoline. Er ist sehr gut und sehr verschwiegen, er weiß, dass er den Mund halten und niemandem etwas von heute Abend erzählen darf.«
Und das stimmte auch. Alfonso hat sich lange darüber ausgelassen, wie wichtig bei diesem Auftrag Diskretion sei, worauf der Junge nur mit einem kurzen Achselzucken geantwortet hatte; er konnte sich sowieso nicht vorstellen, wer sich für die Schilderung einer nächtlichen Serenade im Materdei-Viertel interessieren sollte.
Der Mann kam auf ihn zu, musterte ihn aus der Entfernung von wenigen Zentimetern mit zusammengekniffenen Augen. Dem Jungen lief ein Schauder über den Rücken, doch er hielt dem prüfenden Blick stand. Am Ende nickte der Fremde, als hätte der Junge ihn überzeugt, und gab dann der anderen Gestalt, die im Dunkeln wartete, ein Zeichen.
Nun trat ein Mann hervor, der wesentlich jünger als der Fremde war und anders aussah, auch wenn es einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden gab. Der Junge konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er ihn schon einmal gesehen hatte, doch er hätte nicht sagen können, wo. Der Mann war groß und athletisch gebaut, trug einen doppelreihigen Nadelstreifenanzug ohne Übermantel, dazu eine breite, gepunktete Krawatte. Die Schuhe, modisch und aus schwarzem Leder, waren staubig-matt und ein wenig zerschrammt. Er hatte eine eher dunkle Gesichtshaut, hohe Wangenknochen, die schwarzen Augen waren leicht verhangen. Den Hut hatte er sich weit in den Nacken geschoben, sodass man deutlich eine feuchte Haarsträhne sah, die ihm in die Stirn fiel.
Als er sich näherte, stieg dem Jungen der durchdringende, scharfe Geruch von Alkohol in die Nase. Der Mann war betrunken. Torkelnd machte er ein paar Schritte nach vorn, sodass sein Freund ihn stützen musste. Der Entstellte flüsterte ihm auf Englisch etwas zu, worauf er mit belegter Stimme antwortete: »Nein, Jack, nein. Ich will das machen. Ich will es machen. Gehen wir.«
Sie gingen einige Hundert Meter weiter und blieben stehen, als sie an einen kleinen Platz gelangten. Der Mann im Nadelstreifenanzug hob eine Hand und zeigte auf ein Fenster im zweiten Stock eines eleganten Palazzos. Der Junge bemerkte, wie er in der Tasche die Fäuste schloss und wieder öffnete, offenbar hatte er Lampenfieber. Urplötzlich führte der Mann zwei Finger zum Munde und stieß einen langen, durchdringenden Pfiff aus; ein Pfiff, der aus unerfindlichen Gründen in den Ohren des Jungen wie ein Klagelaut klang.
Der Mann mit dem entstellten Gesicht legte seinem Freund eine Hand auf den Arm, die der andere jedoch entschieden abschüttelte; nun stand er mit breiten Beinen und leicht schwankend mitten im Lichtkegel einer Laterne. Alfonso zog die Gitarre aus ihrem Kasten, und der Junge tat es ihm mit seiner Mandoline nach. Jack drehte sich um und legte gebieterisch einen Finger an die Lippen. Der Betrunkene nahm den Hut ab, ließ ihn zu Boden fallen und fuhr sich dann mit der Hand durchs Haar und übers Gesicht. Dann stieß er einen Seufzer aus und nickte ihnen zu.
Alfonso stimmte die ersten Töne an, und der Junge fiel gekonnt in die Melodie ein. Der Klang der Mandoline war wie das Tüpfelchen auf dem i, süß und herzzerreißend.
Alle warteten auf den Einsatz des Mannes, der ganz gewiss kein Sänger war und nicht zuletzt durch seine Betrunkenheit die herrliche Melodie eigentlich nur ruinieren konnte. Aber schließlich war er es, der bezahlte, sich vielleicht mit einem schlichten Kinderreim blamierte, doch der Junge wusste, dass sein geübtes Ohr trotzdem leiden würde, wenn es gezwungen wurde, schiefe Töne zu hören. Manchmal fragte er sich, wieso es manchen Menschen nicht bewusst war, dass sie sich keinen Gefallen taten, indem sie ausgerechnet die Frau, die sie umgarnen und bezirzen wollten, mit Katzenmusik malträtierten.
Und so war es zu seiner allergrößten Überraschung, als er entdeckte, dass der Mann tatsächlich singen konnte, und wie. Er hatte das angenehme Timbre eines Tenors, perfekt intoniert, und den Text beherrschte er auch. Doch nicht nur das.
Der Mann sang aus tiefstem Herzen. Aus den Worten, die der Junge so gut kannte, sprach ein zeitloser Schmerz, für den es keine Linderung gab. Dieser Betrunkene, das wurde dem jungen Mann mit der allergrößten Klarheit bewusst, war dabei, jenem Fenster und damit der Welt eine verzweifelte Botschaft zu schicken.
Wie vorauszusehen, gingen oben die Lichter an. Trotz der Feuchtigkeit und dem Wind wurden mehrere Läden aufgeklappt, und es zeigten sich die verschlafenen und neugierigen Gesichter von Menschen, die wissen wollten, wer da sang, und für wen.
Die erste Strophe ging zu Ende, und der Mann nahm die zweite in Angriff. Dabei hielt er die ganze Zeit den Blick auf ein Fenster im zweiten Stock gerichtet, die rechte Hand auf die Brust gelegt, die linke an der Flanke. Der Junge bemerkte, dass dem Mann Tränen über die Wangen liefen, doch seine Stimme blieb fest und sicher.
In solchen Situationen geschah es oft, dass irgendjemand sich einmischte und über den Lärm beschwerte, weil er schlafen wollte, oder die Musik mit einem Gegengesang oder sogar ein paar Frotzeleien begleitete. Diesmal jedoch war von nirgendwoher auch nur ein Laut zu hören. Das zufällige Publikum lauschte schweigend und voller Anteilnahme, vielleicht auch, weil es die tiefe Rührung wahrnahm, die den Sänger ergriffen hatte.
Zu Beginn der dritten und letzten Strophe öffneten sich endlich auch die Läden des zweiten Stockwerks, und es zeigte sich das Antlitz eines Mannes mit langen Schnurrbartenden und einem Haarnetz. Die überraschte Miene des Mannes verfinsterte sich, als ihm dämmerte, dass das Ständchen unmissverständlich und ohne jeden Zweifel ausgerechnet an sein Fenster gerichtet war. Genau mit dem letzten Vers wurden die Läden mit einem lauten Knall wieder geschlossen, der auf der ganzen Piazza widerhallte.
Das allerletzte Wort, das der Betrunkene sang, ging in einem Schluchzer unter. Alfonso hörte auf zu spielen und senkte den Kopf, während der Junge beschloss, das Lied mit einem zarten und bittersüßen Schlussakkord ausklingen zu lassen, als würde er auf einem Grab eine Blume niederlegen.
Ein Fenster nach dem anderen wurde geschlossen. Kein Kommentar, niemand lachte, nicht einmal ein Flüstern war zu hören. Eine Frau mittleren Alters warf dem Sänger eine Kusshand zu, bevor sie im Haus verschwand.
Der Entstellte trat auf seinen Freund zu und berührte ihn sanft an der Schulter. Der andere schlug die Hände vors Gesicht. Aus dem heftigen Beben seines Rückens schloss der Junge, dass er weinte.
Nur wenige Augenblicke vergingen, dann ging der Mann namens Jack zu Alfonso und drückte ihm ein Bündel Geldscheine in die Hand. Der Gitarrist lüpfte dankend den Hut, griff zu dem Gitarrenkasten, in dem er sein Instrument bereits wieder verstaut hatte, und bedeutete seinem jungen Kollegen mit einem Nicken, ihm zu folgen und den Rückweg anzutreten. Der Junge warf einen letzten Blick zu dem Betrunkenen zurück und folgte ihm.
Er hatte das Gefühl, einem Begräbnis beigewohnt zu haben.
III
Beim Eintreten des Paares verstummte das heitere Stimmengewirr im Restaurant des Grand Hotel einen Moment lang, was so überraschend kam, dass sich einer der Geiger verspielte und sich einen finsteren Blick des Pianisten einhandelte. Doch es war nur ein Augenblick, dann nahmen die Gäste ihre Gespräche wieder auf, möglicherweise sogar noch etwas angeregter als zuvor, denn man hatte ihnen – wie auf dem Silbertablett – ein äußerst lohnendes Gesprächsthema serviert.
Die Garderobenfrau nahm sowohl die Pelzstola der Dame als auch den Mantel ihres Begleiters voller Ehrerbietigkeit und mit einem Lächeln entgegen, während ein Kellner sie mit gravitätischer Miene willkommen hieß – Ja, gerne, hier entlang, wenn Sie mir bitte folgen wollen – und sie zu einem reservierten Tisch begleitete, der sich, wie es der Zufall wollte, ganz hinten in dem geräumigen Speisesaal befand und von mehreren Wandleuchtern in Form von Kandelabern sowie tropfenförmigen Kristalllampen erhellt wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die beiden buchstäblich einen Spießrutenlauf hinter sich bringen und so manch giftigen Kommentar seitens der Gäste über sich ergehen lassen, die hier ihre kostspielige Mahlzeit verzehrten. Immerhin ein kleines Spektakel, das nirgendwo angekündigt war.
Das Orchester stimmte einen Walzer an.
Mit betont herausfordernder Miene wählte die Frau ausgerechnet den Platz, auf dem jeder im Saal ihr ins Gesicht sehen konnte. Der Mann hingegen setzte sich mit dem Rücken zum Publikum und bekundete damit demonstrativ sein Desinteresse an der Neugier, die er so offensichtlich hervorgerufen hatte.
Mit einem angedeuteten Bückling zog sich der Ober zurück; in wenigen Minuten würde er mit den Speisekarten zurückkehren.
Die jüngst Eingetroffene war mit Sicherheit die schönste und eleganteste Frau unter den anwesenden Damen. Sie trug ein Kostüm aus dunkelgrauem Satin mit halblangem Rock und über dem Handgelenk geschlossenen Ärmeln, die am Ellbogen leicht gerafft waren, dazu eine Art Schärpe aus schwarzer Seide schräg über der Schulter, die den Busen schmeichelnd betonte und über die rechte Hüfte drapiert war, wo sie mit einem Gürtel samt aufwendiger Schließe festgehalten wurde. Das kleine Hütchen saß keck ein wenig links auf dem Kopf, wo es mit einem kleinen Besatz aus Seide, die mit der Farbe des Kleides harmonierte, auf das rotblonde, leicht kupferfarben schimmernde Haar gesteckt war. Die schmalen Fesseln der Dame steckten in schwarzen, hochhackigen Schuhen aus schwarzem Leder, dem gleichen Material, aus dem auch die kleine, flache Etuitasche mit Klappverschluss gefertigt war, welche die Dame auf dem Tisch abgelegt hatte. Kleine Ohrringe aus Platin mit einer winzigen Diamantrosette baumelten von ihren Ohrläppchen. Die Hände steckten in ebenfalls schwarzen Spitzenhandschuhen.
Die Erlesenheit ihrer Kleidung war jedoch nichts im Vergleich zum Strahlen des Antlitzes, das über dem langen Schwanenhals so herausfordernd in die Runde blickte: das winzige Näschen, die ganz leicht geschürzte Oberlippe über den schneeweißen Zähnen, und vor allem die Augen. Fröhlich, glasklar, selbstbewusst und von einer schier unglaublichen Farbe: einem intensiven Veilchenblau mit Tendenz zu Violett.
Voller Stolz ließ die Frau diese Augen in die Runde schweifen und zwang so manchen, der sie neugierig betrachtet hatte, den Blick vor Verlegenheit zu senken. Dann wandte sie sich mit einem zufriedenen Lächeln ihrem Begleiter zu.
In jener Herbstsaison war Bianca Borgati aus der Familie der Markgrafen von Zisa, Gattin des Grafen Palmieri di Roccaspina, die Frau, über die in den Salons des Adels am meisten gesprochen wurde. Schon bald würde dieses Thema von den Planungen für die Winterreisen an die Küste abgelöst werden, doch derzeit schien nichts interessanter zu sein, als dieser Contessa das Gewand der gefallenen Frau auf den Leib zu schneidern; einer Frau, die sich amüsierte, wo doch ihr Gemahl, der arme Romualdo, im Zuchthaus schmachtete. Gewiss, er hatte einen Mord gestanden und war nicht gewillt, dieses Geständnis zu widerrufen; gewiss, so mancher sagte auch, der Conte ziehe es vor, sein Leben hinter Gittern zu fristen, statt die immensen Schulden zurückzuzahlen, die er im Glücksspiel, seinem ganz persönlichen Dämon, gemacht hatte; gewiss, es wäre ehrenhafter und seinem Rang angemessener gewesen, wenn er seinem Leben mit einem Pistolenschuss in die Schläfe ein Ende bereitet hätte. Doch wie auch immer – die ungeschriebenen Gesetze, die das Verhalten der Aristokratie regelten, hätten immer darauf gepocht, dass sich eine Contessa unter diesen Umständen in der Öffentlichkeit nur in Trauerkleidung zeigte, sich ganz auf ein Leben ebenso gefassten wie absoluten Leidens zurückzog; oder sich doch wenigstens von den Restaurants fernhielt, die gerade en vogue waren, statt sie zu besuchen, noch dazu in einer Weise ausstaffiert, von der die anwesenden Damen der Gesellschaft nach eingehender Prüfung sowieso nicht hätten sagen können, wie die Contessa sie sich überhaupt leisten konnte, nachdem doch besagter Gatte, derzeit Häftling, das gesamte Familienvermögen in den Spielhöllen der Stadt durchgebracht hatte.
Daraus konnte, ohne den Schatten eines Zweifels, nur eines geschlossen werden: dass die Contessa di Roccaspina mittlerweile dem ältesten Gewerbe der Welt nachging, indem sie sich sowohl ihre Schönheit als auch einige, wie auch immer geartete Fertigkeiten zunutze machte, von denen die Männer im Saal insgeheim ins Schwärmen gerieten, nicht ohne dabei die gleiche Verachtung vorzutäuschen, die ihre Gemahlinnen oder Verlobten zur Schau trugen. Jetzt war die entscheidende Frage die folgende: Wem ließ die Contessa ihre Fertigkeiten in Sachen Liebeskunst angedeihen? Und woher kam das alles – das Seidenkleid, die Diamantrosetten, diese juwelenbesetzte Gürtelschnalle, diese Spitzenhandschuhe?
Ihre Freundschaft mit dem steinreichen Herzog Carlo Maria Marangolo, dem Erben eines der stattlichsten Vermögen ganz Neapels, war bekannt, doch war dies eine Bekanntschaft älteren Datums; außerdem war der Duca sehr krank. Auf den Fluren wurde jedoch ein anderer Name geflüstert, und dafür war dieser abendliche Ausflug ins Grand Hotel an der Strandpromenade, das nur von der allerhöchsten Gesellschaft frequentiert wurde, die aufsehenerregende Bestätigung.
Seit einiger Zeit machte das Gerücht die Runde, dass die Contessa die Geliebte eines eher sonderbaren Polizeikommissars sei. Dass diese Verbindung, die schon vor geraumer Zeit ihren Anfang genommen hatte, angesichts eines Vorfalls ans Tageslicht gekommen sei, bei dem man besagten Kommissar der Neigung zur Päderastie bezichtigt hatte. Dass die Roccaspina, um der konkreten Gefahr einer Verbannung ihres Geliebten ins Exil entgegenzuwirken, spontan und aus eigenem Willen interveniert habe, indem sie überraschend bei der inoffiziellen Gerichtsverhandlung auftrat, die zur Klärung des Vorwurfs einberufen worden war. Dass er, obgleich nur ein einfacher Beamter der Kriminalpolizei, der weder die Salons noch andere Zusammenkünfte der höheren Gesellschaft besuchte, in Wirklichkeit selbst dem Adel, wenngleich dem Landadel, entstamme und sehr vermögend sei. Und dass schließlich er, kein anderer als er, niemals einen Hut trage, was ein untrügliches Zeichen für eine gewisse Exzentrik und wahrscheinlich auch Perversion war.
Jedenfalls gab es genügend Gesprächsstoff, um die verschlafenen Teegesellschaften dieses Herbstes aufzulockern, die den sommerlichen Klatsch und Tratsch schon lange hinter sich gelassen hatten.
Besonders rankten sich die Gerüchte um die rätselhafte Gestalt des vermeintlichen Galans, Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, Baron von Malomonte. So mancher erinnerte sich noch an seinen verstorbenen Vater, der dreißig Jahre zuvor das mondäne Leben der Stadt geprägt und in der Blüte seiner Jahre Abschied vom Leben genommen hatte. Mancher hatte auch die Mutter noch kennengelernt, eine zarte, grünäugige Gestalt aus guter Familie, die sich, blutjung verheiratet, in der tiefsten Provinz des Cilento vergraben hatte und schließlich einer schweren Nervenerkrankung erlegen war. Und es gab sogar manch Jüngeren, der sich, ohne sich dessen allerdings sicher zu sein, an einen schweigsamen Schulkameraden im Kolleg der Jesuiten erinnerte, einen, der sich stets etwas abseits von den anderen hielt und vielen Angst machte, weshalb man ihm lieber aus dem Wege ging.
Summa summarum waren die gutgelaunte Contessa und der menschenscheue Commissario derzeit das Paar der Paare.
Bianca bedachte den Kellner, der ihr die Speisekarte reichte, mit einem strahlenden Lächeln und sagte zu Ricciardi: »Seit ich eine gefallene Frau bin, ist mein Appetit ins Unermessliche gestiegen. Außerdem heißt es, die französische Küche, die hier geboten wird, sei ausgesprochen köstlich.«
Der Commissario verzog das Gesicht und nickte in Richtung des Speisesaals hinter seinem Rücken. »Du beliebst zu scherzen, Bianca. Mich belastet es sehr, die Ursache des üblen Geredes über dich zu sein, nur weil du mir in jener absurden Situation helfen wolltest.«
Die Contessa kicherte, verbarg dies jedoch hinter vorgehaltener Hand. »Ganz im Gegenteil, Luigi Alfredo, denn was mich betrifft, so hätte ich mir gar nichts Besseres erhoffen können. Wie du weißt, hatte mein Mann mich zu einem vorzeitigen Dasein in der Gruft verurteilt, und was du bei deinen Ermittlungen entdeckt und mir anvertraut hast, hat mich endgültig von jeglichem Skrupel oder schlechtem Gewissen befreit. Aber sprechen wir jetzt nicht mehr darüber.«
Ricciardi nickte. »Natürlich hast du jedes Recht zu tun, was du tust. Aber du hättest den Platz, der dir zusteht, auch zurückerobern können, ohne als eine Art lustige Witwe in die Annalen einzugehen.«
Bianca zuckte anmutig die schmalen Schultern. »Und was sollte mir dieser Klatsch bedeuten? Ich bin es gewöhnt, dass die Leute sich das Maul über mich zerreißen, seit ich ein kleines Mädchen war. Irgendwann werden sie es leid sein, du wirst sehen, und finden andere Themen. Schon jetzt treffen wieder Einladungen ins Konzert oder ins Theater bei mir ein, und schon bald wird irgendeine große Dame, die sich für fortschrittlich hält und dazu aufgelegt ist, Kuriositäten auszustellen, mich zu einem Empfang einladen, bei dem auch ein Pygmäe und ein Feuerspucker zu bewundern sind. So schlimm ist es gar nicht, ein Tier mit zwei Köpfen zu sein.«
Ricciardi rutschte auf seinem Stuhl herum. »Indirekt ist es meine Schuld. Und das ist es, was mich beunruhigt.«
Bianca lachte. »Dann hast du wirklich das Zeug zum Märtyrer. Ich habe dir gesagt, dass mich das Ganze kolossal amüsiert und ich mich so lebendig fühle wie seit Jahren nicht mehr. Nein, wenn ich es recht bedenke, wie noch nie. Lass sie doch reden. Es ist aufregend: Ich bin eine Schauspielerin, die auf der Bühne eine Rolle spielt und ihr Bestes gibt, damit sie später möglichst viel Applaus und viele Vorhänge bekommt. Denn das hier ist doch eine Art Bühne, oder?«
Der Commissario öffnete bereits den Mund, um ihr zu antworten, schloss ihn jedoch wieder, denn der Kellner trat an den Tisch. Bianca lächelte und gab die Bestellung auf, selbstsicher und zufrieden wie ein hungriges kleines Mädchen, das weiß, dass es gleich etwas Köstliches zu essen bekommt.
»Omelette spagnole, vol-au-vent à la toulousaine und dann ein fricandeau vom Kalb. Hinterher vielleicht noch eine Suchard-Torte. Danke.«
Ricciardi riss die Augen auf. »Donnerwetter, du hast ja wirklich Hunger. Für mich bitte die potage a la Reine und dann eine galantine de volaille à la gelée. Danke.«
»Ich hab wirklich Hunger, aber du isst immer wie ein Spatz. Bist du sicher, dass es dir gut geht?«
Ricciardi machte eine unbestimmte Handbewegung. »Ich versuche nur, mich von Nelides Kochkünsten zu erholen, meiner Haushälterin. Sie ist seit … seit noch nicht allzu langer Zeit bei mir, und ich habe immer den Eindruck, sie fürchtet, dass ich vom Fleisch falle. Deshalb übertreibt sie es, und wenn ich auswärts esse, versuche ich das auszugleichen, damit meine Leber nicht irgendwann hin ist.«
Bianca lachte. »Ich hingegen könnte pausenlos essen nach all den Jahren, in denen ich jeden Centesimo umdrehen musste, um nicht zu viel von dem Geld auszugeben, das ich sowieso nicht hatte. Ich werde noch fett und hässlich werden, und niemand wird mehr glauben, dass mich einst ein so faszinierender Mann wie du zur Geliebten haben wollte.«
Ohne es zu wollen, musste Ricciardi lächeln. »Diese Möglichkeit ist auszuschließen, scheint mir – weil von faszinierend bei mir nicht die Rede sein kann und weil es einfach undenkbar ist, dass du einmal hässlich wirst.«
»Hört, hört, Luigi Alfredo, hast du mir da gerade ein Kompliment gemacht? Ich traue meine Ohren nicht, nein, ich muss betrunken sein. Dabei haben wir bedauerlicherweise noch gar nichts Flüssiges zu uns genommen.«
Der Commissario schüttelte den Kopf. »Kein Kompliment, Bianca. Einfach nur die reine und schlichte Wahrheit. Und auch deshalb tut es mir leid, dass du dich in dieser Lage befindest. Du könntest jeden haben, den du begehrst.«
Auf einmal wurde die Contessa ernst und strich ihm mit den behandschuhten Fingern über die Hand.
»Jetzt hör mir bitte mal zu. Ich danke Gott für den Moment, in dem ich beschlossen habe, dich aufzusuchen. Wärst du nicht gewesen und hättest du nicht getan, was du getan hast, würde ich jetzt verzweifelt zu Hause sitzen und meinen Zweifeln und Unsicherheiten erliegen. Und das auch noch in bitterer Armut, denn ich hätte mich verpflichtet gefühlt, meine Existenz auf immer mit der meines Mannes verknüpft zu sehen. Du jedoch hast mich begreifen lassen, wie absurd das Leben war, das ich geführt habe, und das werde ich dir nie genügend vergelten können. Du hast mir die Bianca Borgati zurückgegeben, die gestorben war. Du hast mich zu neuem Leben erweckt.«
Ricciardi lauschte ihr schweigend und sagte dann: »Und ich würde ohne dich auf irgendeiner Insel in der Verbannung sitzen und wüsste weder warum noch durch wen. Deshalb, meine liebe Contessa, liegt die Dankbarkeit ganz auf meiner Seite.«
Bianca klatschte kurz in die Hände. »Na gut, dann sind wir uns eben gegenseitig dankbar. Und jetzt genießen wir.«
Ricciardi wollte schon etwas erwidern, doch Bianca unterbrach ihn. »Der Wahrheit zuliebe muss ich auch Carlo Maria Marangolo dankbar sein. Unter dem Vorwand, es sei unverzichtbar für unsere kleine Darbietung, hat er mir dieses herrliche Gewand zukommen lassen, das ich sonst bestimmt nicht akzeptiert hätte. Ich habe ihn besucht, weißt du? Er ist inzwischen bettlägerig, denn diese neue Behandlung schwächt ihn sehr. Aber du müsstest hören, wie sehr er sich amüsiert, wenn ich ihm erzähle, wie man auf uns reagiert. Er, der nicht nur aufgrund seiner hohen Stellung und seines Namens diese Leute immer verabscheut hat. Er sagt, sie seien armselig und provinziell.«
»Auch ich bin ihm sehr dankbar«, erwiderte Ricciardi. »Hätte er nicht von meiner misslichen Lage erfahren, hätte er nicht beschlossen, seine Bekanntschaften zu meinen Gunsten gegeneinander auszuspielen, dann …«
Bianca schenkte ihm ein Lächeln. »Ich muss dir gestehen, als er mir sagte, wir müssten uns mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit sehen lassen, um unsere Behauptung zu stützen, und man würde uns mehrere Monate lang überwachen, dachte ich nicht, dass ich das schaffen könnte. Es ist eine Sache, in einem abgedunkelten Raum einer verlassenen Fabrik vor einer Gruppe unbekannter Bonzen etwas auszusagen, und etwas anderes, es vor einer Welt wie dieser zu leben. Ich hielt das Gericht der Öffentlichkeit, das nur allzu bereit war, uns zu verurteilen, für ein schier unüberwindliches Hindernis.«
Der Commissario ließ verstohlen den Blick schweifen.





























