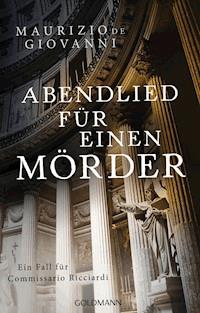8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissario Ricciardi
- Sprache: Deutsch
Ein wunderbar atmosphärischer Kriminalroman im
Neapel der 30er Jahre.
Neapel Anfang der Dreißigerjahre an einem mörderisch heißen Julitag: Professor Iovine del Castello, ein berühmter Chirurg und angesehenes Mitglied der Oberschicht, stürzt aus dem Fenster seiner Praxis in den Tod. Für Commissario Ricciardi und seinen Assistenten Brigadiere Maione ist schnell klar, dass es sich weder um einen Unfall noch um Selbstmord handelt. Ihre Ermittlungen führen sie schon bald zu einer ganzen Reihe von Verdächtigen: Menschen, die sich von Iovine hintergangen, ausgenutzt oder betrogen fühlten. Bei ihren Recherchen werden Ricciardi und Maione mit verletzten Gefühlen, Untreue und unglücklichen Lieben konfrontiert. Und die Geschichte, die Ricciardi und Maione schließlich aufdecken, bringt sie an den Rand dessen, was sie ertragen können ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Neapel Anfang der Dreißigerjahre an einem mörderisch heißen Julitag: Professor Iovine del Castello, ein berühmter Chirurg und angesehenes Mitglied der Oberschicht, stürzt aus dem Fenster seiner Praxis in den Tod. Für Commissario Ricciardi und seinen Assistenten Brigadiere Maione ist schnell klar, dass es sich weder um einen Unfall noch um Selbstmord handelt. Ihre Ermittlungen führen sie schon bald zu einer ganzen Reihe von Verdächtigen: Menschen, die sich von Iovine hintergangen, ausgenutzt oder betrogen fühlten. Bei ihren Recherchen werden Ricciardi und Maione mit verletzten Gefühlen, Untreue und unglücklichen Lieben konfrontiert – was umso schlimmer ist, als sowohl der Commissario als auch sein Assistent selbst unter privaten Nöten leiden. Und die Geschichte, die Ricciardi und Maione schließlich aufdecken, bringt sie an den Rand dessen, was sie ertragen können …
Autor
Maurizio de Giovanni wurde 1958 in Neapel geboren, wo er auch heute noch lebt. Er hat Literatur studiert, arbeitet hauptberuflich aber als Banker. Das Schreiben von Kriminalromanen ist seine Leidenschaft. Die Ricciardi-Romane, die auch im Ausland große Erfolge feiern, wurden mehrfach ausgezeichnet. Weitere Ricciardi-Romane sind bei Goldmann in Vorbereitung.
Maurizio de Giovanni
Die Klagen der Toten
Ein Fall für Commissario Ricciardi
Aus dem Italienischen von Judith Schwaab
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »In fondo al tuo cuore« bei Einaudi, Turin.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2014
by Giulio Einaudi editore S.p.A., Torino
This edition published by arrangement with Théses Contents srl
in cooperation with book@
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: UNO Werbeagentur München
Coverfoto: mauritius images / Novarc / Miguel Caibarien
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16665-6V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Gewidmet dem großen verborgenen Herzen von Paolo Repetti
I
Er stürzt, der Professore.
Er stürzt, und während er stürzt, breitet er die Arme aus, als wolle er die glühend heiße Sommernacht, die ihn empfängt, umschlingen.
Er stürzt, und obwohl er während des kurzen Handgemenges die gesamte Luft, die er in der Lunge hatte, ausgestoßen hat, zwingt ihn sein Körper jetzt sinnloserweise noch einmal dazu einzuatmen, auch wenn dieser frische Sauerstoff zu nichts mehr dienen wird und nicht einmal mehr rechtzeitig in seine Blutbahn gerät.
Auch seine Nase wird nicht mehr den Duft erschnuppern, den die Bäume und die Blumen in den Rabatten verströmen, den Geruch nach Essen aus den Fenstern des Viertels, über dem die Sommerhitze liegt wie eine Verwünschung.
Er stürzt mit geschlossenen Augen und sieht auch nicht das Licht, das bei denen brennt, die trotz der späten Stunde keinen Schlaf finden, auch nicht, ein wenig entfernt, jenseits der Häuserdächer, die zum Meer hin abfallen, den Laternenschein der großen Straße, die dem Gassengewirr ein Ende bereitet.
Er stürzt, der Professore. Und seine Gedanken zerspringen in Tausend kleine Stücke, lauter Geistesblitze, die nie wieder einen der wohlgeformten Sätze bilden werden, für die er zu Recht in der akademischen Welt berühmt ist. Jetzt sind sie nur noch wie die Splitter eines zerbrochenen Spiegels, die noch im Fallen die vorbeisausende Welt einfangen und dabei dem ganzen, schönen Bild nachweinen, das sie einst geformt haben.
Einer dieser Splitter fängt die Liebe ein.
Hätte er noch die Zeit, bei dem Thema zu verweilen, so würde der Professore denken, wie seltsam sie doch ist, die Liebe. Sie lässt dich absurde Dinge tun, weit entfernt von dem, was sonst deine Art ist; mal macht sie dich lächerlich, mal erfüllt sie das Leben mit Farbe. Die Liebe erschafft, die Liebe zerstört, würde er es in eines seiner blumigen Bonmots fassen. Und manchmal lässt sie dich auch aus dem Fenster fliegen.
Doch der Professore stürzt, und wenn man stürzt, kann man sich nicht mehr erlauben als Gedankensplitter. Und so stellt sich auch der außergewöhnliche Verstand eines Wissenschaftlers der Angst vor dem Schmerz.
Den Schmerz kann man studieren, würde der Professore behaupten, wenn ihm dazu noch die Zeit und die Muße blieben. Er ist ein Symptom, ein Zeichen dafür, dass die vertrackte Maschinerie des menschlichen Körpers, über die man so viel weiß und doch so vieles auch nicht, nicht mehr recht funktioniert. Ein Signal, wie ein hell leuchtendes Warnlicht, auf das es zu achten gilt: Schnell, eilt herbei, da ist etwas im Argen. Bei Kindern – so würde der Professore berichten, wenn er nicht fiele – liegt genau hier das Problem. Sie können nicht sagen, wo es ihnen wehtut, sie begreifen nicht, was sie spüren. Sie jammern und weinen und schreien, doch sie sagen nichts; und der arme Arzt, der diese kleinen Ungeheuer behandeln soll, muss behutsam vorgehen, hier tasten, dort drücken, bis ein lauterer Schrei ihm die Augen öffnet, sodass er endlich begreift. Kalt, kalt, heißer, ganz heiß.
Stürze er nicht in so schwindelerregendem Tempo, würde dem Professore zum hundertsten Mal der Gedanke kommen, wie seltsam doch das Leben ist, weil es dich dazu bringt, dich aus beruflichen Gründen mit Dingen abzugeben, mit denen sonst niemand zu tun haben will. Er zum Beispiel hat Kinder noch nie ausstehen können; nicht einmal, als er selbst noch ein Kind war, der einzige, zur Trübsal neigende Sohn eines viel beschäftigten Kaufmannes aus der Provinz und einer weinerlichen Schullehrerin, deren Zärtlichkeiten er mied wie die Pest. Aber so ist es nun mal, würde er achselzuckend sagen, wenn er nicht damit beschäftigt wäre, in der warmen Abendluft mit den Armen zu rudern; Arbeit ist Arbeit, und da die Kinder nun mal aus den Frauen herauskommen und diese sein Metier sind, muss er sich notgedrungen mit ihnen beschäftigen.
Er stürzt, der Professore. Und blitzartig wird ihm bewusst, dass keine Zeit mehr ist, auch wenn der Sturz länger dauert, als er erwartet hätte.
Es bleibt ihm keine Zeit mehr, sich wieder in Form zu bringen, und sei es auch nur, um in dem Handgemenge besser zu bestehen, das ja zu seinem Fall geführt hat, mit lächerlicher Leichtigkeit aus dem Fenster gestürzt. Und wenn man bedenkt, dass er sogar stolz auf seine geschmeidigen, überaus feinfühligen Chirurgenhände war, so gänzlich anders als die rauen Hausfrauenhände vieler seiner Patientinnen, die zu ihm kamen, damit er sie kurierte, mit verhärmten Gesichtern und leeren Taschen; selbst auf sein schlaffes Fleisch und das Doppelkinn war er stolz, das sichere Zeichen für so manch üppiges Abendessen und einen großen Patientinnenstamm, der unter den Kollegen viel Neid erzeugte.
Vielleicht hätte ihn ja so manch trainierterer Muskel, Folge der langen Fußwege, die er früher von zu Hause bis zum Krankenhaus zurückgelegt hat – bevor er sich einen nagelneuen Fiat 521 C, ausgestattet mit Tacho, Uhr und Anzeigen für den Benzin- und Ölstand, angeschafft hat, ein zweifarbiges Schmuckstück in Schwarz und Creme, das sein ganzer Stolz war und in genau diesem Moment zweiundzwanzig Meter unterhalb von ihm geparkt ist und dem Sturzflug seines Besitzers reg- und vermutlich auch regungslos entgegensieht –, vor dem Sturz bewahrt. Dann wäre er jetzt vielleicht auch immer noch ansehnlich und hätte weder ein zerrissenes Hemd noch verrutschte Hosenträger, und die Goldbrille säße nicht krumm und schief auf seinem verzerrten Gesicht.
Allerdings, so würde der Professore denken, wenn die Zeit seines Sturzes nicht beinahe zu Ende wäre, rechnet auch niemand, der gerade in seinem Arbeitszimmer sitzt und die Operationen des kommenden Tages plant, damit, um sein Leben kämpfen zu müssen. Bestenfalls rechnet man mit einem unangemeldeten Besucher, den man kurz angebunden abwimmeln könnte; ganz gewiss jedoch nicht mit einem ebenso schnellen wie heftigen Kampf mit bloßen Händen, der so unerwartet kommt, dass einem nicht einmal mehr die Zeit bleibt, mit einem lauten Schrei um Hilfe zu rufen. Nicht, dass um diese Uhrzeit noch sehr viele Leute unterwegs gewesen wären, doch irgendein Krankenpfleger, ein Wärter oder auch ein Assistenzarzt im Besitz eines wehrhaften, kräftigen Körperbaus hätte ihn ja doch vielleicht gehört und wäre ihm zu Hilfe geeilt, und statt dem Boden mit einem Tempo entgegenzusausen, das er, wäre er nicht im Sturz begriffen, noch hätte errechnen können, könnte er jetzt wegen des tätlichen Angriffs Anzeige erstatten.
Seltsam, wie sich in extremen Situationen die Zeit dehnt, würde der Professore denken, könnte er den Sturz überleben. Und er würde schildern, wie das Gehirn unter den Gedankenfetzen, die durch die Luft fliegen, blitzschnell seine Auswahl trifft und dabei von der wundersamen Flinkheit profitiert, mit der dieses erstklassige Produkt der Evolution dazu in der Lage ist, manche Verbindungen herzustellen und andere auszuschließen. Und er würde schildern, der Professore, dass es ganz und gar nicht so ist, wie immer behauptet wird, dass nämlich im Moment des Todes ein ganzes Leben vor dem inneren Auge des Sterbenden vorüberzieht; so gibt es zum Beispiel von der Frau und dem Sohn keine Spur in seinen flirrenden Gedanken, die sprühen wie ein Feuerwerk, leuchtend hell und funkelnd vor dem dunklen Nachthimmel. Auch nicht von vielen anderen Personen, die, wie in einer verworrenen Choreografie, den Arbeitstag eines bedeutenden Wissenschaftlers und praktizierenden Mediziners von Rang beleben. Eine Tätigkeit, der er mit Sorgfalt nachgeht und die es ihm, nebenbei gesagt, hätte er sie ein bisschen weniger ernst genommen, erlaubt hätte, jetzt bequem in seinem Bett zu liegen, statt durchs Dunkel zu flattern wie eine Fledermaus.
Klar und deutlich steht hingegen vor seinem inneren Auge, während er mit geschlossenen Augen und verzerrtem Gesicht dem Aufprall entgegengeht, das lebhafte und fröhliche Bild von Sisinella.
Sisinella mit ihren schneeweißen Zähnen und ihren roten Lippen, zu diesem hinreißenden Schmollmund verzogen, der ihn verrückt macht. Sisinella, die lachend neben ihm sitzt und mit den Händen ihren Hut festhält, während sie mit offenem Verdeck in seinem schönen Auto dahinsausen, das er im Grunde nur für sie gekauft hat. Sisinella, die ihm das Tor zu einem ganz eigenen und höchstpersönlichen Paradies geöffnet hat, in diesem mit Daunen gepolsterten Bett, das ganze vier Träger ihr in die neue Wohnung auf dem Vomero geliefert haben. Sisinella, die ihm das Leben eines jungen Mannes geschenkt hat, ihm, der doch nie ein junger Mann gewesen war. Sisinella mit den weichen Händen, Sisinella mit den langen Beinen, Sisinella mit der Haut wie Sahne und Erdbeeren. Sisinella.
Er stürzt, der Professore, und im Stürzen denkt er, wie gern er doch ihr Gesicht gesehen hätte, wenn sie das Päckchen auswickelt, das er ihr unters Kopfkissen gelegt hätte, damit sie es wie durch Zufall findet. Und wie sie sich gefreut hätte, aufgeregt wie ein kleines Mädchen, die Wangen noch errötet vom Liebesspiel, das Näschen gekraust vor lauter Begeisterung, und die prachtvolle, junge Brust bebend vor Lust. Und wie reich sie ihn für diese Gabe beschenkt hätte. Schade. Wirklich schade.
Er stürzt, der Professore, doch wie alles auf der Welt hat auch sein Sturz ein Ende. Und dieses wundervolle Machwerk, das außergewöhnlichste Produkt der Evolution, dieses Gehirn, das so viele brillante Gedanken hervorgebracht hat und seinen Besitzer auf den höchsten Gipfel seiner Profession gebracht hat, tritt zu einem guten Teil aus seiner beinernen Hülle, die es mehr als fünfzig Jahre umschlossen hat und jetzt beim Aufprall auf den Boden geknackt wird wie eine Nuss, kaum mehr als zwei Sekunden, nachdem der Fuß des Professors sich zweiundzwanzig Meter darüber vom Fußboden gelöst hat.
In einem letzten, gewaltigen Blitz erlischt das große Feuerwerk, und was bleibt, ist die Erinnerung an ein schelmisches, verführerisches Lächeln.
II
Sie sahen sich am Palazzo dell’Immacolatella, und es war nicht nötig, dass sie sich verabredeten. Sie sahen sich jedes Mal, wenn bekannt wurde, dass ein Dampfschiff in See stach, eines von diesen Riesendingern mit zwei Schornsteinen und einem Schiffshorn, von dessen lautem Hupen einem das Trommelfell platzte und die Brust bebte, wenn man in der Nähe stand.
Sie sahen sich am späten Nachmittag, wenn der eine als Lehrjunge seine Pause machen und die andere ihre Hausarbeit unterbrechen konnte, weil der Herr des einen hinter der Theke saß und seinen Weinrausch ausschlief und die Mutter der anderen sich ans Nähen machte, bevor sie sie von Neuem mit lauter Stimme rufen würde, damit sie das Abendessen zubereitete.
Er war zwölf nach Lenzen und hundert, wenn man ihm in die Augen schaute und seine schwarzen Hände sah, schon jetzt von dem Beruf, den er erlernte, gezeichnet, den mageren, zappeligen Körper in einer abgetragenen und längst gewendeten Jacke, die wer weiß wem gehört hatte, und wer weiß wann. Sie war elf nach Lenzen und hundert, wenn man sie reden hörte, ungestüm, damit man ihr nicht anmerkte, dass sie müde oder traurig war, das spitze Näschen über den schmalen Lippen, die Brauen finster zusammengezogen vor lauter Entschlossenheit zu überleben.
Zuerst kam er und setzte sich immer an die gleiche Stelle, zwischen den Bergen von aufgerollten Tauen, die so dick waren wie ein Arm. Es war ein Beobachtungsposten, der mit Sorgfalt ausgewählt war, denn von dort aus sah man das Schiff, die Mole sowie die großen Kähne, auf denen die Truhen und Bündel mit all den Dingen, die die Leute auf ihre Reise mitnahmen, zum Schiff geschippert wurden. Und man sah sie, auf dem Boden kauernd oder ausgestreckt schlafend, schon seit dem vorigen Tag, wie sie auf eine ebenso ersehnte wie gefürchtete Abreise warteten, den Fahrschein in den Händen, dessen Preis sie sich jahrelang vom Munde abgespart hatten. Manche schliefen, andere schauten aufs Meer hinaus, als hätten sie es noch nie gesehen, eingezwängt in ihre armselige Kleidung, die sie sorgsam gewaschen und gebügelt hatten, als ginge es auf ein Fest. Und dort wartete das große Schiff, von zwei Matrosen an der Laufplanke bewacht, und ließ die Spannung ins schier Unermessliche steigen, ehe der langersehnte Pfiff kam, der ankündigte, dass es endlich losging.
Das Schiff. Ein riesiges schwarzes Tier mit einem gewaltigen Wanst, der sie alle verschlucken und alles mit sich nehmen würde, Dinge und Menschen, und nichts würde zurückbleiben außer der gewohnten, gewaltigen Leere.
Er spürte, wie sie sich näherte, leise und geschmeidig wie eine streunende Katze, und sich hinter ihm niederkauerte. Er drehte sich nicht um, noch wandte er den Blick von der langen Schlange aus Menschen, die Dutzende von Metern vor ihm auf ihr Schicksal harrten. Es herrschte eine unwirkliche Stille, während die Sonne unterging und den Julihimmel mit Flammen und Farben übergoss. Sie schaute über seine Mütze hinweg aufs ölige Meer und auf die Boote, die mit ihren wirbelnden Rudern um das große Schiff kreisten wie Fliegen um ein Ross.
»Wer weiß, wo sie hinfahren«, murmelte sie.
Er zuckte mit den Achseln. »Nach Amerika. Weißt du denn nicht, dass sie nach Amerika fahren?«
»Klar, nach Amerika«, erwiderte sie flüsternd, als befände sie sich in der Kirche. »Aber wohin? Es ist groß, dieses Amerika. Und wenn sie dort sind, was machen sie dann? Wohin gehen sie? Was essen sie? Da sind auch Kinder, siehst du sie? Die müssen immer essen, sonst sterben sie.«
Er blieb einen Moment lang stumm, kaute auf einem Strohhalm. Dann sagte er: »Vor allem fahren sie erst mal nach Palermo, auf Sizilien. Dort laden sie weitere Leute ein, noch mal so viel wie die hier. Und das Schiff kommt aus Genua. Wenn du genau hinschaust, sind schon Leute an Bord, ab und zu zeigt sich jemand an der Reling, siehst du? Die aus Genua schnappen sich die besten Plätze, dann nehmen sich die aus Neapel den Rest. Und die Sizilianer müssen sich mit dem begnügen, was übrig ist.«
»Und woher weißt du das alles?«
»Das hat mir Gennarino erzählt. Sein Vater bringt die Seekoffer an Bord. Die Abreisenden geben ihm was, damit er achtgibt, dass nichts kaputtgeht. Er trägt eine schwarze Kappe, siehst du ihn? Hinten auf dem Boot.«
Sie strich zärtlich über ein Tau, als wäre es ein Tier.
»Das wollte ich gar nicht wissen.«
»Was dann?«
»Ich wollte sagen … Na ja, die gehen fort. Sie kommen nie wieder. Und was machen sie? Was für eine Sprache sprechen sie in Amerika? Was essen sie?«
Er fuhr entrüstet auf. »Denkst du eigentlich immer bloß ans Essen? Die gehen fort, damit sie reich werden, damit es ihnen gut geht. Aber meinst du denn, in Amerika gibt es nichts zu essen? Ganz bestimmt essen die dort mehr als hier. Die da sind alle Hungerleider und arme Teufel, und das, was sie dort drüben vorfinden, ist immer noch besser als das, was sie zurücklassen. Weil sie gar nichts zurücklassen. Rein gar nichts.«
Sie erwiderte nichts darauf, streichelte nur immer weiter das Seil. Eine große Ratte spitzte zwischen den Taurollen hervor, neben denen sie sich niedergelassen hatte. Sie stampfte mit dem Fuß auf, und die Ratte huschte mit einem leisen Quieken davon.
»Ich denke nicht immer ans Essen. Ich denke an die Kinder und an die Frauen, die ihren Ehemännern irgendwohin nachreisen. Und ich denke an diejenigen, die zurückbleiben, schau sie dir nur an.«
Direkt hinter den Abreisenden gab es eine weitere Gruppe von Leuten: Kinder, Frauen und vor allem Alte, auf gewöhnlichere Weise gekleidet. Eltern, Ehefrauen und Kinder, die – wahrscheinlich vergebens – darauf gewartet hatten, dass ihre ausgewanderten Angehörigen ihnen Geld schickten, damit sie ihnen nachreisen konnten, oder dass sie zurückkehrten, gescheitert und noch hungriger als zuvor.
»Ich würde dich nie alleine fahren lassen. Ich würde mit dir mitkommen. Entweder beide oder keiner.«
Er drehte ganz leicht den Kopf, blickte sie ernst an.
»Ich lerne einen Beruf. Und ich bin gut, das weißt du. Ich werde immer arbeiten, und an Geld wird es uns nicht fehlen. Wir fahren nicht, wenn du nicht fahren willst.«
Das Schweigen wurde durch ein kurzes Hupen des Schiffshorns unterbrochen. Einer der Matrosen pfiff, und alle, die geschlafen hatten, sprangen auf.
Ein Kind fing zu weinen an, die Mutter nahm es auf den Arm. Eine alte Frau in der Gruppe derjenigen, die blieben, barg das Gesicht in ihrer Schürze. Von Weitem konnte man ihr Weinen nicht hören, doch man sah, wie ihre Schultern bebten.
Er fuhr fort: »Aber hättest du denn keine Lust wegzugehen? Um mal zu sehen, wie es ist, dieses Amerika? Um zu sehen, ob auch wir es schaffen, inmitten von Indianern zu leben? Es heißt, das Land ist größer als alle anderen, und es gibt dort komische Tiere, wie man sie noch nie gesehen hat.«
Die Sonne sank schnell, doch die Luft kühlte nicht ab.
Sie wischte sich einen Schweißtropfen ab. »Nein. Ich will zu Hause bleiben. Gehen tun nur die Schwachen, Leute, die es nicht geschafft haben. Ich schaffe es. Ich will es schaffen.«
Er schwieg. Er spuckte den Strohhalm aus und nahm einen Stein in die Hand.
»Und warum kommst du dann hierher, wo die Schiffe abfahren? Wenn du nicht wegwillst, warum kommst du dann hierher?«
»Weil du hierherkommst. Weil ich weiß, dass es dir gefällt.«
»Nur deshalb?«
Ein Mann und eine Frau standen eng umschlungen am Ende der Laufplanke. Sie weinten nicht, noch sagten sie sich Koseworte oder Worte des Trostes. Sie klammerten sich einfach nur aneinander, wie verzweifelt.
Sie flüsterte: »Nein. Nicht nur deshalb. Einfach um mich daran zu erinnern, dass ich nicht weggehen muss, um etwas zu essen zu haben. Dass es mir gut gehen wird, hier zu Hause, wo mein Platz ist. Weil ich nicht schwach bin. Ich werde es schaffen.«
Sie war noch ein Kind und hatte so leise gesprochen, dass es schier unmöglich war, die einzelnen Worte zu verstehen; er jedoch drehte sich um und starrte sie erschrocken an, als hätte sie ihm ins Ohr geschrien.
»Wenn es Menschen zusammen gut geht, wenn sie sich gernhaben, wenn sie eine Familie gründen, dann kann ihr Platz überall auf der Welt sein. Man muss doch nicht kämpfen, oder? Man geht ganz einfach dorthin, wo es einem besser geht.«
Sie erwiderte nichts; sie schaute nur einfach weiter regungslos auf das Paar, das sich stumm in den Armen hielt, und auf die schwarze Flanke des Schiffes im Hintergrund.
»Ich werde glücklich sein«, murmelte sie. Und begann ganz langsam und bestimmt zu nicken, als lauschte sie einer Stimme in ihrem Inneren, die ihr sagte, wie sie dies bewerkstelligen sollte. »Ich werde glücklich sein. Ich weiß, dass ich es sein werde. Das steht in der Tiefe meines Herzens geschrieben.«
III
Ich werde glücklich sein, dachte Enrica. Ich werde glücklich sein.
Die Luft in der geschlossenen Kabine des Schiffes war unerträglich stickig, und so war sie hinaus auf die Brücke gegangen. Doch der heiße Wind brachte auch hier keine große Erleichterung, und der Geruch nach Diesel zusammen mit dem Schlingern des Schiffes verursachten ihr Übelkeit; zum hundertsten Male fragte sie sich, ob sie die richtige Wahl getroffen habe.
Ich werde glücklich sein, sagte sie sich entschlossen vor. Sogar laut flüstern tat sie es, ohne sich dessen bewusst zu sein, und eine dicke Dame mit kreidebleichem Gesicht beäugte sie neugierig.
Die letzten Monate waren nicht leicht gewesen. Sie hatte sich trotz ihrer zurückhaltenden Art dazu zwingen müssen, mit Sorgfalt und Geduld eine freundschaftliche Beziehung zu Rosa aufzubauen, der Haushälterin des Mannes, in den sie verliebt war.
Verliebt? O ja, gewiss. Dessen war sie sich sicher. Denn die Liebe, so dachte Enrica, ist eine körperliche Tatsache, noch bevor sie eine Angelegenheit der Seele ist. Sie wird daran gemessen, wie dir das Herz einen Moment lang stehen bleibt, wenn sein Blick auf dir ruht, und wie es einen Takt schneller schlägt, wenn du merkst, dass in seinen Augen Zärtlichkeit aufsteigt. Die Liebe ist die Wärme, die dein Gesicht übergießt, wenn du daran denkst, wie es wäre, deine Lippen den seinen zu nähern. Die Liebe ist dieses Schmachten im Bauch, wenn du an einem Winterabend seine Gestalt am Fenster siehst, jenseits der Straße und des Regens.
Die Liebe ist eine körperliche Tatsache. Und sie war verliebt.
Das Absurde daran war, dass sie immer gespürt hatte – in ihrem Herzen, auf ihrer Haut, in ihrem Bauch –, dass auch er sie liebte. Und in den langen Monaten, in denen er sie vom Fenster aus beobachtet hatte und sie auf eine Geste, ein Wort von ihm gewartet hatte, hatte sie sich gefragt, warum er keinen Schritt auf sie zukam. Gab es eine andere Frau?
Die einzige Methode, das herauszufinden, war, mit dem Menschen zu reden, der ihm nahe war, und das war als Einzige eben seine alte Tata, eine einfache Frau, ruppig nur dem Anschein nach, die Enricas verzweifeltem Annäherungsversuch mit ihrer anpackenden Art begegnet war und ihr gesagt hatte, wie sehr sie sich wünsche, dass aus der Sache etwas würde, und zwar bald, weil sie sich müde fühle und Angst habe, er würde allein zurückbleiben, wenn sie nicht mehr da war.
Jetzt, auf der Brücke des Schiffes, während sie sich das Hütchen mit der behandschuhten Hand festhalten und ein parfümgetränktes Taschentuch an die Nase pressen musste, versuchte Enrica sich an die Begeisterung und Vorfreude zurückzuerinnern, die sich ihrer bemächtigt hatten, als sie sein Haus betrat. Noch zu Ostern war es ihr erschienen, als könnte sie die Mauer, die zwischen ihnen stand, endlich einreißen, könnte mit der ganzen Ruhe und Geduld, die ihr eigen waren, die Stellung erringen, die sie wollte, an der Seite des Mannes, den sie in aller Stille für sich auserwählt hatte, ganz allein dort in ihrem Kämmerchen, indem sie wieder und wieder jenen allerersten, unbeholfenen Brief las, den er ihr geschrieben und in dem er sie gebeten hatte, sie möge ihm gestatten, sie zu grüßen.
Sie hatte für ihn gekocht. Zusammen mit Rosa hatte sie ein Abendessen mit all den Leckereien zubereitet, die er so gerne mochte. Sie hatte ein Kleid ausgewählt, ein Parfüm, ein Paar Schuhe. Sogar auf die Themen, über die sie plaudern würden, hatte sie sich vorbereitet. Sie war bereit; sie fühlte sich als die Frau, die sie immer hatte sein wollen.
Ein Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf, doch sie schluckte es hinunter. Bei der Erinnerung an jenen Abend tat sie sich selbst leid. Er war nicht gekommen, und sie hatte dort gesessen, stocksteif und stumm, mit der peinlich berührten Rosa, die an der Schwelle zur Küche stand und traurig zu ihr herübersah, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Am Ende war Enrica aufgestanden und nach Hause gegangen. Später dann, als die Sorge um sein Befinden über ihre Enttäuschung gesiegt hatte und sie hellwach ihren Posten am Fenster einnehmen ließ, hatte sie ein Automobil gehört, das anhielt, und hatte ihn aussteigen sehen, nachdem der Fahrer ihm die Tür aufgehalten hatte; sie hatte im Inneren des Wagens eine Gestalt erkannt und dann, in der Stille der Nacht, das Lachen einer Frau gehört. Jener Frau.
Es war genau in diesem Moment gewesen, dass sie beschlossen hatte, glücklich zu sein – trotz ihm.
Wenn er die andere vorzog, dann konnte sie ihm dies nicht zum Vorwurf machen. Einmal hatte sie die Frau im Gran Caffè Gambrinus gesehen und nicht umhin gekonnt, ihre Schönheit zu bewundern, ihre Klasse, ihre Eleganz. Rosa hatte ihr mit abfälligem Ton gesagt, die andere sei ein liederliches Weibsstück, eine von den Frauen, die in der Öffentlichkeit rauchten und mit allen herumschäkerten, doch es sei ihr durchaus bewusst, wie schwierig es für eine einfache Lehrerin sei, mit so einer in Wettstreit zu treten.
Die Mutter – die keine Gelegenheit ausließ, sie daran zu erinnern, dass man eine junge Frau, die mittlerweile schon vierundzwanzig Jahre zähle, offiziell als alte Jungfer bezeichnen müsse, dass ihre jüngere (ja, jüngere!) Schwester schon seit mehr als zwei Jahren verheiratet sei und bereits ein Kind habe, während sie sich mittlerweile offenbar mit einem Leben in schrecklicher Einsamkeit abgefunden hatte – beobachtete sie mit unverhohlener und wachsender Sorge, was jetzt schier unerträglich geworden war, da Enrica nicht einmal mehr das süße Geheimnis eines Gefühls hegen konnte, von dem sie glaubte, es würde erwidert. Der Vater, der ihr so ähnlich im Charakter war, ebenso still und doch auf scheue Weise entschlossen, hatte begriffen, dass es ihr nur noch mehr Schmerz bereitet hätte, darüber zu reden; und so beobachtete er sie im Geheimen und teilte die Traurigkeit, die ihr so deutlich aus dem Gesicht sprach, mit Anteilnahme und dem Gefühl, nichts dagegen ausrichten zu können.
Indem sie ihre Brillengläser vor der Meeresgischt schützte, sagte sich Enrica, ja, es sei die richtige Entscheidung gewesen. Sie war den Gedanken leid, noch einen glühend heißen Sommer lang den Kopf zu senken, wann immer er am Fenster vorbeiging; sich an den Nachmittagen, an denen sie Schüler unterrichtete, die sich auf die Herbstexamen vorbereiteten, zu zwingen, nicht auf die andere Straßenseite zu schauen; und jeglichen zufälligen wie schmerzlichen Begegnungen mit Rosa in den Lebensmittelläden des Viertels aus dem Weg zu gehen. Was hätte sie ihr sagen sollen? Dass sie sich nicht in der Lage fühlte, für ihre Liebe in den Krieg zu ziehen? Dass die Waffen der Verführung, in deren Handhabung jene andere offenbar so kundig war, nicht die ihren waren? Und dass sie so feige und resigniert war, die Segel zu streichen, nur um nicht mehr zu leiden?
Genau aus diesem Grunde war sie zu der Lehranstalt gegangen, an der sie ihr Diplom gemacht hatte, und hatte sich erkundigt, ob denn irgendwo anders eine Lehrerin gebraucht würde. Sie lief weg? Ja. Sie lief weg. Vor ihm. Vor sich selbst. Vor dem, von dem sie sich gewünscht hatte, es möge passieren, und das nicht eingetroffen war. Vor dem stagnierenden Leben, dem zu entkommen ihr nicht gelungen war.
Sie hatte lange darüber nachgedacht, und es war ihr als die beste Lösung erschienen. Es nannte sich »Sommerfrische in günstigem Klima« und diente dazu, der Schwindsucht vorzubeugen, einer der Plagen, die die Gesundheit von Kindern bedrohten. Gebt einem kranken Kind das Meer, und das Meer wird euch ein gesundes Kind zurückgeben, lautete der Slogan; wer weiß, ob das stimmte. Jedenfalls bot die Ferienkolonie jemandem, der es sich eigentlich nicht leisten konnte, gute Luft und der Jugendorganisation der Faschisten die Möglichkeit, im Sommer um Anhänger zu werben. Die Leiterin des Instituts, die sich an Enrica als ihre beste Schülerin erinnerte, hatte sie in die Arme geschlossen und ihr versprochen, sich bei der ersten Gelegenheit für sie zu verwenden, wenn ein Platz frei würde, und nur wenige Tage später hatte sie ihr geraten, sich dort zu bewerben.
Der Vater hatte protestiert; er hatte sie lieber bei sich in der Nähe. Die Mutter jedoch hatte sie unterstützt, in der Hoffnung, eine andere Umgebung könne auch die Chancen für Enrica erhöhen, eine Bekanntschaft zu machen.
Und so befand sich Enrica jetzt an Bord eines Schiffes, das sie nach Ischia bringen würde, unterwegs zu einer Sommerkolonie, wo man einer Lehrerin verlustig gegangen war, die skandalöserweise ein Kind erwartete, obwohl sie nicht verheiratet war. Es schien ganz so, als wollte die Vorsehung Enrica bei ihrer Entscheidung beistehen, sich von jenen grünen und kummervollen Augen, die ihr jede Nacht im Traum erschienen, fernzuhalten, nächtlichen Stunden, in denen sie sich ewig im Bett herumwälzte, bis sie endlich Schlaf fand.
Sie schloss die Augen vor der Sonne, schluckte und versuchte, sich mit der Aussicht abzulenken, die sich ihr bot. Sie erkannte Pizzofalcone, die Kartause von San Martino, Castel Sant’Elmo, das dort oben auf den leuchtend grünen Hügeln thronte, sowie Castel dell’Ovo, das sich aufs Meer hinaus erstreckte wie ein langer Finger aus Stein. Dahinter ragte der Hügelzug des Posillipo ins Azurblau des Golfes hinein, von Hunderten von Booten umschmeichelt, die nach einer langen Nacht des Fischens nach Hause fuhren. Von dieser Warte aus gewann die Stadt, die doch so treulos und überfüllt war, eine bewegende Schönheit, die einen Hauch Heimweh in Enrica aufkommen ließ. Sie fragte sich, wie es wohl um die Gefühle derer bestellt war, die gezwungen waren auszuwandern und sich diesem Spektakel in dem Wissen zuwandten, dass sie es in ihrem Leben vielleicht nie mehr zu Gesicht bekommen würden.
Auf einmal stieg Verzweiflung in ihr auf und drückte ihr die Kehle ab. Die Dame mit dem kreidebleichen Gesicht, die offenbar schwer gegen das Erbrechen ankämpfte, brachte die Kraft auf, sie zu fragen, ob es ihr gut gehe. Enrica nickte mit einem etwas angespannten Lächeln und wandte sich dann zum Meer, um den Ozean von Tränen zu verbergen, der ihre Augen zum Überlaufen brachte.
Ich werde glücklich sein, sagte sie sich vor. Ich werde glücklich sein.
Und weinte still vor sich hin.
IV
Einmal im Jahr kommt in dieser Stadt die Hitze. Die wahre Hitze.
Gewiss, mancher wird sagen, dass es hier des Öfteren Zeiten gibt, in denen die Temperaturen zu hoch sind, und dass es dafür im Allgemeinen nie wirklich kalt wird. Aber so ist es nicht. Ein anderer wird behaupten, oft gebe es auch außerhalb der Jahreszeit Tage, an denen der Südwind Luft aus Afrika über die Stadt weht, Luft, die die Menschen verrückt macht und sie zu Taten, Worten und Gedanken zwingt, die ihnen ansonsten nicht einmal im Traum einfallen würden. Und das stimmt auch. Aber die große Hitze, die wahre Hitze, die kommt einmal im Jahr.
Es ist keine Überraschung. Man rechnet schon seit dem Frühjahr damit, wenn es überall nach Blumen duftet und die Krawatten gelockert werden, wenn es angenehmer ist, sein Schwätzchen unten auf der Straße oder bei offener Tür zu halten oder von Fenster zu Fenster in den engen Straßen und Gässchen der Innenstadt. Jetzt wird’s heiß, sagen die Leute im Viertel und hängen fröhlich die Bettlaken auf die Leine, die zum Beispiel zwischen den Balkonen von zwei Mietshäusern aufgespannt ist, sie sagen es lächelnd, doch in ihrer Stimme schwingt auch ein wenig Beunruhigung mit. Denn sie wissen, dass die Hitze, die wahre Hitze, eine ernste und überaus schreckliche Angelegenheit ist.
Die Hitze – die wahre Hitze – kommt nicht urplötzlich. Zu einer ganz bestimmten Zeit nähert sie sich vom Meer her, wie eine Flotte in Kampfformation. Erste Boten sind ein paar Wolken, vielleicht ein kurzer Wolkenbruch, einfach so, wie ein Ablenkungsmanöver, bevor der wirkliche Angriff losgeht. Die Hunde heben schnuppernd ihre Schnauzen, manche winseln. Die Alten seufzen.
Dann kommt eine Nacht, die, anders als gewöhnlich, keinerlei Abkühlung bringt, und das ist das untrügliche Vorzeichen. Die Männer gehen im Haus umher und suchen vergeblich nach einer Kombination aus offenen Fenstern, durch die sich ein gewisser Luftzug herstellen lassen könnte. Die jungen Mütter sitzen ängstlich am Bettchen ihrer Kinder und bewachen sie im Schlaf, weil sie zu oft die Mär von plötzlich verstorbenen Neugeborenen gehört haben, die bei Morgengrauen tot in der Wiege liegen.
Am ersten Tag der Hitze geht die Sonne auf, und jeder fürchtet sie. Sie steigt am Himmel auf wie ein großes Schlachtschiff, das in einen Hafen fährt, bedrohlich und gleißend. Vor ihr gibt es kein Entrinnen. Die Straßenhändler werden von ihr überrascht, wenn sie bereits ihren Geschäften nachgehen, und sind auf der Stelle schweißgebadet unter der Last ihrer Waren, die sie, sofern verderblich, sogleich versuchen, vor der Gluthitze zu schützen, damit sie ansehnlich bleiben, jedoch nur mit geringem Erfolg, denn schon binnen Kurzem sieht alles schlaff, armselig, hässlich aus. Wie die Verkäufer selbst, die alle Hände voll zu tun haben, mit rauen Schreien die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu lenken, die sich jedoch hüten, auf ihre Balkone hinauszutreten, wenn es sich eben vermeiden lässt. Noch schlimmer ergeht es den Kaufleuten, die reglos und in banger Erwartung auf den Schwellen ihrer Läden stehen, in deren Innerem es unerträglich ist, wenn sie nicht wenigstens mit einem sich träge drehenden Ventilator ausgestattet sind.
Allein die Kirchen sind die Rettung, und ihre kühlen Schiffe füllen sich mit Betschwestern, aber auch manch anderem, der das Jahr über mehr damit beschäftigt ist zu sündigen als Buße zu tun. Die Frauen legen mit kühlem Wasser getränkte Tücher auf ihre kleineren Kinder und halten sie im Schatten, während sie für die größeren einen Waschzuber mit frischem Wasser füllen, das schon bald warm und abgestanden sein wird, jedoch immerhin zur Belustigung der Kinder dient, die sich gegenseitig nass spritzen und schreien.
Schon von den ersten Morgenstunden an herrscht großer Andrang an den Stränden, doch sie wirken dennoch wie reglos. Denn die Hitze, die wahre Hitze, ist wie eine eigene Dimension, in der sich die Zeit ausdehnt. Worte wie Klänge verändern sich, die Gedanken nehmen einen anderen Verlauf, wenn diese wahre Hitze herrscht. Die Jungen spielen nicht Tauziehen, die jungen Mädchen gehen nicht paarweise oder zu viert an der Promenade spazieren, um ihre schicken Hüte oder das Nadelstreifenkostüm mit dem Lackledergürtel vorzuführen, das immerhin den Blick auf einen Teil der Waden freigibt. Selbst für einen gewagten Kopfsprung vom Steg ist es schlichtweg zu heiß, ebenso wie für ein Bad in den Wellen, die schlagartig zu warm geworden sind, um noch zu erfrischen. Lieber suhlt man sich, träge wie ein Walross, im seichten Wasser, plaudert ein wenig oder taucht gelegentlich zur Abkühlung den Kopf ins Wasser. Wie gestrandete Wale liegen die wohlbeleibten Honoratioren halb nackt direkt vorne an der Wasserlinie, plaudern über Geschäfte oder Politik und schmökern in der Morgenzeitung.
Ganz allmählich, während die Stunden vergehen, hat die Sonne immer weniger Mitleid. Ganz gleich, worüber man sonst redet – ob über Tagespolitik, die Lottozahlen, die amerikanische Wirtschaftskrise von vor wenigen Jahren und die darauffolgende Depression, von der emigrierte Verwandte in ihren düsteren Briefen berichtet haben –, jedes Thema wird von der Hitze, der wahren Hitze, weggefegt. Man schaut sich ins Gesicht, blass und leidend, von einer Straßenseite zur anderen, man winkt sich mit schlaffer Hand zu, haucht bestenfalls mit den Lippen einen entsprechenden Kommentar (»Was für eine Hitze, oje, was für eine Hitze!«) und geht schlurfend weiter. Man verabredet sich in den Arkadengängen der Galleria Umberto, die müde unter Glasdächern vor sich hin welken, immer auf der Suche nach feuchtem, aber wenig zufriedenstellendem Schatten, und diskutiert darüber, wie lange wohl dieser Zustand anhalten mag.
Und die Geschichten, die man sich erzählt, ähneln sich: »Heute Nacht, Herr Nachbar, habe ich mich auf den Fußboden gelegt, um ein bisschen Erleichterung zu finden.« Oder: »Stell dir vor, ich hab nur in Unterhemd und Unterhose auf dem Balkon übernachtet, und die Mücken haben mich bei lebendigem Leib aufgefressen, buchstäblich aufgefressen. Sieh nur, was ich für Stiche an den Armen habe!« Man fächelt sich mit dem Strohhut Luft zu, und die jungen Männer mit den zweifarbigen Schuhen schauen sich die Signorine, die langsam vorübergehen, erst einmal genauer an, bevor sie die Anstrengung unternehmen, sie anzusprechen. Die zahlreichen übergewichtigen Herren und beleibten Damen denken angesichts der Hitze, der wahren Hitze, reumütig an die Jahre ihrer verlorenen Jugend zurück, als sie noch beschwingt und leichtfüßig über den Boden schwebten; sie sind zwar froh darüber, weniger Appetit zu haben, essen dafür aber bereits das vierte Eis am Tag, um sich die trockene Kehle zu befeuchten.
Um die Tischchen vor den Cafés unter den breiten weißen Markisen wird mit harten Bandagen gekämpft, und wer als Sieger Platz nehmen darf, nimmt sein Getränk mit kleinsten Schlückchen zu sich, während diejenigen, die warten müssen, ihnen mit kaum verhohlenem Groll dabei zusehen und den schlimmsten aller Tode wünschen. Die Kutscher warten vergebens auf Fahrgäste und fechten ihre kleinen Scharmützel um Kundschaft im Schatten der Häuser aus, wo sie die meiste Zeit dösend auf ihren Droschken sitzen, mit offenem Mund, den Hut über den Augen.
Die Straßenbahnen, die quietschend und rumpelnd auf das Hügelland und das Meer zufahren, sind voll besetzt mit Familien, die auf der Suche nach Abkühlung sind. In ihrem Inneren herrschen schwüle Luft und der Geruch von Schweiß, und alle beneiden die blinden Passagiere, die in Trauben außen an den Trams hängen und kostenlos mitfahren, halb nackt und dunkel wie Afrikaner, fröhlich schnatternd wie Hanswurste. Immer wieder hält der Schaffner die Tram an, steigt aus, um sie zu verscheuchen, und sie laufen lachend davon wie ein Schwarm Schwalben, um nur kurz darauf, wenn die Straßenbahn weiterfährt, wieder aufzuspringen.
Wenn die Hitze, die wahre Hitze, kommt, senkt sich über die Stadt ein Schleier der Stille und der Sorge, denn alle sind sich dessen sicher, dass das nie enden wird. Jedes Kleidungsstück, selbst das leichteste, fühlt sich an wie eine Schicht dicker Wolle, unerträglich, und breite, dunkle Schweißflecken erscheinen unter den Achseln und am Brustkorb und durchdringen den Stoff. Gezwungen, Jacke und Krawatte zu tragen, denken alle, die im Dienst treppauf, treppab unterwegs sind, dass sie die Kleidungsstücke bestimmt früher reinigen müssen als geplant, und seufzen über die zusätzlichen Kosten, während die Frauen im heiratsfähigen Alter ihre Ausgänge aufs Minimum reduzieren, um die in der Nachbarschaft gelegte Dauerwelle so wenig wie möglich in Mitleidenschaft zu ziehen.
So mancher steht auf dem Balkon und schaut sehnsüchtig die Straße entlang, auf der Suche nach dem Eisverkäufer, der mit lauten Rufen auf sich aufmerksam macht. Er wird teurer sein als sonst, wofür es lautstarke Proteste hageln wird, doch wer kann, wird sich trotzdem ein Stückchen Kälte gönnen und damit die Hoffnung darauf, dass die Hitze, die wahre Hitze, früher oder später vorbei sein wird. Mit dem Eismann feilscht man anders als mit anderen Straßenhändlern. Genauer gesagt, wird überhaupt nicht gefeilscht; er kennt genau die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden und bleibt nicht einmal stehen, wenn er nicht das Klimpern von Münzen hört, auch weil jeder Halt mit dem Schmelzen des weißen Goldes einhergeht, das er auf seinem Wagen geladen und mit Decken und Lumpen abgedeckt hat. Hat man ihm den gewünschten Preis gezahlt, zieht er mit einem Eisenhaken den Eisblock hervor, schneidet mit einem krummen, schwarzen Messer unter den faszinierten Blicken der Kinder ein Stück ab, während irgendein Gassenjunge freudestrahlend die Splitter aufhebt, die dabei auf den Boden fallen. Bewohner höherer Stockwerke können das Eis aufgrund seines hohen Gewichts nicht mit einem Korb nach oben ziehen, so wie man es mit Obst oder Gemüse macht, dafür ist der Weg über das dunkle und steile Treppenhaus noch angenehmer, trägt man doch eine kühle Last in den Armen.
Die Hitze, die wahre Hitze, dauert nur ein paar Tage an, und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, fallen diese Tage stets auf eine Zeit zwischen Beginn und Mitte Juli. Tage ohne Regen und ohne Frieden, eingehüllt von gleißendem Sonnenlicht, das durch die Dampfschwaden, die in der Luft über den Straßen hängen wie ein Damoklesschwert, milchig wird. Tage, an denen die Alten schweigsam werden und mit verlorenem Blick ins Leere schauen, an denen es keine Geschichten zu erzählen und keine Zipperlein zu bejammern gibt, an denen man sogar die Nachbarn oder Bekannten aus der Gasse mit bissigen Kommentaren verschont. Oft genügt schon ein mühsames Schnaufen als Ersatz für eine Antwort, und auf die besorgten Fragen der Kinder, wie es einem gehe, reagiert man manchmal nicht einmal einsilbig.
Die Hitze, die wahre Hitze, geht unter die Haut, dorthin, wo in den Kammern des Gedächtnisses die Erinnerungen sitzen, und davon haben die Alten bekanntlich am meisten. Auf einmal stehen Ereignisse vor ihrem inneren Auge, die viele Sommer zurückliegen, lächelnde Gesichter und vergessene Liebeslieder, Spaziergänge an einem anderen Meer, das doch noch viel blauer war. Zahnlose, sabbernde Greisinnen werden wieder zu anmutigen Tänzerinnen, die auf längst vergessenen Festen die Tarantella tanzen und darauf warten, dass ihr Liebster sie in den Halbschatten eines Torgangs lockt, der so heimelig ist wie ein wohlig dunkles Bett. Und alte Männer, die schon seit Jahren an den Stuhl gefesselt sind, verwandeln sich in junge Fischer mit tief gebräunter Haut, die des Nachts in ihrem Boot sitzen, in charmanter Begleitung, und unter einem Mond, der noch viel heißer scheint als die Sonne, von Liebe sprechen. Die Hitze, die wahre Hitze, kann so feige und hinterlistig sein, und beutelt all diejenigen, die schwach sind, mit Wehmut und Traurigkeit.
Sie dauert nur ein paar Tage an, die wahre Hitze. Doch in diesen Tagen verändert sich die Atmosphäre, und die Stadt wird eine andere. Sie hat den Geschmack von Eis und den Geruch von Meer, doch sie kann auch die schwarze Farbe des Todes annehmen.
Denn die wahre Hitze, sie kommt aus der Hölle.
V
Noch zwanzig Schritte und er würde es sehen. Nicht einmal dreißig Meter, gleich hinter der Ecke. Er holte tief Luft und ging schneller.
Wenn er konnte, machte er einen Umweg, falls er sich dadurch nicht allzu sehr verspätete; und wenn es wirklich nicht zu vermeiden war, versuchte er, schneller daran vorbeizukommen, um den Moment abzukürzen. Den Moment, in dem die kalten Finger des Leids ihm über die Haut strichen und nach seinem Herzen griffen.
Fast war er jetzt an dem Punkt angelangt und senkte den Blick; die Hände in den Hosentaschen, die leichte Jacke offen über dem weißen Hemd, der schmale schwarze Binder mit einer goldenen Krawattennadel über der Knopfleiste festgemacht – das einzige Zugeständnis an eine gewisse lässige Eleganz. Hätte er einen Hut getragen, würde er aussehen wie so viele junge Männer, Angestellte oder Geschäftsleute, die auf den Straßen der Stadtmitte unterwegs waren, durch die Arbeit dazu gezwungen, trotz der mörderischen Hitze jener Tage auszugehen. Doch Luigi Alfredo Ricciardi war kein Angestellter, nicht einmal ein Anwalt, wenngleich er Jurisprudenz studiert hatte. Er war Polizeikommissar und wie immer zu dieser frühen Morgenstunde auf dem Weg ins Präsidium, wo sich sein Büro befand.
Doch auf dem Weg wartete jemand auf ihn. Jemand, der in seiner körperlichen Gestalt gerade von zwei schwitzenden städtischen Totengräbern weggetragen worden war, unter den betrübten Blicken der kleinen Menge, die sich leider an derlei gewöhnt hatte: an den Anblick eines Kindes, das von einer Straßenbahn überrollt worden war. Das geschah bedauerlicherweise nur allzu oft; Waisenkinder, die sich um ein Stück Brot gebalgt hatten, ein Gassenjunge, der hinter einem Ball aus Stofffetzen herlief, ein kleiner Streuner, der einer kurz abgelenkten Mutter entfleucht war. Oder einer der vielen Jungs, die unerlaubterweise und unter größter Gefahr auf den Trittbrettern dieser rumpelnden Verkehrsmittel mitfuhren, irgendwann den Halt verloren und von deren schweren Rädern zerteilt wurden.
Genau das war dem kleinen Jungen passiert, der nur wenige Zentimeter von der Stelle, wo er sein Leben gelassen hatte, auf Ricciardi wartete. Ohne hinzuschauen, erfassten die leidgeprüften Augen des Kommissars das grausige Bild eines unversehrten Gesichts unter einem gegen Läusebefall kahl rasierten Schädel, die schmalen Schultern in einem viel zu großen Hemd, die bis zum Ellbogen zerschnittenen Arme. Die schwarze Höhle des Mundes, aus der ein Rinnsal Blut quoll, und die geflüsterten und doch deutlich zu hörenden Worte: cado, cado, nun ’o tengo cchiù, ich falle, ich falle, ich kann mich nicht mehr halten. Eine Stelle zum Festhalten, die plötzlich nicht mehr da war, die Kraft der Arme, die nicht mehr reichte. Der abgetrennte Oberkörper ragte halb in die Luft und sagte Ricciardi, dass der arme Tropf nicht sofort gestorben und ihm so mancher Schmerz nicht erspart geblieben war.
Mit einem flauen Gefühl in der Magengrube fing Ricciardi an zu laufen, presste ein Taschentuch vor seinen Mund. Gott, war das unerträglich. Ein alter Bettler, der im Schatten eines Hauses vor sich hin dämmerte, hob beim Klang der schnellen Schritte des Commissario den trüben Blick und sah ihm mit missgünstiger Neugier hinterher; doch etwas an diesem jungen Mann, der da an ihm vorbeieilte, erschütterte ihn, und er wich an die Mauer zurück. Manche sehen es mir im Gesicht an, dass ich verdammt bin, dachte Ricciardi.
In letzter Zeit war sein Leiden schlimmer als sonst. Nicht einmal die Erleichterung, Enrica durchs Fenster zu sehen, war ihm mehr vergönnt. Die junge Frau war verschwunden, und hinter den Fenstern ihrer Wohnung waren nur die flüchtigen Schemen ihrer Familie zu erkennen. Ricciardi machte es ihr nicht zum Vorwurf, nein – rein verstandesmäßig freute er sich für sie. Was konnte einer wie er ihr schon bieten? Vielleicht hatte sie ja jemanden kennengelernt, oder sie hatte beschlossen, sich nicht mehr mit dem Anblick eines Mannes zu begnügen, der nicht den Mut aufbrachte, die Initiative zu ergreifen. Wenn du nur wüsstest, mein Liebes, welche Hölle in meinem Herzen wütet, und wie sehr ich mir doch wünschte, dir nah zu sein, so wie es sich jeder Mann wünscht, eine Frau zu lieben, zu umarmen und für den Rest des Lebens ihr Geliebter zu sein. Wenn du wüsstest, wie gerne ich normal wäre und die Abertausende Gedanken und kleinen Kümmernisse hegen würde, die alle haben, statt den abgetrennten Rumpf eines Kindes zu sehen und zu spüren, der mich an einer Straßenecke mit seinem Blut besudelt.
Ricciardis Leben war durch die Abwesenheit des Mädchens leerer geworden, als er es sich je vorgestellt hätte. Selbst Rosa, die noch vor Ostern von ihr gesprochen hatte wie von einer kürzlich gemachten Bekanntschaft, die man ja vielleicht einmal zu sich einladen könnte, erwähnte Enrica schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Ricciardi war sehr in Versuchung gewesen, sie nach dem Grund zu fragen, doch Rosa selbst war für ihn Anlass größter Besorgnis.
Denn seiner Tata, seiner alten Kinderfrau, ging es nicht gut. Mehrfach hatte er Rosa dabei ertappt, wie sie sich irgendwo festhalten musste, weil ein Schwindel sie befallen hatte, was sie jedoch entschieden leugnete; wie sie die rechte Hand öffnete und schloss, als wäre sie ihr eingeschlafen. Ab und zu musste sie sich setzen und stand auch nicht auf, wenn er das Zimmer betrat, was sie aus Gewohnheit tat, seit Ricciardi ein Kind gewesen war. Ihr fielen Dinge aus der Hand, auch wenn sie leicht waren, etwa eine Gabel, und es kam vor, dass sie mitten im Satz verstummte, als hätte sie den Faden verloren. Ricciardi hatte versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie sich von Bruno Modo untersuchen lasse, dem Arzt am Pellegrini-Krankenhaus, wo er die Funktion eines Gerichtsmediziners innehatte, einem der wenigen Menschen, denen der Kommissar vertraute. Doch Rosa hatte sich mit solcher Entschiedenheit geweigert, dass er von weiteren Versuchen, sie zu überzeugen, Abstand genommen hatte. Kommt überhaupt nicht infrage, hatte sie gesagt. Denken Sie lieber an sich selbst, der Sie immer blasser und dünner werden. Und jetzt setzen Sie sich und essen, und dass mir ja nichts auf dem Teller bleibt.
Ricciardi hatte nie darüber nachgedacht, dass er Rosa einmal verlieren könnte. Seit er sich erinnern konnte, und auch vorher, war die Frau jeden Augenblick bei ihm gewesen. Viel mehr als seine Mutter, die gekränkelt hatte und früh gestorben war. Und er konnte es sich einfach nicht vorstellen, wie er leben sollte, ohne sich die Gardinenpredigten der alten Kinderfrau anzuhören, ihre Litaneien, ihre Besorgnis, ihren Kummer, ihre Vorwürfe und das Gejammer über sein Leben und die Einsamkeit, zu der er sich aus freien Stücken verdammte und die die alte Frau für absurd hielt. Doch wenn Rosa nicht zum Arzt wollte, dann gab es keine Möglichkeit, sie dazu zu zwingen.
Am Abend zuvor hatte Rosa ihm mitgeteilt, sie habe nach ihrer Nichte Nelide geschickt, damit sie ihr helfe, was Ricciardi ihr schon oft vorgeschlagen hatte. Wenigstens das hatte er erreicht. Vielleicht war sie ja bald wieder auf dem Posten, wenn sie sich nur ein wenig ausruhte, und alles wäre wieder in Ordnung.
Trotz der frühen Stunde herrschte bereits eine sengende Hitze. Aus einem offenen Fenster drang das Trällern einer schönen Frauenstimme an Ricciardis Ohr. Auf einmal musste er an Livia denken, die auch Sängerin gewesen war und ihn gelegentlich dazu verdonnerte, mir ihr ins Theater zu gehen. Doch mit ihr auszugehen gefiel ihm, und sei es auch nur, weil ihn die seicht dahinplätschernden Abende mit ihr von seiner Arbeit ebenso ablenkten wie von seiner Sorge um Rosa und vor allem seinem Kummer um die entschwundene Enrica.
Er wusste, dass er Livia etwas bedeutete. Das hatte sie ihm selbst gebeichtet. Und Ricciardi fragte sich, warum ausgerechnet er, da sie doch so reich und anziehend war, dass sie alle Männer hätte haben können. Vielleicht, dachte er, während er die letzte Etappe seines Weges in Angriff nahm, reizte Livia ja gerade die Tatsache, dass er keinerlei Neigung zeigte, ihr den Hof zu machen, eine Haltung, die für sie vermutlich eine angenehme Abwechslung war.
Im Übrigen lief das mit Livia in geregelten Bahnen. Sie pflegten eine Freundschaft, indem sie miteinander ins Theater oder ins Lichtspielhaus gingen, und das war’s. Keine gesellschaftlichen Ereignisse, kein Essen, kein Aperitif, keine weiteren Begegnungen. Sie waren einander nicht versprochen und würden es auch nie sein. Man verbrachte manch angenehme Stunde miteinander, tauschte sich über die Theatervorstellung aus, plauderte ein wenig, während er sie im Automobil nach Hause begleitete; dies alle paar Wochen einen Abend lang. Sie verlangte nicht mehr von ihm, und nichts anderes wäre er bereit gewesen, ihr zu geben. Das Ritual war immer gleich: Ihr Fahrer erschien im Präsidium und überreichte ihm ein Kuvert mit den Eintrittskarten und einem Billett, auf dem das Datum und die Uhrzeit der Aufführung vermerkt waren; wenn Ricciardi einverstanden war, fand sich der Fahrer am verabredeten Tag wieder ein und holte ihn vom Büro ab.
Er hatte den Verdacht, dass Rosa von Livia nicht begeistert war, weshalb er es vermied, von ihr zu sprechen. Was ihn betraf, so übte die ehemalige Sängerin durchaus eine gewisse Anziehung auf ihn aus, und es war nicht zu leugnen, dass es ihm schwerfiel, den Blick von ihrem herrlichen Körper zu lösen, der stets nach dem letzten Schrei gekleidet war, ihrem makellosen Gesicht und den vor Fröhlichkeit sprühenden Augen. Außerdem war es höchst angenehm, mit ihr ein Theater zu betreten und die Blicke zu spüren, die sich auf seine Begleiterin richteten – bewundernd die der Männer, voller Neid die der Frauen. Doch hätte er tatsächlich sein Herz einer Frau schenken wollen, wenn nicht jener Fluch an ihm haftete, so hätte er sich immer für die liebliche Enrica entschieden, die in seinen Augen von unvergleichlicher Schönheit war.
Während er in Gedanken – und ohne es zu wollen – von einer Frau zur anderen wanderte, fand er sich auf einmal vor dem Eingang des Präsidiums wieder und sah sich einer ebenso vertrauten wie imposanten Gestalt in der Uniform eines Brigadiere gegenüber.
»Maione? Was tust du denn schon hier?«
Der Mann tippte sich an die Mütze und salutierte schneidig.
»Was soll man machen, Commissario? Durch die Ferien sind die Dienstpläne durcheinandergeraten, aber die Änderungen kommen mir durchaus gelegen. Ich hab mit Cozzolino getauscht, der Junggeselle ist und seinen Urlaub nutzt, um sich eine Braut zu suchen, wobei ich mich frage, wie der alte Wachhund sich mit diesem Gesicht eine angeln will. Jedenfalls war es ganz gut so, denn in der Poliklinik ist was passiert. Vor Kurzem kam ein Anruf von dort. Ich hab Camarda und Cesarano vorgeschickt und bin hiergeblieben, um auf Sie zu warten, weil ich wusste, dass Sie bald kommen würden. Was meinen Sie, gehen wir?«
VI
Die Poliklinik der Universität von Neapel lag mitten im Gassengewirr der Innenstadt und war auf dem weitläufigen Gelände eines ehemaligen Klosters errichtet worden.
Mit ihrem hohen Tor tauchte sie urplötzlich vor einem auf, direkt hinter einer engen Kurve, die, wie alle anderen, nur auf einen harmlosen kleinen Platz zu münden schien, der wiederum auf ein anderes Gässchen führte und so weiter und so fort. Ricciardi dachte, dass die Stadt ja vielleicht genau so angelegt worden war – ohne Plan: ein Gässchen nach dem anderen und ein Platz nach dem anderen, wie ein lebendiges Wesen, das sich ganz allmählich in die Länge ebenso wie in die Breite, vom Meer bis in die Hügel hinein erstreckte, bis man schließlich vor einem herrlichen patrizischen Palazzo stand, mit üppig blühenden Blumenbeeten hinter einem gewaltigen Portal, und begriff, dass das alles eben doch einen Sinn hatte.
Vor dem Tor hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt, die von zwei Wärtern in Schach gehalten wurde. Der Anblick von Maiones Statur und seiner Uniform genügte, und man trat beiseite, um die beiden Polizeibeamten durchzulassen. Der ältere der beiden Wachleute, ein stämmiger Mann mit Schnauzbart und einer Uniform, die ihm um mehrere Größen zu klein war, salutierte, bedeutete ihnen, ihm zu folgen, und ging wortlos voraus.
Sie betraten einen baumbestandenen Parkweg, auf dem es immer noch angenehm frisch war. Die Blumenbeete waren gepflegt, der Rasen frisch gemäht. Ricciardi und Maione blickten sich um. Die Poliklinik setzte sich aus mehreren kleineren Gebäuden von gleicher Höhe zusammen, vier Stockwerke plus Hochparterre, alle in gutem Zustand. An den Fenstern standen Menschen, einige davon Männer im weißen Kittel, auch ein paar Krankenschwestern mit Häubchen. Es lag die typische Atmosphäre des Wartens in der Luft, die sich erst durch das Eintreffen der Polizei lüftete, als öffnete sich durch ihr Erscheinen ein Vorhang, und das Spektakel könne, zur großen Erleichterung der Zuschauer, endlich beginnen.
In der Nähe eines der Gebäude standen mehrere Personen im Kreis versammelt. Gleich daneben war ein einziges Fahrzeug geparkt, schwarz und cremefarben, nagelneu. Maione entdeckte einen der beiden Polizisten, die er vorausgeschickt hatte, und rief nach ihm.
»Cesara’, da sind wir. Na, was gibt’s?«
Der Mann kam ihm entgegen und salutierte zackig.
»Jemand ist gestürzt. Offenbar von da oben.«
Er zeigte vage auf eines der Gebäude.
Maione schnaubte und sagte, seinen Untergebenen nachäffend: »Soso, jemand ist gestürzt, offenbar von da oben. Geht’s vielleicht ein bisschen genauer? Na, ist ja gut. Und sag mir bitte, mit wem man hier reden muss, um mehr zu erfahren.«
Als sie näher traten, sahen sie, was sich in der Mitte des Kreises befand. Bislang war nur zu erahnen, dass es sich bei dem Toten, der mit dem Gesicht nach unten lag, um einen nicht mehr ganz jungen Mann handelte. Er trug keine Jacke, das Hemd war im unteren Bereich zerrissen, ein Hosenträger hatte sich gelöst. An einem Fuß fehlte der Schuh, und unter der hochgerutschten Hose war ein sandfarbener Strumpf zu erkennen, der an einem schwarzen Sockenhalter befestigt war. Ricciardi nickte Maione zu, und der Brigadiere sagte zu Camarda, dem anderen Polizisten, er solle im Präsidium anrufen und einen Fotografen anfordern. Außerdem solle Dottor Modo aus dem Pellegrini-Krankenhaus kommen, falls er gerade Dienst habe.
Gleich neben dem Leichnam standen zwei Krankenschwestern, von denen eine weinte, ein Gärtner mit einer Harke in der Hand und Gummistiefeln an den Füßen, ein Wärter in der gleichen Uniformbluse wie der, der die beiden Polizisten hereingeführt hatte, sowie ein Mann im weißen Kittel. Maione bat sie mitzukommen und entfernte sich einige Schritte mit ihnen, weil er wusste, dass Ricciardi in den ersten Minuten am Tatort immer gerne allein war.
Der Commissario stellte fest, dass die Haltung des Toten durchaus auf einen Sturz schließen ließ, der wahrscheinlich aus größtmöglicher Höhe erfolgt war. Und tatsächlich stand im obersten Stockwerk des Gebäudes, das mindestens zwanzig Meter über dem Boden liegen musste, ein Fenster offen. Anscheinend hatte der Mann sogar ein wenig Anlauf genommen, denn er war über das Gebüsch hinweg gefallen, das direkt neben der Hausmauer den Parkweg säumte. Entweder er war gestürzt, oder jemand hatte ihn gestoßen. Kurz sammelte sich Ricciardi und wandte sich dann abrupt ab.
Leicht zurückgesetzt und im Schutze des spärlichen Schattens, den die Bäume auf der anderen Seite des Weges spendeten, stand der Commissario da und betrachtete den Toten näher. Sein Rumpf war im Vergleich zum Becken deutlich verschoben, als wäre der Körper zweigeteilt; den gleichen Eindruck hatte man, wenn man die Gestalt entlang der vertikalen Achse betrachtete, denn eine Hälfte des Kopfes war nahezu unversehrt, während die andere vom Aufprall sehr in Mitleidenschaft gezogen war. Bestimmt, dachte der Commissario, würde der Arzt bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung ein gebrochenes Rückgrat und einen Schädelbruch feststellen. An der Stirn des Toten klaffte eine große Wunde, aus der sich bereits gerinnendes Blut ergoss und die gesamte rechte Seite des Gesichts bedeckte, welches zerknautscht und deformiert war. Das Jochbein war eingedrückt, und an der Stelle des Mundes gähnte nur noch ein schwarzes Loch. Vom rechten Auge nichts zu sehen. Die linke Gesichtshälfte war unversehrt, auf ihr stand ein wie gerührter, träumerischer Ausdruck; das Augenlid war halb geschlossen, und um die Lippen spielte eine Art Lächeln. Es war ein schauerlicher Anblick.
Ricciardi bemerkte, dass der Kopf mit der rechten Seite auf dem Boden lag, woraus sich auf die Dynamik des Sturzes schließen ließ. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf das Bild und stellte sich, wie schon so oft, dem Schmerz eines anderen Menschen, der wie eine Botschaft vor Ricciardis innerem Auge erschien. Hier war es nur ein leises Wispern, das der Verstorbene von sich gab: Sisinella e l’amore, l’amore e Sisinella, Sisinella e l’amore, l’amore e Sisinella. Sisinella und die Liebe, die Liebe und Sisinella. Der letzte absurde Gedanke am Ende des Sturzes und zu Beginn des Todes. Der Commissario fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, das mit einem Schweißfilm überzogen war, und konnte trotz der Hitze einen Schauder nicht unterdrücken.
Er wandte sich wieder Maione zu, der inzwischen die Personalien der Menschen aufgenommen hatte, welche kurz zuvor um den Leichnam gestanden hatten. Dann stellte der Brigadiere alle einander vor.
»Das hier ist Polizeikommissar Ricciardi, und ich bin Brigadiere Raffaele Maione.«
Der Mann mit der Harke ging in Habtachtstellung und stellte sein Gartengerät kerzengerade neben sich auf, als wäre es ein Gewehr.
»Caporale Vitale Pollio, Commissario. Zu Ihren Diensten.«
Maione musterte ihn amüsiert. »Rührt euch, Caporale! Glaubt der doch glatt, er ist noch an der Front! Signor Pollio ist hier der Gärtner. Und er ist derjenige, der die Leiche gefunden hat.«
Pollio richtete einen verlegenen Blick auf den Brigadiere.
»Verzeihen Sie, Brigadiere, aber wenn einer mal Soldat war, dann bleibt er es auch, für immer. Ich war im Krieg, wissen Sie, und die Front, die trägt man für immer mit sich herum, wie einen Mantel. Ja, ich war gerade mit den Beeten da hinten beschäftigt. Zuerst hielt ich ihn für einen Haufen Lumpen. Ich dachte, was liegen die da mitten auf dem Weg, diese schmutzigen Lappen? Ich bin näher rangegangen und nahm gleich die Harke mit, weil ich dachte, ich könnte damit was aufheben. Dann habe ich entdeckt, dass es eine Leiche ist. Wissen Sie, Commissario, an der Front musste ich oft aus dem Schützengraben raus, um die Leichen der Gefallenen einzusammeln, und hab deshalb so manche gesehen. Zum Beispiel erinnere ich mich, einmal, nach einem Angriff der Österreicher, da …«
Maione unterbrach ihn entschlossen. »Ja, ja, Pollio, wir haben verstanden. Und als Sie gemerkt hatten, dass es sich nicht um einen Haufen dreckige Lumpen handelt, was haben Sie da gemacht?«
Der Gärtner blinzelte. »Entschuldigen Sie, Brigadiere. Ich hab sofort den Wärter gerufen, den Herrn Gustavo hier. Und ich hab nichts angefasst.«
Ricciardi wandte sich an den Mann in der Uniformbluse, einen dürren Zeitgenossen, der sich ständig umschaute, als fürchtete er jeden Moment das Eintreffen der feindlichen Truppen, die Pollio gerade heraufbeschworen hatte.
»Und dann sind Sie hinzugetreten, Signor …«