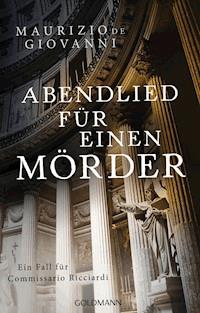8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissario Ricciardi
- Sprache: Deutsch
Neapel in den 30er Jahren: An einem nasskalten Tag Ende Oktober stirbt der Waisenjunge Matteo durch Rattengift. Alles sieht danach aus, dass der Junge das Gift zufällig zu sich genommen hat, das irgendwo ausgelegt war. Und da es sich um einen Straßenjungen handelt, hat keiner ein Interesse daran, der Sache nachzugehen. Außerdem steht ein Staatsbesuch Mussolinis an, und ein Mord auf den Titelblättern der Gazetten würde die Feierlichkeiten empfindlich stören. Commissario Ricciardi glaubt allerdings, dass mehr hinter dem Tod des Jungen steckt, und beginnt zu ermitteln. Dabei stößt er auf eine wahre Tragödie …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Neapel in den 30er Jahren: An einem nasskalten Tag Ende Oktober stirbt der Waisenjunge Matteo durch Rattengift. Alles sieht danach aus, dass der Junge das Gift zufällig zu sich genommen hat, das irgendwo ausgelegt war. Und da es sich um einen Straßenjungen handelt, hat keiner ein Interesse daran, der Sache nachzugehen. Außerdem steht ein Staatsbesuch Mussolinis an, und ein Mord auf den Titelblättern der Gazetten würde die Feierlichkeiten empfindlich stören. Commissario Ricciardi glaubt allerdings, dass mehr hinter dem Tod des Jungen steckt, und beginnt zu ermitteln. Dabei stößt er auf eine wahre Tragödie …Informationen zu Maurizio de Giovannisowie zu lieferbaren Titeln des Autorsfinden Sie am Ende des Buches.
Maurizio de Giovanni
Ein zufälliger Tod
Ein Fall für Commissario Ricciardi
Aus dem Italienischen von Judith Schwaab
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die italienische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi« bei Einaudi.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2018
Copyright © der Originalausgabe 2010 Fandango Libri srl
This edition published by arrangement with Thésis Contents srl and book@LitAG
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © mauritius images / imageBROKER / Barbara Boensch
Redaktion: Sigrun Zühlke
BH · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-17712-6V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Giovanni und Roberto, die mir die wundervollste aller Ängste geschenkt haben
I
Als sich im Morgengrauen die Konturen der Dinge aus dem Regen und der nächtlichen Dunkelheit herausschälten, hätte ein zufälliger Passant sie sehen können – den Hund und den kleinen Jungen am Fuße der breiten Steintreppe, die zum Capodimonte hinaufführte. Allerdings hätte es dazu großer Aufmerksamkeit bedurft, denn sie waren im schwachen Morgenlicht kaum zu erkennen.
Dort saßen sie, mucksmäuschenstill, ohne auf die dicken, kalten Regentropfen zu achten, die unablässig vom Himmel fielen. Sie saßen auf einem steinernen Treppenabsatz, einer Art Bank in einer Schmucknische oberhalb der ersten Stufen. Die Treppe war durch den Regen zu einem reißenden Bach geworden, der Äste und Blätter vom darüberliegenden königlichen Park mit sich führte.
Wäre ein zufälliger Passant stehen geblieben, um die beiden anzuschauen, hätte er sich wohl gefragt, wie es denn möglich sei, dass der Sturzbach mitsamt dem Unrat, den er mit sich riss, zwar unablässig ins Tal strömte, jedoch sowohl den Hund als auch den Jungen bis auf ein paar zufällige Spritzer zu verschonen schien und an ihnen vorbeifloss, ohne sie zu berühren. Immerhin bot die Schmucknische einen gewissen Schutz, auch vor dem Regen; nur das Rückenfell des Hundes zuckte gelegentlich, als würde er bei einem Windstoß erschaudern.
Jemand hätte sich fragen können, was die beiden da machten, der Hund und das Kind, und warum sie an einem verregneten, kalten Herbstmorgen dort verharrten.
Der Junge war grau und hockte, die Hände im Schoß, die Füße nur wenige Zentimeter über dem Boden baumelnd, auf der Stufe, den Kopf leicht nach hinten geneigt, die Augen ins Leere gerichtet, als hinge er einem Traum oder einem Gedanken nach. Der Hund schien zu schlafen, den Kopf auf die Pfoten gelegt, das braun gescheckte Fell klatschnass. Ein Ohr stand nach oben, die Rute lag neben dem Körper.
Jemand hätte sich fragen können, ob die beiden auf etwas oder jemanden warteten. Oder ob sie über etwas nachdachten, das geschehen und ihnen in Erinnerung geblieben war. Oder ob sie lauschten, einem Geräusch, einer leisen Musik.
Jetzt wird der Regen stärker, bahnt sich mit Macht seinen Weg durch die Wolken, als wollte er gegen das Aufgehen der Sonne rebellieren; doch der Hund und das Kind reagieren nicht, wie gleichgültig den Wassermassen gegenüber, die sich auf sie ergießen. Rinnsale kalten Wassers strömen von der Nase des Jungen und dem aufgestellten Ohr des Hundes.
Der Hund wartet.
Der kleine Junge hat keine Träume mehr.
II
Montag, 26. Oktober 1931
Der Anruf kam um halb sieben morgens, eine Stunde vor Ende der Nachtschicht.
Ricciardi hatte nichts dagegen einzuwenden, länger im Präsidium zu bleiben. Für ihn waren dies die entspanntesten Stunden, in denen er lesen oder sich in dem Zimmer neben seinem Büro zu einem angenehmen Nickerchen auf dem Sofa ausstrecken konnte. Und es kam eher selten vor, dass seine Ruhe oder seine Gedankengänge durch einen der Schutzmänner gestört wurden, der an die Tür klopfte, weil der Commissario gebraucht wurde.
Verbrechen geschehen nachts, doch am Morgen werden sie entdeckt; das ist die gefährliche Stunde, wenn das Tageslicht den Schleier über den Untaten der Nacht lüftet.
Ricciardi hatte sich gerade am Waschbecken am Ende des Flurs gewaschen, als er sah, wie Brigadiere Maione die Treppe hochkeuchte.
»Commissario, das hat uns gerade noch gefehlt. Hätten die nicht bis zum Ende unserer Schicht warten können? Jemand hat vom Tondo di Capodimonte angerufen. Er sagt, dort steht eine Milchverkäuferin mit einer Ziege an der Leine. Sie weint.«
Ricciardi ließ sich das Gesagte kurz durch den Kopf gehen, während er sich die Hände abtrocknete.
»Rufen die uns jetzt schon, wenn Milchverkäuferinnen weinen? Und wer weint da eigentlich, sie oder die Ziege?«
Maione breitete die Arme aus, immer noch atemlos vom Erklimmen der Treppe. »Commissario, Sie belieben zu scherzen. Draußen regnet es wie aus Kübeln, und da wir noch eine Stunde Dienst haben, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als bei strömendem Regen bis nach Capodimonte zu gehen. Aber die Sache ist ernst; offenbar sitzt ein totes Kind auf der großen Treppe unterhalb von Capodimonte. Gefunden hat es besagte Verkäuferin, die mit ihrer Ziege an der Leine von einem Bauernhof kam, um in der Stadt Milch zu verkaufen. Sie sagt, sie komme immer dort vorbei, habe den Jungen reglos dort sitzen sehen und ihn an der Schulter gerüttelt, ohne dass er sich gerührt habe. Daraufhin ist sie zum nächstbesten Haus gelaufen, um Hilfe zu holen, und der Einzige, der dort ein Telefon hatte, hat uns angerufen. Wie auch immer – hätte das nicht ein paar Stunden später passieren können? Dann hätte nämlich Cozzolino nasse Füße gekriegt; der ist noch jung und ehrgeizig, während ich bei der kleinsten Feuchtigkeit einen wehen Rücken bekomme und kreuzlahm werde.«
Ricciardi hatte bereits den Regenmantel an. »Also wirst du allmählich wirklich alt, mein Lieber. Komm, schauen wir mal, was da los ist – vielleicht ist es ja nur ein Scherz, du weißt ja, dass manche Leute einen Heidenspaß daran haben, die Polizei ohne triftigen Grund in den Regen hinauszuscheuchen. Danach hast du Feierabend, gehst nach Hause und trocknest dich.«
Der Weg vom Polizeipräsidium bis nach Capodimonte war der gleiche, den Ricciardi jeden Tag zurücklegte, wenn er nach Hause ging. Es war ein langer Weg, zumal er an einer Stelle mit einer atemberaubenden Steigung aufwarten konnte. Dazu musste man die Via Toledo mit ihren imposanten, vornehmen Palazzi entlanggehen, den Largo della Carità und Spirito Santo überqueren, am Museo Nazionale vorbei; dann änderte sich die Gegend schlagartig, es ging bergauf und bergab durch das Gassengewirr der Quartieri Spagnoli, des Hafens und der Sanità, allesamt Gegenden, in denen das Leben brodelte, ein Miasma aus Schmerz und Lebensfreude und Armut.
Das dachte Ricciardi jedes Mal, ob am Morgen oder am Abend, wenn er die argwöhnischen Blicke derer auf sich spürte, die mit allen Mitteln zu verbergen suchten, auf welche Weise sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Diese Straße sagte so viel über die Stadt, in der sie alle lebten. Sie sagte alles.
Und sie veränderte sich ständig, je nach Jahreszeit: ob es nun der glühend heiße Sommer mit seinem Gestank nach verrottendem Müll war, der duftende Frühling mit seinen Obst- und Blumenverkäufern, die wohlhabenden Passanten ihre Ware feilboten, oder die vermeintliche Wüstenei des Winters, in der man seine anrüchigen Geschäfte in die ebenerdigen Wohnungen verlegte, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen, der ohne Unterlass durch die Straßen fegte.
Oder wie jetzt, im feuchtkalten Herbst, wenn sich die Gassen, die Ricciardis langen Weg kreuzten, in sprudelnde Bäche verwandelten, welche allerlei Unrat mit sich führten und vom fernen Hügelland bis ins schier unerreichbare Meer spülten.
Maione hüpfte von Pfütze zu Pfütze, in dem sinnlosen Unterfangen, sich seine Stiefel nicht zu ruinieren.
»Die bringt mich um. Ganz bestimmt. Meine Frau bringt mich um. Sie haben ja keine Vorstellung, Commissario, wie Lucia zum Tier wird, wenn sie meine mit Staub und Schlamm bedeckten Stiefel putzen muss. Dann sage ich ihr: ›Komm, lass, ich putze sie mir selber.‹ Und sie: ›Red keinen Unsinn, ich bin die Frau eines Brigadiere, und dessen Stiefel putze ich.‹ Und ich frage sie: ›Warum machst du dann so einen Aufstand?‹ ›Ich putze sie ja‹, sagt sie dann, ›aber könntest du nicht ein bisschen besser aufpassen?‹«
Während sie tapfer ihren Weg fortsetzten, hielt der Brigadiere einen großen schwarzen Schirm über sie, um sich selbst und den Commissario vor dem Regen zu schützen. Ricciardi trug wie immer keinen Hut und schien sich überhaupt nicht um die Witterung zu scheren, was Maione sogleich zum Thema machte.
»Ich verstehe Sie einfach nicht, Commissario. Von einem Schirm will ich gar nicht reden, auch wenn der durchaus angebracht wäre, nachdem es jetzt drei Tage durchgeregnet hat, aber den kann man ja durchaus mal vergessen. Aber warum setzen Sie nicht wenigstens einen Hut auf? Sie sind noch jung, aber glauben Sie mir, wenn Sie erst mal in meinem Alter sind, wird Ihnen jeder Wassertropfen einzeln auf dem Kopf wehtun, wenn er Sie trifft.«
Ricciardi ging unbeirrt weiter, die Hände in den Taschen des Regenmantels. »Weißt du, ich kann Hüte einfach nicht ausstehen, ich kriege Migräne davon. Außerdem stamme ich bekanntlich aus den Bergen, Kälte und Feuchtigkeit stören mich nicht. Mach dir keine Sorgen, denk lieber an deine eigenen Zipperlein und mach dir die Stiefel nicht dreckig.«
Sie waren an dem Punkt ihres Weges angelangt, der Ricciardi am meisten auf der Seele lastete. Es handelte sich um die Brücke, die die Bourbonen gebaut hatten, damit man den Königspalast erreichen konnte, ohne dafür durch die Sanità zu müssen, was schon damals eines der gefährlichsten Viertel der Stadt gewesen war. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war genau dieses hohe Viadukt, diese Brücke ohne Fluss darunter, deren Pfeiler in den darunterliegenden Gassen verankert waren, zum bevorzugten Ort für Selbstmörder geworden.
Das, was Ricciardi bei sich seine »Gabe« nannte, nämlich die überaus schmerzliche Fähigkeit, den letzten Gedanken eines Verstorbenen wahrzunehmen, wenn ihn ein gewaltsamer Tod ereilt hatte, wurde in der Nähe ebendieser Brücke zu einer schier unerträglichen Belastung. Immer gab es hier mindestens eines dieser durchscheinenden Trugbilder, die nur darauf warteten, den Blick zu heben, wenn der Commissario vorbeiging, und ihm die Worte zuzuflüstern, mit denen jene arme Seele gezwungen gewesen war, ihre fleischliche Existenz auf Erden zu verlassen. Wie ein Abschiedsbrief mit einem einzigen Empfänger – ihm.
An diesem verregneten Morgen, deutlich sichtbar für die Augen seiner Seele, nahm er ein junges Pärchen wahr, das händchenhaltend auf dem Geländer der Brücke balancierte. Der junge Mann hatte sich das Genick gebrochen, blickte mit dem Kopf nach hinten, als hätte der schon immer falsch herum auf dem Hals gesessen, und murmelte: Nicht ohne dich, niemals ohne dich.
Der Rumpf der jungen Frau war eingedrückt und ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Aus dem, was einst ihr Gesicht gewesen war, schwebte Ricciardi ein Gedanke entgegen: Ich will nicht sterben, ich bin jung, ich will nicht.
Ricciardi kam in den Sinn, dass die Liebe vielleicht mehr Opfer forderte als der Krieg. Nein, nicht vielleicht. Es war so.
Weiter hinten, ebenfalls auf dem Geländer, flüsterte ein alter, beleibter Mann mit eingeschlagenem Schädel: Ich kann sie euch nicht mehr zurückzahlen, ich kann es nicht. Schulden, dachte der Commissario und beschleunigte seine Schritte, ließ den schnaufenden Maione hinter sich. Noch so eine unheilbare Krankheit. Gott, was war er müde. Immer das Gleiche, immer das gleiche Grauen.
Dann endlich hatten sie den Tondo di Capodimonte erreicht, über dem sich die gewaltige Treppe zum gleichnamigen Palast erhob. Hier kamen sie nur mit Mühe voran, weil sich das letzte Stück des Weges durch die heftigen Regenfälle in einen Sturzbach aus Ästen und Blättern verwandelt hatte, dem sie sich stromaufwärts entgegenstemmen mussten. Maione hatte es aufgegeben, seine Stiefel zu retten, und kämpfte sich mit mürrischer Miene voran. Ricciardi gingen die Selbstmörder nicht aus dem Sinn, was ihn noch trauriger machte.
Eine kleine Menschenmenge hatte sich direkt nach dem ersten Absatz am Fuße der breiten Treppe versammelt. Was sich hinter den aufgespannten Schirmen verbarg, die wie ein Wald aus Pilzköpfen vor ihnen aufragten, war nicht zu erkennen. Sobald Maione und Ricciardi in Begleitung zweier Schutzmänner eintrafen, zerstreute sich die Menge.
Maione grinste. »Immer dasselbe. Nur eins ist größer als die Neugier – die Angst, in Schwierigkeiten zu geraten, sobald die Polizei auftaucht.«
Ricciardi hatte sofort den Jungen entdeckt, auf einer Art Steinbank unterhalb des linken Strebepfeilers. Er war so klein, dass seine Füße nicht bis auf den Boden reichten, und vollkommen durchnässt. Seine zerschlissenen Kleider, ärmlich und schmutzig wie von einem Straßenjungen, hatten sich mit Wasser vollgesogen. An den Füßen trug der Kleine ein Paar Holzpantinen, darunter deutlich sichtbare Frostbeulen. Seine Lippen waren bläulich angelaufen, die halb offenstehenden Augen blickten ins Leere.
Besonders beeindruckten Ricciardi die Hände des Jungen, die wie zwei tote Vögelchen in seinem Schoß lagen. Sie waren schneeweiß, die Haut viel heller als die von der Kälte rötlich angelaufene der Beine, und erschienen dem Commissario wie ein Sinnbild trotziger Schicksalsergebenheit. Doch ringsum gab es keine Spuren von Trugbildern – der Junge war also nicht durch Gewaltanwendung gestorben, sondern vielleicht durch Kälte oder Hunger, vielleicht auch an einer Krankheit. Allein und den Unbilden des Lebens, der Gewalt, der Einsamkeit überlassen, ging es Ricciardi durch den Kopf. Ohne eine Wahl zu haben.
Wenn es etwas gab, das er hasste, dann waren es tote Kinder. Dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, von heilloser Verschwendung und vertanen Chancen. Ein Volk, eine Gesellschaft, wird daran gemessen, wie sie mit ihren Kindern umgeht, hatte er einmal gelesen. Dabei kam diese Stadt nicht allzu gut weg.
Maione riss ihn aus seiner Versunkenheit. »Bevor wir das Präsidium verlassen haben, habe ich im Krankenhaus anrufen lassen; sowohl der Gerichtsmediziner als auch der Leichenwagen müssen jeden Moment hier sein. Dort hinten wartet die Milchverkäuferin mit ihrer Ziege an der Leine, möchten Sie mit ihr sprechen? Gleich daneben steht auch der Herr, dem das Telefon gehört, der Herr mit dem Schirm. Ich habe ihm bereits gesagt, dass wir ihn nicht brauchen und er gehen kann, aber er rührt sich nicht vom Fleck. Soll ich die beiden herrufen?«
Die Milchverkäuferin trug ein fest ums Kinn gebundenes Kopftuch; ihre Lippen zitterten. Sie war sehr jung, fast noch ein Kind; in der einen Hand hielt sie das Ende der Schnur, mit der ihre Ziege angebunden war, in der anderen eine metallene Milchkanne. Schnatternd vor Kälte, vor Angst und Verlegenheit erzählte sie stockend, dass sie jeden Tag diese Treppe herunterkomme, um ihre Runde im Viertel zu drehen und Milch zu verkaufen. Heute nun habe sie wegen des Regens besonders vorsichtig sein müssen, um nicht zu stürzen, doch auf einmal habe die Ziege sich gesträubt, denn unten am Fuß der Treppe habe ein Hund gesessen und geknurrt.
»Da sitzt er, sehen Sie ihn? Als ich von dem Haus des Herrn, von dem aus ich Sie angerufen habe, zurückkam, hatte er sich woandershin gesetzt, und seither hat er sich nicht mehr vom Fleck gerührt.«
Jetzt erblickte auch Ricciardi, etwa zwanzig Meter von ihnen entfernt, das Hundetier, das langgestreckt auf den Hinterpfoten lag, reglos wie eine Statue, und sie aufmerksam beobachtete. Es war ein Mischling, wie man ihn zu Hunderten überall in der Stadt sah, mit bräunlich geschecktem, schmutzigem Fell und spitzer Schnauze. Das eine Ohr war aufgerichtet, das andere schlapp.
Nun fuhr die junge Frau in ihrer Erzählung fort und schilderte, wie sie, nachdem sie vergeblich versucht hatte herauszufinden, ob das Kind schlief oder krank sei, zum nächstgelegenen Haus gelaufen sei, wo einer ihrer Kunden wohne, der Buchhalter Caputo. Dieser, ein kleiner, elegant gekleideter Herr mittleren Alters mit goldumrandeter Brille, trat nun einen Schritt vor und lüpfte den Hut.
»Wenn Sie erlauben, Commissario, ich bin Buchhalter Ferdinando Caputo, zu Ihren Diensten. Das Mädchen hier, das Caterina heißt, kommt jeden zweiten Tag hierher. Leider vertrage ich nur Ziegenmilch, weil mir die von der Kuh schwer im Magen liegt und mir danach den ganzen Tag schlecht ist. Jedenfalls kommt dieses Mädchen, Caterina, heute in den Hof unseres Mietshauses gelaufen und fängt an zu schreien: ›Kommt nur, kommt, Hilfe, da ist ein kleiner Junge auf der Treppe, der keinen Mucks mehr macht.‹ Ich war gerade erst wach und noch im Nachthemd, bin gleich aus dem Bett ans Fenster gestürzt, und dann …«
Jetzt riss Maione der Geduldsfaden. »Ist ja gut, Herr Buchhalter«, blaffte er, »kommen wir bitte zum Punkt. Bei allem Respekt interessiert es uns doch nicht, was für ein Gewand Sie des Nachts tragen. Und was ist dann passiert, sind Sie runtergegangen?«
»Nein, Brigadiere. Sollte ich denn etwa in Hemd und Nachtmütze auf die Straße gehen? Nein, habe ich zu dem Mädchen gesagt, das, wie gesagt, auf den Namen …«
»Ja, ja, auf den Namen Caterina hört, das wissen wir schon, und das hat auch der Kollege auf dem Präsidium in den Bericht geschrieben, der übrigens Antonelli heißt und …«
Jetzt war der Herr Buchhalter gekränkt. »Aber Brigadiere, machen Sie sich etwa lustig über mich? Ich wollte nur genau sein, ganz in Ihrem Interesse. Jedenfalls kam das Mädchen zu mir hoch, und wir haben bei der Polizei angerufen. Das ist alles.«
Ricciardi wedelte mit der Hand. »Schon gut, schon gut, Ihnen beiden vielen Dank. Unser Kollege hier hat Namen und Adressen notiert, wenn nötig, melden wir uns noch einmal bei Ihnen. Das glaube ich aber nicht. Sie können gehen.«
Endlich allein gelassen näherten sie sich dem toten Jungen. Ricciardi fragte sich, wieso um diese Uhrzeit noch keine Angehörigen oder Bekannten auf der Suche nach einem so kleinen Jungen waren, der nicht nach Hause gekommen war. Maione war vor dem toten Kind in die Hocke gegangen und betrachtete es voller Interesse.
»Commissario, wir müssen erst mal rausfinden, ob der Kleine überhaupt eine Familie hat. Die Kleidung, die er trägt, stammt offenbar aus dem Müll, und die Hose ist so groß, dass sie nur mit einer zweimal um die Taille gewickelten Schnur hält. Das Hemd ist aus einem Sack geschneidert. Und schauen Sie nur, diese Holzpantinen an den bloßen Füßen, bei der Kälte. Das ist ein Straßenjunge, einer von denen, die kein Zuhause haben. Glauben Sie mir. Keine Freunde, keine Familie.«
Ricciardi wandte sich zu dem Hund um, der nur wenige Meter entfernt von ihnen lag und sie nicht aus den Augen ließ.
»Eine Familie vielleicht nicht. Aber wenigstens einen Freund hatte er; schade nur, dass der uns nichts sagen kann. Ah, da kommt ja endlich die Gerichtsmedizin. Dann werden wir vielleicht gleich mehr über den Tod unseres kleinen Einzelgängers hier erfahren.«
III
Die Gerichtsmedizin traf ein in Gestalt von Dottor Bruno Modo, der zwischen den Pfützen hindurchhüpfte und sich nach Kräften bemühte, nicht allzu nass zu werden und dabei gleichzeitig einen Schirm, die obligatorische lederne Arzttasche sowie ein Blatt Papier in Händen zu behalten.
Kaum hatte er Ricciardi und Maione erblickt, setzte er eine kämpferische Miene auf. »Ach, ihr also! Wer sollte es auch sonst sein. Ein Anruf in aller Herrgottsfrühe, wo du gerade erst mit patschnasser Hose im Krankenhaus angekommen bist und sie notdürftig getrocknet hast, dann zwei Kilometer gegen den Strom in diesem verdammten Sturzbach, den ihr die Via Nuova Capodimonte nennt – wer anders konnte das sein als der fröhliche Ricciardi und sein magerer Knappe, der hochwohlgeborene Brigadiere Maione? Wollen wir nicht endlich mal Schluss machen mit diesem persönlichen Herbeizitieren? Da, lest mal: ›Es wird um das sofortige Erscheinen von Dottor Bruno Modo gebeten.‹ Genügt nicht irgendein Arzt? Muss es denn immer unbedingt ich sein, den ihr ruft?«
Maione verzog den Mund zu einem sarkastischen Grinsen. »Allerdings, Dottore. Tatsache ist, dass unser Commissario hier nur dann zufrieden ist, wenn Sie höchstpersönlich erscheinen. Nur Ihnen vertraut er. Wenn dieser andere kommt, dieses Äskulapjüngelchen, mit dem ist er nie recht zufrieden. So wie Sie mit den Toten umgehen, tut das eben kein anderer, und deshalb rufen wir immer Sie. Freuen Sie sich denn gar nicht, uns zu sehen?«
Modo wandte sich an Ricciardi und schwenkte mit gespielt bedrohlicher Miene das Schreiben, mit dem er einbestellt worden war. »Ich warte immer drauf, dass mal ein Phonogramm kommt, auf dem steht: ›Zwei Polizisten tot aufgefunden, von den Faschisten gemeuchelt!‹ Schön wär’s! Das wäre dann der Tag, an dem ich mir ein Parteibuch besorge, ha!«
Ricciardi hatte bislang keine Miene verzogen, doch man sah ihm an, dass er sich amüsierte.
»Habt ihr schon mal daran gedacht, als Komiker-Duo aufzutreten, ihr beiden, im Salone Margherita vielleicht? Der Dottore und der Brigadiere! Wie auch immer: Wollen wir jetzt mit dieser Untersuchung anfangen, damit wir irgendwann mal wieder ins Trockene kommen? Auf den ersten Blick ist ja keinerlei äußere Gewaltanwendung zu erkennen.«
Modo zog ein gekränktes Gesicht.
»Soso, dann entscheidest jetzt du, wann es Anzeichen für Gewaltanwendung gibt und wann nicht? Wenn ihr mich schon extra hier antanzen lasst und ich bis auf die Unterhose nass werde, dann wollen wir diese Untersuchung auch gründlich machen. Wo ist denn die Leiche? Aha, hier. Ein kleiner Junge. Sehr jung, wird nicht älter als sieben oder acht Jahre alt sein. Schlimm.«
Er ging um den Jungen herum, hob behutsam die Kleidung an, berührte voller Zärtlichkeit Hände und Beine. Ricciardi bemerkte aus der Ferne, dass der Hund aufgestanden war und aufmerksam beide Ohren aufgestellt hatte; als das Tier jedoch bemerkte, wie behutsam Modo vorging, blieb es zwar wachsam, rührte sich jedoch nicht von der Stelle.
Der Dottore überprüfte die Haltung des Leichnams, ging vor ihm in die Hocke, um die Füße abzutasten, betrachtete eingehend das Gesicht. Dabei machte er sich auf der Rückseite des Blattes, mit dem man ihn angefordert hatte, Notizen. Maione hielt schweigend den Schirm über ihn und versuchte zu verstehen, was die raschen Handgriffe des Gerichtsmediziners zu bedeuten hatten.
Am Ende trat Modo auf Ricciardi zu und trocknete sich die Hände an einem Taschentuch ab.
»Also: Der Leichnam ist bereits steif und abgekühlt, wenn ihr mich fragt, ist der Tod gestern Abend eingetreten oder spätestens in der Nacht. Du hast Recht, es gibt keinerlei Zeichen auf äußere Gewaltanwendung, zumindest keine tödliche; da sind verblasste blaue Flecken, ein paar Abschürfungen, aber nichts, was mit dem Tod in Zusammenhang stehen könnte. Er sitzt, weil er an der Mauer angelehnt ist; sonst wäre er umgekippt oder gestürzt. Nach meinem Dafürhalten ist er sieben Jahre alt, könnte aber auch ein wenig älter sein; diese Kinder bekommen nur sehr wenig zu essen, leiden oft unter Rachitis und sind deshalb meistens deutlich kleiner, als es ihrem Alter entspricht. Vielleicht ist er auch schon zehn oder zwölf, das müsst ihr herausfinden.«
»Was den Todeszeitpunkt anbelangt, bist du dir sicher?«, fragte Ricciardi.
Modo zuckte mit den Achseln. »Sicher kann man sich nie sein, bei dieser Kälte und dem Regen. Die Hornhaut der Augen ist bereits getrübt, mit einem Schleier überzogen, und mir scheint, die Ränder der Pupillen werden schwarz. Die Hypostase, sprich, die roten Flecken am Körper, welche durch schwerkraftbedingte Blutansammlungen entstehen, kannst du hier auf der rechten Seite des Halses sehen, außerdem an der rechten Ohrmuschel, unter den Oberschenkeln und auf den Beinen, was aussieht wie Strümpfe. Siehst du? Wenn ich mit den Fingern auf die Haut drücke, wird sie nicht weiß. Folglich befindet sich der Leichnam schon länger in dieser Position.«
»Und die Todesursache? Keine Gewaltanwendung, da sind wir uns einig. Wie ist er dann gestorben?«
»Ich kann es dir nicht sagen. Möglicherweise einfach ein Herzstillstand. Wie ich bereits erwähnte, sind diese Kinder schwach und unterernährt; aus jeder Erkältung kann eine Lungenentzündung werden. Niemand gibt ihnen Medikamente, wenn sie krank sind, keiner kümmert sich um sie. Das ist diesen Monat schon der Dritte. Einen hat man am Bahnhof gefunden, bei dem standen die Rippen so hervor, dass man die Leiche nicht einmal öffnen musste, um das Skelett zu betrachten. Ein Mädchen, das in Sant´ Eframo gefunden wurde, war so ausgehungert, dass es mitten auf der Straße gestürzt ist und von einem Automobil überfahren wurde wie ein Bündel Lumpen. Es ist schlimm, ich weiß. Aber das ist nur eine der Auswirkungen, die die Armut in dieser ach so glorreichen und zukunftsträchtigen Stadt hat.«
Maione lauschte ihm mit betrübter Miene. »Mir tun diese kleinen Wesen furchtbar leid, Dottore. Früher hat jede Familie so ein Kind bei sich aufgenommen, man nannte sie die Kinder der Muttergottes. Und sie wurden besser behandelt als die eigenen Kinder, weil man glaubte, das bringt Glück. Aber wer kann es sich bei dem Elend, das mittlerweile herrscht, noch leisten, ein Maul zusätzlich zu stopfen?«
Modo ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, einen kurzen Exkurs zu seinem Lieblingsthema zu machen. »Aber heißt es denn nicht, wir lebten in einem Land, wie es besser nicht sein könnte? Lesen Sie Zeitung, Brigadiere – da ist nur von Feiern und Einweihungen die Rede, von Schiffstaufen und Militärparaden. Von den Besuchen ausländischer Fürsten und Könige, von jubelnden und applaudierenden Menschenmengen. Nur Sie, ich und unser Freund Ricciardi hier wissen, dass es ganz anders ist. Dass man hier Kinder wie diesen kleinen Unbekannten einfach an irgendeiner Straßenecke verhungern lässt.«
Ricciardi hob die Hand. »Ich bitte dich, Bruno, keine Politik so früh am Morgen. Das schaffe ich nicht. Ich habe die ganze Nacht Berichte geschrieben, und mit dem Amtsschimmel habe ich genauso wenig am Hut wie du; aber wenn du dich weiterhin so abfällig über Mussolini und die Faschisten auslässt, wirst du früher oder später ernsthafte Schwierigkeiten bekommen, fürchte ich.«
Modo fuhr sich mit der Hand durch das dichte weiße Haar und setzte seinen Hut wieder auf.
»Na und? Glaubst du, ich in meinem Alter hätte Angst davor zu sagen, was ich denke? Nach allem, was ich im Krieg für mein Land geleistet habe? Ich antworte dir so, wie die auch antworten: Es ist mir scheißegal!«
»Du begreifst das einfach nicht. Nein, du tust so, als würdest du nicht begreifen. Leute wie du tun viel für andere. Du bist der beste Arzt, den ich kenne, und nicht nur, weil du kompetent bist und viel weißt, sondern vor allem, weil du ein mitfühlender Mensch bist. Ich hab dich beobachtet, wie du diesen armen kleinen Kerl untersucht hast – mit Respekt, als wäre er noch am Leben. Meinst du denn, es wäre besser für diese Kinder, für uns alle, wenn Leute wie du, die sowieso dünn gesät sind, aus dem Verkehr gezogen würden, nur wegen irgendeiner Bemerkung oder gar einem einzigen Wort, geäußert am falschen Ort und zur falschen Zeit? Ist es nicht besser zu versuchen, die Dinge zu ändern, Tag für Tag?«
Und Maione fügte, unter seinem Schirm hervor, hinzu: »Der Commissario hat Recht, Dottore. Ich jedenfalls habe jetzt meine Aufgabe als Spitzel zu erfüllen, und in etwa fünf Minuten gehe ich Sie denunzieren, dann schickt man Sie an einen warmen und trockenen Platz, und ich tue Ihnen damit sogar noch einen Gefallen.«
Modo brach in Gelächter aus und nickte den beiden Leichenträgern zu, die ihn begleitet hatten.
»Wie dumm muss ich sein, dass ich es immer wieder versuche, mit zwei Polizisten ein ernstes Gespräch zu führen? Das ist, als würde man zu einem Paar Ochsen reden, bloß mit dem Unterschied, dass die wenigstens so tun würden, als hörten sie mir zu, statt auch noch dumme Bemerkungen zu machen. Na gut, jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Und dann schicke ich diesen armen kleinen Kerl auf den Friedhof, damit wenigstens er seinen Frieden findet.«
Der Regen hatte nachgelassen und sich in Sprühregen verwandelt, fein wie Nebel. Die Leichenträger hoben das tote Kind auf, wobei sie etwas Mühe hatten, die bereits steifen Glieder auszurichten. Ricciardi sah, wie sie sich dem Leichenkarren näherten, der von einem alten schwarzen Klepper mit vor Nässe glänzendem Fell gezogen wurde. Der Kopf des Jungen baumelte herab, Wasser rann über seinen Hals. Ohne es zu wollen, fühlte sich Ricciardi an ein Lämmchen erinnert, mit dem er als Kind eine Weile gespielt hatte und das zu Ostern vom Verwalter ihres Landguts geschlachtet worden war: der gleiche schlaff herabhängende Kopf, der gleiche weiche Nacken. Zwei schutzlos ausgelieferte Kreaturen. Zwei Opfer.
Mitten in dieser gespenstischen Atmosphäre des Todes, mitten im wabernden Nebel stieß der Hund ein einziges kurzes Heulen aus. Ricciardi spürte, wie ihm ein Schauder über den Rücken lief.
Einem Impuls folgend rief er Modo, der sich bereits mit den Leichenträgern entfernte, noch einmal zurück. »Du, Bruno, hör mal, tu mir einen Gefallen. Schick ihn nicht gleich auf den Friedhof. Lass ihn erst ins Krankenhaus bringen und mach eine Autopsie. Ich will genau wissen, woran er gestorben ist.«
»Was soll das heißen, woran er gestorben ist? Ich hab’s dir doch gesagt, Herzstillstand. Diese Kinder haben praktisch kein funktionierendes Immunsystem, er kann an allem Möglichen gestorben sein. Warum willst du ihn noch weiter quälen? Außerdem: Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel ich im Krankenhaus zu tun habe? Bei diesem Wetter sind zwei von fünf Kollegen krank, und ständig kommen neue Patienten mit Bronchitis, Lungenentzündungen herein, ganz zu schweigen von den vielen Stürzen und Unfällen.«
Ricciardi legte ihm eine Hand auf den Arm. »Ach, komm, Bruno. Ich bitte dich nie um einen persönlichen Gefallen. Tu’s für mich.«
Modo brummte: »Das stimmt nicht, dass du mich nie um etwas bittest. Um genau zu sein, bist du eine unglaubliche Nervensäge. Aber gut, in Ordnung. Den Gefallen will ich dir tun. Aber denk dran, du bist mir was schuldig.«
»Einverstanden, ich schulde dir auch was. Wenn der Befehl für deine Festnahme auf meinen Tisch flattert, werde ich dich erst mal ausgiebig in der Stadt suchen, dann hast du noch genügend Zeit für einen letzten Besuch im Bordell.«
Der Dottore fing zu lachen an. »Du weißt, dass die Liebesdamen dieser Stadt nicht ohne mich leben können, oder? He, ihr da drüben, bleibt stehen, kleine Zieländerung. Bringt mir den Jungen ins Krankenhaus. Das ist mein Kunde.«
Als der Karren abgefahren war, trat Maione auf Ricciardi zu. »Commissario, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hat denn der kleine Kerl nicht schon genug durchgemacht? Muss man ihn auch noch im Tod quälen, wo es doch keinerlei Anzeichen auf Gewaltanwendung gab?«
Ricciardi schwieg. Er beobachtete den Hund, der die kleine Gruppe keine Sekunde aus den Augen ließ und an Ort und Stelle sitzen geblieben war, auch als der Leichenkarren längst weg war.
Er zuckte mit den Achseln. »Was soll ich sagen, Maione? Mir kam es einfach irgendwie falsch vor, ihn unter die Erde zu bringen, ohne zu wissen, wie er gestorben ist. Komm, kehren wir ins Präsidium zurück, dann können wir endlich diese Nachtschicht beenden.«
IV
Ganz entgegen seiner Gewohnheiten war der stellvertretende Polizeipräsident Angelo Garzo bereits um Viertel nach acht im Büro. Was Ponte, den Schutzmann, der erst kürzlich zu seinem persönlichen Assistenten befördert worden war, in Angst und Schrecken versetzte.
Was hieß eigentlich befördert? Ponte hegte starke Zweifel daran, ob es sich wirklich um eine Beförderung handelte. Sicher, sein Gehalt hatte sich um ein paar Lire erhöht, sodass er weniger Mühe hatte, es bis zum Ende des Monats zu schaffen. Und er musste nicht mehr auf Streife gehen, was ihm all die Unpässlichkeiten ersparte, die es mit sich brachte, bei Wind und Wetter hinauszumüssen, besonders an regnerischen Tagen wie den vergangenen. Außerdem hatte ihm seine neue Stellung Neid und erhöhten Respekt bei seinen Kollegen eingebracht, die hinter seiner Neigung, andere anzuschwärzen, den eigentlichen Grund für seine neue Position vermuteten und ihm folglich aus dem Weg gingen.
Andererseits war Ponte nun voll und ganz den Launen seines Vorgesetzten ausgeliefert, die so wetterwendisch waren, wie es die Natur nie sein konnte: Auf Momente unbegründeter Euphorie folgten oft Tage tiefster und schwärzester Niedergeschlagenheit, Phasen, in denen es Ponte oblag, allein aus Garzos Mienenspiel zu schließen, was sein Chef wollte. Mutmaßliches Wohlwollen, das zum Beispiel auf eine Belobigung des Polizeipräsidenten folgte, wechselte sich mit flammenden Wutausbrüchen ab, bei denen es angeraten war, sich schleunigst unsichtbar zu machen, bevor man mit allerlei denkwürdigen Beschimpfungen überschüttet werden konnte.
Doch zurzeit machte Ponte die schlimmste Zeit durch, an die er sich erinnern konnte. Die Dinge verhielten sich so: Vor rund einem Monat hatte sie ein Telegramm aus dem Innenministerium erreicht, in dem sie von der Entscheidung des Duce höchstpersönlich in Kenntnis gesetzt wurden, ausgerechnet in Neapel seine Rede an die Nation zu halten. Der Besuch des Ministerpräsidenten und seiner höchsten Funktionäre sollte vom dritten auf den vierten November stattfinden, und man erwartete die größtmögliche Mitwirkung der örtlichen Behörden, selbstverständlich allen voran des Polizeipräsidiums und der Präfektur.
Ponte hatte die Depesche als Erster gelesen, der zuständige Kollege von der Telegrafenabteilung hatte sie ihm gegeben, damit er sie unverzüglich dem Herrn Polizeipräsidenten bringe; doch da Ponte wusste, dass Garzo ihm bei lebendigem Leib die Haut abziehen würde, wenn er von so einer bedeutenden Sache nicht als Erster in Kenntnis gesetzt wurde, hatte er sich, so schnell er konnte, in dessen Büro begeben.
Die Reaktion seines Vorgesetzten würde er lange nicht vergessen. Dieser war erst erbleicht, dann puterrot und anschließend wieder kreidebleich geworden, wobei zwei große rote Flecken an seinem Hals und auf der Stirn erblüht waren. Er war aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen, und besagte Depesche war ihm aus den zitternden Händen gefallen. Dann hatte er etwas Unverständliches gemurmelt, war auf seinen Stuhl zurückgesunken und hatte Ponte mit einer vagen Kopfbewegung bedeutet, das Dokument dem Polizeipräsidenten zu überbringen.
Von diesem Zeitpunkt an war Garzo immer unleidlicher geworden. Stundenlang schloss er sich in seinem Büro ein, prüfte wieder und wieder uralte Polizeiberichte, weil ihn der Gedanke einer möglichen Inspektion in Angst und Schrecken versetzte; ein anderes Mal stürzte er unangekündigt auf die Wache und beschwerte sich mit schriller Stimme über den Schlendrian, der in diesem für das Präsidium so wichtigen Raum eingekehrt sei. Heute nun war er mit dem allerersten Hahnenschrei auf dem Präsidium erschienen, als der bemitleidenswerte Ponte sich gerade bei einer Tasse Malzkaffee und einer Zigarre entspannen wollte. Eines war ihm mit einem Blick auf den Kalender klar: Weitere acht Tage dieser Art würden unerträglich sein.
Vizepolizeipräsident Garzo schaute bereits zum vierten Mal in einer halben Stunde auf den Kalender und dachte, dass er noch weitere acht Tage in dieser Hochspannung nicht ertragen würde. Der Duce. Der Duce höchstpersönlich, ihr großer Heerführer, die Lichtgestalt ihrer Nation, der Mann, dem das italienische Volk sein uneingeschränktes Vertrauen schenkte, würde hier sein, vielleicht sogar in genau diesem Büro, dort vor ihm würde er stehen. Und vielleicht würde er ihn anlächeln, ihm die edle Hand zum Gruße reichen. Zum wohl tausendsten Mal, seit er jene Depesche aus dem Ministerium gelesen hatte, hatte Garzo das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Für die Sicherheit des Duce sorgten die Armee und die Geheimpolizei, zumindest das betraf ihn also nicht; doch sein Vorgesetzter, der Polizeipräsident, hatte es klar und deutlich gesagt: Die Ordnung und das äußere Erscheinungsbild des Präsidiums – und allgemeiner gesagt, der ganzen Stadt – oblagen seiner, Garzos, Verantwortung.
Insbesondere und allein von ihm hing es ab, dass der Duce, der Minister sowie alle Funktionäre, die mit ihm aus Rom kamen, in Neapel eine faschistische Stadt wie aus dem Bilderbuch vorfanden, eine Stadt ohne Verbrechen und ohne Schattenseiten. Und er, Angelo Garzo, war wild entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Stadt sich auch genau so präsentierte.
Garzo klappte seinen Taschenspiegel auf und vergewisserte sich, dass bei seinem kleinen Schnurrbärtchen, das er sich gemäß einer Eingebung seiner Gattin seit einiger Zeit stehen ließ, kein Härchen aus der Reihe tanzte. Diese seine Ehefrau, eine ebenso energiegeladene wie befehlsgewohnte Dame, hatte unerschütterlich den Standpunkt vertreten, das äußere Erscheinungsbild sei wie eine Visitenkarte, wenn jemand Karriere machen wolle. Und sein Ehegespons wusste, wovon es redete: Ihr Onkel hatte einst als Präfekt alle Dienstgrade einer Ministerialkarriere durchlaufen und war dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Garzo war sich der Tatsache bewusst, dass er kein besonders guter Polizist war; er hatte stets eine gewisse Abscheu vor Kriminalität empfunden und fand es schrecklich, sich durch den Kontakt mit Menschen, die Verbrechen begangen hatten, die Hände schmutzig machen zu müssen. Dafür war er immer recht gut im Knüpfen von Kontakten gewesen, wobei er es hielt wie ein Radfahrer: nach oben buckeln, nach unten treten. Auf diese Weise war es ihm gelungen, sich aus der aktiven Polizeiarbeit herauszuhalten und dafür eine Rolle als Führungspersönlichkeit einzunehmen, in die er seine ganzen organisatorischen Fähigkeiten einbringen konnte. Probleme erkannte er sofort und wusste ihnen aus dem Weg zu gehen, indem er die Ursachen erkannte und sie dann sorgfältig entfernte.
Und was waren das nun für Probleme?, überlegte er. Was konnte sich zwischen ihn und das Lob des Duce stellen, konnte dafür sorgen, dass ihm die Komplimente des Ministers und die herzliche Umarmung seines Vorgesetzten, des Polizeipräsidenten, verwehrt blieben? Hier kam ihm sogleich Ricciardi in den Sinn.
Eigentlich hätte der Moment für einen Besuch des Duce nicht günstiger sein können. Es waren keinerlei Ermittlungen im Gange, ungelöste Fälle gab es auch keine, alles war in bester Ordnung und lief wie am sprichwörtlichen Schnürchen. Warum dann diese Besorgnis?
Ricciardi war ein ausgezeichneter Polizist, das stand außer Frage. Er hatte äußerst vertrackte Fälle aufgeklärt, von denen einige schier unlösbar gewesen waren; dies allerdings nach Garzos Dafürhalten deshalb, weil er in seinem tiefsten Inneren selbst ein Krimineller war, jemand, der genau wie die Verbrecher dachte, die er hinter Schloss und Riegel brachte. Doch abgesehen von dieser Einschätzung war da auch noch die Tatsache, dass Ricciardi unkontrollierbar und nur schwer zu fassen war. Er lebte mit seiner alten Kinderfrau zusammen. Er hatte keine Laster, keine Freunde, nicht einmal eine Frau. Ein Mann ohne Laster, so dachte Garzo, konnte auch keine besonderen Tugenden besitzen. Und dann diese Augen, diese beunruhigenden grünen Augen, durchscheinend wie Glas, die dich anschauten, ohne mit der Wimper zu zucken; die dich beschämten, ohne unverschämt zu sein, die dich mit den dunklen Abgründen deiner Seele konfrontierten, die du lieber nicht gekannt hättest und von denen du gar nicht gewusst hast, dass du sie besitzt. Garzo erschauderte.
In letzter Zeit war da auch noch die Sache mit der Witwe Vezzi gewesen, eine weitere Komplikation. Der stellvertretende Polizeipräsident konnte sich partout nicht erklären, wie sich eine so schöne Frau, reich und angesehen, mit Verbindungen in allerhöchste Kreise (genauer gesagt war sie die Busenfreundin der Tochter des Duce), derart vernarrt in einen Menschen wie Ricciardi zeigen konnte. Oft kam sie aufs Präsidium, um ihn zu besuchen, ohne jegliche Skrupel oder Scham; und je mehr der Commissario sein Desinteresse bekundete, desto größer waren ihre Anstrengungen, ihn zu umgarnen. Diese Bekanntschaft, ebenso wie die gesellschaftliche Rolle, die der Dame jetzt, nachdem sie aus der Hauptstadt nach Neapel gezogen war, mehr und mehr zukam, bedeutete für den Commissario einen zusätzlichen Schutz. Schutz?, fragte sich Garzo. Ja, Schutz. Denn wenn sie nicht wäre, hätte er sich diesen grünäugigen Sonderling nur allzu gern vom Hals geschafft. Er hätte Ricciardi auf irgendeinen Posten in der Provinz versetzt, wo er, weit entfernt vom Polizeipräsidium und von Garzos Karriere, nach Herzenslust ermitteln könnte.
Einer spontanen Eingebung folgend beschloss Garzo, die dicken juristischen Wälzer, die seinen Bücherschrank schmückten, nach der Farbe des Einbands zu sortieren, damit sie besser mit den Tapeten harmonierten. Nein, er fand einfach keine Ruhe; Ricciardi würde ihm Schwierigkeiten bereiten, dessen war er sich sicher.
Andererseits: Wenn er es recht bedachte, konnte die Vernarrtheit der Witwe Vezzi in den Commissario ihm durchaus auch nützlich werden. Tatsächlich wurde gemunkelt, die Frau plane, in ihrem neuen neapolitanischen Zuhause einen exklusiven Empfang zu Ehren des Besuchs des Duce zu geben. Vielleicht, überlegte er, könnte es ihm ja gelingen, seine Position zu nutzen und sich zu der Festivität einladen und dort möglicherweise sogar sehen zu lassen. Es hieß nämlich, Edda, die Tochter des Duce, sei dessen Augenstern und habe folglich großen Einfluss auf den Herrn Papa; vielleicht würde er der Dame ja sympathisch sein und könnte auf diese Weise sogar eine Empfehlung bekommen.
Schon sah er sich als Polizeipräsident in der Fürstenloge des San Carlo sitzen undden bedeutendsten Menschen dieser Stadt huldvoll zuwinken. Und ihm kam der durchaus prickelnde Gedanke, wie er die Anwesenheit einer Nervensäge wie Ricciardi möglicherweise doch noch zum eigenen Vorteil wenden könnte.
Von neuer Euphorie berauscht rief er: »Ponte!«
V
Livia Lucani, die Witwe Vezzi, freute sich darüber, dass ihr neues Zuhause in Neapel allmählich Gestalt annahm und dass es ganz und gar den Vorstellungen entsprach, die Livia sich gemacht hatte, als sie beschloss, ihren Wohnsitz in diese Stadt zu verlegen.
Es war das erste Zuhause, das ihr wirklich ganz alleine gehörte. Das Haus ihrer Eltern, die aus einer vornehmen und wohlhabenden Familie aus Jesi stammten, hatte sie vor einigen Jahren verlassen, um zu einer Tante in Rom zu ziehen und Gesang zu studieren. Noch zu Beginn einer vielversprechenden Karriere als Opernsängerin, als ihre Altstimme begann, bekannt und beliebt zu werden, war ihr dann Arnaldo begegnet, der zu den größten Tenören des Jahrhunderts gehörte, und sie hatten geheiratet. Demnach, so überlegte sie, war hier in Neapel das erste Mal, dass sie ein Haus für sich selbst ausgewählt und eingerichtet hatte.
Doch möglicherweise würde sie ja gar nicht lange allein darin wohnen, dachte sie und nahm einen Schluck Kaffee. Vielleicht würde ja früher oder später wieder jemand ihr Bett und ihr Leben teilen. Und zwar jemand mit grünen Augen.
Nur mit Mühe riss sie sich von ihrer Versunkenheit los und wandte sich der Planung ihres Tages und ihres neuen Zuhauses zu. Dieses hatte sie, mit Ricciardis Hilfe, den sie um Tipps gebeten hatte, mitten im Zentrum der Stadt ausgesucht. Zwar war offenkundig, dass der Commissario nicht gewillt war, ihr gegenüber Verpflichtungen einzugehen, genauer gesagt, dies ausdrücklich vermied; doch Livia war sich sicher, früher oder später würde er auf ganz natürliche Weise merken, dass sie die richtige Frau für ihn war, diejenige, die ihn aus der seltsamen, düsteren Einsamkeit reißen würde, in der zu leben er bislang beharrte.
Statt für die sanften Hügel von Posillipo, von denen man eine herrliche Sicht auf den Golf hatte, oder jenes ganz neue Viertel auf dem Vomero, wo es jede Menge Grün und frische Luft gab, hatte sich Livia für die Gegend in der Nähe der Via Toledo entschieden und sich ein elegantes Appartement in der Via Sant´ Anna dei Lombardi ausgesucht. Ihr gefiel es, im Zentrum zu wohnen, inmitten von Theatern und Cafés, wo sie nach Herzenslust flanieren und sowohl elegante Geschäfte als auch die ältesten Kirchen der Stadt bewundern konnte.
An diese Stadt hatte sie ihr Herz verloren, noch bevor sie sich in Ricciardi verliebt hatte; sie schätzte ihre Fröhlichkeit, ihre Eigenart, zu jeder Jahreszeit ihr Antlitz und ihre Farbe zu ändern, freute sich an den Gassenjungen, die in Trauben an den quietschend in die Kurve gehenden Straßenbahnen hingen. In Neapel liebte man die Musik, und Livia genoss es, dass es überall und zu jeder Tages- und Nachtstunde jemanden gab, der sang, ob nun aus vollem Halse oder ganz leise vor sich hin. Und auch das Essen fand sie köstlich und das Klima mild, obwohl sie sehr wohl wusste, wie unbeständig das Wetter sein konnte, so wie jetzt, in diesen regnerischen Tagen. Nein: In Neapel konnte man einfach nicht traurig sein.
Die römischen Freundinnen riefen sie fast jeden Tag an und fragten sie, was denn nun so schön an dieser Stadt sei, dass Livia sogar beschlossen hatte, ganz dort zu wohnen. Doch in Wirklichkeit, dachte Livia, waren sie nur neugierig, was tatsächlich der Grund für ihre Umsiedelung war.
Livia war der Mittelpunkt der höheren Gesellschaft Roms gewesen; und es war selten, dass eine so schöne und faszinierende Frau auch unter ihren Geschlechtsgenossinnen beliebt war, die doch sonst eher zum Neid neigten oder fürchteten, jemand könne ihnen ihre Ehemänner ausspannen. Livia jedoch hatte mit ihrer Offenheit und Ehrlichkeit mühelos die Untiefen des Klatsches und der Boshaftigkeit umschifft und am Ende alle bezaubert, Männer wie Frauen.
Mit einigen Menschen verband sie echte Freundschaft, und dazu zählte auch Edda, die Lieblingstochter des Duce. Das Mädchen war gerade mal zwanzig Jahre alt, damit rund zehn Jahre jünger als Livia – eine sprunghafte und kapriziöse junge Frau, die nur allzu gern ihr Herz an die faszinierende Signora gehängt hatte, welche für sie der Inbegriff von Eleganz und Klasse war. Man mochte sich, und wenn es ihre Verpflichtungen als Tochter des Duce erlaubten, rief Edda Livia gerne an und führte mit ihr lange und überaus unterhaltsame Telefongespräche. Das war auch einer der Gründe gewesen, warum Edda ihren Vater gebeten hatte, sie bei seinem Besuch in Neapel mitzunehmen, obwohl ihre eigene Reise nach China mit ihrem Ehemann, einem Diplomaten, den sie erst im vergangenen Jahr geheiratet hatte, kurz bevorstand.
So war Livia auf die Idee gekommen, einen Empfang im kleinen Kreis zu veranstalten und auf diese Weise sowohl ihr neues Zuhause offiziell für das gesellschaftliche Leben zu öffnen als auch ihrer Freundin zu zeigen, dass diese Stadt alles andere war als eine wilde Ansammlung von gefährlichen Elendsvierteln, als die so mancher sie gerne darstellte.
Nicht, dass es so leicht sein würde, die Tochter des Duce einfach mir nichts, dir nichts zu einem Empfang zu laden; für eine solche Veranstaltung bedurfte es gewaltiger Sicherheitsmaßnahmen, sie würde die Aufmerksamkeit der gesamten vornehmen Welt auf sich ziehen und auch nicht folgenlos für die Politik der Stadt bleiben. Doch es würde Livia Spaß machen, ihre Räumlichkeiten eleganten Menschen zu öffnen und zu beobachten, wie sie sich wohl zu benehmen wussten, all die vermeintlichen Größen der neapolitanischen Gesellschaft, die sie in den vergangenen Tagen in den Theatern der Stadt kennengelernt hatte.
Diese besuchte Livia in der Regel allein, denn es gefiel ihr nicht, sich von irgendjemandem, der ihr nichts bedeutete, begleiten zu lassen. Dabei fehlte es ihr wahrlich nicht an möglichen Kandidaten. Es verging kaum ein Tag, an dem ihre Bediensteten ihr nicht riesige Blumenbuketts hereinbrachten, ob nun ohne Absender oder von flammenden Brieflein mit ihr unbekannter Unterschrift begleitet.
Jetzt erhob sie sich, zog den Gürtel ihres Morgenrocks enger um die schmale Taille und trat vor ihren Spiegel, betrachtete ihre weiche, wohlgeformte Gestalt, die zart gebräunte Haut, das dunkle Haar. Meine Schönheit, dachte sie. Wie viel Schaden hat sie wohl schon angerichtet, bei mir selbst und anderen, diese meine Schönheit?
Es war ihre Schönheit gewesen, die Arnaldo verzaubert hatte, einen engherzigen Menschen, der daran gewöhnt war, alles zu bekommen, was er wollte. Es war ihre Schönheit gewesen, die vor einigen Jahren zweien ihrer Galane den Kopf verdreht hatte, zwei Männern, die Livia beide zurückgewiesen hatte, was sie nicht daran hinderte, sich zu duellieren. Und es war ihre Schönheit gewesen, die sie daran hinderte, eine einfache Freundschaft mit Männern zu pflegen, weil diese früher oder später den Versuch einfach nicht lassen konnten, sie zu erobern.
Und nun, da sie es sich zum ersten Mal selbst gewünscht hätte, einen Mann zu faszinieren, den sie so gerne an ihrer Seite gehabt hätte, schien ausgerechnet dieser Mann ihr zu widerstehen. Livia wusste, dass sie Ricciardi nicht gleichgültig war, sie war nicht unempfänglich für die Spannung, die zwischen ihnen herrschte, wie ein leises Prickeln im Körper, wenn er sich ihr näherte, doch da war auch etwas, das ihn bremste und von ihr fernhielt.
Einmal hatte er ihr gesagt, sein Herz sei bereits vergeben und da sei eine andere Frau in seinen Gedanken. Damals hatte Livia ihn gefragt, ob er verheiratet oder verlobt sei, und Ricciardi hatte traurig den Kopf geschüttelt und verneint.
Das veränderte alles, hatte sie damals gedacht und war aus dem Abgrund der Verzweiflung, in den sie für einen kurzen Moment lang zu stürzen schien, wieder aufgetaucht. Er gehörte also niemandem, war frei und konnte folglich immer noch der ihre werden. Wäre er gebunden gewesen, hätte sie ihm schon damals den Laufpass gegeben: Zu oft war sie von ihrem untreuen Ehemann belogen, betrogen und gedemütigt worden, um einer anderen Frau das Gleiche antun zu wollen. Doch wenn dieser seltsame, faszinierende Commissario frei war, was konnte dann so schlimm daran sein, sich eine Strategie zu seiner Eroberung zurechtzulegen?
Strategie? Eroberung? Das waren Begriffe aus dem Krieg, nicht aus der Liebe. Doch im Grunde, überlegte Livia, war die Liebe nicht auch ein Krieg? Mehr eine Jagd als ein Krieg vielleicht, doch im Grunde änderte das nichts.
Was war nur an diesem Mann, das sie so sehr für ihn einnahm? Ganz gewiss seine Augen – wie zwei geschliffene Smaragde, die selbst im Dunkeln noch zu leuchten vermochten. Dann diese wilde Haartolle, die ihm tief in die Stirn fiel, und die knappe Handbewegung, mit der er sie beiseitestrich. Seine Hand, mager und nervös: die Hand, die sie in diesen regnerischen Nächten so gern auf ihrem Körper gespürt hätte …
Livia begann sich zu kämmen. Ja, sie wollte diesen Mann mit jeder Faser ihres Seins, begehrte ihn, wie sie noch nie jemanden begehrt hatte. Livia war immer von anderen Menschen geführt, geleitet und gelenkt worden: von ihren Eltern, den Lehrern, ihrem Mann. Jetzt jedoch hatte sie ein eigenes Haus, das sie sich selbst ausgesucht, und ein eigenes Leben voller Dinge, die sie sich immer gewünscht hatte; es war nur natürlich, dass sie nun auch den Mann an ihrer Seite haben wollte, den sie begehrte.
Livia fragte sich, wer wohl ihre unbekannte Rivalin sei, jene Frau, von der Ricciardi sagte, er liebe sie. Nicht dass dies einen Unterschied gemacht oder ihre Entschlossenheit beeinträchtigt hätte; aber sie fragte sich, wie sie wohl aussah, ob brünett oder blond, groß oder klein.
Und bange fragte sie sich auch, ob sie wohl schöner war als sie.
VI
Enrica betrachtete den schlafenden Jungen mit der Schreibfeder in der Hand. Er hatte den Kopf tief übers Blatt gebeugt, Speichel rann ihm aus dem Mundwinkel. Er schnarchte. Es war schon das dritte Mal an diesem Morgen, dass ihn der Schlaf übermannt hatte.
Von all dem Unterricht, den sie gab, waren die Stunden mit Mario die schwierigsten: Aufgrund der Angewohnheit des Jungen, urplötzlich einzuschlafen, hatte man ihn aller Schulen des Landes verwiesen, und sein Vater, ein reicher Wurstwarenhändler, hatte Enricas Mutter, die zu seinen Kundinnen gehörte, sein Leid geklagt. Diese hatte auf der Stelle ihre Tochter empfohlen, welche ausgebildete Lehrerin sei und mit Geduld und Durchhaltevermögen genau die Richtige sei, um dem Problem Abhilfe zu schaffen.
Und so verbrachte Enrica einen guten Teil jeden Morgens mit dem Versuch, Mario zu wecken, der ansonsten ein guter Junge war, aber eben ständig über seinen Aufgaben einschlummerte. Sie hatte vor, ihn zu den Prüfungen für die Mittelschule anzumelden, und hegte durchaus die Hoffnung, dass er diese bestehen würde, vorausgesetzt allerdings, er fiel nicht auch am Prüfungstag durch lautes Schnarchen auf.
An diesem Tag jedoch würde Enrica ihren Zögling wenigstens ein paar Minuten schlafen lassen. Sie hatte nämlich zu tun.
Möglichst leise zog sie ein Blatt Papier aus der Tasche ihres Rockes und rückte ihre dicke Brille auf der Nase zurecht. Enrica war keine Schönheit, doch sie besaß eine natürliche Anmut und eine Weiblichkeit, die sich ebenso in ihrer Art, sich zu bewegen, ausdrückten wie in ihrem anziehenden Lächeln, wenngleich sie ein wenig zu groß für eine Frau war und ihre langen Beine stets unter altmodisch geschnittenen Röcken verbarg. Mit ihrem in sich gekehrten Charakter und ihrer zwar liebenswerten, aber auch etwas störrischen Art gelang es ihr, Diskussionen vor allem mit der Mutter aus dem Weg zu gehen, die vergeblich versuchte, ihr die eigenen Überzeugungen überzustülpen, und stattdessen ihrem eigenen Willen zu folgen, wobei Enricas Vater, Inhaber eines überaus angesehenen Hutgeschäfts an der Via Toledo, ihr Beistand leistete.
Der Mann liebte seine Erstgeborene von ganzem Herzen, dieses Mädchen, das ihm mit seiner zurückhaltenden und wortkargen Art so sehr ähnelte und im hohen Alter von vierundzwanzig Jahren noch immer nicht unter der Haube war. Dabei hatte es an Gelegenheiten nicht gemangelt, zuletzt in Gestalt des Sohnes eines wohlhabenden Geschäftsinhabers aus der Nachbarschaft, den zu treffen Enrica sich rundweg geweigert hatte – sehr zum Leidwesen der Mutter, die befürchtete, ihre Tochter könne als alte Jungfer enden. Ich liebe einen anderen, hatte Enrica gesagt, einfach so. Ohne Umschweife hatte sie diese schreckliche Nachricht bei einem sonntäglichen Mittagessen geflüstert, bevor die Bolognese aufgetragen wurde.
Giulio Colombo, Enricas Vater, hatte in den darauffolgenden Tagen alle Hände voll zu tun gehabt, ihre Mutter wieder zu beruhigen. Um wen es sich bei dem mysteriösen Herzblatt ihrer Tochter handelte, war nicht in Erfahrung zu bringen gewesen, nur dass es kein bereits verheirateter Mann sei. »Wenigstens etwas«, hatte die Mutter gesagt und sich nervös mit dem Fächer Luft zugewedelt. »Was hast du denn vor?«, hatte sie das Mädchen gefragt, sich durchaus der Tatsache bewusst, dass Enrica ihre Pläne in die Tat umsetzen würde, ganz gleich, worin sie bestanden. »Ich warte«, hatte diese mit der gewohnt heiteren Entschlossenheit geantwortet.
Und wenn sie das tat, ließ man sie gewöhnlich eine Weile in Ruhe.
Das häusliche Leben war dann wieder in die gewohnten Bahnen zurückgekehrt. Enrica hatte weiter unterrichtet, dem Papa seine Leibgerichte gekocht und sich nach dem Abendessen zum Sticken ans Küchenfenster gesetzt, wo sie aus der Ferne auch dem Radio lauschen konnte, das im Wohnzimmer lief. Und von wo aus sie verstohlene Blicke zu dem Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite werfen konnte, hinter dem sich der Umriss einer schlanken Gestalt abzeichnete, welche sie von dort aus bei ihrer Handarbeit beobachtete.
Seit einigen Monaten wusste Enrica, wer der Unbekannte war. Sie hatte eine Vorladung aufs Polizeipräsidium erhalten, wo es um eine Bluttat ging, mit der sie nicht das Geringste zu tun hatte, und sich auf einmal vor dem Mann ihrer Träume wiedergefunden, eben jenem unbekannten Beobachter von gegenüber: Commissario Alfredo Ricciardi. Um die Wahrheit zu sagen, war die Begegnung nicht allzu gut verlaufen: Enrica hatte sich über sich selbst geärgert, weil sie vollkommen unvorbereitet in die Situation gegangen war, noch salopper und nachlässiger gekleidet als sonst, ohne einen Hauch von Schminke, und prompt auch noch eine Angriffslust an den Tag gelegt hatte, die so gar nicht ihre Art war. Tagelang hatte sie sich in der schmerzlichen Gewissheit gequält, dass sie ihn nie wiedersehen würde.
In den darauffolgenden Wochen hatte sich die Sache wieder mehr oder weniger eingespielt. Beide hatten ihre Gewohnheit wiederaufgenommen, einander aus der Ferne anzuschauen, sich sogar gelegentlich flüchtig gegrüßt, zum Beispiel mit einem Nicken. Enrica war geduldig. Sie wusste zu warten. Und dieses Warten war erst vor einigen Tagen durch einen Brief belohnt worden, den sie nun, in diesem Moment, in Händen hielt, während der kleine Mario vor sich hin schnarchte.
Enrica lächelte, als sie sich daran erinnerte, wie ihr Vater bei seiner Rückkehr von der Arbeit die Post durchgeblättert hatte, welche ihnen der Pförtner ihres Hauses gebracht hatte. Mit einem Stirnrunzeln hatte er den Brief betrachtet, ihr dann einen einvernehmlichen Blick zugeworfen, mit dem er sie in ein anderes Zimmer gebeten hatte, wo sie vor den detektivischen Blicken seiner Frau geschützt waren. Dort hatte er ihr das Schreiben kommentarlos in die Hand gedrückt und nur gesagt: »Der ist nicht frankiert.«
Womit er ihr sagen wollte, dass jemand den Brief offenbar persönlich vorbeigebracht und abgegeben oder in den Briefkasten im Hausflur des Palazzos gesteckt hatte. Dann hatte er sie allein gelassen, ohne weiter nachzufragen. So war das zwischen ihnen beiden: Diskretion ging vor.
Das Herz hatte ihr so heftig in der Brust geklopft. Sie war auf ihr Zimmer gegangen und hatte erst einmal fast eine halbe Stunde gewartet, den Umschlag angestarrt und allerlei Vermutungen angestellt, was er wohl enthalten mochte. Dabei zweifelte sie keine Sekunde lang daran, dass er von ihm war und er sich endlich dazu durchgerungen hatte, sich zu melden; gleichzeitig fürchtete sie jedoch sehr, enttäuscht zu werden und dass es sich vielleicht nur um einen formellen Gruß handelte und sonst nichts.
Nun las sie ihn zum wohl hundertsten Mal und dachte, dass er vielleicht ja auch tatsächlich nicht mehr und nicht weniger war als das. Aber immerhin hatte er Kontakt zu ihr aufgenommen.
»Sehr verehrtes Fräulein«, begann der Brief, »ich erlaube mir, Ihnen zu schreiben, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich könnte so ungehobelt und vermessen sein, Sie von Fenster zu Fenster zu grüßen. Allerdings muss ich auch sagen, dass unsere Begegnung kürzlich so überraschend war, dass ich mich außerstande sah, mich anständig vorzustellen. Mein Name ist Luigi Alfredo Ricciardi, ich bin Kriminalkommissar und wohne, wie Sie wissen, auf der anderen Straßenseite. Unsere Fenster liegen einander direkt gegenüber. Dieses kurze Schreiben schicke ich Ihnen einzig und allein zu dem Zweck zu erfahren, ob Sie etwas dagegen haben, gegrüßt zu werden, wenn ich Sie gelegentlich aus der Ferne sehe. Sollte dies der Fall sein, dann kann ich Ihnen versichern, dass es nicht mehr vorkommen wird. Aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, dass es mir sehr gefallen würde, wenn es nicht der Fall wäre.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis dahin verbleibe ich
Ihr Ihnen sehr zugeneigter
Luigi Alfredo Ricciardi«
Es war keine große Sache, doch für Enrica zählte am allermeisten das, was nicht im Brief stand. Dass er offenbar nicht gebunden war, zum Beispiel an jene wunderschöne und vornehme Dame, mit der sie ihn einmal im Gambrinus gesehen hatte, denn sonst hätte er ihr nicht geschrieben. Dass sie ihm nicht gleichgültig war. Und schließlich, dass er offenbar genauso gebildet, zurückhaltend, ja schüchtern war, wie sie ihn sich vorgestellt hatte.
Und jetzt?, fragte Enrica sich bekümmert. Jetzt war sie an der Reihe. Sie würde ihm antworten müssen, nicht gerade mit übertriebener Selbstgewissheit, aber auch nicht allzu kühl, damit er nicht zu der Überzeugung gelangen konnte, sie habe kein Interesse, wie sie es aufgrund ihres Verhaltens bei jener einen Begegnung, die sie gehabt hatten, gefürchtet hatte. Sie musste nachdenken, und zwar schnell.
Und wie nur sollte sie ihm eine Antwort zukommen lassen? Ganz gewiss konnte sie sich, so bekannt wie sie im Viertel war, nicht mit einem Umschlag in der Hand in der Nähe seines Hausbriefkastens sehen lassen; und etwas mit der Post zu schicken würde einen großen Zeitverlust bedeuten. Aber, so fiel ihr ein, sie kannte vom Sehen die alte Dame, die bei ihm wohnte, eine füllige und stets freundliche, mütterliche Frau, die im selben Gewürzladen einkaufte wie sie; also musste Enrica einfach nur den Mut aufbringen, sie einmal anzuhalten, sich vorzustellen und mit ihr zu sprechen.
Enrica steckte das Schreiben wieder in die Tasche und betrachtete seufzend Mario, der immer noch in seinen Träumen versunken war. Schließlich hüstelte sie; der Junge wachte auf und schien zunächst Mühe zu haben, sie zu erkennen.
Enrica lächelte ihn an und sagte: »Also, wo waren wir stehengeblieben?«
Und sie warf einen zärtlichen Blick zum Fenster gegenüber.
VII
Ricciardi stand am Fenster seines Büros und trocknete sich, so gut es ging, die Stirn mit einem Taschentuch ab. Wind und Regen peitschten über die Piazza und fegten alles davon, was nicht fest im Boden verankert war. Die Steineichen schüttelten ihre unbelaubten Äste, Menschen nahmen in den Hauseingängen Zuflucht und klappten ihre Schirme zu, die einem solchen Wüten nicht gewachsen waren.
Beim Anblick des Fensters kam ihm wieder die stickende Enrica in den Sinn, ein Bild der Ruhe und der Heiterkeit, zu dem er oft Zuflucht nahm, wann immer er aufgewühlt oder nervös war. Enrica. Und der Brief, den er ihr geschrieben hatte. Obwohl ihm durchaus bewusst war, dass er nichts allzu Gewagtes getan hatte, verspürte er dennoch große Unruhe. Für einen wie ihn, der zwischenmenschlichen Kontakten ebenso wenig zugeneigt war wie der Zurschaustellung von Gefühlen, war es buchstäblich eine Revolution gewesen, zu Papier und Feder zu greifen und einen so direkten Kontakt herzustellen. Er warf einen Blick auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch, wo die junge Frau bei ihrer unglückseligen ersten Begegnung gesessen hatte. Was für ein erbärmliches Bild er damals abgegeben hatte! Enrica musste ihn für einen kompletten Idioten gehalten haben.