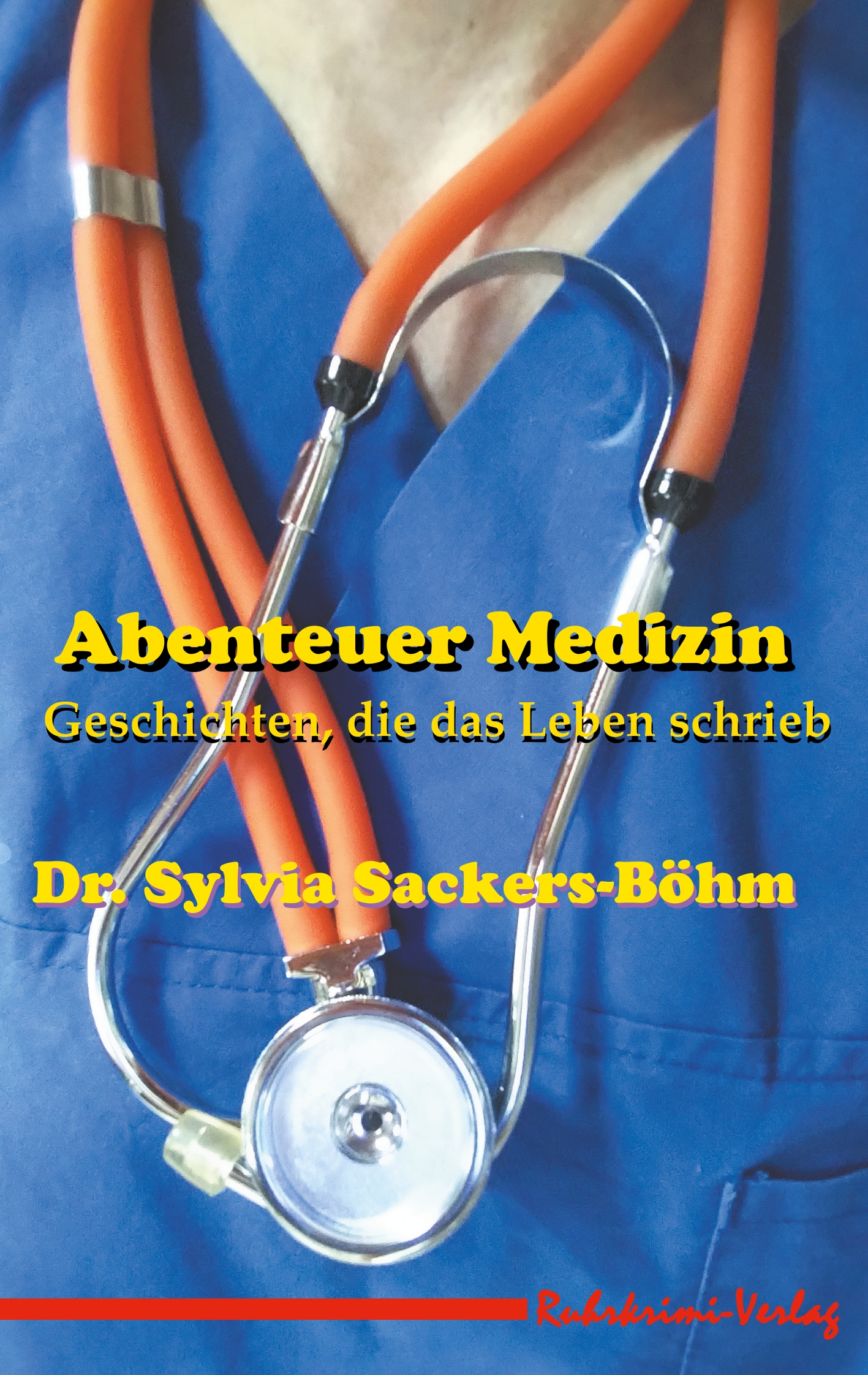
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wen interessieren eigentlich Geschichten aus der Medizin? Meine sorgten mehr als einmal für Kurzweil auf Partys und konnten die Kinder meiner Freunde unterhalten. Aber sind sie für die breite Öffentlichkeit geeignet? Viele dieser Geschichten liegen Jahrzehnte zurück. Zahlreiche Protagonisten sind bereits verstorben. Die Geschichten spiegeln dies mit Humor, Spannung und auch Trauer wider.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Wen interessieren eigentlich Geschichten aus der Medizin?
Meine sorgten mehr als einmal für Kurzweil auf Partys und konnten die Kinder meiner Freunde unterhalten. Aber sind sie für die breite Öffentlichkeit geeignet?
Der Ruhrkrimi-Verlag gab den Anstoß, Erlebtes aus meiner medizinischen Tätigkeit aufzuschreiben.
Je länger ich über meine Erlebnisse nachdachte, umso mehr fiel mir ein. Viele dieser Geschichten liegen Jahrzehnte zurück. Zahlreiche Protagonisten sind bereits verstorben. Die Namen wurden verändert.
Seit 29 Jahren bin ich Ärztin. Mit drei Jahren stand der Berufswunsch schon fest. Meine Eltern belächelten mich, halfen mir aber, diesen Traum zu verwirklichen. Mein Ehemann unterstützte mich immer!
Ich finde diesen Beruf immer noch spannend, herausfordernd und bereichernd. Die Geschichten spiegeln dies mit Humor, Spannung und auch Trauer wider.
Viel Spaß beim Lesen!
Dr. Sylvia Sackers-Böhm
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Keine Person hinter verschlossener Tür
Schützt die Notärztin
Eine Ente mit dem Entenfang
Ihr seid aber auch schön verkleidet!
Alles auf Grün
Ist das eine aufgehende oder eine untergehende Sonne?
Heute ist kein guter Tag zum Sterben
Iste alles echte, Herr Professore
Adipositas gigantea
Plötzlich Schlangenexperte
Hier wird nicht geschlafen!
Test oder Unwissenheit, der falsche Ikterus
Der arme Doktor hat was mit den Augen
Rot auf Rot und Schwarz auf Schwarz
Ihr seid aber gut ausgestattet
Das Paragol hat nicht geholfen!
Das Funkenmariechen ist verletzt!
Der Krug zur Heimaterde
Der verkannte Star am Künstlerhimmel
Das Liebesleben in den Dienstzimmern
Urlaubsreif
Vaterschaftstest post mortem
Cannabis als Medikament
Was ist der Sinn des Lebens (-rettens)?
Dann liegt Josef quer
Suchtmedizin
Mülheim, die sympathisch verschlafene Stadt
Schlüsseleinsatz durch unzählige verschlossene Türen
Harte Schale, weicher Kern
Herr Doktor, Frau Doktor
»Schreien Sie doch nicht so laut«
Bezahlung in Naturalien
»Unsere Doktors« - Integriert ins Dorfleben!
Treffen auf dem Balkon
Die Geburt im Rettungswagen
Da schwimmt was in der Ruhr
Schwester Hannah
Syndrom oder Psyche?
Keuschheit im Nachtdienst
Einmal Outbreak nachspielen
Gestalkt von einer Borderlinerin
Die Kunst des Abturfens
Das Leben ist mühselig und selten gerecht
SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe und andere Kronen der Virologie
Stets unter Beobachtung
Die Lerngruppe wird zu Freunden
Bananenstecker
Glossar
Keine Person hinter verschlossener Tür
Es war ein herrlicher Morgen mitten im April. Ein Samstag an dem zum ersten Mal nach einem trüben Winter wieder strahlender Sonnenschein sein goldenes Licht über die Innenstadt von Mülheim verbreitete.
Man konnte den süßlichen Duft der Akazien in der lauen Luft riechen und den Beginn des Frühlings zum ersten Mal wirklich erahnen.
Normalerweise kein Tag, an dem man gerne arbeitete, aber der Dienst als Notärztin war für mich weniger Arbeit, als ein spannendes Abenteuer.
Der ›Blutrausch‹ wie mein Mann es manchmal nannte, die unmittelbare Befriedigung, wenn nach einem Dienst Leben gerettet worden war, hatte mich in den Bann gezogen.
Der Grad, zwischen dem Hochgefühl, jemandem das Leben gerettet zu haben und der völligen Niederlage war indes schmal. Seit meiner Qualifikation zur Notärztin hatte ich das Glück, nur mit beherrschbaren Fällen konfrontiert gewesen zu sein. Das gab mir Selbstbewusstsein und den Mut zum Notarztdienst. Außerdem war diese Tätigkeit so viel anders, als der Dienst im Krankenhaus.
Die Sanitäter, damals noch eine Männerdomäne, wollten mich immer beschützen und haben sich zum Teil als echte Kavaliere entpuppt. Andererseits waren sie auch immer für einen derben Witz zu haben.
Ich konnte einmal richtig auf die Pauke hauen und nicht, wie im Krankenhaus, die nette, stets devote Assistenzärztin verkörpern.
An diesem Samstag, ich hatte gerade meinen Fahrer von der Feuerwehr, einem ausgebildeten Rettungssanitäter, begrüßt, gab der Notrufempfänger Alarm.
Die Leitstelle meldete, dass sich eine hilflose Person hinter verschlossener Tür befände. Ob diese Person gestürzt war und sich nicht bemerkbar machen konnte oder ob es sich um einen Toten handelte, konnte man nicht sagen.
Der Einsatzort war nicht weit von unserem Standort, dem Marienhospital, entfernt. Die Wohnung der hilflosen Person befand sich in einem der Iduna-Hochhäuser, einer der Bausünden der 1970er Jahre, die die Mülheimer Skyline dominieren.
Quelle: Rüsterstaude, Wikipedia, Lizens: CC
Bei einem Einsatz unter solch einem Stichwort rückt die Feuerwehr mit großer Flottille an: Polizei, Feuerwehrwagen mit Drehleiter (falls man nur von außen an die Wohnung herankommt), Rüstwagen mit Werkzeug, Rettungswagen und (hoffentlich) nicht zuletzt dem Notarzteinsatzfahrzeug.
So waren wir etwa gleichzeitig vor Ort und eilten ins Gebäude.
Die Wohnung befand sich in der 14. Etage, kein Stockwerk, in das man mal eben hinaufläuft.
Da wir so viele Personen waren, okkupierten wir sämtliche Aufzüge. Die Zivilpersonen schickten wir hinaus, weil dies ein wichtiger Notarzteinsatz war!
So nötigten wir auch einen älteren Herrn aus dem Aufzug, der mit Tüten bepackt vom Einkauf kam.
Vor der Wohnung angekommen, hörten wir keinen Mucks aus dem Inneren. Es wurde beschlossen, dass Gefahr im Verzug sei und die Tür schleunigst aufgebrochen werden müsse. Das war schnell erledigt, die Zarge ein wenig gesplissen, aber wir konnten endlich Hilfe leisten.
Wir fanden niemanden in der Wohnung, der Hilfe benötigte. Sie war leer.
Mit dem nächsten Aufzug kam der ältere Herr, den wir zuvor hinausgenötigt hatten, in den Flur und trat zu uns in die Wohnung. Er brachte vor Entsetzten über die zerborstene Türzarge und die Anzahl der Menschen kein Wort hervor, denn es handelte sich um seine Wohnung.
Zunächst musste ich den Mann beruhigen, der inzwischen kurz vor einem Herzinfarkt stand. Als er sich beruhigt hatte, ließ sich erfahren, dass in der Wohnung ein Hausnotruf zum Malteser Hilfswerk eingerichtet war.
Die pflegebedürftige Ehefrau des Mannes war in der vorangegangenen Nacht ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Aufregung hatte er vergessen, den Maltesern Bescheid zu geben. Nach einer für ihn kurzen Nacht, ging er zum Einkaufen.
In dieser Zeit wurde über eine Fernsprechanlage vom diensthabenden Mitarbeiter des Hilfsdienstes routinemäßig abgefragt, ob alles in Ordnung sei. Er bekam keine Antwort und setzte völlig zurecht den Notruf ab. Damit wurde die Kaskade in Bewegung gesetzt.
Nach vielen wortreichen Entschuldigungen und einer provisorisch durch die Feuerwehrleute zusammen gezimmerten Türzarge, zogen wir uns zurück.
Zurück in unserem Aufenthaltsraum im Krankenhaus hatte dieser Einsatz schon sein Motto bekommen. Es war nicht die ›hilflose Person hinter verschlossener Tür‹, sondern ›keine Person hinter verschlossener Tür‹.
Schützt die Notärztin
Einer der ersten Einsätze in meiner beruflichen Karriere war gleichzeitig einer der spektakulärsten.
Kurz nach Mitternacht wurden wir nach Mülheim-Speldorf in eine gehobene Wohngegend gerufen. Es hieß, es hätte dort eine Schießerei gegeben.
Mit bedrücktem Schweigen fuhren mein Fahrer und ich zum Einsatzort. Auf der Fahrt dorthin rekapitulierte ich in meiner Phantasie sämtliche Arten von Schussverletzungen und deren medizinische Versorgung.
Q: Wikipedia, Autor: Ernstl, Lizens: CC
Alles war abgesperrt und man ließ uns nicht an den Ort des Geschehens. Zur Untätigkeit verdammt wurden aus Sekunden Minuten und Minuten zu gefühlten Stunden. Endlich kam über Funk die Erlaubnis auszusteigen. Ich schnappte mir den Notfallkoffer, der Fahrer trug den schweren Defibrillator.
Plötzlich liefen drei Polizisten auf mich zu, kreisten mich, mit zugewandtem Rücken und gezogener Pistole, ein und jemand rief: »Schützt die Notärztin«.
Alles wirkte surreal und ich fühlte mich, wie in einem Krimi. War ich wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation? Eingekreist und abgeschirmt durch die drei Beamten näherte ich mich dem Haus, in dem angeblich geschossen worden war.
Im Vorgarten des Reihenhauses lag ein junger Mann mit einer Stichwunde im Bauch. Mir wurde berichtet, dass er von einem Einbrecher mit dem Messer angegriffen worden sei und verletzt wurde. Im Haus befänden sich weitere verletzte Personen.
Dies war eine Situation, um den leitenden Notarzt der Stadt anzufordern. Der war aber nicht zu erreichen. Also musste ich mich allein mit meiner Feuerwehrmannschaft und der Polizei durchschlagen.
In dem schummrigen Licht einer Terrassenlaterne konnte ich die Wunde des Mannes kaum erkennen, geschweige denn sehen, ob innere Organverletzungen bestanden. So drückte ich einem Polizisten eine Taschenlampe in die Hand und befahl ihm, die Verletzung auszuleuchten.
Während der Untersuchung und dem Versuch, einen venösen Zugang für eine Infusion zu legen, begann der Lichtkegel zunehmend zu schwanken.
Der Polizist stand kurz vor einem Kreislaufkollaps. Er konnte kein Blut sehen und ein Rettungssanitäter löste ihn ab. Kreislaufstabil und mit versorgter Wunde, schickte ich den Verletzen ohne ärztliche Begleitung auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus, da weitere Personen meine Hilfe benötigten.
Im Flur des Hauses schlug mir der Geruch von frischem Blut entgegen. Ich fand einen Mann mittleren Alters inmitten einer riesigen Blutlache. Sein Körper wies unzählige Messerstiche auf und es war klar, dass seine Verletzungen nicht mehr mit dem Leben zu vereinbaren waren.
Nach einer kurzen Untersuchung geleitete mich ein Kriminalbeamter ins Wohnzimmer. Durch ein riesiges Panoramafenster schauten wir auf eine großzügige Terrasse. Dort lag eine Frau auf dem Bauch und rührte sich nicht. Im Bereich ihres Halses befand sich eine große Menge Blut.
Mir wurde bedeutet, im Wohnzimmer zu bleiben, da sich im Garten ein angeschossener Kampfhund aufhielt, der sich verkrochen hatte. So verletzt war er gefährlich und musste zunächst gefunden werden. Ich stand wie vor einer Kinoleinwand, den Blutgeruch aus dem Flur in der Nase, meinen Fahrer neben mir und war zur Untätigkeit verdammt.
Allmählich wurde mir übel und ich bemerkte aufkommenden Schwindel. ›Du bist hier die Notärztin, dir darf nicht schlecht werden‹, sagte ich mir und kurz darauf durften wir dann doch auf die Terrasse. Der Hund war nicht gefunden worden, und man ging davon aus, dass er sich auf irgendein Nachbargrundstück verkrochen hatte.
Ich hockte mich vor die Frau und sah, dass ihr die Kehle durchgeschnitten worden war. Auch sie war tot.
Nachdem ich den Tod von zwei Menschen festgestellt hatte, hieß es, es gäbe noch einen kleinen Jungen, der in der ersten Etage schliefe.
Haarsträubende Theorien von einem kollektiven Suizid wurden entwickelt. Ich sollte kurz feststellen, ob der Junge vergiftet worden sei.
Dass das nicht ›mal eben‹ möglich sei und ich dazu den Jungen wecken und in diesem Chaos zwischen den Leichen seiner Eltern untersuchen müsste, erläuterte ich den Polizisten sehr nachdrücklich.
So entschied ich mit meinem Fahrer, den Jungen möglichst schlafend aus dem Haus zu schaffen. Ich weiß nicht viel über Kinder, aber eines kannte ich von Freunden: Wenn sie einmal tief und fest schlafen, werden sie so schnell nicht wach.
So schlichen wir uns ins Kinderzimmer. Mein Fahrer nahm den etwa Vierjährigen auf den Arm. Ich griff mir das Kopfkissen und einige Stofftiere und drapierte alles so um den Kopf des Jungen, dass er nichts sehen würde, falls er auf dem Weg zum Rettungswagen doch wach werden würde.
Mit dem Kind auf dem Arm, leise, beruhigend auf ihn einflüsternd, liefen wir die Treppe hinab, durch den blutverschmierten Flur an der Leiche des Vaters vorbei zum Auto.
Eine Traube von schaulustigen Nachbarn hatte sich vor dem Haus versammelt und ich fragte, wer mit dem Kind vertraut sei.
Es meldete sich eine Nachbarin, die ich aufforderte, mit in den Rettungswagen zu steigen.
Ich setzte mich in die hintere Kabine, übernahm den Jungen mit seinem Kopfkissen.
Auf dem Weg zum Krankenhaus wurde der Kleine wach. Durch seine kuschelige Position und das bekannte Gesicht der Nachbarin realisierte er zum Glück nicht, dass er nicht auf dem Schoß seiner Mutter, sondern bei einer völlig fremden Person saß.
Über Funk hatte mein Fahrer im Krankenhaus bereits alle Diensthabenden und vor allem den Hauspsychiater informiert, der mich an der Tür empfing und sich unmittelbar um das Kind kümmerte. Erst jetzt bemerkte der Junge, dass seine Eltern gar nicht da waren.
Im Aufenthaltsraum des Krankenhauses fiel der Stress von mir ab und ich erwachte wie aus einem Albtraum.
Der verletzte junge Mann war bereits chirurgisch versorgt und stationär aufgenommen worden. Wie mir berichtet wurde, hatte er sehr viel Geld in seinen Hosentaschen.
Erst am darauffolgenden Tag erfuhr ich von einem Kriminalbeamten, dass dieser drogensüchtige junge Mann, seinen Vater und die Stiefmutter getötet hatte, nachdem er versucht hatte, das Geld seines Vaters zu stehlen. Er war von dem Paar überrascht worden und hatte sie getötet.
Die Stichverletzung hatte er sich selbst zugefügt, um einen Raubüberfall auf die Familie vorzutäuschen, als klar wurde, dass die Polizei alarmiert worden war.
Noch Monate nach dem Einsatz träumte ich von der Szene am Wohnzimmerfenster. Immer wieder drängte sich mir die Frage auf, ob die Frau vielleicht nicht gestorben wäre, wenn wir sofort zu ihr gekonnt und sie behandelt hätten. Im Grunde war mir aber klar, dass sie durch diesen Schnitt sofort tot war.
Ein Jahr später war die Gerichtsverhandlung des jungen Mannes und ich wurde als Zeugin vernommen.
Ihm an dem Tag zu begegnen, mit dem Wissen, dass ich kein Opfer, sondern einen Täter behandelt hatte, löste für mich lange Zeit einen Zwiespalt der Gefühle aus!
Eine Ente mit dem Entenfang
Es war eine sehr heiße Sommernacht. Die Bereitschaftszimmer, auch die für die Notärzte, lagen im nicht isolierten Dachgeschoss des Krankenhauses. Es gab sogar Teile des Söllers, die gesperrt waren, weil dort Fledermäuse lebten, die nicht gestört werden durften.
Sie flogen nachts ungehindert durch den Flur und hatten eine der Nachtschwestern fast in den Wahnsinn getrieben.
Aufgrund ihrer vermeintlichen Halluzinationen rechnete sie mit einer Überführung in die geschlossene Abteilung.
Die Auslegware der Notarzt-Dienst-Zimmer strömte noch nach Jahren in der warmen Jahreszeit Dämpfe aus, die selbst einen Lungen-Gesunden in einen Asthma-Anfall trieben. Es hatten sich Tauben hinter dem Kleiderschrank eingenistet, weil ein Kollege ein Kippfenster geöffnet hatte, um dem üblichen Mief zu entkommen. Als dieses Nest nach Wochen entdeckt und entsorgt wurde, hatte sich ein neuer Geruch zu dem Muff des Teppichs gesellt.
In dem überhitzten Zimmer lag ich vollständig angezogen auf dem Bett. Wenn der Pieper alarmierte, hatte ich nur noch die Zeit, mir die Zähne zu putzen.
Es war kurz vor Mitternacht. Mein Dienst war hart gewesen. Ich hatte viele Einsätze wegen der kritischen Wetterlage.
Es hatte Patienten mit Blutdruckproblemen gegeben. Junge Leute waren zu lange ungeschützt in der Sonne geblieben und letztendlich hatten viele alte Menschen nicht genug getrunken und waren zum Teil verwirrt.





























