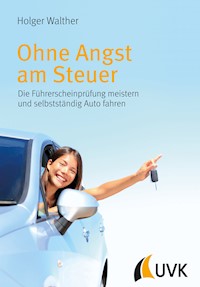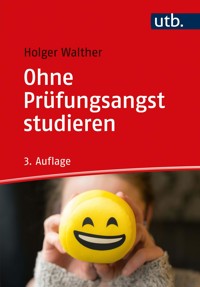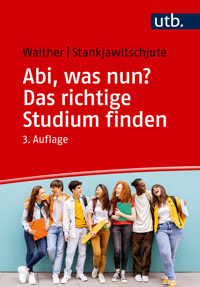
21,99 €
Mehr erfahren.
Das richtige Studium mit Methode finden! Das Abi in der Tasche und was nun? Tausende von Schüler:innen stellen sich jedes Jahr aufs Neue diese Frage. Schließlich ist die Auswahl an Studienfächern riesengroß. Und: Die Entscheidung hat großen Einfluss auf das weitere Leben. Der vielfach erprobte Ratgeber verliert sich nicht in der Vielzahl von Studiengängen, sondern vermittelt eine sinnvolle Methode zur richtigen Studienwahl. Dieses Buch, nun in der dritten, überarbeiteten Auflage, ist seit vielen Jahren für Abiturient:innen und Studieninteressierte der hilfreiche Wegweiser auf dem Weg zum richtigen Studium.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Holger Walther / Sandra Stankjawitschjute
Abi, was nun? Das richtige Studium finden
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: © eyetoeyePIX ∣ iStock
Autorenfoto Holger Walther: © privat ∣ Fotograf: Andreas Kirsch
Autorinnenfoto Sandra Stankjawitschjute: © privat
Icon Kapitelende: © pop_jop ∣ iStock
Dipl.-Psych. Holger Walther (oben) und Sandra Stankjawitschjute, M. Sc. (unten) sind approbierte Psychotherapeut:innen. Beide arbeiteten bis vor kurzem in der Psychologischen Beratungsstelle der Humboldt-Universität zu Berlin und sind nun ausschließlich freiberuflich in ihrer jeweiligen eigenen psychotherapeutischen Praxis in Berlin tätig.
3., überarbeitete Auflage 2025
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2022
1. Auflage 2013
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838563749
© UVK Verlag 2025— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 3906
ISBN 978-3-8252-6374-4 (Print)
ISBN 978-3-8463-6374-4 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Jedes Jahr steht ein neuer Abiturjahrgang vor derselben Frage: Wie soll es nun nach der Schule weitergehen? Ganz unterschiedlich sind die Vorstellungen: mal ganz klar und eindeutig, bei anderen aber auch unentschieden oder diffus. Ihnen stellt sich immer wieder die Frage, wie man herausfindet, was zu einem passt. Die Auswahl ist vielfältig und die eigenen Interessen breit gestreut. Gerade das macht aber eine Entscheidung nicht leichter. Zu wissen, dass es ein Studium sein soll, stellt einen ersten, wichtigen Entschluss dar. Immerhin wollen fast 70 % der dazu Berechtigten studieren. Doch auch diese Entscheidung verringert die Optionen kaum merklich, wenn es schließlich fast 20.000 verschiedene Studiengänge an über 400 Hochschulen verteilt auf die ganze Bundesrepublik gibt.
Doch auch viele, deren Entscheidung schon länger zurückliegt und die bereits studieren, finden sich erneut an einem ähnlichen Punkt wieder. Wenn nämlich die ersten Erfahrungen an der Hochschule mehr oder weniger deutlich zeigen, dass das Studium so gar nicht zu einem passt, und man scheinbar die falsche Wahl getroffen hat. Zurück an den Anfang – doch dieses Mal muss eine sichere Wahl getroffen werden, denn noch ein Neustart wäre indiskutabel. Dieser Anspruch jedoch verhindert häufig eine Neuorientierung, die gleichzeitig als so wichtig und zwingend empfunden wird.
Zunächst durchaus beruhigend könnte sich eine Auffassung auswirken: Unsere Arbeitswelt ist mittlerweile derart im Wandel, so dass die Entscheidung für ein Studienfach nicht automatisch den gesamten Lebensweg festlegt. Alte Berufsbilder und deren konkrete Umsetzung im Arbeitsalltag verändern sich, neue Arbeitsgebiete entstehen nicht nur aufgrund der technischen Entwicklungen. Doch ein fester Bestandteil in diesem Gefüge bist du mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Interessen und Fähigkeiten. Auch diese können durchaus wandlungsfähig sein, sich entwickeln und verändern, aber im Kern bleiben sie dir erhalten. Daher ist es für die meisten der größte Wunsch, einen Beruf zu ergreifen, der richtig zu einer/einem passt und der dann glücklich und zufrieden machen soll.
Sicher ist es auch deine Vorstellung, bei der Studienwahl zu einer authentischen Entscheidung zu kommen, bei der du am Ende behaupten kannst, dir selbst treu geblieben zu sein. Genau dabei will dieses Buch dich unterstützen. Mit einem Paket aus bewährten Methoden gelingt es dir, die verschiedenen Aspekte der Studienwahl zu berücksichtigen. Dabei ist es wichtig, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und bei der Suche die anderen in gewissem Rahmen als Infoquelle und Ratgebende zu nutzen. Es ist das Ziel dieses Buches, dich durch einen fundierten Entscheidungsprozess zu begleiten, hin zu einer Entscheidung, mit der du leben kannst. Denn am Ende wirst du es sein, die/der hauptsächlich mit der Entscheidung leben muss.
Wir bedanken uns bei all den Ratsuchenden, die es uns möglich machten, sie in ihrem Entscheidungsprozess zu begleiten, in dem sie uns einen tiefen Einblick in ihre persönliche Situation erlaubten. Ohne sie hätte es dieses Buch nicht geben können.
Unser Dank gilt auch unserer Kollegin aus der Allgemeinen Studienberatung der Humboldt-Universität zu Berlin, Frau Dr. Benita Bischoff, deren Anteil an den gemeinsam durchgeführten Veranstaltungen uns so viele bedeutsame Einzelheiten aus der Welt der Studiengänge nähergebracht hat.
Berlin, im November 2024
Holger Walther und Sandra Stankjawitschjute
Das bedeuten die verwendeten Symbole
▶
Unter der angegebenen Adresse findest du im Internet weitere Informationen.
Hier steht Zusatzmaterial zum Download auf unserer Website für dich bereit. Folge einfach dem Link oder QR-Code.
→
Der Pfeil verweist dich auf wichtige Begriffe im Glossar oder Buchkapitel, die für dich ebenfalls interessant sein könnten.
Teil I: Alles, was du über die Entscheidung wissen solltest
„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“
(Nils Bohr, dänischer Physiker und Nobelpreisträger, 1995–1962)
1Grundsätzliches
Entscheidungen sind unglaublich vielfältig und können die unterschiedlichsten Folgen haben: So gibt es Entscheidungen im Leben, die lebensbedrohlich und nicht revidierbar sind. Die Tragweite dieser Entscheidungen ist also sehr groß. Aber es gibt eben auch die vielen kleinen, alltäglichen Entscheidungen, die bereits morgen ohne Bedeutung sind. Deine Studienwahl liegt irgendwo dazwischen: Sie bestimmt deinen Weg der nächsten Jahre, muss aber nie endgültig und unveränderbar sein. Dies zeigen die vielen unterschiedlichen Lebensläufe anderer, in denen sich Karrieren Stück für Stück entwickeln oder in denen radikale Brüche zu finden sind. So etwas kann aus einer Not heraus geschehen, wie etwa einer Arbeitslosigkeit. Aber natürlich ebenso selbst gewählt sein.
Ausblick | Das erwartet dich
In diesem ersten Teil des Buches wirst du viele quälende Gedanken und Gefühle zur Studienwahl wiederfinden und auch für dich neue beschrieben sehen. Denn es wird darum gehen, die Vielfalt des Entscheidungsprozesses zu reflektieren. Schon hier wird deutlich, dass eine fundierte Entscheidung mit viel Aufwand verbunden ist. Doch im Hinblick auf das, was du dafür bekommst, lohnt die Energie, die du in deine Studienwahl investierst. Dieser Prozess beginnt bereits, wenn du nach dem Lesen dieses ersten Teils konkrete Hilfestellungen bei der Wahl eines Studienfaches im zweiten, deutlich umfangreichen Teil dieses Buches bekommst. Arbeite die einzelnen Schritte sorgsam durch. Nimm dir damit genügend Zeit für deine Studienwahl und profitiere am Ende von einer Entscheidung für deine Zukunft.
1.1Die Qual der Wahl
Eine Entscheidung wird immer dann von uns gefordert, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Idee oder ein Vorhaben umzusetzen. Das reicht von so banalen Dingen wie bei einem Blick ins Internet zu entscheiden, welches YouTube-Video oder welchen Kinofilm man sehen will, bis hin zu deutlich weitreichenden Entscheidungen, wie etwa die Entscheidung für einen bestimmten Beruf oder eine Ausbildung. Dementsprechend erlauben wir es uns, manche Dinge aus dem Bauch heraus eher spontan zu entscheiden, während wir anderes aufwändig abwägen und dafür eine mehr rationale Vorgehensweise wählen. Dies geht nicht ohne eine sogenannte Entscheidungskompetenz. Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit, in Frage kommende Alternativen sachlich zu ergründen, um nicht Gefahr zu laufen, voreilige Schlüsse zu ziehen oder eine zu stark emotionale Entscheidung zu treffen. Erstrebenswert finden es viele, insgesamt eine gewisse Entschlossenheit an den Tag zu legen: Ist erst eine Entscheidung gefällt, möchten sie diese konsequent umsetzen und später auch nicht bereuen.
Sicher ist es auch dein Wunsch, die Entscheidung für einen Studiengang gut überlegt zu haben und dabei in erster Linie kein wichtiges Argument und auch kein Gefühl außer Acht gelassen zu haben. Dann hast du dich für die rationale Vorgehensweise entschieden, die mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Das Besondere an diesem Buch ist es, dass bei unserer Vorgehensweise dennoch emotionale Argumente und spontane Ideen nicht zu kurz kommen, damit insgesamt eine Ausgewogenheit entsteht. Auch diese werden angemessen berücksichtigt und geben dir das berechtigte Gefühl, an alles gedacht zu haben.
Gut zu wissen | Entscheidungen treffen
Idealerweise folgen Entscheidungen einem bestimmten Ablauf, um zu garantieren, nichts Wichtiges übersehen und möglichst an alles gedacht zu haben. Dieser Ablauf sieht, allgemein formuliert, wie im folgenden Abschnitt gezeigt aus.
Die Phasen einer EntscheidungEntscheidungPhasen der
Versuchen wir, einen allgemeinen Ablauf zu beschreiben, der bei den meisten Entscheidungsprozessen zu beobachten ist, dann zeigt sich, dass wir bei Entscheidungen eigentlich fünf Phasen durchlaufen. Da dies eher unbewusst und automatisch abläuft, möchten wir dir die Phasen vorstellen, damit du daran auch den Aufbau des Buches nachvollziehen kannst. Denn mithilfe dieses Buches wirst du die fünf Phasen bewusster und gezielt durchlaufen.
Kurz und bündig | Die Phasen einer Entscheidung
Phase 1: Feststellen eines Bedarfs, eines Wunsches,eines Bedürfnisses oder einer Idee
Phase 2: Herausfinden und Beschreiben der möglichen Alternativen
Phase 3: Beurteilung der wahrscheinlichen Konsequenzenfür jede Alternative und Entscheidung
Phase 4: Umsetzung
Phase 5: Prüfung mit dem Ergebnis: beibehalten oder revidieren
Phase 1 | Feststellen eines Bedarfs, eines Wunsches, eines Bedürfnisses oder einer Idee
In dieser Phase wird eine Idee geboren, ein Wunsch geäußert oder eine Notwendigkeit formuliert, weil es einen konkreten Bedarf für eine Veränderung gibt. So ist es für dich vielleicht selbstverständlich, mit dem erworbenen Abitur nun auch zu studieren. Also muss ein Studiengang gefunden werden. Oder du hast längere Zeit überlegt und etwa nach einer schon absolvierten Berufsausbildung und Berufstätigkeit doch noch den Wunsch verspürt, einen stärkeren intellektuellen Schwerpunkt zu bekommen. Es ist nicht ganz so dringend, einen Studiengang zu finden, denn in diesem Fall wäre es mehr ein Wunsch als eine unbedingte Konsequenz. Anders dagegen wiederum, wenn du bereits studierst, aber mit dem Studienfach oder den Studieninhalten unzufrieden bist und deshalb darüber nachdenkst, ob es nicht doch ein anderes Fach sein sollte. Hier kann man nicht mehr von einem Wunsch sprechen. Denn es gibt einen akuten Bedarf nach Veränderung, der entsprechendes Handeln notwendig macht. Dies beschreibt die nächste Phase.
Phase 2 | Herausfinden und Beschreiben der möglichen Alternativen
Bevor etwas entschieden werden kann, müssen erst einmal die möglichen Optionen feststehen. Für Studiengänge gilt: Welche Fächer kommen in die engere Wahl und habe ich die Möglichkeit, diese zu studieren? Eine genauere Beschreibung bedeutet etwa: Wo gibt es das Fach, was wird darin tatsächlich gemacht und welche Anforderungen muss ich erfüllen?
Unser Kühlschrank-Beispiel soll das erklären: Ich habe auf etwas Appetit, nämlich Käse. Aber erst der tatsächliche Blick in den Kühlschrank zeigt mir die vorhandenen Möglichkeiten in Form verschiedener Käsesorten, aus denen ich auswählen kann. Denn wer kann immer auswendig wissen und garantieren, was sich hinter der verschlossenen Kühlschranktür verbirgt? In einer Familie oder einer WG können sich die Optionen im Kühlschrank schnell verändern und plötzlich ist nur noch eine Sorte da. Finde also heraus, welche Alternativen wirklich zur Verfügung stehen.
Phase 3 | Beurteilung der wahrscheinlichen Konsequenzen für jede Alternative und Entscheidung
Diese Phase beschreiben viele als die schwierigste Phase, da unsere Erfahrung zeigt, dass die Erstellung einer Liste mit allen gefundenen Beschreibungen nur selten den gewünschten Aha-Effekt und damit automatisch eine Entscheidung bringt. Eher pendeln wir zwischen den Alternativen hin und her und heben einzelne Argumente immer wieder unterschiedlich hervor. Darüber hinaus sollen wir auch noch einen Blick in die Zukunft werfen und vorhersagen können, was die Folgen der jeweiligen Alternative sein werden, etwa die Berufschancen eines konkreten Studiengangs. Häufig bleibt dann genau an dieser Stelle die Entscheidung stecken, weil solche Vorhersagen so schwer, wenn nicht sogar unmöglich sind. In → Teil II arbeitest du daher eine eigene Sammlung möglicher Konsequenzen durch, womit dir die notwendige persönliche Beurteilung gelingen wird. Damit hast du dann eine umfassende Entscheidungsgrundlage.
Phase 4 | Umsetzung
Ist eine Entscheidung gefällt, sollte irgendwann danach die konkrete Umsetzung beginnen. Das heißt, ein Ereignis setzt tatsächlich ein und du sammelst damit Erfahrungen. Im Kühlschrank-Beispiel bedeutet dies: Du legst den ausgesuchten Käse auf eine Brotscheibe, beißt ab und probierst damit diese Kombination. Du nimmst noch mehrere Bisse und stellst immer mal wieder fest, wie gut es dir schmeckt. Auf dein Studienfach übertragen heißt dies: Du hast dich beworben und dann begonnen zu studieren. Du lernst die Hochschule und das Fach tatsächlich kennen und sammelst viele Erfahrungen, beispielsweise zu den tatsächlichen Inhalten der Seminare und vielleicht auch Informationen zu den Berufsaussichten.
Phase 5 | Prüfung mit dem Ergebnis: beibehalten oder revidieren
In dieser Phase ist quasi alles vorbei und du weißt, was aus einer Sache letztendlich geworden ist. Du kannst nun die ursprüngliche Entscheidung an ihrem Ergebnis messen und sie im günstigen Fall beibehalten. Ist aber das gewünschte Ergebnis nicht zufriedenstellend oder sogar gar nicht eingetreten, dann wäre es komisch, trotzdem alles so zu belassen. Dann ist es sinnvoll, die Entscheidung neu zu überdenken und anzupassen. Denn die gemachten Erfahrungen kannst und darfst du nicht einfach ignorieren. Dazu nochmal das Käse-Beispiel: Hast du eine gute Entscheidung getroffen, dann wird es dir schmecken. Du nimmst nämlich sehr gerne weitere Bisse oder belegst sogar noch eine zweite Scheibe mit derselben Käsesorte. Für zukünftige Mahlzeiten weißt du, dass diese Sorte eine gute Wahl bedeutet. Und entsprechend lautet die gegenteilige Konsequenz bei einer schlechten Erfahrung: Schmeckt der Käse nicht, solltest du beim nächsten Mal unbedingt eine andere Sorte wählen. Und damit hättest du die ursprüngliche Wahl revidiert.
Den Ablauf dieser fünf Phasen einzuhalten, fällt bei dem Beispiel mit dem Kühlschrank nicht so schwer, denn die Käsesorten unterscheiden sich vielleicht nur wenig und, egal was du nimmst, satt würdest du ja in jedem Fall. Bei der Studienwahl bist du in jeder der fünf Phasen deutlich mehr gefordert. Wenn alle Phasen bewusst durchlaufen wurden, kannst du von einer gründlichen Entscheidung ausgehen. Doch macht dieser schematische Ablauf auch einen häufig genannten Nachteil bei der Wahl des Studiums deutlich: Es dauert ziemlich lange, bis du die Ergebnisse deiner Wahl überprüfen kannst. Schließlich liegen dann das Bewerbungsverfahren, vielleicht ein Umzug und mindestens das erste Semester hinter dir. Das macht einen Teil der Unsicherheit aus und deshalb fragen sich Viele zu Recht: „Wie soll ich denn heute wissen, ob ich in 10 Jahren immer noch damit zufrieden bin?“
Was macht die EntscheidungEntscheidung so schwer?
Zu viele Möglichkeiten
Viele sind unzufrieden mit den immer größer gewordenen Supermärkten, in denen man inzwischen nicht nur Lebensmittel, sondern ähnlich wie in einem Kaufhaus sogar Kleidung, Haushaltswaren oder Handwerksbedarf bekommt. Sie fühlen sich erschlagen von dem Überangebot und versuchen häufig gezielt, das meiste auszublenden, in dem sie eine einfache, aber wirkungsvolle Strategie entwickelt haben: Sie nehmen sich vor, nur genau das einzukaufen, was auf einem zuhause geschriebenen Einkaufszettel steht. Der Vorteil: Man muss nicht mehr durch alle Reihen laufen, sondern sucht nur die Ecken und Regale auf, in denen die gewünschten Dinge zu finden sind.
An diesem Beispiel kannst du deutlich eine Bedingung unseres Gehirns sehen: Eine zu große Auswahl muss reduziert werden, denn je weniger Optionen bestehen, umso leichter mag das Gehirn sich entscheiden. Ein erster Schritt zur Reduktion ist die Erkenntnis, dass nicht alle Möglichkeiten für mich persönlich relevant sind. Trinke ich beispielsweise keinen Alkohol, dann kann ich im Supermarkt gleich eine riesige Ecke aussparen. Und selbst eine verlockend klingende Auswahl an Käsesorten reduziert sich, wenn ich persönlich bedeutsame Kriterien anlege. Solltest du nur fettarmen Käse kaufen wollen, fällt nämlich auch hier der größte Teil schon mal weg.
Das Ziel ist es also, aus dem Überangebot eine grobe Auswahl zu treffen und am Ende auf drei bis vier Möglichkeiten zu reduzieren. Und das funktioniert auch umgekehrt so: Wenn du gar keine Idee hast, was du nehmen könntest, dann versuchst du auch, drei bis vier Möglichkeiten zu finden. Gibt es nur eine Möglichkeit, dann ist ja eine Entscheidung überhaupt nicht möglich. Gibt es zwei Optionen, dann bist du in der Situation, die der Kommunikationswissenschaftler und Psychologe Paul Watzlawick die Illusion der AlternativenIllusion der Alternativen genannt hat, weil es ja nur ein Entweder-oder gibt. Keine der Alternativen muss zwingend passend oder richtig sein. Erst ab drei Wahlmöglichkeiten empfinden wir eine Wahlfreiheit und können beginnen, die Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen.
Dafür ist immer auch dagegen
Kennst du das auch aus einem Restaurant? Da gibt es mehrere leckere Gerichte, aber du kannst nur eines essen. Sobald du dich mehr für das eine erwärmen kannst, wird dir deutlich, dass das andere auch ganz gut wäre. Und dir wird klar: Was immer ich auch nehme – das andere habe ich dann nicht.
Wir müssen uns wohl damit abfinden: Wer sich für etwas entscheidet, hat sich im selben Atemzug damit auch gegen etwas anderes entschieden. Und auf das muss man nun verzichten. Aber vielleicht verpasse ich da ja auch etwas? Würde man sich für Medizin entscheiden, lernt man andere Fächer wie Germanistik oder Architektur nämlich nicht kennen. Auch bei der Entscheidung für ein Studienfach an einem bestimmten Ort können Fragen aufgeworfen werden: Woher weiß ich denn, ob ich nicht in Erfurt meine:r Partner:in fürs Leben über den Weg gelaufen wäre, wo ich mich doch für Bremen als Studienort entschieden habe? Man fragt sich, ob das andere nicht besser wäre und genau aus der Angst heraus, etwas zu verpassen, wird keine Entscheidung gefällt.
Gut ist es daher, wenn wir unsere Entscheidung begründen können, denn es muss ja Kriterien gegeben haben, weshalb das eine gegenüber dem anderen bevorzugt wurde. Man könnte die Kriterien, die wir auch als Argumente bezeichnen können, der Übersicht halber mit Plus- und Minuszeichen im Sinne von Pro und Contra versehen. Das ergibt einen groben Überblick. Doch bei wichtigen Entscheidungen ist das zu wenig! Deshalb wirst du mit dem → Teil II ausführlicher an die Studienwahlentscheidung herangehen.
Die Illusion einer objektiv „richtigen“ Entscheidung
Es wäre doch schön, wenn es die Gewissheit gäbe, mit einer sachlichen, rationalen und gründlichen Herangehensweise genug getan zu haben, um damit zu einer garantiert „richtigen“ Entscheidung zu kommen. In Sachen Gründlichkeit stimmen wir dieser Auffassung zu. Doch eine rein rational gewonnene Entscheidung würde eine ganz zentrale Komponente außer Acht lassen: die Person und damit die Persönlichkeit und Individualität von Entscheidungsträger:innen. Natürlich hat jeder Mensch ganz eigene Vorlieben und Abneigungen, genauso wie Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle. Und vielleicht auch eigene Vorstellungen davon, wie man grundsätzlich leben und arbeiten möchte. Wichtig ist es, diese Anteile nicht unberücksichtigt, sondern sie irgendwie systematisch mit in eine Entscheidung einfließen zu lassen. Du hättest dann eine authentische, eigentlich subjektive und individuelle Entscheidungsgrundlage. Das bedeutet, dass andere Personen mit einer anderen Geschichte und Persönlichkeit sich durchaus anders entscheiden würden. Das Buch zeigt dir im zweiten Teil, wie du diese Dinge bei deiner Entscheidung berücksichtigen kannst.
1.2Der EntscheidungsdruckEntscheidungsdruck
Bei all dem, was eine Entscheidung so schwer machen kann, ist eine Sache noch nicht erwähnt worden: der Entscheidungsdruck. Dieser entsteht aus der persönlichen Situation heraus oder weil Bewerbungsformalitäten und Anmeldefristen eingehalten werden müssen. Es wird kein Aufschub geduldet, denn die Zeit schreitet voran und oft beobachtet unser soziales Umfeld jeden einzelnen unserer Schritte mit erwartungsvollen Blicken.
An zweiter Stelle ist ein anderer Entscheidungsdruck zu nennen, der durch Gedanken und Ansprüche entsteht: Ich muss unbedingt ein richtig zu mir passendes Fach finden, das mir einen Job garantiert und mich dann 40 Jahre lang glücklich macht. Für viele kommt dann noch der zweifelnde Gedanke dazu, sich mit einer falschen Entscheidung die gesamte Zukunft zu verbauen. Doch für wie viel Zukunft entscheidest du dich heute eigentlich wirklich? Denn gerade das gestufte Studium ermöglicht eine neue Flexibilität, da dir im Bachelor zunächst erst einmal überwiegend die Grundlagen eines Faches vermittelt werden. Damit kannst du sogar schon in einen Beruf gehen. Der Master ermöglicht es dir dann aber, dieses Basiswissen zu vertiefen oder sogar durch fachfremde Inhalte zu ergänzen. Mit der letzteren Variante würdest du deinem bisherigen Studium auch eine Wende oder neue Akzentuierung ermöglichen. Die Ideen dazu tauchen aber vielleicht erst während des Bachelors auf. Du siehst, dass hättest du nicht alles von vornherein berücksichtigen können. Und doch kann es sich so ergeben, wenn du nämlich in dieser Zeit offen bleibst für neue Ideen und Wege.
Gut zu wissen | Kommt Zeit, kommt Rat
Du musst nicht gleich alles wissen: Die Entscheidung für einen Studiengang ist eine grobe Orientierung. Viele Feinheiten, etwa die genaue Vorstellung von einem späteren Arbeitsplatz, können sich im Laufe des Studiums ergeben. Das musst du jetzt noch nicht alles wissen bzw. in deine Entscheidung einfließen lassen.
An dritter Stelle soll noch eine weitere hemmende, häufig zu findende Einstellung erwähnt werden. Bei dieser will man versuchen, unbedingt alle persönlichen Interessen im Beruf unterzubringen. Das kann und muss zum Glück nicht klappen, denn du bestehst ja nicht nur aus Arbeit. Die anderen Interessen können sich in Hobbys oder sonstigen Beschäftigungen widerspiegeln, denn deine Persönlichkeit setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Da ist das Studium bzw. der Beruf eben nur einer der Bausteine.
1.3Die EntscheidungsstrategienEntscheidungsstrategien
Ob du nun wie in dem vorherigen Abschnitt beschrieben einen solchen Druck empfindest oder zum Glück mit einer gewissen Ruhe und Zuversicht an die Studienwahl herangehst, auch du hast sicher schon überlegt, mit welcher Strategie du diese komplexe Aufgabe bewältigen sollst.
Zunächst ein paar häufig vorkommende, zum Teil grobe und vereinfachte Strategien, die durchaus zum Erfolg führen können:
Entscheidungsstrategie Nr. 1 | Ich weiß genau, was ich werden will.
Wenn du später einmal einen ganz bestimmten Beruf ausüben willst (z. B. Ärzt:in, Lehrer:in, Rechtsanwält:in, Psychotherapeut:in, Chemiker:in), dann brauchst du gar nicht lange überlegen, wie du diesen Plan umsetzt. Das Studium ist wie eine Eintrittskarte und der Weg steht ziemlich genau fest: Ein:e Ärzt:in beispielsweise muss Medizin studiert haben. Jetzt liegt es nur noch an den schwankenden Zugangsvoraussetzungen, ob du für genau diesen Studiengang auch einen Studienplatz bekommen wirst. In diesem Fall würdest du dich daher genau erkundigen, wie du dich wo bewerben musst und ob es an der jeweiligen Hochschule besondere Voraussetzungen gibt, etwa einen bestandenen Mediziner:innentest oder ein einjähriges Praktikum als notwendige EintrittskartePraktikum.
Häufig bedeutet es aber auch folgendes: Die Eintrittskarte sagt nichts über den Kinofilm aus. Das heißt ein theoretisches, wissenschaftliches Studium gibt nicht eindeutig die für eine spätere Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten weiter. Ein Dilemma, in dem sich etwa viele Lehrer:innen wiederfinden, wenn sie ihre Fächer umfangreicher studieren müssen, als sie es später im Unterricht anwenden werden. Und dann kann es motivationsmäßig schwierig werden, wenn du einen Arbeitsplatz, wie die Schule, bereits kennst und du dir nun eine damit nur indirekt zusammenhängende Eintrittskarte erarbeiten musst. Wenn dir dies allerdings bewusst ist, steht dem Studium nichts im Wege.
Entscheidungsstrategie Nr. 2 | Ich will vor allem in eine andere Stadt.
Ein häufiger Grund, sich für ein Studium zu entscheiden, ist die Möglichkeit, damit gleichzeitig den Heimatort zu verlassen. Dabei steht dann nicht so sehr im Vordergrund, was inhaltlich und ausbildungstechnisch passieren soll, denn es spielen stärker persönliche Gründe eine Rolle, beispielsweise eine Loslösung von einer einengenden elterlichen Umgebung. Natürlich ist mit der Entscheidung für den neuen Lebensraum eine wichtige persönliche Grundlage geschaffen. Schließlich setzt du dich damit einer neuen Umgebung aus, die ihren Einfluss auf dich ausüben wird. Was du dann dort studierst, sollte aber trotzdem nicht ganz egal sein, es sei denn, du willst nochmal wechseln können. Achte dann unbedingt darauf, wie die Bedingungen für einen Wechsel aussehen, etwa dann, wenn du BAföGBAföG bekommst. Da darfst du nämlich nicht beliebig wechseln oder du gefährdest diese finanzielle Unterstützung.
Entscheidungsstrategie Nr. 3 | Ich nehme, was ich mit meinem Abiturdurchschnitt bekommen kann.
Diese Vorgehensweise sieht folgendermaßen aus: Man nehme seinen Abiturdurchschnitt und schaue sich die Numerus-clausus-Werte der letzten Bewerbungsrunde einer Hochschule an. Daraus wird nun ganz schlicht abgeleitet, welche Fächer zur Auswahl stehen. Je nach deinem Durchschnitt stehen dann also ganz bestimmte Fächer zur Auswahl, je besser dein Schnitt, umso mehr Fächer werden es sein. Du könntest dich nun entsprechend bewerben und würdest ein Fach mit passendem Numerus clausus mit großer Wahrscheinlichkeit bekommen. Aber du solltest dich fragen, ob diese Fächer, die du bekommen könntest, auch zu dir passen und ob diese Strategie daher eine gute Entscheidungsgrundlage ist. Darüber hinaus liegt dieser Strategie noch eine völlig falsche Vorannahme zugrunde: Die veröffentlichten Numerus-claususNumerus clausus-Werte seien immer gültig. Tatsächlich sind die Numerus-clausus-Werte des letzten Jahres zwar grobe Orientierungsmöglichkeiten und du kannst damit auch versuchen, deine Chancen zu sichten. Die Werte lassen aber keine Aussage darüber zu, wie es sich im diesjährigen Bewerbungsverfahren gestalten wird. Nehmen wir einmal an, die meisten sehr guten Abiturient:innen gingen aus irgendeinem Grund dieses Jahr vermehrt ins Ausland und bewerben sich daher nicht an deutschen Hochschulen. Dann hätten wir eine völlig neue Zusammensetzung der Numerus-clausus-Werte und Bewerber:innen mit einem bisher als unzureichend eingestuften Abiturdurchschnitt hätten auf einmal bessere Chancen auf einen Studienplatz. Da dies aber erst am Ende des Bewerbungsverfahrens einer Hochschule feststeht, wäre es sinnvoller, zunächst ein zu sich passendes Fach zu finden und dann alles daran zu setzen, dafür einen Studienplatz zu bekommen. Da ist dann auch der im Vergleich zum Vorjahr zu erwartende Numerus clausus natürlich wichtig, um die möglichen Chancen abzuwägen.
Entscheidungsstrategie Nr. 4 | Ich mache aus einem guten Leistungskurs ein Studienfach.
Gute Noten in einem Leistungskurs können durchaus bedeuten, dass du dich für dieses Fach interessierst und die Inhalte wahrscheinlich auch deinen Fähigkeiten entsprechen. Viele Schüler:innen unterscheiden sich beispielsweise darin, ob ihnen grundsätzlich die naturwissenschaftlichen Fächer oder doch mehr die Sprachen liegen. Da liegt es nahe, aus dieser Tendenz ein Studienfach abzuleiten. Doch eine wichtige Frage ist, ob es einen Zusammenhang zwischen den Noten in einem Schulfach und dem Studienerfolg in dem entsprechenden Studiengang gibt. Während ein insgesamt guter Abiturdurchschnitt tatsächlich die beste Prognose für ein erfolgreich absolviertes Studium erlaubt, sieht es mit dem Zusammenhang zwischen Schulfach und Studiengang leider ganz anders aus: Tatsächlich kann ein Leistungskurs in der Schule den Start in das entsprechende Studienfach unterstützen, weil wichtige Grundlagen schon vorhanden sein können. Sie müssen dann nicht erst durch einen sogenannten Brückenkurs nachgeholt werden. Da aber eine Hochschule in ihrer Ausbildung vor allem einen theoretisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt hat, sind die Inhalte wegen dieser anderen Herangehensweise gänzlich verschieden zu dem, was du in der Schule kennengelernt hast. Du darfst daher aus deinen Erfahrungen im Leistungskurs (z. B. Deutsch) ein grundsätzliches Interesse ableiten, kannst dies aber nicht automatisch mit einem garantierten Erfolg im ähnlich benannten Studium (hier: Germanistik) gleichsetzen.
Entscheidungsstrategie Nr. 5 | Ich nehme, was am Schluss übrigbleibt: die Negativ-Auslese.
Nehmen wir einmal an, du willst an einem bestimmten Hochschulort leben. Also nimmst du das dortige Studienangebot zur Hand und streichst alles weg, was auf gar keinen Fall für dich in Frage kommt. Irgendetwas wird am Schluss übrigbleiben. Und das nimmst du dann. Was geschieht aber, wenn du vielleicht mehr technisch oder medizinisch interessiert bist, doch an dem Ort nur eine einzige pädagogische Hochschule existiert? Dann könntest du nämlich nur Lehrer:in werden. Diese Strategie ist daher zu simpel, weil sie kaum deine Interessen und Fähigkeiten ausreichend berücksichtigen kann.
Entscheidungsstrategie Nr. 6 | Ich will viel Praxis im Studium.
Vielleicht passt zu dir ja viel besser ein Studium mit starkem Praxisbezug. Diesen findest du stärker an den Hochschulen (ehemals Fachhochschulen) oder ganz direkt im sogenannten Dualen Studium. Die derzeit fast 2.000 dualen Angebote bundesweit – hauptsächlich in technischen Berufen – wechseln akademische Lehre an einer Hochschule mit praktischen Teilen in einem Betrieb ab. Im Jahr 2022 lernten bereits mehr als 138.000 Studierende auf diese Weise. Beachte aber unbedingt die Zugangsvoraussetzungen, die innerhalb der Bundesländer und sogar von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich ausfallen können.
Immer noch hat das seit den 1970er-Jahren existierende duale Modell wie auch die ehemaligen Fachhochschulen mit dem Ruf zu kämpfen, für solche Auszubildenden zu sein, denen das klassische Universitätsstudium zu schwer sei. Fakt ist aber, dass der stärkere Praxisbezug tatsächlich zu besseren Jobaussichten führen kann. Es kommt also vor allem darauf an, zwischen einem eher theoretisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt und der stärkeren Praxis zu entscheiden. Im dritten Teil, dem Service-Teil dieses Buches, findest du eine ausführlichere Beschreibung besonderer Hochschularten und genauere Hinweise zum Dualen Studium.
Entscheidungsstrategie Nr. 7 | Was für andere gut ist, wird auch für mich gut sein.
Bei den Menschen in unserer näheren Umgebung, die uns wichtig sind, bekommen wir ja automatisch mit, was sie tun und wie es ihnen damit geht. Wenn eine Sache gut läuft und wir ein bisschen darüber erfahren haben, dann kann das für uns durchaus attraktiv werden. Das geschieht tagtäglich mit allen möglichen Tipps etwa zu interessanten Reisezielen oder zum Kulturprogramm. Warum dann also nicht auch zum Studium? Da hier noch stärker etwas gilt, was übrigens auch bei den nicht ganz so folgenschweren Reise- und Kulturtipps eine Rolle spielt: Nimm die positiven Erfahrungen der anderen ruhig als Ideengeber, doch prüfe ganz genau, ob diese Option für dich wirklich in Frage kommt. So würde man sich beispielsweise bei einem angeblich tollen Kinofilm erzählen lassen, warum er so sehenswert ist: Du bekommst ein wenig von der Handlung berichtet, vielleicht wird eine schauspielerische Leistung hervorgehoben oder die eingesetzten filmischen Mittel sind interessant genutzt. So kannst du prüfen, ob du den Film auch sehen solltest, weil er dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich gefallen könnte. Genau so kann die beste Freundin zufrieden in ihrem Studium sein oder deine Eltern erfolgreich in ihren Berufen – für dich muss das noch lange nicht gelten. Lass dir daher auch hier näher schildern, was etwa den Studiengang für deine Freundin interessant macht. Und überlege dann genau, ob auch du damit zufrieden sein könntest.
Entscheidungsstrategie Nr. 8 | Ich studiere das Ergebnis eines Onlinetests.
Dies ist mittlerweile eine der häufigsten Strategien, weil du beim Surfen zum Stichwort „Studienwahl“ ziemlich schnell auf zahlreiche Onlinetests stößt. Und wenn ein Test auch noch kostenlos ist – so denken viele –, hat man schließlich nichts zu verlieren. Schließlich kommt nach einer gewissen Mühe am Schluss eine Aussage heraus, die vielleicht so lauten könnte: „Zu den von Ihnen gemachten Aussagen passen die naturwissenschaftlichen Studiengänge Physik und Biophysik.“ Was kann einen da noch abhalten, sich genau dafür zu bewerben? Schließlich wird dir mit dem Nennen konkreter Fächer suggeriert, du hättest eine fundierte Entscheidung getroffen. Doch für Lai:innen ist es häufig nicht nachvollziehbar, wie der Test zu diesem Ergebnis kommt. Damit bleibt auch dessen Aussagekraft uneindeutig. So sind Onlinetests als alleinige Entscheidungsstrategie ungenügend, weil du dich auf ein einziges Ergebnis stützen würdest. Das Buch zeigt dir deshalb, welche Tests sinnvoll sind und was sie bedeuten an genau der Stelle, wo sie während des Suchprozesses hingehören. Deshalb findest du die Onlinetests in → Teil III: Services zur Studienwahl im Abschnitt 1.3 als eine mögliche Infoquelle beschrieben – aber eben nur als eine von mehreren hilfreichen Quellen.
Mit den nächsten Kapiteln näherst du dich dem Ganzen nun auf eine ausführlichere, viele wichtige Aspekte einbeziehende Art und Weise, für die es eine günstige Grundhaltung gibt. Diese möchten wir dir vorab näherbringen.
1.4Eine günstige GrundhaltungGrundhaltung: „gut“ statt „richtig“
Umgangssprachlich benutzen wir im Zusammenhang mit Entscheidungen die Adjektive „richtig“ oder „falsch“. Damit soll eine Bewertung vorgenommen werden und unausgesprochen gehen wir davon aus, dass der Ausgang einer Entscheidung allein von unseren Überlegungen abhängt. Wir müssen eben nur lang genug über eine Sache nachdenken, dann werden wir auch zu einer richtigen Entscheidung kommen. Doch genau das ist leider überhaupt nicht der Fall. Da wir in einem komplexen System leben, in dem andere Menschen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die technischen Möglichkeiten und selbst das Wetter sich unvorhersehbar verhalten können, kann eine Sache doch zu einem unangenehmen Ergebnis führen, die ursprüngliche Entscheidung selbst aber dennoch gut gewesen sein. Wie ist das gemeint? Hast du beispielsweise bei einer Reiseplanung viele Überlegungen angestellt, dass ein Urlaub am Meer gerade besser passt als eine Reise in die Berge und entsprechend gebucht, dann kann die mehr oder weniger zufällige Entwicklung des Wetters dir leider viele Tage Regen bescheren. Natürlich hat dies Einfluss auf deine Urlaubsaktivitäten und auch den Erholungseffekt. Aber nicht automatisch ist die Schlussfolgerung erlaubt: „Wären wir doch besser in die Berge gefahren!“ Wenn du nämlich an deinen Entscheidungsprozess denkst, dann bist du zu dem Ergebnis „Meer“ gekommen, da du viele Argumente gegeneinander abgewogen hast. Was dann tatsächlich geschah, lag nicht mehr allein in deiner Hand und damit ist die Frage berechtigt, wie viel Verantwortung man sich selbst für diese Entwicklung der Dinge zuschreiben darf – auf jeden Fall nicht die gesamte Verantwortung. Vielleicht nimmt dir diese Sicht ja ein wenig von dem Druck, allein der sprichwörtliche Schmied deines Glücks zu sein. Und damit würde sich auch der Anspruch erübrigen, möglichst perfekt an die Entscheidung heranzugehen. Denn Perfektionismus erreichen zu wollen, hat noch niemandem geholfen, weil er nämlich gar nicht zu erreichen ist. Flugzeugabstürze etwa oder die nicht kontrollierbaren Naturkatastrophen demonstrieren uns tagtäglich, dass der Mensch einem Anspruch auf Perfektionismus nicht gerecht werden kann. Und deshalb könntest du dich in Sachen Studienwahl nun einer guten Entscheidung widmen und versuchen, den Anspruch zu begraben, dass es unter allen Umständen die 100 % richtige werden muss. Dabei ist dir dieses Buch behilflich, wenn du mit jeder Seite, die du bearbeitest, eine hohe Gründlichkeit umsetzt. Und du wirst viele wichtige Dinge berücksichtigen. Doch den Zufall und andere Überraschungen kannst du natürlich nicht einplanen.
2Einflussfaktoren der StudienwahlStudienwahlEinflussfaktoren
Studienwahl kann wie der Kauf eines neuen Computers sein: Die Vielfalt des Angebots erschlägt eine:n fast und steht jemand unter Zeitdruck, würde sie/er am liebsten das erstbeste nehmen. Wenn viel Auswahl überfordert und uns eher orientierungslos macht, dann muss das vielfältige Angebot unbedingt reduziert werden. Tatsächlich sind nicht alle PC-Zubehör-Teile und möglichen Programme für dich gedacht. Dafür ist es notwendig, die persönliche Situation zu analysieren, aus der sich quasi eigene Wünsche an den PC ableiten lassen. Wer vorher also eine Liste mit den Dingen macht, die der PC haben bzw. können soll, findet leichter ein konkretes Geschäft und dort das passende Gerät. Im Computer-Beispiel sähe das in etwa so aus: Was habe ich mit dem PC alles vor? Brauche ich ihn nur zuhause oder muss ich mobil damit sein? Was ist in der Grundausstattung vorhanden und was brauche ich zusätzlich? Muss er besonders schnell sein oder vor allem viel Speicherplatz haben? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Du siehst, wie aus solchen Eckdaten der Einkauf sich konkretisieren kann. Vergleichbare Überlegungen wirst du mit diesem Buch hinsichtlich deiner Studienwahl anstellen.
Doch grundsätzlich gilt: Je mehr du überlegst und aktiv suchst, je mehr Informationen du einholst und je häufiger du mit anderen über deine Studienwahl sprichst, umso mehr Einflüssen bist du natürlich ausgesetzt. Das ist keineswegs verkehrt. Du kannst dadurch viel Neues und Wichtiges erfahren, kritische Anmerkungen prüfen und die eigenen Gedanken sortieren. Entscheidend ist jedoch vielmehr, wie du mit diesen Einflüssen umgehst: Tragen sie zu deiner Entscheidungsfindung bei oder verwirren sie hauptsächlich? Kann eine Information als seriös eingestuft werden oder handelt es sich nur um Hörensagen? Mit welchen Personen sind die Gespräche angenehm und unterstützend und mit welchen sind sie eher wenig hilfreich? Zu solchen Fragen erfährst du alles Notwendige in diesem Kapitel und dem zweiten Teil des Buches.