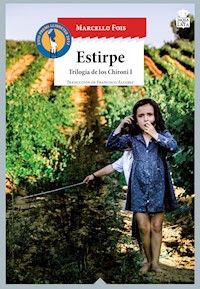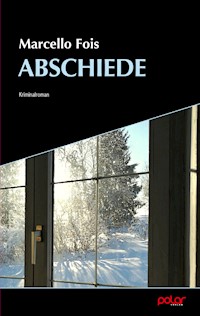
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Kommissar Striggio an den Fall des kleinen Michele gerät, der auf einem Rastplatz spurlos aus dem Auto der Eltern verschwunden ist, durchlebt er privat eine schwierige Phase. Leo, seine Liebe, will, dass er endlich aufhört, ihre Beziehung zu verheimlichen, vor allem gegenüber seinem Vater. Und der ist gerade mit dem Zug von Bologna auf dem Weg zu ihm, mit einer bestürzenden Nachricht im Gepäck. Das Verschwinden Micheles einem ganz "speziellen" Jungen erweist sich als Sprengsatz, der schließlich alles zum Explodieren bringt. Liebe und Hass wieder ausbrechen lässt. Bruchstücke der Vergangenheit an die Oberfläche schleudert. Der neue Roman von Marcello Fois ist ein Noir, weißglühend und von höchster Spannung. Ständig splitternd, durchbrochen vom Leben. Eltern, Kinder, Geschwister, Kollegen und Geliebte: Alle haben Teil an einem Ge- heimnis, das wohl behütet ist, seine Lösung verbirgt, bis zu den Schlussakkorden, wenn Fois die Karten auf den Tisch legt und wieder einmal seine großartige universelle erzählerische Begabung unter Beweis stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DARK PLACES
Marcello Fois
Abschiede
Aus dem Italienischen von Monika LustigHerausgegeben von Jürgen Ruckh
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlages ist daher ausgeschlossen.
Originaltitel: Del dirsi addio. Marcello Fois
Copyright: 2017 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
Prima edizione „Supercoralli“ www.einaudi.it
First published: Einaudi
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2020
Aus dem Italienischen von Monika Lustig
Mit einem Nachwort von Monika Lustig
© 2020 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Michael v. Killisch-Horn
Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann
Coverfoto © ermess / Adobe Stock
Autorenfoto: © daniela zedda
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland
ISBN: 978-3-945133-97-2eISBN: 978-3-945133-98-9
Menschen gibt es, die um eines vermeintlichenParadieses willen aus der Erde eine Hölle machen:
Dieser Roman ist all den anderen gewidmet.
Inhalt
… Vor allem anderen
ERDE
1468
FEUER
1453
WASSER
Ludovico III. Gonzaga
LUFT
Danksagungen
Quellenangaben
Vom Verschwinden der Kinder
… Vor allem anderen
Als sie Gea mitteilten, dass ihr Vater gestorben war, wohnte sie schon seit einigen Tagen bei den Ludovisis. Das Gericht hatte verfügt, dass sie die Ludovisis von jetzt an ihre Familie nennen musste.
Sicher ließ sich nicht behaupten, dass dieser Tod sie nichts anginge. Immerhin handelte es sich um ihren Vater und um den Mann, der ihrem Bruder Lilo Böses angetan hatte.
Jahre später, als sie zur Frau geworden war, las sie irgendwo, dass Oreste Bomoll sich bis zu seinem Tod für unschuldig erklärt hatte. Und dass die Formulierung er war gestorben durch die zutreffendere er hat sich das Leben genommen zu ersetzen war. Das mochte wie eine sprachliche Spitzfindigkeit klingen, brachte aber in jeder Hinsicht einen wesentlichen Unterschied zum Ausdruck. Zumindest in den Augen von Gea. Wie immer die Dinge auch gelaufen sein mochten, sie wusste sehr gut, was sie gesehen hatte. Und dem Polizeibeamten, der sie befragte, hatte sie nichts verheimlicht, genau wie die Tante es ihr aufgetragen hatte. Denn die Tante hing sehr an ihr und an Lilo.
Es war ein Nachmittag mitten im Herbst. Die Familie, der sie anvertraut worden war, lebte weit entfernt von dem Ort, an dem sie geboren worden war. Von den Fenstern des neuen Hauses ging der Blick auf Felswände und zu einem Streifen reinweißen Himmels. Die Ludovisis waren anständige Leute und hatten sie mit der größtmöglichen Herzlichkeit aufgenommen. Und sie hatte dem eine gewisse Passivität entgegengesetzt. Sie hatte sich trösten, ernähren, kleiden, kämmen lassen und alles Übrige. Sie hatte zugelassen, dass sie mit ihr all das machten, was eine Familie mit den eigenen Kindern machen muss. Als sie ihr an diesem Nachmittag mitteilten, dass ihr Vater gestorben war, nahm sie die Nachricht daher wie eine weitere bislang in der Schwebe hängende Angelegenheit auf, die endlich ad acta gelegt werden konnte: Lilo, ihr Zwillingsbruder, war verschwunden; die Tante war abgereist; der Vater war gestorben.
Signora Ludovisi traute sich nicht, sie zu streicheln, wenngleich sie dachte, dass in dem Moment eine liebevolle Geste sicherlich angebracht wäre. Und Gea verhielt sich so distanziert, dass jegliche Berührung von vornherein unmöglich war.
Noch am selben Abend jedoch, in dem eigens für sie hergerichteten Zimmer, zeigte sie Nicola, dem Sohn der Ludovisis, wie man sich umarmt.
»Dein Vater ist gestorben. Vor drei Monaten, als du im Heim warst«, sagte Signora Ludovisi gedehnt, mit einer Spur von Bedauern, weil ihr keine weniger unverhüllte Formulierung eingefallen war.
Einige Minuten zuvor hatten sie noch davon gesprochen, dass der echte Winter vor der Tür stehe, es schneien werde, man sich gut einpacken müsse, wenn man das Haus verlässt, und dass bald wieder die Heiße-Schokoladen-Zeit anbrechen werde. Und dann, ganz unvermittelt, hatte Signora Ludovisi gesagt: »Gea, da ist etwas, das ich dir sagen muss.« Und die Veränderung in ihrem Ton hatte dem jähen Vorbeirauschen der Wolken geglichen, das einen sonnigen Vormittag in einen grautristen Nachmittag verwandelt. »Setzen wir uns doch einen Moment«, hatte sie gesagt, war ihr zum Sofa vorausgeeilt und hatte mit der flachen Hand auf den leeren Platz neben sich geschlagen. Gea war ihr gefolgt, aber anstatt sich auf den ihr zugewiesenen Platz zu setzen, hatte sie den Sessel gegenüber gewählt. »Dein Vater ist gestorben, vor drei Monaten, als du im Heim warst«, sagte Signora Ludovisi mit Nachdruck. »Sie wollten abwarten, bis du eine Pflegefamilie hättest, bevor sie es dir mitteilten. Jetzt hast du uns.« Dann deutete sie eine liebevolle Geste an, merkte aber, dass das Mädchen zu weit weg war und ihre Geste am Ende plump wirken würde, also ließ sie davon ab.
Gea sah sie an. Dann blickte sie um sich. Sie hörte Nicola mit seinen Freunden im Hof Fußball spielen und sah, dass sich der Fetzen Himmel über den Bergkämmen kobaltblau gefärbt hatte. »Eine heiße Schokolade wäre mir jetzt doch willkommen«, sagte sie.
ERDE
Ich schwöre, die Erde wird sicher vollkommen sein für ihn oder sie, die vollkommen sind.
Die Erde bleibt Stückwerk und brüchig für ihn oder sie allein, die Stückwerk und brüchig bleiben.
Walt Whitman Grashalme,übersetzt von Hans Reisiger, Zürich 1985
Vor Jahrtausenden trug Gea den Namen Chtonie. Und lebte unter der Erde. Sie war ein Albino und ein schwieriges, unzugängliches Wesen, genau wie man sich Höhlenbewohner vorstellt, die noch nie das Sonnenlicht erblickt haben. Zeus war es, der sie aus den Tiefen hervorzog, in denen sie hauste. Was der Grund war, der den Gott der Götter dazu bewegt hatte, bleibt ein Rätsel. Chtonie war keine Schönheit: Sie war fett und weiß wie eine jener Larven, auf die die australischen Ureinwohner ganz versessen sind. Sie war halb blind und hatte einen fürchterlichen Charakter. Aber Zeus liebte die Herausforderungen. Und diese war mit Abstand die schwierigste. Zuallererst galt es, sie aufzuspüren, denn sie versteckte sich in den unzugänglichsten Klüften oder in den Tiefen der Höhlengänge am Meeresgrund. Wiederholt hatte Zeus versucht, sie hervorzulocken, war mit seiner Blitzhand, unter der sich die Erdkruste wie Gelatine teilte, längskantig in die Tiefe eingedrungen. Dann war er damit wie wild in allen Richtungen herumgefahren, ohne zu begreifen, was oder wen er da jeweils erwischt hatte. Es brauchte rund zweihundert Menschenjahre – was ungefähr zehn Minuten Götterzeit gleichkommt – und so manchen Misserfolg, bis er schließlich am Ziel war. Nach beharrlichem Suchen hielt Zeus bald schon den schlaffen Leib von Chtonie in der Hand. Er jubelte und achtete sorgsam darauf, die Faust nicht zu schließen, damit sie in den Windungen seiner glühenden Finger nicht erstickte.
Aus den Eingeweiden der Erde gehoben, schaute Chtonie sich um. Was sie sah, behagte ihr zwar nicht besonders, aber es missfiel ihr auch nicht. In der Hand des Gottes hatte sie ihre Blässe verloren, war dunkler geworden und zog eine finstere Miene. Womöglich hatte sie immer schon finster dreingeblickt, auch zuvor, als sie noch in den Eingeweiden der Erde gelebt hatte. Zeus jedenfalls fand, dass sie in dieser dunklen Version ganz und gar nicht übel sei. Nun gab es viel zu tun. Für den Anfang würde er es halten wie Rex Harrison in My fair Lady, wenn er die noch ungeschliffene Audrey Hepburn den Satz: »Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn« endlos wiederholen lässt.
In diesem lasterhaften Gott der Götter steckte eine gewisse Leidenschaft für die missions impossible: In Schwanengestalt, in Form von goldenem Regen, als Hengst, als weißer Stier und so fort hatte er geliebt. Einmal hatte er, nur um Alkmene zu verführen, wohl oder übel die Gestalt ihres Ehemanns Amphitryon annehmen müssen. Er hatte ein beachtliches Curriculum vorzuweisen, denn er war jemand, dem die Vorstellung, etwas nicht tun zu können, absolut zuwider war. Und genau diesen Charakterzug hat er dann Milliarden Menschenwesen verliehen.
Wie auch immer, aus dem Erdenuterus gehoben, verlor Chtonie ihre Blässe. Und sie wurde sehend. Und was sie sah, war ein wirres Gemisch aus fester, flüssiger, gasförmiger Materie. Das Himmelsgewölbe war in ihren Augen nicht vertraueneinflößend genug, um sich unter ihm sicher zu fühlen, zumal die Erde auf diese Weise Winden aller Art ausgesetzt war.
In Zeus’ riesiger Hand fühlte sie sich aufgehoben wie Jessica Lange, wenn sie von King Kong gepackt wird. Und sie blickte um sich, mit wachsendem Misstrauen. Gewiss nicht resigniert, denn im Stillen dachte sie, sobald die Gelegenheit käme, würde sie in sichere Gefilde zurückkehren, wo keine Winde bliesen und die Gewölbe aus festem Gestein, nicht aus Luft waren. Zurück an ihrem sicheren Ort, wo das Getier blind und die Gewitter der Oberfläche nichts weiter als kristalline Rinnsale waren, gefiltert von vielen Schichten Erde und Gestein. Aber sie hatte die Hartnäckigkeit desjenigen unterschätzt, der sie ans Tageslicht geholt hatte. Sie hatte nicht mit den zauberhaften Verführungen der oberirdischen Welt – die wahrhaft abgründig waren – gerechnet. Als Erstes war da der Duft, denn man konnte nicht gerade behaupten, dass dort unten, wo sie herkam, wer weiß was für ein Wohlgeruch herrschte. Trotzdem war die Grotte wunderbar sicher, auch wenn sie nach Fauligem roch, nach Vogelmist und Salz. Das fiel Chtonie erst auf, als sie die herrlich angenehmen Düfte schnuppern durfte, die aus der Öffnung des Himmels kamen. Heute würde ihr, wenn der Wind günstig stand, der Gestank des Eco Centers am Lungo Isarco Destro um die Nase wehen. Und Zeus nickte zufrieden, denn diese Kreatur, auf die er einige Minuten seiner Zeit verwendet hatte, was Jahrhunderten der Menschenzeit gleichkam, erwies sich als unglaublich begabt und von rascher Auffassungsgabe.
Gleich nach dem Duft kam die Temperatur, die, noch weit davon entfernt, eine Obsession der Menschen zu werden, ein Gefühl der Teilhabe war: Bei Kälte verdickt sich die Haut, bei Hitze wird sie dünn und transpiriert. In der Pranke von Zeus schwitzte Chtonie, und jetzt, der freien Luft ausgesetzt, zitterte sie und bekam eine Gänsehaut. In den Tiefen, aus denen man sie geraubt hatte, gab es weder Warm noch Kalt. Dort herrschte eine einzige, gleichmäßige, vorhersehbare Temperatur.
Dann waren da die Tränen, salziges Wasser, das direkt aus den Augen drang. Chtonie wusste nicht einmal, was dieses seltsame Phänomen war, das sie Wasser, das Meereswasser zu sein schien, verlieren ließ. Sie spürte bloß, wie es ihr über die Wangen rann, und wusste nicht, was sie machen sollte. Der Donnergott sprach zu ihr, um sie zu beruhigen, und gab den Dingen einen Namen: Duft, Temperatur, Tränen. Und dann blickte er jenem Geschöpf in die Augen und sagte, dass auch sie wie alle belebten und unbelebten Dinge an der Oberfläche einen Namen brauchte, und dieser Name sei Gea. Darauf bewegte er wie der Riese in dem Film Jack and the Beanstalk seine riesige Hand wie einen Kipplaster, setzte sie behutsam auf der Erde ab und befahl ihr zu gehen. Und so entdeckte Chtonie, dass es außer der Härte des Gesteins, das sie stets unter ihren Füßen gespürt hatte, auch die wundervolle Weichheit der Wiesen gab. Dass außer der Sprödheit ihres unterirdischen Namens auch die Weichheit ihres irdischen Namens existierte. Chtonie, inzwischen endgültig Gea, blickte verloren, aber voller Erregung um sich. Und erstmals wandte sie sich direkt an Zeus und sagte, dass sie wirklich nicht begreife, wie man so unglücklich und zur selben Zeit so glücklich sein könne. Es braucht seine Zeit, aber du wirst es schon noch verstehen, dachte Zeus, der nie laut sprach, sondern dachte. Und nachdenkend, immer wieder dieselben Gedanken wälzend und grübelnd, gab er, ohne den Mund aufzumachen, Antworten, die dennoch alle um ihn herum hörten.
Genau wie es Nicola Ludovisi widerfuhr, der zusammen mit der Familie – seiner Ehefrau Gea, dem Sohn Michele – schweigsam am Tisch Nummer sieben in der Antica Trattoria Olimpo in Sanzeno saß.
»›Einige Jahrtausende‹, wie viele?«, fragte Gea mehr überrascht als erheitert den Sohn.
»Sagen wir, vier oder fünf«, hatte Michele geschwind nachgerechnet. »Wenn man bedenkt, dass die mykenische Zivilisation rund 1600 vor Christi zu verorten ist …«
»Bist du sicher, dass du erst elf Jahre alt bist?«, fragte Gea den Sohn. »Kannst du dir so etwas vorstellen?«, fügte sie an Nicola gewandt hinzu. Ihr Tonfall, ihr ganzes Getue war eine Mischung aus Aufrichtigkeit und Verlogenheit, als wäre sie im Gegensatz zu dem, was sie glauben machen wollte, über dieses kleine Genie hochzufrieden. »Ich denke, du solltest deine Kindheit leben, das meine ich«, sagte sie, wieder an den Sohn gerichtet. »Nicola, sag du es ihm auch …«
Nicola schien abgelenkt von den hässlichen Druckgraphiken an der Wand hinter Gea. Höchstwahrscheinlich hatten sie etwas mit dem Namen des Lokals zu tun. Denn dort ging es um Zeus und seine Verwandlungen: Auf dem ersten sah man ihn in Gestalt eines tänzelnden Hengstes, der die Göttin Dia umgarnt; auf dem zweiten als prächtigen Schwan, der sich nach Leda verzehrt; auf dem dritten als gekrönten Stier, der Europa auf dem Rücken trägt; auf dem vierten ist er herabtropfender goldener Regen, den Danaë zwischen ihren Schenkeln empfängt; auf dem fünften steht da ein bärtiger Mann, hinter ihm ein Bett, und auf dem liegt eine spärlich gekleidete Frau, und nicht weit entfernt befindet sich eine Büste mit dem vollkommenen Ebenbild des stehenden Mannes …
»Nicola?«, ließ Gea nicht locker, »weilst du unter uns?«
Nicola machte ein entsprechendes Zeichen. »Das da versteht man wirklich nicht«, sagte er und deutete auf den letzten der fünf Drucke.
»Amphitryon«, klärte Michele ihn prompt auf. Wie er es auch in der Klasse getan hätte, sehr zum Ärger seiner Mitschüler, bei denen er verhasst war, weil er immer alles wusste.
Bei Schuljahresbeginn, einige Monaten zuvor, war Gea von der Klassenlehrerin einbestellt worden, die etwas von Asperger-Syndrom gefaselt hatte. Und Gea hatte sich, obwohl sie selbst häufiger an so etwas gedacht hatte, gesagt, dass sie jetzt das Gegenteil glauben machen musste.
»Ach«, meinte Nicola zerstreut.
»Jetzt ist es aber genug«, sagte Gea plötzlich.
»Genug, mit was denn?«, entgegnete der Ehemann und breitete die Handflächen auf der Tischplatte aus, als hätte er das dringende Bedürfnis, einen sicheren Kontakt zu etwas herzustellen.
»Du hast den ganzen Abend kein einziges Wort gesagt.« Und damit verriet sie sich, denn jetzt war klar, dass sie ihn über ihrem lockeren Geplauder keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte; und zwar mithilfe ihres dritten Auges, wie Nicola es nannte, mit dem sie ihren Kontrollzwang über alles und jeden ausübte.
Nicola hätte gerne alles gestanden, was ihn seit dem Nachmittag in Unruhe versetzt hatte.
»Hat es etwas mit deiner Arbeit zu tun?«, bedrängte Gea ihn. Endlich zeigte sie eine klare Linie. Nicola deutete ein Nein an. »Was sonst?« Und dann wartete sie, den Mund so komisch verzogen, wie man es macht, wenn man Kindern Luftküsse zuwirft. »Mir fehlen die Worte«, gab sie sich schließlich geschlagen, nachdem sie vergeblich auf ein Lebenszeichen des Ehemannes gewartet hatte.
Manche meinen, dass Worte wie Omen sind. Wie Schlüssel, mit denen sich die Türen zu dunklen Räumen öffnen lassen. Zu solchen, die über Jahre fest verschlossen bleiben und am Ende in Vergessenheit geraten. Vielleicht ist es das, was den Männern und Frauen dieser Erde widerfährt: Sie wohnen in Häusern mit verschlossenen Zimmern, in denen möglicherweise Schätze verborgen sind, aber auch, passenderweise, unsagbare Geheimnisse.
Aufgrund dieses knappen Wortwechsels war Michele über längere Zeit still gewesen. Gea bemerkte es und sah ihn überrascht an.
»Amphitryon«, sagte er, als hätte ihr Blick ihn wieder wach gemacht. »Zeus gibt vor, Amphitryon, der Ehemann von Alkmene, zu sein. Also betrügt sie ihren Ehemann, ohne am Ende zu wissen, dass sie ihn betrogen hat.«
Jetzt schienen die Dinge Geas Ansicht nach für einige Momente wieder im Lot zu sein. »Und dieses seltsame Tier da unten, was ist das?«, fragte sie ohne echtes Interesse, auf eine Stelle des Bildes neben dem Schriftzug deutend. Ohne die Antwort abzuwarten, wandte sie sich wieder dem Ehemann zu: »Um Himmels willen, was ist denn bloß?«, fragte sie ihn eindringlich.
»Das ist der Teumessische Fuchs«, verkündete Michele stattdessen. »Ein Tier, das unmöglich einzufangen ist.«
»Nicola.« In ihrem klagenden Ton lag jetzt so etwas wie ein Versprechen.
»Amphitryon beabsichtigt, den Fuchs von Kephalos einfangen zu lassen, aber in Wirklichkeit ist es Zeus, der ihn fängt. Dann verwandelt dieser sich in Amphitryon, nicht in Kephalos, und verführt dessen Frau«, sagte Michele ins Leere hinein.
»Womöglich hat sie den Unterschied nicht einmal bemerkt.« Zum ersten Mal hatte Nicola etwas zur Unterhaltung beigetragen.
Gea verzog das Gesicht, wie jedes Mal, wenn sie eine rasche Zusammenfassung der vorherigen Episoden geben wollte …
Das Abendessen war in gereizter Atmosphäre verlaufen, Michele hatte wie besessen über alles geredet, bis Nicola, der die ganze Zeit auf einen Punkt im Raum gestarrt hatte, plötzlich mit der Hand in seine Richtung gefuchtelt, als wollte er ihn schlagen, ohne es aber tatsächlich zu tun. »Schaffst du es eigentlich, auch mal den Mund zu halten!«, hatte er in einem Ton gezischelt, der furchteinflößender war als jeder Hieb. Michele war erstarrt und hatte die Augen aufgerissen mit jenem theatralischen Gebaren, das den Reaktionen besonders phantasiebegabter Kinder eigen ist.
In anderen Phasen ihres Lebens hätte Gea aggressiv auf das Verhalten ihres Gatten gegenüber dem gemeinsamen Sprössling reagiert, diesmal nicht. Besser gesagt, eigentlich wollte sie reagieren, ließ es dann aber sein; in ihrem Blick lag die vollkommene Schicksalsergebenheit eines Menschen, der nun eine entschieden andere Richtung einschlägt – nicht mehr die, die ihn stets in eine Sackgasse geführt hat.
Nicola spürte diesen unterschwelligen Stimmungswechsel, ohne sich bewusst zu sein, was er konkret mit sich brachte. Das erhabene Schweigen, in dem sie nach Begleichung der Rechnung zum Parkplatz gingen, verschaffte ihm die Illusion, als Sieger aus diesem Stellungskrieg hervorgegangen zu sein.
Und aus diesem Grund fühlte er sich dann, vor dem Wagen angekommen, seiner selbst so sicher, dass er sogar ein Versprechen gab:
»Wir reden zu Hause darüber«, sagte er.
Gea sah ihn skeptisch an: »Ich fahre«, erwiderte sie und streckte die Hand nach dem Schlüssel aus.
Im Wagen beschränkten sie sich darauf, ihrer Unruhe gegenseitig Nahrung zu geben, indem sie gewisse Schweigephasen bis zum Geht-nicht-mehr ausdehnten oder sie mit Allerwelts-Phrasen verwässerten.
Stumm fuhren sie etwa zwanzig Minuten in Richtung Bozen. Michele, in der Mitte der Rückbank, schien eingeschlafen zu sein. »Wird Baffo sterben?«, fragte er plötzlich wie aus dem Nichts. »Die Tierärztin hat gesagt, er wird sterben.«
»Hier stirbt keiner! Cristina hat nichts dergleichen gesagt.« Gea nannte die Tierärztin beim Vornamen, sie kannten sich seit der Mittelschule, waren in dieselbe Klasse gegangen; doch bereits in der Oberstufe hatten sich ihre Wege wieder getrennt.
Nicola holte ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche seiner Daunenjacke, zog eine heraus und steckte sie sich zwischen die Lippen.
»Du weißt, dass im Auto nicht geraucht wird. Wir waren uns doch einig, oder nicht?«, fuhr Gea ihn an, als gäbe es, außer aggressiv zu sein, keine andere Art, sich an den Ehemann zu wenden. Das waren Momente, in denen sie die Zivilisation nur als lästig empfand. Das Lenkrad mit aller Gewalt umklammernd, als wäre es der Gegenstand, der sie davon abhielt, dem Unmenschen an ihrer Seite einen Kinnhaken zu verpassen, beugte sie sich zur Windschutzscheibe vor, die leicht beschlug. Inzwischen waren es bis Bozen nur noch knapp zehn Kilometer.
»Du warst einverstanden«, sagte er provozierend. »Außerdem, ich habe sie ja gar nicht angezündet, oder?« Und er sah sie an, als wäre der springende Punkt für ein Gleichgewicht zwischen ihnen genau der, dass er jeden Moment entscheiden konnte, sich die scheiß Zigarette anzuzünden, oder sie nicht angezündet im Mundwinkel zu halten, wie ein Versprechen oder eine Drohung.
»Mistkerl«, kommentierte sie, aber nicht verhalten genug, denn er tat so, als würde er einen langen Zug aus der nicht brennenden Zigarette nehmen.
»Hab ich mir wenigstens eine Antwort verdient?« Eines musste man Gea lassen: So leicht gab sie sich nicht geschlagen.
»Zu Hause«, nuschelte er prompt, was sie einigermaßen aus dem Konzept brachte.
»Zankt ihr euch etwa?«, fragte Michele just in dem Moment, als ihre Diskussion beendet schien. Er hatte längst begriffen, dass seine Eltern ihre besondere Art zu schweigen hatten, die echten Streit bedeutete.
»Müsst ihr euch jetzt scheiden lassen?«, fragte er.
Nicola war sichtlich verärgert und sagte in scharfem Ton: »Was hast du eigentlich zu melden? Warst du nicht eingeschlafen?«
Gea schaltete einen Gang zurück, um die Kurve zu nehmen und den Motor des Geländewagens nicht zu überhitzen. Am Steuer zu sitzen half ihr, sich einzubilden, die dicke Luft nicht zu spüren, die sich schon mit Messern schneiden ließ. »Hier lässt sich niemand scheiden«, versicherte sie, wobei ihr Blick im Rückspiegel den von Michele kreuzte, und ihre Worte klangen geschwollen und übertrieben beschwichtigend. »Du bist nicht angeschnallt«, sagte sie, ohne sich umzudrehen.
»Hast du jetzt auch Augen am Hinterkopf?«, sagte Nicola.
»Genau, wusstest du das nicht? Ich bin eine Mama mit der Option Rückwärtsblick. »Gurte dich jetzt, Michele.«
»Was ist denn das für ein Wort – sich gurten?«, fragte Nicola, ohne dass er es schaffte, belustigt zu klingen, so sehr er sich auch anstrengte.
»Ein beliebiges Wort«, erwiderte Michele.
»Das es nicht gibt«, sagte Nicola. Geas Blick klebte förmlich an dem Lichtstreifen, den der Wagen in die Dunkelheit warf. »Du erfindest Wörter?« stellte er mit einem schwachen Lächeln fest.
Seine Bemerkung, vielmehr dieser bestimmte Ton irritierte sie. Seit Jahren schon kannte sie seine Art, den Dingen ihre Bedeutung abzusprechen. Dieses wie nebenbei all das Hervorkehren, was in seinen Augen Unzulänglichkeiten waren. Bei einer heftigen Diskussion hatte er ihr einmal geschworen, er werde sie auf all die Dinge hinweisen, die sie tat, während sie zugleich behauptete, sie würde sie nicht tun. Eines davon war: Wörter zu erfinden. Weil Gea doch immer verkündete, die Sprache sei so wichtig, die Wörter seien so wichtig. Und nun hatte er sie dabei ertappt, wie sie Neologismen schmiedete, die nicht einmal besonders gelungen klangen. »Überprüfe, ob dein Sicherheitsgurt korrekt geschlossen ist«, sagte Gea schließlich mit Nachdruck, als würde sie jeden Buchstaben einzeln wieder hinunterschlucken. »Ich muss mal«, fügte sie noch hinzu.
»Was musst du?«, fragte Nicola.
»Was soll die Frage?« Tatsächlich konnte Gea jetzt einen aggressiven Unterton nicht unterdrücken. Der aber war ein Überbleibsel ihrer Verärgerung von zuvor.
Nicola fühlte sich überrumpelt, doch er brauchte nur einen kurzen Moment, um Kontra zu geben:
»Was sollen deine Fragen überhaupt?«
»Jetzt krieg dich wieder ein!«, blaffte sie ihn an.
»Streitet ihr euch jetzt?«
»Scheiße!«, zischte Nicola.
»Das hab ich gehört«, verkündete sein Sohn. »Du hast ein unanständiges Wort gesagt.«
»Bravo«, sagte Nicola voller Ironie. Täte sich doch die Erde unter uns auf, dachte er und schloss die Augen. Genau jetzt müsste die Erde aufbrechen und uns verschlingen. Und sie müsste diesen Scheißort mit sich in die Tiefe reißen. »Hast du denn dein Videospiel nicht mit?«, sagte er stattdessen.
»Die Mama will nicht, dass ich im Auto damit spiele, und auch nicht bei Tisch. Ich muss auch mal.«
»Wir sind bald zu Hause«, entgegnete Nicola unwirsch.
»Dein Benehmen im Restaurant hat mir überhaupt nicht gefallen«, fuhr Gea fort und bog auf einen Rastplatz ab, damit für ihn klar wäre, dass sie in keinem Punkt nachgegeben hatte.
»Dir passt all das nicht, bei dem du nicht Recht hast, Gea«, sagte er, um sie zu provozieren, ohne es aber zu übertreiben; es genügte ihm, die Zigarette zwischen den Lippen zu drehen. »Was machst du?«
»Ich halte an, wir müssen beide mal.« Gea umklammerte das Lenkrad immer noch so fest, dass ihre Fingerknöchel schneeweiß wurden. »Ist dir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit nie Recht habe?«
»Mama…«, begann Michele.
»Was gibt es denn«?, brüllte sie genervt.
»Ich muss jetzt ganz arg.«
»Ich hab verstanden.« Gea bremste scharf.
Ohne sich um seinen Sohn zu kümmern, riss Nicola die Wagentür auf und stieg aus. Er drang ins Unterholz vor und zündete sich als Erstes die Zigarette an: Das war sein dringendes Bedürfnis. Dann vernahm er das Geraschel, das Michele und Gea zwischen den Rhododendronbüschen verursachten. In der mondlosen Finsternis wirkte die scharfgezackte, eisige Landschaft wie zu Glas erstarrt. Alle sagten, dass es bis jetzt nur wenig geschneit hätte, doch der Schnee bald überreichlich fallen werde. Der Himmel künde das mit diesem besonderen kompakten Grauton an, versicherten sie. Nicht weit entfernt formte der Lichtkegel der Autoscheinwerfer eine poröse Fläche, einen Asphaltstreifen aus schwarzem Tüll und an dessen Rändern die abgeschrägten Keilformen der Zwergtannen. Nicola ging zum Wagen zurück und überlegte, dass er sich nicht einmal hatte verstellen müssen: Diese Zigarette war die wichtigste des Tages.
Genau in dem Moment zeigte sich der Fuchs.
Zwei, drei Meter vor ihm, wie erschaffen von dem milchdünnen Nebel, war er aufgetaucht. Der Fuchs wartete, bis er ihn ansah. Und kaum hatte er von der gerade ausgetretenen Zigarettenkippe aufgeschaut, hatte er ihn auch schon im Blick. Im Innern dieser Nacht ertönten die Rufe der Nachtvögel, er konnte jeden einzelnen erkennen: den der Zwergohreulen, der Käuzchen, der Schleiereulen, der Waldohreulen, der Uhus … Und das Knirschen der mahlenden Kiefer der Hirsche, die in regelmäßigen Abständen Rinde von den Baumstämmen rissen … Und die verstohlenen Schritte der Schmuggler und der Flüchtlinge …
Das erzählte der Fuchs. Das zeigte er.
Und er zeigte, dass da ein Riss war, der sich von den Grenzen zum Nichts bis hin zu Nicolas Füßen auftat und so scharf gezogen, so real war, dass er gezwungen war, einen Satz zurück zu machen, um nicht hineinzufallen. Dann begannen die Scheinwerfer des Wagens zu zittern und erloschen. Das Licht kollabierte mit einem Schlag. Aus dem Nichts hörte er Geas Stimme, sie rief …
»Leo?«
»Ich bin hier.«
»Wo, hier?«, fragte Sergio und reckte den Hals weit über die Bettkante hinaus.
»Auf dem Boden«, erwiderte der andere. »Mein Rücken«, sagte er zur Erklärung.
Sergio ließ sich zu ihm nach unten gleiten. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst deinen Rücken untersuchen lassen?«
Leo presste die Lider zusammen. »Es ist gleich vorüber. Ich brauch nur eine Weile so ausgestreckt dazuliegen. Es geht vorbei, es geht vorbei …«, versicherte er mit schmerzverzerrtem Gesicht.
»Dreh dich um«, sagte Sergio gebieterisch und fasste ihn an der Hüfte.
»Aua,« jammerte Leo.
»Dreh dich um, hab ich gesagt!« Doch er wartete nicht ab, dass er das tat, er zerrte an ihm, bis er ihn mit dem Bauch nach unten, den Rücken in voller Breite in Position gebracht hatte.
Er musste Leos Jammern ignorieren, bevor er ihm die Daumen genau in die Mitte seiner wundervollen Lendenkurve presste. »Warum nur bist du so verdammt schön?«, fragte er, während er ihn mit kräftigem Druck massierte.
»Du tust mir weh«, sagte Leo, aber nicht glaubhaft genug. Das Licht streifte ihn in malerischer Vollendung, wie es gewissen Körpern widerfährt, die besonders reich von Mutter Natur gesegnet sind.
»Entspann dich«, wies Sergio ihn an, mit dem gleichen Mangel an Überzeugung. Leo hielt den Kopf zwischen den gekreuzten Armen nach unten. »Geht’s jetzt besser?«, fragte Sergio im Ton desjenigen, der weiß, was er tut.
In der Tat hatte dieser Ton zwischen ihnen eine genaue Funktion, nämlich ihren Altersunterschied hervorzuheben. Siebeneinhalb Jahre. Für Sergio war das ein heikler Punkt, und am Ende war er es auch für Leo geworden.
»Da ist er ja wieder, dieser Ton«, sagte Leo, das Gesicht nur durch die Unterarme vom Fußboden getrennt.
Abrupt ließ Sergio von ihm ab und richtete den Oberkörper auf.
»Welcher Ton?«, fragte er und bereute die Frage sofort.
»Dein Ton, von wegen: Lass gut sein, ich habe mehr Erfahrung als du, tritt einen Schritt zurück, Bürschchen … und so weiter«, zog Leo ihn auf, ohne die Haltung eines reumütigen Novizen aufzugeben. Es war, als spräche er aus einer anderen Welt, denn seine Stimme, die direkt auf das Parkett traf, klang irgendwie verfremdet.
»Ich habe keinen besonderen Ton«, verteidigte sich Sergio, aber ohne dass es wie eine Verteidigung klingen sollte. Leos Rücken war etwas, das sich der Vollkommenheit näherte: klare Linien, kraftdurchdrungen, an jedem Punkt so geformt, dass es dem Licht eine Wonne war. Genau, das war er. »Warum zum Teufel musst du nur so schön sein? Begreifst du, dass das ein Problem ist?« Der angesprochene Rücken bebte vor Anstrengung, um das Lachen zu unterdrücken. »Jeder würde das begreifen«, fuhr Sergio unbeirrt fort und begann wieder, Leos Hüften und Lendenkurve zu massieren.
»Ein jeder«, fuhr er mit einem schwachen Vorwurf in der Stimme und voller Leidenschaft fort. »Aber du nicht. Mit diesem Rücken zum Beispiel spazierst du einfach so durch die Gegend.«
»Ich sehe keine Alternative«, sagte Leo, und mit einem Seufzer gab er zu erkennen, dass er auf dem richtigen Weg war, sein Problem mit der Muskelverspannung zu lösen.
»Die Lösung wäre, dich tatsächlich nicht zu lieben«, sagte Sergio mit Nachdruck.
Mit einem Ruck kam Leo auf den Knien zu sitzen, und sein Hinterkopf hätte beinahe Sergios Nase getroffen. »Das darfst du nicht einmal zum Scherz sagen«, sprach er klar und deutlich, in Richtung Wand. Es kostete ihn Mühe, sich umzuwenden, denn er wusste nicht, welche Miene Sergio aufsetzen würde, wenn er sich denn entschlösse, ihm ins Gesicht zu sehen. »Nie mehr. Nie mehr«, sagte er gleich zweimal, als wäre seine Aussage, nur einmal ausgesprochen, nicht klar genug. Dann erhob er sich.
Sergio umklammerte Leos Knie, als wollte er ihn daran hindern fortzufahren. »Nie mehr«, versicherte er ihm. »Verzeih mir.«
»Du weißt doch, wie ich bin! Du weißt doch, was ich denke, oder nicht?«, fragte Leo aus der Höhe.
Er bezog sich auf eine Diskussion, die sie vor einigen Jahren gehabt hatten, Sergio wusste das sehr genau. Damals lebten beide noch in Bologna. Sie hatten sich gerade erst kennengelernt, an einem regnerischen Abend, in der Bar, in der Leo hin und wieder jobbte. Sergio war mit einigen Kollegen dort, um etwas zu trinken, und Leo hatte hinter dem Tresen alles getan, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch er hatte ihn bemerkt: Wie hätte er ihn auch nicht bemerken sollen, diesen wunderschönen Jüngling? Der Unterschied war, dass er nie etwas getan hätte, um das zu erkennen zu geben. Nun, gewiss, das war die Zeit, in der er von sich selbst behaupten und denken durfte, dass ein Mann zu sein nicht bedeutet, die Schönheit eines anderen Mannes nicht zu erkennen, so sie denn vorhanden ist. Und im Falle von Leo war sie vorhanden. Aber es war die Zeit, in der er nicht einmal unter Folter ein solches Thema angeschnitten hätte. Es war wohlbehütet, tief in seinem Innern. Deshalb war er auch fest bei seinem Entschluss geblieben, sich nie und nimmer umzudrehen, um ihn anzuschauen, und auch sonst nicht das geringste Interesse erkennen zu lassen. Mit den Kollegen wurde über Arbeit gesprochen, damals war er Chefinspektor der Kriminaltechnik bei der Staatspolizei in Bologna; oder über Weiber. Ob sie nun verheiratet oder Junggesellen waren, sie sprachen über Sex; sie erzählten von Mösen, »die weit wie der Weltraum waren«, oder von »Holzmösen«. Ihm missfiel das nicht, denn es hinderte ihn daran, diesen Druck wie von einem Finger auf der Kehle zu spüren, der ihm den Atem nahm, jedes Mal, wenn der Gedanke ihn heimsuchte, dass ihm Männer gefallen könnten. Und zwar – da meldete sich seine humanistische Bildung zur Unzeit zu Wort – ganz exakt die viri, oi andres, und nicht die homines, die oi anthropoi. An jenem Abend hatte der Chefinspektor Striggio eine Menge Gründe, um so zu tun, als hätte er, und zwar genau in dieser Reihenfolge, Lust, über Weiber zu sprechen, und keine Lust, diesen wunderschönen Burschen zu bemerken, der hin und wieder in der Bar gegenüber dem Sitz der KTU arbeitete. Der erste war, dass er erst vor vier Tagen seinen dreißigsten Geburtstag gefeiert hatte; der zweite, dass er seinen Vater in jeder Hinsicht enttäuscht hatte; der dritte, dass er in knapp zwei Stunden seine Verlobte treffen sollte; der vierte, dass er keine Absicht hatte, dieser schrecklichen und wunderbaren Spannung nachzugeben, die seinen Unterleib fest im Griff hatte, jedes Mal, wenn der herrlich schöne junge Mann an ihm vorüberging; der fünfte, dass er keine Zeit zu verplempern hatte, weil innerhalb der nächsten Minuten seine Kollegen eine umwerfende Anekdote aus seinem Mund hören wollten.
Es war einer jener Tage mitten im Herbst, die den Eindruck eines vorgezogenen Frühlings vermittelten, während tief in ihnen eine Art Groll dräute. Und urplötzlich verfinstern sie sich, schicken Regen und Wind. Und da meinte Sergio mit einem Blick nach draußen zum Himmel, was mehr ein Ablenkungsmanöver war, es sei vermutlich besser, ins Büro zurückzukehren, ein heftiges Gewitter sei im Anzug. Einige Blitze in der Ferne schienen ihm rechtzugeben, und so konnte er sich die Anekdote ersparen und an seinen Arbeitsplatz zurück.
Das Gewitter ging eine Stunde später los. Sergio war auf dem Nachhauseweg, um sich für seine Verabredung bereit zu machen, der Regen prasselte heftig auf das Wagengehäuse und übertönte fast das Autoradio. Als er an der Bar vorbeifuhr, sah er ihn erneut: Der wunderschöne junge Mann presste sich eng an das Rollgitter, doch der Regen erreichte ihn trotzdem. Und so etwas ging einfach nicht! Also fuhr er an den Bordstein und fragte, ohne auszusteigen, durch den Spalt des Wagenfensters, ob er ihn ein Stück mitnehmen solle. Leo ließ sich das nicht zweimal sagen. Er stieg ein, pitschnass, den Geruch nach Erde und Regen, Schweiß und Metall verströmend. Er atmete schwer wie gewisse wagemutige Alpinisten, die sich aufmachen, die Gipfel ohne Sauerstoffflaschen zu bezwingen. Er war so großartig, so rein in seinem Unvermögen, sich zu verstellen, so aufgeregt, dass er schier erstickte. Trotzdem hatte er die Mitfahrgelegenheit ohne das geringste Zaudern angenommen. Und Sergio begriff, dass in diesem wunderschönen jungen Mann, mit seiner ganzen Verlegenheit, die er allein mit sich ausmachte, mit seiner völligen Unerschrockenheit vor dem Abgrund, obwohl ihm das Herz bis zum Halse schlug, ein Begehren brannte, das niemand ihm bis dahin gezeigt hatte. Und er verliebte sich in ihn, wie es den Menschen widerfährt, den homines und den anthropoi.
Und deswegen konnte er diesem Geschenk eines regnerischen Herbsttages alles gestatten. Aber noch sollte Zeit vergehen, bevor er sich bereit fühlte, das auch zum Ausdruck zu bringen.
Leo stieg in den Wagen und sagte: »Leo«. Als wäre sich mit Namen vorzustellen dringlicher, als den Wagenschlag zu schließen, durch den es hereinregnete. Sergio erwiderte, er solle doch ruhig ganz einsteigen, ohne etwas hinzuzufügen. Also nahm Leo Platz und schloss mit plötzlicher Eilfertigkeit die Wagentür. Es schien, als wäre er gerannt und hätte nicht, eng gegen das Rollgitter gepresst, Schutz vor dem Regen gesucht. Sergio fragte ihn, ob Leo die Kurzform von Leone sei. Und Leo brach in ein Gelächter aus, das die Zuspitzung der Emotionen verriet, und antwortete, aber nein, in seinem Fall stehe Leo für Leonardo. Auch Sergio deutete ein Lächeln an, wie um zu sagen, er verzeihe ihm dieses Übermaß an Emotionalität nur deshalb, weil er das Glück gehabt habe, dass er sich in ihn verliebt habe – noch bevor ihm selbst bewusst geworden sei, wie ihm geschah. Dann ließ er den Motor an und ohne zu fragen, wohin er ihn denn fahren solle, bog er in die Via Cesare Battisti ein und von dort weiter über das Verbindungsstück der Via Ugo Bassi, die in die Via Marconi mündet. Auf der Höhe des Sitzes der Arbeitergewerkschaften fragte er ihn schließlich, wohin er ihn bringen solle.
Allmählich ließ der Regen nach. Einige mutige Passanten wagten sich unter den Säulengängen hervor, um die Allee zu überqueren; der Großteil aber wartete an der überdachten Bushaltestelle auf das Ende des Regens. Ein seltsam böiger Wind war aufgekommen, der seine Raubtierpranken ausfuhr, was sich auch auf das Licht des Tages auswirkte, denn der Sonnenuntergang schien sich über eine unermessliche Zeitspanne hingezogen zu haben. Leo sprach das Wort »Bolognina« mit einer Betonung aus, als wären alle weiteren Angaben überflüssig. Und sich räuspernd sagte er, dass Sergio in der Bar den Regen besser nicht herbeigerufen hätte. Und das sagte er, als hätte er begriffen, aus welchem Grund der sexy Polizist die Kollegengruppe hatte ablenken müssen. Und natürlich begreife er, wie nervig und eingleisig so manches Gerede sein kann, aber er glaube nun einmal fest daran, dass die Dinge beim Namen zu nennen auch bedeute, sie herbeizurufen. Niemand auf der Welt hätte meinen können, dass es sich dabei um eine angemessene Unterhaltung mit einem Unbekannten handelte, der noch nicht einmal seinen Namen genannt hatte. Und doch dachte Sergio genau das. Dieser Vorwurf erschien ihm völlig gerechtfertigt, vor allem weil er jetzt wusste, wie sehr dieser Regen ihn in Schwierigkeiten gebracht hatte. Dennoch fuhr er weiter, ohne eine Silbe zu sagen, und überließ dem wunderschönen jungen Mann das Wort, der bei jedem Rot der Ampel in Kussnähe war, bei jedem Betätigen der Gangschaltung näher rückte, der erzählte und erzählte, und seine Worte erreichten ihn wie lebendige Wesen. Nach der Bahnhofsbrücke musste er nach rechts abbiegen, gleich vor der Piazza dell’Unità.
»Ich weiß, wie du gestrickt bist«, bestätigte Sergio und erhob sich. Dann legte er ihm die Hand auf die Schulter, um ihn umzudrehen und ihm in die Augen sehen zu können. Wie nackt auch immer, Leo besaß die Gabe, nie schutzlos zu wirken. Seit einiger Zeit ließ er sich einen Bart wachsen. Aber das hatte ihn, anders als erhofft, nicht erwachsener aussehen lassen. Im Gegenteil, er wirkte damit jünger, wie ein Jugendlicher, der für die Theateraufführung am Schuljahresende ein Toupet trägt: ein fünfzehnjähriger Milchbubi, der die Rolle eines stark behaarten Helden des Risorgimento spielt.
Nachdem er vor dem mehrstöckigen Haus aus der Epoche Umberto I, eingefasst von einem schmalen, staubigen Ziergarten, angehalten hatte, saßen sie stumm da und schauten auf den nachlassenden Regen jenseits der Windschutzscheibe. Mit einer solchen Anspannung, als befände sich jenseits des Kristalls, auf das leise die Tropfen klopften, das Urgeheimnis des Lebens. Ihr Schweigen füllte jede Stelle im Wageninneren, bis ihnen das Atmen schwerfiel. Nach Luft schnappend, sagte Leo, er müsse jetzt gehen. Sergio fragte ihn, wie alt er sei, da es wirklich unmöglich war, ein für ihn passendes Alter zu schätzen. Ein zarter Flaum auf den Unterarmen bezeugte, dass er die Pubertät hinter sich hatte. Leo antwortete, zweiundzwanzig, und dann fragte er Sergio nach seinem Namen.
»Sergio. Und vor vier Tagen bin ich dreißig geworden«, sagte er. Dann nahm er sich die Zeit, um über die Tatsache nachzudenken, dass dieser wunderschöne junge Mann ihn nicht nach seinem Alter gefragt hatte. Der Motor, auf Minimum gehalten, brummte; und draußen brachte ein unberechenbarer Wind die weißroten Absperrbänder um eine Baustelle zum Vibrieren; und die weißen, schwarzen, grauen, violetten Wolken zogen im Galopp vorüber wie eine Antilopenherde, deren Anführer urplötzlich Alarm geschlagen hatte; und die Adamsäpfel zuckten jedes Mal, wenn es notwendig wurde, die Spucke, die sich in der Kehle gesammelt hatte, hinunterzuschlucken; und die Hände beschränkten sich darauf, die Unmöglichkeit oder gar die Unangemessenheit, einander zu berühren, als gegeben hinzunehmen. Leo sagte ihm, dass er alleine wohne. Er sagte das in einem sehr sachlichen Ton, ohne sich zur Seite zu drehen. Sergio presste die Lippen zusammen, als wollte er sagen, dass die Information als das zu nehmen war, was sie war. Der andere bedeutete ihm mit einer vagen Kopfbewegung, dass er sie als Einladung betrachten dürfe, gleichwohl rechnete er nicht damit, dass er das auch so verstehe. Seine Nervosität zeigte sich unverhohlen, als er wie unter Zwang die Handflächen auf dem gespannten Stoff seiner Jeans auf Kniehöhe trockenrieb. Sergio sagte, dass er noch einen Anruf zu tätigen habe. Und wieder bewegte Leo leicht den Kopf und fügte hinzu, dass er sich ruhig Zeit lassen solle, seine Wohnung befinde sich im zweiten Stock, die kleine Tür auf der rechten Seite.
»Nicht einmal der Bart, den du dir hast wachsen lassen, lässt dich erwachsener aussehen«, sagte er und streichelte mit beiden Händen sein Gesicht.
Leo entfuhr dieses knappe Lachen, das ihn jedes Mal unfähig machte, dem Mann, den er liebte, Unrecht zu geben. Sich in seinen Augen gespiegelt zu sehen verdeutlichte ihm, dass es sich entweder um einen ungetreuen oder einen allzu getreuen Spiegel handelte. Es bedarf einer gehörigen Portion Unschärfe, um das eigene Spiegelbild zu akzeptieren. Und findest du dein Bild gespiegelt in den Augen des Mannes, den du liebst, dann wird aus einer solchen Unschärfe reine und echte Willkür. Dieser Leo, den er in Sergios Augen gespiegelt sah, war in der Tat nicht wahrheitsgetreu: ein schmaler, wohlproportionierter Jüngling, mit einem glatten Körper und dünner, fuchsroter Behaarung; mit dem dicken, vulgären, beschnittenen Glied in Ruhestellung und dem absurden Bart im Stil der Carbonari. Alles wahr und alles falsch also. Einer Herme vom Gianicolo ähnlicher als einem Hipster. Oder vielleicht galt die übliche Regel, dass es nichts Modernes gibt, was nicht antiken Ursprungs ist. Oder dass wir mit Leichtfertigkeit nur dann von etwas Neuem sprechen können, wenn wir die Vergangenheit ausreichend ignorieren. Die jungen Leute und die Unwissenden neigen immer zu Enthusiasmus. Wobei es sich dabei um zwei unterschiedliche Arten von Enthusiasmus handelt, gewiss, aber in jedem Fall um Enthusiasmus. Und wenn er, Leo, stets mit Entschlossenheit in der eigenen Zeit auftrat, war es vielleicht deshalb, weil er nicht in der Lage war zu ignorieren, aus welcher Zeit er kam.
»Schön, nicht wahr?«, fragte Leo und meinte noch immer den Bart, während er die Hände streichelte, die seinen Bart streichelten. In der Tat, schön war er, pechschwarz und überraschend dicht.
»Du bist immer so voller Begeisterung«, sagte Sergio. »Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass er deine Lippen verdeckt.«
»Ja, ich muss ihn besser pflegen, den Oberlippenbart stutzen. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er dich besonders stört«, sagte Leo, zum Satzende hin lauter werdend, denn Sergio war zur Toilette gegangen, um zu pinkeln. Und tatsächlich war kurz darauf von dort zu hören, wie die Klobrille hochgeklappt wurde, und dann der Urinstrahl. Wie absurd es auch klingen mag, aber dieser Strahl war das Beruhigendste, was er sich erwarten durfte. Müsste er die Dinge aufzählen, die er an Sergio liebte, er hätte genau mit diesem Mannesstrahl angefangen, den er beim Pissen produzierte. Oder mit dem scharfen, elektrisierenden Geruch seines Schweißes. Oder mit seiner dunklen Brustbehaarung in Form eines Ginkgo-Blattes. Oder mit der ungeschliffenen Schmalheit seiner Fesseln. All das waren Merkmale, dachte er, die sich nicht auf vorrangig körperliche Eigenschaften beschränkten, sondern mit noch anderem zu tun hatten.
Als Sergio das Telefonat beendet hatte, musste er wohl oder übel die vier Treppenabsätze hinaufsteigen, die ihn von der kleinen Tür zur Rechten auf dem zweiten Stock trennten. Es war darum gegangen, einen unverfänglichen Ton anzuschlagen, um mitzuteilen, dass unvorhersehbare Probleme bei seiner Arbeit aufgetaucht seien, und er folglich nicht pünktlich zu ihrer Verabredung kommen könne. Das war alles, und ohne seinen Worten einen besonderen Nachdruck zu verleihen, denn nichts lässt bei einer Verlobten mehr Verdacht aufkommen als ein nachdrücklicher Ton. Lieber halten die Frauen dich für einen Scheißkerl als für einen Verräter, auch wenn es am Ende auf das Gleiche hinausläuft. Als Laura am Telefon antwortete, redete Sergio daher mit ihr so, wie man es mit jedem X-beliebigen tut, der weiß, was Sache ist. Sie hatten es einander zig Mal wiederholt: Du weißt ja, was für einen Beruf ich habe, du weißt, wie ich bin, du weißt, dass ich diese Dinge nicht ertrage … Und so hatte er es kurz gemacht, sich auf eine knappe Ansage beschränkt, eine von denen, die keinen Zusatz vorhersahen: »Probleme bei der Arbeit, also fällt unsere Verabredung flach, ich rufe dich morgen an.« Und sie, die wusste, wie seine Arbeit war und wie er gestrickt war und welches die Dinge waren, die er nicht ertrug, hatte flugs begriffen, dass es nicht angebracht war, weitere Fragen zu stellen. Sie sagte bloß: »Bis morgen also.« Und er darauf: »Bis morgen.« Und sie hatte noch hinzugefügt: »Ich liebe dich«, und er hatte erwidert: »Ja natürlich, ich auch … Bis morgen.« Dann hatte er das Gespräch beendet, war noch eine Weile hinter dem Steuer sitzengeblieben und hatte, die Straße im Blick, versucht, alle seine Kräfte zu bündeln, um den Motor zu starten. Stattdessen war er ausgestiegen und hatte das Ozon ringsum eingeatmet, als müsste er sich für einen bevorstehenden Wettkampf im Tauchsport nochmal kräftig die Lungen füllen; dann hatte er die Türautomatik des Wagens betätigt, noch einen Blick auf das schlichte Wohnhaus geworfen und die zwei Meter zurückgelegt, die ihn vom Hauseingang trennten.
Als er im zweiten Stock angelangt war, fand er die kleine Tür rechterhand angelehnt. Er trat ein, einen Arm ausgestreckt, wie ein Blinder es getan hätte. Drinnen war es dunkel, seine Pupillen brauchten einige Sekunden, bis sie den Raum erfassten. Die Eingangstür schloss er ganz einfach, indem er mit beiden Schultern dagegen drückte und darauf achtete, ein gewisses Geräusch zu erzeugen, damit derjenige, der ihn erwartete, auch ja hörte, dass er gekommen war. Er drang in den Halbschatten des langen Korridors ein, bis er das letzte Zimmer auf der linken Seite erreichte. Dort saß Leo auf einem Bett ohne Kopfteil, er hatte sich die regennassen Klamotten ausgezogen und sie einfach auf den Boden fallen lassen. Noch bis kurz zuvor schienen sie zusammen mit ihm geatmet zu haben, jetzt lagen sie da, ohne Form und Leben, wenige Schritte vom Eingang entfernt. Leo hatte es nicht für nötig befunden, sich wieder anzuziehen. Und so konnte Sergio nun zum zweiten Mal die Fleischwerdung eines unermesslich geheimen Begehrens beobachten, das so geheim war, dass es die Schranke des Unmöglichen überwunden hatte. Das erste Mal war lang her, er war dreizehn gewesen, in einer schwülheißen Nacht, in der ein Kollege seines Vaters in seinem Zimmer untergebracht war. Und jetzt war es das zweite Mal. Und es war dieser wunderschöne junge Mann dort. Licht war er im Halbschatten, mit einem ins Nichts gerichteten Blick. Als wäre er nicht echt, sondern nur die Gestaltwerdung seiner meistverdrängten Phantasie, seines Begehrens, das, zuvor ungeformt, jetzt eine Form bekommen hatte. Er sagte zu ihm, dass er nicht wüsste, einfach so, ohne offenkundigen Zusammenhang, und seine kehlige Stimme klang so seltsam, als käme sie von einem, der nicht er war, von einem, den er noch nie gesehen hatte. »Ich weiß nicht«, hatte er gesagt. Und Leo hatte ihn gefragt, was genau er denn nicht wüsste. Und er hatte erwidert, nicht einmal das wüsste er, zumindest nicht jetzt in dem Moment. Und der andere hatte gefragt, was denn »jetzt, in diesem Moment«, so Besonderes geschähe. Und dann hatte er sich erhoben, die Handflächen darbietend – doch ich reiche euch die enttäuschten Hände –, aber nur, weil er keine Sekunde länger sein Verlangen, ihn zu berühren, unterdrücken wollte. Und er berührte ihn. Er berührte das Fleisch durch den Hemdenstoff, spürte das flachgepresste Körperhaar unter dem dünnen Stoff. Er begann, das Hemd aufzuknöpfen, und Sergio ließ ihn gewähren: und bete auch ich in deinem ruhigen Hafen.
»Soll ich alles mitnehmen?«, fragte Leo unvermittelt, als er ins Bad gekommen war. Sergio stand unter der Dusche und antwortete nicht. Leo entdeckte seine Zahnbürste und steckte sie in einen durchsichtigen Behälter von der Art, wie man sie auf Flugreisen verwendet, dazu eine Körperlotion, ein After Shave, Gurgelwasser, Nagelschere und Nagelknipser.
»Es ist doch nur für ein paar Tage«, sagte Sergio, während er sich das nasse Haar trocken rubbelte. Er war um einen ruhigen Ton bemüht, wie jemand, der eine an sich schon peinliche Situation nicht noch mehr aufheizen will.
»Ja, gewiss«, bekräftigte Leo mit einer Spur zu viel Groll. »Wir hatten darüber gesprochen, oder etwa nicht?«, versuchte er einzulenken. »Es ist doch nur für ein paar Tage«, sagte er erneut.
»Das hast du bereits gesagt«, erwiderte Leo und hatte jetzt alle seine Sachen beisammen.
»Ich schäme mich deiner nicht«, kam Sergio ihm zuvor.
»Aha, und wegen wem schämst du dich dann?«
Sergio blickte in den Spiegel, als suchte er in seinem Spiegelbild nach einer passenden Antwort. »Meinetwegen, glaube ich«, sagte er dann.
»Folglich wegen mir, glaubst du nicht?«
»Du kennst meinen Vater nicht«, rechtfertigte Sergio sich, ohne zu bedenken, wie lächerlich ein solcher Satz aus dem Mund eines fast vierunddreißigjährigen Mannes klingen musste.
»In der Tat, ich kenne ihn nicht.« Leo ließ nicht locker; zwar hatte er sich gefügt und Sergios Wohnung freigeräumt, das ja, aber er wollte nicht, dass die Sache allzu schmerzfrei für ihn ausginge.
»Leo …«
»Das ist nicht die Art, wie es nach vier Jahren laufen sollte, findest du nicht?«, sagte er, ohne mit einer Antwort zu rechnen.
Sergio antwortete trotzdem, konnte aber eine Spur von Opferhaltung nicht unterdrücken, die zuweilen recht gute, wenn auch nicht die allerbesten Ergebnisse gezeitigt hatte. »Wir sind doch zusammen, nicht wahr?«
»Es wäre korrekter zu sagen, dass ich mit dir zusammen bin, und du, wenn du kannst: wenn dein Vater nicht vor Ort ist, wenn deine Kollegen nicht dabei sind, wenn du nicht nach Bologna zurück musst …«
»Leo …«
»Ja, gewiss, das ist mein Name, du kannst ihn ruhig wiederholen …«
»Leo, bitte …«, flehte Sergio ihn nun an. Aber seine Worte fanden keinen Adressaten mehr, denn sein wunderschöner junger Mann nahm gerade einige Stücke Unterwäsche, eine Schachtel Kondome und einen Flakon Gleitmittel aus der Schublade der Kommode.
»Sicher besser, wenn ich auch diese Sachen mitnehme, oder nicht?«, fragte er.
Sergio schüttelte den Kopf: »Seine Frau ist seit zwei Monaten tot, Leo! Was soll ich denn tun? Ich will nicht, dass wir so auseinandergehen, ich bitte dich …«
»Du bittest mich? Dann bitte mich«, entgegnete Leo, während er die Reisetasche schloss. In der Zwischenzeit hatte er einen Slip angezogen und sich ein T-Shirt mit der Aufschrift ODIO GLI INDIFFERENTI1 übergestreift.
Dieses Shirt hatte Sergio ihm vor ein paar Jahren geschenkt, anlässlich eines Sommerfestivals im Süden, zu dem Leo unbedingt hatte fahren wollen. Es war noch keine Woche vergangen, dass Sergio sich endlich dazu entschlossen hatte, mit Laura zu reden.
Sie hatten sich zum Abendessen verabredet. Wie immer sah sie reizend aus, elegant und verlockend, wie nur echte Schönheiten es sein können. Laura war strahlend und intelligent. Eine Frau mit Einfühlungsvermögen. Als sie zu Sergio ins Auto gestiegen war, und noch bevor sie den Sicherheitsgurt umgelegt hatte, hatte sie ihm trotz des frisch aufgelegten Lippenstifts einen sanften Kuss auf die Lippen gedrückt. Er hatte den Motor angelassen. Schweigend hatten sie fünf-, sechshundert Meter zurückgelegt. Dann, als wäre ihm plötzlich etwas über die Maßen Wichtiges in den Sinn gekommen, war er an die Seite gefahren und hatte direkt unterhalb der Mauern des Baraccano Halt gemacht. Er hatte den Motor abgestellt, das Lenkrad gepackt, als wollte er aus diesem Stillstand etwas Endgültiges machen, und gesagt, er müsse mit ihr reden.
Es war nicht einfach gewesen, sie hatte bereits zuvor begriffen, dass sie einander alles Erdenkliche sagen könnten. Sie hatte verstanden, dass es zwischen ihnen aus war, gewiss, aber den Grund dafür hatte sie nicht verstanden. Laura war es wichtig klarzustellen, dass alles von ihm ausgegangen war, und diese Schuldzuweisung nahm er wie einen himmlischen Segen entgegen. Er bestätigte, dass es sich genau so verhalte, dass nichts, aber auch gar nichts von ihr abhänge, dass ihre gemeinsame Zeit eine wunderbare bleiben würde, aber ihm sei klar geworden, dass er sie nicht liebe. Und sie fragte, warum. Sie fragte, was sie falsch gemacht hätte. Sie behauptete, dass es ohne den mindesten Zweifel eine andere geben müsse, was er aufs Entschiedenste verneinen konnte, ohne dass es gelogen wäre. Aber der Grund, weshalb man liebt, ist exakt derselbe, aus dem man aufhört zu lieben, oder nicht? Sie erwiderte, das wisse sie nicht und es sei doch seltsam, dass er urplötzlich diesen Umstand begriffen hätte. Es sei denn, er habe immer schon gelogen. Er entgegnete, dass, wenn es jemanden gebe, den er belogen habe, dann sei er selbst derjenige gewesen. Und Laura sah ihn mit einer gewissen Unleidigkeit an, denn sie hatte erkannt, dass mit diesem Mann zu tun zu haben bedeutete, einen Lachs außerhalb des Wassers mit bloßen Händen festhalten zu wollen. Je mehr sie sich mühte, ihn zu fassen zu kriegen und damit ihren letzten Jahren einen Sinn zu geben, desto mehr ging er auf Distanz, entglitt er ihr. Am Ende sagte sie, sie habe verstanden, denn sie wolle nicht völlig den Boden unter den Füßen verlieren. Und er entschuldigte sich erneut wegen all der Hoffnungen, die er zunichtegemacht hatte. Und dann beging er den Fehler zu sagen, er wisse, wie sie sich fühlen müsse. Und sie, im Begriff auszusteigen, mit einem Fuß bereits draußen, schnellte mit einer brüsken Bewegung ins Wageninnere zurück, lehnte sich bequem in den Beifahrersitz und zog die Wagentür zu. Dann tat sie einen Seufzer, denn am Ende hatte er es mit seinem heuchlerischen Mitgefühl geschafft, sie aus der Reserve zu locken. Jetzt musste er die Konsequenzen seiner Leichtfertigkeit tragen.
Er wisse doch, was für einen Beruf sie habe, oder nicht? Und Sergio bejahte stumm. Er wisse doch, wie sehr ihr daran gelegen sei, die Dinge gut und richtig zu tun, oder nicht? Wieder ein stummes Ja. Alle glauben immer, dass Geschichtslehrer überflüssig seien. Sergio begriff nicht, worauf sie hinauswollte, aber Laura gebot ihm zu schweigen, wie sie es mit dem neunmalklugen Schüler in ihrer Klasse gemacht hätte, den sie ständig bremsen musste. Er wisse doch, dass sie sich erst kürzlich angeboten habe, ihre Klasse auf einer Studienfahrt nach Ausschwitz und Birkenau zu begleiten, ob er sich daran noch erinnere? Ob er sich auch erinnere, dass sie ihm sogar den Vorschlag gemacht habe, sich ihnen anzuschließen? Er bestätigte auch das. Nun gut, als sie in Birkenau gewesen waren, hatte es für sie eine Führung zu den Latrinen des Lagers gegeben. Diese Latrinen bestanden aus einer einzigen Marmorplatte mit Löchern von dreißig Zentimeter Durchmesser in bestimmten Abständen. Die Deportierten hatten, je einer pro Loch, zehn Sekunden Zeit, um zu defäkieren oder den ganzen Rest zu verrichten, danach mussten sie aufstehen und den anderen in der Reihe Platz machen. Ob das nun reichte oder nicht, exakt das war ihre Zeit, sie konnten sich nicht abputzen, oft waren sie gezwungen, sich zu erheben, bevor sie fertig waren, menstruierende Frauen oder Menschen mit Durchfall bekamen keinerlei Ausnahmebehandlung. Auf dieser durchlöcherten schneeweißen Marmorplatte, vielleicht das einzige Manufakt im ganzen Lager, das nicht das vollständige Grauen zum Ausdruck brachte, konzentrierte sich, wenn es dessen überhaupt noch bedurfte, einer der Gipfel menschlicher Grausamkeit. Denn im Gegensatz zu allen anderen Bereichen des Lagers war die ausgewiesene Funktion dieses spezifischen Bereichs der, einem physiologischen Bedürfnis Rechnung zu tragen. Damit sagten sie, sie verstünden die Notwendigkeit, Kot und Urin auszuscheiden, doch das zu sagen, bedeutete rein gar nichts. Sie behaupteten, etwas zu respektieren, das sie de facto ganz und gar nicht respektierten. Was wiederum viel schlimmer war als das, was wenige Meter von dort entfernt geschah, wo die glasklare und unumkehrbare Regel herrschte: Leib und Leben der Gefangenen sind vollkommen wertlos und verdienen keinerlei Respekt oder Aufmerksamkeit.
Ob er nun begriffen habe, wie sie sich fühlen musste? Sergio blieb stumm. Sie aber war wie ein reißender Fluss und fügte hinzu, dass er nur so getan habe, als behandle er sie mit einem gewissen Zartgefühl, das er ihr in Wirklichkeit nie entgegengebracht habe. Er behauptete, er habe Dinge begriffen, die er jedoch nie begriffen hatte.
Beim Aussteigen sagte sie, es sei ja wohl völlig überflüssig, den Abend im Restaurant oder sonst wo fortzusetzen, denn das, was sie sich zu sagen hätten, sei ja nun gesagt. Sergio erhob keinen Einwand. Was er gehört hatte, erschien ihm absurd und völlig übertrieben, aber wie ein echter Soldat überließ er ihr die Wahl der Waffen. Und auch den bühnenreifen Abgang. Trotzdem hatte er noch Jahre an die Latrinen von Birkenau als eine Metapher für die unmenschlichste Grausamkeit denken müssen, die einem gewissen nur dem Anschein nach zartfühlenden Verhalten innewohnte. Bevor er den Motor anließ, wartete er ab, bis Laura zu einem winzigen Punkt geworden und im Gewirr der Gassen des Zentrums verschwunden war.
»Es stimmt nicht, dass es mir nicht wichtig ist …«, sagte Leo mit Nachdruck. Er war jetzt vollständig angekleidet, über dem Shirt mit dem Schriftzug trug er eine leichte Daunenjacke.
»Ich weiß, dass es dir wichtig ist. Du wirst sehen, ich werde mit ihm sprechen.«
»Ach, ich wünschte, du könntest begreifen, wie wichtig es ist.«
Wie immer, wenn alles geklärt schien, fing er wieder von vorne an. Sergio ließ die verräterische Falte zu, die sich immer, wenn er verärgert war, zwischen seinen Augenbrauen bildete. »An welchem Punkt unserer Unterredung kam es dir so vor, als hätte ich nicht begriffen, wie wichtig es ist?« Ein ganzer schwankender Satz, bei dem er sich vergeblich bemühte, nicht in einen grollenden Ton zu verfallen.
»Jetzt bist du sauer«, schloss Leo. »Wir reden ein andermal. Sollte ich etwas liegen gelassen haben, kannst du ja noch immer gegenüber deinem Vater behaupten, dass du einen auswärtigen Kollegen beherbergt hast.«
»Scheiße«, meinte Sergio. Dieses Gebaren ließ ihn ohnmächtig zurück. Seinem Instinkt folgend hätte er diesem arroganten Hurensohn, der da vor ihm stand, eine in die Fresse hauen sollen, doch zufällig war der auch von Kopf bis Fuß der Mann, in den er ohne Wenn und Aber verliebt war.
»Du bringst mich nicht dazu, etwas Unbedachtes zu tun«, sagte er leise. »Ich frage mich, wann es auch für mich ein wenig Nachsicht geben wird«, fügte er ebenso leise hinzu. »Wohin willst du?«, fragte er.
Leo gefiel es, die Dinge auf die Spitze zu treiben. Er wusste alles, was es über ihn zu wissen gab. Beispielsweise, dass es gefährlich sein konnte, ihn in einer Ecke Schachmatt zu setzen, doch noch viel gefährlicher war es, sich selbst in eben diese Ecke zu zwängen. Denn das war im Grunde Liebe, richtig? »Nach Hause«, erwiderte er. »Zu mir nach Hause«, stellte er klar.
»Jedes Mal, wenn du aus dieser Türe gehst, überkommt mich eine Wahnsinnsangst, dich nicht mehr wiederzusehen, jedes Mal. Ich weiß, dass ich zu viel von dir verlangt habe, zu viel verlange«, ergab er sich. »Seine Frau ist vor zwei Monaten gestorben: Wie hätte ich es denn anstellen sollen? Du weißt, wie viel Mühe es mich gekostet hat, ihn so weit zu bringen, dass er überhaupt kommt. Ich dachte, wir wären uns einig.«
»Was genau willst du eigentlich von mir?«, fragte Leo, der infolge dieser Wendung zum Rührseligen etwas aus dem Konzept gebracht worden war.
»Verlass mich jetzt nicht auf diese Weise.«
»Auf welche Weise?«
»So, als sollten wir uns nie mehr wiedersehen. «
Leo wurde klar, dass für Sergio ein solcher Moment absoluter Schwäche just der seiner größten Stärke war. »Wie kannst du so etwas auch nur denken?«, begehrte er mit halber Kraft auf wie ein Tenor, der seinen Part übt, ohne dabei seine Stimmkraft zu vergeuden. Und so blieb sein Protest am Ende schwammig, undeutlich.
»Nicht du bist es. Ich bin es«, sagte Sergio mit Nachdruck. »Du musst mir sagen, dass du verstehst, dass du meine Entscheidung mitträgst.« Er war kurz davor, in Tränen auszubrechen.
»Weinst du jetzt?«, fragte Leo an eine unsichtbare Wesenheit zwischen ihnen gewandt. In ihren vier gemeinsamen Jahren hatte er ihn noch nie weinen sehen.
»Auf alle Fälle ist es nicht nötig, dass du schon heute Nacht gehst.«
»Doch, sehr wohl, lass nur! So hast du mehr Zeit, alles vorzubereiten.«
Sergios Handy begann zu vibrieren, als wäre es ein lebendiges Etwas, und suchend sah er sich um. Leo deutete auf das halbleere Bücherregal hinter ihm. Widerwillig ging er dran, denn ein Anruf aus dem Kommissariat um diese Uhrzeit kam nie mit der Absicht, ihm eine Gute Nacht zu wünschen. Er hörte eine Weile zu, und Leo genügte die Zeit, um zur Wohnungstür zu gelangen und sie zu öffnen. Aus dem Treppenhaus drang wie ein scharfer Hieb eiskalte Luft herein und machte Sergio wieder bewusst, dass er splitterfasernackt war. »In zwanzig Minuten bin ich da«, sagte er abschließend zu dem Niemand im Äther. Dann legte er das Handy hin und eilte zu Leo, um ihn zu küssen, bevor er ganz verschwunden wäre.
»Du holst dir noch den Tod«, sagte Leo als Erwiderung auf den Kuss. »Geh wieder rein«, sagte er. »Geh dich anziehen, du hast kein Schamgefühl.«
1 Ich hasse die Gleichgültigen.