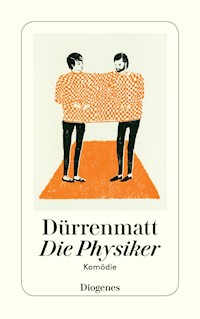11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Unterwerfung unter das Leben? Aber was ist ›das Leben‹? Blechmans Antwort als höhnische Herausforderung und Auftakt (I) des dreiteiligen Prosastücks: »Wenn du Wissenschaft willst, geh ins Laboratorium. Wenn du aber das Leben suchst, geh ins Scheißhaus.« Dann die Bürgeridylle des Dom(inik) Wright (II). Dom: der gütige, besorgte Hausvater, will seiner Tochter eine erstklassige Hochzeit ausrichten. Woher das Geld nehmen? Dritter Teil (III): Dom, der Polizist, geht auf Jagd. Sein Revier sind die Stationen der New Yorker U-Bahn, wo die Unterwelt sich von ihm loskaufen muß. Achtung 901! Gleichsam über die Schulter des Voyeurs hinweg entsteht auf der Hetzjagd ein abgründiges Bild der New Yorker Unterwelt, dessen religiös-visionäre Erhöhung nicht Haß, Gemeinheit und Verrat standhält. Die U-Bahn-Stationen sind die via Dolorosa, in der schließlich alle Illusionen zerbrechen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Ähnliche
Burt Blechman
Achtung 901
Aus dem Amerikanischen von Traut Felgentreff
FISCHER Digital
Inhalt
Fragment eines Manuskriptes
Wenn du Wissenschaft willst, geh ins Laboratorium. Wenn du aber das Leben suchst, geh ins Scheißhaus. Hier fängt alles an, auf einem Misthaufen, genannt Leben, wo ein Volk von Sklaven sich darauf vorbereitet, für den Tod zu kämpfen.
Du mußt wissen, daß sie für zwei Dinge gemacht sind, fürs Geschwätz und für den Krieg. Schwanger von Gerede, quaken und quasseln, belfern und salbadern sie:
»Wo?« und »Wann?«
»Für was?«
»Instinkt«, schreit ein Morbider.
»Geschichte«, ein Professor.
»Hunger«, einer, und zeigt auf sein kümmerliches Gedärm.
»Ruhm«, ein anderer, der nach Orden giert.
»Raum«, seufzt ein Dicker und
»Schönheit«, ein Ephebe.
»Dort muß es sein«, ein Mystiker.
Der Haufen, verpestet von Verfall (Verwirrung, Verdammnis), treibt zur Schlachtbank.
Ihr Gehirn, ihr Verstand ist angekettet an die Erde. Aus den Tiefen dieses Kerkers eine Antwort.
»Marsch«, röchelnd wie der Herzschlag einer verreckenden Sau.
»Marsch«, das ist die Sehnsucht ihrer Angst, der Ausdruck ihrer Raserei.
Einer nach dem anderen recken sie ihre feigen Nacken. Die Antworten des Kerkers werden lauter. Schleichende Schritte, trampelnde Hufe, nach Hufen wilde Klauen, nach Klauen knirschende Zähne, dumpfe Trommeln, donnernde Kanonen. »Marsch!« die Stimme ist laut genug, alle Vernunft zu ersticken, schrill genug, jeden Widerstand zu brechen.
Es ist die Königin. Sie ist jetzt scharf, nicht auf Liebe, sondern auf den Krieg. Sklaven und Studenten, Arbeiter und Schüler, Soldaten und Professoren, ein gefügiger Haufen sie alle, spülen das gefährliche Gift hinunter. Stellt euch die Trompeten vor, die Fanfaren, Trommeln über Trommeln, eine nationale Hymne: Hymne der Freiheit, Hymne des Sieges, Hymne des Glaubens, des Stolzes. Wenn Musik die Nahrung der Leidenschaft ist, dann ist die Hymne das Palliativ der Verzweiflung.
Blätter zittern. Der Wald dröhnt. Der lange Zug windet sich den Spalt herunter, zwei und zwei, vier und vier. Eins, zwei, sieben, acht – die vieläugigen, vielbeinigen Ungeheuer nehmen den Rhythmus auf. So fängt das Leben gewöhnlich an, mit einem Gewaltmarsch ins Unbekannte.
»Freiheit, Freiheit«, stöhnen die Sklaven bei der Heuer zu ihrer lebenslangen Schicht.
»Los, los«, die Arbeiter.
Aufpasser lauern am Weg, keinen Augenblick würden sie zögern, »Gefahr« zu schreien, das einzige Wort, das sie kennen.
»…« grölen die Studenten, ein unaussprechliches Wort. »…« Von der Königin dann eine scharfe Warnung.
Die spindeligen Sklaven mit ihrer kastrierten »Freiheit«. Und die Arbeiter mit ihrem »Los«. Und dieser gewaltige Urmutterschrei einer Königin: »Mir nach! Mir nach! Mir nach!« Denn die, die zu dieser Gesellschaft gehören, kennen nur ein einziges Wort. Und alles, was sie schreien, addiert sich zu Verhängnis.
Sie kommen über einen Fluß, es könnte auch ein Strom sein. Nicht breiter als ein Streichholz. In diesem Mythos (du kannst ihn dir mannsklein oder ameisengroß vorstellen) gibt es kein anderes Ende als den Tod.
Die Schüler melden: »Gefahr«.
Die Studenten fordern: »…«
Die Sklaven flüstern: »Freiheit«.
Die Arbeiter befehlen: »Los«.
Die Königin kommandiert: »Mir nach!«
Sie gehorchen.
Also geht es in den Fluß, breit wie ein Faden, tief wie eine Träne. Zwei und zwei, so klammern sich die Liebenden mit Zangenarmen, mit Gabelbeinen, mit Sägekiefern aneinander. Zwei und zwei gehen sie unter. Und zwei und zwei sterben sie.
Aber das ist noch nicht das Ende. Sie dienen weiter, zwei und zwei – denn über die Leiber der Ertrunkenen, über diese Brücke kopulierender Verliebter geht es, über das Gebein der Vorfahren. Angstgeschrei erfüllt den schrecklichen Dschungel.
Die Königin ist hinter neuem Land her, hinter neuer Beute, neuen Eroberungen. Ernte, solange die Sonne scheint. Und sie scheint noch. Hin über die Seufzerbrücke, weiter gegen das nächste Hindernis und das nächste. Siegesstern nach Schlachtstern.
Der müde Haufen zieht weiter, als hätte er nichts anderes gehört, gesehen, gerochen als Befehle. Zweig nach Zweig legen sie zurück, vergessen alle Vorsicht, weil die Königin Orden in ihren Weg laicht. Sie ist unendlich großzügig.
Der Zug robbt über den Dschungelboden. Sklaven schleppen, Arbeiter heulen, Soldaten hinken. Blind stürzen die Schüler voran. Die Kolonne hat kein Ende. Die Königin hat entschieden. Perlen und Fanatismus, Rubine und Hochmut vernebeln ihr leeres Gehirn.
Das phosphoreszierende Licht der Sonne verkriecht sich hinter Wolken. Oma Natur lauert auf jede Bewegung. Ein einziger Schritt zurück, und sie wird sie alle am Boden zermalmen. Ein Atemholen nur, und sie wird es ihnen geben. Weiter stolpern sie durch den Wald.
Mit knirschenden Zähnen rückt die Sippe vor. Hunger weckt Scham. Müde Männer betteln um Rückkehr, die Arbeiter um eine Rast. Die Königin senkt ihre gehörnte Krone in grausamer Rachlust: »Los!« Und die Welt bebt.
Ein Schluchzen geht durch die Zweige. Die Schwachen bleiben zurück, zwei und zwei, so fallen sie in das tote Laub, in gigantische Farne, giftige Blüten. Der Zug geht weiter.
Gehorsam marschieren sie durch Wälder, fromme Lieder summend. Die dürren Sklaven schlagen einen anderen Ton an. »Nein«, winseln sie. Kahlköpfige Krieger recken Greifzangen in den Himmel: »Ergebt euch!« Arbeiter stöhnen »es reicht«. Aber die Eine und Einzige bleibt bei ihrem Schrei, diesem grausigen, wilden, blutgierigen Schrei, »Vorwärts! Vorwärts! Vorwärts!«
Aus ihren hundert Augen bewacht sie die zerrissene zerfallene Kolonne. Ein gieriger Rachen. Soldaten schwenken schwache Stacheln, die aus rot entzündeten Kehlen wachsen. Arbeiter greifen mit nutzlosen Gliedern. Sklaven schlagen mit ohnmächtigen Fühlern. Zwei und zwei verschwinden sie in der gefräßigen Falle.
Aber sie wehren sich nicht, ziehn sich nicht zurück.
Sie riechen Verderben: ihr Geschick.
Die Kehle ist zugeschnürt. Der Mund schnappt nach Luft. Dann wird es stiller. Über den Schwellbauch klettern sie, ihre Legionen sind dezimiert, ihr Weg ist eine Schlachtbank. Die Reihe formiert sich wieder, der Marsch geht weiter. Denn die Königin wird für Nachschub sorgen. Wenn sie erst einmal dabei ist, kann sie nichts mehr aufhalten. Kind nach Kind wälzt sich aus ihrem gebärwütigen Schoß.
»…«, rufen die Männchen. »Jetzt!« sagt einer. Ein Riese holt aus, und er ist zermalmt. Ein Wort und nur ein einziges Wort gilt. Und jetzt ist weder das richtige Wort noch die richtige Zeit. Krieg denkt sie, und Tod sagt sie. Und »Vorwärts! Vorwärts! Vorwärts!«
Schicksal winkt. Stolz zwingt. Heute Termiten, morgen Menschen. Das zusammengeschrumpfte Bataillon setzt seinen vorbezeichneten Weg fort.
»Freiheit«, winseln die Rekruten.
»Los«, fauchen die Unteroffiziere.
»…«, denken die Studenten.
»Gefahr«, warnen die Leutnants.
Sie marschieren weiter. Der Wald wird ein Acker von Füßen. Ein lautloses Gemetzel treibt sie in den Schlamm und stampft sie wieder heraus mit tausend Giften, mit Netzen, mit einem undurchdringlichen Ring von Flammen. Ein einsamer, schriller Schrei, unerbittlich: »Vorwärts!«
In eine Zone des Verderbens, vorbei an Weizenhalmen, zwei und zwei, vier und vier, vergessen und vergehend. Aus Weizen wird Gras. Aus Gras wird Gestrüpp, aus Gestrüpp Wüste.
Der Zug stockt. Sie bitten um Rast, um Erbarmen, um Wasser. Über die gelben Dünen. Sklaven zerfallen zu Asche, Arbeiter verröcheln. Wie die Funken eines verglimmenden Feuers huschen sie über die schwelende Glut.
Ein Zittern geht durch die Reihen. Sklaven knien in ihren Spuren. Krieger zittern (bibbern, beben, brechen).
In einer Kaskade blitzender Diademe, in einem Gestöber von Hermelin, mit einem verführerischen Lächeln auf den Lippen, so kommt ihre Königliche Hoheit die Schneise herunter. Die Königin, die Königin, Platz für die Königin. »Vorwärts« heult es durch ihre goldglänzenden Zähne. »Vorwärts!«
Krieger erstarren vor Furcht. Arbeiter schleppen sich erschöpft dahin. Sklaven sinken in den Sand. Die Schüler haben nichts zu melden.
»Vorwärts«, ein Schrei aus der Nachhut, »Vorwärts!« Sie marschieren weiter, fallen in nicht gegrabene Gräber, kaum noch atmend. Kaum noch eine Bewegung. Vorwärts durch die Wüste, über den Sand, in der Sonne, eine unendliche Hundertschaft, sich ewig wiederholend, sinnlos gedankenlos planlos marschieren, marschieren eins zwei sieben acht 1–2–7–8–1–2 …
Ein Flüstern, sehr sanft zuerst, als wärs ein Wiegenlied. Von einem Sklaven kommt es, einem frechen Stück Leben, nicht größer als ein Stecknadelkopf. Ein letzter Wunsch, ein Sterbetraum. Lauter. Noch lauter. Einer nach dem anderen, die Gruppe, die Sippe, die ganze Nation nimmt es auf, das Wort, die schreckliche Pest, sie geht von den Sklaven zu den Arbeitern, von den Arbeitern zu den Studenten und Soldaten.
Ihre winzigen Kiefer mahlen vor Verwunderung:
Warum? keuchen sie; warum? seufzen sie; warum? ächzen sie; warum? schreien sie. Vorwärts ist die Antwort, vorwärts. Unerbittlich.
Mit einer Stimme, die sich in Raserei überschlägt, in einem Gebrüll bar aller Vernunft, einem unendlichen ohrenbetäubenden Crescendo: «Vorwärts! Vorwärts! Vorwärts!«
– 901
(O geschändete Nonne)
(Gotteslästerliche Wonne)
Dom
Etwas Altes
»Bitte freundlich!«
Die Wrights vor der Kamera. Das heitere Quartett gefriert im Blitzlicht zu Statuen, taut dann wieder auf. Verkrampfte Posen lösen sich, und muntere Stimmen schwirren durcheinander.
Nur Dom ist nicht dabei, der ärgert sich. »Mein Schlips saß schief.«
»Wie dein Vater«, sagt Lucy Wright. »Spielt den Verrückten, wenn er in Wirklichkeit der glücklichste Mann auf der Welt ist.«
Sue betrachtet die roten und weißen Streifen der Krawatte. »Dein Schlips ist o.k.!«
Der Fotograf lächelt beruhigend. »Ausgezeichnet, eine gute Aufnahme.«
Tina dreht das Radio an. Ein Bariton singt »America’s most beautiful …«
»Die glückliche Braut und ihr Vater«, lacht der Fotograf und drückt auf den Knopf.
»Friends will know you’ve arrived«, plärrt der Lautsprecher.
»Laß das Radio, Tina«, ruft Lucy Wright. »Wir warten.« Dom knufft sie zärtlich. Sie starren ins Objektiv. »Achtung, der Kuckuck«, sagt der Fotograf.
»Wer ist Kuckuck?« lacht Dom.
»For the man on his way up«, säuselt der Bariton.
Das Blitzlicht. »Du hast gewackelt«, schreit die kleine Sue.
»Keinen Millimeter«, sagt Dom.
Der Fotograf dreht den Film weiter. »Das war sehr gut.«
»Die letzten Nachrichten von der Front …«
»Dreh ab«, sagt Dom. »Heute kann ich das nicht hören.« Mrs. Wright rennt zum Radio. Tina gähnt.
Dom lächelt. »Unsere Kleine ist müde, bevor es überhaupt angefangen hat.«
»Nimm sie doch nicht dauernd auf den Arm«, sagt Lucy Wright und geht in die Küche. »Ich mache Kaffee.«
Dom starrt in den Spiegel. Der Schlips saß schief. Man wird es auf dem Foto sehen. Der Fotograf fummelt am Blitzlicht herum. Klingel. Sue läuft zum Guckloch.
»Ein paar Leute, Papa. Ich glaube, das sind sie.«
»Wer ist da?« ruft Dom vorsichtshalber.
Eine heisere Stimme: »Herr und Frau Rosso.«
Lucy bringt die dampfende Kanne aus der Küche. »Worauf wartet ihr noch? Macht doch auf!«
Dom zögert. Er möchte noch seinen Schlips fertig binden, einen letzten schnellen Blick in den Spiegel werfen, sein graues Haar zurückkämmen. Dann mit einem sorgfältig einstudierten Lächeln zur Tür: »Bitte treten Sie ein, wir haben Sie erwartet.«
Die Kamera verkrümelt sich in eine Ecke. Rosso umarmt Dom. Frau Rosso und Lucy lächeln sich an. Tina gibt Sue einen Kuß. Das Blitzlicht macht dem verlegenen Schweigen ein Ende.
»Ich dachte, Al käme mit Ihnen«, sagt Tina.
»Sein Zug hat wohl Verspätung«, sagt Rosso.
Dom rückt das goldene D auf seinem Schlips zurecht.
»Vielleicht ist er nervös.«
»Sie meinen, wegen der Krise an der Front?« sagt Rosso.
»Darüber wollen wir lieber nicht reden.« Lucy gießt den Kaffee ein.
»Ich meine, wegen der Hochzeit«, sagt Dom. »Nur noch ein Tag, und sie sinds.« Lucy bringt Zucker und Sahne. »Ich meine, er hat vielleicht doch einen Bammel gekriegt. Das ist doch nur natürlich.«
Rosso schaut pikiert.
Ein letztes Bild. Die entzückende Braut am Polterabend wird man darunter schreiben. Tina versucht, interessiert zu schauen.
»Sie ist nicht halb so aufgeregt wie wir«, sagt Lucy lächelnd. »Sogar Susy ist nervöser.«
Blitzlicht. »Das schadet euren Augen«, sagt Rosso verdrossen.
Der Fotograf packt seinen Kram ein und sagt: »Morgen wird dann von früh bis spät geknipst.«
Jeder unvergeßliche Augenblick für immer festgehalten. So steht es in der Werbebroschüre.
»Dominick, bitte pack du die Geschenke nicht aus«, sagt Lucy.
»Dominick!« lacht Dom. »Seit vierundzwanzig Jahren bin ich verheiratet, und plötzlich bin ich ›Dominick‹! Als hätten wir uns gerade kennengelernt.«
Lucy wird rot. »Als wärst du die Braut«, lacht Dom, »die errötende Braut.«
»Lassen Sie sie doch endlich in Ruhe«, mokiert sich Rosso. »Ihre Frau ist wunderbar. Sie dürfen sie nicht so reizen.«
»Ich möchte die Geschenke sehen«, sagt Susy.
»Tina weiß, wer was geschenkt hat, so kann sie sich bei den Leuten bedanken«, sagt Dom und nimmt eines der Päckchen, in Silberpapier mit blauem Band. Die Rossos setzen bescheiden-sittsame Mienen auf.
Für die Zukunft wünschen wir
Silber und Gold.
Jahr für Jahr
Sei das Glück euch hold.
»›Von Herrn und Frau Rosso‹«, liest Dom vor und reißt das Papier herunter. »Hier«. Er gibt Tina den Radiowecker.
»Silber«, schreit Sue. »Silber und Gold. Wie es auf der Karte steht.«
»Wie hübsch«, seufzt Lucy. »Wie ein schönes Schiff.« Gedankenverloren poliert Tina eines der mächtigen Segel. »Das ist viel zu kostbar.«
»Chrom«, sagt Frau Rosso. »Mit Messingauflage. Wirklich nichts Besonderes.«
Dom dreht sich um.
»Chrom rostet nicht«, sagt Tina schnell, »genau das Richtige.« Tina nickt ein Dankeschön. Susy strahlt, als gehörte alles ihr, auch die Hochzeit.
Die Geschenke werden begutachtet, eines nach dem anderen. Tina liest mit ihrer spröden Stimme die Glückwünsche. Susy hält die Geschenke hoch, daß ein jeder sie sehen kann; Lucy sagt: »das hätte es wirklich nicht gebraucht.« Frau Rosso seufzt »wie schön«, und Dom schreibt die Geschenke fein säuberlich in sein Notizbuch.
Rosso schaut auf die Uhr. »Ich wüßte gern, wo Al so lange bleibt.«
Susy zeigt auf die Tür. »Schau, Mama, Queenie kommt. Sie möchte auch dabei sein.«
»Paß auf, daß dein Vater sie nicht im Wohnzimmer sieht« – eine ängstliche Warnung von Lucy.
»Ist Ihre Tochter in der Highschool?« fragt Frau Rosso. »Nächstes Jahr.« Der Ärger weicht einem charmanten Lächeln.
Tina hält den Spaniel im Arm und streichelt sein Fell. »Tina liebt dieses Hündchen einfach«, lacht Lucy. »Ich glaube, das macht Dom eifersüchtig.«
»Wissen Sie, was dieses alte Biest angerichtet hat?« fragt Dom und legt das Notizbuch und den goldenen Kugelschreiber beiseite. »Es hat unsere gute Couch total ruiniert, total. Es wird allmählich schwachsinnig.« Er gibt Susy einen sanften Stoß. »Sei jetzt Papas liebes Mädchen und bring Queenie in die Küche zurück.«
Frau Rosso sagt: »Ein reizendes Tier. Und dieses schöne goldene Fell.«
Dom flüstert etwas hinter vorgehaltener Hand. Rosso schaut grimmig. »Ich werde sie nach der Hochzeit anrufen«, sagt er laut zu Lucy.
Lucy seufzt und sagt dann mit einem vertraulichen Lächeln zu Frau Rosso: »Er ist so entsetzlich stur, mein Mann. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, kann ihn nichts davon abbringen.«
»Nichts außer einer Zehn-Dollar-Note«, grinst Rosso.
»Wie unser Al«, sagt Frau Rosso. »Stur wie ein Panzer. Was er sich vornimmt, tut er auch. Allein dieses Studium in den letzten Jahren. Zum Verrücktwerden.«
»Immer wieder vergesse ich es«, sagt Dom, »was studiert er gleich wieder?«
»Irgend etwas mit Physio oder so«, hilft Lucy.
»Physiologie!« erklärt Rosso stolz. »Wie Medizin, aber besser. Spezialisierter.«
»Denken Sie nur, aus einer so einfachen Familie«, sagt Frau Rosso. »Man kann sich nur wundern, wie man zu einem solchen Sohn kommt.«
»Mit Tina geht es mir genauso«, lacht Dom. »Wissen Sie, neulich …«
»Er wird es zu etwas bringen«, sagt Rosso. »Wenn er sich einmal für etwas entschieden hat, bleibt er dabei, und wenn er noch so schwer arbeiten muß.«
»Wissen Sie, neulich hat Tina …« sagt Dom.
»Deshalb ist Al auch nach New York gegangen. Um Karriere zu machen«, sagt Frau Rosso. »Eigentlich wäre er ja viel lieber hier bei uns.«