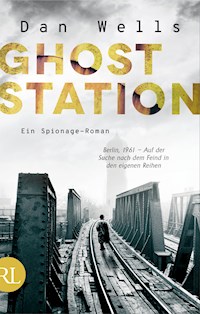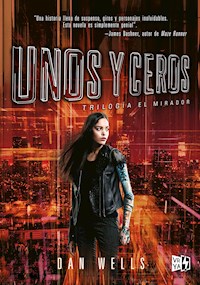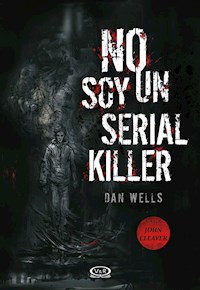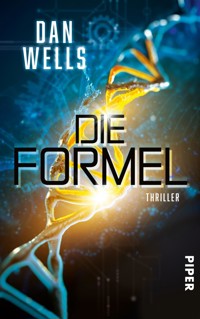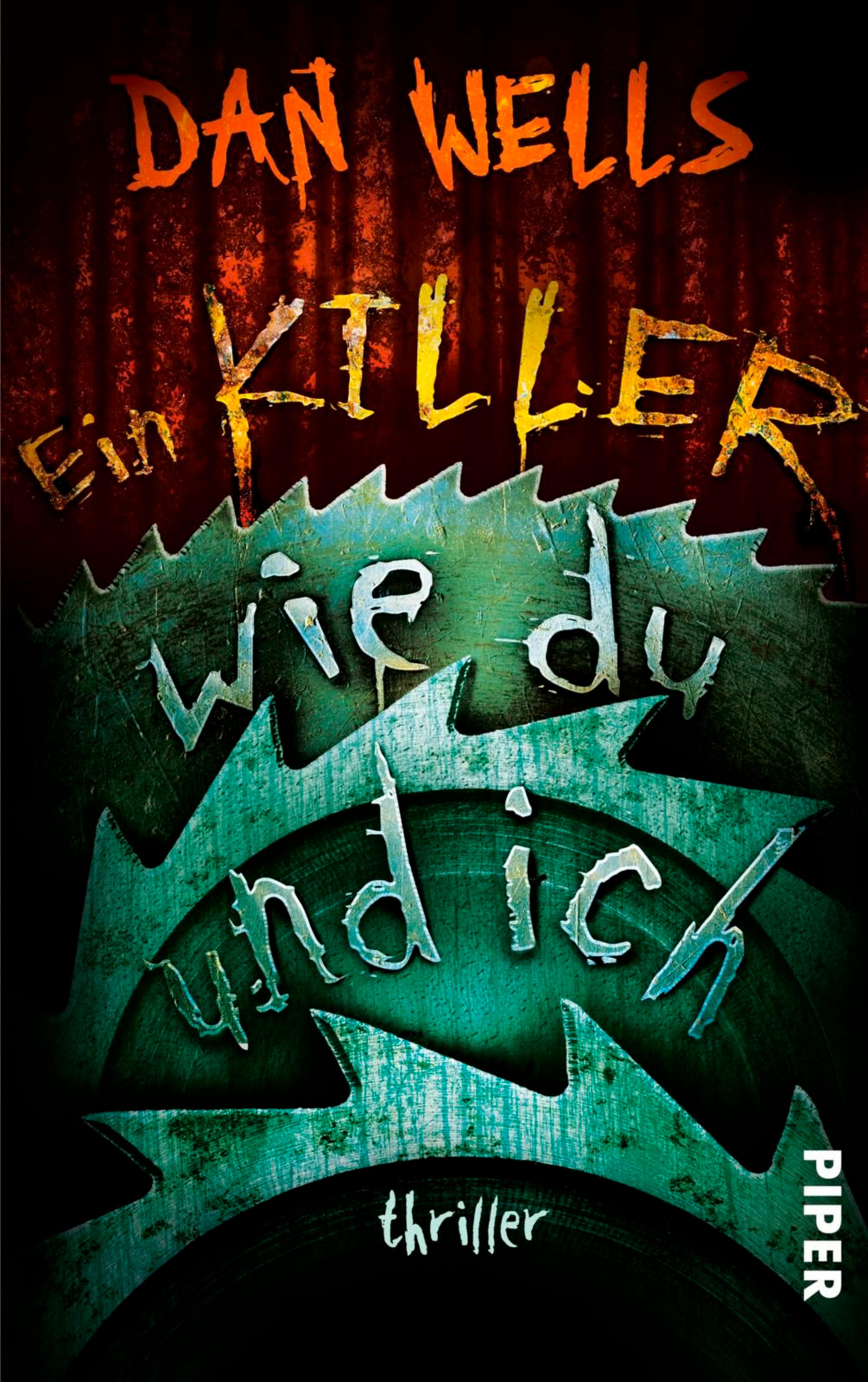12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Los Angeles im Jahr 2050: Die junge Hackerin Marisa Carneseca umgibt ein Geheimnis. Als sie zwei Jahre alt war, verlor sie bei einem Autounfall ihren Arm, während Zenaida de Maldonado, die Frau eines Mafiabosses, starb. Niemand kann Marisa sagen, warum sie in diesem Auto saß oder wie es nach dem Unfall zu der Fehde zwischen den Carnesecas und den Maldonados kam. Die Vergangenheit holt Marisa viele Jahre später ein, als Zenaidas frisch abgetrennte Hand aufgefunden wird. Ist Zenaida doch noch am Leben? Als Marisa erfährt, dass nicht nur die Gangs von Los Angeles, sondern auch die größten Konzerne der Welt in den Fall verwickelt sind, wird klar, dass mehr dahinter steckt, als Marisa je hätte ahnen können ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Jürgen Langowski
ISBN 978-3-492-99228-2© Dan Wells 2018Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Active Memory« bei Balzer + Bray, New York 2018© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: Guter Punkt, MünchenCovermotiv: Guter Punkt, Kim Hoang unter Verwendung eines Motivs von liuzishan / thinkstockDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Kapitel 1: Die Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Highschool …
Kapitel 2: Das ändert alles …
Kapitel 3: Omar pfiff durch die Zähne …
Kapitel 4: Marisa zog den Abzug durch …
Kapitel 5: Marisa schnitt eine Grimasse …
Kapitel 6: Olaya, sagte Marisa …
Kapitel 7: Meine Fans werden ausflippen …
Kapitel 8: Säure?, fragte Jaya …
Kapitel 9: Wir müssen hier weg …
Kapitel 10: Salad Bowl ist ein ausgesprochen …
Kapitel 11: Nach ihrer Schicht ging Marisa …
Kapitel 12: In Marisas Gesichtsfeld …
Kapitel 13: Das war unsere letzte Spur …
Kapitel 14: Also … Sahara starrte …
Kapitel 15: Marisa schrie auf …
Kapitel 16: Wer sonst könnte gemeint sein …
Kapitel 17: Sahara und Anja trafen sich …
Kapitel 18: Moment mal, sagte Marisa …
Kapitel 19: Marisa rief Detective Hendel an …
Kapitel 20: Gib mir die Pistole …
Kapitel 21: Marisa kreischte, ihr Vater brüllte …
Kapitel 22: Anja rief ein Autotaxi …
Kapitel 23: Omar stieß die Tür …
Kapitel 24: Sahara hielt Omar hoch oben …
Kapitel 25: Auf der untersten Ebene …
Danksagung
Glossar
Dieses Buch ist einer Heldin gewidmet: Ada Lovelace.
Sie schrieb das erste Computerprogramm der Welt zu einer Zeit, als Computer nur eine theoretische Möglichkeit waren und Programmiersprachen noch nicht existierten. Unsere ganze Existenz beruht auf den Träumen einer jungen Frau, die eine herausragende Idee hatte und die Zukunft erfand. Lass dir von niemandem einreden, du könntest nicht genauso großartig sein.
Kapitel 1
Die Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Highschool war mit einem ganzen Schwarm wunderschöner schwebender Laternen geschmückt. Die solarbetriebenen LED-Lampen hingen an großen Ballons aus Mylarfolie, deren Auftrieb genau bemessen war, sodass sie regungslos in der Luft verharrten. Die Steuerung war intelligent genug, um die Ballons an die vorgesehenen Positionen zurückzubringen, wenn eine unberechenbare Bö sie mitriss. Oder, dachte Marisa, wenn ein ebenso unberechenbarer Schüler sie absichtlich wegstieß. Letzteres war sogar die wahrscheinlichere Variante. Sie war selbst erst siebzehn und ungeheuer stolz, dass sie alles wusste, was ein Mensch nur wissen konnte, aber wenn es etwas gab, das sie nie verstehen würde, dann waren es die Jungs auf der Highschool.
»Was mögen die wohl gekostet haben?«, überlegte Marisas Vater, der die Lichter durch das Fenster ihres Autotaxis betrachtete.
»Heute ist ein besonderer Abend«, verkündete Marisa. »Es ist der Wissenschaftswettbewerb.«
»Das heißt WIKITEM«, ergänzte Marisas zwölfjährige Schwester Pati. Es war förmlich zu hören, wie sie in Großbuchstaben sprach. »Wissenschaft, Kunst, Ingenieurswesen, Technologie und Mathematik, alles in einem.«
Gabi schnaubte. »Es ist bloß ein Wissenschaftswettbewerb.« Sie war zwei Jahre älter als Pati und viel schwerer zu beeindrucken. »Warum sind wir überhaupt hier?«
»Euer Bruder hat beim Wettbewerb ein Nuli eingereicht«, antwortete der Vater. »Keiner von euch hat jemals ein Nuli gebaut.«
Marisa verdrehte die Augen. »Papi, das ist kein Wettkampf.«
»Natürlich ist es ein Wettkampf«, widersprach er. »Es gibt einen Preis und so weiter.«
»Ich meine zwischen deinen Kindern.«
»Es ist überhaupt kein Wissenschaftswettbewerb«, wandte Pati ein. »Es ist eine Vorführung für Roboter und Hacker. Gama hat gesagt, es soll einen Nulikampf geben …«
»Das hier ist nichts für Hacker«, fiel Gabi ihr ins Wort. »Die Schule lässt doch nicht die eigenen Computer von den Schülern hacken.«
»Mari macht das aber die ganze Zeit«, beharrte Pati.
»Das sollte sie lieber lassen«, warf der Vater ein.
»Ay, que niña«, sagte Marisa. »Cállate.«
»Entschuldige dich bei deiner Schwester!«, verlangte der Vater.
»Ja«, entgegnete Marisa. »Entschuldige dich!«
Er musterte sie mit finsterem Blick. »Ich meinte dich, morena.«
Pati machte ein selbstgefälliges Gesicht. »Wir sagen nicht cállate, hast du das vergessen?«
»Na gut«, gab Marisa zurück. »Tut mir leid. Auf Spanisch: lo siento. Auf Chinesisch: bi zui.«
Marisas Vater betrachtete sie misstrauisch aus den Augenwinkeln. Er sprach kein Chinesisch und wusste nicht, dass sie ihrer Schwester noch einmal gesagt hatte, sie solle die Klappe halten. Der Augenausdruck verriet allerdings, dass er etwas in dieser Richtung vermutete.
»Es gibt auch keine Nulikämpfe«, schränkte Gabi ein. »Da stehen einfach nur, como, fünfzig Jungs neben den blöden kleinen Robotern, die sie gebaut haben.«
»Und fünfzig Mädchen«, ergänzte Marisa.
»Wen kümmern die schon?«, fragte Gabi. »Ich bin nur mit einem Jungen verwandt, also bleiben neunundvierzig, die mir etwas über ihre Projekte erzählen wollen.«
»Highschooltypen«, meinte Marisa voller Abscheu. »Die kannst du alle haben.«
»Genau das habe ich vor.«
»Meine Ohren!«, rief ihr Vater. »Könnt ihr nicht wenigstens warten, bis ihr ausgestiegen seid?«
Das Autotaxi hielt am Bordstein, die Türen glitten klappernd auf. Normalerweise wären sie nicht mit dem Taxi gefahren, aber ihr Vater erholte sich gerade von seiner Lebertransplantation. Er konnte zwar gehen, die Ärzte rieten ihm allerdings, sich vorläufig noch zu schonen. Deshalb hatten sie das billigste Autotaxi genommen, das es gab. Marisa stieg aus, rückte das T-Shirt zurecht – es zeigte die Intruders, ihre aktuelle nigerianische Lieblings-Metalband – und betrachtete die Schule. Ihre Schule, auch wenn sie überwiegend daheim lernte. Sie stemmte die Metallprothese gegen den Türrahmen und streckte den natürlichen Arm ins Auto. Ihr Vater schlug ein, und sie zog ihn grunzend hoch. Die Gelenke und Servomotoren im Metallarm, eine schlanke, ästhetische Prothese, bewältigten die Anstrengung mühelos, hinterließen allerdings eine Reihe winziger Dellen im dünnen Dach des Taxis. Egal. Sie schüttelte den Kopf und half Gabi, auch das Pflegenuli auszuladen.
»Triste Chango«, stöhnte ihr Vater. »Ich hasse dieses Ding.«
Das bedeutete so viel wie dummer Affe, war in diesem Fall aber der Name, den die Familie dem Pflegenuli gegeben hatte. Marisa tätschelte lächelnd den Blechkasten. »Das Ding hält dich am Leben, Papi. Wir wollen doch nicht, dass eine Naht reißt, dass du eine Infektion bekommst oder so.«
Er schüttelte den Krückstock, bis er ganz ausgeklappt war, und setzte sich langsam zur Highschool in Bewegung. »Ich brauche keinen Babysitter.« Triste Chango folgte ihm dienstbeflissen und hielt die Rettungsmittel bereit.
Sobald Pati und Gabi ausgestiegen waren, blinzelte Marisa den Bezahllink in der Benutzeroberfläche ihres Djinnis an. Das Computerimplantat zeigte sich als sanftes Glühen am Rand ihres Gesichtsfelds. Auf ihrem Konto war nicht mehr viel Geld, aber ihre Mom hatte ihnen genug gegeben, damit sie das Taxi bezahlen konnten. Es bat um ein Trinkgeld, was Marisa voller Schadenfreude ablehnte, und fuhr mit einem etwas zu schrillen Motorgeräusch davon.
»Deshalb ist Jugendlichen so ziemlich alles egal.« Marisa nahm Pati an der Hand und folgte dem Vater in die Schule. Pati trug wie Marisa schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt. »Hundert Menschen haben gerade gesehen, wie wir ausgestiegen sind, und wenn ich Wert auf ihre Gedanken legen würde, dann würde ich sterben. Es ist wirklich das Beste, wenn einem alles egal ist.«
»Bäh, du bist vielleicht blöd!«, meinte Gabi.
Marisa lächelte Pati an. »Siehst du?«
Das LED-Schild über dem Eingang war anlässlich des Wettbewerbs umdekoriert. Jetzt stand dort WIKITEM in quietschgelben Buchstaben. Im Eingangsbereich waren Trophäen und Zeitungsartikel ausgestellt. Die meisten drehten sich allerdings eher um Sport als um Wissenschaft. Mehrere Besucher winkten ihnen zu, als sie zur Cafeteria gingen, wo die Projekte ausgestellt wurden. Los Angeles war riesig – die größte Stadt der Welt, zumindest der Ausdehnung nach, wenn schon nicht nach der Einwohnerschaft –, aber Mirador bildete eine verschworene Gemeinschaft, in der jeder so gut wie jeden anderen zumindest flüchtig kannte. Dank ihres Restaurants waren die Carnesecas zudem bekannter als viele andere Einwohner.
»Buenas tardes, Carlo Magno!« Ein älterer Mann winkte Marisas Vater gut gelaunt zu und stemmte die Hände in die Hüften, als betrachte er ein besonders schönes Stück Rindfleisch in der Auslage eines Metzgers. »Du siehst gut aus, du erholst dich schnell.«
»Danke, Beto.« Carlo Magno lächelte, und Marisa sah, dass ihr Vater ehrlich dankbar war, auch wenn er nichts mehr sagte. Er tat immer gern so, als strotze er vor Gesundheit, aber der heutige Abend setzte ihm zu.
»Komm schon!« Pati zog Marisa an der Hand weiter. »Lass uns Sandro suchen! Hast du schon sein Nuli gesehen? Es ist erstaunlich.«
»Ich habe es gesehen«, antwortete Marisa. »Sein Zimmer liegt direkt neben meinem.« Trotzdem ließ sie sich weiterziehen. Gabi war schon verschwunden.
»Wartet!«, rief Carlo Magno. »Lasst mich doch nicht allein hier stehen!«
»Du bist nicht allein«, widersprach Marisa. »Du hast doch Triste Chango.«
»Wie bitte?«, fragte Beto.
»Sein Nuli«, ergänzte Marisa. »Du warst nicht gemeint.« Pati zerrte sie durch die Tür in die Cafeteria. An diesem Tag waren die Tische nicht zu langen Reihen, sondern zu Dreiecken zusammengestellt worden. Marisa konnte nicht recht erkennen, inwiefern das den öden Raum ansehnlicher machte oder wie man sich jetzt besser darin zurechtfinden sollte. Jedes Dreieck war mit WIKITEM-Objekten dekoriert, auf einigen lagen sogar Plakate, die den unvermeidlichen Strebern gehörten, aber meist waren es einfach Nulis, Roboter oder Monitore, die irgendeine hübsche neue Software zeigten. Auf den Wandbildschirmen liefen unverfängliche Videos über Tiere in freier Wildbahn: Serengeti, Amazonas, die Ruinen des alten Detroit. Das diesjährige Thema lautete Wildnis der Stadt, und die meisten Projekte zielten auf irgendeinen Aspekt der Natur oder auf die einzigartige Symbiose der Stadt mit der Natur.
Gabi stand in der Nähe an einem Tisch. Sie trug die beste Weste und einen Falten-Minirock und hörte hingerissen Jordan Brown zu, der ihr den neuen Müllsammelalgorithmus erklärte, den er für ein Hausmeisternuli entwickelt hatte.
»Die Software kann nicht nur mehr Arten von Abfall erkennen, sondern ihn auch viel präziser nach recycelbaren Stoffen sortieren. Lebensmittel und organische Abfälle, Papier und sogar Metallkeramik in Form von einseitig beschichteten Folien …«
Marisa ließ sie allein und wanderte weiter in den Raum hinein. Jordan war süß, besuchte aber bereits die Abschlusskurse und hatte eine Reihe unglaublicher Stipendienangebote bekommen. Gabi hatte keine Chance, aber warum sollte sie die Träume ihrer Schwester zerstören?
In ihrem Djinni ploppte eine Nachricht auf. Ein kleines Ebenbild ihres Freunds Bao tanzte fröhlich in ihrem Gesichtsfeld. Sie blinzelte darauf und las den Text.
Drei Minuten.
»Chamuco«, murmelte sie.
»Was?«, fragte Pati.
»Anscheinend ist Bao hier.« Marisa sah sich um. Bao war einer ihrer besten Freunde auf der ganzen Welt und einer ihrer häufigsten Mittäter, was mitunter ganz wörtlich zu verstehen war.
»Ach herrje!« Pati riss die Augen weit auf. Sie war unsterblich in Bao verknallt. »Sehe ich auch gut aus? Ich habe mich nicht einmal zurechtgemacht. Gabi ist klasse, aber ich sehe aus, als hätte ich unter einer Brücke geschlafen. Was soll ich bloß machen?«
»Du siehst großartig aus.«
»Ich trage einen Sport-BH. Sieht man das? Glaubst du, er merkt was?«
Marisa lachte. »Bao ist viel zu sehr Gentleman, um einer Zwölfjährigen auf die Brüste zu starren.«
»Aber dazu sind sie doch da!«
»Ay, Pati, cálmate. Bao liebt dich … wie eine Schwester.«
»Ich bleibe nicht ewig zwölf.«
»Aber du wirst ewig fünf Jahre jünger sein als er.«
»Wenn ich zwanzig bin, spielt das keine Rolle mehr.«
»Schön.« Marisa ließ den Blick über die Menge schweifen. »Wenn du zwanzig bist, ist er fünfundzwanzig. Dann erlaube ich dir, ihn zu heiraten.«
Pati runzelte die Stirn. »Warum siehst du dich dauernd um?«
»Das ist ein Spiel, das Bao und ich spielen. Er hat mir drei Minuten gegeben, um ihn zu entdecken.«
»Wir verteilen uns.« Auf einmal war Pati konzentriert wie ein Laserstrahl. »Dann können wir mehr Gelände abdecken. Los!« Schon drehte sie sich um und verschwand im Gedränge.
Da ploppte die nächste Nachricht auf: Es ist nicht fair, deine kleine Schwester bei der Suche einzusetzen.
Noch einmal betrachtete Marisa die Menge. Wo er auch war, er konnte sie beobachten.
Hast du gehört, was sie gesagt hat?, schrieb sie zurück.
Nein.
Gott sei Dank.
Also hielt er sich ganz in der Nähe auf, konnte sie aber nicht belauschen. Wo steckte er nur? Die Decke war niedrig, es gab weder Balkone noch erhöhte Stellen, die ihm eine gute Übersicht geboten hätten. Gib mir einen Tipp.
Das habe ich gerade schon getan. Darauf folgte die Zeichnung einer Katze, die ihr die Zunge herausstreckte.
Bao war unter Marisas Freunden der Einzige, der kein Djinni besaß. Die Supercomputer wurden direkt ins Gehirn eingepflanzt, waren nahtlos mit den Sinnen und dem Nervensystem verbunden und konnten mit fast allen Objekten in der Welt kommunizieren. Hätte er eins besessen, dann hätte sie einfach ihre GPS-App mit seiner ID füttern können und ihn sofort gefunden. Ohne Djinni war er so flüchtig wie ein Geist. Genauso wollte er es haben, denn er lebte davon, Touristen zu bestehlen.
Äußerlich so gelassen wie nur möglich wanderte sie an den nächsten Tischen vorbei, fand aber unter keinem einen grinsenden chinesischen Jungen. Wo steckte er nur?
Sie sah auf die Uhr. Noch eine Minute.
Vielleicht war er weitergegangen und wich ihr in der Menge einfach aus …
Nun steh da nicht so rum, sendete er.
Also beobachtete er sie immer noch. Er musste ganz in der Nähe sein.
Oder vielleicht auch nicht. Ein garantiert sicheres Versteck bot sich nur, wenn man den Raum erst gar nicht betrat. Wieder sah sie sich um, ließ den Blick über die Fuge zwischen Wand und Decke wandern und entdeckte es schließlich – eine kleine schwarze Überwachungskamera. Sie zielte mit den Fingern darauf und tat so, als feuere sie einen Schuss ab. Da bist du ja.
Dreizehn Sekunden vor Ablauf der Zeit.
Bist du ins Büro des Schuldirektes eingebrochen?
Das klingt so kriminell, sendete Bao zurück. Ich breche nicht ein, ich verschaffe mir Zugang. Das ist etwas anderes.
Das ist eine Unterscheidung, auf die sich die meisten Cops bestimmt nicht einlassen.
Ich ziehe es vor, mich überhaupt nicht mit Cops einzulassen.
Vielleicht solltest du dann aufhören, dir irgendwo Zugang zu verschaffen.
Soll ich denn die belastenden Aufnahmen von mir auf dem Server lassen? Du hast das nicht richtig durchdacht.
Welche belastenden Aufnahmen?
Die Aufnahmen, die zeigen, wie ich eingebrochen bin, um die Aufnahmen zu löschen.
Marisa lachte. Deine Logik ist umwerfend.
Finde ich auch, antwortete Bao. Ich bin jetzt fertig, wir können uns gleich treffen. Wie wäre es mit Sandros Tisch?
Gern. Und da wäre noch etwas.
Ja?
Sag bitte etwas Nettes zu Pati, wenn du sie siehst. Sie schickte die Nachricht ab, ging weiter und stolperte fast, während sie eine dringende Ergänzung folgen ließ. Aber sag nichts über ihr T-Shirt. Sag auf keinen Fall etwas über ihr T-Shirt.
Stimmt damit etwas nicht?
Sag einfach nichts dazu. Sonst stirbt sie vor Verlegenheit.
Du bist der Boss. Es gab eine kurze Pause, bevor die nächste Nachricht kam. Ein seltsamer Boss, den ich nicht verstehe, aber trotzdem ein Boss. Bis gleich.
Marisa sah sich in der Menge um. Anscheinend war ganz Mirador gekommen, aber es war nicht schwierig, Sandro zu finden. Er hatte ein Djinni. Sie blinzelte ihre Navi-App an, worauf vor ihr eine blaue Linie entstand, der sie durch das Gedränge folgen konnte. Lächelnd machte sie sich auf den Weg. Überall boten die Schüler ihre Projekte feil wie die Verkäufer ihre Waren auf einem Straßenmarkt. Ein Mädchen hatte ein Nuli, das den Schmutz von Sonnenkollektoren entfernte, was die Energieausbeute erhöhte. Ein Junge präsentierte einen kleinen Fabrikationsroboter mit einem neuartigen Gelenk, das weniger wartungsanfällig war. Marisa blieb an einem Tisch stehen und las den neuen Code, den ihre Freundin Rosa für ein Rangernuli geschrieben hatte. Das Gerät sollte bedrohte Arten beobachten und vor Wilderern beschützen. Rosa Sanchez war achtzehn und lebte im barrio. Sie hatte die KI angepasst, damit das Gerät die Wilderer aktiv jagte, statt sie bei jeder Annäherung nur passiv zu schocken. Die Veränderung war durchaus imstande, das Machtgleichgewicht zwischen Wilderern und Wildhütern auf den Kopf zu stellen.
Alles in dem Raum war erstaunlich, und Marisa war stolz auf ihre Freunde und Nachbarn. Dies war die Zukunft, genau hier und jetzt. Hundert Schüler mit großartigen Ideen und ein Raum voller Besucher, die dazu Ja statt Nein sagten. Etwas Schöneres hatte Marisa noch nie gesehen.
An der hinteren Wand entdeckte sie ihren Bruder Sandro, der gerade den Zuschauern sein Försternuli beschrieb. Natürlich hatte er auch ein Plakat gedruckt.
»Pflanzen erkranken genauso wie Tiere«, erklärte er gerade. »Wenn das geschieht, kann sich die Erkrankung im ganzen Ökosystem wie ein Buschfeuer ausbreiten. Ein einziger Schädling wie diese Bakterienart kann in wenigen Wochen einen ganzen Obstgarten vernichten.« Er hielt einen Bildschirm hoch, auf dem ein Baum mit verschrumpelten schwarzen Blättern zu sehen war, die wie verbrannt wirkten. »Dies hier ist der Feuerbrand, und die Bakterien, die ihn verursachen, heißen Erwinia amylovora. Sie haben es vor allem auf Obstbäume abgesehen. Wir können dagegen spritzen, aber das Mittel ist giftig und benetzt alles – die kranken Blätter, die gesunden Blätter und sogar die Früchte. Mein Nuli kann diese und ein Dutzend andere Krankheiten und Parasiten aufspüren und präzise sprühen, ohne Kollateralschäden zu verursachen. Es kontrolliert sein Revier rund um die Uhr und benötigt dank seiner Genauigkeit erheblich weniger Chemikalien als die traditionellen Methoden. Deshalb ist es auch preiswerter.«
Die kleine Zuschauermenge applaudierte, und Marisa jubelte lauter als alle anderen. »Ándale, Sandro! Lechuga!«
»Du weißt doch, dass er seinen Spitznamen hasst.« Plötzlich stand Bao dicht neben ihr. Marisa hatte ihn nicht einmal kommen sehen.
»Was glaubst du denn, warum ich ihn benutze?«, fragte sie und rief den Namen laut und rhythmisch. »Le-chu-ga! Le-chu-ga!«
Sandro musterte sie, als die Zuschauer zum nächsten Projekt weiterzogen. Wie gern hätte sie gesehen, dass er eine Grimasse schnitt oder die Augen verdrehte, doch er zog nur die Brauen hoch. Er war ein Jahr jünger als sie, behandelte sie aber immer wie seine kleine Schwester.
»Danke, dass du gekommen bist«, sagte er.
»Claro que sí, hermanito. Deine Präsentation war perfekt.«
»Wirklich?«
»Es war gut«, bestätigte Bao. »Hast du ein Video, das dein Gerät im Einsatz zeigt?«
»Auf dem Tablet.« Er wies auf den Bildschirm, den er in der Hand hielt. »Im Augenblick halte ich die Vorführung eher kurz, aber die Preisrichter werden es sehen.«
»Eine Quizfrage.« Bao warf Marisa einen Blick zu. »Wie nennst du ein reptilisches Frettchen mit Flügeln?«
»Sie heißen MyDragons«, antwortete Marisa. »Die Werbung ist in der ganzen Stadt zu sehen.«
»Genau«, bestätigte Bao. »Falls du so etwas mal in Aktion erleben willst, La Princesa dort drüben hat eins.« Er deutete in die entsprechende Richtung. Marisa sah hin und sperrte den Mund auf. Richtig, da war sie – Francisca Maldonado, La Princesa de Mirador, mit einem hell lilafarbenen MyDragon auf der Schulter.
»Sind sie etwa alle hier?« Tatsächlich, La Princesa war nicht allein. Die ganze Maldonado-Familie war gekommen – Omar, Sergio und inmitten der anderen Don Maldonado höchstpersönlich. Der reichste Mann in Mirador und das Oberhaupt eines berüchtigten Verbrecherclans, der den Stadtteil kontrollierte wie ein Privatkönigreich. Don Maldonado und Marisas Vater hassten einander mit einer alten, nie erlöschenden Leidenschaft, und diese Fehde hatte einen starken Einfluss auf Marisas Leben ausgeübt. Noch schlimmer war der Umstand, dass sie sich strikt weigerten, ihr zu erklären, wie die Fehde begonnen hatte.
Hallo, Mari. Am Rand von Marisas Gesichtsfeld hüpfte eine neue Nachricht in einem Fenster, das sie niemals schloss. Es war der private Kanal zu ihrer besten Freundin Sahara. Sieh nicht hin, aber deine Lieblingsmenschen sind da.
Ich habe sie schon entdeckt, sendete Marisa zurück. Und dazu mit einem verflixten MyDragon. Einfach nur, um uns zu zeigen, dass sie viel reicher sind als wir.
Ich habe ein Blumenbukett auf der Schulter, antwortete Sahara. Franca hat ein gentechnisch maßgeschneidertes Kuscheltier.
Ich bin mit einem uralten Taxi gekommen, das sogar noch ein Lenkrad hatte, entgegnete Marisa. Die Maldonados sehen aus, als hätte man sie mit der Sänfte hergetragen, während jemand Palmwedel über ihren Häuptern geschwungen hat.
»Erde an Marisa«, sagte Bao. »Tauschst du schon wieder Beleidigungen mit Sahara aus?«
»Ich habe mein eigenes Make-up in weniger als fünf Minuten aufgelegt«, sagte Marisa laut. »Sie sieht aus, als hätte sie einen Schrank voller komplett ausgedruckter Gesichter, die sie einfach nur auflegen muss, wenn sie rausgeht.«
»Mit denen darfst du dich nicht vergleichen«, wandte Sandro ein. »Sonst fühlst du dich nur mies.«
Warum sind sie überhaupt hier?, fragte Sahara.
Pati und Carlo Magno kamen durch die Menge herüber, Triste Chango schwebte über ihnen wie ein kastenförmiges treues Hündchen.
»Bao konnte ich nicht finden, aber ich habe Papi gefunden!«, rief Pati und hielt unvermittelt inne, als sie sah, dass Bao schon da war. »Hallo, Bao, wie schön, dich zu sehen! Hast du schon Sandros Nuli gesehen? Ist das nicht krass?«
Marisa lächelte. Wenigstens war Pati nicht schüchtern.
»Ich habe es gesehen«, bestätigte Bao. »Es ist mit großem Abstand das Beste hier.«
»Wird ihm wohl nicht viel nutzen.« Carlo Magno schüttelte zornig den Krückstock in die Richtung der Menschentraube, die sich um die Maldonados gesammelt hatte. »Weißt du, was dieser chundo hier zu suchen hat?«
»Das habe ich mich auch gerade gefragt.« Ihr sank das Herz, als ihr bewusst wurde, dass es nur eine denkbare Antwort gab.
»Er ist der Preisrichter«, erklärte Carlo Magno und bestätigte ihre Befürchtungen. »Don Francisco Maldonado bestimmt den Sieger des Wissenschaftswettbewerbs und überreicht mit seinen schmierigen Fingern den Scheck. Glaubst du, er wird sich jemals für einen Carneseca entscheiden?«
»Ich glaube, er wird nach der Qualität der Arbeit entscheiden«, widersprach Sandro. Ihr Vater machte nur »Pah!«.
»Du bist ein Dummkopf«, erklärte Carlo Magno. »Ein Genie und trotzdem ein Dummkopf. Er hasst uns, das war schon immer so, und das wird keine wissenschaftliche Projektarbeit verändern. Ganz egal, wie brillant sie ist.«
Marisa hatte unwillkürlich die Metallprothese mit der menschlichen Hand gepackt. Den Arm hatte sie im Alter von zwei Jahren bei einem Autounfall verloren. Die Geheimnisse, die dieses Ereignis umgaben, färbten auf alle Bereiche ihres Lebens ab. Jeder in Mirador kannte die wichtigsten Einzelheiten. Don Franciscos Frau Zenaida war mit dem Auto gefahren – sie hatte es tatsächlich selbst gesteuert, wie es die Menschen früher getan hatten, bevor vollautomatische Autos der Normalfall geworden waren. Und dabei hatte sie einen Unfall gehabt. Niemand wusste, wohin sie aus welchem Grund fahren wollte, und da sie beim Aufprall aus dem Auto geschleudert worden und gestorben war, konnte man sie auch nicht mehr fragen.
An dieser Stelle wurde es allerdings eigenartig. Die ersten Menschen, die am Unfallort eingetroffen waren, hatten in Zenaidas Auto drei Kinder gefunden: Jacinto Maldonado, ihr zweites Kind, das nur knapp überlebt hatte, Omar Maldonado, das vierte und jüngste Kind, das völlig unversehrt geblieben war, und schließlich Marisa Carneseca. Es gab absolut keinen Grund, warum auch sie mitgefahren war. Ihr Arm war knapp unter der Schulter abgetrennt worden.
Warum hatte Marisa in dem Auto gesessen? Warum hatte Zenaida den Wagen manuell gesteuert? Und warum hassten sich Don Maldonado und Marisas Vater seitdem so innig?
Große heilige Handgranate, schrieb Sahara. Das ist nicht nur der lila MyDragon, das ist der selbst leuchtende lila MyDragon. Davon haben sie nur drei Stück hergestellt.
Ja, sendete Marisa zurück und schloss das Chatfenster. Sie wollte nicht weiter tratschen.
»Guten Abend, Mister Carneseca.« Bao versuchte tapfer, die Spannung aufzulösen, die die ganze Gruppe zum Verstummen gebracht hatte. Er streckte die Hand aus, und Carlo Magno schlug geistesabwesend ein. »Wie schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind!«
»Ich tue mein Möglichstes«, antwortete Carlo Magno. »Eigentlich brauche ich dieses Ding gar nicht mehr.« Er schlug schwach nach Triste Chango, worauf der Apparat fröhlich piepste.
»Eine wirklich gute Leber konnten wir uns nicht leisten«, erklärte Marisa. »Nicht mal eine mittelmäßige. Bei den billigsten bekommt man für zehn Wochen ein Nuli dazu, das überwacht, ob alles in Ordnung ist. Ein Service des Krankenhauses, das sich damit vor Klagen schützen will.«
»Das drückt die Kosten«, sagte Bao.
Carlo Magno starrte böse zu den Maldonados hinüber. »Meine Frau kann nicht einmal mitkommen, weil wir das Restaurant aus Kostengründen nicht schließen können, und er schleppt die ganze Familie an.«
Bao lächelte. »Ich vergesse immer, wie ähnlich Sie und Marisa sich sind.«
Carlo Magno und Marisa wechselten einen Blick. Sie waren beide nicht sicher, ob ihnen der Vergleich zusagte.
»Nicht die ganze Familie«, wandte Pati ein. »Jacinto ist nicht da.«
»Jacinto hat seit …« Carlo Magno blickte wieder zu Marisa hinüber und machte abermals »Pah!«.
»Da kommt die nächste Besuchergruppe!«, rief Sandro. »Macht ein bisschen Platz, damit ich mit der Präsentation beginnen kann!«
Alle wichen aus und entfernten sich ein Stück von den Maldonados. Marisa fand eine Bank, auf die sich ihr Vater setzen konnte. Triste Chango huschte herbei. »Ihr Puls nähert sich der Obergrenze, die der Arzt festgelegt hat. Bitte atmen Sie folgendermaßen tief durch: ein … aus … ein … aus!«
Carlo Magno schlug mit dem Gehstock nach dem Apparat.
Sahara schickte eine neue Nachricht, Marisa lehnte die Stirn an die Wand. Warum war alles immer so schwierig? Sahara schickte eine zweite und eine dritte Nachricht, und dann glühte ihr Symbol schwach rot. Marisa blinzelte es an, und die Nachrichten explodierten auf ihrem Bildschirm.
Ach herrje.
Siehst du das?
MARI, SIEHST DU DAS?
Marisa runzelte verwirrt die Stirn und antwortete. Was soll ich sehen?
Sieh nur, Don Francisco!
Marisa wandte sich um und suchte in der Menge nach ihm, aber es wimmelten zu viele Menschen in seiner Nähe umher. Sie drehte den Kopf hierhin und dorthin und versuchte herauszufinden, was Sahara in solche Aufregung versetzte. Schließlich stieg sie neben ihrem Vater auf die Bank. Rings um die Maldonados war ein freier Raum entstanden, und dort redete eine Frau mit Francisco.
Eine Frau, die ihm ein Abzeichen unter die Nase hielt.
»Was soll das?«, schimpfte Carlo Magno. »Komm wieder herunter, bevor dich ein Lehrer sieht!«
»Das ist ein Cop.« Marisa fragte sich immer noch, was dort eigentlich vorging. »Don Francisco redet mit einer Polizistin.«
»Er redet dauernd mit Polizisten«, erklärte Carlo Magno. »Die Cops sind praktisch seine Privatarmee. Sein Sohn leitet die Wache im Ort.«
»Aber sie stammt nicht aus Mirador«, entgegnete Marisa. »Ich kenne alle Polizisten aus unserem Viertel. Sie trägt auch keine Uniform, und sie wirkt nicht sonderlich erfreut.«
»Außer Dienst?«, fragte Bao.
»Sie zeigt ihm das Abzeichen«, entgegnete Marisa.
Hab sie gefunden, sendete Sahara. Ich habe bei der Datenbank der Polizei von Los Angeles eine Bildsuche gestartet. Sie heißt Kiki Hendel und arbeitet bei der Mordkommission in der Innenstadt.
Was will sie hier?, sendete Marisa zurück.
Woher soll ich das wissen?
»Vielleicht haben sie ihn endlich erwischt«, überlegte Carlo Magno. »Vielleicht kriegen sie ihn wegen irgendeiner Sache dran. Womöglich wegen der Steuern. So haben sie auch Al Capone geschnappt.«
»Wen?«, fragte Pati.
»Tā mā de«, flüsterte Bao, der auf der anderen Seite auf die Bank gestiegen war. »Sie führt ihn ab.«
»Was?« Carlo Magno stand so schnell auf, dass die Bank aus dem Gleichgewicht geriet. Marisa und Bao mussten abspringen, um nicht zu stürzen. Die Bank fiel klappernd um, und Carlo Magno richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Haben sie ihn verhaftet?«
»So hat es nicht ausgesehen.« Bao bemühte sich, die Bank wieder aufzurichten. »Sie … sie begleitet ihn nur nach draußen.«
Ich blick da nicht mehr durch, sendete Sahara.
Ich auch nicht, antwortete Marisa.
Mal sehen, ob ich Cameron nach draußen schicken und ihn beobachten kann, schrieb Sahara. Sofort stieg auf der anderen Seite des Raums eines von Saharas kleinen Kameranulis auf und sauste zur Tür.
»Ich forsche mal online nach.« Marisa blinzelte auf ihr Djinni. »Leute, sucht nach allem, was euch einfällt. Nachrichtensendungen hier aus der Stadt oder über ihr Anwesen in Mirador, ihre Besitztümer, ihre Vollstrecker oder was auch immer.« Sie durchsuchte bereits das Internet und forschte in den lokalen Nachrichtenblogs.
Warte, sendete Sahara. Wie hieß noch mal seine Frau?
Zenaida, antwortete Marisa. Aber über die wirst du nichts finden. Sie ist vor fünfzehn Jahren gestorben.
Bist du sicher?
Marisa hielt erschrocken inne.
Das LAPD hat ihre Hand gefunden, fuhr Sahara fort. An einem Tatort in South Central. Ihre linke Hand, am Handgelenk abgetrennt, lag auf dem Boden.
Marisa konnte sich nicht rühren. Sie begriff kaum, was Sahara als Nächstes schrieb.
Ich weiß nicht, was vor fünfzehn Jahren passiert ist, aber gestern Abend hat Zenaida noch gelebt.
Kapitel 2
»Das ändert alles«, stellte Sahara fest. Sie hatte ihr eigenes Programmierprojekt im Stich gelassen – eine App, mit der man neue Modetrends in Echtzeit verfolgen konnte – und war zu Marisa im hinteren Teil des Raums gekommen. Die Bank stand wieder, wo sie hingehörte, und Marisa saß dort wie verdattert. Sahara versuchte, sie zu beruhigen. »Das ändert wirklich alles.«
»So kannst du mich kaum beruhigen«, hielt Marisa ihr entgegen.
»Tut mir leid«, erwiderte Sahara. Sie trug ein hellgelbes Kleid mit hohem Kragen und langen Ärmeln, aber freien Schultern. Auf die nackte Haut hatte sie dunkelrote Blumen gesprüht, im Haar trug sie rote und gelbe Blüten. Die warmen Farben bildeten einen wundervollen Kontrast zu Saharas dunkelbrauner Haut, und die ganze Aufmachung war perfekt geeignet, den Wert ihrer Mode-App zu unterstreichen. »Worüber sollen wir stattdessen reden? Über Alain? Hast du mal wieder etwas von ihm gehört?«
»Lass uns lieber über Don Francisco reden!«, erwiderte Marisa. »Warte mal … wo ist Pati?«
»Draußen bei Bao«, antwortete Sahara. »Sie schwebt fast vor Verzückung, also beruhige dich!«
»Und mein Dad?«
»Drei Meter neben dir. Er telefoniert mit deiner Mom und schimpft über sein Nuli.«
Marisa drehte sich um. Tatsächlich, Carlo Magno saß ganz in der Nähe auf einer anderen Bank und lamentierte auf Spanisch, während er mit dem Stock das Pflegenuli abwehrte. Er redete mit Guadalupe, Marisas Mutter, aber er benutzte das Djinni, sodass er aussah wie ein Verrückter, der seine Roboterfrau anbrüllt. Marisa musste über das Bild lachen, und das löste endlich die blockierten Gefühle. Ein paar Sekunden später heulte sie in die Blumen auf Saharas Schulter.
»Sch…scht«, machte Sahara und rubbelte ihr den Rücken. »Schon gut.«
»Sie hat die ganze Zeit gelebt«, sagte Marisa. »Ich dachte mein Leben lang, sie sei tot, aber …«
»Was bedeutet das?«, wollte Sahara wissen.
»Ich … keine Ahnung«, gestand Marisa. »Ich glaube, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Der Unfall hat mein ganzes Leben bestimmt. An diesem Tag begann der Streit zwischen meinen Eltern und den Maldonados. Das hat alles andere überschattet, und dabei war es eine Lüge.«
»Sie haben Don Francisco in die Innenstadt gebracht«, berichtete Sahara. »Ich konnte es über Cameron beobachten.«
»In Handschellen?«
Sahara schüttelte den Kopf. »Sie hat ihn nicht verhaftet, sondern nur … mitgenommen. Wahrscheinlich wird er befragt.«
»Glaubt die Polizei, dass er etwas weiß?«, überlegte Marisa. »Hat er seine Frau fünfzehn Jahre lang versteckt und ihr … und ihr dann die Hand abgehackt? War ihm überhaupt bekannt, dass sie noch lebt?«
»Das können wir nicht wissen. Wahrscheinlich erfahren wir es erst, wenn etwas in den Nachrichten kommt«, antwortete Sahara.
Marisa richtete sich auf und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus dem Gesicht. »Wir könnten die Überwachungskameras der Polizeiwache hacken.«
»In den nächsten zehn Minuten?«, fragte Sahara. »Du bist gut, aber nicht so gut.«
»Oder wir könnten … ich weiß auch nicht. Wir könnten Omar anrufen«, sagte Marisa.
»Ist das dein Ernst?«, entgegnete Sahara. »Ich glaube, Omar Maldonado hat gerade genug Sorgen, nachdem die Hand seiner Mutter wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Außerdem … wie oft hat uns dieser Drecksack schon hereingelegt?«
»Früher waren wir mal Freunde. Vielleicht … vielleicht versteht er es.«
»Ihr wart kleine Kinder«, gab Sahara zu bedenken. Wieder rubbelte sie über Marisas Rücken. »Hab etwas Geduld! Wir werden es bald erfahren.«
»Bald genug?« Noch einmal rieb Marisa sich die Augen, dann hob sie entsetzt die Hand. »Habe ich gerade meine Mascara verschmiert? Jetzt sehe ich bestimmt aus wie ein Waschbär.«
»Der schärfste Waschbär, der mir je begegnet ist«, versicherte ihr Sahara. Sie stand auf und zog Marisa hinter sich her.
»Wohin willst du?«
»Gleich beginnt die Preisverleihung«, erklärte Sahara. »Wir wollen doch nicht verpassen, wie ich im Programmieren gegen Rosa Sanchez verliere.« Sie zerrte Marisa durch die Menge, bis sie Rektor Layton entdeckten, der unsicher vor einem Mikrofonnuli stand. Die beiden stellvertretenden Rektoren warteten hinter ihm. Anscheinend hatte er schon die übliche Litanei absolviert und allen Lehrern, den freiwilligen Helfern und den Vertretern der Schulbehörde gedankt. Marisa war inzwischen wieder einigermaßen bei Sinnen und empfand eine ironische Dankbarkeit, dass ihr die erschütternde Neuigkeit den Sermon erspart hatte. Nun begann Rektor Layton mit der ersten Kategorie – Chemie –, sodass Marisa nicht weiter auf ihn achten musste, während sie nach Nachrichten über Zenaida suchte. Sie fand mehrere Newsblogs, die verschiedene Morde erwähnten. Mordfälle waren in Los Angeles allerdings nichts Ungewöhnliches. Sie überflog die Berichte, bis sie den fand, den sie suchte – eine abgetrennte Hand in South Central. Auch nachdem sie die richtige Geschichte gefunden hatte, war sie keineswegs sicher, dass der Artikel brauchbare Informationen enthielt. Blabla … Schießerei, blabla … gefährliches Stadtviertel, blabla … Bandenaktivitäten. Sie verfeinerte die Suche und entdeckte eine Aufnahme, die ein Gaffer mit dem Djinni gemacht hatte. Auch dort fand sie jedoch keine nützlichen Hinweise. Mindestens vier Männer und Frauen waren an der Schießerei beteiligt gewesen, aber aufgrund der großen Entfernung konnte sie die Gesichter nicht erkennen.
»Klatschen!«, flüsterte Sahara.
Marisa reagierte sofort und blinzelte auf das Video, um es anzuhalten und sich wieder auf die Cafeteria zu konzentrieren, wo gerade höflicher Applaus aufbrandete.
»Was ist passiert?«, fragte Marisa.
»Sandro ist in seiner Kategorie Dritter geworden«, berichtete Sahara.
»Jaaaa!«, rief Marisa viel lauter als vorher. »Ándale, moreno! Viva la lechuga!«
Sandro nahm die Urkunde vom Rektor entgegen, drehte sich um und lächelte Marisa an. Sie jubelte noch einmal und beugte sich zu Sahara hinüber.
»Hast du auch gewonnen?«
»Wenn ich irgendetwas gewinne, erfährst du es sofort. Versprochen.«
»Das glaube ich gern«, entgegnete Marisa. »Hast du denn verloren?«
»Das wirst du gleich erfahren. Meine Kategorie ist die nächste.«
»Ich gebe ihnen zwanzig Sekunden«, erklärte Marisa. »Dann sehe ich mir das Video noch einmal an.«
Tatsächlich dauerte es vierzig Sekunden, bis die Sieger des Programmierwettbewerbs verkündet wurden. Sahara hatte gegen Rosa Sanchez verloren. Marisa umarmte ihre Freundin, sah sich noch einmal das Video der Schießerei an und knurrte enttäuscht. Es zeigte so gut wie nichts.
»Beruhige dich!« Sahara fasste Marisa sacht an den Schultern. Dann schob sie sich ins Blickfeld ihrer Freundin. Marisa sah sie an, und nun erst sprach Sahara weiter. »Atme tief durch, ja? Fühlst du dich jetzt besser?«
»Kommt drauf an. Besser als was?«
Sahara drückte ihr noch einmal beruhigend die Schultern. »Du wirst es schon herausfinden. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Früher oder später wirst du alles erfahren. Dann kennst du die ganze Geschichte. Du hast auch diesen Grendel, diesen Hacker aus dem Darknet, mehrere Monate lang gejagt, um die Informationsbröckchen über den Unfall und deine Vergangenheit zu bekommen, über die er verfügte. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Du musst nicht auf die Jagd gehen, du musst nicht ausrasten, du musst einfach nur durchatmen, ruhig bleiben und warten.«
»Grendel ist nicht der Einzige, der weiß, was damals passiert ist.« Marisa blickte zu ihrem Vater hinüber, der sich immer noch am Telefon ereiferte. »Mein Dad weiß es auch.« Wieder einmal erschrak sie über ihren Zorn, weil er ihr nichts über den Unfall erzählen wollte. Als hätte die Neuigkeit einen Schorf von ihren Gefühlen gerissen und eine frische Wunde freigelegt.
»Du wirst es bald herausfinden«, prophezeite Sahara. »Ob er es dir nun verraten will oder nicht.«
Marisa ließ ihren Vater nicht aus den Augen. »Wie bald?«
Auf einmal fuhr ihr Vater auf.
»Disculpe, corazón«, sagte er leise. »Ich bekomme gerade einen anderen Anruf.« Er blinzelte, beendete das Gespräch mit Guadalupe und warf Marisa einen kurzen Blick zu, bevor er wieder blinzelte. »Mándame«, sagte er energisch. »Hier ist Carlo Magno Carneseca.«
Marisa ging einen Schritt auf ihn zu, als könne sie den Anruf, der direkt in die Hörnerven eingespeist wurde, besser verfolgen, wenn sie ihrem Vater näher war. Er sah sie kurz an und wandte sich ab.
»Ja«, sagte er, lauschte einen Moment lang und sagte noch einmal: »Ja.«
»Papi?«, fragte Marisa.
»Heute Abend?«, fragte Carlo Magno. »Nein, das kommt nicht infrage. Ich bin auf dem Wissenschaftswettbewerb meines Sohns.« Wieder eine Pause. »Ja, das habe ich gesehen. Nein, ich habe es doch schon gesagt, das ist völlig …« Wieder eine Pause. »Gut. Ich komme, so schnell ich kann.«
Er blinzelte noch einmal und seufzte.
»Papi?«, fragte Marisa. »Wer war das?«
»Du kommst nicht mit«, erklärte Carlo Magno.
Marisa ging weiter auf ihn zu, da ihr Verdacht neue Nahrung fand. »War das die Polizei? Sie wollen auch dich befragen, oder? Weil du weißt, was passiert ist.«
»Du kommst nicht mit«, wiederholte er entschlossen.
»Du kannst nicht allein dorthin«, wandte Marisa ein. »Die Ärzte sagen, einer von uns muss jederzeit bei dir sein.«
»Du bringst die Mädchen nach Hause.«
Marisa verschränkte die Arme vor der Brust und suchte seinen Blick. »Sahara, würde es dir etwas ausmachen, meine Schwestern nach Hause zu bringen?«
»Bin schon dabei«, antwortete Sahara.
Carlo Magno schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Ich habe dir gesagt, dass du nicht mitkommst, und dabei bleibt es. Endgültig!«
In Marisas Gesichtsfeld erschien ein Polizeiabzeichen. Bei dem Anblick blieb ihr fast das Herz stehen. Warum rief die Polizei sie an? Sie fing sich wieder, starrte auf das Symbol und blinzelte es an. Den Ton leitete sie auf einen kleinen externen Lautsprecher, der in den Metallarm eingebaut war. So konnte ihr Vater das Gespräch mithören.
»Hallo?«, sagte sie.
»Marisa Carneseca?«, sagte jemand am anderen Ende. »Hier ist Kiki Hendel, ich bin Detective beim LAPD. Haben Sie einen Moment Zeit, um mir einige Fragen zu beantworten?«
Es war die Frau, die Don Francisco persönlich abgeholt hatte. »Natürlich«, antwortete Marisa. »Aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich war erst zwei Jahre alt, als sie starb … oder als sie verschwand … oder was auch immer.«
Die Stimme der Frau klang nach müder Belustigung. »Anscheinend machen Neuigkeiten schnell die Runde. Sind Sie auch auf dieser Schulveranstaltung?«
»Das ganze Stadtviertel ist da.«
»Dann können Sie und Ihr Vater zusammen kommen«, verlangte die Frau. »Ich hätte ihm gleich sagen können, dass er Sie mitbringen soll, aber ich habe selbst eine jugendliche Tochter, die sich in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht mit mir blicken lässt. Wie gut, dass es noch Familien gibt, die zusammenhalten!«
»Genießen Sie es, solange es so bleibt«, entgegnete Marisa. »Mein Dad hat mich vermutlich schon enterbt, bis wir auf der Wache eintreffen, aber wir kommen gleich.«
»Bis dann.« Die Beamtin trennte die Verbindung.
»Ich empfehle dir mit jedem bisschen väterlicher Autorität, das ich noch habe, heute Abend zu Hause zu bleiben«, forderte Carlo Magno.
»Sie will mit mir reden«, erwiderte Marisa. »Was soll ich tun? Einem Cop sagen, dass er mich mal kann?« Sie schwieg einen Moment lang und sprach dann weiter. »Außerdem habe ich schon ein Taxi bestellt.«
Carlo Magno seufzte und betrachtete das Pflegenuli, als rechne er von dieser Seite mit Beistand. »Siehst du, womit ich mich herumschlagen muss?«
»Ihr Blutdruck ist anormal hoch«, erklärte Triste Chango. »Sie sollten etwas mit niedrigem Natriumgehalt essen und belastende Situationen meiden.«
Carlo Magno schlug mit dem Stock nach dem Nuli. »Schön«, sagte er und setzte sich zur Tür in Bewegung. »Dann wollen wir es hinter uns bringen.«
Die Polizeiwache in South Central Los Angeles war ein älteres Gebäude, das um 2020 renoviert worden war. Statt der hellen Farben und der 3-D-Projektionen, die Marisa aus den Filmen kannte, herrschten hier polierter Stahl und deckenhohe Fensterfronten vor. Es war ein altmodisches Design. Der Beamte am Empfang notierte die Namen, registrierte sie und ließ Marisa im Warteraum Platz nehmen, während Carlo Magno in einen der hinteren Räume komplimentiert wurde. Anscheinend wurde Don Francisco gleichzeitig in einem anderen Raum befragt. Sie hörte keine wütenden Schreie, also wussten die beiden offenbar nichts von der Anwesenheit des anderen.
Es war schon fast zehn Uhr abends, aber auf der Wache herrschte immer noch Hochbetrieb. Beamte, Detectives und Nulis zogen zielstrebig durch die Gänge und waren viel zu beschäftigt, um Notiz von Marisa zu nehmen oder gar ihre Fragen zu beantworten. Sie biss sich auf die Zunge und überwand sich, äußerlich ruhig zu bleiben. Dabei dachte sie auch an Saharas Bemerkung, dass sie bald die Einzelheiten erfahren werde. Nach einer Weile kehrte der Empfangsbeamte mit einem jungen Mann zurück und wies ihn an, zusammen mit Marisa zu warten.
Es war Omar Maldonado.
»Hallo«, sagte Marisa.
»Hallo.«
Sie war immer unsicher, wenn sie Omar begegnete. Als Kinder waren sie Freunde gewesen, obwohl es die Väter nicht wissen durften, weil die beiden Männer einander gehasst und auch den Kindern jeglichen Kontakt untereinander verboten hatten. Dann waren sie älter geworden, und Omar hatte sich in die Geschäfte des Vaters eingeschaltet. Marisa hatte in ihm etwas bemerkt, das sie … vielleicht konnte sie es am besten als Maskerade bezeichnen. Ein Gefühl, als sei alles, was er sagte, nur gespielt, genau wie die elegante, vertrauenswürdige Präsentation einer Website voller Malware. Er sah teuflisch gut aus – wenigstens das vermochte sie einzuschätzen, ganz egal, was er sagte oder tat. Aber sie durfte ihm keinesfalls vertrauen. Er hatte Marisa und ihre Freunde mehrfach betrogen, manchmal auf schreckliche Weise, aber er hatte ihnen auch geholfen, sie sogar einmal vor dem Tod bewahrt und dabei das eigene Leben aufs Spiel gesetzt. Was Marisa am stärksten zusetzte, war die Tatsache, dass sie im Guten wie im Schlechten nie sicher sein konnte, was er wirklich wollte. Wie oft mochte seine Unterstützung eine genau berechnete Geste sein, um ihre Gunst zu gewinnen?
Er nutzt uns alle aus, sagte sie sich. Einmal ein Maldonado, immer ein Maldonado.
Sie sah ihn an, wie er da im hellen Licht der stahlgrauen Polizeiwache saß, und entdeckte etwas in seiner Miene, das sie dort noch nie bemerkt hatte. Sie hatte ihn freundlich, zornig, doppelzüngig, charmant erlebt – oh, und wie charmant! –, aber an diesem Abend erkannte sie zum ersten Mal, dass er Angst hatte.
Sie wollte ihn fragen, ob alles in Ordnung sei, aber wäre das wirklich richtig gewesen? Was sollte er darauf schon antworten? Er hatte seine Mutter für tot gehalten und gerade eben herausgefunden, dass sie doch noch lebte … dass sie vielleicht tatsächlich gestorben oder zumindest verstümmelt war. Die Mutter war in keinem Krankenhaus aufgetaucht. War sie jetzt tatsächlich tot? War sie dieses Mal wirklich gestorben? In wie viele Stücke hatte man sie zerlegt? Marisa wurde übel, wenn sie nur daran dachte. Sie überwand sich und sprach ruhig, und sei es nur, um die Stimmen im Kopf zum Schweigen zu bringen.
»Dann wollen sie auch mit dir reden, was?«
Omar hob den Kopf und sah sie zum ersten Mal an. Seine Augen hatten das gewohnte Funkeln verloren, aber sie waren nicht gerötet. Was ihn auch beschäftigte, er hatte nicht geweint. Sie war nicht sicher, ob er das überhaupt konnte.
»Nein«, antwortete er, und als er auf dem Stuhl herumrutschte, schien sich wieder eine Maske vor sein Gesicht zu legen, die die Angst und Verletzlichkeit verbarg und durch eine aalglatte, liebenswürdige Ruhe ersetzte. »Ich bin nur für den Fall hier, dass mein Vater etwas braucht. Ich nehme an, du bist aus dem gleichen Grund gekommen, oder?«
Marisa verdrehte die Augen. »Mein Papa schneidet sich lieber die Leber heraus, als mich um Hilfe zu bitten. Er will nicht, dass ich überhaupt hier bin, und hat im Taxi kein Wort mit mir gesprochen.«
»Aber du bist trotzdem gekommen.« Er deutete auf sie. Die Geste kam ihr aus irgendeinem Grund ungeheuer eigenartig vor. »Das nenne ich Treue.«
»Sag ihm das! Wenn die Cops nicht verlangt hätten, dass ich mitkomme, dann hätte er mich in der Schule an einen Tisch gekettet.«
Omar zog die Augenbrauen hoch. »Haben sie dich wirklich herbestellt? Die Cops, meine ich?«
»Ja, sie … sie wollen mit mir reden.« Sie runzelte die Stirn. »Mit dir nicht? Wir saßen an diesem Tag doch beide in dem Auto.«
»Aber wir waren zu jung, um uns an irgendetwas zu erinnern«, wandte Omar ein. Er beugte sich vor. Sie konnte beobachten, wie sich hinter der Fassade die Rädchen im Kopf drehten. »Sie wollen mit meinem Vater und mit Sergio reden, aber Franca und ich sind raus.«
»Und Jacinto?«
Die Frage tat er mit einem Kopfschütteln ab. »Der scheidet sowieso aus. Vielleicht wollen sie später doch noch mit ihm reden, aber … Mari, du warst damals zwei Jahre alt. Was wollen die bloß von dir?«
»Ich …« Marisa schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich dachte, ich wüsste es, aber wenn sie dich nicht befragen, dann …« Sie zuckte mit den Achseln. »Vielleicht wussten sie, dass Papi krank ist und eine Begleitung brauchte?« Diesen Gedanken verwarf sie sofort wieder. Die Polizistin hatte am Telefon gesagt, sie wolle auch Marisa einige Fragen stellen.
»Sie ist letzte Nacht zu mir gekommen«, erklärte Omar.
Marisa sah ihn verblüfft an. »Was? Deine Mutter hat dich besucht?«
»Nein, ich meine nicht …« Er stockte und starrte auf die Wand. »Sie ist nicht persönlich gekommen, sie ist mir im Traum erschienen. Oder ich bin im Traum zu ihr gegangen, und sie wollte weg. Sie ist gelaufen, immer gelaufen und hat sich über die Schulter umgedreht. Sie hat mich gesehen, sich wieder nach vorn gedreht und ist weitergelaufen. Sie ist gerannt und gerannt. Ich dachte, sie sei voller Angst oder auch wütend. Vielleicht wollte sie einfach nur schnell wegkommen. Aber sie wollte nicht, dass ich bei ihr war, und deshalb ist sie weggelaufen, und jetzt ist sie …«
Marisa beobachtete ihn und war verblüfft über den Schmerz, der aus seiner Stimme sprach. Wann hatte sie das letzte Mal bei Omar eine echte Gefühlsregung gesehen, ganz zu schweigen von Kummer? »Es tut mir leid«, sagte sie schließlich. »Das ist übel.«
Er lachte auf, ein kurzes, geringschätziges Geräusch. »Ja.«
»Das Gehirn ist manchmal ein dummes Ding.«
Er sah sie an und schien etwas erwidern zu wollen, blieb aber stumm.
»Warum ist sie gerannt?«, fragte Marisa. »Im Traum weiß man das eigentlich.«
»Nicht in diesem«, antwortete Omar.
»Tut mir leid«, wiederholte Marisa. »Das ist übel«, murmelte sie dann noch einmal. Was sollte sie sonst sagen?
Bevor ihr eine bessere Antwort einfiel, brachte der Empfangsbeamte eine dritte Person in den Wartebereich – eine unglaublich attraktive, etwa dreißig Jahre alte Frau. Sie hatte glänzendes dunkles Haar, und das Gesicht war wie aus feinstem Porzellan modelliert. Sie war auf eine Weise schön, die nur selten zu sehen war – eher wie ein Wesen aus einem Traum und nicht wie ein lebendiger Mensch. Sahara wäre sofort auf sie abgefahren, und sie nahm an, dass die Frau auch auf Omar höchst anziehend wirkte. Sie sah ihn von der Seite an und stellte fest, dass dem so war. Ja, er beobachtete sie, blieb aber äußerlich unbewegt – eher eine vorsichtige Einschätzung als die hemmungslose Bewunderung, mit der sie gerechnet hatte. Er legte seine Maske nicht ab. Marisa betrachtete wieder die Frau und bemühte sich, sie möglichst unauffällig näher in Augenschein zu nehmen. Es war schwer, irgendetwas anderes außer dem Gesicht zu sehen. Die Kleidung trat demgegenüber völlig in den Hintergrund. Die Fremde war ganz in Schwarz gekleidet – schwarze Hose, schwarze Kostümjacke, obendrein sogar noch schwarze Handschuhe. Wer trug denn im Sommer in Los Angeles Handschuhe? Die Frau wirkte selbstbewusst und gefasst. Vielleicht eine leitende Angestellte oder eine Geschäftsführerin.
Umgekehrt würdigte die Frau Marisa oder Omar keines Blickes, sondern beobachtete die Bürotüren, hinter denen Carlo Magno und Don Francisco befragt wurden.
In Marisas Blickfeld tauchte eine Nachricht von Omar auf, die sie blinzelnd öffnete.
Weißt du, wer das ist?
Nein, sendete sie zurück. Und du?
Keine Ahnung.
Noch einmal betrachtete Marisa die Frau. Sie blinzelte, um für ihre Freundinnen ein Foto zu machen, aber dann hielt sie inne, sah sich das Foto an und beschloss, es noch einen Schritt weiter zu treiben. Da sie die gebuchte Bandbreite kaum ausnutzte, konnte sie auch ein Video in Echtzeit senden. Wieder blinzelte sie und richtete ihr Djinni für das Streamen ein. Dann schickte sie Sahara und ihrer Freundin Anja eine Nachricht.
Fijense esta mamita.
Die erste Antwort kam von Sahara. Verdammt, was soll das jetzt heißen?
Blinzle einfach auf den Videofeed.
Na gut, antwortete Sahara. Ihre ID erschien im Streamingfenster, worauf fast sofort eine weitere Nachricht im Chat folgte. O Mann, Mari, warum treibe ich mich nicht öfter auf Polizeiwachen herum? Sie ist hinreißend.
Sag ich doch.
Sie kann nicht echt sein.
Marisa bewegte ganz leicht den Kopf, damit der Videofeed den ganzen Raum erfasste. Siehst du? Ich bin wirklich auf der Wache. Sie ist eine reale Person.
Oje, sagte Sahara. Ist das Omar?
Ja, er ist mit seinem Dad hier.
Verpass ihm einen Tritt.
Komm schon, Sahara, seine Mom ist gerade gestorben.
Hat ihr Tod ihn durch irgendeinen Zauber in einen anständigen Menschen verwandelt?
Anja schaltete sich mit einem völlig unverständlichen deutschen Satz in den Chat ein: Ich beschlagnahme Eichhörnchen.
Wie war das?, fragte Marisa.
Tut mir leid, sendete Anja zurück. Ich dachte, wir spielen Willkürliche Sätze in einer Sprache, die die Freunde nicht beherrschen.
Ay, que feas, antwortete Marisa. Ihr wohnt in LA und sprecht nicht mal Spanisch? Habt ihr im Djinni keinen Autoübersetzer laufen? Wie könnt ihr damit überleben?
Und du hast keinen für Deutsch eingerichtet, gab Anja sofort zurück. Sonst wüsstest du, wie man Eichhörnchen beschlagnahmt.
Ich glaube, Anja drückt sich in keiner Sprache verständlich aus, bemerkte Sahara.
Würg, antwortete Marisa. Blinzle auf den Link, huera.
Anjas ID erschien im Streamingfenster. Boah, schrieb sie. Was für eine heiße Braut.
Ja, das sage ich doch, sendete Marisa zurück. Hast du eine Ahnung, wer sie ist?
Ein Model?, fragte Sahara. Eine Schauspielerin?
Vielleicht ist sie Anwältin, überlegte Anja.
Sie ist jedenfalls nicht Don Franciscos Anwältin, antwortete Marisa. Omar kennt sie auch nicht.
Hast du Omar etwa vor uns gefragt?, wollte Anja wissen.
Zeig es ihr, schlug Sahara vor.
Wieder bewegte Marisa den Kopf und sah Omar an.
Arsch, sendete Anja. Reintreten.
Marisa verdrehte die Augen. In der Polizeiwache geht das nicht.
Schade, kommentierte Sahara. Die Polizeiwache ist einer seiner empfindlichsten Körperteile.
Wartet mal. Marisa blickte zu einer Bürotür hinüber. Es klickte, der Knopf drehte sich. Dann trat Carlo Magno heraus und wirkte sogar noch wütender als zuvor. Detective Hendel folgte ihm. Sie trug Hemd und Fliege, einen langen Rock und ein Kopftuch. Eine Muslima? Marisa schüttelte den Kopf. Dem Namen nach hätte sie vermutet, dass die Beamtin eine orthodoxe Jüdin war.
»Noch einmal vielen Dank für Ihre Zeit, Mister Carneseca.« Sie gab Carlo Magno die Hand, der widerwillig einschlug. »Möchten Sie hier warten, während ich mit Ihrer Tochter spreche?«
»Auf gar keinen Fall!«, brüllte Carlo Magno. »Ich habe Ihnen schon alles gesagt. Sie weiß nicht mehr als ich, und deshalb fahre ich jetzt mit ihr nach Hause.«
»Mister Carneseca«, setzte die Polizistin an, doch bevor sie weitersprechen konnte, trat die schwarz gekleidete Frau dazwischen und schüttelte der Polizistin energisch die Hand.
»Guten Abend, Detective Hendel. Ich bin Ramira Bennett. Wir haben vorhin telefoniert.«
»Ja, Miss Bennett. Wenn Sie sich bitte setzen wollen, dann werde ich …«
»Ich fürchte, meine Auftraggeber möchten keine Zeit vergeuden«, widersprach Bennett. Sie ließ die Hand der Polizistin nicht los und manövrierte Hendel geschickt zum Büro zurück. »Meine Fragen nehmen nicht viel Zeit in Anspruch, und danach können Sie die Befragungen fortsetzen.«
Sie ist hier, um der Polizistin Fragen zu stellen?, staunte Sahara. Jetzt will ich aber wirklich gern wissen, wer sie ist.
»Ja«, sagte Carlo Magno, »reden Sie mit ihr. Ich nehme meine Tochter mit und fahre nach Hause.«
»Nein«, widersprach Detective Hendel.
»Papi, mach keine Szene!«, sagte Marisa im gleichen Augenblick.
»Ich mache keine Szene!«
Er macht eindeutig eine Szene, warf Anja ein.
»Sir.« Ramira Bennett richtete nun die volle Aufmerksamkeit auf Carlo Magno, obwohl sie, wie Marisa bemerkte, der Polizistin immer noch den Weg versperrte. »Wenn Sie und Ihre Tochter einen Moment warten wollen, will ich sehen, wie ich Ihnen helfen kann.«
Carlo Magno stammelte etwas. Entweder schockierte ihn das Hilfsangebot, oder es lag an der überwältigenden Symmetrie ihres Gesichts. Jedenfalls hatte sie Detective Hendel schon wieder ins Büro bugsiert und die Tür hinter sich geschlossen, bevor ihm auch nur ein Wort über die Lippen gekommen war.
Kapitel 3
Omar pfiff durch die Zähne. »Sie ist gut.«
»Cállate.« Carlo Magno deutete grimmig auf ihn und ging zu Marisa hinüber. Das Pflegenuli blieb ihm dicht auf den Fersen. »Vámonos.«
»Wir bleiben hier«, widersprach Marisa.
»Nein, das tun wir nicht.«
»Es ist wichtig.«
»Bildung ist wichtig«, erklärte Carlo Magno. »Die Familie. Oder das Rezept meiner Mutter für adobada. Das hier ist nur ein Spektakel, also gar nichts.«
Dein Dad ist wirklich komisch, sendete Sahara.
Halt den Mund, antwortete Marisa und zupfte ihren Vater am Ärmel, als er gehen wollte. »Papi, setz dich!«
»Ich will nicht, dass du mit ihr redest.«
Marisa ließ nicht locker. »Sag mir, was hier los ist!«
»Nichts ist los. Es ist vorbei.«
Schau mal Omar an, sendete Anja. Ich will sehen, wie er auf all das reagiert.
»Halt den Mund!«, rief Marisa. Zu spät erkannte sie, dass sie die Aufforderung laut ausgesprochen hatte. »Entschuldige!« Sie riss die Augen weit auf. »Es tut mir leid, das war für Anja gedacht, nicht für dich.«
Carlo Magno hob beide Hände. »Schreibst du jetzt Nachrichten an deine Freundinnen? Kannst du nicht einmal das hier ernst nehmen?«
»Wieso hat der Chat mit meinen Freundinnen damit zu tun, dass ich etwas nicht ernst nehme?«
»Weil ich deine Freundinnen kenne«, erwiderte Carlo Magno.
Verbrenne, sendete Anja.
Marisa blinzelte auf das Fenster, beendete die Unterhaltung und schaltete alle Benachrichtigungen ab. »Wechsle nicht das Thema! Es geht hier nicht um meine Freundinnen, sondern um dich. Ich rede mit ihnen, weil du kaum zwei Worte zu mir sagen kannst, ohne dass ein Nein darin vorkommt.«
»Das ist nicht wahr.«
»Nicht ist eine andere Form von Nein.«
»Das ist nicht der Punkt, auf den es ankommt!«
»Da, schon wieder!«
»Nein, es …« Genervt ballte Carlo Magno die Hände zu Fäusten. »Mari, du …« Wieder hielt er inne, blickte zu Omar hinüber, senkte die Stimme und sprach weiter. »Du musst das verstehen. Ich bitte dich um etwas, das dir schwerfallen wird, aber du musst es tun.«
Marisa runzelte die Stirn. Es traf sie, dass er auf einmal so ernst wurde. »Was denn?«, flüsterte sie zurück.
»Du musst mir glauben.«
Marisa seufzte und verdrehte die Augen. »Santa vaca.«
»Es ist mir ernst«, fuhr er fort. »Hör auf mich und sieh einmal im Leben ein, dass ein vierundvierzigjähriger Vater vielleicht doch mehr weiß als ein siebzehnjähriges Kind. Wenn ich dir etwas sage, verstehe ich manchmal die Auswirkungen und Begleitumstände besser als das Mädchen, auf dessen Erziehung und Schutz ich mein Leben verwende.«
»Wir sind auf einer Polizeiwache«, erwiderte Marisa. »Ich bin hier gut beschützt.«
»Vor Gewalt, ja«, erklärte Carlo Magno. »Manchmal tut Gewalt nicht so weh wie die Wahrheit.«
»Die Wahrheit macht uns frei«, hielt Marisa dagegen. »Das müssen wir uns jede Woche in der Kirche anhören.«
»Du bist schon frei.« Carlo Magno blickte zwischen Omar und Marisa hin und her, während er noch leiser weitersprach. Leise und sehr ernst. Flehend. »Wenn man die Vergangenheit ans Licht zerrt, dann ist das, als kratze man an einem Schorf herum. Solange du es tust, fühlt es sich gut an, weil du glaubst, du magst die Schmerzen. Dann aber blutet es, und es tut richtig weh, und selbst wenn es gut geht, bleibt immer noch eine Narbe zurück, die du nicht mehr loswirst. Und wenn du Pech hast, heilt es überhaupt nicht mehr, und du musst ewig bluten und an den Schmerzen leiden. Ich will nicht, dass du damit leben musst.«
Marisa war berührt, weil sich sein Tonfall so sehr verändert hatte, doch die Worte machten sie wütend, und die Diskrepanz zwischen den beiden Gefühlen brachte sie aus dem Gleichgewicht. »Papi …«
»Die Vergangenheit ist vorbei«, beharrte er.
Auf einmal flog die Bürotür auf, und Ramira Bennett stolzierte ruhig und herrisch heraus.
»Eine Unverschämtheit!«, schimpfte Detective Hendel.
Bennett sah sie nicht einmal an, sondern betrachtete eine Art Tablet, das sie in der Hand hielt. »Sie dürfen sich gern an Ihre örtliche Regierung wenden«, sagte sie. Dann tippte sie einige Male auf den Bildschirm und schob ihn in die Brusttasche ihres Anzugs. »So sind die Gesetze, und Sie werden sich daran halten.«
»Sie gehen mir auf den Wecker«, antwortete Hendel.
Marisa hätte nur zu gern gewusst, worüber die beiden sich stritten. Sie musste sich sehr beherrschen, um nicht mit irgendetwas herauszuplatzen, und hielt sich am Arm ihres Vaters fest.
Hendel kochte, knirschte mit den Zähnen und wandte sich an den Empfangsbeamten. »Lopez! Geben Sie Miss Bennett das Beweisstück, das wir in dem Fall Nummer neun-sieben-fünf sichergestellt haben«, rief sie zornig.
Der Beamte blinzelte und ging offenbar auf dem Djinni eine Liste mit Fällen durch, dann blinzelte er noch einmal vor Überraschung. »Die … die Hand, Madam?«
»Ja«, fauchte Hendel. »Die Hand.«
»Das ist ein Beweisstück in einer laufenden …«
»Bundesgesetz 7o.3482«, unterbrach Bennett. »Sie haben an der Hand eine Blutuntersuchung durchgeführt und damit die Rechte meines Auftraggebers verletzt. Damit haben Sie sich strafbar gemacht, auch wenn es sich um einen Vorgang in einer laufenden Ermittlung handelt. Dies geht aus Unterartikel 2.6r4 hervor. Wenn Sie mir die Hand sofort übergeben, verzichten wir auf eine Anklage.«
Der Empfangsbeamte sah zwischen Bennett und Hendel hin und her. »Ich muss mit der Chefin reden.«