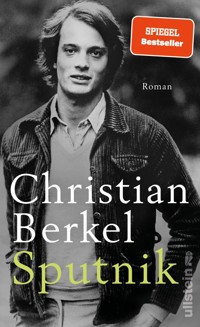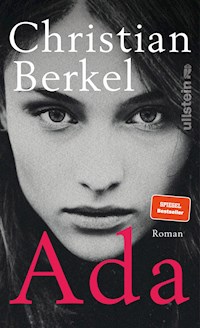
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wirtschaftswunder, Mauerbau, die 68er-Bewegung – und eine vielschichtige junge Frau, die aus dem Schweigen der Elterngeneration heraustritt. In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirtschaftswunder sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will endlich ihren Vater – aber dann kommt alles anders. Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse erzählt Christian Berkel von der Schuld und der Liebe, von der Sprachlosigkeit und der Sehnsucht, vom Suchen und Ankommen – und beweist sich einmal mehr als mitreißender Erzähler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ada
Der Autor
CHRISTIAN BERKEL, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u.a. mit dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Sein Debütroman Der Apfelbaum wurde von Kritikern und Lesern gleichermaßen gefeiert.
Das Buch
Christian Berkel erzählt die Geschichte von Ada: Mit ihrer jüdischen Mutter aus Nachkriegsdeutschland nach Argentinien geflohen, vaterlos aufgewachsen in einem katholischen Land, kehrt sie 1954 mit ihrer Mutter Sala nach Berlin zurück. In eine fremde Heimat, deren Sprache sie nicht spricht. Dort trifft sie auf den lange ersehnten Vater Otto, doch das Familienglück bleibt aus. In einer noch immer autoritär geprägten Gesellschaft wächst Adas Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Anknüpfend an den Apfelbaum taucht Christian Berkel in seinem neuen Roman ein in die dynamische Zeit der fünfziger und sechziger Jahre. Adas Weg, ihre Reise zu sich selbst, führt sie von Buenos Aires über die Studentenbewegungen von Berlin und Paris bis nach Woodstock.
Christian Berkel
Ada
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Alle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCoverabbildung: © Luc Kordas /Alamy Stock PhotoAutorenfoto: © Gerald von Foris
Quelle des Songtextes: »Eleanor Rigby« (Lennon/McCartney): Revolver, The Beatles, erschienen 5. 8. 1966 bei Parlophone, Seite A, Song 2.»Mama« (Bixio/Balz/Cherubini): Heintje, Heintje, erschienen 1968 bei Ariola, Seite A, Song 2.»Oh Mia Bella Napoli« (Siegel/Winkler): Rudi Schuricke singt Gerhard Winkler, Rudi Schuricke, erschienen 1959 bei Polydor, Seite A, Song 2.»Freedom (Motherless Child)«: (Traditional American Folk). Richie Havens. Woodstock: 3 Days of Peace and Music. USA 1970.Zitat Motto: »Sophokles.« Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Band 16. Hrsg. Michael Franz. Stroemfeld/Roter Stern 1988, S. 196.
E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comISBN: 978-3-8437-2337-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Erinnern
Das Traumbuch
Falscher Abgang
Im Auge des Zyklons
Am Anfang war der Brudermord
Die Kommode
Der Sündenfall
Satan
Exodus
Der Name des Vaters
Uschka
Andere Verhältnisse
Hitler
Lots Weib
Stimmen
Die Unzertrennlichen
Die Zeit mit Mopp
Tutti Frutti
Ein Traum
Die Rückkehr
Im Kreis der Lieben
Der Sputnik-Schock
Jenseits von Eden
Nod
Ein blattloser Stängel
Die Krankheit Tod
Der andere
Lots Tochter
Schneewittchen
Ein Besuch in Weimar
Das Ende vom Anfang
Zweiter Versuch
Philemon und Baucis
Geisterstunde
In der Bibliothek
Abbruch
Von Angesicht zu Angesicht
Weihnachten
Es
Die weiße Frau
Die Krise
II Wiederholen
1990 im Herbst
Die Steine, die alles ins Rollen brachten
Karneval der Tiere
Die Arche
Das Ende vom Anfang
Bonnie und Clyde
Eine Butterfahrt
Selbst Könige müssen sich entscheiden
Für eine bessere Zukunft
Frühling 1967
2. Juni 1967
Die Zauberflöte
Im Kreis der Lieben
III Durcharbeiten
1991 im Herbst
Paris
Dans la rue
93, Rue du Faubourg Saint Honoré
Ein Foto
Bar-Mizwa
Le Coup de Foudre
Die Reise
1993 im Frühling
Anhang
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Erinnern
Dieses Buch ist ein Roman, wenn auch einige seiner Charaktere erkennbare Vor- und Urbilder in der Realität haben, von denen das eine oder andere biografische Detail übernommen wurde. Dennoch sind es Kunstfiguren. Ihre Beschreibun-gen sind ebenso wie das Handlungsgeflecht, das sie bilden, und die Ereignisse und Situationen, die sich dabei ergeben, fiktiv.
Widmung
Für Andrea
Motto
Daß doch niemals du erkenntest, wer du bist.
Sophokles
Das Traumbuch
Ich hatte es verloren. Als junges Mädchen schrieb ich jeden Tag darin. Nicht nur Träume zeichnete ich auf. Einfach alles, was mir durch den Kopf ging. Und dann, eines Tages, nach einem meiner vielen Umzüge, war es verschwunden. Weg. In den nächsten Monaten suchte ich es überall. Ich kehrte das Unterste zuoberst, durchwühlte sogar die Mülltonnen. Hatte ich es wirklich verloren? Vielleicht sogar versehentlich weggeworfen? Bei der Suche fiel mir ein Hochzeitsfoto meiner zweiten Ehe in die Hand. Sie war kinderlos geblieben und irgendwann gescheitert. Wie so oft war ich weitergezogen, um meine Zelte woanders aufzuschlagen. Eine einsame Karawane. Ich und Ich. Dazwischen ein paar Orte. Von Trennung zu Trennung war ich mir verloren gegangen, jede Verbindung zu meiner Familie war gelöscht. Nichts war geblieben. Nichts und ein paar leere Koffer.
Erinnerungen an eine Liste aus den späten Fünfzigerjahren. Ein Spiel zwischen Uschka und mir, ein Zeitvertreib unter Heranwachsenden, der immer ernster wurde. Eine von uns warf ein Wort in den Raum, die andere nahm es auf, um den Faden weiterzuspinnen. Meistens fing meine Freundin Uschka an.
»Reisen.«
»Paris.«
»London.«
»Rom.«
»New York.«
»Was machst du in New York?«
»Spielen, eine Schauspielschule, nein, warte, eine … Modelschule.«
»Gibt’s das?«
»Weiß nicht. Weiter. Du bist dran, Ada, los, nicht einschlafen.«
»Was?«
»Was willst du beruflich machen?«
»Weiß nicht.«
»Egal, sag irgendwas.«
»Schöne Dinge.«
»Schöne Dinge?«
»Ja, vielleicht Mode. Irgendwas mit Menschen. Ich könnte deine Kleider entwerfen.«
»Designerin?«
»Kann ich das? Ich kann nicht mal zeichnen.«
»Man kann alles, was man will.«
»Alles?«
»Alles. Also. Was willst du?«
»Einen Mann.«
»Oh Gott, wie langweilig. Die kommen auch so. Muss man sich nicht wünschen.«
»Reisen. Überallhin. An Orte, wo noch niemand war. Gibt es so was?«
»Bestimmt.«
Ganze Nachmittage verbrachten wir damals so, sprangen von Ast zu Ast, während um uns herum die Häuser aus dem Boden schossen. Berlin wuchs schnell, grau und hässlich. Gab es in den Fünfzigerjahren so etwas wie ein Gefühl dafür, dass irgendetwas fehlte? Was war los in diesem Lummerland? Maikäfer flieg. Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist in Pommernland. Und Pommernland ist abgebrannt. Maikäfer flieg.
Der Maikäfer flog zu allen Gelegenheiten. Selbst meine Mutter trällerte das Lied beim Aufräumen oder Saubermachen. Es war, als gingen wir über eine Brücke, ohne es zu merken. Wohin? In unsere Vergangenheit? Ich glaube, dass wir gar keine Vergangenheit hatten. Zumindest versuchte jeder diesen Eindruck zu erwecken. Die Erwachsenen sprachen von der Stunde Null. Tabula rasa. Nicht nach uns die Sintflut, nein, wir waren die, die nach der Sintflut kamen. Wir wuchsen in den Trümmern auf, die man uns übrig gelassen hatte. Die meisten von uns sahen es nicht, weil sie es nicht anders kannten. Aber ich sah es, auch wenn ich es nicht verstand, weil ich aus Buenos Aires kam, wo es keine Bombenkrater gab. Dort tanzte die Sonne über den Dächern unversehrter Häuser. Deutschland war müde. Es roch nach Verwesung und Tod. Schweigend bauten die Menschen dieses Land wieder auf. Als kämen sie aus dem Nichts. Als hätte es vor der Stunde Null in diesem Land kein Leben gegeben. Selbst das Maikäferlied schlug von Erinnerung befreit mit seinen Flügelchen den Takt für die Zukunft. Niemand sprach. Weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte, war nichts geschehen. Aber ihre dumpfe Angst, es könnte sich wiederholen, erinnerte sie daran, dass da noch etwas war. Diese Angst wurde zu unserer Mitgift. Auf der Suche nach einem Ventil schleppten wir sie mit uns herum. Unsere Dichtungen waren defekt. Was in uns kochte, schoss eines Tages nach allen Seiten aus uns heraus.
Am Anfang war der Brudermord
Mit einem Schrei fing alles an, auch bei mir. Mein Name ist Ada. Geboren wurde ich unmittelbar vor Kriegsende, im Februar 1945, in Leipzig. Als Deutschland endlich am Boden lag. Um ein Haar wäre meine Mutter bei der Geburt verblutet. Der Gynäkologe, ein alter Naziprofessor übelster Sorte, entriss mich ihr nach sechsundzwanzig Stunden mit der Zange, was so klingt, als wollte sie mich nicht hergeben, oder nicht »loslassen«, wie man neumodisch sagt. »Eine echte Viecherei, als würde ein Lastwagen durch mich hindurchkacheln«, sagte sie.
Dieser Berliner Jargon ist eigentlich untypisch für eine Frau aus so gutem Hause, vielleicht war er der Sehnsucht nach meinem Vater geschuldet, der noch in russischer Gefangenschaft war und sich nach seiner Rückkehr weigerte, zu uns nach Argentinien zu kommen, wohin wir nach dem Ende des Krieges emigriert waren. Mein Vater »aus dem dritten Kreuzberger Hinterhof«, wie sie sagte und was je nach Tonlage bewundernd oder vernichtend klang. Ein Lastwagen also. Tja, und dieser Lastwagen auf der Durchreise in eine vor Kälte und Hunger schlotternde Welt, das bin ich. Aber nach mir kam noch etwas. »Platt wie ein Blatt«, rief die Hebamme erschrocken dem Naziprofessor zu. Dieses Blatt war mein toter Zwilling. Sein Geschlecht ließ sich nicht mehr ermitteln.
Ob mir dieser Beginn die Sprache verschlagen hatte? War mein Schrei ein Siegesschrei, weil ich die Konkurrenz noch vor der Geburt an die Wand der Gebärmutter gedrückt hatte? Hatte ich den Urkonflikt der Menschheit, den Brudermord, noch vor dem Anfang erledigt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht einmal, ob es ein Bruder oder eine Schwester war.
Jedenfalls wollte ich die ersten Jahre meines Lebens nicht sprechen. Angeblich verstand ich sehr bald jedes Wort, »aaaaber«, wie meine Mutter nicht müde wurde hervorzuheben, ich weigerte mich, ihr auch nur ein einziges Wort nachzusprechen. Das traf sie hart. Immerhin hatte man ihren Onkel schon im zarten Alter von siebenundzwanzig Jahren auf einen eigens für ihn geschaffenen Lehrstuhl für das neue Fach der Pädagogik an der Humboldt-Universität in Berlin gehievt, ihr Vater kannte Sigmund Freud persönlich und hatte Hermann Hesse analysiert, ihre jüdische Mutter war Psychiaterin und hatte ihrerseits Vater, Mutter und Franco, den spanischen Generalissimo überlebt. Bessere Voraussetzungen konnte es kaum geben. »Punktum«, würde sie jetzt sagen. Aber ich entpuppte mich von Anfang an als eine Enttäuschung, eine Blamage, wie sie schlimmer nicht sein konnte. Ich, das Kind einer unvorstellbar großen Liebe, einer Liebe, die kein Krieg, kein Gott, ja nicht einmal der kleine österreichische Maler kleingekriegt hatte, der Gefreite mit dem neckischen Oberlippenbart, der Hitler eben. Dieses Kind, also ich, konnte oder wollte nicht sprechen. Ich hatte mich scheinbar entschieden, nicht mitzumachen, zumindest kam es meiner Mutter so vor.
Die Kommode
Sie stand in unserem kleinen Schlafzimmer und übte eine besondere Anziehung auf mich aus. Das Anwesen, in dem wir in Buenos Aires lebten, gehörte nicht uns. Die Besitzer waren ein unvorstellbar reiches argentinisches Ehepaar, sie hießen Mercedes, ja, wie das deutsche Auto, und German, nein, das heißt nicht »Deutsch«, sondern ist die spanische Übersetzung von Hermann. Zufälligerweise, falls man an Zufälle glaubt, ist das auch der zweite Vorname meines Vaters, der eigentlich Otto heißt, Otto Hermann, aber dazu komme ich später.
Warum wir aus Deutschland dorthin gezogen waren, wusste ich nicht, ich war gerade mal zwei Jahre alt. An einem fürchterlich kalten Wintertag stiegen wir auf ein großes Schiff und legten wenige Wochen später an einem strahlenden Sommertag in Buenos Aires an. Das roch eindeutig nach Verbesserung. Zunächst. Meine Mutter fand bald diese Stelle als Erzieherin von zwei verwöhnten Blagen, Zwillinge, die nichts Besseres im Sinn hatten, als mich von früh bis spät ihre Überlegenheit spüren zu lassen. Damals wäre ich durchaus gewillt gewesen zu sprechen, allein, weil meine Mutter sich so eine unsagbare Mühe mit mir gab. Sie bastelte Kartenspiele, formte Kasperlepuppen aus feuchtem Zeitungspapier, verbrachte jede freie Minute mit mir, zumindest in der ersten Zeit. Aber ich begriff sehr schnell, dass mein Schweigen die einzige wirksame Waffe im Kampf gegen die Zwillinge war. Sie begannen mich zu fürchten und nannten mich Hexe. Wenn sie versuchten, mich zu schlagen oder auszuziehen, um mich zu demütigen, begann ich, ohne jede Vorwarnung, aus Leibeskräften zu schreien. Dabei schraubte ich meine Stimme so hoch, dass sie erschrocken das Weite suchten.
Wir lebten also in einem Palast, aber bewohnten dort nur ein winziges Zimmer. Wir waren Personal, Bodenpersonal. Und da es in diesem Zimmer nicht allzu viel zu entdecken gab, kaprizierte ich mich auf die Kommode. C’était mon caprice, würde man auf Französisch sagen, eine Sprache, die ebenso wie meine Muttersprache Spanisch weniger konfliktbeladen für mich ist als das Deutsche, das ich erst sehr spät lernte. Außerdem klingt im Französischen alles bedeutend eleganter, was mir, über meinen »Unterschichtenkomplex« hinweghalf, ein Komplex, der mir streng genommen gar nicht zustand, kam ich doch, zumindest mütterlicherseits, aus gutem Hause. Aber scheinen wir nicht am meisten, was wir am wenigsten sind?
Diese Kommode, ein klobiges Stück aus der Zeit des argentinischen Barocks, war an sich nicht sonderlich interessant, wohl aber ihr Inhalt. Sie war ein Heiligtum, niemand durfte sie ungestraft öffnen, was ihren Reiz erhöhte. Oft saß meine Mutter schweigend neben ihr, versunken in Briefe, die sie anschließend wieder in der oberen Schublade versteckte oder gegen alte Fotografien tauschte. Auf einer stand ein junger Mann mit stillem Gesicht vor einem dunklen grauen Hintergrund. Mein Vater, wie sie mir sagte.
Ich kannte ihn nur von diesem schon einigermaßen abgegriffenen Foto, das obendrein auch noch unscharf war. Ich hatte ihn nie gesehen, nie seine Stimme gehört, und in den Augen aller, insbesondere der Zwillinge, war ich ein Bastard, ein unrechtmäßiges Kind aus einem fremden Land, dessen Mutter aus Gründen, die niemand kannte oder verstand, am wenigsten ich selbst, nach Argentinien gekommen war. Ein Kind, das nicht sprechen konnte und, schlimmer noch, nicht getauft, also auch nicht katholischen Glaubens war, wie jedes andere Kind in diesem Land. Mit einer Mutter, die allen auf die Nerven ging, weil sie so deutsch war, weil sie immer alles richtig machen wollte, weil sie kein Geld hatte und von der Gunst anderer abhängig war. Mehr wusste ich über meine Herkunft nicht.
Noch geheimnisvoller war die zweite Schublade. Dort versteckte meine Mutter ihre Unterwäsche. Ihre Schlüpfer unterschieden sich von meinen nur in der Größe, daneben aber lag etwas, dem mein ganzes Interesse galt. Etwas, das ich nicht besaß, etwas, das ich auch nicht tragen durfte, es wäre auch völlig sinnlos gewesen. Mein kleiner Körper schien nicht dafür gemacht, »noch nicht«, wie meine Mutter lachend sagte, wobei sie die Augen verdrehte. Sie ahnte nicht, wie sehr ihre Worte in meinen Ohren widerhallten. Dieses eigenartige Stück bestand aus zwei Körben, in denen meine Mutter jeden Morgen ihre Brüste verstaute. Ich dachte mir schon, dass ich eines Tages auch Brüste haben würde, aber ich war eben nur eine kleine Frau, eine señorita. Was das bedeutete, wurde mir erst sehr viel später klar, aber im Gegensatz zu den Jungen waren wir Mädchen eben keine Mädchen, sondern kleine Frauen, es galt also schnell groß zu werden, denn eine kleine Frau war streng genommen keine Frau. Da sie aber auch kein Mädchen war, war sie nichts.
War meine Mutter außer Haus, schlüpfte ich in die Körbe, stopfte mir Äpfel oder Orangen hinein, band die Enden im Rücken zusammen, um stolz vor dem Spiegel auf und ab zu schreiten. Kurze Augenblicke geborgten Glücks, eine Neugier, die ich bald teuer bezahlen musste.
Warum versteckte sich meine Mutter morgens und abends beim An- und Ausziehen vor mir? Manchmal gelang es mir trotzdem, einen Blick zu erhaschen, dann rutschten die Brüste aus den Körben oder wurden wieder hineingestopft, als seien sie eine Last. Vielleicht, dachte ich, sollte ich mir mit dem Heranwachsen doch etwas Zeit lassen. Ich beschloss, von nun an meine Umgebung aufmerksamer zu betrachten.
Der Sündenfall
Bald lernte ich, mir den Po zu waschen. Der Po geht von dem kleinen Schlitz vorne bis zu dem großen Schlitz hinten, erklärte meine Mutter. In beiden Schlitzen befanden sich Löcher, die ich nicht anfassen durfte, für beide gab es nur ein Wort: der Po. Der eine Po konnte dies, der andere das, aber alles in allem war es ein und dasselbe und immer auch ein bisschen »pfui«. Ich habe das später bei vielen Freundinnen festgestellt, unsere Mütter wollten das andere Wort nicht aussprechen, so als existierte es nicht, denn was nicht existiert, dafür kann es auch kein Wort geben, oder? Später in der Schule, ich war glaube ich schon sechzehn oder älter, gab es dann doch eins, »Vagina« oder auch »Scheide«. Das klang wenig ermutigend. Ich habe auch nie einen Jungen von seinem »Penis« reden hören, nicht mal im Biologieunterricht. Meine Mutter guckte streng, wenn sie über diese Dinge sprach. Sie schien auch zu glauben, dass ich alles verstand, was sie sagte, weil sie häufig ihre Sätze mit »nicht waaahr?« beendete. Ich wusste nichts über Wahrheit, aber die Schlitze zu waschen tat gut. Es war schön.
In unschuldiger Neugier, na ja, Neugier ist wohl nie frei von Schuld, jedenfalls nicht in einem katholischen Land, also eher verträumt betrat ich an einem frühen Nachmittag den Vorraum des herrschaftlichen Schlafgemachs. Die Sonne brannte durch die aufgerissenen Fenster. Hinter der angelehnten Tür bewegten sich die Schatten von Mercedes und German. Ihre nackte Haut glänzte feucht, sie röchelten, als Mercedes plötzlich einen Schmerzensschrei heiser aus sich herauspresste und mir dabei für einen endlosen Augenblick mitten ins Gesicht sah. Starr stand ich da. Stirbt sie jetzt, fragte ich mich? Und wenn ja, was tue ich dann? Wohin jetzt? In unserem Zimmer schlief meine Mutter, die durfte ich nicht wecken. Voller Angst lief ich ins Bad, zog meinen Schlüpfer aus, setzte mich auf den weißen Beckenrand der Badewanne, klemmte die Hände fest zwischen meine dünnen Schenkel irgendwo in der Nähe des Lochs. Die Tür flog auf. Eine Hand packte mich am Nacken, eine andere riss mir die Finger aus dem Schlitz. Ich schrie.
Ich verstand die Worte nicht, die mir entgegengeschleudert wurden. Winselnd, wie der kleine Hund der Zwillinge, versteckte ich mich hinter der Toilette. Mercedes stand bleich vor mir. Sie schrie und spuckte. Immer wieder spuckte sie nach mir. In meinen Ohren pochte es, als ich wieder hochgerissen wurde, mein Kopf schlug gegen das Waschbecken. Heißes Wasser schoss über mein Haar, verbrannte mein Gesicht. Dann verlangsamte sich das Pochen, wurde immer leiser, mir wurde abwechselnd heiß und kalt, bis sich alles um mich herum in gleichmäßiges Rauschen verwandelte. Ich versuchte zu atmen, aber statt Luft drang jetzt Wasser in meine Lungen, eine gewisse Abneigung gegen Wasser in jeder Form ist mir seitdem geblieben. Wieder spürte ich Mercedes’ eisernen Griff. Dann klopfte es laut und eindringlich in meinem Innern, als würde jemand gegen eine Tür schlagen. Ich versuchte mich zu befreien. Ich schlug und trat um mich. Es wollte nicht helfen, ich wurde immer schwächer, bis ich die leise schreiende Stimme meiner Mutter vernahm. Ich glitt aus Mercedes’ Hand, schlug hart zu Boden. Warum sickerte es aus meiner Stirn? Ich fühlte keinen Schmerz, keinen Kummer, keine Angst, keine Scham. Ich fühlte nichts mehr, und dieses Nichts tat gut.
Danach wurde alles anders. Mercedes und meine Mutter sprachen nicht mehr miteinander, schlimmer noch, meine Mutter sprach auch kaum noch mit mir. Sie nahm mich hin und wieder auf den Arm oder ließ mich auf ihrem Schoß sitzen, achtete aber darauf, dass ich die Beine geschlossen hielt. Den Blick abgewandt, vermied sie jede Bewegung, kein Schaukeln, kein Wippen, wie ich es liebte. Einmal fasste ich sie am Kinn. Überrascht sahen wir einander an. Die Zeit blähte sich wie eine Seifenblase, löste sich und platzte.
Die Sonntage verbrachten wir in der Kirche. Nach dem Gottesdienst verschwand meine Mutter im Beichtstuhl. Allein verlor ich mich im hinteren Bereich der Kapelle. In einer kleinen Wölbung, allen Blicken entzogen, blieb ich erschrocken stehen. Versteckt im Dunkeln, als dürften nur Eingeweihte sie erkennen, stand eine hölzerne Skulptur der Mutter Gottes mit ihrem Sohn. Jesus sah seine Mutter forschend an, Maria wandte sich ab. Es war also richtig, dass meine Mutter mir nicht mehr in die Augen sah, die Mutter Gottes sah ihr Kind auch nicht an. Trotzdem verletzte es mich, ich nahm es meiner Mutter übel.
Wenige Tage darauf standen wir mit dem Priester feierlich beieinander. Während er dunkel etwas vor sich hin murmelte, wahrscheinlich ein Gebet, spritzte er mir Weihwasser auf den Kopf.
»Du bist jetzt eine Christin«, sagte meine Mutter zu mir.
Ich wusste nicht, was das war, aber meine Mutter schien stolz darauf zu sein, und so dachte ich, sie sei auch stolz auf mich. Ein vollkommen neues, ein erhabenes Gefühl.
Am Nachmittag las sie mir aus der Bibel vor. So lernte ich den Teufel kennen, als armer Engel vom Himmel gefallen brachte er die Menschen in Versuchung, um sich an Gott zu rächen. Dieser arme Engel tat mir so leid, dass ich zur großen Irritation meiner Mutter laut zu weinen begann. Ich glaube, sie war zum ersten Mal froh, dass ich nicht sprechen konnte. Kaum auszudenken, wie enttäuscht sie gewesen wäre, hätte sie erfahren, dass ich den armen Teufel netter fand als den lieben Gott, unter dem ich mir gar nichts vorstellen konnte, außer, dass er ein Vater war, was bedeutete, dass jeder Vater auch ein Gott war, ein strenger Gott, der einen mir nichts dir nichts aus dem Himmel werfen konnte.
Bald darauf verließen wir die Familie Sonntag. Ich kam nicht umhin zu denken, dass es wohl meine Schuld gewesen war.
Auf den Tag folgt die Nacht, ohne Teufel kein Gott. Die Konstruktion ist konsequent.
Satan
Der neue Arbeitgeber meiner Mutter war ein strenger Mann, ein Capitan. Bei ihm war das Leben noch trostloser als bei den Zwillingen. Hier war ich keine Hexe mehr, nur noch die Tochter einer Putzfrau, ich musste den Kopf senken, wenn der Capitan sich mir näherte. Tagsüber versteckte mich meine Mutter vor seinen Blicken. Allein in meinem Zimmer, auf dem Bett, legte ich mich auf den Bauch, winkelte die Beine an, fasste mit den Händen nach meinen Füßen und begann mich rhythmisch auf und ab zu wiegen. Je mehr sich mein Körper dabei spannte, umso schöner fühlte es sich an. Ein Rauschen erfasste mich, schlug immer länger werdende Wellen durch meinen Körper, bis ich innehielt, um mich gleich darauf, erst sanft, dann immer heftiger, zu wiegen, hinauf und steil hinab und wieder hinauf in schwindelnde Höhen, bis sich meine Lippen öffneten. Dann hielt ich inne, horchte in mich hinein, folgte ohne jedes Bewusstsein meinen langsamen, dann immer schneller kreisenden Beckenbewegungen, presste das Kissen zwischen meinen Beinen immer fester zusammen, spannte meinen Körper in völliger Reglosigkeit, bis er zuckte, fühlte Schauer über mich hinwegfegen. Danach lag ich still da.
Da ich nur in dieser Nähe zu mir selbst alles um mich herum vergessen konnte, zog ich mich, sooft ich konnte, ins Schlafzimmer zurück. Was ich im Verborgenen tat, war schlecht, das wusste ich, aber da mein Vater sich weigerte, zu uns zu kommen, wie mir meine Mutter erzählte, konnte ich auch gleich ein Teufel werden, wenn ich nicht schon einer war.
Eines Tages, als ich mich wieder ins Schlafzimmer begab, lag auf dem Bett die Puppe, die mir Mercedes geschenkt hatte. Ich legte mich zu ihr und dachte an Mercedes und German und auch an meine Mutter und den Mann auf dem Foto aus der Kommode, also an Gott. Ich war wirklich ein Teufel. Das war nun klar, denn ich spürte, welch diebische Freude es mir bereitete, ihn zu verhöhnen, indem ich Dinge tat, die verboten waren und die mich nun, da ich an ihn dachte, direkt vor seinen Augen, unter seinem strengen Blick zu einem wahrhaften Teufel werden ließen. Ein Teufel, der sich nicht mal heimlich wünschte, wieder ein Engel zu sein. Mit vorsichtigen Bewegungen umkreiste ich die Puppe. Ich hörte nicht die nahende Gestalt, ich sah nicht die Reitgerte durch die Luft fliegen, ich spürte nur einen Blitzschlag. Erschrocken krampfte sich mein Körper zusammen, als mich der nächste Hieb traf. Da war sie, die Strafe, die Gott auf dem Fuße folgen ließ, um mich seine Macht spüren zu lassen. Ich drehte mich um, versuchte mit den Händen meine aufplatzende Haut zu schützen. Die dunkle Gestalt packte mich, schleuderte mich in die Luft und ließ mich auf den Boden krachen. Kaputt, dachte ich, kaputt. Ich musste weg. Das wurde so angeordnet.
Ich kam in eine Klosterschule. Wir wurden von strengen Frauen bewacht. Wie der Priester, der mich getauft hatte, waren auch sie mit Gott verbandelt. Als meine Mutter mich der Schwester Oberin übergab, verstand ich, dass diese Trennung nicht vorübergehend sein würde. Zum Abschied strich sie mir übers Haar. »Machen Sie es kurz«, hörte ich die Frau in dem grauen Gewand sagen. Ihre Haare waren weiß, das Gesicht faltig, die Hände dick und feucht. Als meine Mutter ging, riss ich mich los. Die überraschte Oberin war nicht schnell genug. Ich war eine gute Läuferin, selbst die Zwillinge hatten mich nie einholen können. Ich hörte, wie sie mir keuchend und schnaufend nachrannte. Schnell versteckte ich mein Gesicht in dem warmen Schoß meiner Mutter. Aber sie schob mich zur Oberin zurück und verschwand.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.