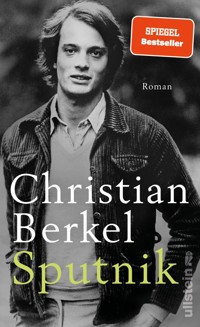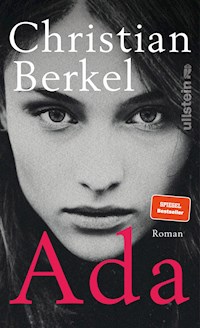9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu.« Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe. Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris unter, bis die Deutschen in Frankreich einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter. Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Leben aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat. Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Apfelbaum
Der Autor
Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u.a. mit dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit 2006 ist er in der ZDF-Serie »Der Kriminalist« zu sehen. Er lebt mit seiner Frau Andrea Sawatzki und den beiden Söhnen in Berlin.
Das Buch
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris unter, bis die Deutschen in Frankreich einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter. Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Leben aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat. Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen.
Christian Berkel
Der Apfelbaum
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN 978-3-8437-1878-3Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung:Büro Jorge Schmidt, MünchenCoverfoto: Trotz aller Bemühungen des Verlags konnte der Rechteinhaber nicht ausfindig gemacht werdenAutorenfoto: © Gerald von ForisE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Textbeginn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Textbeginn
Widmung
Für Andrea, Moritz und Bruno
Motto
Jedes Schicksal, wie weitläufig und verschlungen es auch sein mag, besteht in Wirklichkeit
aus einem einzigen Augenblick
; dem Augenblick, in dem der Mensch für immer weiß, wer er ist.
Jorge Luis Borges
1
»Na, mal wieder die Mutter besuchen?«
Was ging das die Blumenverkäuferin an? Und dazu noch dieser unverhohlene Vorwurf in der Stimme. Was wusste sie schon? Hier in Spandau kannte jeder jeden. Unerträglich. Ich bezahlte eilig und verließ den Laden.
Mit den Blumen in der Hand bog ich in den schmalen Weg zwischen den Wohnblöcken. Immerhin hatte man damals daran gedacht, diese Schuhschachteln um eine Rasenfläche zu gruppieren. Meine Eltern hatten sich dort eingemietet, nachdem sie ihr Haus in Frohnau verkauft hatten, um den Großteil des Jahres in Spanien zu leben. Damit löste mein Vater das Versprechen ein, das er meiner Mutter Jahrzehnte zuvor, in den Fünfzigerjahren, gegeben hatte, als sie aus Argentinien zurückgekehrt war und sich in Deutschland nicht mehr zurechtfand. Dieses Land war nicht mehr ihre Heimat, konnte es nie mehr werden.
»Komm schnell rein.«
Meine Mutter stand in der Tür, nur mit einem Morgenmantel bekleidet. Bevor ich ihr die Blumen in die Hand drücken konnte, zog sie mich in den Flur. Ein paar Wochen waren seit meinem letzten Besuch vergangen. Der Herbst ging in Regen und Schnee über. Es war kalt geworden.
»Ich muss dir etwas erzählen.«
In ihrem kleinen Wohnzimmer drehte sie sich um und warf den Kopf in den Nacken.
»Ich habe geheiratet.«
Ein Flugzeug donnerte über die Siedlung hinweg. Mein Vater war vor neun Jahren, am 24. Dezember 2001, gestorben.
»Warum hast du mir nichts davon erzählt?«, fragte ich.
Sie sah mich prüfend an, wartete einen Moment.
»Keine Sorge, er ist schon wieder tot.«
»Wie … aber …«
»Leberschaden.«
»Ach.«
»Ja, wie dein Vater, da war’s auch die Leber, aber schon damals im Krieg. Ganz plötzlich ist er umgefallen. Tot. Bei Carl war es ähnlich. Er hat deinen Vater im Krieg kennengelernt. Sie sind zusammen in Russland im Lager gewesen.«
»Wie … wer ist in Russland gestorben?«
»Na, dein Vater.«
»Nein.«
»Nein?« Sie lachte ungläubig. »Ich muss es ja wohl wissen, er war ja schließlich mein Mann, auch wenn wir unter Adolf nicht heiraten durften.«
»Nein, er kann nicht während des Krieges gestorben sein, sonst wäre ich ja nicht geboren … oder er wäre nicht mein Vater.«
»Natürlich war er dein Vater. Das wär ja noch schöner! Was soll denn das? Ideen wie ein altes Haus, das dem Einsturz nahe ist.«
»Na, ich bin 1957 geboren, er kann ja nicht im Krieg gefallen, also gestorben sein, meine ich, und mich dann zwölf Jahre nach Kriegsende gezeugt haben …«
Sie starrte mich wütend an.
«Bei dir haben sie wohl eingebrochen und vergessen zu klauen.« Ihre trüben Augen fixierten mich. »Das ist ja zum Piepen, ist das! Also jetzt pass mal auf, der Carl, der hat mir sehr viel Geld hinterlassen, weil, na ja, er wollte, dass ich abgesichert bin, weißt du, und da er mit seiner Sippe wegen mir immer Ärger hatte …«
»Warum denn?«
»Na, er kam aus der Familie Benz.« Sie machte eine Pause und sah mich vielsagend an.
»Benz?«
»Ja. Daimler Benz.«
Der Name war wie ein Achtzylinder über ihre Zunge gerollt.
»Und warum hatte er deinetwegen Ärger mit seiner Familie?«
»Manchmal bist du aber wirklich schwer von Kapee. Warum wohl? Die haben natürlich Angst vor Erbschleichern. Außerdem war Carl sehr viel jünger als ich. Das hat denen natürlich auch nicht gepasst.«
»Wie alt war er denn?«
»So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Siebenundvierzig? Manches vergesse ich inzwischen, weißt du? Vielleicht auch sechsundvierzig, also Ende vierzig oder Anfang … na ja.«
»Aber ich dachte, er sei mit Papa in russischer Gefangenschaft gewesen?«
»Das habe ich doch gesagt. Hast du wieder nicht zugehört?«
»Nein, ich meine nur, dass er dann nicht Ende vierzig gewesen sein kann … also, wenn er zusammen mit Papa in dem russischen Lager war.«
Ich hoffte, sie würde einlenken, obwohl mir klar war, dass sie es nicht tun konnte. Widersprüche hatten sie auch früher nicht gestört. Ich versuchte es trotzdem.
»Eigentlich müsste er dann so etwa in deinem Alter gewesen sein.«
»War er aber nicht. Er war dreißig Jahre jünger. Punktum. Also, jetzt pass mal auf, er hat mir zwei Millionen Euro auf mein Konto überwiesen. Und da ich das Geld nicht brauche, wollte ich es deiner Schwester und dir schenken.« Sie strahlte mich zufrieden an.
»Oh, das ist lieb von dir, aber willst du es nicht doch behalten?«
»Wozu? Ich habe genug, und allzu lange will ich auch gar nicht mehr leben. Ich kenne das alles schon zur Genüge und will mich ja schließlich nicht langweilen. – Ach, bevor wir zur Bank gehen, um das Geld abzuheben, möchte ich noch ins Interconti fahren.« Ich sah sie fragend an.
»Na, da haben Carl und ich unsere Hochzeitsnacht verbracht, und am nächsten Morgen habe ich doch diiiirekt mein Hochzeitskleid dort vergessen. Wahrscheinlich hängt es da noch im Schrank. Das möchte ich schon haben.«
Ich war mit einem Block voller Notizen gekommen, saß vor meiner Mutter, wollte sie über meinen Vater befragen – und sie erzählte von ihrer Hochzeit mit Carl Benz.
Ich begriff, dass die Zeit, nach der ich suchte, nicht in Vergessenheit geraten war. Sie begann sich vor meinen Augen aufzulösen. Was blieb, waren Bruchstücke aus ihrem Leben. Einzelne Motive tauchten in Variationen auf, wurden neu verknüpft, als hätte man ein Bild in einzelne Teile zerschnitten, einige dabei verloren, andere zu einem neuen Ganzen zusammengesetzt. Als würde die Seele im Vergessen neu kartografiert.
Und mein Vater, mit dem sie durchs Leben gegangen war – seit ihrem dreizehnten Jahr –, mein Vater war verschwunden, vor langer Zeit im Krieg gestorben, ersetzt durch Carl Benz.
Mein Vater war von März 1945 bis Ende 1950 in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Verwandelte sie die Tatsache, dass sie in dieser Zeit von ihm getrennt gewesen war, jetzt in seinen Tod? Wenn sie ihn damals verloren geglaubt hatte, wenn sie begonnen hatte, seinen Tod zu akzeptieren, wie es viele Frauen damals taten, dann war dieser Tod eine Zeit lang Teil ihrer Wirklichkeit geworden. Griff ihr schwindendes Gedächtnis jetzt erneut darauf zurück?
Die Filiale der Sparkasse war nur wenige Minuten entfernt. Zielstrebig ging meine Mutter auf einen Berater zu. Sie legte eine große, leere Tasche auf den Tresen.
»Guten Tag, würden Sie bitte meinen Kontostand aufrufen? Sala Nohl«, sagte sie in gesetztem, beinahe feierlichem Ton. Nach dem Tod meines Vaters hatte sie wieder ihren Mädchennamen angenommen.
»Sehr gerne, gnädige Frau.«
Der Bankangestellte nickte höflich. Sie lächelte mich verschwörerisch an. Für einen kurzen Moment wurde ich unsicher. Es konnte eigentlich nicht sein. Oder doch?
«3.766 Euro und 88 Cent, gnädige Frau.«
Sie sah kurz auf.
»Nein, das andere Konto.«
Der Berater schien nicht zu verstehen. Sie wandte sich zu mir und schüttelte seufzend den Kopf, als würde sie sich für die Unfähigkeit eines Mitarbeiters entschuldigen, der noch einiges lernen musste, worüber sie jetzt mal großzügig hinwegsehen würde.
»Gnädige Frau, es tut mir leid, aber Sie haben bei uns nur dieses Konto.«
»So so, habe ich das, ja?«
Sie nickte unsicher, während aus ihrem Gesicht die Farbe wich. »Gut, dann komme ich morgen noch mal, wenn Ihr Chef da ist.«
Der arme Mann blickte mich fragend an.
»Sehr gerne, gnädige Frau.«
Ich führte sie vorsichtig hinaus.
Auf der Straße blieb sie nach wenigen Schritten stehen. Sie sah mich erschrocken an.
»Ich kann das doch nicht alles geträumt haben.«
Ich sprach mit Ärzten, schilderte so gewissenhaft ich konnte meine Beobachtungen, auch die frühesten Zeichen der beginnenden Auflösung, und erfuhr, was ich von Anbeginn wusste. Mir blieb nichts, als sie auf dem unabwendbaren Weg bis zum Eingang des Tunnels zu begleiten, um sie, Schritt für Schritt, in die erinnerungslose Dunkelheit zu entlassen. Ein Psychiater riet mir, meine Mutter so oft wie möglich zu besuchen. Regelmäßige Gespräche, soziale Kontakte könnten den Verlauf mildern. Die Besuche fielen mir schwer. Es dauerte, bis ich mich hier und da in ihre Welt hineindenken konnte. Meistens gelang es mir erst im Nachgang, die Bilder in meinem Innern zu ordnen, wenn ich wieder mit mir und dem Klang ihrer Stimme allein war.
Manche Menschen schmecken noch den Kuchen, den ihre Mutter sonntags auf den Tisch stellte, die besondere Mahlzeit, ihr Leibgericht, dessen Duft ihnen verlässlich die verschlossenen Räume ihrer Kindheit öffnet. Andere erinnern sich an ihr Parfum, ihre Umarmungen, ihr Wachen am Krankenbett, an ihren Gang, ihre Bewegungen, die Silhouette ihres Rückens, wenn sie das Licht löschte und das Zimmer verließ, an den Kuss, der ihnen die Angst vor dem Einschlafen nahm, an ihr Lachen und ihre mitfühlenden Tränen, oder an ihre stille, Halt gebende Anwesenheit. Für mich waren es ihre Worte. Worte, die sich in Bilder verwandelten, die zu meinen eigenen wurden. Zum Boden, zu den Wänden, den Fenstern und Türen meiner Welt. Nichts in meiner Kindheit war verstörender als ihr Schweigen. Und jetzt? Würde sie langsam in eine Welt hinübergleiten, in der es keine gemeinsame Sprache mehr gab?
Der Psychiater erklärte mir, dass es selbst im Wahn eine Verbindung zur Wirklichkeit gebe, nur sei sie nicht leicht zu erkennen. »Wenn ein Paranoiker bei der Morgenvisite erzählt, dass er die ganze Nacht von einem Pfleger mit elektromagnetischen Strahlen misshandelt worden ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Pfleger am Vorabend wohl nicht sehr freundlich zu dem Patienten war.« Meinen Beschreibungen nach stehe es aber noch nicht so schlimm um meine Mutter. Ich fragte nach seiner Diagnose. Er lächelte achselzuckend. »Was hilft Ihnen ein Etikett?« Ich insistierte nicht. Was sollte ich mit einem Wort, dessen Tragweite ich nicht ermessen konnte? Beim Abschied legte er mir seine Hand auf die Schulter. Für einen Moment war mir, als würde ich ihn schon ewig kennen. »Verlieren Sie nicht den Mut.«
Zu Hause suchte ich in alten Fotoalben nach Spuren aus ihrem früheren Leben. Ich hatte begonnen, meine Gespräche mit ihr aufzuzeichnen. Jetzt hörte ich mir die Aufnahmen wieder und wieder an, und mein anfängliches Erschrecken wich unruhiger Neugier. Gleichzeitig fühlte ich mich wie ein heimlicher Beobachter, ein Eindringling. Diese Aufnahmen, die mir so teuer wurden, enthielten die Essenz ihres Lebens, eine Münze, die in einem dunklen Brunnen ins Bodenlose zu fallen schien. Konnte ich in ihrem Vergessen wahrhaftig eine Form der Erinnerung finden? In welches vage Kellergelass würde sie mich führen? Und was verbarg sich auf der Kehrseite dieser Medaille? Konnte es sein, dass prägende Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit auf noch tiefer liegende Schichten prallten, um sich zu einer neuen Wirklichkeit zu verdichten? Wurden die Lücken unserer Familiengeschichte im Vergessen freigelegt? War die offizielle Version unserer Geschichte nur eine domestizierte Erinnerung, eine Deutung mit Streichungen und Ergänzungen, wie wir sie alle bei dem Versuch vornehmen, aus den disparaten Teilen unserer Existenz, der Fülle an Unverdautem, ein verständliches Ganzes zu formen, eine Identität? Bei jedem Besuch fragte ich behutsam nach, grub tiefer. Je weiter die Ereignisse zurücklagen, desto besser schien meine Mutter sich zu erinnern. Die Geschichte meiner Eltern tauchte schemenhaft vor mir auf, magische Momentaufnahmen im Entwicklungsbad einer verlorenen Zeit.
Ich stand vor ihrer Tür in Spandau. Nach dem Klingeln wartete ich unruhig. Eine beklemmende Stille. Grau und schmutzig wirkte alles hier, obwohl die Wege penibel gepflegt wurden. Die Luft war feucht, am Horizont sammelten sich ein paar Gewitterwolken. Und wenn niemand öffnete? Vielleicht war sie gestorben? Vielleicht lag sie tot im Flur oder hingestreckt auf dem Wohnzimmerlaminat. Ich klingelte noch einmal. Manchmal hörte sie nur laut Musik, oder die Klingel war abgeschaltet, weil sie ihre Ruhe haben wollte. Ich war gerade dabei, zu meinem Mobiltelefon zu greifen, da hörte ich ihre Schritte. Sie war nie sportlich gewesen. In den Sommerferien meiner Kindheit saß sie den ganzen Tag am Strand unter dem Sonnenschirm und schaute auf das Meer. Damals war ihr Körper schwer und aufgeschwemmt. Ich wusste nicht, warum. Ich schämte mich, wenn ich sie ansah, ich wünschte mir eine schöne, begehrenswerte Mutter, um die mich alle beneideten, eine, die sich elegant kleidete, mit langen, dunklen Haaren, wie auf ihren Jugendfotos. Aber sie aß seit Jahren Unmengen von Süßigkeiten, starb für buttrige Soßen und bezahlte ihre Hemmungslosigkeit, wie ich später dachte, mit steigenden Blutzuckerwerten. Altersdiabetes lautete die Diagnose, seit einigen Jahren musste sie dreimal täglich Insulin spritzen. Eine ihrer schlimmsten Angewohnheiten, eine Marotte, die mich immer aufs Neue verstörte und meine ganze Kindheit hindurch verfolgte, waren ihre wechselnden Perücken gewesen, ein Attribut für die selbstbewusste Frau der Sechzigerjahre, wie die Werbung damals suggerierte. Einmal kam ich vorzeitig aus dem Kindergarten, sie öffnete die Tür, eine fremde Frau mit Haaren so ochsenblutrot wie die Haustür. Erschrocken starrte ich sie an. Wer war das? Wo war meine Mutter? Hatte ich mich in der Hausnummer geirrt, oder wohnten meine Eltern nicht mehr hier? Und wenn ja, was sollte ich jetzt tun? Erst der Klang ihrer Stimme konnte mich in die Wirklichkeit zurückholen.
Hinter der Tür hörte ich meinen Namen. Ihr Organ war immer noch so durchdringend wie früher. Ängstlich, schrill, wenn sie nicht wusste, wer vor der Tür stand, oder wenn sie in Eile war, dunkel und leise, wenn sie sich ärgerte, glockenhell und melodisch, wenn sie eine ihrer vielen Geschichten erzählte. Die Tür sprang auf. Im Alter hatte meine Mutter ihre Schönheit zurückgewonnen. Sie stand in dunklen Hosen und einem mauvefarbenen Twinset fragil und verletzlich vor mir. Im Gegensatz zu früher achtete sie wieder auf ihre Kleidung. Ich küsste sie zur Begrüßung links und rechts. Plötzlich fühlte ich das Bedürfnis, sie schützend in die Arme zu nehmen. Unsicher legte ich meine Hand auf ihre Schulter. Zuckte sie bei meiner Berührung, oder war es ein Erstarren? Wich sie zurück? War ihr meine Berührung unangenehm?
Im Wohnzimmer beugte sie sich über den Couchtisch. Sie zupfte die kleine, rechteckige Brokatdecke zurecht. Hinter dem Tisch an der Wand stand ein breites, mit goldenem Samt bezogenes Schlafsofa. Seine nach außen geschwungenen Mahagonibeine verjüngten sich zu etwas zu klein geratenen goldenen Tatzen. »Empire, aus Schlossbesitz«, erklärte sie jedem Besucher in vertraulichem Ton. Mehr pflegte sie nicht zu sagen. Gefundenes und Erfundenes vermischte sie mit Erlebtem und Erdachtem. Mal begnügte sie sich mit einer Andeutung, mal genoss sie es, weit ausschweifend ihren Bogen zu spannen. Dass der dunkle Tisch eine Nachbildung war, erwähnte sie nur, um ihre Urteilsfähigkeit in diesen Dingen zu unterstreichen. »Aber er passt«, fügte sie entschieden hinzu. Nur ein Narr hätte ihr widersprochen. Alles passte in der vollgestellten Enge ihrer Zweizimmerwohnung. Hier war ihr pied-à-terre, seit sie mit meinem Vater die Zelte in Berlin abgebrochen hatte, um seine letzten zwanzig Lebensjahre mit ihm in einem weißen Haus, in einer verlassenen andalusischen Mondlandschaft zu verbringen. Mitten im Naturpark Cabo de Gata, dem Kap der Katze, versuchte sie, ihren Erinnerungen zu entfliehen. Rechts von der Terrasse verlor sich der Blick in einer weiten, leer gefegten Landschaft, unten flimmerte oder tobte die See. Eine Wüste am Meer.
Sie setzte sich jetzt auf ihren Sessel neben dem Sofa. Ich hatte wieder das Aufnahmegerät mitgebracht. Der Plan, ein Buch über sie zu schreiben, über unsere Familie, über ihre Beziehung zu meinem Vater, war in den letzten Jahren langsam gereift. Zunächst arbeitete er sich wie ein streunender Köter an mich heran, der wieder und wieder an mir herumschnüffelte, um kurz vor dem Abdrehen seine Duftmarke zu setzen. Ja, anfangs fühlte es sich so an, als würde mir jemand ans Bein pinkeln. Freunde und Weggefährten ermunterten mich, diese Geschichte aufzuschreiben. Jeder begründete es auf seine Weise. Ich merkte, wie sie sich die Versatzstücke, die Episoden, die ich je nach Zuhörer variierend erzählte, aneigneten.
Für mich blieben diese Geschichten fremd und zugleich nicht fremd genug. Viele Lücken warfen Fragen auf, die ich mich nicht zu stellen getraute. Jeder Familienroman arbeitet mit seiner eigenen Grammatik, entwickelt seine eigenen Zeichen, seine Syntax, die ihn für die beteiligten Personen oft unlesbarer werden lassen als für den außenstehenden Betrachter. Das Fremde wächst in der Nähe. Wie bei einem Baum das Wurzelwerk in Größe und Umfang dem Wipfel entspricht, so ist es auch hier. Fremd wurzeln wir im Verborgenen, greifen unter der Erde um uns und dehnen uns aus. Die Früchte, das, was wir sehen, heranreifend oder verfault, lebendig oder tot, korrespondieren mit dem, was wir in der Natur nicht sehen können und in der Familie nicht sehen dürfen. Dem Tabu. Jedes Kind erkennt es mit schlafwandlerischer Sicherheit.
Ich sah in ihr Gesicht. Sie trug ihr dünnes weißes Haar streng nach hinten zu einem kleinen Dutt gebunden. Die letzten zwanzig Jahre in Spanien hatten ihr gutgetan. Ihre Depression war in der Sonne ausgeblichen, sie hatte abgenommen und ihre Perücken ins Meer geworfen. Ein Akt der Befreiung, der mir eine Mutter zurückgab, die ich so fast nie gesehen hatte. Sie erinnerte von ferne an das zarte junge Mädchen auf einem Bild von 1932. Mit dreizehn Jahren waren ihre Haare dunkelbraun, der Blick traurig und ernst. Jetzt saß sie vor mir, einundneunzigjährig, das geschrumpfte Gesicht beherrscht von ihrer geschwungenen Nase, die großen Hände, die immer noch neugierig nach allem griffen. Der im Alter wieder erschlankte Oberkörper hatte seine Spannung bewahrt.
Der süßliche Duft alten Lebens kroch mir in die Nase. Im Eingang hing die gelbe Baskenmütze meines Vaters an einem Haken. Er hatte sie auf seinem Sterbebett getragen. Vier Jahre waren seitdem vergangen. Wenn ich die Mütze sah, war sein Geruch noch immer in der Luft, als hätte er den Raum nicht endgültig verlassen, als könnte er sie jederzeit vom Haken nehmen und sich schweigend auf einen seiner langen Spaziergänge machen. Meine Mutter folgte meinem Blick.
»Dein Vater passte ja gar nicht zu mir.«
Es verschlug mir kurz die Sprache. Ein erstaunlicher Satz über zwei Menschen, die, mit einigen Unterbrechungen, ein Leben lang nicht voneinander hatten lassen können.
»Gab es denn jemand anders?«
»Eigentlich nicht.«
»Nie?«
»Ich würde sagen, eigentlich nicht.«
Ich kannte andere Geschichten, aus anderen Zeiten, aber auch jetzt war eine andere Zeit angebrochen. Immer noch schaute sie auf seine gelbe Baskenmütze.
»Mein Vater hatte ihn im Tiergarten aufgegabelt. Und dann stand er an einem schönen blauen Sonntag vor unserer Tür. Gestiefelt und gespornt. Ich sah gleich, dass er sich nicht wohlfühlte. Dieser Anzug. Nein. Also wirklich, zum Piiiepen.« Sie machte eine Pause.
»Warst du gleich in ihn verliebt?«
»Ich?«
»Ja.«
Sie wiegte vorsichtig den Kopf.
»An manches kann ich mich dann doch nicht mehr so genau erinnern, weißt du – aber wahrscheinlich schon.«
»Und du warst damals …«
»Dreizehn.«
»Und er?«
»Siebzehn.«
Ihr Kopf kippte leicht vor, als würde sie einnicken. Kurz darauf sprach sie weiter, die Augen halb geschlossen.
»Mal sehen, wie lange er heute wieder braucht. Eigentlich eine Frechheit, er verschwindet, und es kommt ihm nicht in den Sinn zu sagen, wohin er geht oder wann er zurückzukommen gedenkt. Das geht nun schon ein ganzes Leben so. Uuuunglaublich.«
2
Im Mai 1915, bei der Schlacht von Gorlice-Tarnów, fiel der Barbier Otto Joos durch einen Schuss in die Brust, als er mit dem Bajonett die feindliche Linie stürmen wollte.
In der Parterrewohnung eines dritten Kreuzberger Hinterhofs entband seine Frau Anna mithilfe der herbeigeeilten Nachbarin unter den Augen ihrer kleinen Tochter Erna einen Jungen. Das Baby war klein und wog gerade drei Kilo, trotzdem machte es einen erstaunlich kräftigen Eindruck. Die Geburt hatte zwanzig Minuten gedauert.
»Armer Steppke, keen Vata nich!« Die Nachbarin schüttelte den Kopf.
»Hör uff so zu berlinern. Das Kind soll was Besseres hören.«
Anna gab dem Kleinen die Brust. Sie war bemüht, so klar und vornehm wie möglich zu sprechen, verzog dann aber erschrocken das Gesicht.
»Autsch. Der hatn juten Zug.«
»Mensch, Anna, wat machste nu? Jetz haste nochn Maul su stopfen.«
Anna hörte nicht zu. Sie schaute ihren neugeborenen Sohn an.
»So ’n Pech mit den Otto. Det dir aber ooch alle wegsterben. So ’n Pech auch. Nee.«
»Kannst gehen, Frau Kazuppke, die Erna hilft mir.«
Die Tür fiel ins Schloss. Frau Kazuppke schüttelte noch ein paarmal den runden Kopf und wischte die blutigen Hände an ihrer fleckigen Schürze ab. Sie hatte schon einige Nachbarskinder zur Welt gebracht und andere zu den Engeln geschickt. Sie kannte das Leben, und sie wusste, dass mit diesem Jungen ein Problem mehr auf die Welt gekommen war.
Erna schlich auf ihren spindeldürren Beinen heran. Vorsichtig schob sie ihr scharfgeschnittenes Gesichtchen über die Schulter der Mutter.
»Süß«, sagte sie trocken, »wie solla ’n heeßen?«
»Otto. Wie sein Vata.«
Erna nickte.
Ein paar Wochen später, beim Kirchgang, lernte Anna den arbeitslosen Maurer Karl kennen. Auf der Kirchenbank hatte sie auch ihre anderen Männer kennengelernt. Nicht der schlechteste Ort dafür. Jeder, der hierherkam, suchte Besinnung, innere Einkehr oder Trost für seine geschundene Seele. Nach der Messe ließ sich leicht ein Gespräch anfangen. Ein Pläuschchen. Oder auch mehr. Wer in die Kirche ging, um die Worte des Herrn zu hören, war bereit, sich zu öffnen. So viel stand fest. Und er war wohl auch kein ganz schlechter Mensch, denn er glaubte an etwas Höheres, und das Höhere bedeutete Anna viel.
Karl war ein stattlicher Mann. Das Leben hatte ihm übel mitgespielt, das erkannte Anna sofort. Breite Schultern und in der stolzen Brust ein gekränktes Herz, solche Gegensätze zogen sie an. Sie sah in ihm eine Wohnung, die zwar stark renovierungsbedürftig, aber auch vielversprechend war. Das Gute an solchen Männern: Die Konkurrenz erkannte selten ihr Potenzial, jedenfalls nicht so schnell wie Anna. Aus ihrem ersten Mann Wilhelm, dem Willi, wäre sicher etwas geworden. Er arbeitete nicht gerne, aber so etwas ließ Anna nicht gelten. »Keine Feigheit vor dem Feind«, sagte sie immer in ihrem besten Hochdeutsch, und sie wusste, wovon sie sprach. Sie selbst scheute keine Mühen, war sich für nichts zu schade, wenn es darum ging, ihre Familie zu schützen, den Kindern und dem Mann ein gemütliches zu Hause zu bieten. Eine warme Mahlzeit am Tag, auch wenn in der Erbsensuppe nur selten genügend Fett, geschweige denn ein bisschen Wurst schwamm, es gab immer ein paar Stullen für die Arbeit oder für den Schulhof. Anna war arm und erfinderisch. Sie fürchtete sich vor nichts und niemand, auch nicht vor Autoritäten. Mit ihrem Mutterwitz wickelte sie ebenso raffiniert wie charmant gerade wohlhabende Leute mühelos um den Finger. Als Putzfrau war sie begehrt, schnell, akkurat, vertrauenswürdig. Oft gab man ihr mehr als das vereinbarte Geld: ein Schmuckstück, ein abgetragenes Kleid, Besteck, das man nicht mehr wollte oder ein altes Möbelstück, das einem neuen weichen musste. Die Herrschaften freuten sich über diese junge Frau, die so wissbegierig war, die Freude an der schönen Einrichtung fand, ohne zu fragen, warum sie nicht auch so leben durfte. Selten behielt Anna diese Geschenke. Meist fand sie schnell einen Käufer, um mit dem Erlös ihre Ersparnisse für schlechte Zeiten aufzupolstern. Sie war eine Frau mit Weitblick.
Willi war überfordert. Er begann sich immer mehr zurückzuziehen, fing das Trinken an, kam nächtelang nicht nach Hause und erhängte sich schließlich in einer sternklaren Nacht am Ast eines morschen Baums im Tegeler Forst. Durch seinen schweren Körper brach der Ast, aber auch sein Genick. Von ihm stammte Annas älteste Tochter, die siebenjährige Erna. Anna liebte Erna, doch sie war klug genug, um zu erkennen, dass da ein kleines Luder heranwuchs, vor dem man sich beizeiten in Acht nehmen sollte oder das man vor sich selbst schützen musste. Leider gingen in demselben Hinterhof, in dem sie Parterre wohnte, in den oberen Stockwerken junge Dinger dem horizontalen Gewerbe nach. Wenn Anna müde von der Arbeit nach Hause kam, drückten sich die Abendbesuche in verklemmter, aufgestauter Lust an ihrem Fenster vorbei. Dicke, dünne, alte, junge, hübsche, hässliche – aus guten, aus besseren, aus schlechten Kreisen. Einige klopften auch an ihr Fenster, klingelten an ihrer Tür, denn Anna war nicht nur jung und hübsch, sie war auch das, was viele Männer »anziehend« fanden. Aber Anna war nicht käuflich. Sie verachtete die jungen Frauen nicht, aber sie war stolz, sie wäre lieber verhungert, als sich einem dieser Kerle für ein paar Mark hinzugeben. »Stolz ist det Einzje, wat ’ne arme Frau hat, den darfste dir nich’ abkoofen lassen, sons biste Neese.« Aber Ernas Vater, der Willi, war schwach. Da konnte auch der liebe Gott nicht helfen.
Kurz nachdem sie ihn begraben hatte, lernte sie in der Kirche Otto kennen. Von außen betrachtet war er das Gegenteil von Willi. Klein, eher zart, die Schultern schmal, volle Lippen, darüber ein kecker Schnurrbart, den er sorgsam pflegte. Otto war Friseur. Er trank nicht, hurte nicht herum, verfügte über gute Ersparnisse, einen wendigen Geist, war fleißig, wenn auch nicht besonders ehrgeizig. Darauf konnte man bauen. In kurzer Zeit setzte ihm Anna den Floh ins Ohr, er könnte doch Barbier werden. Als Barbier würde er seine Familie besser versorgen, er wäre dann wer, könnte auch Operationen machen, wie ein echter Arzt, einen kaputten Zahn ziehen, Abszesse aufschneiden. Mit vereinten Kräften kämen sie dann sicher bald aus der Parterrewohnung heraus, vielleicht in den zweiten Hinterhof, vor allem aber weg vom schlechten Einfluss und noch schlechterer Gesellschaft, womit eher die Freier als die Huren gemeint waren. Vor ihnen fürchtete sich Anna. Nicht um ihretwillen, sie wusste sich Respekt zu verschaffen, nein, es ging ihr um die kleine Erna. Sie wusste, dass unter diesen Männern, die täglich kurz nach Einbruch der Dunkelheit im Hof herumlungerten, auch Perverse waren, die spätestens in zwei, drei Jahren ihre widerlichen Finger nur allzu gern nach ihrer kleinen Erna ausstrecken würden.
Otto schaffte den Aufstieg schnell. Er war geschickt und wäre unter besseren Voraussetzungen wohl Chirurg geworden. Vielleicht hätte er es mit Annas Hilfe sogar so weit gebracht, aber dann kam der Krieg, vier Jahre Grausamkeit, und Otto fiel, wie viele andere seines Alters, für sein Vaterland, drei Monate bevor er selber Vater wurde. Er war Annas große Liebe, und so gab sie dem gemeinsamen Sohn seinen Namen.
Ottos Stiefvater Karl fand wenig Gefallen an dem Jungen. Eifersüchtig registrierte er jede Geste, jede kleinste Aufmerksamkeit, die Anna ihrem Sohn angedeihen ließ. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Ingeborg wurde es noch schlimmer. Nun hatte Karl endlich sein eigenes Kind. Die Blagen, wie er Erna und Otto nannte, waren ihm lästig. Er sah nicht ein, warum er für fremde Brut den Rücken krumm machen sollte. Den Krieg hatte er undekoriert überlebt, und alles, was ihm aus dieser Zeit blieb, war ein schweres Trauma: plötzliche Angstschübe, die er immer regelmäßiger mit Alkohol bekämpfte. Schritt für Schritt verlagerte er den Krieg von außen nach innen. Was er nicht vertrank, verspielte er, in der Hoffnung, das verlorene Geld zurückzugewinnen. Beim Bau war er rausgeflogen, ausgeträumt der Traum vom Polier. Er nahm, was kam, verdingte sich als Gelegenheitsarbeiter, meist in der Fabrik. Ein Ungelernter war er nun, ein Hilfsarbeiter, ein Niemand. Bis auf den Boden der Schnapsflasche suchte er vergeblich nach seinem verlorenen Stolz. Samstags bekam er seine Lohntüte, die er meist noch in derselben Nacht vertrank. Dann taumelte er nach Hause und prügelte alle windelweich. Nur nicht seine kleine Inge.
Anna konnte ihn nicht aufhalten. Sie wusste, dass sie Otto und Erna in Sicherheit bringen musste. Durch ihre Arbeitgeberin erfuhr sie von der Kinderlandverschickung. Da Otto und Erna einen verstörten, ausgemergelten Eindruck erweckten, gelang es ihr recht schnell, für beide einen Platz zu finden. Otto kam zu einer Familie in Oberschlesien, Erna verschlug es ins Ruhrgebiet.
Anna trennte sich schwer, aber sie wusste sich nicht anders zu helfen. Erna war in letzter Zeit oft davongelaufen, und der kleine Otto stotterte vor Angst, wenn er seinen Stiefvater Karl auch nur von Weitem sah. Dem Anschein nach war es ein gutes Geschäft für beide Seiten. Die Kinder waren in Sicherheit, und die Gasteltern bekamen vom Staat ein ordentliches Zubrot für die Haushaltskasse. Ein knappes Jahr dauerte die Trennung. Eine Erholung für Erna, die Hölle für Otto, der vom Regen in die Traufe kam.
Morgens um fünf riss ihn die noch halb trunkene Irmgard mit ihren dicken Armen aus dem Schlaf, stopfte ihn draußen vor der Tür bei klirrender Kälte in einen Bottich mit Eiswasser und tauchte ihn mit dem Deckel unter, bis er zu ertrinken drohte. Jedes Mal amüsierte sie sich königlich über sein Gezappel. Otto lernte schnell, dass sie den Deckel erst wieder hochnahm, wenn er sich darunter nicht mehr rührte. Außerdem hatte er entdeckt, dass es zwischen dem Deckel und dem Wasserspiegel einen kleinen Spalt gab. Vorsichtig hielt er den Mund knapp über der Wasseroberfläche und schnappte nach Luft, bis Irmgard den Deckel wieder hob, um ihn in letzter Sekunde, wie sie meinte, aus dem Wasser zu ziehen.
Otto wurde zum Bettnässer und kotete sich ein. Der Gastvater packte ihn dann am Schlafittchen und zwang ihn fluchend, »den Dreck« aufzufressen. Weigerte er sich, schlug ihm der Gastvater mit der eingekoteten Hose ins Gesicht. Im Weggehen murmelte er drohend, er werde ihm schon noch diese Fisimatenten abgewöhnen. Otto stotterte nicht mehr, er hörte ganz auf zu sprechen. Dann verweigerte er das Essen. »Wer nich’ will, der hat schon«, kommentierte Irmgard sein Verhalten ungerührt.
Nach elf Monaten rettete Anna ihren Sohn knapp vor dem Hungertod. Sie holte beide Kinder zurück nach Berlin. Dort führte sie von nun an ein eisernes Regiment. Erhob Karl die Hand gegen eines der Kinder, schlug sie ihm mit dem Besen auf die Finger oder entzog sich ihm nächtelang.
In der Schule war Otto der Kleinste und Schwächste. Seine Klassenkameraden traten an die Stelle des Vaters und verprügelten ihn tagein, tagaus. Als er sich wieder einmal das blut- und tränenverschmierte Gesicht über dem verdreckten Waschbecken der nach altem Urin stinkenden Schultoilette abwusch, betrachtete er sich im Spiegel und sah, dass sich etwas ändern musste. Von einer Baustelle klaute er nachts ein paar schwere Ziegelsteine und eine herumliegende Eisenstange. Er feilte die Löcher der Ziegel aus, sägte die Eisenstange zurecht und bastelte sich eine Hantel zusammen. Im Hof stand ein kleines Eisengerüst. Über die Stange warfen die Frauen ihre billigen Teppiche, um sie mit einem aus Rohr geflochtenen Klopfer zu bearbeiten. Anna hatte diese Arbeit ihrem Karl überlassen. »Tust ja sonst nischt.« Von Liebe war keine Rede mehr. Wenn er sich auf sie legte, spreizte sie die Beine und stöhnte schnell und laut, damit’s ihm kam. Bald besann sich Karl darauf, dass man mit dem Teppichklopfer auch die Hintern seiner missratenen Familie bearbeiten konnte.
Jeden Morgen stand Otto nun zwei Stunden früher auf, schlich an seinem schnarchenden Stiefvater vorbei, der meistens auf der Couch im Wohnzimmer übernachten musste, goss sich in zorniger Erinnerung an seine Peinigerin Irmgard einen Kübel eiskalten Wassers über den nackten Körper, holte, in Unterhose und Feinripp, seine Hantelstange aus dem Kellerversteck und ging auf den Hof, um zu trainieren. Anfangs gelang es ihm kaum, das Gewicht in die Höhe zu stemmen, sich an der Teppichstange hochzuziehen oder sich mehr als dreimal vom Boden in den Liegestütz zu drücken. Aber er wusste, wenn er jetzt aufgeben würde, wäre er für immer verloren. Die Lektion war klar und einfach: Prügel kriegen oder austeilen. Er war sich nicht einmal sicher, ob er austeilen wollte, aber er wusste, dass er nicht mehr einstecken durfte. Nach ein paar Wochen wurden die Ziegel zu leicht. Er befestigte zwei volle Bierkästen, die er seinem lallenden Stiefvater im Halbschlaf unter dem Bett weggezogen hatte, mit einem Seil an der Eisenstange und steigerte sich zügig von drei Fünfersätzen zu vier Sätzen à dreißig. Anna sah ihrem Sohn vom Fenster aus zu und schwieg. Sie hatte verstanden. Wann immer es Kartoffeln gab oder gar Butter und Brot, legte sie es für Otto beiseite. Ein halbes Jahr später war Otto immer noch unverändert klein, aber aus all seinen Sachen herausgewachsen. Muskelbepackt trat er still den Schulweg an, der so lange sein Kreuzweg gewesen war.
Paul Meister, Ottos Erzfeind, den alle ehrfürchtig Paule nannten, war nicht der Hellste in der Klasse, aber mit seinen Fäusten war er schneller als jeder Streber beim Einmaleins. Wer sich seinem Willen widersetzte, den trommelte er zu Boden. Und da er auch im Sprechen nicht der Wendigste war, befehligte er seine Truppen mit Blicken.
Es war ein Montagmorgen im Dezember. Auf dem Schotter des Schulhofs lag kalt der Raureif. In der ersten großen Pause teilte Paule mit ein paar herrischen Gesten zwei Mannschaften zum Fußballspiel ein. Otto stand absichtslos in einer Ecke. Sorgfältig packte er das Butterbrot aus, das seine Mutter ihm mitgegeben hatte. Das dreckverschmierte Leder traf ihn mit voller Kraft ins Gesicht. Schießen konnte Paule. Seine Claqueure grölten vor Freude.
»Otto der Doofe kackt sich inne Hose«, schrie ein dünner, pickeliger Knabe. »Otto der Schlappschwanz schiebt sich Butterbrote in den Wanst«, setzte ein rotgesichtiger Junge nach, der sich hinter Paule versteckt hielt. Seine Arme standen weit vom dicken Körper ab, als hätte ihm jemand die Krücken weggerissen.
Siegesgewiss stolzierte Paule auf Otto zu. Er blieb vor ihm stehen. Mit einem kurzen Blick aus den Augenwinkeln bedeutete er Otto, seinen Platz in der Mannschaft einzunehmen. Dann geschah alles sehr schnell. Otto verpasste ihm mit seiner Rechten einen Leberhaken. Während Paule fast erstickte, krachte Ottos Linke zuerst mit der Faust und dann mit dem Ellenbogen in sein Gesicht und zertrümmerte ihm Nase und Jochbein. Als Otto auf ihm lag und sein Gesicht wie einen alten Lappen über den Schotter riss, konnte Paule sich nicht mehr genau daran erinnern, ob er erst etwas gesagt hatte, um dann Otto das Butterbrot aus der Hand zu hauen, oder ob es umgekehrt gekommen war.
Die Claqueure wichen stumm zurück. Hilfe suchend streckte Paule ihnen sein blutendes Gesicht entgegen. Keiner rührte sich. Alle starrten ehrfürchtig zu Otto. Er war der neue König. Gleichgültig schlenderte er vom Platz.
Ein älterer Junge kam ihm von der anderen Seite des Schulhofs entgegen, als sich alle verkrümelten. Er streckte Otto die Hand entgegen.
»Roland.«
Otto sah ihn schweigend an. Er kannte den Unterprimaner vom Hörensagen. Um solche Leute hatte er immer einen Bogen gemacht. Sie würden ihn sowieso nie beachten. Jetzt sah er ihm zum ersten Mal in die Augen. Blau-weiße Milch, dachte er. Roland war wenig größer als er. Seine knotigen Hände hingen locker, aber in leichter Spannung vom Körper, eigenartig abgewinkelt, die Beine in entspannter Bereitschaftsstellung. Ein Kämpfer. Otto erkannte es sofort. Er schlug ein.
3
»Det is der Otto.«
Sie standen in einer alten Turnhalle. Es roch nach Schweiß. Auf den Matten trainierten Jugendliche, die meisten älter und kräftiger als Otto. Sie trugen schwarze, eng anliegende einteilige Anzüge mit kurzen Hosen. Lautlos verkeilten sie ihre Körper ineinander. Ab und zu pressten sie die Luft stoßartig aus den Lungen, um sich keuchend aus einem Hebelgriff zu befreien, oder den Gegner mit Armen und Beinen zu umschlingen.
Der Mann, den alle Chef nannten, war vielleicht Anfang zwanzig. Die Augen unter seiner niedrigen Stirn ruhten starr und kalt auf Otto, als gälte es ihm ein Geständnis zu entlocken. Unbeirrt sah Otto zurück.
»Anfänger?«
Otto nickte. Der Chef deutete auf eine Tür auf der gegenüberliegenden Seite.
»Jeh ma su Atze und hol dir ’n Trikot.« Damit wandte er sich wieder seinen Ringern zu, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen. Im Hinübergehen beobachtete Otto, wie er sanft, aber bestimmt an die Jungs herantrat, hier und da einen Griff korrigierte oder eine andere Haltung demonstrierte.
In den nächsten Wochen trainierte Otto regelmäßig mit Roland im Ringverein Sport-Club Lurich 02. Den Chef sah er nur aus der Ferne, er kümmerte sich nicht um Anfänger. Ab und zu hörte er seine leise, raue Stimme, die eher an einen Mann um die fünfzig denken ließ. Für die Jugend war Atze zuständig, ein alter Haudegen, der, wie viele seiner Generation, dem Alkohol verfallen war. Die zusammengekniffenen Augen in seinem zerfurchten Gesicht sahen wie umgekippte Schießscharten aus, die ganze Erscheinung eine verlassene Festung in Geisterhand. Sein eigentlicher Lehrer war Roland. Er brachte ihm alle Tricks und Kniffe bei. Otto wurde immer stärker. Nach dem Training fiel er zu Hause vor Erschöpfung in tiefen, glücklichen Schlaf. Jedes Mal lernte er einen neuen Bereich seines Körpers kennen. Seine Kraft wuchs von Tag zu Tag, und er wusste sie mit Feingefühl einzusetzen. Er lernte siegen, schnell den Gegner zu pinnen, ihn mit beiden Schultern für drei Sekunden auf die Matte zu drücken. Die Regeln waren einfach, es wurde geworfen, geschleudert und gehebelt. Der Gegner wurde zu Fall gebracht, um ihn möglichst schnell passgenau zu drehen. Otto war für seinen Spaltgriff gefürchtet. Dabei fasste er dem Gegner unter die Beine, um ihn anschließend blitzartig hochzureißen. Er verstand sich bald gut aufs Tricksen, entwickelte eine überraschende Kreativität, wenn es darum ging, die Stärken und Schwächen des Gegners zu erkennen und zu nutzen, dessen Kraft ins Leere laufen zu lassen. Er berauschte sich zunehmend an dem neuen Körpergefühl.
Zu Hause beobachtete sein Stiefvater wie ein angeschlagenes Leittier die Veränderung des Jungen. Einmal erhob er die Hand gegen Otto. Er verharrte wie von einem unerwarteten Schmerz durchzuckt in dieser Pose. Sein Atem ging schwer, dann drehte er sich weg. Es war kurz nach dem Abendessen gewesen. Alle hatten den gespenstischen Auftritt miterlebt. Karl verschwand, oder war es nur noch sein Schatten, der sich davonschlich? Nur Otto hatte das leise Zittern seiner Augenlider gesehen.
Der Frieden, wohl eher nur ein Waffenstillstand, hielt nicht lange an. Als Otto eines Abends erschöpft, aber glücklich vom Training die Wohnungstür hinter sich schloss, traf ihn ein harter Schlag, der in der Dunkelheit nur knapp sein Genick verfehlte. Sein Kopf fiel nach vorne, und er sackte geräuschlos zu Boden. Karl riss den Küchenstuhl in die Höhe, um sein Werk zu vollenden, als ein brennender Schmerz seinen Körper durchzuckte. Wie ein angeschlagenes Tier kroch er in Todesangst winselnd aus dem Flur. Anna legte den glühenden Schürhaken überraschend ruhig auf den Ofen und sah nach ihrem Sohn. Sie versorgte seine Platzwunde und brachte ihn zu Bett. Mit Eiswasser kühlte sie seine heiße Stirn. Als sie ihm schluckweise warme Honigmilch gab, sah er sie lange an. Er fasste ihre Hand.
»Du musst keene Angst nich um mich haben, Mutta. Ick kann malochen bis sum umfallen. Ick werde imma wat su ackern finden. Ick bring uns alle durch. Morjens um viere will ick jetz Briketts austragn, ick hab ooch noch janz andere Ideen. Und dann kannste dir ausruhen. Du sollst nicht imma für alle schuften.«
Anna blickte voller Stolz auf ihren einzigen Sohn. Er war jetzt dreizehn Jahre alt und rasierte sich jeden Morgen. Sie sah die Augen und das Kinn seines Vaters, sie sah ihren gefallenen Mann.
Komische Zeiten. Im Krieg hatten sie gehungert. Manche Söhne waren vor ihren Vätern gestorben, andere wurden geboren, nachdem die Väter gefallen waren.
»Otto«, sie nahm seine Hände, »hör auf zu berlinern. Dein Vater hat es auch nicht getan. Er war ein guter Mann. Er war Barbier, rasierte und operierte vornehme Kundschaft. Wenn die Nacht schwarz ist, gehört ’n Junge ins Bett. Wenn du hier rauswillst, musste dich auf deinen Hosenboden setzen, nicht Briketts schleppen.«
Er liebte die Hände seiner Mutter. Hätte sie bloß nicht diesen Kerl geheiratet. Sein Stiefvater war zu nichts gut.
»Det schaff’ ick.«
»Ich.« Sie lächelte.
»Ich«, sagte er.
»Und wasch deine Haare, sonst bekommste ’ne Glatze wie dein Vater.«
»Nee, Mutta, bei mir brechen de Kämme durch, so dick sin meene Haare.«
»Meine«, sagte sie.
»Meine.«
4
»Wat willst’n du hier?«
Ein grober Kerl blickte Otto von oben herab an.
»Kohle«, sagte Otto. Er hielt dem prüfenden Blick stand.
»Austragen oder einsacken?« Der Mann war höchstens Mitte zwanzig, sah aber aus wie fünfzig. Gesicht und Hände schwarz, breite Schultern, kräftige Arme. Seine Haut war rau und fleckig wie eine alte Lederschürze. Otto starrte ihn an. Irgendwoher kannte er diesen Mann.
»Beides«, sagte Otto und stellte sich breitbeinig hin.
Der Mann sah ihn aus dunklen Schlitzen an. Dann pfiff er kurz.
»Komm ma mit runta, du Piepel, ick will ma sehen, ob de bein Handwerk jenauso jut bist, wie mit`n Mundwerk. Die meisten, die herkommen, feifen La Paloma, aber ham keenen Arsch inne Hose.«
»Ick feife nicht bei de Arbeet.«
Woher kannte er diese Stimme? Otto war zu aufgeregt, um der Frage nachzuspüren.
Schweigend gingen sie die Treppe hinunter in den pechschwarzen Keller. Der Mann hustete sich durch die rußige Luft. Otto riss die Augen auf, so etwas hatte er noch nicht gesehen. Die Briketts füllten tonnenweise geschichtet den Raum. Der Chef musste unermesslich reich sein.
»Wann ham Se’n anjefangen mit de Kohlen?«
»Vor hundert Jahre, sagen meene Knochen.«
»Und seit wann jehört Ihnen det hier?«
Der Mann gab ihm einen Katzenkopf.
»Stell ick hier die Fragen, oder wer?« Otto schwieg.
»Räum ma de linke Tonne von hinten, an de rechte Wand hier vorne.«
»Wieso?«
»Willste studieren oder arbeeten?«
Beim Anblick der riesigen schwarzen Wand vor seinen Augen erschien Otto ein Studium zum ersten Mal verlockend, und er sehnte sich nach der gemütlichen Schulbank, auf der er in ein paar Stunden vor Erschöpfung einschlafen würde.
»Ick jeb dir ’ne halbe Stunde. Wenn de det schaffst, jib’s dreißig Pfennje, wenn nich, haste Lehrjeld jezahlt und kannst dir von’ Acker machen. Mund zu, sonst kommen de Fliegen rin.«
Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, schob er seinen schweren Körper ebenso schweigend die Treppen hoch, wie sie heruntergekommen waren. Krachend fiel die Tür ins Schloss. Otto suchte nach dem Lichtschalter. Er hörte ein Rascheln. Angespannt lauschte er in die Dunkelheit. Am liebsten hätte er laut mit sich selbst gesprochen, aber vielleicht stand der Kerl noch oben hinter der Tür. Wieder raschelte es. Etwas bewegte sich. Wahrscheinlich Ratten. Bei ihnen in der Hermannstraße hatte der Stiefvater mal eine im Keller erschlagen. Das Biest war dreißig Zentimeter lang, mit riesigen, scharfen Zähnen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Finsternis. Er suchte vergeblich nach dem Lichtschalter, da tönte von oben die bekannte, staubtrockene Stimme:
»Zerbrochene Briketts werden vom Lohn abjezogen.«
Wer war das? Verdammt, er kannte den Mann doch …? Egal, er hatte jetzt keine Zeit. Es musste doch hier unten irgendetwas geben, was einem die Arbeit erleichtern würde. Womit wurden denn diese riesigen Paletten bewegt? Und was meinte der Chef mit der linken Tonne von hinten? Irgendeine Tonne von links hinten, oder die hinterste Tonne auf der linken Seite? In dem Fall müsste er die zwei Reihen davor zuerst wegräumen. Unmöglich. In einer halben Stunde konnte er nicht jedes Brikett einzeln umschichten. Unschlüssig sah er sich um. Nichts. Sollte er sich lieber aus dem Staub machen? Seine Mutter hatte wohl recht, er war zu jung für diese Arbeit, und den rüden Ton kannte er auch schon von seinem Stiefvater, dafür musste er sich nicht in einem Keller einsperren lassen. Wieder hörte er das Rascheln. Die Briketts waren reihenweise dicht an den Wänden aufgeschichtet. Wenn da aber Ratten oder andere Tiere herumkrochen, musste es irgendwo einen Hohlraum geben, und wenn es einen Hohlraum gab, dann würde man dort vielleicht etwas lagern, etwas, das man hier unten brauchte. Wie kamen die Kohlen verdammt noch mal nach draußen? Die Treppe war viel zu schmal. Außerdem war es oben nicht besonders dreckig, keine Spuren von Ruß. Otto bewegte sich tastend vor.
»Ah.« Er war gegen einen Eisenträger gestoßen. Vorsichtig ging er auf die Knie und rutschte weiter in die Richtung, aus der das Rascheln kam. Es könnte dort einen Schacht geben, durch den die Kohlen nach oben transportiert wurden. Von dort müsste auch Licht in den Raum fallen. Vielleicht lag da Werkzeug rum. Langsam gefiel ihm seine Aufgabe. Er dachte an die dreißig Pfennig, wie viel das in der Woche, wie viel es im Monat machen würde, wie oft er dreißig Pfennig verdienen müsste, um seiner Mutter etwas Besonderes davon zu kaufen. Ein neues Radio. Das wäre eine feine Sache. Das Hochzeitsgeschenk seines Stiefvaters schepperte blechern vor sich hin, und der Empfang war saumäßig. Beim Elektrohändler stand eins im Schaufenster. Er hatte sich schon oft die Nase an der Scheibe platt gedrückt, so schön und einmalig stand es da, er sah es vor sich, während er sich weiter nach vorne arbeitete. Die eleganten runden Drehknöpfe an der Vorderseite, die beigefarbene Bespannung aus feinstem Stoff. Der Klang musste göttlich sein. Genau das Richtige für eine Konzertübertragung, die seine Mutter so gerne hörte. Der Kasten war gewiss aus Mahagoni. Das kostet ein Vermögen, dachte er. So etwas würde sich der Stiefvater nie leisten können. Aber seine Mutter träumte davon, das wusste Otto. Er kniete vor einer großen schwarzen Wand. Ein winziger Lichtstrahl zwängte sich durch die Ritzen der Briketts. Da musste es sein. Auf Zehenspitzen, die Arme ausgestreckt, trug er die oberste Reihe ab. Es wurde heller. Lautes Rascheln. Ein Fallrohr lenkte seinen Blick nach oben. Er hörte, wie eine Ratte hinaufkletterte. Vier Meter über ihm befand sich ein großes Gitter. Das war der Schacht, durch den die Kohle rein- und rausging. Er kletterte über die halb abgetragene Brikettmauer. Welcher Idiot hatte diesen Zugang verstellt? Und warum? Da standen zwei Sackkarren und eine fahrbare Hebebühne. Geschafft. Der Rest war Kinderspiel. Bevor seine Zeit abgelaufen war, stand er oben vor dem Chef. Der blickte von seiner Taschenuhr auf.
»Dreiundzwanzig Minuten und zwölf Sekunden.«
»Den Rest könnse behalten.«
»Morgen früh um fünwe. Jehste noch sur Schule?« Otto nickte. »Wat macht dein Vata?«
»Der is’ in Krieg jefallen.«
»Wo?«
»Gorlice-Tarnów.«
»Wo issn det?«
»Galizien.«
»Scheißkrieg. Hab beede Brüder dort valorn.«
»Wo?«
»Bein Jasangriff in Ypern. Det is in Belgien. Janz stolz warn se. Jetz is allet bald vorbei, hamse jeschrieben, mit det deutsche Jas drehen wa denen de Lichta aus. Is dann anders jekommen. Sin beede janz jämmerlich erstickt. Scheißvaterland. Beschissn hamse uns, von oben die Jauche über uns ausjekippt. Und wer löffelt die Brühe aus? Sicher nich’ die, die se uns einjebrockt ham. Kieck da de Verträge an, die se uns in Versailles uffjetischt ham, da wern wa uns noch lange dran vaschlucken.«
Er steckte ihm ein Geldstück in die Hand. Otto starrte ungläubig darauf. Es waren nicht dreißig Pfennig, es war eine ganze Mark. Er war ein gemachter Mann.
»Hau nich’ allet uffn Kopp. Wer weeß, wie lange wa noch wat ham. Und vajess de Schule nich. Du hast wat inne Birne. Wirf det nich’ weg.« Er streckte ihm die schwielige Hand entgegen. »Morgen um fünwe. Ick bin Egon.«
Otto stand aufrecht da, als wäre er soeben zum Ritter geschlagen worden. Er griff nach der schweren Hand und hörte überrascht seine eigene feste Stimme.
»Otto.«
»Weeß ick.«
Ick ooch, dachte Otto jetzt. Egon hielt seine Hand fest. Otto war, als wärmten diese kleinen, kalten Augen in dem schwarzen Gesicht plötzlich den ganzen Raum.
»Schmal biste, aber hast jut trainiert. Kannst ooch als Ringer wat werden. Viele glooben sum Ringen braucht man Kraft, aber siegen tun nur die, die mitn Kopp kämpfen. Darfst dich nur nich mit die Falschen einlassen. Is ooch viel Jesochse bei uns in’n Vaein. Die verspeisen Jungs wie dich sum Frühstück. Und setz det Ringen richtig ein. Die Kunst des Ringens wurde erlernt, um die Schwachen und Unterdrückten su schützen, nicht andersrum.«
Die letzten Worte hatte er in ein etwas ungelenkes Hochdeutsch verpackt.
»Vajess det nich’«, schob er in seinem gewohnt schnoddrigen Ton schnell hinterher.
Zum ersten Mal lächelte er. Ein Grinsen zog sich breit über die rußgegerbte Lederhaut. Otto erwiderte den Händedruck. Er hatte es geahnt. Egon war der Chef vom Ringverein Sport-Club Lurich 02.
Auf der Straße traf ihn die Sonne wie ein Blitz. Er sprang in die Luft.
5
Sein Stiefvater wischte sich mit der Hand über den Mund und seufzte rülpsend. Der Eintopf war aufgegessen.
»Wie anner Front, nur besser.«
Karl hatte es nicht lange an der Front ausgehalten. Eines Morgens hatte er sich mit dem Gewehr in den linken Fuß geschossen und wurde wegen Untauglichkeit zurück in die Heimat geschickt. Seine Kameraden hielten zu ihm, sie wussten, dass Karl zu schwach für diesen Krieg war, zu schwach für dieses Leben. Keiner verlor ein Wort über die Selbstverstümmelung, um ihm das Kriegsgericht zu ersparen. Und nun war er Hilfsarbeiter, ein gebrochener, stattlicher Mann.
»Dafür ham die uns in Versailles teuer zahlen lassen«, sagte Otto trocken.
»Wat für’n Ding? Hör uff mit die Fisimatenten, bild dir ja nüscht ein, du Rotzlöffel. Kieck’n dir an, Mutta, mit seine Eselsohren will der jetz eenen uff Schlaumeier machen.«
Warum hatte seine Mutter diesen Idioten heiraten müssen? Otto spürte, wie kalte Wut langsam in ihm hochstieg.
»Esel mit kleenere Ohren als ick ham schon größere Disteln jefressen wie dir.«
Er sah zu seiner Mutter. Wie dich, hätte es geheißen. Er biss sich auf die Zunge und duckte sich blitzschnell unter dem Teller weg, der auf ihn zuflog.
»Wir hams ja«, murmelte Anna, als sie die Scherben aufsammelte.
Karl starrte sie aus wässrigen Augen drohend an, dann riss er das Tischtuch mit allem, was darauf stand, herunter. Keuchend deutete er auf den Boden.
»Abjeräumt.«
Als seine Mutter ihn zur Nacht küsste, sah Otto sie ernst an. Er sprach langsam und bedacht.
»Mutter, ich will auf die Höhere Schule.«
Anna legte ihm die Hand auf die Stirn. Sie nickte und löschte das Licht. Er blieb wach. Er hatte nicht berlinert. Der Mond erleuchtete das Zimmer. Auf der Wand lag der Schatten des Fensterkreuzes. Seine Schwester Erna schlüpfte zu ihm unter die Bettdecke.
»Haste schon ma jefickt?« Sie war drei Jahre älter als er. Otto schüttelte den Kopf.
»Willste ma probieren?« Sie nahm seine Hand und führte sie über ihre dürren Schenkel.
»Hör uff, sonst kleb ick dir eene.«
»Mach ick’s ma ebn selba.« Kichernd drehte sie sich zur Wand und presste ihren kleinen Hintern fest an ihn.
»Ick wette, du fickst besser als die Alten.«
Otto kämpfte gegen den aufsteigenden Ekel an. Er wusste, wie Erna ihr Taschengeld aufbesserte. Sie ging im Puff über ihnen nicht nur putzen. Er rechnete, wie viel er in den nächsten Wochen verdienen könnte. Er musste hier raus. Die leuchtenden Zahlen im Kopf, fiel er unter dem rhythmischen Gestöhne seiner Schwester in einen unruhigen Schlaf.
In den nächsten Monaten versorgte er jeden Morgen die Nachbarschaft mit Briketts. Abends half er in einem Feinkostgeschäft aus, schleppte Kisten, sortierte Ware aus. So kam er an altes Brot, Gemüse, Salat, alles, was der vornehmen Kundschaft nicht mehr frisch genug war. Er brachte es nach Hause. Die Familie musste nicht mehr hungern.
Als Ringer schaffte er es bis in die Bezirksmeisterschaften. Der Verein nahm neben der körperlichen Ertüchtigung die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten seiner Mitglieder in seine Satzung auf. Die Arbeiter sollten sich von der schweren, eintönigen Maloche an den Maschinen erholen, kommunistische Ideale und Klassenbewusstsein wurden vermittelt. Zum ersten Mal hörte Otto das Wort Bildung.
Zum zweiten Mal hörte er von der Höheren Schule.
»Wat willste denn da?«, fragte sein Stiefvater Karl.
»Das verstehst du nicht.«
Karl sah ihn unschlüssig an. Er versuchte, Ehrfurcht gebietende Entschlossenheit in seinen Blick zu legen. Die Pause geriet ihm zu lang, zum Aufplustern war es zu spät. Er zitterte. Ihm wurde heiß und kalt. Ameisen krabbelten durch seinen linken Arm. Er öffnete ein paarmal hintereinander stumm den Mund, schnappte wie ein halb toter Fisch nach Luft, dann kippte er ohnmächtig auf die Tischplatte. Otto sprang auf, holte ihn zu Boden, legte ihn schnell und behutsam auf den Rücken, drückte mit beiden Händen rhythmisch auf seinen Brustkorb und beatmete ihn. Karl kam wieder zu sich. Gemeinsam mit seiner Mutter trug Otto ihn zu Bett. Er hatte keine Sekunde nachgedacht, er hatte keine Wut, keinen Widerwillen empfunden, auch keine Nähe. Die Augen seiner Mutter ruhten jetzt auf ihm. Besser als jeder Arzt, dachte sie und schwieg. Otto fühlte den Puls seines Stiefvaters.
»Ich ruf ’n Krankenwagen.«
6
Der Chef hatte die Mitglieder im Vereinsraum zusammengetrommelt. Sie lungerten im Kreis auf dem gewachsten Boden, als Egon in ihre Mitte trat und sich setzte. Diese Treffen fanden seit einigen Wochen regelmäßig statt, ein Pflichttermin, den Otto nie verpasste. Im Gegensatz zu den meisten saß er kerzengerade da und sog die Worte des Chefs wissbegierig in sich auf. Egons Blick machte die Runde, das gelangweilte Gemurmel verstummte.
»Ick will euch heute wat von Karl Marx erzählen. Kennt den wer?«
Die Arbeiter sahen ihn aus leeren Augen an.
»Jut, wat nich is’, kann ja noch werden. Rom is ooch nich an eenen Tach erbaut worn. Paulchen, kieck nich wie ’ne Kaulquappe, det jeht hier um deene Sukunft.« Er machte eine gewichtige Pause. »Und um die von deene Leute, also sperr de Lauscher uff. Wenn ooch nur een Halbsatz bei euch Pachholken hängen bleebt, hat sich die Nummer jelohnt. – Also, der Karl Marx, der hat sich det mal so jedacht und dabei hata ’ne janze Menge Hirnschmalz vabraten und allet wat die so vor ihn jedacht und jesacht ham, hata von’ Kopp uff de Füße jestellt. Desdawegen is det jerade für euch so brauchbar, kapee?«
Alle nickten stumm.
»Wat denn nu?«, quakte ein schwitzender Struwwelpeter dazwischen.
»Janz ruhig, Brauner.«
Hinter Egon juchzte ein eselartiges Wiehern auf.
»Ick sehe, wir sind von Jeistesjrößen umzingelt.«
Das Lachen verstummte.
»Also …«
Otto fühlte, er atmete mit Egon. Er sah, wie dieser blitzschnelle, kraftvolle Ringer, der jeden zu Boden zwang, nach Worten rang. Wie er sich bemühte, alles, was er in der marxistischen Arbeiterschulung gelernt hatte, in eigenen Formulierungen verständlich weiterzugeben – und wie sehr es ihm misslang.
Wieder machte Egon eine Pause. Er sah in die Runde.
»Un’ wenn de Betriebe nich investiern können, weil ihnen de Banken keen Jeld mehr leihen, ham ooch die, also de Banken, irgendwann keen Zasta mehr, weil de Betriebe un’ überhaupt alle nüscht mehr uff de Bank tragen und dann … dann is allet wech und dann is sappenduster. Ente.«
Die Ringer klatschten. Außer Otto hatte keiner ein Wort verstanden.
Auf dem Heimweg blieb Otto vor dem Elektrofachgeschäft stehen. In der Auslage stand noch immer das Radio. Seine Augen streiften sanft das Mahagonigehäuse. In der unteren linken Ecke prangte stolz ein Schriftzug, der sich dunkel von dem hellen, vornehmen Stoff abhob. Enigma. Er malte sich aus, wie seine Mutter in der Küche sitzend den Konzertübertragungen lauschte. Der Klang würde sich wie ein Adler durch den Raum schwingen. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, sich so etwas Außergewöhnliches zu wünschen. Jeder Groschen wurde für die Familie gespart. Und für schlechte Zeiten. Aber die schlechten Zeiten waren immer da, dachte Otto. Er kannte keine anderen. Worauf sollte man denn warten? Auf noch schlechtere? Wofür arbeiten, wenn sich das Leben nicht verbessern ließ? Was war wichtiger, ein besseres Leben oder ein höheres? Worin bestand der Unterschied? Konnte man durch das Höhere auch das Bessere erreichen? Egons Ausführungen schwirrten ihm durch den Kopf. Es hatte alles ganz überzeugend geklungen. Dann sah er die tumben Gesichter seiner Vereinskameraden vor sich. Egon war es nicht gelungen, sie zu erreichen. Solange sie nicht genügend zu beißen hatten, würde alles Reden sinnlos sein. Also erst das Bessere, dachte Otto, dann vielleicht das Höhere.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Textbeginn
Stille.
Ein Baum fiel krachend zu Boden. Erneut warfen die Männer ihre Motorsäge an. Ein Schrei. Das Kreischen dehnte und blähte sich, die Säge grub ihre Zähne in die nächste Kiefer. Ich wagte nicht, mich umzudrehen. Mein Herz zog sich zusammen. Ich hörte, wie die Wurzeln des hundertjährigen Riesen langsam aus dem Boden gerissen wurden, wie im Fallen sein Widerstand brach.
Ich saß auf einem Pfeiler aus rotem Klinkerstein am Eingang unseres neuen Hauses. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite reihten sich die frisch lackierten Holzzäune in der Morgensonne aneinander, dahinter kläfften Hunde in die Vorstadtidylle. In meinem Rücken, im kniehohen Gras eines verwunschenen Gartens, wie ihn sich jedes Kind erträumt, acht tote Kiefern. Acht. Ich hatte mitgezählt. Nun stand nur noch der kleine, verwachsene Baum. Den durften sie nicht fällen. Mein Vater hatte es mir versprochen. Vorsichtig drehte ich mich in der Grabesstille um.
Ich verlor das Gleichgewicht. Ein Sturz wie ein Schreck. Ich stemmte mich mit aller Kraft gegen den Uhrzeigersinn. Noch während ich fiel, oder schwebte, noch bevor mein sechsjähriger Kopf auf die Steinplatten schlug, sah ich ihn in seiner schlichten Schönheit. Die Sonne schoss durch seine Blätter, seine Früchte blitzten auf. Er stand noch. Allein. Gar nicht verloren. Trotzig. Mein Apfelbaum.