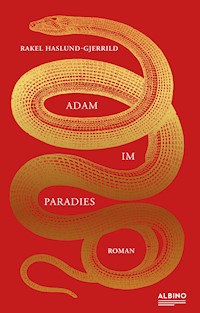
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frederiksberg, 1913: Auf dem Höhepunkt seines Ruhms bereitet sich der 70-jährige Maler Kristian Zahrtmann darauf vor, sein Meisterwerk zu schaffen: Adam im Paradies. Ein sinnliches Glanzstück soll das Gemälde werden, überquellend vor Motiven, Farben und Symbolen, im Zentrum ein schöner nackter Mann. Während Zahrtmann das Atelier seiner Villa mithilfe exotischer Pflanzen in den Garten Eden verwandelt und den jungen Soldaten empfängt, der ihm als Aktmodell dient, gleiten seine Gedanken zurück in die Vergangenheit – zu rauschenden Zusammenkünften der Kopenhagener Décadence; nach Italien, wo er in Civita d'Antino eine Künstlerkolonie gründete; und nicht zuletzt zu seinem ehemaligen Schüler und Modell Hjalmar Sørensen, an dessen Anmut er sich durch den jungen »Adam« erinnert fühlt … In ihrem Roman lässt Rakel Haslund-Gjerrild den dänischen Meistermaler als Ich-Erzähler auftreten. In neun Kapiteln – allesamt nach Werktiteln aus Zahrtmanns Oeuvre benannt – zeichnet die Autorin in einer betörenden, kontemplativ-sinnlichen Sprache ein Porträt des Künstlers, das sowohl seiner lächelnden Wehmut als auch seinem feinen Humor Ausdruck verleiht. Die Erzählung wird durchbrochen von historischen Dokumenten über die Sittlichkeitsprozesse der Jahre 1906/07, als in Dänemark Homosexuelle verfolgt und einige (darunter der Schriftsteller Herman Bang) aus dem Land vertrieben wurden – ein ebenso subtiler wie genialer Kunstgriff, um Zahrtmanns nie eingestandene Homosexualität zu spiegeln, der aber nie das Sprachkunstwerk in den Hintergrund drängt, das Signatur und emotionaler Motor des Romans ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ADAM IM PARADIES
RAKEL HASLUND - GJERRILD
ADAM
IM
PARADIES
ROMAN
Aus dem Dänischen von Andreas Donat
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem
Titel Adam i Paradis bei Lindhardt & Ringhof, Kopenhagen.
© 2021 Rakel Haslund-Gjerrild
Die Übersetzung wurde aus Mitteln der Danish Arts Foundation gefördert.
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds und vom Senat Berlin gefördert.
1. Auflage
© 2022 Albino Verlag, Berlin
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
Aus dem Dänischen von Andreas Donat
Umschlaggestaltung: Robert Schulze in
Anlehnung an Simon Lilholt/Imperiet
Satz: Robert Schulze
Umschlagabbildung: istockphoto.com/NSA Digital Archive
Abbildung auf Vorsatzpapier: Kristian Zahrtmann,
Adam i Paradis, 1914, Nationalmuseum Stockholm
Printed in the Czech Republic
ISBN 978-3-86300-343-2
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen:
www.albino-verlag.de
Inhalt
Adam langweilt sich im Garten des Paradieses
Anlage 1
Drei Jahre früher
Selbstporträt bei Lampenschein
Anlage 2
Sokrates und Alkibiades
Anlage 3
Susanna im Bade
Anlage 4
Struensee und Caroline Mathilde am Totenbett der Königin Sophie Magdalene
Anlage 5
Die Milchprobe
Anlage 6
Kniender Priester, San Romano
Anlage 7
Adam langweilt sich im Garten des Paradieses
Anlage 8
Leonora Christina verlässt das Gefängnis
Anlage 9
Nachwort
Personengalerie
Anmerkungen
Zitatnachweise
Danksagung
Wenn es dennoch kolossales Aufsehen erregen wird, so ist dies dem Wesen seines Motivs zu verdanken. Unser Stammvater ist als schöner, schlanker Jüngling von herrlichem Körperbau dargestellt. Selbstverständlich ist er – im Adamskostüm, und rund um ihn wölbt sich des Paradieses ganze Blumen- und Laubpracht in strahlenden Zahrtmannschen Farben. Doch Adam blickt melancholisch drein. Wonach sehnt er sich? Und wo ist Eva? Woher rührt seine Langeweile? Der schelmische alte Meister gibt keine Antwort. Des Rätsels Lösung zu finden, obliegt dem Betrachter selbst. Wer mag, kann es ja versuchen.
ZAHRTMANNS NEUES BILD:
ADAM LANGWEILT SICH IM GARTEN DES PARADIESES
von Sfinx
Hovedstaden, 12. November 1913
Adam langweilt sich im Garten des Paradieses
Sommer 1913
Casa d’Antino, Frederiksberg
JEDER DER MÄNNER trägt einen Baum. Den Wagen des botanischen Gartens haben sie dreißig Meter von der Casa d’Antino entfernt an der Ecke Mariendalsvej und Drosselvej abgestellt. Meine schöne Kentiapalme, die größte, mussten sie, damit sie überhaupt in den Wagen passte, behutsam biegen, sodass ihre Wedel gegen das Dach federten. Hier, im Abendlicht am Fuglebakken zu voller Größe entfaltet, ist ihr Anblick unübertroffen. Ich stelle mir vor, wie meine Nachbarn Else und Harald Moltke bei Abendtee und Zuckerbrot in ihrer Sofaecke sitzen und Graf Harald nach seiner Lesebrille greift, dabei einen Blick aus dem Fenster wirft und einen Dschungel vorbeiwandern sieht.
«Ihr seht aus wie ägyptische Fächerträger, mit all den wedelnden Palmblättern über euren Köpfen», rufe ich den Arbeitern zu, die vorsichtig – denn ich habe sie ermahnt, die Pflanzen so achtsam zu behandeln wie Säuglinge oder chinesisches Porzellan – meine Paradiespalmen tragen. Zuerst kommt Kentia, hinter ihr die Phönixpalme und dann die Dracena, deren Blätter ihre messerscharfen Schatten auf Haus und Fensterscheibe werfen.
«Hier lang, ja, so. Vorsicht in der Tür, dass sie mir ja nicht knicken! Das wäre doch jammerschade.» Ich trete von der Eingangsschwelle meiner Villa. Die türkisfarbene Haustür öffnet sich zu den Beeten, in denen Päonien in allen Farben blühen, dazu Purpursonnenhut und blaue Iris; die Fenster darüber sind nach dem Hitzeausbruch des Nachmittags immer noch durstig geöffnet. Auch die Türen zum Hintergarten und zum Sonnenschoß, meiner nach Süden gewandten Terrasse mit ihren Blumentöpfen und Blutjohannisbeeren, stehen sperrangelweit offen, und so kann der Juli nun prall und mit allen Düften durchs Haus toben und die Spitzengardinen zu Windkörpern blähen, deren Tanz den Staub aufwirbelt, den Frau Hessellund in den Ecken hat liegen lassen.
«Hier herein, durch das Wohnzimmer in mein Atelier», singe ich meinen muskulösen Riesenengeln, als sie mit den Palmen über die Schwelle treten. «Immerhin erschaffen wir hier das Paradies, meine Herren.»
Der Baum der Erkenntnis, habe ich beschlossen, wird ein Zitronenbaum sein. Der ist über die Maßen schön, mit Früchten so groß wie Fäuste, die sich um die Sonne schließen.
Als die Trageengel wieder gegangen sind, setze ich mich und nehme die Szenerie in Augenschein. Mein großes Atelier, das zuvor so hell war, hat sich in eine grünliche Grotte verwandelt, erfüllt von einer gänzlich fremden Duftpalette. Vor allem von den Bananen geht ein starker Geruch aus. Ich habe vollreife gekauft, um das intensivste Gelb zu erhalten, das die Bananencouleurskala zu bieten hat, denn wenn so vieles auf dem Bild grün wird, müssen die Bananen in einem so reifen Gelb leuchten, dass es gelber nicht geht: Man soll die Farbe riechen können, ihr Zittern am Abgrund, unmittelbar bevor sie sich hinabstürzt ins Braune.
OFT LIEGE ICH morgens lange im Bett und warte, dass die Wirklichkeit ankommt und die grauen Wände des Schlafs aus meinem Bewusstsein verjagt. Manchmal werde ich von Doggy geweckt. Er wetzt an meinem Schlafzimmer vorbei und setzt sich mit einem breiten, klatschenden Geräusch vor der Küchentür auf den Fliesenboden des Entrées. Wenig später höre ich, wie Frau Hessellund die Tür zu ihrem Zimmer öffnet. «Guten Morgen, Doggy», sagt sie mit leiser Stimme und geht mit dem Hund in die Küche. Durch das Gewusel der beiden fühlt sich das Haus nun an wie ein Körper, der sich hin und her wälzt, aber noch nicht aus dem Bett will. An manchen Morgen wache ich so zeitig auf, dass ich weder die Vögel hören kann, noch die Straßenbahn oder Doggy. Nur meinen eigenen Atem. Dann möchte ich nicht aufstehen. Das wäre, als träte man hinaus in einen Traum, als stünde man eines klaren Morgens auf und entdeckte, dass die Welt vierzehn Minuten nach vier zum Stillstand gekommen ist und alle Menschen, Vögel und Tiere zu Schatten geworden sind. Wie es wohl sein mag, taub zu sein, eingeschlossen im Vakuum des eigenen Körpers. Dann würde ich niemals aufstehen. Aber jetzt ist es schon weit nach Sonnenaufgang, der Tag ist hier, das merkt man vor allem an Frau Hessellunds immer lauter schnalzenden Schritten; mit ihr muss man behutsam umgehen – manchmal schnappt sie zu. Sie poltert und klappert mit den Töpfen, um mich hören zu lassen, dass heute sie das Haus am Laufen hält, während ich wie ein störrisches Kind im Bett liegen bleibe. «Peter, Frühstück!», höre ich sie ihrem Sohn zurufen, dem sechsjährigen, vogelgliedrigen Peter. Er läuft mit nackten Füßen über den grünen Fliesenboden in die Küche, wo der Haferbrei dampfend auf ihn wartet.
Heute scheint die Sonne, das höre ich am arbeitslüsternen Summen, das aus dem Garten zu mir hereindringt, nun, da all meine Sommerblumen sich zu voller Blüte geöffnet haben und mit ihren Staubblätterzungen benommen nach den Bienen lecken. Die Sonne treibt ihre Messer in die Erde: So lasst denn Grünes sprießen und Blütenflor, Triebe schlagen und Knospen bersten, denn heute ist der Tag, an dem Adam kommt! Vielleicht wäre mir das Ganze niemals eingefallen, wenn wir nicht gerade den Paradiesmonat hätten, diesen einen Monat, in dem hier bei uns die Worte «drinnen» und «draußen» die Bedeutung verlieren, die ihnen während all der anderen Monate innewohnt. Im Juli schläft man mit offenen Fenstern und Türen. Wir verwandeln uns in kleine Gartentiere und essen im Freien – dort stehen die Terrassenmöbel und trinken die Wärme wie durstige Kühe. Im Juli trifft man auf keinen Widerstand: hinauszugehen ist wie in sich selbst umherzuwandeln, zu Hause auf jedem Wiesenfleck, unter jedem Schatten.
Ich habe ihn letzte Woche gefunden, im Zug auf der Heimreise von Kalundborg. Die Luft stand still, selbst an der Küste, und alles – die Steine, die Dünen, der Sand, der Zug – vibrierte im heißen Dunst. Ich nahm meinen Koffer und begab mich in die Coupéhitze, um meinen Platz zu suchen. Im Zugwaggon wimmelte es von Körpern, allesamt in Blau. Sie schrien, schlugen einander auf die Schultern und warfen mit Taschen und Mundvorrat quer über den Mittelgang, während ich mich höflich zwischen ihnen hindurchdrückte, meine Reisetasche vor mir herhaltend wie den Steven jener breitheckigen Jolle, die ich war. Ich hatte einen Fensterplatz am hintersten Ende des Coupés, allerdings hatte sich mein Sitznachbar quer über beide Sitze ausgestreckt und schlief, das Kinn gegen die Brust gepresst, sodass seine Atemzüge klangen wie die eines neugeborenen Kalbs mit verschleimtem Hals. «Henriksen!», riefen seine Kameraden auf den Sitzen vor uns, und einer von ihnen gab ihm einen Klaps auf die Mütze, sodass Henriksen mit einem missmutigen Blick in meine Richtung aufsprang. Als der Zug sich schließlich in Bewegung setzte und sowohl Reisetasche als auch breitheckige Jolle an dem auf meiner Fahrkarte angegebenen Platz verstaut waren, schlief Henriksen bereits wieder.
Dank eines lustigen Zufalls war ich als offenbar einziger ziviler Passagier im Soldatenwaggon platziert worden, der ungeachtet der Temperatur bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die Soldaten hatten versucht, den Unterschied zwischen drinnen und draußen durch das Öffnen sämtlicher Coupéfenster aufzuheben, soweit sich das nun machen ließ. Dies zeigte erst dann so richtig seine Wirkung, als wir über den offenen seeländischen Feldern an Fahrt gewannen und der Duft von Wiese, Heu und Weidevieh in die Schwüle unseres Wagens hereinpolterte. Ich saß in meinem hellen Leinenanzug auf meinem Platz und fächelte mir mit der Zeitung zufrieden Luft zu, eigentlich recht guter Dinge, von südländischen Sommern an Hitze gewöhnt, während die Soldaten in ihren Uniformen schwitzten und stöhnten, ehe sie schließlich einer nach dem anderen unter Gegröle und Gelächter und Geschubse und Geknuffe anfingen, sich die Hemden aufzuknöpfen. Es war, als würde vor meinen Augen ein Picknickkorb ausgepackt: kalte Hähnchenkeulen, Tarten, Pasteten, Apfelspalten und Gläser prickelnden Perlweins, so wurden Kleidersäcke und Tornister auf den Boden geworfen und als Schemel oder Spieltische für eine Art Whist benutzt, aufgeknöpfte Uniformjacken häuften sich zu blauen Wollbergen, während Stiefel faul von den Füßen gestreift wurden, sodass vom grünen Boden des Coupés ein moosartiger Geruch aufstieg. Einer der Soldaten, derjenige, der zuvor Henriksen wachgeknufft hatte, zog sich sogar noch weiter aus und zwinkerte mir barbrüstig zu.
Adam saß auf der gegenüberliegenden Seite des Gangs in der Ecke, halb schlafend, den Kopf gegen das Fenster gelehnt. Darum war er mir anfangs nicht aufgefallen. Sein blondes Haar war eins mit den Kornfeldern, die mit der zähflüssigen Hast des Sommers am Zug vorbeischossen – wie schnell der Sommer doch immer verrinnt – und die grelle Nachmittagssonne verwischte seine Gesichtszüge, sodass ich, während er schlief, von meinem Platz aus kaum mehr von ihm sah als einen Lichtfleck in der Ecke. Doch dann wurde nach ihm gerufen, und plötzlich, ohne sichtbaren Übergang von Schlaf zu voller Existenz, stand Adam im Mittelgang des Coupés, leicht vornübergelehnt, die Arme lässig auf den Sitzlehnen vor ihm liegend, von wo er sich sogleich wie ein launenhafter Donnergott anschickte, einen Kameraden an den Haaren zu ziehen. «Teufel!», rief der Angegriffene, Adams Hand zur Seite schlagend, während jener grinste und mit sergeantartiggrober Freundlichkeit dem Jungen hart die Wangen tätschelte.
Eine plumpe pinkfarbene Päonie.
Seine lederne Hose, das Hemd mit den lose über die Ellbogen gekrempelten Ärmeln, das Sonnenlicht auf den Flimmerhärchen seiner Arme und ein trockener Atemzug der vorbeifahrenden Sommerwiesen und Felder ließen mich erschaudern wie vor Freude, vor Furcht: Da stand er, über uns gelehnt, und glich einem Adam. Und ich konnte ihn vor mir sehen, diesen ersten Mann der Erde, wie er sich vom Bache erhob, um eine Frucht zu pflücken, und der somit, ohne es selbst zu wissen, das Paradies verließ, durch Jahrtausende von Heidesteppen und Wiesenhängen streifend, flötend ohne Melodie, auf dem Weg durch die Reihen Kopfnüsse austeilend, um schließlich hier im Zug von Kalundborg zu landen.
Ich fragte Adam an Ort und Stelle – er stand mit einer trotz allen Holperns und Polterns des Zuges erdenschweren Ruhe im Mittelgang und drehte sich eine Zigarette, die er in einer zusammenhängenden, fließenden Bewegung zwischen seinen Lippen platzierte –, ob er möglicherweise Interesse hätte, mir Modell zu sitzen. Ich erzählte, ich sei auf der Suche nach einem Modell für Adam im Paradies und fügte hinzu, dass ich ihn für geeignet hielte, dass er sich bestimmt gut machen würde als Adam. Er sog den Rauch ein, blies ihn über unsere Köpfe hinweg und sagte dann ohne Zögern Ja; genau wie Hjalmar und, ja, vor allem Carl Vilhelm Ja gesagt hätten, stets in augenblicklicher Klarheit darüber, was sie wollten. Er sei gerade ausgemustert worden, sagte Adam, und habe bislang noch keine andere Arbeit gefunden. Er brauche Geld; ob er einen Vorschuss haben könne?
Ich bezahlte ihn für den restlichen Juli und August, während der Zug in den Bahnhof einrollte. Die Soldaten riefen Hurra, die Sonne schien, die Stadt duftete nach Stadt und ein wenig nach altem Bier, und dann gingen sie zum Zechen ins Wirtshaus, während ich für einen Augenblick auf dem Bahnsteig stehen blieb und mich von der Sonne wärmen ließ, regungslos wie eine Libelle über dem rauschenden Strom der Reisenden mit ihren Koffern, Kisten und Seesäcken.
«SIND ES DIE BANANEN, die so riechen?»
Frau Hessellund steht mit dem Vormittagstee in der Tür. Sie schnuppert, dreht den Kopf. Gleichzeitig blicken wir hinab auf die Bananen. Ich habe sie nun seit drei Tagen hier liegen, und schon jetzt breiten sich die braunen Punkte auf ihnen aus wie Sommersprossen, ich muss morgen neue kaufen.
«Behagt Ihnen der Geruch nicht?»
«Ist etwas stickig hier, soll ich ein Fenster öffnen?», fragt sie, stellt das Teetablett auf die Kiste und öffnet, ohne eine Antwort abzuwarten, das Fenster.
«Nur einen Spalt», sage ich. «Es zieht heute ein wenig, wie mir scheint.»
«Er ist nicht gekommen?», fragt Frau Hessellund und bleibt vor dem Paradies stehen. Schon ist der Dschungelduft der Julibrise gewichen, nun dringt Kopenhagen herein.
«Nein, das sehen Sie wohl.»
«Er hat bestimmt Ihre Postkarte noch nicht gelesen», sagt Frau Hessellund mit einem Lächeln.
Schon den gestrigen Vormittag habe ich zum großen Teil mit Warten verbracht. Ich hatte eine Postkarte an das Mietshaus geschickt, in dem er logiert, mit der Nachricht, dass das Paradies nun bereitstehe, und ihn gebeten, jeden Tag von halb neun bis zwölf zu mir zu kommen. Jetzt ist es fast zehn.
«Ja, da haben Sie wohl recht. Ich liege ja ohnehin nur hier und schwimme mit dem Blick über die Decke.»
Frau Hessellund hat sich zum Gehen gewandt, bleibt aber in der Tür stehen. «Ach ja, dieser Brief an Sie ist gestern gekommen. Aber ich habe es ganz vergessen, denn es war nicht der Postbote, der ihn gebracht hat», sagt sie. «Ich habe ihn durch den Briefschlitz fallen hören. Als ich die Tür öffnete, war niemand da, nur ein junger Mann drüben an der Straßenbahnhaltestelle.»
Einen Augenblick lang halten wir beide den Umschlag fest, jeder an seinem Ende. «Es ist ein merkwürdiger Brief. Und ohne Absender», sagt sie, während sie loslässt.
Auf den Umschlag ist eine Orange gemalt, An den Meister steht auf dem Griff eines Messers zu lesen, das gerade dabei ist, die Frucht entzweizuschneiden. An und für sich hübsch. Das Beunruhigende sind die Ameisen, die er über den ganzen Umschlag gemalt hat, ins Fruchtfleisch, auf den Messergriff, und ganze Scharen von Ameisen strömen auf die Orange zu, ein Heer im Gänsemarsch von der Rück- bis auf die Vorderseite, unter der Lasche hervorkrabbelnd, als kämen sie von irgendwo aus dem Inneren des Umschlags.
«Ja, das ist in der Tat ein etwas merkwürdiger Brief», sage ich zu Frau Hessellund und lege den Brief zwischen die Seiten eines Buches. «Aber ich bekomme ja so viele seltsame Zuschriften. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Oft komme ich nicht einmal dazu, sie zu lesen. Möchten Sie die Briefe in Zukunft vielleicht einfach auf den Sekretär legen? Dann kann ich Ihre heraussortieren. Sie haben doch jetzt so viel anderes zu tun, da ist es nur recht und billig, dass ich mich um die Post kümmere. Das allermeiste ist ja ohnehin an mich.»
Das bringt Frau Hessellund dazu, ihr Lächeln fallenzulassen. Sie bekommt fast nie Post. Letzte Woche kam die endgültige Erbschaftsurkunde ihres verstorbenen Mannes. Es stand, wie ich geahnt und sie befürchtet hatte, nichts für sie Erfreuliches darin.
«Wenn Ihnen das lieber ist», sagt sie nur und geht.
«NEHMEN SIE BITTE hier Platz.»
Ich deute auf den Korbsessel, den ich mitten im Atelier vor der großen, dem Mariendalsvej zugewandten Fensterpartie platziert habe. Adam setzt sich. Es muss Vormittagslicht sein, beschließe ich. Der Lichteinfall ist gut. Ich mag die Kälte, die der Morgen mit sich bringt. Etwas Zögerndes, Wartendes liegt in dem bläulichen Licht. Noch ist der Tag eine Möglichkeit. Später reift er heran wie eine Frucht und wird wärmer und wärmer, ehe er schließlich im Sonnenuntergang explodiert, der die Gesichter erröten lässt, sodass sie fast aufgedunsen wirken vor lauter Farbe. Und dann kommt die Nacht. Das muss ich mir für das nächste Mal merken, wenn einer von den Jungen sich über die Langsamkeit der älteren Maler auslässt, nein, werde ich sagen, siebzig geworden zu sein bedeutet, von einer solchen Freude erfüllt zu sein, dass man sie kaum im eigenen Körper zu fassen vermag. Man spürt das Herannahen der Explosion, werde ich sagen. Die Intensität ist so stark, dass man sich häufig hinsetzen und einfach nur atmen muss, um nicht überzuströmen. Aber mein Adam ist jung, und darum passt dieses Scharfe und Gelbliche zur überbelichteten Schulter- und Scheitelpartie, die blauen Schatten, die seine Muskeln hervortreten lassen. Ich sage zu Adam: «Stellen Sie sich vor, Sie säßen auf einem Thron.»
Der ranke Mann richtet sich auf. Das Licht ist eine Krone auf seinem Haupt, ein Mantel um seine Schultern. Ja, wenn doch ein König so sitzen könnte, wie Adam jetzt sitzt. Kissen sind keine vonnöten, Brust und Kopf werden von der Rückenmuskulatur aufrecht gehalten. Das hier ist ein Körper, der sich niemals beugt, und der kein Nachgeben kennt. Er kann nur dieses Eine: gerade sitzen.
Mir ist, als stünde ich der Natur selbst gegenüber. Ich muss mich setzen und tief Atem holen.
Adam bleibt sitzen, wie er sitzt. Die Majestät der Natur, die keiner verlogenen Machtinsignien bedarf. Vielleicht sollte der König ebenfalls nackt sein, vorausgesetzt er hätte einen Körper wie Adam. Das wäre dann Des Kaisers neue Kleider in einer Art Neufassung, in der das ganze Land sich dessen erfreut, Seine Majestät in nackter Noblesse durch die Straßen gehen zu sehen. Und jedermann würde einsehen, dass es immer so sein sollte, und dass es in Wahrheit die Bekleideten sind, die etwas zu verbergen haben. Ich spekuliere, ob Andersen nicht eigentlich genau das andeuten wollte. Wäre der Kaiser kaiserlicher gewesen, keiner hätte sich darum gekümmert, ob er etwas anhat oder nicht. So betrachtet sind Kinder natürliche Royalisten im eigentlichen Verstand. Das einzige Mal, dass mein Vater mich geschlagen hat, war bei der Totenfeier für Christian VIII. im Jahre 1848. Wir standen im Rathaus von Rønne unter all diesen prächtig gekleideten Leuten, Frauen mit schwarzen Schleiern und Muffs, und betrachteten das große Panorama, auf dem der Sarg zu sehen war, gezogen von vielen, vielen weißen Pferden in schwarzen Schabracken. In jenem Augenblick lernte ich, was Crêpe ist: dieser matte und zugleich glänzende Seidenstoff mit einer Beschaffenheit wie die Rinde einer alten Eiche. Ich konnte es nicht lassen, vorsichtig mit den Händen über die Kleider der Damen zu streichen und den Stoff zu liebkosen. Ich war kaum fünf Jahre alt und begriff die Trauer der Erwachsenen nicht, aber ich war erfüllt von der Symmetrie zwischen den Pferden, die den glänzenden Sarg zogen, der für mich so aussah wie der große Stein in unserem Fluss – und da lachte ich, denn dies war das Prächtigste, was ich jemals gesehen hatte. Mein Lachen gluckste zwischen all diesen unbeweglichen schwarzen Unterteilen und Beinkleidern hervor, und mein Vater, mein ruhiger, besonnener Vater, der nicht verstand, dass ich lachte, weil ich überwältigt war von Königlichkeit, errötete vor Scham und gab mir eine Ohrfeige, die mich sogleich zum Weinen brachte.
Meine erste Skizze hat etwas Steifes an sich. Adam sitzt etwas zu aufrecht, man sieht sofort, dass er Soldat ist. Und das geht nun mal nicht. Oder seine Steifheit rührt daher, dass es ihm unangenehm ist, nackt zu sein. Was man immerhin auch verstehen kann. Für gewöhnlich dauert es ein paar Tage, bis man sich daran gewöhnt, das habe ich schon bei vielen Modellen erlebt.
«Gut so», sage ich zu Adam, «aber wissen Sie, ich habe nicht vor, den Stuhl zu malen. Tun Sie einfach so, als wäre er nicht da. Der Körper selbst muss der Thron sein. So! Lehnen Sie sich ein wenig zurück. Ja, genau so. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Diwan. Man muss Lust bekommen, sich auf Sie draufzulegen. Ganz entspannt, als wären Sie gerade aufgewacht.»
Wie schön, diesen Körper in seiner Geschmeidigkeit zu betrachten, den Muskeln unter der Haut mit dem Auge zu folgen, wie sie sich spannen und wieder lösen. Die kleine Beuge über dem Nabel, wenn er sich im Korbsessel zurücklehnt, der Bauch, der nach unten hin weicher wird und den Nabel wie ein Fingerhutschälchen nach oben schiebt, dem Licht entgegen.
«Können Sie in dieser Position die Bauchmuskeln angespannt lassen?»
«Aber bin ich denn nicht ein Sofa?», fragt Adam und blickt mir zum ersten Mal seit seiner Ankunft in die Augen. Schweigend hatte er sich ausgezogen, seine Kleidung zusammengefaltet, sie auf meinen Schreibtischsessel gelegt. Ich dachte, er sei nervös und verlegen wegen seiner Nacktheit, aber sein Blick ist vollkommen ruhig, beinahe kalt.
«Gewiss», sage ich, «Sie sollen entspannt wirken, Sie sollen so aussehen, als würden Sie sich langweilen. Stellen Sie sich vor, Eva wäre noch nicht erschaffen worden. Adam sitzt allein da und weiß nicht, was er machen soll. Darum langweilen Sie sich. Aber Ihr Bauch ist so schön, wenn Sie die Muskeln anspannen. Nur ein kleines bisschen.»
«So kann ich aber nicht lange sitzen.»
«Aha, ja, das sehe ich ein. Für einen kleinen Augenblick? Dann mache ich eine Skizze. Und danach versuchen wir etwas anderes.»
ADAM BEWEGT SICH. Oder nicht? Ich blicke auf. Doch, jetzt ist Leben in ihm. Ich hatte schon gedacht, er würde schlafen. Mit offenen Augen schlafen zu können ist gewiss eine Kunst, die Soldaten sich mit der Zeit aneignen, eine formidable Fähigkeit: still zu stehen, ohne zu merken, ob vier Stunden vergangen sind oder hundert Jahre, um sodann auf den Ruf des Feldwebels innerhalb einer Sekunde zur Tat zu erwachen. Aber jetzt ist er ganz präsent. Er blickt zu mir herüber, er hat sich immer noch nicht bewegt, doch irgendwie ist er wieder in seinen Körper zurückgekehrt. Äußerst präsent. Ich lächle. Es ist zehn Uhr, und vor dem Fenster tauchen die Schwalben herab, wieder und wieder und jedes Mal mit derselben Freude, ich muss an den Fahrtwind losfahrender Wagen denken, der den Leuten ihre Hüte beinahe von den Köpfen reißt. Ja, man kann sehen, welch eine Veränderung in der Kopfbekleidungsmode der Vormarsch der Motorenthusiasten mit sich gebracht hat: nach hahnenkammhohen Hüten nähert man sich nun mit eng sitzenden Ledermützen und Pilotenbrillen den Schwalben an, um motorisierten, aerodynamisch für Flug und Fall gebauten Sperlingsvögeln gleich die Hügel hinunterrauschen zu können. Eine Freude ist es, rasch zu malen; ich fange flüchtige Schimmer seiner Atemzüge ein, seines Blicks.
«Wünschen die Herren den Vormittagstee hier im Atelier einzunehmen?», fragt Frau Hessellund mit einem Ton von ebensolcher Balance wie das Tablett mit Tee und Sandkuchen auf ihrer Hand. Oh. Sie steht direkt hinter mir. Ich habe sie nicht kommen hören. Wie lange hat sie schon so dagestanden und uns zugesehen?
«Ich wünsche doch keinen Tee, wenn ich ein Modell hier habe», sage ich gereizt. «Das stört. Sehr.»
«Ah», sagt Frau Hessellund, ohne irgendwelche Anstalten zum Gehen zu machen. Ich bleibe mit dem Rücken zu meiner Haushälterin sitzen. Der Augenblick ist fort, ich kann mich nicht einmal erinnern, woran ich soeben noch gemalt habe. Adam lächelt und nickt in Richtung des Teetabletts hinter mir. «Gegen eine Tasse Tee hätte ich nichts einzuwenden. Ich schlafe hier schon fast ein», sagt er und steht nackt auf, während Frau Hessellund mit einem Lächeln nähertritt und leichtfüßig an mir und Adam vorüberschwebt, um das Tablett auf den Schreibtisch zu stellen. Sie bleibt stehen, gießt Tee in die Tasse.
«Möchten Sie auch, Kristian?», fragt sie, ohne sich zu mir umzuwenden. Adams Hose hängt über dem Schreibtischsessel. Er zieht sie an – ohne jede Eile, wie mir vorkommt. Sie wartet mit der Tasse in Händen, die Adam mit einer leichten Verbeugung und immer noch nacktem Oberkörper entgegennimmt. Es schickt sich nicht, dass sie stehen bleibt, so wie Adam sie anstarrt. Ich habe recht daran getan, an meiner Schule keine Frauen zuzulassen, sei es als Schülerinnen oder als Modelle, denn sie verderben den Jungen die Konzentration für die Aufgabe, für den Ernst der Kunst.
«Nein, nicht jetzt während der Arbeit», sage ich mit einer gewissen Schärfe. «Erst nach zwölf. Möchten Sie so freundlich sein, sich das für die Zukunft zu merken, Frau Hessellund?»
Sie wendet sich von Adam ab und nickt unmerklich zur Antwort, kaum mehr als ein Lidschlag, der etwas länger dauert als notwendig. Dann verlässt sie tänzelnd das Atelier, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Der Tee bleibt auf dem Schreibtisch stehen und füllt den Raum mit dem bittersüßen Zitrusduft der Bergamotte. Ich arbeite an den Mohnblumen in der linken Ecke des Bildes weiter, während Adam seinen Tee trinkt.
«Lauschen Sie mal», sage ich zu Adam. «Was hören Sie?»
Adam blickt langsam auf, er braucht ein wenig, um aus seinem Paradiesschlummer zu erwachen, aus seiner Langeweile. Ich blicke auf Adam zwischen den Palmen und nicke aufmunternd.
«Was hören Sie, wenn Sie genau hinhören?»
«Nichts», sagt Adam und scheint sich schon wieder zu langweilen. Aber nun habe ich mir in den Kopf gesetzt, ihn aufzuwecken.
«Die kleinen Geräusche, mein Lieber, können Sie die nicht hören?»
Adam zuckt mit den Schultern.
«Hören Sie denn die Uhr nicht?», frage ich mein leicht gelangweiltes Modell. «Was sagt die Uhr?»
Adam, vermutlich weil ich ihn für seine Anwesenheit bezahle, sagt schließlich: «Tick tack.»
«Ja!», rufe ich. «Tick tack! Ich habe immer geglaubt, dass die Uhr tick tack, tick tack, tick tack sagt. Aber kürzlich meinte Graf Moltke, die Uhr sage eigentlich nur tick tick tick.
Es ist immer derselbe Laut, der sich wiederholt. Tick tack ist ein Hirngespinst, eine Geschichte, die unsere grauen Zellen einander aus purer Langeweile erzählen: Zuerst war das Leben tick, dann wurde es tack. Irgendetwas ist geschehen. Tick tack. Und in Wahrheit gehen die Sekunden einfach nur tick tick tick tick, bis man stirbt. Ziemlich bedauerlich, finde ich.»
«Hm», sagt Adam nur und blickt aus dem Fenster.
ICH WEISS NICHT, was mich dazu gebracht hat, aufzublicken: keine Bewegung in den Gardinen, kein Geräusch von der Straße, und nur ein kaum hörbares Summen in einem Haus, zu dem der Wind keinen Zugang hat. In ein Buch vertieft, hatte ich einfach dagesessen, als ich plötzlich aufsah und mein Blick durch die Fensterscheibe auf ihn fiel. Oder nein, das ist nicht präzise genug ausgedrückt, mein Blick fiel nicht auf ihn, vielmehr war es so, dass ich aufblickte und ihn sah. Jener Zwischenraum war nicht da, der sonst immer zwischen Sehen und Erkennen des Gesehenen zu liegen pflegt, im Gegenteil: Ich blickte auf, um ihn zu sehen. Er war da, und noch ehe ich den Kopf gehoben hatte, wusste ich es.
Jetzt steht er da draußen vor meinem Haus und erkennt mich im Farbenkontrast zwischen dem gelben Fingerstrauch und der türkisfarbenen Haustür der Casa d’Antino. Er tritt näher, richtet sich auf. Er lockert den Unterkiefer, lächelt und fasst den Entschluss, den er ohnehin bereits gefasst hat, möge er nun aufblühen oder zugrundegehen.
Und ich begreife, dass diese Ruhe, mit der ich nun sein Klingeln an der Haustür erwarte, nur der Tatsache geschuldet sein kann, dass ich im Grunde schon lange auf ihn gewartet habe, und dass ich Mal für Mal Enttäuschung empfunden haben muss, oder vielleicht vielmehr Erleichterung darüber, dass es nicht er war, der gerade vorbeigegangen ist oder die Milch gebracht hat. Doch nun ist die Spannung aus all diesen Hunderten von Bruchteilen hunderter Tage wie weggeblasen und ich fühle nichts als Klarheit: Hier steht er und klingelt an meiner Tür.
Auch Frau Hessellund muss Hjalmar durchs Küchenfenster gesehen haben, denn noch steht er, ohne geklingelt zu haben, zögernd auf den Treppenstufen, als sie bereits auf dem Weg ins Entrée ist. Ich sehe sie vor mir, wie sie am Küchentisch sitzt, die Schollen im Spülbecken, wo das Eis längst geschmolzen ist und Fisch und aufgelöstes Zeitungspapier in blutiggelbem Matsch umhertreiben, das Abendessen wieder einmal verspätet, die Zwiebeln ungeschält, ungehackt auf dem Tisch, ein Herbstkranz rund um das Schneidebrett, Frau Hessellunds Kinn ruht in ihrer Hand, sie ist übermannt von Verzweiflung oder von Tagträumen, sie wartet. Denn Frau Hessellund wartet im Grunde genommen immer. Das Warten ist für sie zum Dauerzustand geworden, aber es ist ein Warten ohne Hoffnung, eine Sehnsucht, der man die Augen ausgestochen hat. Das ist traurig, aber so leben viele, sie warten darauf, dass irgendetwas kommt und sie aus diesem Wartesaal des Lebens herauszieht, dass irgendjemand festen Schrittes durchs Gartentor hereintritt und den Kies unter seinen Füßen zum Knirschen bringt. Diese Möglichkeit ist es, die Möglichkeit, dass jemand an der Tür klingeln, dass alles trotz allem immer noch anders werden könnte, deretwegen wir ausharren und bleiben. Und war es etwa nicht genau diese Hoffnung, die Frau Hessellund erfüllte, als ihre totgewarteten Augen einen muskulösen blonden Mann am Küchenfenster vorbeigehen sahen? Sie muss plötzlich aufgestanden sein, überrascht, dass Adam an einem Nachmittag vorbeikommt und nicht zum festen Zeitpunkt um halb neun. Und so wird ihr die Idee gekommen sein, dass es also sie sein müsse, die er besuchen wollte, und nicht ich. Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb gerade sie, die alle anderen Gäste vergeblich klingeln lässt, bis ich schließlich selbst aufstehe und sie hereinlasse, weshalb also Frau Hessellund nun mit hastigen Schritten aus der Küche kommt und über den Klinkerboden des Entrées geht, um genau in dem Augenblick an der Tür zu stehen, als er klingelt.
Sie öffnet die Tür.
Der Gedanke an die Enttäuschung, die sich nun Frau Hessellunds bemächtigt, erfüllt die ganze Villa mit zarter Wehmut, und es ist, als gingen Gardinen, Truhen, Regale, Gemälde und ich ganz leicht in die Knie, bereit, Frau Hessellund aufzufangen, wenn sie fällt.
«Ich bin hier, um den Meister zu sehen», höre ich Hjalmar zu Frau Hessellund sagen. «Würden Sie so freundlich sein, ihm das zu melden?» Und wenig später, als Frau Hessellund nicht die geringste Bewegung macht, sondern bloß wie eine welke Tulpe in der Tür stehen bleibt, fügt er hinzu: «Ist dies nicht Kristian Zahrtmanns Villa?»
«Doch, er wohnt hier», sagt Frau Hessellund mit tonloser Stimme. Einen Augenblick lang stehen die beiden einander schweigend gegenüber, dann seufzt sie und mustert Hjalmar mit scharfer Aufmerksamkeit. «Verzeihen Sie, ich habe Sie für jemand anderen gehalten. Sie haben eine so unglaubliche Ähnlichkeit.» Ich sehe, wie sie sich aufrichtet, und ich sehe Hjalmar ihren Blick erwidern.
«Ja, ganz unglaublich, diese Ähnlichkeit», sagt sie noch einmal, doch dann reißt sie sich zusammen, und mit leicht geknicktem Nacken sammelt sie ihre Rolle vom Klinkerboden auf: «Ich bin die Haushälterin.»
«Nun, das hatte ich mir fast gedacht», höre ich Hjalmar mit einem kleinen, freundlichen Lachen sagen. «Seine Frau hätten Sie ja wohl kaum sein können.» Die beiden lachen.
«Aber wem sehe ich denn so ähnlich?», fragt Hjalmar und hört auf zu kichern.
«Ach, nur jemandem, der für ihn Modell sitzt, er kommt immer vormittags, ein junger Soldat.»
«Aha.»
Beide schweigen für einen Augenblick.
«Wären Sie so freundlich, Herrn Zahrtmann zu melden, dass Hjalmar Sørensen hier ist, um ihn zu sehen?», sagt Hjalmar in einem neuen Tonfall.
Frau Hessellund schaut zu mir herüber ins Atelier. Unsere Blicke begegnen sich, und so weit ist es mittlerweile gekommen zwischen ihr und mir, dass sie sich nicht im Geringsten dafür schämt, in meiner Gegenwart mit einem Fremden über mich gelacht zu haben, und darüber hinaus, dass sie auf mein Kopfschütteln hin einfach nur lächelt, als wüsste sie, wovon sie doch keine Ahnung hat, und sich wieder Hjalmar zuwendet.
«Herr Zahrtmann ist leider nicht zu Hause.»
«Ach nein?»
«Nein, leider.»
«Dann muss ich ein andermal wiederkommen», sagt er.
«Ja, ein andermal», wiederholt sie.
«Nun denn, leben Sie wohl», sagt Hjalmar. Er blickt durch das Fenster zu mir herein. Er lächelt lange, legt seine Hand an die Schirmmütze. Er wendet sich zum Gehen, zögert aber, und ehe er verschwindet, die Straße hinunter, hinaus aus der Stadt, dreht er sich noch einmal um, und durch Glas und offene Tür höre ich ihn deutlich sagen:
«Ich möchte Sie bitten, ihm auszurichten, dass Hjalmar Sørensen hier gewesen ist, um zu sagen, dass Herr Zahrtmann ihm ein guter Lehrer gewesen ist. Er hat gesehen, dass ich das Zeug hatte, ein anderer zu werden als der, der ich zu sein glaubte. Und dafür bin ich ihm Dank schuldig.»
Und dann geht er, wie er eben geht.
Der schönste Mann, den die Welt je gesehen hat.
Anlage 1
Allgemeines bürgerliches Strafrecht vom 10. Februar 1866
§ 177. Umgang wider die Natur wird mit Zwangsarbeit in einer Besserungsanstalt bestraft.
§ 185. Wer mit unzüchtigem Verhalten gegen den Anstand verstößt oder öffentliches Ärgernis erregt, wird mit Gefängnis bei Wasser und Brot oder mit Zwangsarbeit in einer Besserungsanstalt bestraft.
Drei Jahre früher
Selbstporträt bei Lampenschein
17. Dezember 1910 Skandinavisches Panoptikum, Kopenhagen
«ACH, WIE SEHR liebe ich doch Scholle mit Zitrone», sage ich zu Valdemar, während wir satt und froh über den Kongens Nytorv spazieren, der sich zur Feier des Tages zebrafarben gekleidet hat: Straßenbahnstreifen in frischem Puderschnee. Wir essen immer Scholle mit Zitrone und Pfannkuchen, und gern im kanalseitigen Lunchrestaurant des Hotel Continental an der Ecke zwischen Havnegade und Nyhavn. Wenn ich hier mit Silberbesteck an einem weißgedeckten Tisch sitze, die gelbgrüne Säure Tropfen für Tropfen über eine frischgedämpfte Scholle träufele und dabei hinausblicke auf die Lagerhäuser und Fischerboote und Fähren, dann fühle ich mich zu Hause, mehr als an jedem anderen Ort in dieser Stadt. Vielleicht weil einen hier, wo die Wasserwege des Meeres offen vor einem daliegen, das Gefühl durchdringt, alle Personen, die man ist, auf einmal in sich fassen zu können.





























