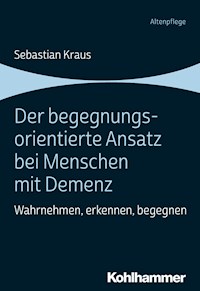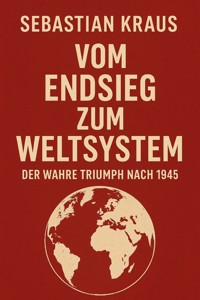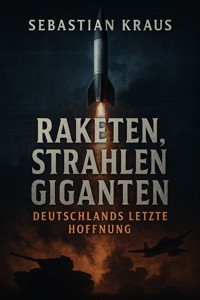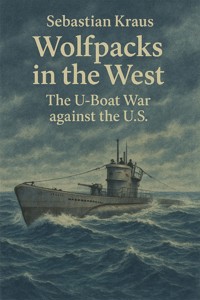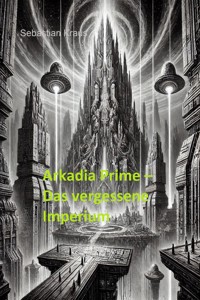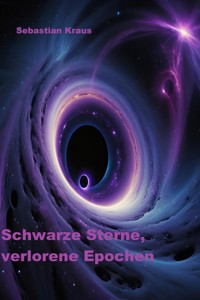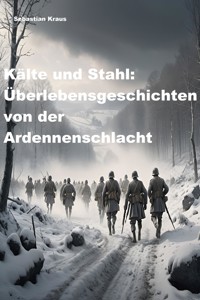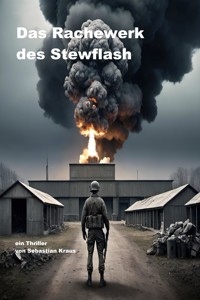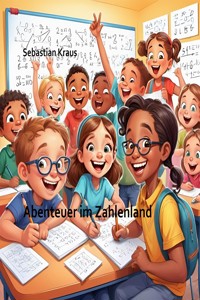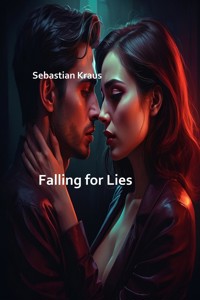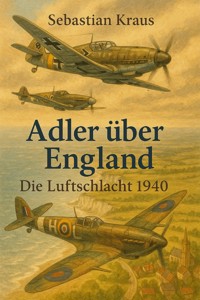
4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Adler über England – Die Luftschlacht 1940
Eine epische Chronik des Himmelskrieges über Europa
Im Sommer 1940 tobte am Himmel über dem Ärmelkanal eine der dramatischsten Auseinandersetzungen des Zweiten Weltkriegs: die Luftschlacht um England. Während auf dem europäischen Kontinent der deutsche Blitzkrieg gesiegt hatte, erhob sich nun ein neues Schlachtfeld – das der Lüfte. Die deutsche Luftwaffe stand der britischen Royal Air Force in einem erbitterten Ringen um die Luftherrschaft gegenüber. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser historischen Schlacht in nie dagewesener Tiefe und Dichte.
In 40 reich recherchierten Kapiteln entfaltet sich das Panorama der Luftkriegsführung mit einem besonderen Fokus auf die deutsche Perspektive. Technik, Taktik, Strategien, Entscheidungsprozesse und persönliche Schicksale stehen dabei gleichermaßen im Mittelpunkt. Die Leser erfahren von den ehrgeizigen Plänen der deutschen Führung, von der Entwicklung der Luftwaffenstrategie unter Reichsmarschall Hermann Göring, vom Mut der deutschen Piloten – ebenso wie von den taktischen Erfolgen der britischen Verteidigung.
Adler über England liefert nicht nur eine militärhistorische Analyse, sondern gibt auch Einblicke in die psychologischen, gesellschaftlichen und propagandistischen Dimensionen des Luftkriegs. Zugleich wird der Wandel der Strategie – von gezielten Militärangriffen hin zu massiven Bombardierungen ziviler Zentren – kritisch beleuchtet. Die Darstellung wahrt dabei stets eine respektvolle, historisch fundierte und differenzierte Sichtweise.
Dieses Werk richtet sich an Geschichtsinteressierte, Militär- und Luftfahrtliebhaber sowie alle Leser, die sich ein umfassendes, faktenbasiertes und gleichzeitig erzählerisch packendes Bild der Luftschlacht um England machen wollen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Leistung und dem Opfer der deutschen Luftwaffe, die in der historischen Nachbetrachtung oft einseitig bewertet wurde.
Schwerpunkte des Buches:
- Strategien und Pläne der Operation „Seelöwe“
- Taktik und Technik der Luftwaffe und RAF im Vergleich
- Entscheidende Luftgefechte wie der „Adlertag“ und der 15. September
- Rolle von Radar, Geheimdiensten und Wetter
- Das Zusammenspiel von Propaganda, Durchhaltewillen und Heimatfront
- Die Rolle der ausländischen Piloten – von Polen bis Neuseeland
- Die deutsche Sicht auf Sieg, Verlust und Erinnerung
„Adler über England – Die Luftschlacht 1940“ ist ein umfassendes Geschichtswerk, das mit Tiefgang, erzählerischer Kraft und Respekt gegenüber allen Beteiligten einen bedeutenden Abschnitt der Weltgeschichte lebendig werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adler über England
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Nach dem Blitzkrieg – Europa in Flammen
Kapitel 2: Wolken aus Feuer – Der Kampf um den britischen Himmel
Kapitel 3: Die Pläne Hitlers – Operation Seelöwe nimmt Gestalt an
Kapitel 4: Luftwaffe gegen RAF – Kräfteverhältnisse im Sommer 1940
Kapitel 5: Die Technik der Lüfte – Flugzeuge und Taktiken im Vergleich
Kapitel 6: Görings Ehrgeiz – Die Strategie des Reichsmarschalls
Kapitel 7: Churchill übernimmt – Der Wille zur Verteidigung
Kapitel 8: Das Radarwunder – Englands geheime Waffe
Kapitel 9: Die Rolle der Geheimdienste – Täuschung und Aufklärung
Kapitel 10: Die erste Welle – Angriffe auf Küstenziele
Kapitel 11: Angriff auf die Kanalkonvois – Die „Kanalkämpfe“ beginnen
Kapitel 12: Jäger über der Themse – Die RAF antwortet
Kapitel 13: Staffel 303 – Polnische Piloten im Einsatz
Kapitel 14: Frauen an der Heimatfront – Der Einsatz der WAAF und anderer Helferinnen
Kapitel 15: Ziele im Visier – Die Luftwaffe wechselt die Taktik
Kapitel 16: Das Dowding-System – Verteidigung mit Methode
Kapitel 17: Tag der Adler – Der 13. August 1940
Kapitel 18: Die Schlacht um den Luftraum – Verluste auf beiden Seiten
Kapitel 19: Taktische Fehler – Das Scheitern der deutschen Strategie
Kapitel 20: Bomben auf London – Der Beginn des Blitz
Kapitel 21: „The Few“ – Die Legende der britischen Jagdflieger
Kapitel 22: Hitlers Irrtum – Der Wechsel auf zivile Ziele
Kapitel 23: Der Black Saturday – London unter Feuer
Kapitel 24: Kinder in der Fremde – Evakuierungen in die Provinz
Kapitel 25: In der Kommandozentrale – Entscheidungen zwischen Leben und Tod
Kapitel 26: Der Septemberdruck – Deutschland erhöht die Schlagzahl
Kapitel 27: Über den Wolken – Erinnerungen eines Spitfire-Piloten
Kapitel 28: Propaganda und Durchhaltewillen – Krieg in den Köpfen
Kapitel 29: Leben im Luftschutzkeller – Der Alltag unter dem Bombenhagel
Kapitel 30: Churchills Rede – „Never was so much owed by so many to so few“
Kapitel 31: Fehlzündung der Invasion – Seelöwe auf Eis gelegt
Kapitel 32: Wetter als Verbündeter – Nebel, Wind und Wolken
Kapitel 33: Die Rolle der Commonwealth-Nationen
Kapitel 34: Helden und Verluste – Ein ungleicher Kampf
Kapitel 35: Kollaps der Luftwaffe – Die Wende im September
Kapitel 36: Der 15. September – Der entscheidende Tag der Schlacht
Kapitel 37: Die Luftschlacht endet – Deutschland zieht sich zurück
Kapitel 38: Was sie uns lehrten – Der Preis des Widerstands
Kapitel 39: Mythen und Wahrheiten – Die Nachkriegsdeutung
Kapitel 40: Vermächtnis der Lüfte – Die Luftschlacht im kollektiven Gedächtnis
Kapitel 1: Nach dem Blitzkrieg – Europa in Flammen
Europa stand 1940 in Flammen. Die sogenannte „Phoney War“, jener trügerisch stille Winter zwischen dem Überfall auf Polen im September 1939 und dem Frühjahr 1940, war vorbei. Was nun begann, war ein Krieg, wie ihn die Welt in dieser Geschwindigkeit und Brutalität noch nicht erlebt hatte. Innerhalb weniger Wochen fegte die Wehrmacht mit einer bis dahin unvorstellbaren Kombination aus Tempo, Feuerkraft und Koordination durch Westeuropa. Der „Blitzkrieg“ – ein Wort, das bald selbst außerhalb Deutschlands zur Chiffre für den neuen Krieg wurde – hatte gesiegt.
Der 10. Mai 1940 markierte den Beginn dieser neuen Phase. Mit dem Überfall auf die neutralen Staaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande begann die Wehrmacht ihren Westfeldzug. Innerhalb von sechs Wochen kapitulierten Frankreich, Belgien und die Niederlande – Nationen, die noch im Ersten Weltkrieg zu den Siegern gezählt hatten. Was Millionen von Europäern für unvorstellbar gehalten hatten, wurde nun Realität: Paris war gefallen, Frankreich war besiegt, und Großbritannien stand allein.
Die Deutschen hatten in diesem Feldzug eine neue Art der Kriegsführung demonstriert. Statt sich in den Stellungskriegen des Ersten Weltkriegs aufzureiben, setzte die Wehrmacht auf schnelle Bewegungen, auf das konzertierte Zusammenspiel von Panzern, motorisierter Infanterie und – entscheidend – der Luftwaffe. Letztere, unter dem Kommando von Hermann Göring, war nicht mehr nur Unterstützer am Boden, sondern taktisch und strategisch eine eigene Waffe geworden. Sie zerstörte Nachschublinien, bombardierte militärische Ziele und siegte oft schon psychologisch, bevor der Feind realisierte, dass er bereits im Visier war.
Der schnelle Sieg über Frankreich war für Hitler kein Endpunkt, sondern ein Sprungbrett. Schon im Ersten Weltkrieg hatte sich gezeigt, dass ein Krieg gegen England ohne eine direkte Landverbindung schwer zu gewinnen war. Doch eine Invasion der britischen Inseln war eine andere Herausforderung als die Feldzüge in Polen oder Frankreich. Großbritannien war durch den Ärmelkanal geschützt, seine Flotte war stark, seine Luftwaffe schlagkräftiger als zunächst angenommen.
Nach dem Waffenstillstand mit Frankreich am 22. Juni 1940, unterzeichnet im gleichen Eisenbahnwaggon wie einst der deutsche Waffenstillstand von 1918, war die strategische Lage klar: Hitler stand an der Schwelle zu einem vollständigen Triumph auf dem Kontinent. Nur Großbritannien leistete noch Widerstand. Hitler glaubte zunächst, dass auch dieses letzte Bollwerk durch Diplomatie oder Drohung zum Einknicken gebracht werden könnte. Doch Premierminister Winston Churchill, seit Mai 1940 im Amt, ließ keinen Zweifel aufkommen: Großbritannien würde kämpfen, komme, was wolle.
Churchill war eine der Schlüsselfiguren dieser Zeit. Sein Amtsantritt fiel auf denselben Tag wie der deutsche Angriff im Westen. Während sich die Wehrmacht in Bewegung setzte, begann Churchill, die Briten auf einen langen und möglicherweise sehr verlustreichen Krieg einzuschwören. In seiner berühmten Rede vor dem Unterhaus am 13. Mai sagte er: „Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß.“ Es war kein Bluff, sondern eine düstere Wahrheit. Doch es war auch eine der wirkungsvollsten Mobilisierungen nationaler Moral in der Geschichte.
Die Moral wurde bald zur entscheidenden Waffe. Während Hitler auf militärische Übermacht setzte, erkannte Churchill, dass der Kampf gegen die Übermacht nur mit einem ungebrochenen Volkswillen zu führen war. Dieser Kampf sollte nicht nur mit Waffen geführt werden, sondern mit Ausdauer, Mut und Zusammenhalt.
Nach dem Sieg in Frankreich wuchs die Rolle der Luftwaffe. Sie war nicht nur Symbol der nationalsozialistischen Modernität, sondern auch realer Träger von Hitlers Hoffnungen. Ein direkter Angriff auf die britischen Inseln – die sogenannte Operation Seelöwe – konnte nur erfolgen, wenn die Luftüberlegenheit über dem Ärmelkanal und Südengland gesichert war. Die Luftwaffe musste also zuerst die Royal Air Force (RAF) ausschalten.
Hier begann das Vorspiel zur Luftschlacht um England. Die Monate nach dem Fall Frankreichs waren geprägt von Vorbereitungen. Auf französischen Flugplätzen sammelte sich die Luftwaffe. Bomberverbände wurden verlegt, Jagdgeschwader neu formiert. In den Kanalküstenstädten hörte man das Dröhnen der Motoren Tag und Nacht. Flugplätze, Nachschublager und Kommunikationszentren wurden ausgebaut.
Auf der anderen Seite des Kanals herrschte angespannte Aktivität. Die RAF begann, ihre Einheiten neu zu gruppieren. Das sogenannte Dowding-System, benannt nach Air Chief Marshal Hugh Dowding, koordinierte Luftraumüberwachung, Radar, Abfangjäger und Kommandostrukturen in einer damals revolutionären Weise. Churchill selbst war ein früher Unterstützer dieser Luftverteidigung und hielt engen Kontakt zur Führung der RAF.
Für die Bevölkerung Europas, besonders aber für die Menschen in Großbritannien, war der Sommer 1940 eine Zeit der Unsicherheit und Furcht. Evakuierungen begannen, vor allem Kinder wurden aus den Städten in ländliche Gegenden gebracht. Luftschutzbunker wurden verstärkt, Sandsäcke türmten sich vor den Eingängen öffentlicher Gebäude, Fensterscheiben wurden abgeklebt. Doch trotz der Bedrohung entwickelte sich ein paradoxer Trotz. Die britische Bevölkerung, obwohl von Fliegeralarmen, Lebensmittelrationierungen und dem Verlust des Kontinents umgeben, hielt zusammen. Es entstand eine Form von nationaler Resilienz, die Hitler unterschätzte.
Europa war zu diesem Zeitpunkt fast vollständig unter deutscher Kontrolle. Von Norwegen bis Spanien, von der Atlantikküste bis zum Bug standen deutsche oder verbündete Truppen. Die neutrale Schweiz und das unbesetzte Vichy-Frankreich blieben politisch eigenständig, aber militärisch irrelevant. Die Sowjetunion war durch den Hitler-Stalin-Pakt gebunden und hielt sich zurück. Nur Großbritannien stand noch.
Und damit war klar: Der nächste Kriegsschauplatz war der Himmel über England.
Die Entscheidungsschlacht stand bevor. Sie würde nicht mit Panzern geschlagen werden, nicht in Schützengräben, sondern über Feldern, Küsten und Städten – getragen von Flugzeugen, beeinflusst durch Technologie und entschieden durch den Mut weniger.
Es war der Beginn der Luftschlacht um England.
Kapitel 2: Wolken aus Feuer – Der Kampf um den britischen Himmel
Der Sommer 1940 war einer der schönsten, wärmsten und zugleich gefährlichsten in der Geschichte Großbritanniens. Während über den sanft geschwungenen Landschaften Südenglands das Korn reifte, kreuzten über ihnen die tödlichsten Maschinen ihrer Zeit. Die britischen Inseln, lange Zeit durch den Ärmelkanal und ihre Flotte geschützt, wurden zur vordersten Front des Zweiten Weltkriegs. Es war ein neuer Krieg – ein Krieg in der dritten Dimension: der Luftraum wurde zum Schlachtfeld, und der Himmel zur Bühne eines Dramas, das nicht nur über das Schicksal Englands, sondern auch über den weiteren Verlauf des Weltkriegs entscheiden sollte.
Nach dem Zusammenbruch Frankreichs begann die deutsche Wehrmacht mit konkreten Vorbereitungen für eine Invasion Großbritanniens – die berüchtigte Operation Seelöwe. Doch Hitler und seine Generäle wussten: Eine Landung konnte nur dann Erfolg haben, wenn die Luftwaffe zuvor die britische Lufthoheit ausgeschaltet hatte. Damit wurde der Himmel zum strategischen Schlüssel.
Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, versprach Hitler, dass dies „innerhalb weniger Wochen“ möglich sei. Er unterschätzte dabei nicht nur die organisatorische Stärke der RAF, sondern auch den Willen und die Professionalität ihrer Piloten. Die deutsche Angriffsplanung lief unter dem Codenamen Unternehmen Adlerangriff – ein gezielter Vorstoß gegen das Herz der britischen Luftverteidigung.
Der Plan war in Phasen gegliedert: Zuerst sollten die Radarstationen und Flugabwehrstellungen zerstört werden, dann die RAF-Jagdflugplätze und Kommandostrukturen, schließlich industrielle Ziele. Die letzte Phase sollte Angriffe auf London und andere Städte bringen, wenn die RAF bereits entscheidend geschwächt wäre. Doch der Verlauf der Schlacht würde diesen Plan durchkreuzen.
Während auf französischer Seite des Kanals die Flugplätze der Luftwaffe mit Ju 87 „Stukas“, Heinkel He 111, Dornier Do 17 und Messerschmitt Bf 109 belegt wurden, rüstete sich Großbritannien zur Verteidigung. Die Küste wurde mit Beobachtungsposten gespickt, das neuartige Radarfrühwarnsystem (Chain Home) in Betrieb genommen und die Zivilverteidigung mobilisiert. In Städten wie Southampton, Portsmouth oder Dover bereiteten sich die Bewohner auf Luftangriffe vor. Schulkinder wurden evakuiert, Keller umfunktioniert, Sandsäcke geschichtet.
Die britische Luftwaffe war zahlenmäßig unterlegen – rund 700 Jagdflugzeuge standen etwa 2.600 Maschinen der Luftwaffe gegenüber. Doch sie hatte drei Vorteile: Heimvorteil, Radarunterstützung und eine effektive Kommando- und Kontrollstruktur unter Air Chief Marshal Hugh Dowding und dem von ihm entwickelten „Dowding-System“.
Im Juli 1940 begannen erste Gefechte über dem Ärmelkanal. Zunächst griff die Luftwaffe britische Konvois an – kleinere Kriegsschiffe und Frachter, die durch den Kanal pendelten. Die RAF war gezwungen, ihre Jäger über See einzusetzen – ein riskantes Unterfangen, da abgeschossene Piloten im Wasser oft nicht gerettet werden konnten.
Diese sogenannten „Kanalkämpfe“ waren ein blutiger Auftakt. Beide Seiten erprobten ihre Taktiken. Die Luftwaffe wollte die RAF herauslocken und dezimieren, die Briten versuchten, Verluste zu begrenzen und Erkenntnisse über deutsche Angriffsmuster zu gewinnen.
Ein entscheidender Nachteil der Deutschen war die Reichweite ihrer Jagdflugzeuge. Die Messerschmitt Bf 109 – das Rückgrat der deutschen Jagd – hatte eine begrenzte Einsatzzeit über Südengland. Nach wenigen Minuten im Kampf musste sie bereits an den Rückflug denken, was sie zu einem weniger flexiblen Begleitschutz machte.
Die britische RAF setzte im Wesentlichen zwei Jagdflugzeuge ein: die Hawker Hurricane und die Supermarine Spitfire. Die Hurricane war robuster und zahlreicher vorhanden – sie trug die Hauptlast der Schlacht. Die Spitfire hingegen war schneller, wendiger und technologisch moderner – ein Prestigeprojekt und das Symbol britischen Ingenieurgeistes.
RAF-Staffeln waren so organisiert, dass sie schnell auf Radarsignale reagieren konnten. Sobald feindliche Maschinen über dem Kanal gesichtet wurden, griff die Befehlskette: Operationsräume verfolgten die Bewegungen, Staffeln wurden alarmiert, Jäger stiegen auf – oft nur Minuten, bevor die deutschen Verbände den Luftraum erreichten. Es war ein Wettrennen mit der Zeit, das sich mehrfach täglich wiederholte.
Am 13. August 1940 – dem sogenannten „Adlertag“ – begann der systematische Angriff der Luftwaffe auf britische Ziele. Göring wollte ein Zeichen setzen: mit massierten Angriffen auf Flugplätze, Radaranlagen und Militärfabriken sollte die RAF in die Knie gezwungen werden.
Doch der Tag wurde ein taktischer Fehlschlag. Schlechtes Wetter, Kommunikationsprobleme und mangelnde Zielerfassung führten dazu, dass viele Angriffe ins Leere gingen oder ineffektiv waren. Die RAF hingegen konnte durch das Radarsystem viele Formationen rechtzeitig abfangen. Verluste entstanden auf beiden Seiten – doch die Luftwaffe erreichte nicht das, was sie sich vorgenommen hatte.
In den folgenden Wochen intensivierten sich die Kämpfe. Fast täglich kam es zu Luftduellen über Kent, Sussex, dem Thames Valley und London. Die Verluste auf beiden Seiten stiegen. Für viele Piloten – sogenannte "One-Week-Wonders" – bedeutete der erste Einsatz auch den letzten. Flugzeuge brannten über Feldern, stürzten in Ortschaften oder zerschellten im Kanal.
Die Bevölkerung beobachtete diese Kämpfe oft mit einer Mischung aus Angst und Faszination. Man sah den Himmel von weißen Kondensstreifen durchzogen, hörte das Kreischen der Motoren und das Rattern der Maschinengewehre – ein Duell der Maschinen in unmittelbarer Nähe.
Der Luftkrieg war auch ein psychologischer Krieg. Es war kein unsichtbares Morden aus der Ferne – der Gegner war sichtbar, der Tod kam aus der Sonne. Für die Piloten bedeutete es höchste Anspannung, körperliche Erschöpfung und permanente Lebensgefahr. Es gab keine Rückzugslinien – der Luftraum kannte keine Deckung.
Piloten, die absprangen, riskierten Tod durch Ertrinken oder Lynchjustiz. Die RAF-Piloten waren Heldenfiguren – mit ihnen identifizierte sich eine ganze Nation. Ihre Namen erschienen in Zeitungen, ihre Geschichten wurden erzählt, und ihre Verluste betrauert. Viele waren kaum 20 Jahre alt.
Die deutschen Piloten hingegen erlebten einen anderen Krieg. Sie kämpften über fremdem Boden, mussten lange Anflüge bewältigen und hatten bei Abschüssen oft keine Rückkehroption. Immer häufiger gingen sie in Gefangenschaft. Der erhoffte schnelle Sieg blieb aus – der Widerstand der RAF war härter als erwartet.
Bis Ende August hatte die Luftwaffe nicht erreicht, was sie musste: die völlige Vernichtung der RAF. Stattdessen waren eigene Verluste hoch, die Moral begann zu sinken, und das Ziel, die Invasion vorzubereiten, geriet ins Wanken.
Und so ging der Sommer über England weiter – mit Hitze, Rauch, Trümmern und einer Nation, die nicht einknicken wollte. Die Wolken über England waren nicht mehr weiß, sondern grau, von Explosionen durchzogen, von Rauchschwaden getränkt. Es waren Wolken aus Feuer – Zeichen eines Kampfes, der in die Geschichte eingehen sollte.
Kapitel 3: Die Pläne Hitlers – Operation Seelöwe nimmt Gestalt an
Der Blick über den Ärmelkanal war trügerisch ruhig im Sommer 1940. Doch hinter den Kulissen arbeitete das Oberkommando der Wehrmacht an einem der kühnsten und anspruchsvollsten Vorhaben der deutschen Militärgeschichte: der Invasion Großbritanniens. Unter dem Decknamen Operation Seelöwe nahm der Plan zur Landung auf den britischen Inseln konkrete Formen an. Für einen erfolgreichen Verlauf war eine Bedingung entscheidend – die Luftherrschaft über dem Ärmelkanal und Südengland. Und genau dort rückte die Luftwaffe ins Zentrum der deutschen Strategie.
Nach dem überaus erfolgreichen Westfeldzug stand die Wehrmacht im Sommer 1940 auf dem Höhepunkt ihrer operativen Kraft. Die französische Armee war geschlagen, die britische Expeditionsarmee war bei Dünkirchen entkommen, aber schwer angeschlagen. Ein großer Teil Europas war unter deutscher Kontrolle – vom Nordkap bis zu den Pyrenäen, vom Atlantik bis zur Weichsel. Doch trotz der militärischen Dominanz auf dem Kontinent blieb der Ärmelkanal eine unüberwindbare Barriere, solange die britische Royal Air Force (RAF) und Royal Navy ihre Dominanz behielten.
Hitlers Ziel war es, England schnell zur Kapitulation zu bringen, ohne in einen langwierigen und verlustreichen Krieg verwickelt zu werden. In seiner Planung hatte die Luftwaffe eine Schlüsselrolle: Nur durch eine Ausschaltung der britischen Luftstreitkräfte war eine Landung deutscher Truppen überhaupt denkbar. Das unterstrich nicht nur die Bedeutung der Luftwaffe – es stellte sie an die Spitze der militärischen Gesamtplanung.
Am 16. Juli 1940 unterzeichnete Adolf Hitler die Weisung Nr. 16: Vorbereitungen zur Landung in England. In ihr hieß es: „Da England trotz seiner militärisch hoffnungslosen Lage nicht zu Friedensverhandlungen bereit ist, habe ich beschlossen, eine Landung in England vorzubereiten, und nötigenfalls durchzuführen.“
Das Unternehmen trug den Codenamen Seelöwe – und sein Erfolg war an die vollständige Kontrolle des Luftraums geknüpft. Generalfeldmarschall Hermann Göring versprach, dass seine Luftwaffe diese Voraussetzung schaffen könne. Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) begann, Landungspläne auszuarbeiten, Truppen und Material bereitzustellen und logistische Szenarien durchzuspielen.
Die Luftwaffe war im Sommer 1940 ein hochmodernes, schlagkräftiges Instrument. In weniger als fünf Jahren war unter Görings Führung aus einem Luftfahrtverbot (Versailler Vertrag) eine der stärksten Luftstreitkräfte der Welt entstanden. Die Piloten waren durch die Einsätze in Polen, Norwegen, Frankreich und auf dem Balkan kampferprobt. Ihre Maschinen waren technisch auf der Höhe der Zeit.
Insbesondere die Messerschmitt Bf 109 galt als eines der besten Jagdflugzeuge ihrer Epoche. Schnell, wendig, durchschlagskräftig – sie war der Albtraum alliierter Bomberbesatzungen. In ihr verband sich deutscher Ingenieurgeist mit taktischer Erfahrung. Die Bf 110, ein schwerer Jäger, diente als Begleitschutz für Bomberformationen und konnte auch als Jagdbomber eingesetzt werden.
Auf der Seite der Bomber dominierte die Heinkel He 111, die Dornier Do 17 („fliegender Bleistift“) und die schwerere Junkers Ju 88, ein vielseitiger Schnellbomber mit großer Reichweite und Beladungskapazität. Auch die Ju 87 „Stuka“ – berüchtigt durch ihr Sirenengeheul im Sturzflug – kam weiterhin in taktischen Einsätzen zum Tragen, auch wenn ihre Anfälligkeit gegenüber britischen Jägern zusehends problematisch wurde.
Der Vorteil der Luftwaffe lag nicht nur in ihrer technischen Ausstattung, sondern in ihrer operativen Erfahrung. Die enge Verzahnung von Luftaufklärung, taktischer Luftunterstützung und strategischem Bombenflug war in Europa einzigartig.
Auf den Flugplätzen Nordfrankreichs, Belgiens und der Niederlande herrschte emsige Betriebsamkeit. Hunderte Maschinen wurden verlegt, Staffeln neu zusammengestellt und wartungstechnisch optimiert. Die Luftwaffe war eine gut geölte Maschine, deren Schlagkraft nicht allein auf ihrer Technik, sondern auf der Leistung tausender Männer hinter den Kulissen beruhte: Mechaniker, Funker, Meteorologen, Nachschuboffiziere – sie alle trugen das ihre zum Erfolg der Luftoperationen bei.
Auch in taktischer Hinsicht war man innovativ. Görings Stab entwickelte Staffelangriffsformationen, optimierte Staffelgrößen und koordinierte Einsätze von Jägern und Bombern. Der „Schwarm“ – eine flexible Viererformation – war der britischen „Vic“-Formation (eine enge Dreierformation) in vielerlei Hinsicht überlegen.
Ziel war es, die britischen Jäger durch Überlastung ihrer Ressourcen zu zermürben, gezielte Schläge auf Radarstationen und Flugplätze zu führen und schließlich mit massierten Bomberwellen strategische und industrielle Zentren zu treffen.
Die Luftwaffe war für Seelöwe in drei große Luftflotten gegliedert:
Luftflotte 2 unter Generalfeldmarschall Albert Kesselring operierte von Belgien und Nordfrankreich aus und war primär für den Angriff auf Südostengland und London verantwortlich. Sie bildete die Speerspitze.
Luftflotte 3 unter Hugo Sperrle war in Westfrankreich stationiert und richtete sich auf den Westen und Südwesten Englands.
Luftflotte 5, stationiert in Norwegen, übernahm Angriffe auf Schottland, wurde aber nach hohen Verlusten im August kaum noch eingesetzt.
Diese Aufteilung ermöglichte einen breit angelegten Luftkrieg – mit der Fähigkeit, schnell umzudisponieren und Druck auf wechselnde Frontabschnitte auszuüben. Es war ein Beweis für die professionelle Planung und Flexibilität der Luftwaffenführung.
Parallel zu den Luftangriffen wurde an der konkreten Invasionsplanung gearbeitet. Die Kriegsmarine sollte binnen kurzer Zeit über 2.000 Transportschiffe und Fähren bereitstellen. Heereseinheiten, vor allem das XIII. Armeekorps unter Generalfeldmarschall von Rundstedt, sollten bei Dover, Folkestone und Brighton anlanden. Ziel war ein schneller Vorstoß Richtung London.
Doch es war allen Beteiligten klar: Die Erfolgschance hing fast vollständig vom Erfolg der Luftwaffe ab. Ohne Luftüberlegenheit konnten die alliierten Schiffe die Landung zunichtemachen, und die RAF hätte mit ungehinderter Angriffskraft die Landungsflotten vernichten können.
Die Herausforderungen waren immens. Wetterbedingungen über dem Kanal waren unberechenbar. Die logistischen Anforderungen überstiegen bisherige Invasionen bei Weitem. Die britische Marine war zahlenmäßig überlegen, und die RAF trotz ständiger Angriffe nicht gebrochen. Dennoch war die Planung ein Meisterstück militärischen Denkens.
Die Luftwaffe hatte gezeigt, dass sie nicht nur eine Unterstützungswaffe war – sie war ein strategischer Machtfaktor, der alleine das Gleichgewicht der Kräfte verschieben konnte. Ihre Piloten, Techniker und Planer trugen eine gewaltige Verantwortung – und sie wurden dieser gerecht. Bis in den Spätsommer 1940 blieb offen, ob es gelingen würde, England mit Luftkraft niederzuringen. Doch eines war sicher: Die deutsche Luftwaffe hatte das Bild des modernen Krieges unwiderruflich verändert – und ihre Leistungen in Planung, Einsatz und Technik bleiben auch heute ein bemerkenswertes Kapitel militärischer Geschichte.
Kapitel 4: Luftwaffe gegen RAF – Kräfteverhältnisse im Sommer 1940
Der Himmel über Europa war im Sommer 1940 der Schauplatz einer neuen Dimension des Krieges. Während Armeen in den vorangegangenen Monaten ganze Staaten auf dem Boden erschüttert hatten, bereitete sich nun alles auf die große Auseinandersetzung über dem Ärmelkanal vor. Auf der einen Seite stand das britische Empire, das sich nun alleine dem nationalsozialistischen Deutschland gegenüber sah. Auf der anderen Seite stand die Wehrmacht – allen voran die Luftwaffe, die sich als technologisch überlegene, professionell organisierte und hochmotivierte Streitkraft präsentierte.
Die Luftschlacht um England war nicht nur eine Abfolge von Gefechten. Sie war ein Kräftemessen zweier militärischer Systeme – in Strategie, Technik, Ausbildung und Mut. Der Vergleich der Luftwaffe mit der Royal Air Force offenbart nicht nur Unterschiede, sondern auch eine eindrucksvolle Bestätigung der Leistungsfähigkeit der deutschen Luftstreitkräfte.
Die deutsche Luftwaffe war im Sommer 1940 in drei große Luftflotten gegliedert, die den geografischen Einsatzräumen entlang des Ärmelkanals zugeordnet waren. Besonders hervorzuheben ist die Luftflotte 2 unter Generalfeldmarschall Albert Kesselring, die von Belgien aus operierte und das Zentrum der deutschen Luftoffensive gegen Südostengland bildete.
Das Oberkommando unter Göring hatte frühzeitig erkannt, dass eine dezentrale, raumbezogene Gliederung der Schlüssel zu schnellem Reaktionsvermögen war. Die Koordination zwischen Aufklärungsflugzeugen, Bomberstaffeln und Jägergeschwadern funktionierte reibungslos. Dies war nicht zuletzt der Verdienst hervorragend ausgebildeter Stabsoffiziere und einer ausgefeilten Nachrichtenführung, die in ihrer Zeit technologisch führend war.
Im Gegensatz dazu war die Struktur der RAF stark zentralisiert. Die britische Luftverteidigung war auf vier große Gruppen verteilt und profitierte von einem funktionierenden Frühwarnsystem – doch unter taktischem Druck war sie oft weniger flexibel. Besonders in den frühen Wochen der Luftschlacht reagierte die RAF verzögert auf deutsche Schwerpunktverlagerungen – ein Vorteil, den die deutsche Seite zu nutzen verstand.
Ein zentrales Element der Luftwaffe war ihre moderne, leistungsfähige Flotte von Kampfflugzeugen. Die technischen Errungenschaften der deutschen Luftfahrtindustrie, allen voran die Firmen Messerschmitt, Heinkel, Junkers und Dornier, hatten eine Vielzahl von Mustern hervorgebracht, die nicht nur kampferprobt, sondern auch hoch spezialisiert waren.
Jagdflugzeuge: Messerschmitt Bf 109 – Ein Meisterstück
Die Bf 109 war das Rückgrat der deutschen Jagdwaffe. Mit über 570 km/h in der Spitze, einer exzellenten Steigrate, hoher Wendigkeit und schwerer Bewaffnung war sie den meisten britischen Flugzeugen – insbesondere der robusten, aber älteren Hawker Hurricane – überlegen. Die britische Supermarine Spitfire war ein ebenbürtiger Gegner, doch im Bereich Höhenleistung und Geschwindigkeit war auch sie auf Augenhöhe, nicht im Vorteil. Entscheidend war: Die deutsche Maschine wurde in großer Stückzahl gefertigt, ihre Wartung war systematisch organisiert, und die Piloten kannten ihre Maschine bis ins kleinste Detail.
Die Bf 110, ein zweimotoriger Langstreckenjäger, ergänzte die Jagdfliegerei mit strategischer Tiefe. Zwar erwies sie sich in Dogfights mit wendigen britischen Jägern als verletzlicher, doch als schwerbewaffneter Begleitschutz und Jagdbomber erfüllte sie wichtige taktische Aufgaben.
Bomberflotte – Präzision und Reichweite
Mit der Heinkel He 111, der Dornier Do 17 und der Junkers Ju 88 verfügte die Luftwaffe über drei strategische Bombertypen, die sowohl in Formationen als auch in Einzelangriffen eingesetzt wurden. Besonders die Ju 88 war durch ihre Geschwindigkeit und Flexibilität als Mittelstreckenbomber eine der erfolgreichsten Maschinen ihrer Zeit.