
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jetzt endlich als Sammelband: Die Afghanistan-Romane der Erfolgsautorin Deborah Ellis! Parvana und ihre Freundin Shauzia erleben die Willkürherrschaft der Taliban, dann den Krieg gegen die Amerikaner. Familien müssen fliehen, werden auseinandergerissen, Kinder versuchen - völlig auf sich gestellt - irgendwie zu überleben. Jedes der beiden Mädchen muss seinen Weg allein gehen: Parvana schlägt sich in den Norden Afghanistans durch, weil sie hofft, dort ihre Mutter und ihre Geschwister wiederzufinden. Shauzia flieht nach Pakistan, um der geplanten Zwangsheirat zu entkommen. Trotz aller Rückschläge erreichen beide ihr Ziel und haben noch immer die Kraft, an ein besseres Leben und an ein Wiedersehen zu glauben. Die Trilogie ist eine Erfolgsgeschichte: Vor 10 Jahren erschien der erste Band, weltweit wurden 2 Millionen Bücher verkauft, knapp eine Million Dollar aus den Tantiemen von Deborah Ellis gingen als Spenden an Straßenkinder und an Frauenorganisationen in Afghanistan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Deborah Ellis
Die Sonne im Gesicht
Allein nach Mazar-e Sharif
Am Meer wird es kühl sein
Deborah Ellisist Schriftstellerin und Psychotherapeutin und lebt in Toronto. Sie verbrachte viele Monate in afghanischen Flüchtlingslagern in Pakistan, wo sie Gespräche mit Frauen und Mädchen führte. Die Geschichten, die sie dort hörte, und die Menschen, die sie kennenlernte, inspirierten sie zur Trilogie Die Sonne im Gesicht, Allein nach Mazar-e Sharif und Am Meer wird es kühl sein.
Deborah Ellis
Die Sonne im Gesicht
Allein nach Mazar-e Sharif
Am Meer wird es kühl sein
Aus dem kanadischen Englisch übersetztvon Anna Melach bzw. Brigitte Rapp
Die Übersetzung der Bücher wurde gefördert vom Canada Council for the Arts und vom Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.
© Copyright 2001, 2003 und 2004für die deutschsprachigen Einzelausgaben Verlag Jungbrunnen Wien
© Copyright 2000, 2002 und 2003 der Originalausgabe Deborah EllisTitel der Originalausgaben:Die Sonne im Gesicht – The BreadwinnerAllein nach Mazar-e Sharif – Parvana’s JourneyAm Meer wird es kühl sein – Mud CityAlle erschienen bei Groundwood Books / Douglas & Mclntyre
EPUB ISBN 978-3-7026-5883-01. Auflage 2010Einbandgestaltung: Christian Hochmeister© Copyright 2010 by Verlag Jungbrunnen WienAlle Rechte vorbehalten – printed in Austria
Inhalt
Band 1Die Sonne im Gesicht
Band 2Allein nach Mazar-e Sharif
Band 3Am Meer wird es kühl sein
Glossar
Nachwort der Autorin
Den Kindern,die wir zwingen, tapferer zu sein,als sie sein sollten
Deborah Ellis
Band 1
Die Sonne im Gesicht
Aus dem kanadischen Englisch übersetztvon Anna Melach
Jungbrunnen
Im Text kursiv gesetzte Wörter werden im Glossar erklärt.
1. Kapitel
„Ich kann diesen Brief genauso gut lesen wie Vater“, flüsterte Parvana in die Falten ihres Tschador. „Zumindest fast so gut.“
Sie wagte nicht, diese Worte laut auszusprechen. Der Mann, der neben ihrem Vater saß, wollte ihre Stimme gewiss nicht hören. Keiner auf dem großen Markt von Kabul wollte ihre Stimme hören. Denn Parvana war nur deshalb hier, weil sie ihrem Vater dabei helfen musste, zum Markt zu kommen und nach der Arbeit wieder zurück nach Hause. Sie saß gut verborgen auf ihrer Decke. Ihr Kopf und der Großteil ihres Gesichtes waren von ihrem Tschador bedeckt.
Eigentlich sollte Parvana überhaupt nicht auf der Straße sein. Die Taliban hatten befohlen, dass alle Mädchen und Frauen in Afghanistan in ihren Häusern bleiben sollten. Sie hatten den Mädchen sogar verboten, zur Schule zu gehen. Parvana hatte die sechste Klasse Grundschule verlassen müssen, und ihre Schwester Nooria durfte nicht mehr in die Mittelschule gehen. Ihre Mutter, die bei einem der Radiosender von Kabul als Journalistin gearbeitet hatte, war von einem Tag zum anderen entlassen worden. Seit über einem Jahr waren sie nun mit der fünfjährigen Maryam und dem zweijährigen Ali alle zusammen in einem einzigen Zimmer gefangen.
Parvana konnte fast jeden Tag für ein paar Stunden ins Freie, weil sie ihren Vater beim Gehen stützen musste. Sie war immer froh, aus dem Zimmer hinauszukommen, auch wenn das hieß, dass sie dann viele Stunden auf einer Decke auf dem harten Boden des Marktes sitzen musste. Das war zumindest irgendeine Abwechslung. Sie hatte sich sogar daran gewöhnt, den Mund zu halten, ganz still zu sitzen und ihr Gesicht zu verstecken.
Für ihre elf Jahre war Parvana sehr klein. Und als kleines Mädchen konnte sie sich normalerweise auf der Straße aufhalten, ohne dass die Taliban unangenehme Fragen stellten.
„Ich brauche das Mädchen, damit es mich beim Gehen stützt“, sagte der Vater jedem Soldaten, der wissen wollte, was Parvana auf der Straße verloren hatte. Und er zeigte dann auf sein Bein. Der Vater hatte einen Fuß verloren, als die Mittelschule, an der er unterrichtet hatte, von einer Bombe getroffen worden war. Er hatte damals auch innere Verletzungen davongetragen und war nun oft sehr müde.
„Und ich habe keinen Sohn zu Hause, der mir helfen kann, nur ein Kleinkind“, erklärte der Vater.
Parvana duckte sich dann noch mehr zusammen und versuchte, noch kleiner auszusehen. Sie hatte Angst, den Soldaten aufzufallen. Sie hatte schon oft mitangesehen, wie sie Menschen, besonders Frauen, behandelten. Sie schlugen und peitschten alle aus, die ihrer Meinung nach aus irgendeinem Grund eine Strafe verdienten.
Wenn Parvana so Tag für Tag auf dem Markt saß, konnte sie eine Menge sehen. Aber wenn Soldaten der Taliban in der Nähe waren, hätte sie sich am liebsten unsichtbar gemacht.
Nun bat der Kunde den Vater, den Brief noch einmal vorzulesen. „Lies langsam“, sagte er, „damit ich es mir merken und meiner Familie berichten kann.“
Parvana hätte auch gerne einen Brief bekommen. Seit Kurzem funktionierte in Afghanistan wieder die Post, nachdem sie durch den Krieg jahrelang gestört gewesen war. Viele von Parvanas Freundinnen waren mit ihren Familien aus Afghanistan geflohen. Vermutlich nach Pakistan, aber Parvana wusste nichts Genaueres, deshalb konnte sie ihnen auch nicht schreiben. Sie selbst war mit ihrer Familie wegen der Bomben so oft umgezogen, dass ihre Freundinnen nicht mehr wussten, wo sie nun wohnte.
„Afghanen sind über die ganze Erde verstreut, wie Sterne über den Himmel“, sagte ihr Vater oft.
Der Vater hatte den Brief ein zweites Mal vorgelesen. Der Kunde dankte ihm und bezahlte. „Ich werde wiederkommen, wenn es Zeit ist, eine Antwort zu schreiben“, sagte er.
Die meisten Menschen in Afghanistan konnten nicht lesen und schreiben. Parvana war eine der wenigen Glücklichen, die es gelernt hatten. Ihre Eltern waren beide auf der Universität gewesen und glaubten an die Wichtigkeit der Bildung für alle, auch für Mädchen.
Der Nachmittag ging weiter. Kunden kamen und gingen. Die meisten sprachen Dari, die Sprache, die auch Parvana am besten beherrschte. Wenn ein Kunde Pashtu sprach, konnte sie das meiste verstehen, aber nicht alles. Parvanas Eltern sprachen auch Englisch. Der Vater war in England auf der Universität gewesen. Das war sehr lange her.
Auf dem Markt ging es lebhaft zu. Männer kauften für ihre Familien ein, fliegende Händler boten ihre Waren und Dienste an. Manche Händler hatten feste Plätze; die Teestände zum Beispiel. Mit dem großen Teekessel und den vielen Tabletts voller Teegläser konnte man nicht herumwandern. Deshalb gab es viele Teejungen, die mit einem Tablett in dem Labyrinth des Marktes herumliefen und den Händlern Tee brachten, die ihre eigenen Läden nicht verlassen konnten. Dann rannten sie mit den leeren Gläsern wieder zurück.
„Das könnte ich auch tun“, murmelte Parvana. Sie wäre so gerne auf dem Markt herumgewandert, hätte die engen, verwinkelten Gässchen kennengelernt, so gut, wie sie die vier Wände ihres eigenen Zuhauses kannte.
Der Vater wandte sich nach ihr um. „Ich würde dich lieber auf einem Schulhof herumlaufen sehen als hier!“ Dann wandte er sich wieder um und rief den vorübergehenden Männern zu: „Haben Sie etwas vorzulesen? Haben Sie etwas zu schreiben? Pashtu und Dari! Wunderschöne Sachen zu verkaufen!“
Parvana runzelte die Stirn. Es war doch nicht ihre Schuld, dass sie nicht mehr zur Schule gehen durfte! Sie wäre viel lieber in einem Klassenraum gesessen als hier auf der unbequemen Matte, wo ihr der Rücken und der Po wehtaten. Parvana vermisste ihre Freundinnen, ihre blauweiße Schuluniform und die vielen neuen Dinge, die sie jeden Tag gelernt hatten.
Ihr Lieblingsgegenstand war Geschichte, vor allem die Geschichte Afghanistans. Viele Völker hatten Afghanistan zu erobern versucht. Vor viertausend Jahren waren die Perser gekommen. Dann kam Alexander der Große, danach kamen die Griechen, die Araber, die Türken, die Briten und schließlich die Sowjets. Einer der Eroberer, Tamerlan von Samarkand, hieb die Köpfe seiner Feinde ab und stapelte sie in großen Haufen auf wie Melonen auf einem Obststand. Alle diese Leute waren in Parvanas wunderschönes Land gekommen, um es zu erobern, und die Afghanen hatten sie alle hinausgeworfen!
Aber jetzt wurde das Land von den Taliban-Milizen regiert. Die Taliban waren Afghanen, und sie hatten sehr bestimmende, eindeutige Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Als sie die Hauptstadt Kabul erobert hatten und allen Mädchen verboten, zur Schule zu gehen, war Parvana im ersten Moment nicht allzu traurig gewesen. Ihr drohte gerade eine Mathematikschularbeit, für die sie nichts gelernt hatte, und außerdem hatte sie wieder einmal Schwierigkeiten, weil sie während der Stunde ständig schwätzte. Der Lehrer hatte einen Beschwerdebrief an ihre Mutter schicken wollen, aber die Taliban waren zuvorgekommen.
„Warum heulst du denn?“, hatte Parvana ihre Schwester Nooria gefragt, die nicht aufhören konnte zu weinen. „Ein oder zwei Ferientage, das ist doch super!“ Parvana war überzeugt gewesen, die Taliban würden sie ein paar Tage später wieder zur Schule gehen lassen. Und bis dahin hatte der Lehrer die ärgerliche Mitteilung wegen ihrer Schwätzerei sicher vergessen.
„Sei doch nicht so blöd!“, schrie Nooria sie an. „Lass mich in Ruhe!“
Eine der Schwierigkeiten, wenn man mit der ganzen Familie in einem Zimmer wohnt, besteht darin, dass man unmöglich jemanden in Ruhe lassen kann. Wo Nooria war, da war auch Parvana, und wo Parvana war, da war Nooria.
Parvanas Eltern kamen aus angesehenen afghanischen Familien. Wegen ihrer guten Ausbildung hatten sie in ihren Berufen viel Geld verdient. Sie hatten in einem großen Haus mit einem Innenhof gewohnt, mit Dienstpersonal, einem Fernsehapparat, einem Kühlschrank, einem Auto. Nooria hatte sogar ein eigenes Zimmer gehabt. Parvana hatte ihres mit ihrer kleinen Schwester Maryam geteilt. Maryam plapperte zwar ununterbrochen, aber sie und Parvana liebten einander von ganzem Herzen. Und es war herrlich gewesen, Nooria ausweichen zu können.
Das Haus war von einer Bombe zerstört worden. Die Familie war seither immer wieder umgezogen, jedes Mal in eine kleinere Wohnung. Und jedes Mal, wenn wieder ein Haus, in dem sie gerade wohnten, von einer Bombe getroffen wurde, verloren sie mehr von ihren Sachen. Mit jeder Bombe wurden sie ärmer. Und jetzt lebten sie alle zusammen in einem einzigen Zimmer.
In Afghanistan herrschte seit mehr als zwanzig Jahren Krieg. Das war doppelt so lang, wie Parvana auf der Welt war.
Zuerst hatten die Sowjets mit ihren großen Panzern das Land überrollt und es mit Kriegsflugzeugen überflogen und Bomben auf Dörfer und Felder abgeworfen.
Parvana war einen Monat vor dem Abzug der Sowjets geboren. „Du warst ein so hässliches Baby, dass die Sowjets es nicht ertragen konnten, mit dir im gleichen Land zu sein“, spottete Nooria immer wieder. „Sie sind vor Schreck über die Grenze in ihr eigenes Land geflohen, so schnell sie ihre Panzer tragen konnten.“
Nachdem die Sowjets weg waren, wollten die Männer, die zuvor auf die Sowjets geschossen hatten, weiterhin auf Menschen schießen, und daher schossen sie aufeinander. Viele Bomben fielen damals auf Kabul. Viele Menschen starben.
Bomben waren immer ein Teil von Parvanas Leben gewesen. Jeden Tag, jede Nacht fielen Bomben und Raketen vom Himmel und irgendjemandes Haus explodierte.
Und wenn die Bomben fielen, rannten die Menschen. Sie rannten zuerst hierhin, dann rannten sie dorthin, auf der Suche nach einem Platz, wo sie vor den Bomben sicher waren. Als Parvana noch klein war, wurde sie getragen. Als sie größer wurde, musste sie selber rennen.
Nun wurde ein Großteil des Landes von den Taliban kontrolliert. Das Wort Taliban heißt eigentlich: „religiöser Gelehrter“. Parvanas Vater erklärte ihr, Religion sei dazu da, den Menschen zu helfen, menschlicher, freundlicher und glücklicher zu werden. „Aber die Taliban machen Afghanistan nicht zu einem Land, in dem man glücklich und menschenwürdig leben kann“, sagte der Vater.
Es fielen immer noch Bomben auf Kabul, aber nicht mehr so häufig wie vorher. Im Norden des Landes war immer noch Krieg, und dort wurden derzeit auch die meisten Menschen umgebracht.
Einige weitere Kunden waren gekommen und wieder gegangen, und Vater schlug vor, für heute mit der Arbeit aufzuhören.
Parvana sprang auf und knickte sofort wieder zusammen. Ihr Bein war eingeschlafen. Sie rieb es und versuchte dann noch einmal aufzutreten. Diesmal blieb sie stehen.
Zuerst sammelte sie all die kleinen Dinge ein, die sie zu verkaufen versuchten, Teller, Schüsselchen, kleine Dosen und verschiedene Ziergegenstände aus dem Hausrat, die die Bomben überlebt hatten. Wie viele Afghanen verkauften sie, was sie entbehren konnten. Mutter und Nooria sahen regelmäßig alles durch, was sie noch besaßen, um herauszusuchen, was sie nicht unbedingt brauchten. Es gab so viele Leute in Kabul, die ihre Habseligkeiten verkauften, dass Parvana sich immer wieder wunderte, dass überhaupt jemand übrig geblieben war, der auch etwas kaufte.
Parvana schüttelte die Decke aus und faltete sie zusammen. Der Vater packte Schreibzeug und Papier in die Schultertasche. Er stützte sich auf seinen Stock, nahm Parvanas Arm und stand langsam auf. Sie machten sich auf den Heimweg.
Kleine Entfernungen konnte der Vater allein, nur mit dem Stock, schaffen. Aber für längere Strecken brauchte er Parvana als Stütze.
„Du hast genau die richtige Größe für mich“, sagte er.
„Und wenn ich wachse?“
„Dann wachse ich mit dir!“
Vater hatte eine Beinprothese gehabt, die hatte er aber verkauft. Er hatte sie eigentlich gar nicht verkaufen wollen. Denn Prothesen werden ja extra für eine bestimmte Person angefertigt, und das künstliche Bein eines Menschen passt nicht unbedingt einem anderen. Aber als ein Kunde Vaters falsches Bein auf der Decke liegen sah, wollte er es unbedingt haben. Die anderen Dinge sah er gar nicht an. Und er bot Vater einen so guten Preis, dass der sich überreden ließ.
Jetzt gab es sehr viele Beinprothesen auf dem Markt von Kabul zu kaufen. Seit die Taliban befohlen hatten, Frauen müssten zu Hause bleiben, nahmen viele Ehemänner ihren Frauen die Prothesen weg und verkauften sie. „Du gehst ja nicht fort, wozu brauchst du dann ein falsches Bein?“, fragten sie.
Überall in Kabul gab es zerbombte Häuser. Ganze Straßenzüge, in denen es einst Wohnhäuser und Geschäfte gegeben hatte, waren nur noch Schutt und Staub.
Kabul war früher eine schöne Stadt gewesen. Nooria erinnerte sich noch an unbeschädigte Gehsteige, an Verkehrsampeln, deren Lichter wechselten. Abends waren sie spazieren gegangen oder ins Kino, oder sie hatten in eleganten Geschäften nach Kleidern oder Büchern gestöbert.
Den größten Teil von Parvanas Leben bestand die Innenstadt von Kabul nun aus Ruinen, und sie konnte sich die Stadt nicht anders vorstellen. Es tat ihr weh zu hören, wie das alte Kabul vor der Bombardierung ausgesehen hatte. Sie wollte gar nicht daran denken, was die Bomben alles zerstört hatten, vor allem Vaters Gesundheit und ihr eigenes schönes Haus. Das machte sie zornig, und weil sie mit ihrem Zorn nirgendwohin konnte, wurde sie traurig.
Parvana und ihr Vater verließen den belebten Markt und gingen eine Straße hinunter zu dem Haus, in dem sie wohnten. Parvana geleitete ihren Vater vorsichtig um tiefe Löcher und Steintrümmer herum, die sich mitten auf der Straße befanden.
„Wie können Frauen in ihren Burkas auf diesen Straßen gehen?“, fragte Parvana ihren Vater. „Wie können sie sehen, wo sie hinsteigen?“
„Sie fallen oft“, antwortete der Vater. Er hatte recht. Parvana hatte oft Frauen stürzen sehen.
Sie blickte die Straße entlang auf ihren Lieblingsberg, der sich majestätisch am Ende der Straße erhob.
„Wie heißt dieser Berg?“, hatte sie einmal ihren Vater gefragt, kurz nachdem sie in diese Gegend gezogen waren.
„Das ist der Mount Parvana.“
„Das stimmt nicht!“, sagte Nooria.
„Du solltest dem Kind nichts Falsches sagen“, meinte die Mutter. Es war in der Zeit vor den Taliban gewesen. Die ganze Familie war gemeinsam spazieren gegangen. Mutter und Nooria hatten bloß leichte Tücher über ihrem Haar getragen und ihre Gesichter im Sonnenschein baden lassen.
„Berge werden von Menschen benannt“, erklärte der Vater. „Ich bin ein Mensch, und ich nenne diesen Berg Mount Parvana.“
Die Mutter gab lachend nach. Vater lachte auch, Parvana lachte, und auch die kleine Maryam, die beinahe noch ein Baby war und nicht wusste, warum sie lachte. Sogar die stets mürrische Nooria stimmte ein. Das Lachen der ganzen Familie eilte bis zum Gipfel des Mount Parvana und wieder zurück zur Straße. Nun aber stiegen Parvana und ihr Vater langsam die Stufen zu ihrer Wohnung hinauf. Sie lebten im dritten Stock eines Wohnblocks. Das Haus war von einer Bombe getroffen und beschädigt worden, und eine Hälfte war nur mehr Schutt.
Die Stiegen liefen im Zickzack an der Außenmauer des Hauses hinauf. Auch sie waren teilweise zerstört, und manche Stufen waren verschoben. Das Stiegengeländer war nur mehr an einigen Stellen vorhanden. „Stütze dich niemals auf dieses Geländer!“, hatte der Vater Parvana immer wieder eingeschärft. Die Stiegen hinaufzusteigen war für den Vater einfacher als hinunter, aber sie brauchten trotzdem sehr lange. Endlich erreichten sie die Wohnungstür und traten ein.
2. Kapitel
Mutter und Nooria waren wieder einmal beim Putzen. Der Vater küsste Ali und Maryam, wusch sich im Bad den Staub von Gesicht, Händen und Füßen und streckte sich auf einem Toshak aus, um sich auszuruhen.
Parvana legte ihr Bündel neben die Tür und nahm ihren Tschador ab.
„Wir brauchen Wasser“, sagte Nooria.
„Kann ich mich nicht erst ein bisschen hinsetzen?“, fragte Parvana die Mutter.
„Du wirst besser sitzen, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist. Geh jetzt gleich! Der Wassertank ist fast leer.“
Parvana seufzte. Wenn der Tank fast leer war, musste sie fünfmal zum Wasserhahn hinuntergehen. Nein, sechsmal, weil die Mutter es nicht leiden konnte, wenn der Wassereimer leer war.
„Wärst du gestern gegangen, als Mutter dich gebeten hatte, müsstest du heute nicht so viel schleppen“, sagte Nooria spöttisch, als Parvana an ihr vorüberging, um den Kübel zu holen. Nooria lächelte ihr überlegenes Große-Schwester-Lächeln und warf mit einem Schwung ihr langes Haar über die Schultern zurück. Parvana hätte sie ohrfeigen können.
Nooria hatte wunderschönes, dichtes, langes Haar. Parvanas Haar war dünn und strähnig. Sie wünschte sich auch Haare wie ihre große Schwester, und Nooria wusste das sehr gut.
Parvana murrte den ganzen Weg vor sich hin, die vielen Stufen hinunter und weiter, den Häuserblock entlang, bis sie schließlich beim gemeinsamen Wasserhahn für die ganze Nachbarschaft angelangt war. Der Rückweg mit dem vollen Eimer war noch schlimmer, vor allem die drei Stockwerke hinauf. Aber die Wut auf Nooria gab ihr Kraft, deshalb schimpfte Parvana den ganzen Weg leise weiter.
„Nooria geht nie Wasser holen, und Mutter auch nicht. Und Maryam auch nicht. Die muss überhaupt nie irgendetwas arbeiten!“
Parvana wusste natürlich, dass sie Unsinn daherredete, aber sie murrte trotzdem weiter. Maryam war erst fünf, sie konnte nicht einmal den leeren Kübel die Stufen hinuntertragen, geschweige denn einen vollen hinauf. Die Mutter und Nooria aber mussten, wo immer sie außerhalb des Hauses hingingen, Burkas tragen, und mit diesen Burkas konnten sie unmöglich einen vollen Eimer Wasser die halb zertrümmerten Stufen hinaufschleppen. Außerdem war es immer gefährlich für Frauen, sich ohne männliche Begleitung außerhalb des Hauses aufzuhalten.
Parvana wusste, dass sie es war, die Wasser holen musste, weil niemand anderer in der Familie das tun konnte. Manchmal machte sie das wütend. Manchmal war sie stolz darauf. Aber eines war klar: Was sie auch fühlte, ob sie gut oder schlecht gelaunt war, das Wasser musste geholt werden, und sie war diejenige, die es holen musste.
Endlich war der Wassertank gefüllt, auch der Eimer war voll. Parvana konnte aus den Sandalen schlüpfen, ihren Tschador aufhängen und sich ausruhen. Sie setzte sich auf den Fußboden neben Maryam und sah zu, wie ihre kleine Schwester ein Bild zeichnete.
„Du kannst wunderschön zeichnen, Maryam! Eines Tages wirst du deine Zeichnungen verkaufen und viel, viel Geld dafür bekommen. Und wir werden alle reich sein und in einem Palast leben, und du wirst ein Kleid aus blauer Seide tragen …“
„Aus grüner Seide“, sagte Maryam.
„Aus grüner Seide“, stimmte Parvana zu.
„Du könntest uns helfen, statt bloß herumzusitzen!“ Die Mutter und Nooria putzten wieder einmal den Schrank.
„Ihr habt den Kasten doch vor drei Tagen erst geputzt!“
„Hilfst du uns jetzt oder nicht?“
Nicht, dachte Parvana, aber sie stand auf. Die Mutter und Nooria waren ständig dabei, irgendetwas zu putzen. Da sie ja nicht arbeiten oder zur Schule gehen durften, hatten sie nicht viel anderes zu tun. „Die Taliban haben uns befohlen, im Haus zu bleiben, aber das heißt nicht, dass wir im Dreck leben müssen“, sagte die Mutter immer.
Parvana hasste diese Putzerei. Sie verbrauchten dabei das ganze Wasser, das sie so mühsam heraufschleppen musste. Noch mehr Wasser verbrauchte Nooria, wenn sie ihre Haare wusch.
Parvana blickte sich in dem kleinen Zimmer um. Alle Möbel, an die sich Parvana aus früheren Wohnungen erinnerte, waren von Bomben zerstört oder von Plünderern gestohlen worden. Alles, was sie jetzt an Möbeln besaßen, war der große hölzerne Schrank, der schon im Zimmer gewesen war, als sie eingezogen waren. Darin wurden die wenigen Besitztümer aufbewahrt, die sie hatten retten können. Außer dem Kasten hatten sie noch zwei Toshaks, die an der Wand auf dem Boden lagen, das waren alle ihre Möbelstücke. Früher hatten sie schöne afghanische Teppiche gehabt. Parvana erinnerte sich, wie sie als Kind mit dem Finger die verschlungenen Muster nachgefahren war. Jetzt lagen bloß billige Matten auf dem Betonboden.
Parvana konnte den Raum mit zehn Schritten durchqueren und mit zwölf Schritten in die andere Richtung. Es war ihre Aufgabe, die Matten mit einem kleinen Besen zu kehren. Sie kannte jeden Zentimeter des Zimmers.
Am einen Ende befand sich der Waschraum. Er war sehr klein, mit einem orientalischen Trittstein-WC, keiner modernen, westlichen Toilette, wie sie früher eine gehabt hatten! Hier stand auch der kleine Propangasherd, weil eine winzige Lüftungsklappe hoch oben in der Wand für frische Luft sorgte. Auch der Wassertank war da, ein großes metallenes Fass, in dem fünf Eimer Wasser Platz hatten. Daneben war die Waschschüssel.
In dem noch stehenden Teil des Gebäudes lebten auch noch andere Leute. Parvana sah sie manchmal, wenn sie Wasser holte oder mit ihrem Vater zum Markt ging. „Wir müssen uns von den Nachbarn fernhalten“, sagte der Vater. „Die Taliban ermuntern die Leute, einander auszuspionieren. Es ist sicherer für uns, wenn wir nichts mit ihnen zu tun haben.“
Es ist vielleicht sicherer, dachte Parvana oft, aber es ist auch einsamer. Vielleicht wohnte ein anderes Mädchen in ihrem Alter gleich nebenan, und sie würde das niemals herausfinden. Vater hatte seine Bücher, Maryam spielte mit Ali, Nooria hatte die Mutter, aber Parvana war ganz allein.
Die Mutter und Nooria hatten die Fächer feucht ausgewischt. Jetzt räumten sie den Schrank wieder ein.
„Hier sind ein paar Sachen, die dein Vater auf dem Markt verkaufen kann. Leg sie zur Tür“, sagte die Mutter.
Der leuchtend rote Stoff erregte Parvanas Aufmerksamkeit. „Das ist ja mein schöner Shalwar Kameez! Den können wir nicht verkaufen!“
„Was wir verkaufen, bestimme ich, nicht du! Wir brauchen ihn nicht mehr, außer du hast vor, auf eine Party zu gehen, von der du mir nichts erzählt hast.“
Parvana wusste, dass es keinen Sinn hatte zu widersprechen. Seit Mutter ihre Arbeit verloren hatte, wurde sie jeden Tag gereizter.
Parvana legte ihr geliebtes Kleidungsstück mit den anderen Sachen zur Tür. Sie streichelte mit den Fingern über die kunstvolle Stickerei. Dieser Shalwar Kameez war ein Eid-Geschenk ihrer Tante aus Mazar-e Sharif, einer Stadt im Norden von Afghanistan. Hoffentlich ist die Tante böse auf die Mutter, weil die ihr Geschenk verkauft, dachte Parvana.
„Warum verkaufen wir nicht Noorias gute Kleider? Sie geht überhaupt nirgends hin!“
„Sie braucht sie, wenn sie heiratet.“
Nooria lächelte triumphierend. Als zusätzliche Beleidigung warf sie den Kopf zurück, dass ihr schönes, langes Haar flog.
„Der tut mir heute schon leid, der dich einmal heiratet“, sagte Parvana. „Er kriegt eine eingebildete, hochnäsige Kuh zur Frau!“
„Es reicht!“, sagte die Mutter.
Parvana schäumte vor Wut. Immer ergriff die Mutter Noorias Partei! Parvana hasste Nooria, und sie hätte auch ihre Mutter gehasst, wenn sie nicht ihre Mutter gewesen wäre.
Ihr Ärger schmolz aber dahin, als sie sah, wie die Mutter das Bündel mit Hossains Kleidern in die Hand nahm und im obersten Fach des Schranks verbarg. Die Mutter sah immer so traurig aus, wenn sie Hossains Kleider in der Hand hatte.
Nooria war nicht immer das älteste Kind der Familie gewesen. Hossain war der Älteste gewesen. Er war von einer Landmine getötet worden, als er vierzehn war. Mutter und Vater sprachen niemals von ihm. Die Erinnerung war zu schmerzlich. Nooria hatte Parvana einmal von Hossain erzählt, bei einer der wenigen Gelegenheiten, wo die Schwestern miteinander redeten.
Hossain hatte gern gelacht, und wollte immer, dass Nooria mit ihm spielte, obwohl sie doch ein Mädchen war.
„Sei doch nicht so eine Prinzessin“, hatte er gesagt. „Ein wenig Fußball spielen tut dir gut!“
Und manchmal, erzählte Nooria, hatte sie nachgegeben und mit ihm Fußball gespielt. Er hatte ihr den Ball immer so gut zugeschossen, dass sie ihn stoppen und zurückschießen konnte. „Er hat auch dich immer hochgenommen und mit dir gespielt“, berichtete Nooria. „Er hatte dich wirklich gern. Stell dir das vor!“
Ich hätte Hossain sicher auch gern gehabt, dachte Parvana.
Als sie den Schmerz im Gesicht ihrer Mutter sah, vergaß sie ihren Zorn und half stillschweigend, das Abendessen herzurichten. Das Essen heiterte alle ein wenig auf, und so blieben sie noch eine Weile beisammen sitzen, als sie fertig waren.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt tauschten Nooria und die Mutter dann immer ein geheimes Signal aus, und beide erhoben sich im gleichen Augenblick, um das Geschirr wegzuräumen. Parvana hatte keine Ahnung, wie sie das machten; sie versuchte immer, das Geheimzeichen zu entdecken, aber das war ihr bisher noch nicht gelungen.
Ali war auf Mutters Schoß eingeschlafen, ein Stückchen Nan in der kleinen Faust. Ab und zu richtete er sich schlaftrunken auf, als wolle er nichts von der Unterhaltung versäumen, und versuchte aufzustehen, aber die Mutter hielt ihn mit sanfter Gewalt fest. Ali zappelte ein wenig, dann schlief er wieder ein.
Vater hatte sich mit einem kurzen Schläfchen etwas erfrischt. Er hatte seinen guten, weißen Shalwar Kameez angezogen. Sein langer Bart war sorgsam gekämmt. Parvana fand ihren Vater sehr schön.
Die Taliban hatten allen Männern befohlen, sich Bärte wachsen zu lassen. Zuerst fiel es Parvana schwer, sich an das neue Gesicht ihres Vaters zu gewöhnen. Er hatte zuvor niemals einen Bart getragen. Auch er selbst konnte sich nur schwer daran gewöhnen, denn der Bart kitzelte ihn anfangs fürchterlich.
Nun erzählte der Vater wieder historische Episoden. Er hatte Geschichte unterrichtet, bevor seine Schule von einer Bombe getroffen worden war. Parvana war mit diesen Geschichten aufgewachsen, deshalb war sie auch in der Schule in diesem Fach sehr gut gewesen.
„Im Jahre 1880 wollten die Briten unser Land erobern. Wollten wir, dass die Briten uns eroberten?“, wandte er sich an Maryam.
„Nein!“, antwortete Maryam.
„Natürlich nicht! Jeder kommt nach Afghanistan und will es erobern, aber wir Afghanen werfen sie alle hinaus! Wir sind außerordentlich gastfreundliche Menschen. Ein Gast ist bei uns König. Merkt euch das. Wenn ein Gast in unser Haus kommt, muss er immer das Allerbeste bekommen!“
„Oder sie“, sagte Parvana.
Vater lächelte ihr zu. „Oder sie. Wir Afghanen tun alles, damit sich ein Gast wohlfühlt. Aber wenn jemand in unser Haus kommt oder in unser Land und sich wie ein Feind benimmt, dann verteidigen wir uns!“
„Vater, erzähl weiter“, drängte Parvana. Sie hatte die Geschichte schon oft gehört, aber sie wollte sie immer wieder hören.
Wieder lächelte der Vater. „Wir müssen diesem Kind irgendwie Geduld beibringen“, sagte er zur Mutter. Parvana brauchte ihre Mutter nicht anzusehen, um sich vorzustellen, was sie jetzt dachte: Da gibt es noch eine Menge ganz anderer Sachen, die wir diesem Kind beibringen müssen …
„Also schön“, gab der Vater nach. „Weiter. Es war im Jahre 1880. Im Staub rund um die Stadt Kandahar kämpften die Afghanen mit den Briten. Es war eine fürchterliche Schlacht. Viele Männer starben. Die Briten waren im Vorteil, und die Afghanen waren nahe daran aufzugeben. Ihr Kampfesmut war erloschen, und sie hatten keine Kraft mehr weiterzukämpfen. Sie waren nahe daran, sich gefangen nehmen zu lassen. Dann konnten sie wenigstens verschnaufen und vielleicht ihr Leben retten.
Da stürmte plötzlich ein kleines Mädchen, jünger als Nooria, aus einem der Häuser des Dorfes. Es rannte mitten durch die kämpfenden Truppen bis vor die Kampflinie und wandte sich nach den afghanischen Soldaten um. Es riss seinen Schleier vom Kopf, und während die heiße Sonne auf sein Gesicht und den bloßen Kopf brannte, schrie es den afghanischen Truppen zu:
‚Wir können diesen Kampf gewinnen!‘, schrie es. ‚Gebt die Hoffnung nicht auf! Reißt euch zusammen! Los, kämpfen wir weiter!‘ Es schwenkte den Schleier wie ein Kriegsbanner und führte die Truppen in den Endkampf mit den Briten. Und die Briten hatten keine Chance. Die Afghanen gewannen die Schlacht.
Und was ihr daraus lernen könnt, meine Töchter“, sagte Vater und blickte von einer zur anderen, „ist: In Afghanistan hat es immer die tapfersten Frauen der Welt gegeben. Ihr seid alle tapfere Frauen. Ihr seid die Erbinnen des Mutes von Malali!“
„Wir können diesen Krieg gewinnen!“, rief Maryam und schwang ihre Arme, als hätte sie eine Fahne in der Hand. Die Mutter rettete geschwind die Teekanne aus ihrer Reichweite.
„Wie können wir tapfer sein?“, fragte Nooria. „Wir dürfen doch nicht einmal auf die Straße hinaus! Wie können wir Männer in der Schlacht anführen? Ich hab genug vom Krieg! Ich will keinen Krieg mehr!“
„Es gibt verschiedene Arten von Kampf“, antwortete der Vater ruhig.
„Zum Beispiel den Kampf mit dem Abendessen-Geschirr“, sagte die Mutter.
Parvana schnitt ein so kummervolles Gesicht, dass der Vater lachen musste. Maryam versuchte, sie nachzuahmen, da mussten auch die Mutter und Nooria lachen. Ali erwachte, und als er alle lachen sah, lachte er mit.
Die ganze Familie lachte noch, als plötzlich vier Taliban-Soldaten die Tür aufstießen.
Ali reagierte als Erster. Das Krachen der Tür gegen die Wand erschreckte ihn, und er begann zu schreien.
Die Mutter sprang auf, und einen Augenblick später waren Ali und Maryam in einer Ecke des Zimmers hinter ihrem Rücken versteckt.
Nooria rollte sich blitzschnell zu einer Kugel zusammen und deckte sich mit ihrem Tschador zu. Junge Frauen wurden manchmal von Soldaten geraubt. Sie wurden aus ihren Häusern gezerrt, und ihre Familien sahen sie nie wieder.
Parvana vermochte sich überhaupt nicht zu bewegen. Wie erstarrt saß sie am Rande des Essenstuches. Die Soldaten waren riesengroß. Ihre hoch aufgetürmten Turbane machten sie noch größer.
Zwei Soldaten packten den Vater. Die anderen beiden begannen das Zimmer zu durchsuchen. Die Reste des Abendessens flogen durch das ganze Zimmer.
„Lasst meinen Mann in Ruhe!“, schrie die Mutter. „Er hat nichts Unrechtes getan!“
„Warum bist du nach England studieren gegangen?!“, brüllte einer der Soldaten den Vater an. „Afghanistan braucht keine ausländischen Ideen!“ Sie zerrten ihn zur Tür.
„Afghanistan braucht noch mehr ungebildete Halsabschneider wie dich“, sagte der Vater. Einer der Soldaten schlug ihm ins Gesicht. Blut tropfte aus seiner Nase auf den weißen Shalwar Kameez.
Die Mutter sprang auf die Soldaten los und hämmerte mit den Fäusten auf sie ein. Sie packte den Vater am Arm und versuchte, ihn aus dem Griff der Männer loszureißen.
Einer der Soldaten hob sein Gewehr und schlug sie auf den Kopf. Sie brach auf dem Fußboden zusammen. Der Soldat schlug noch ein paarmal zu. Maryam und Ali schrien laut bei jedem Schlag auf Mutters Rücken.
Als Parvana ihre Mutter am Boden liegen sah, konnte sie sich plötzlich wieder bewegen. Die Soldaten zogen ihren Vater aus der Wohnung hinaus, und Parvana schlang ihre Arme fest um seinen Leib. Die Soldaten rissen sie mit Gewalt los. Parvana hörte den Vater sagen: „Pass auf die anderen auf, meine kleine Malali!“ Dann war er weg.
Hilflos sah sie zu, wie zwei Soldaten ihn über die Treppen hinunterzerrten, sein schöner Shalwar Kameez schleifte auf dem staubigen Boden. Dann bogen sie um eine Ecke und Parvana konnte ihn nicht mehr sehen.
Inzwischen schlitzten die beiden anderen Soldaten im Zimmer mit Messern die Toshaks auf und warfen die Sachen aus dem Kasten zu Boden.
Vaters Bücher! Im Boden des Kastens war ein Geheimfach, das der Vater gebaut hatte, um die wenigen Bücher zu verstecken, die nicht durch die Bomben vernichtet worden waren. Es waren einige englische Bücher über Geschichte und Literatur darunter. Er hatte sie versteckt, denn die Taliban verbrannten alle Bücher, die ihnen nicht zusagten.
Sie durften Vaters Bücher nicht finden! Die Soldaten hatten beim obersten Fach angefangen und kamen immer weiter hinunter. Kleider, Decken, Töpfe, alles landete auf dem Fußboden. Näher und näher kamen sie dem Fach mit dem doppelten Boden. Parvana schaute voll Entsetzen zu, wie die Soldaten sich hinunterbeugten, um die Sachen herauszuholen.
„Verschwindet aus meinem Haus!“, schrie sie plötzlich und warf sich mit solcher Kraft auf die Soldaten, dass beide zu Boden stürzten. Sie schlug mit Fäusten auf die Männer ein, bis sie zur Seite gestoßen wurde. Dann klatschten Schläge auf ihren Rücken. Parvana hielt den Kopf zwischen den Armen geschützt, bis die Soldaten zu schlagen aufhörten und weggingen.
Mutter erhob sich vom Fußboden und bemühte sich, Ali zu beruhigen. Nooria lag noch immer wie ein Ball zusammengerollt. Maryam war es, die Parvana trösten kam. Bei der ersten leichten Berührung ihrer Hand zuckte Parvana erschrocken zurück, voll Angst, die Soldaten seien zurückgekommen. Maryam streichelte vorsichtig Parvanas Haar, bis diese begriff, wer sie streichelte. Sie setzte sich auf, ihr ganzer Körper schmerzte. Parvana schloss Maryam in die Arme, beide zitterten am ganzen Leib.
Sie wusste nicht, wie lange sie alle so sitzen und liegen blieben, aber sie saßen noch immer an der gleichen Stelle, als Ali schon lange zu schreien aufgehört hatte und vor Erschöpfung eingeschlafen war.
3. Kapitel
Die Mutter legte Ali behutsam auf eine freie Stelle auf dem Fußboden. Auch Maryam war eingeschlafen und wurde neben ihren Bruder hingelegt.
„Räumen wir hier auf“, sagte die Mutter endlich. Langsam brachten sie das Zimmer in Ordnung. Parvanas Rücken und Füße schmerzten. Auch die Mutter bewegte sich mühsam.
Mutter und Nooria räumten den Kasten wieder ein. Parvana holte den Besen von seinem Nagel im Waschraum und kehrte die verstreuten Reiskörner auf. Mit einem Tuch wischte sie den verschütteten Tee auf. Die zerschnittenen Toshaks konnten sie flicken – aber das würde bis morgen warten.
Als das Zimmer wieder einigermaßen normal aussah, legten sie die dicken Steppdecken und Wolldecken auf den Fußboden und legten sich zum Schlafen nieder. Ohne Vater.
Parvana konnte nicht einschlafen. Sie hörte, wie auch die Mutter und Nooria sich ruhelos auf ihren Decken hin und her warfen. Bei jedem winzigen Geräusch fuhr Parvana auf. Sie stellte sich vor, dass der Vater zurückkam – oder die Taliban. Jeder Laut erfüllte sie mit Hoffnung und gleichzeitig mit Angst.
Sie vermisste das Schnarchen ihres Vaters. Er hatte ein sanftes, angenehmes Schnarchen. Während der vielen heftigen Bombardements auf Kabul, als sie so oft umgezogen waren, war Parvana manchmal in der Nacht aufgewacht und hatte nicht gewusst, wo sie sich befand. Aber sobald sie ihren Vater schnarchen hörte, fühlte sie sich sicher.
Heute Nacht schnarchte niemand neben ihr.
Wo war der Vater? Hatte er einen guten Platz zum Schlafen? War ihm kalt? Hatte er Hunger? Hatte er Angst?
Parvana war noch nie in einem Gefängnis gewesen, aber sie hatte Verwandte, die schon einmal eingesperrt worden waren. Eine ihrer Tanten war mit hunderten anderen Schulmädchen verhaftet worden, als sie gegen den Einmarsch der Sowjet-Truppen protestierten. Alle afghanischen Regierungen steckten ihre Gegner ins Gefängnis.
„Du bist kein richtiger Afghane, wenn du nicht jemanden kennst, der im Gefängnis ist“, sagte die Mutter manchmal.
Aber keiner hatte Parvana jemals erzählt, wie es in einem Gefängnis aussah. „Du bist noch zu klein für solche Dinge“, sagten die Erwachsenen immer. So musste sie versuchen, sich das selber vorzustellen.
Es ist sicher kalt dort, dachte Parvana. Und dunkel.
Plötzlich kam ihr ein Gedanke, und sie setzte sich mit einem Ruck kerzengerade auf. „Mutter, zünd die Lampe an!“
„Psst, Parvana! Du weckst Ali auf!“
„Zünd die Lampe an“, flüsterte Parvana. „Wenn sie Vater freilassen, braucht er ein Licht im Fenster, das ihm den Weg hier herauf zeigt!“
„Er kann doch nicht gehen! Er hat seinen Stock hiergelassen. Schlaf jetzt, Parvana! Du kannst im Augenblick gar nichts tun!“ Parvana legte sich wieder hin, aber schlafen konnte sie nicht.
Das Zimmer hatte ein einziges kleines Fenster, hoch oben an der Wand. Die Taliban hatten befohlen, alle Fenster müssten mit schwarzer Farbe angestrichen werden, damit niemand die Frauen drinnen sehen konnte.
„Wir werden das nicht tun“, hatte Vater gesagt. „Unser Fenster ist so klein und so hoch oben, da kann unmöglich jemand hereinschauen.“ So hatten sie das Fenster nicht gestrichen, und bisher hatte noch niemand etwas dagegen gesagt.
An klaren Tagen schien die Sonne für kurze Zeit in einem schmalen Balken herein. Ali und Maryam saßen dann in dem kleinen Sonnenstrahl. Die Mutter und Nooria setzten sich zu ihnen und genossen die Wärme auf ihren Gesichtern und Armen. Dann drehte sich die Sonne weiter, und der Sonnenstrahl verschwand wieder.
Parvana ließ ihre Augen nicht von der Stelle, wo sie das Fenster vermutete. Die Nacht war so dunkel, dass sie nicht zwischen Fenster und Wand unterscheiden konnte. Die ganze Nacht starrte sie auf die Stelle, bis endlich die Morgendämmerung die Dunkelheit wegschob und wieder Licht durch das Fenster kam.
Beim ersten Licht hörten die Mutter, Nooria und Parvana auf, sich schlafend zu stellen. Leise, um die Kleinen nicht aufzuwecken, erhoben sie sich und kleideten sich an.
Zum Frühstück kauten sie ein paar Bissen von dem übrig gebliebenen Nan. Nooria wollte auf dem kleinen Gasherd im Waschraum Teewasser heiß machen, aber die Mutter sagte: „Es gibt von gestern Abend noch abgekochtes Wasser, das trinken wir. Wir haben keine Zeit, auf das Teewasser zu warten. Parvana und ich gehen euren Vater aus dem Gefängnis holen.“ Sie sagte das in einem Tonfall, als hätte sie gesagt: „Parvana und ich gehen auf den Markt, Pfirsiche kaufen.“
Das Nan fiel Parvana fast aus dem Mund, aber sie sagte nichts. Vielleicht werde ich jetzt endlich sehen, wie es in einem Gefängnis innen aussieht, dachte sie.
Das Gefängnis war sehr weit von ihrem Haus entfernt. Frauen durften ohne männliche Begleitung keinen Bus benutzen. Sie mussten den ganzen Weg zu Fuß gehen. Und wenn sie Vater irgendwo anders hingebracht hatten? Wenn die Taliban sie auf der Straße aufhielten? Mutter sollte ohne ihren Mann überhaupt nicht auf der Straße sein, oder zumindest nicht ohne eine schriftliche Erlaubnis von ihm.
„Nooria, schreib einen Zettel für Mutter!“
„Mach dir keine Mühe, Nooria. Ich werde nicht in meiner eigenen Stadt herumgehen mit einem Zettel auf meine Burka geheftet, wie ein Kindergartenkind! Ich habe einen Universitätsabschluss!“
„Schreib trotzdem einen Zettel“, flüsterte Parvana Nooria zu, als die Mutter auf der Toilette war. „Ich verstecke ihn in meinem Ärmel.“
Nooria war einverstanden. Ihre Handschrift wirkte erwachsener als die Parvanas. Geschwind schrieb sie: „Ich gestatte meiner Ehefrau, sich auf der Straße zu befinden“ und unterschrieb mit Vaters Namen.
„Ich glaube nicht, dass er viel Sinn hat“, flüsterte Nooria, als sie Parvana den Zettel gab. „Die meisten Taliban können nicht lesen!“
Parvana gab keine Antwort. Sie faltete den Zettel klein zusammen und steckte ihn in den Ärmelaufschlag.
Und dann tat Nooria etwas sehr Ungewöhnliches. Sie umarmte die Schwester.
„Komm gut zurück!“, flüsterte sie.
Parvana wollte lieber gar nicht mitgehen, aber zu Hause sitzen und warten, bis die Mutter zurückkam, wäre noch schlimmer.
„Beeil dich, Parvana“, sagte die Mutter. „Dein Vater wartet!“
Parvana schlüpfte in die Sandalen, zog ihren Tschador über den Kopf und ging nach ihrer Mutter zur Tür hinaus.
Sie half der Mutter die zerbrochenen Treppen hinunter. Das war ein wenig so, als würde sie dem Vater helfen. Denn die wallende Burka machte es der Mutter fast unmöglich zu sehen, wo sie hinstieg. Als sie unten angekommen waren, zögerte die Mutter einen Augenblick. Parvana glaubte schon, sie hätte es sich anders überlegt. Aber dann richtete sich die Mutter zu ihrer vollen Größe auf und stürzte sich in die Straßen von Kabul. Parvana eilte ihr nach. Sie musste laufen, um mit den großen, schnellen Schritten der Mutter mithalten zu können, aber sie wagte es nicht, hinter ihr zurückzubleiben. Es waren einige wenige andere Frauen auf der Straße; sie trugen die verordnete Burka, in der sie alle gleich aussahen. Wenn Parvana die Mutter verlor, würde sie sie womöglich gar nicht mehr wiederfinden.
Ab und zu blieb die Mutter bei einem Mann, einer Frau, oder bei einer kleinen Gruppe von Männern stehen, einmal sogar vor einem Hausierer-Jungen, und zeigte ihnen die Fotografie des Vaters. Sie sagte kein Wort, sie zeigte nur stumm auf das Foto.
Parvana hielt jedesmal den Atem an. Fotografien waren verboten. Jeder dieser Menschen, denen sie das Foto zeigte, konnte Parvana und ihre Mutter bei den Militärs anzeigen.
Aber alle schauten das Foto nur aufmerksam an und schüttelten den Kopf. So viele Menschen waren verhaftet. Jeder wusste, was die Mutter wissen wollte, ohne dass sie es aussprechen musste. Das Pul-i-Charki Gefängnis war sehr weit von Parvanas Haus entfernt. Sie mussten lange gehen. Als endlich die große Festung in Sicht kam, taten Parvana die Füße weh, und, was noch viel schlimmer war, sie war außer sich vor Angst.
Das Gefängnis war riesengroß, dunkel und hässlich. Bei seinem Anblick kam sich Parvana noch viel kleiner vor.
Malali hätte keine Angst, dachte Parvana. Malali würde eine Armee zusammenrufen und das Gefängnis stürmen. Malali würde sich die Lippen lecken bei einer solchen Herausforderung. Ihre Knie würden nicht zittern wie Parvanas Knie.
Wenn Parvanas Mutter Angst hatte, dann zeigte sie es nicht. Sie ging direkt auf die Gefängnistore zu und sagte zu dem Wächter: „Ich komme, um meinen Mann zu holen!“
Der Torwächter beachtete sie überhaupt nicht.
„Ich bin hier, um meinen Mann zu holen!“, wiederholte die Mutter. Sie nahm Vaters Fotografie und hielt sie dem Wächter vor die Nase. „Er wurde heute Nacht verhaftet. Er hat nichts Ungesetzliches getan, und ich will, dass er freigelassen wird!“
Einige andere Wächter kamen herbei. Parvana zupfte die Mutter an der Burka, aber die beachtete sie nicht.
„Ich bin hier, um meinen Mann zu holen!“, sagte sie immer wieder. Parvana zog stärker an dem losen Stoff der Burka.
„Bleib fest, meine kleine Malali“, hörte sie ihren Vater sagen, und plötzlich war sie ganz ruhig.
„Ich bin hier, um meinen Vater zu holen!“, rief sie.
Die Mutter schaute sie durch das Gitternetz vor ihren Augen an. Sie beugte sich hinunter und nahm Parvanas Hand.
„Ich bin hier um meinen Mann zu holen!“, rief sie wieder.
Wieder und wieder schrien Parvana und ihre Mutter ihre Botschaft. Immer mehr Männer versammelten sich um die beiden.
„Seid still!“, befahl einer der Wächter. „Ihr solltet überhaupt nicht hier sein! Geht weg! Geht nach Hause!“
Einer der Soldaten nahm das Foto von Parvanas Vater und zerriss es in kleine Stücke. Ein anderer begann mit einem Stock auf die Mutter einzuschlagen.
„Lasst meinen Mann frei!“, rief die Mutter immer wieder.
Ein anderer Soldat kam hinzu und prügelte gleichfalls auf die Mutter los. Er schlug auch Parvana.
Obwohl er nicht sehr fest zuschlug, stürzte Parvana zu Boden. Ihr Körper bedeckte die zerrissenen Stückchen des Fotos. Mit einer blitzschnellen Bewegung fegte Parvana die Teilchen zusammen und verbarg sie in ihrem Tschador.
Auch die Mutter lag nun auf dem Boden. Die Soldaten schlugen sie mit Stöcken auf den Rücken.
Parvana sprang auf die Füße. „Halt! Hört auf! Wir gehen jetzt. Wir gehen ja!“ Sie packte einen Angreifer ihrer Mutter am Arm. Er schüttelte sie ab wie ein lästiges Insekt.
„Wer bist du denn, dass du mir vorschreibst, was ich zu tun habe?“, rief er, aber er ließ den Stock sinken. „Verschwindet!“ Er spuckte Parvana und die Mutter an.
Parvana kniete neben der Mutter nieder, nahm ihren Arm und half ihr auf die Beine. Die Mutter stützte sich auf Parvana, als sie langsam vom Gefängnis weggingen.
4. Kapitel
Es war sehr spät, als Parvana und ihre Mutter nach Hause zurückkehrten. Parvana war so müde, dass sie sich auf die Mutter stützen musste, um die Stiegen hinaufzukommen. So, wie der Vater sich immer auf sie gestützt hatte. Sie konnte an nichts mehr denken als an den Schmerz, der in jeder Faser ihres Körpers saß, vom obersten Teil des Kopfes bis hinunter zu den Fußsohlen.
Ihre Füße brannten und schmerzten bei jedem Schritt. Als sie die Sandalen auszog, entdeckte sie, warum: Die Füße, die so lange Wegstrecken nicht gewohnt waren, waren voller Blasen. Die meisten waren aufgeplatzt und bluteten.
Noorias und Maryams Augen wurden groß vor Schreck, als sie Parvanas Füße sahen. Sie wurden noch größer, als sie Mutters Füße sahen. Die hatten noch mehr offene Stellen, waren noch blutiger als Parvanas Füße.
Die Mutter war ja nicht auf der Straße gewesen, seit die Taliban vor eineinhalb Jahren Kabul eingenommen hatten. Sie hätte hinausgehen können. Sie hatte eine Burka, und Vater hätte sie jederzeit begleitet, wann immer sie es hätte tun wollen. Viele Ehemänner waren froh, dass ihre Frauen daheim bleiben mussten, aber bei Vater war das nicht so.
„Fatana, du bist eine Journalistin“, sagte er oft. „Du musst mit mir hinausgehen in die Stadt und sehen, was da geschieht! Wie willst du denn sonst darüber schreiben können?“
„Und wer soll lesen, was ich schreibe? Darf ich es veröffentlichen? Nein! Also, warum soll ich dann schreiben, und warum soll ich sehen, was geschieht? Es wird ja doch nicht lange dauern. Das afghanische Volk ist stark und mutig. Es wird diese Taliban bald hinauswerfen. Wenn das geschehen ist, wenn wir wieder eine normale Regierung in Afghanistan haben, dann werde ich wieder hinausgehen. Bis dahin bleibe ich zu Hause.“
„Eine normale Regierung kommt nicht von alleine“, sagte der Vater. „Du bist eine Journalistin. Du musst mit deiner Arbeit mithelfen und mitkämpfen!“
„Wenn wir Afghanistan verlassen hätten, als das noch möglich war, dann hätte ich meine Arbeit tun und kämpfen können.“
„Wir sind Afghanen. Hier ist unsere Heimat. Wenn alle gebildeten Menschen davonlaufen, wer wird dieses Land dann wieder aufbauen?“
Diskussionen dieser Art hatten die Eltern oft. Wenn die ganze Familie in einem einzigen Zimmer lebt, dann gibt es keine Geheimnisse.
Mutters Füße waren von dem langen, ungewohnten Gehen so wund und weh, dass sie es kaum bis ins Zimmer schaffte. Parvana war so sehr mit ihren eigenen Schmerzen beschäftigt gewesen und mit ihrer eigenen Erschöpfung, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie schlecht es ihrer Mutter ging.
Nooria versuchte ihr zu helfen, aber die Mutter scheuchte sie fort. Sie warf ihre Burka zu Boden. Tränen und Schweiß liefen über ihr Gesicht. Sie brach auf dem Toshak zusammen, wo Vater gestern sein Schläfchen gehalten hatte.
Dort blieb die Mutter liegen und weinte lange, lange Zeit. Nooria wischte ihr mit einem Schwamm den Teil des Gesichtes ab, der nicht im Kissen verborgen war. Sie wusch auch den Staub von den Wunden auf Mutters Füßen.
Die Mutter tat, als wäre Nooria nicht da. Schließlich deckte Nooria sie mit einer leichten Decke zu. Es dauerte lange, bis die Mutter zu schluchzen aufhörte und einschlief.
Während Nooria versuchte, sich um die Mutter zu kümmern, kümmerte Maryam sich um Parvana. Vorsichtig, die Zunge vor Konzentration aus dem Mund gestreckt, trug sie eine Schüssel voll Wasser zu dem Platz, wo Parvana saß. Sie verschüttete keinen einzigen Tropfen. Maryam wischte Parvanas Gesicht mit einem Tuch ab. Sie konnte das Tuch nicht auswinden, Tropfen flossen Parvana über den Hals. Das Wasser tat gut. Parvana tauchte die Füße in die Waschschüssel. Das tat auch gut.
Sie saß mit den Füßen im Wasser, während Nooria das Abendessen richtete.
„Sie haben uns überhaupt nichts von Vater gesagt“, berichtete Parvana. „Was tun wir jetzt? Wie können wir ihn finden?“
Nooria antwortete etwas, aber Parvana verstand es nicht. Sie fühlte sich so schwer, so müde … die Augen fielen ihr zu, und dann war es plötzlich Morgen.
Parvana konnte hören, wie das Frühstück gemacht wurde.
Ich sollte aufstehen und helfen, dachte sie, aber sie schaffte es nicht, sich aufzurichten.
Die ganze Nacht hatte sie von Soldaten geträumt. Soldaten, die sie anbrüllten und schlugen. In ihrem Traum wollte Parvana sie anschreien, sie sollten ihren Vater freilassen, aber es kam kein Wort über ihre Lippen. Sie hatte sogar geschrien: „Ich bin Malali! Ich bin Malali!“, aber die Soldaten hatten sie überhaupt nicht beachtet.
Das Schlimmste an ihrem Traum war, dass sie zusehen musste, wie die Mutter geschlagen wurde. Es war, als würde Parvana es von weit, weit weg beobachten und könne ihr nicht helfen.
Parvana setzte sich mit einem Ruck auf, dann entspannte sie sich wieder, als sie sah, dass ihre Mutter auf der anderen Seite des Zimmers auf dem Toshak lag. Es war alles in Ordnung, die Mutter war ja da!
„Ich helf dir ins Bad“, bot Nooria ihr an.
„Ich brauche keine Hilfe!“, sagte Parvana. Aber als sie versuchte aufzustehen, taten ihr die Füße scheußlich weh. So nahm sie Noorias Angebot doch an und ging, auf die Schwester gestützt, zum Waschraum.
„In dieser Familie stützt sich jeder auf jeden“, sagte Parvana.
„Wirklich?“, fragte Nooria. „Und auf wen kann ich mich stützen?“
Das war ein so typischer Nooria-Kommentar, dass Parvana sich gleich ein wenig besser fühlte. Wenn Nooria wieder mürrisch war, dann war das ein Zeichen dafür, dass die Dinge sich normalisierten.
Als sich Parvana das Gesicht gewaschen und die Haare gekämmt hatte, fühlte sie sich noch besser. Dann gab es kalten Reis und heißen Tee.
„Mutter, willst du frühstücken?“ Nooria rüttelte ihre Mutter ganz sacht. Die Mutter stöhnte und schüttelte sie ab.
Sie blieb den ganzen Tag auf der Matratze liegen. Sie ging nur ein paar Mal in den Waschraum, und sie trank ein paar Tassen Tee, den Nooria in einer Thermoskanne neben den Toshak stellte. Die Mutter legte sich mit dem Gesicht zur Wand hin und sprach kein einziges Wort.
Am nächsten Tag hatte Parvana genug geschlafen. Die Füße taten ihr noch immer weh, aber sie spielte mit Ali und Maryam. Die Kleinen, besonders Ali, konnten nicht verstehen, warum die Mutter sich nicht um sie kümmerte.
„Die Mutter schläft“, sagte Parvana immer wieder.
„Wann wacht sie denn endlich wieder auf?“, fragte Maryam.
Parvana wusste keine Antwort.
Ali tappte immer wieder zur Tür und zeigte zur Klinke hinauf.
„Ich glaube, er will fragen, wo Vater ist“, sagte Nooria. „Komm, Ali, suchen wir deinen Ball.“
Parvana erinnerte sich an das zerrissene Foto und holte es hervor. Sie legte die Teilchen auf der Matte aus wie die Teile eines Puzzles. Maryam half, Vaters Gesicht zusammenzusetzen.
Ein Teil war verloren gegangen. Vaters Gesicht war ganz, nur ein Stück von seinem Kinn fehlte. „Wenn wir etwas Klebeband kriegen, dann kleben wir es wieder zusammen!“, sagte Parvana.
Maryam nickte. Sie sammelte die Papierstückchen zu einem kleinen Stoß und reichte sie der Schwester. Parvana steckte sie in ein Fach ganz hinten im Schrank.
Der dritte Tag kroch dahin. Parvana überlegte sogar, Hausarbeit zu machen, nur damit die Zeit verging, aber sie wollte die Mutter nicht stören. Und dann saßen die vier Kinder einfach mit dem Rücken an die Wand gelehnt und sahen ihrer Mutter beim Schlafen zu.
„Sie muss doch bald aufstehen“, sagte Nooria. „Sie kann doch nicht für immer liegen bleiben!“
Parvana hielt das Herumsitzen nicht mehr aus. Sie hatte nun eineinhalb Jahre in einem Zimmer gelebt, aber es hatte zumindest immer irgendetwas zu tun gegeben, oder sie war mit Vater zum Markt gegangen.
Die Mutter lag noch immer am selben Platz. Alle bemühten sich, sie nicht zu stören. Aber Parvana dachte, wenn sie noch viel länger flüstern müsste und aufpassen, dass die Kleinen leise waren, dann würde sie plötzlich zu schreien anfangen.
Wenn sie wenigstens lesen könnte! Aber die einzigen Bücher, die sie besaßen, waren Vaters geheime Bücher. Parvana wagte es nicht, sie aus ihrem Versteck zu holen. Wenn die Taliban wieder hereinplatzten? Sie würden die Bücher mitnehmen und vielleicht die ganze Familie bestrafen, weil sie solche Bücher besaßen.
Ali hatte sich verändert. „Was ist los mit ihm? Ist er krank?“, fragte Parvana Nooria.
„Er vermisst Mutter.“ Ali lag auf Noorias Schoß. Er krabbelte nicht mehr herum, wenn man ihn auf den Fußboden setzte. Meistens lag er einfach da, zu einem Ball eingerollt, den Daumen im Mund.
Er weinte kaum mehr, er schrie auch nicht, oder nur ganz selten. Es war zwar angenehm, einmal Ruhe von seinem Geschrei zu haben, aber diese unnatürliche Stille gefiel Parvana noch viel weniger.
Im Zimmer begann es langsam unangenehm zu riechen.
„Wir müssen Wasser sparen“, sagte Nooria, und so wuschen und putzen sie überhaupt nichts. Alis schmutzige Windeln legten sie auf einen Haufen im Waschraum. Das kleine Fenster ging nicht sehr weit auf. Kein Windstoß konnte herein, um den Gestank fortzublasen.
Am vierten Tag gab es nichts mehr zu essen.
„Wir haben nichts mehr zu essen“, sagte Nooria zu Parvana.
„Sag das nicht mir, sag es Mutter! Sie ist die Erwachsene, sie muss uns etwas besorgen.“
„Ich will sie nicht stören!“
„Dann sag ich es ihr!“ Parvana ging zur Mutter hin und rüttelte sie leicht.
„Mutter, wir haben nichts mehr zu essen!“ Keine Antwort. „Mutter, es gibt nichts mehr zu essen!“ Die Mutter drehte sich weg. Parvana rüttelte sie wieder, aber Nooria schubste sie weg.
„Lass sie in Ruhe! Siehst du nicht, dass sie ganz verzweifelt ist?“
„Wir sind alle verzweifelt“, entgegnete Parvana. „Aber wir sind auch hungrig!“ Am liebsten hätte sie laut geschrien, aber sie wollte die Kleinen nicht erschrecken. Sie konnte die Schwester nur wütend anstarren. Und so saßen Nooria und Parvana stundenlang da und starrten einander wütend an.
An diesem Tag aßen sie gar nichts.
„Wir haben nichts mehr zu essen“, sagte Nooria am nächsten Tag wieder zu Parvana.
„Ich geh nicht weg von hier!“
„Du musst aber. Kein anderer von uns kann auf die Straße gehen.“
„Mir tun die Füße weh.“
„Deine Füße werden es überleben, aber wir nicht, wenn wir nichts zu essen haben. Los, geh!“
Parvana blickte zur Mutter, die noch immer auf dem Toshak lag. Sie blickte auf Ali, dessen Gesicht schmal geworden war vom Hunger, und der seine Eltern vermisste. Sie blickte Maryam an, deren Wangen einzufallen begannen, und die so lange Zeit nicht draußen in der Sonne gewesen war. Und zuletzt blickte sie auf ihre große Schwester Nooria.
Nooria sah schrecklich aus in ihrer Angst. Wenn Parvana ihr nicht gehorchte, dann musste sie selbst Essen kaufen gehen.
Jetzt hab ich sie, dachte Parvana. Jetzt kann ich sie quälen, so wie sie mich immer quält. Aber überraschenderweise machte ihr das gar keinen Spaß. Vielleicht war sie zu müde und zu hungrig. Statt eine grobe Antwort zu geben, nahm Parvana das Geld aus der Hand der Schwester.
„Was soll ich kaufen?“, fragte sie.
5. Kapitel
Es war seltsam, ohne den Vater auf dem Markt zu sein. Parvana erwartete fast, ihn auf seinem üblichen Platz auf der Decke sitzen zu sehen, wo er für die Kunden Briefe und andere Schriftstücke las oder schrieb.
Frauen durften die Geschäfte nicht betreten. Normalerweise sollten die Männer alle Einkäufe erledigen, aber wenn Frauen es tun mussten, dann hatten sie vor der Tür stehen zu bleiben und ins Geschäft hineinzurufen, was sie kaufen wollten. Parvana hatte gesehen, wie Ladenbesitzer geschlagen worden waren, weil sie Frauen in ihren Geschäften bedient hatten.
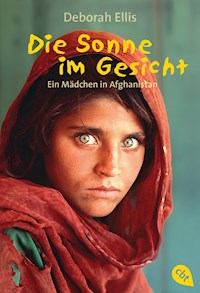
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











