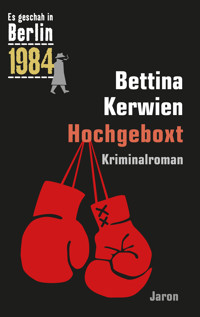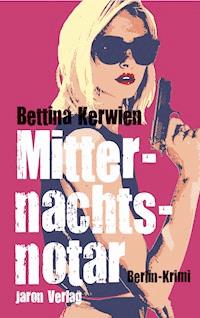Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Es geschah in Berlin
- Sprache: Deutsch
James Bond ist in Berlin: Für den neuen Streifen Octopussy wird direkt am Checkpoint Charlie gedreht. Den Alliierten kommen die Filmarbeiten als Ablenkung gerade recht, denn eine Mitarbeiterin der Kommerziellen Koordinierung, Marina Mars, soll aus der DDR überlaufen – und dabei ein millionenteures Fabergé-Ei über die Grenze schmuggeln. Doch zur Übergabe kommt es nicht: Marina Mars verschwindet, und am Ort der geplanten Aushändigung wird ein BND-Agent tot aufgefunden. Kommissar Kappe nimmt gemeinsam mit seinem Kollegen Landsberger die Ermittlungen auf …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Kerwien
Agentenfieber
Ein Kappe-Krimi
Jaron Verlag
Bettina Kerwien lebt in Berlin. Sie studierte Amerikanistik und Publizistik. Als Geschäftsführerin eines Stahlbauunternehmens widmet sie sich in jeder freien Minute dem Schreiben. In der Reihe «Es geschah in Berlin» erschienen von ihr 2019 «Au revoir, Tegel», 2020 «Tot im Teufelssee» und 2022 «Tiergarten Blues».
Originalausgabe 1. Auflage 2023
© 2023 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Prill Partners|producing, Barcelona
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-95552-066-3
Für Ian Lancaster Fleming (1908–1964)
Wo immer er ist, ist GoldenEye.
Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.
John F. Kennedy
Doctor No said, in the same soft resonant voice, «You are right, Mister Bond. That is just what I am, a maniac. All the greatest men are maniacs. They are possessed by a mania which drives them forward towards their goal. The great scientists, the artists, the philosophers, the religious leaders – all maniacs. What else but a blind singleness of purpose could have given focus to their genius, would have kept them in the groove of their purpose? Mania, my dear Mister Bond, is as priceless as genius. Dissipation of energy, fragmentation of vision, loss of momentum, the lack of follow-through – these are the vices of the herd.» Doctor No sat slightly back in his chair. «I do not possess these vices. I am, as you correctly say, a maniac – a maniac, Mister Bond, with a mania for power. That» – the black holes glittered blankly at Bond through the contact lenses – «is the meaning of my life. That is why I am here. That is why you are here. That is why here exists.» Ian Fleming, Pandora’s Box
Inhalt
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
ZWEI WOCHEN SPÄTER
FAKT UND FIKTION
Es geschah in Berlin …
PROLOG
WEST-BERLIN, im August 1982. Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße. Postkartenblauer Himmel, Verkehrsrauschen. In der Bildmitte die Gedächtniskirche. Überraschend klar hört man Kirchenglocken läuten. Die Straßenbäume sind grün und üppig, der Autoverkehr munter. Gelbe Doppeldeckerbusse, Mofas, Fußgängergewimmel auf den Bürgersteigen. Rechts sieht man die weiße Fassade des Ku’damm-Ecks mit seinen Werbetafeln. Die Kamera zoomt auf einen schwarzen Mercedes, der zügig auf der Gegenfahrbahn aus Richtung Gedächtniskirche kommt.
Man hört aus dem Off die Stimme von M, dem Leiter der Doppel-Null-Abteilung des britischen Geheimdienstes MI6: «Der Octopussy-Zirkus ist in Ost-Berlin gewesen, als wir 009 verloren haben.»
Schnitt.
Das Wageninnere. M und der Doppel-Null-Agent Bond auf dem Rücksitz.
M: «Aber Karl-Marx-Stadt ist weiter im Osten.» M schüttelt den Kopf. «Warum würde General Orlov sich auf einen Juwelenraub einlassen?»
Bond: «Die Juwelen, Sir, sind, glaube ich – wenn Sie mir die Analogie verzeihen wollen –, nur die Spitze des Tentakels.»
Durch die Heckscheibe sieht man die Gedächtniskirche kleiner werden, während der Wagen an den Markisen des Kranzler-Ecks, einer bunten Reihe parkender Autos, Bauwagen und gelben Bussen vorbeifährt.
M gibt ihm einen Briefumschlag. Bond steckt den Umschlag in die Innentasche seines Jacketts.
M: «Das sind die Papiere, die Sie brauchen werden. Charles Morton, Handelsreisender aus Leeds, besucht Möbelfabriken in Ostdeutschland. Pass, Empfehlungsschreiben, Referenzen.» Er zeigt auf den Fahrer. «Karl bringt Sie über die Grenze.»
Karl [schwerer deutscher Akzent]: «No problem!»
Bond und M tauschen vielsagende, lange, englische Blicke. Kraftvoll setzt die Musik des Bond-Leitmotivs ein – dreimal zwei kräftige Akzente in den hohen Bläsern, die immer durch einen weiteren Stoß eine Oktave tiefer beantwortet werden.
Schnitt.
Der Wagen biegt von der Kochstraße rechts ab und fährt auf den Checkpoint Charlie zu.
M [besorgt]: «Ich verlasse Sie hier. Denken Sie daran, 007, Sie sind jetzt ganz auf sich alleine gestellt.»
Bond [ironisch]: «Well, vielen Dank, Sir. Das ist [kurzes Zögern] ein großer Trost.»
M steigt aus und überquert hinter dem Auto die Straße. «Aufpassen!», ruft eine Stimme aus dem Off. Bläser spielen kraftvoll die Bond-Melodie.
Schnitt.
M steht am Straßenrand und schaut besorgt dem schwarzen Mercedes hinterher. Hinter dem Kontrollpunkt sieht man Uniformierte und die Grenzanlagen der Mauer. Hundegebell und Marschtrommeln legen sich unter die Bond-Melodie. Der Mercedes fährt weiter Richtung Staatsgrenze am Checkpoint Charlie. Zoom auf ein Schild: «You are leaving the American sector – Sie verlassen den amerikanischen Sektor.»
Zögerlich steigt M in einen anderen Wagen, der auf ihn gewartet hat. Die Sonne spiegelt sich im gleißenden Chrom der Autotür. Plötzlich blitzt hinter einem Betonpoller etwas auf.
Samstag, 14. August 1982
PETER KAPPES MUTTER schwärmt heute noch von ihrem ersten Besuch bei Edelbert Schramm. So einen italienischen Kaffee hatte der – sa-gen-haft! Und italienische Designerstühle, goldene Lampen, Marmorboden – Edelbert «Schramme» Schramm führt einen eleganten Friseursalon in einer Seitenstraße vom Kurfürstendamm. Kappe kommt auch gerne her. Eigentlich ist er kein Schnösel. Dafür ist in ihrem Team sein Freund und Kollege Wolf Landsberger zuständig. Jetzt hat aber ebendieser Landsberger ihm anlässlich ihrer Beförderung – Landsbergers zum Kriminalobermeister, Kappes zum Kriminaloberkommissar und Ersten Sachbearbeiter sowie stellvertretenden Kommissariatsleiter – einen Friseurgutschein geschenkt. Nicht gerade ein Männergeschenk. Aber strategisch nicht schlecht. Kappes erster Gedanke war, dass Landsberger immer noch daran arbeitet, ihn von den Vorteilen des anderen Ufers zu überzeugen. Egal – bei «Schramme» Schramm macht Haareschneiden tatsächlich Spaß, deshalb ist Kappe jetzt Stammkunde. Kappe wird schnell irgendwo Stammkunde. Er ist eine treue Seele und ein Gewohnheitstier. Ein normaler Beamter halt. Es gibt Schlimmeres, redet er sich ein.
«Dein Landsberger war vorgestern auch hier», plaudert Schramme gut gelaunt drauflos, während er sich mit besorgt gelupften Augenbrauen über Kappes Scheitel beugt. Er steht hinter ihm, kämmt Kappes üppige dunkle Haare von rechts auf links, mustert ihn künstlerisch abwägend im Spiegel vor ihnen. «Für mich ist dein Landsberger der schickste Kerl weit und breit! Und hatte der wieder eine fabelhafte Tapete an!» Schrammes Augen funkeln so verliebt wie abwesend. Er seufzt, als sei bei Kappe eh nichts mehr zu retten, dann drückt er dessen Kopf hintenüber in das Porzellanbecken.
«Das ist nicht ‹mein› Landsberger», nuschelt Kappe lahm in das frisch duftende Handtuch vor seinem Gesicht. Genau richtig temperiertes Wasser flutet seinen Schädel.
«Wasser gut so?», flötet Schramme.
«Ja, ja! Und ich habe den Kollegen Landsberger schon eine Woche nicht mehr gesehen. Er musste plötzlich unbedingt Urlaub nehmen.»
«Weiß ich doch, Herr Oberkommissar! Bin ich sein Friseur oder bin ich sein Friseur?» Wie um zu unterstreichen, dass er tatsächlich ein Friseur ist, shampooniert Schramme drauflos wie ein Weltmeister. Im Takt singt er leise, aber textsicher Fred vom Jupiter. Ein Neue-Deutsche-Welle-Hit aus dem letzten Jahr, in dem es um einen sehr attraktiven und auch sehr muskulösen Außerirdischen geht, der auf der Erde notlanden muss. Kappes Friseurspaß reduziert sich mit jeder Note.
Aber ein gewisses Kribbeln liegt in der Luft. Kappe kennt es aus dem Verhörraum: wenn der Verdächtige noch abwägt, ob sein Geheimnis raus muss oder nicht. Schramme windet sich, seine Bäckchen färben sich rosa – Kappe sieht es beim flüchtigen Spiegelblick durch den Shampooschleier.
Und dann platzt es doch aus dem Friseur raus: «Dreharbeiten!», keucht er und schrubbt Kappes Hinterkopf so enthusiastisch, dass dessen Schädel rhythmisch gegen das Waschbecken ditscht. «Mensch, wenn der Landsberger nicht Filmstar wird, wer denn dann?»
Filmstar? Bei Schramme wird man für sein Geld zum Haarschnitt kostenlos mit den Heimlichkeiten seiner Freunde schockiert, ob man nun will oder nicht.
«Ach.» Von einem Friseur als schlecht informiert entlarvt zu werden, das schmerzt. «Ist Landsberger gar nicht mit seiner Mutter in der Lüneburger Heide?» Dass Kappes bester Freund in der Kartei einer Komparsenagentur steht, das weiß das ganze Kommissariat. Aber Kappe hat keinen blassen Schimmer, ob der Freund jemals zu einem Vorsprechen eingeladen worden ist.
«Nee, Kappe, da biste auf dem falschen Dampfer!», lacht Schramme. «Der Landsberger startet durch. Der hat eine Sprechrolle im neuen James-Bond-Film.»
«Echt jetzt?» In Kappes Gehirn dreht sich plötzlich diese schwarz-weiße Spirale aus dem Bond-Vorspann. Er hebt reflexartig den Kopf. Schramme springt zurück. Wasser spritzt, schäumende Lauge ergießt sich in Kappes Kragen und auf die Fußbodenfliesen.
«Manno!», protestiert Schramme, tupft sich die Spritzer aus dem Gesicht und stopft Kappe ein Handtuch in den Nacken. Kappes Gesicht im Spiegel erinnert ihn selbst an eine Wasserleiche beim Auftauchen.
«Mach mal den Mund wieder zu, Kappe. Du siehst irgendwie mitgenommen aus.» Schramme legt ihm den Handrücken fieberfühlend an die Stirn. «Haste Diamantenfieber?»
«Wenn, dann Agentenfieber. Du machst nur Witze, oder?»
«Nee, Landsberger ist jetzt im Geheimdienst Ihrer Majestät. Kannste glauben! Ich musste ihm so einen ganz scharfen smarten internationalen Schnitt machen – wie Roger Moore. Ich sag dir, der Landsberger sieht aber auch toll aus – wie Jung-Siegfried! Wenn die den entdecken, dann ist der eins fix drei in Hollywood, und ich als sein persönlicher Hair-Stylist …»
«Nicht zu fassen.» Kappe wischt sich den Schaum aus den Augen. «Die ganze Dienststelle hat schon gelacht, als er erzählt hat, dass er Statist oder Komparse werden will. Aber James Bond? Und er hat kein Wort gesagt!»
«Tja, hätteste mal beim ersten Mal nicht gelacht, dann hätte er es dir vielleicht erzählt. Aber das ist seine Bestimmung, Herr Oberkommissar! Mensch, das siehst du doch selbst, dass so ein Knallerkerl nicht bei euch da hinter Aktendeckeln versauern kann!»
«Bei uns ist die Mordkommission, da hinter den Aktendeckeln», brummt Kappe. Schramme frottiert ihm den Schädel, dass ihm die Ohren glühen. Und was soll das jetzt werden?, denkt Kappe und starrt sein verstrubbeltes Ich im Spiegel an. Wird Landsberger kündigen und den Abflug Richtung Traumfabrik machen? Auch seine zweite Kollegin Rosi Habedank spielt ja so exzellent Gitarre, dass sie als Bluesgitarristin durchgehen könnte. Und er? Muss Kappe in der Keithstraße für den Rest seines Berufslebens allein die Amtsstubentradition hochhalten und mit den Mördern und den Unschuldigen und den Zeugen und dem ganzen anderen Gesocks klarkommen?
Schramme setzt ihm den Kopf wieder gerade auf die Schultern. «Und was machen wir bei dir?», will er wissen. «Geschüttelt oder gerührt?»
Der Friseur lacht sich halb tot über seinen eigenen Witz, während seine Schere schon mal loslegt, ohne Kappes Antwort abzuwarten.
Montag, 16. August 1982
2.10 UHR in West-Berlin. Eine Nacht wie jede andere. Im Büro des Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin in der Dahlemer Podbielskiallee 62 bucht der Student Thomas Strauss die Nachtwerte ein: Temperatur 13,3 Grad Celsius, relative Luftfeuchtigkeit 90 Prozent, schwacher Wind Stärke 2. Strauss erwartet einen angenehmen Spätsommertag.
Auf dem Dachgarten des Hilton-Hotels in der Budapester Straße spielt ein französisches Show-Orchester Cha-Cha-Cha.
Im Kreuzberger SO36 gibt’s wieder Randale mit Punks. Die Ratten-Jeannie wird rausgeschmissen und stürzt dabei. Ihr Bierglas zerschneidet ihr die Hand. Sie revanchiert sich und drückt dem Betreiber den Henkel ins Gesicht.
Am Bahnhof Zoo steigt Harald Schulz, 52, Spezialmonteur aus Haldensleben bei Magdeburg, aus dem S-Bahn-Zug und fragt einen Polizisten nach dem Weg zum Notaufnahmelager Marienfelde. Er ist der dritte Republikflüchtling des Monats August, ein sogenannter Sperrenbrecher.
Im Niemandsland am Potsdamer Platz meldet der Wachtmeister der West-Berliner Schutzpolizei Willi Krugowski, 49, seiner Revierwache: keine besonderen Vorkommnisse.
Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker ist auf dem Weg an die westdeutsche Ostsee. Er schläft in einem Sonderwagen, der am fahrplanmäßigen Schnellzug Nürnberg-Kiel hängt.
Im Fernmeldezentrum des Bundesnachrichtendienstes, auch bekannt als Hauptstelle für Befragungswesen, am Hohenzollerndamm 150 arbeitet die diensttuende Fernschreiberin an einem NATO-Kryptogerät. Sie liest einen neuen Schlüssel in Form eines Lochstreifens ein, den sie bei Dienstbeginn vom Kryptobeauftragten erhalten hat. Dazu öffnet sie das Gerät mit einem Schachtschlüssel, den sie aus dem Tresor genommen hat. Die Fernschreiberin entnimmt den vorher gültigen Lochstreifen, den sie gleich dem Kryptobeauftragten gegen Unterschrift zurückgeben wird. Gemeinsam werden sie dann den Lochstreifen vernichten. Gerade drückt sie die Brake-Taste, um den alten Schlüssel zu löschen, und die VS-Taste, um den neuen zu aktivieren. Da ertönt vom Faxgerät her ein Signal, dass das Thermopapier alle ist und eine neue Rolle ins Gerät eingelegt werden muss. Die Fernschreiberin tut es. Schließlich hat sie die Fernschreibprüfung nach Leistungsstufe 4 der ZDv 59/15 mit der Note «sehr gut» abgeschlossen. Und während sie am Fax das Papierfach wieder zuklappt, springt das Gerät pfeifend und jaulend an. Das Erste, was auf dem sich einrollenden Papier erscheint, ist: Si-Fall – keine Übung! Streng vertraulich! Die Fernschreiberin reißt das Papier aus dem Gerät und rennt los.
Kaum ist sie aus der Tür, springt der Minutenzeiger einen Strich weiter: Montag, 16. August 1982, 2.11 Uhr in West-Berlin.
Und es ist keine Nacht mehr wie jede andere.
Als das Telefon klingelt, ist Peter Kappe noch wach. Noch oder schon wieder – er weiß es nicht, und es spielt auch keine Rolle mehr. Ein ausgebildeter Psychologe, der Angst hat und kein Mittel dagegen findet. Das ist schon tragisch. Aber nachts ist die Angst ganz anders. Am Tage sammelt sie sich in ruhigen Momenten in der linken Brustseite und beißt um sich. Dabei hat die Angst noch einen letzten Rest Respekt vor dem Tagesgeschehen im Alltag einer Mordkommission. Sie pflegt gewisse Umgangsformen. Zum Beispiel lässt sie sich von Rosi und ihrem Yogi-Tee im Zaum halten. Trotzdem möchte Kappe lieber keine ruhigen Momente riskieren.
Jetzt schnarrt ihm eine Telefonstimme durch den Morgennebel im Kopf ins Ohr, man habe eine Großlage. Treffpunkt Zentrale, in einer halben Stunde. «Keine Übung. Ich wiederhole: keine Übung!» Ausgerechnet am Montag der ersten Woche nach den großen Ferien. Die Woche, in der alle Berliner Beamten ohne schulpflichtige Kinder Urlaub nehmen. Die gesamte Chefriege ist nicht da. Kappes Chef Harry Engländer auch nicht, aber der ist zu einer Arbeitstagung zum Thema «Elektronische Datenverarbeitung» beim BKA in Meckenheim bei Bonn. Also ist Kappe, gerade frisch zum Kriminaloberkommissar befördert, jetzt die erste Garnitur. Der Morgen ist schon herbstlich kühl. Ein Wagen wartet vor dem Haus.
«Verehrter Bürgermeister, meine Herren …»
Meine stellvertretenden Herren, müsste es eigentlich heißen. Das Lagezentrum der Schutzpolizei im Flughafen Tempelhof ist halb leer. Die wenigen Kollegen schauen genauso unsicher und verschreckt, wie Kappe sich fühlt. Drei stellvertretende alliierte Sicherheitsoffiziere, ein amerikanischer und ein britischer Oberstleutnant sowie ein französischer Major, sitzen mit ihren Dolmetschern in der zweiten Stuhlreihe. Davor der Stellvertreter des Regierenden Bürgermeisters und ein Senatsdirektor als stellvertretender Leiter der Kanzlei im Schöneberger Rathaus. Den stellvertretenden Chef der Schutzpolizei kennt Peter Kappe vom Sehen.
Vor einer Tafel steht ein breitschultriger dunkler Typ im Maßanzug. «Vielen Dank, dass Sie zu unserer kurzfristig einberufenen Lagebesprechung kommen konnten», sagt er. Der Mann hat eine angenehme Stimme. Das ist schön um diese Uhrzeit. «Major Roland Galan, Bundesnachrichtendienst», stellt er sich vor.
Sein Vater, Kriminalhauptkommissar a.D. Otto Kappe, hat Peter Kappe mal von Galan erzählt. Natürlich nur rein privat, von wegen Dienstgeheimnis. Vor Jahren haben die beiden mal zusammengearbeitet. Roland Galan eilt innerhalb der Behörden ein gewisser Ruf voraus – oder vielleicht ist es auch nur ein leises Flüstern unter der Hand, gerade laut genug, dass man es von einem Dienst zum anderen hören kann. Jedenfalls ist er in eingeweihten Kreisen der bekannteste deutsche Geheimagent. Über diesen Widerspruch kann man nur hinweglächeln und hoffen, dass das gut geht. Es heißt, Galan habe 1962 im Zusammenhang mit der Kuba-Krise als ganz junger Agent die ersten Erkenntnisse eines westlichen Nachrichtendienstes über die Stationierung von sowjetischen Mittelsteckenraketen an die USA weitergegeben. Dass der BND international eine Rolle spielt, kommt nur sehr selten vor. Nun ist Galan Mitte Vierzig, sein Gesicht ist smart, aber schon ein bisschen verlebt. Noch ist er in Form. Wenn er den Raum betritt, seufzen die Frauen, und die Männer fühlen sich arm – hört man vom BND. Wie jedes Gerücht ist auch das ungesichert, aber Legenden sind ein wichtiges Arbeitsmittel von Geheimdiensten.
«Wir haben eine Information verifizieren können, die die Sicherheitslage in West-Berlin direkt betrifft», führt der Top-Agent aus. «Bei einer Verlegung zur US-amerikanischen Militärbasis Feldstadt in Bayern ist ein Atomsprengsatz abhanden gekommen. Man vermutet dahinter eine Aktion des KGB, des sowjetischen In- und Auslandsgeheimdienstes. Wie Sie wissen, hat Feldstadt eine eigene US Air Base. Ihre Radarüberwachung zeigt den unautorisierten Start eines nicht identifizierten Flugzeuges von einem nahe gelegenen Sportflugplatz. Die Maschine verschwindet dann nach Überflug der Sektorengrenze auf dem Staatsgebiet der DDR vom Radar, bevor die Amerikaner sie abfangen können. Der Sprengsatz kann also bereits überall sein.»
«Und was hat das mit uns hier in West-Berlin zu tun?», fragt der stellvertretende Leiter der Senatskanzlei.
Major Galan nickt. «Was ich Ihnen jetzt sage, darf diesen Raum nicht verlassen.»
Minuten später geben die alliierten Stellvertreter dem stellvertretenden Polizeichef die Erlaubnis, die 3.000 Mann der West-Berliner Bereitschaftspolizei in ihren Kasernen zu alarmieren. Der stellvertretende Kanzleichef schickt ein Fax an die Deutsche Bahn: den Regierenden Bürgermeister von Weizsäcker im Schnellzug nach Kiel wecken und aus dem Sonderwagen holen.
Peter Kappe staunt, wie ruhig er die Aufgabe annimmt. Major Galan beauftragt ihn, in die Berliner Wohnung des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen zu fahren und dort Bericht zu erstatten. Als sein Wagen auf den Tempelhofer Damm einbiegt, sieht er bei den Knallerbsen-Sträuchern am Eingang zum Präsidium einen Schatten stehen, der ihn an Galan erinnert. Der Schatten kippt sich einen Flachmann hinter die Binde und schmeißt die leere Pulle in die Büsche.
Der Minister empfängt Kappe im Morgenmantel im Bett, in der Hand eine Sammeltasse mit Earl Grey. Kappe steht daneben, während der Mann über eine sichere Leitung erst den Staatsminister im Bonner Kanzleramt anruft. Dann wählt er die Nummer des Kanzlerbungalows, Adenauerallee 139, Bonn. Es meldet sich die Hausdame.
Peter Kappe lehnt den angebotenen Tee ab. Er schickt den Wagen weg und fährt mit der U-Bahn in die Keithstraße. Als er sich auf seinen vertrauten Bürostuhl fallen lässt, ist es 5.30 Uhr. Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf Landsbergers Platz. Dort liegt bereits eine dünne Staubschicht. Kappe verschränkt die Arme auf der Schreibtischunterlage und legt den Kopf ab. Kurz denkt er daran, am offenen Fenster zu rauchen oder sich einen dickflüssigen Nescafé zu machen. Aber ein plötzlicher bleischwerer Schlaf hüllt alles in ein tiefwarmes, samtiges Schwarz.
Er wacht von einem süßlichen Rauchgeruch auf.
«Kappe! Guten Morgen!» Roswitha Habedanks Stimme mit dem leisen bayerischen Dialekt ruft seinen Namen.
Kappe zwingt sich, die Augen zu öffnen. Wie eine Erscheinung mit wallendem Kleid, fliegendem Lockenhaar und einem brennenden Bündel Stroh tanzt Rosi durchs Büro. Kappe springt auf. Sein Stuhl knallt zu Boden. «Es brennt!», schreit er panisch.
«Bist narrisch?», lacht sie. «Entspann dich. Ich räucher nur das Büro aus. Mit echtem Salbei! Bereinigt negative Einflüsse und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Fresh vibes halt, Kappe. Des brauchst am Montag! Hast hier gepennt? Hama an neuen Fall?»
Sie hat ihm einen Yogi-Tee gemacht, und er hebt seinen Stuhl auf, setzt sich und trinkt schweigend. Langsam trocknet der Angstschweiß zwischen seinen Schulterblättern. Er möchte die letzte ihm zur Verfügung stehende Kollegin wahnsinnig gerne einweihen. Wie soll er sonst effektiv arbeiten? «Ja, gewissermaßen haben wir einen neuen Fall», ringt er sich ab. «Aber ein Mord ist es nicht. Noch nicht.»
Die Rosi schwingt sich auf seinen Besucherstuhl, streicht ihr indisches Hippiekleid zurecht, zwirbelt ihre lockigen Haare mit den Fingern durch und schiebt die große runde transzendente Janis-Joplin-Brille auf die Nasenwurzel. «I bin ganz Ohr.»
«Der BND hat unseren Polizeipräsidenten um Amtshilfe gebeten», sagt Kappe und merkt selbst, wie verrückt das klingt. Er sieht auf die Uhr. «Ich habe gleich eine Besprechung mit der Senatskanzlei und den Leitern der West-Berliner Zollbehörden. Der Grenzzolldienst ist hier in West-Berlin ja dem Senat unterstellt. Du musst mir bitte ein Besprechungszimmer mit mindestens acht Stühlen besorgen, dazu Kaffee, Kekse etc. für die vier Zollkommissariate, und dazu kommen als übergeordnete Dienststellen die drei Hauptzollämter. Die werden einen Schock kriegen. Weil wir die selbstständige politische Einheit West-Berlin sind, wird die DDR ja zollamtlich als Inland betrachtet. Der Zoll macht also nur ein bisschen Export, läuft Grenzstreife und sucht höchstens mal nach geschmuggelten Intershop-Waren oder gefälschten Markenjeans.»
«Und was suchen wir jetzt?»
«Eine Bombe.»
Rosis Augen weiten sich wie unter Drogen. Sie holt scharf Luft. «Nein! Shit – doch nicht …»
«Doch.» Kappe legt ein Foto auf den Tisch. Es zeigt einen offenbar tonnenschweren, etwa vier Meter langen weißen Stahlzylinder, einem Torpedo nicht unähnlich. «Die Besatzung einer US-amerikanischen B-47 hat in der Nähe von Feldstadt in Bayern nach einer Kollision mit einem Kleinflugzeug eine Bombe abwerfen müssen. Der Zusammenstoß war möglicherweise provoziert. Jedenfalls konnte die Bombe nicht mehr gefunden werden. Die Amis haben eine Bombe verloren.»
«Einfach so eine Bombe verloren?» Sie legt investigativ den Kopf schief, und er kann ihren Blick nicht halten. «Quasi eigentlich nur ein Bömbchen?»
«Rosi, top secret. Glaub mir einfach, die Lage ist ernst.»
«A, geh weiter, Kappe! Was ist da los?»
«Frag doch Big Bill.»
Rosi ist seit zwei Jahren mit Major Big Bill Bukowski liiert, einem Spion von der Military Liaison Mission der US Army. Außerdem ist er Bluesbassist und ein verdammt netter Kerl.
Aber Rosi sagt eine Spur zu beiläufig: «Zeitverschwendung», sodass Kappe sie sofort mit einem sorgenvollen Blick bedenkt. Reiner kriminalpolizeilicher Reflex. Sie dreht ihre langen Locken zu einem lockeren Zopf. «Ach, geh», winkt sie ab. «I denk nur manchmal, vielleicht ist der doch zu jung für mi. Der lacht immer. Für den ist immer alles awesome.»
«Hier sind alle Männer zu jung für dich.» Kappe zuckt die Schultern. «Spielt das eine Rolle?»
«Ich will mich ja nicht lächerlich machen», sagt Rosi und setzt sich sehr gerade hin. «Also schieb ich’s auf diese vordergründige Positivität der Amis. Nervt halt.»
«Das ist mir auf meinen Besuchen bei meiner Tochter in New York schon aufgefallen. Wie toll alles ist, sagen dir die Amis so oft, bis dir die Ohren bluten. Selbst wenn sie eine Bombe verloren haben.»
«Und woaßt eh, dass der Bill der beste Bassist, aber auch der grausligste Spion in der Stadt is», unkt Rosi und atmet tief durch. «Der red einfach z’vui. Also, i woaß es eh, Kappe.» Ihr Blick wandert aus dem Fenster ins Nichts. «Es ist eine Atombombe, hob I recht?» Kappe will protestieren, aber sie schiebt nach: «Keine Angst, von mir erfährt niemand ein Sterbenswörtchen.»
Kappe ergibt sich in sein Schicksal. Außerdem ist es ganz schön, mit jemandem offen reden zu können. «Von der Air Force heißt es, die Bombe hat keinen nuklearen Kern enthalten. Aber der Kommandant der B-47 hat dem BND das Gegenteil erzählt. Er sagt allerdings auch, dass die Bombe keinen Zünder gehabt hat. Deshalb ist sie auch nicht explodiert.»
«Saubande!», flucht Rosi.
Es bleibt unklar, wen sie meint. Aber Kappe findet, sie hat in jedem Fall recht. Er steht auf und greift nach dem Foto der Bombe. «Und, Rosi: Versuchst du bitte, den Kollegen Landsberger zu erreichen?»
Rosi wirft das noch immer vor sich hin kokelnde Räucherbündel ins Handwaschbecken. «Der ist doch in die Lüneburger Heide», grantelt sie.
«Nee. Da habe ich auch neue operative Erkenntnisse. Ruf bei ihm zu Hause an. Schickt jemanden im Polizeisportverein vorbei. Notfalls schreib Landsberger zur Fahndung aus. Was auch immer er gerade tut, er soll sich auf jeden Fall vom Checkpoint Charlie fernhalten. Wenn ihm sein Leben lieb ist.»
Rosi nickt wie in Trance. Kappe kramt seine Zahnbürste und den elektrischen Rasierer aus dem Schreibtisch. Während er sich auf der Herrentoilette restauriert, muss er an seine Eltern denken. Wahrscheinlich sitzen sie gerade am Küchentisch und genießen ein gemütliches Frühstück mit Toast und Ei. Mittlerweile ist ja auch Kappes Mutter Rentnerin. Die beiden sind halbwegs gesund und genießen das Leben. Soll er sie anrufen und warnen, quasi kurzer Dienstweg? Immerhin kann ihrer aller Existenz jederzeit ausgelöscht werden. Aber dann wiederum – was würde es nützen, Panik zu verbreiten? Würden die beiden beim Berliner Blitz anrufen? Oder nochmal nach Ost-Berlin fahren, dessen Museen sie neuerdings für sich entdeckt haben? Oder im Sonnenuntergang auf ihrem Charlottenburger Balkon eine letzte ganze Schwarzwälder Sahnekirschtorte essen, quasi auf ex?
Zwanzig Minuten später, Besprechungsraum 2. An der Wand hängen Schwarz-Weiß-Poster von Mahatma Gandhi. Auf dem Besprechungstisch stehen kleine Tabletts mit Thermoskannen, Tassen und jeder Menge Keksen. Die Kollegen vom Zoll langen zuerst kräftig zu, aber nach den üblichen Begrüßungsfloskeln sagt Kappe es ihnen. Sie starren Peter Kappe entsetzt an. «Eine Si-Lage?»
Kappe nickt. «Einsatzstufe Berta. Höchste Geheimhaltungsstufe. Kontrollieren Sie den Güterfrachtverkehr aus der DDR gründlich, durchsuchen Sie alle Privat-Pkws.»
«Woher sollen wir die Leute dafür nehmen? Ich kann ja hier leider keine Unterstützung aus anderen Bundesländern anfordern, wie es in Westdeutschland gang und gäbe ist.» Das ist den Zollvorstehern zu viel Action, man sieht es ihnen an.
«Lassen Sie sich etwas einfallen. Ziehen Sie Ihre Leute von den Personenkontrollen am Flughafen ab. Das kann auch die Schutzpolizei machen.»
«Mobilisieren Sie die Freiwillige Polizeireserve?»
«Das diskutieren wir gerade. Im Moment haben wir noch Einsatzstufe Berta, Großlage. Nicht Caesar, Verteidigungsfall. Noch nicht.»
«Was sagen wir unseren Kollegen, wonach sie suchen sollen?»
Ein Schauer durchläuft Kappe angesichts der arglosen Gesichter der Zöllner. Er schluckt hart. «Wir suchen nach einem schweren Maschinenteil», sagt er. «Wahrscheinlich ungefähr vier Meter lang, vielleicht auch in Einzelteilen. Von der Form her zylindrisch. Wie eine Gasflasche oder ein Druckluftzylinder für einen linearen Antrieb.»
«Das klingt nach Munition. Haben Sie nicht so etwas wie eine Abbildung aus dem Identifizierungskatalog?»
Ja, das hat Kappe, kann er aber leider nicht herausgeben. Damit hier keinen der Schlag trifft. Aber auch, damit es nicht morgen auf dem Titelblatt des Berliner Blitz prangt. «Keine Munition», sagt er. «Beschlagnahmen Sie einfach jedes Maschinenteil, das Sie nicht einwandfrei identifizieren können. Sollten Sie den Verdacht haben, es handelt sich um Munition oder Anscheinsmunition, dann gehen Sie nach der Vorschrift vor, die die Entschärfergruppe des LKA KTI 24 – Explosivstoff- und Kampfmittelangelegenheiten ausgearbeitet hat. Im Zweifel rufen Sie den Fachgruppenleiter an. Der Kollege heißt Dr. Arved Muckler, steht alles hier drin.» Kappe schiebt die kopierten Vorschriften über den Tisch.
«Warum sollten die Russen ein Maschinenteil nach West-Berlin bringen? Und wer sollte das denn hier in Empfang nehmen?»
«Der BND verzeichnet derzeit verstärkte Aktivitäten der Staatssicherheit, Hauptabteilung Aufklärung. Es wurden Stasi-Stützpunkte in West-Berlin aufgebaut und inoffizielle Mitarbeiter angeworben. Mehr kann ich Ihnen dazu leider auch nicht sagen. So, und jetzt an die Arbeit, Kollegen!»
Als Kappe wieder in sein Büro kommt, ist die Post gerade durch. In seinem Eingangskorb liegt ein etwa zwanzig Zentimeter hoher Stapel. Ganz oben auf dem Stapel leuchtet eine Postkarte mit Altstadtfotos, darüber ein geschwungener Schriftzug Wunderschönes Wiesbaden. Kappe kennt niemanden, der verreist ist, und schon gar nicht nach Wiesbaden. Verwundert dreht er die Karte um. Die Handschrift kennt er auch nicht. Aber die Postkarte ist eindeutig an die Keithstraße adressiert, zu Händen der 6. Mordkommission. Die flüchtig aufgeklebte 80-Pfennig-Briefmarke zeigt Theodor Heuss. «Hast du das schon gesehen?», fragt er und gibt Rosi die Karte.
«Wer schreibt uns denn a Karten?», wundert sie sich. «Hm. Poststempel aus Wiesbaden. Und keine Anrede, nur ein Text: In Stuttgart wird um 18 Uhr die Fahndung nach Paul F. ausgelöst, der dringend verdächtig ist, als Inhaber einer dubiosen Bauträgerfirma Kundenersparnisse veruntreut zu haben. Zwei Minuten später: Auf dem Flughafen in Hamburg reicht ein Fluggast dem Beamten zur Passkontrolle vor Flugantritt seines Fluges nach Übersee seinen Reisepass. 18.03 Uhr: Der Fluggast wird festgenommen. Es ist der gesuchte Paul F. – So an Schmarrn! Wie soll des gehen?»
«Paul F.? Sagt mir nichts. Wahrscheinlich ein blöder Witz von Landsberger, der seinen Urlaub vortäuschen wollte.» Kappes Telefon beginnt zu klingeln.
«Nicht Landsbergers Handschrift.» Rosi dreht die Karte noch ein paarmal hin und her. Erst will sie sie an die Korkpinnwand hinter ihr heften, an der schon Urlaubspost aus London, Paris und Mallorca hängt. Dann steckt sie sie in einen Asservatenbeutel. Sie haben keine Zeit für so einen Quatsch, aber man weiß ja nie. Kappe nimmt mit der einen Hand den Hörer ab und schmeißt mit der anderen die restliche Post vor Rosi auf den Tisch.
Dr. Elke Ostermann wirbelt durch die Drehtür der Hauptstelle für Befragungswesen am Hohenzollerndamm 150. Sie knallt die Absätze ihrer Pumps auf den Marmorboden. «Major von Pussinske erwartet mich!», peitscht sie dem Pförtner ihre Stimme um die Ohren. Der Mann heißt Schimmelpfennig, weiß sie. Es steht auf dem Schild an seinem Revers. Er sieht heiratsschwindlerisch aufgebrezelt aus, billiges Rasierwasser, glattrasiert, schwarz gefärbte Schläfen. Sie lässt ihre Visitenkarte vor ihm auf den Marmortresen aufschlagen wie ein As von Tennisstar Martina Navratilova.
Aber Schimmelpfennig ist offensichtlich freier West-Berliner. Wenn so einer gerade B.Z. liest und an einem Käsebrot kaut, dann könnte auch der Kaiser von China vorm Tresen stehen. Ostermann sieht Schimmelpfennig an, dass er sie, die lästige Frau Doktor, in einer Sitzecke parken will. Aber dann beäugt er sie, und er findet sie eigentlich ganz knorke. Klar, Berliner stehen auf Frechheit. Elke Ostermann merkt, wie ihr Herrenanzug mit den breiten messerscharfen Schulterpolstern auf das einfache Gemüt des Pförtners wirkt. Eigentlich ist sie eher eine lange Dürre, aber die Mode hilft ihr. Frauen haben ja jetzt auch beruflich etwas zu sagen, oder zumindest hätten sie das gerne. Die voluminöse knallrote Bluse mit dem riesigen Rüschenkragen umrahmt ihren Hals wie eine Papiermanschette eine langstielige dornige Rose. Elke Ostermann trägt die Haare kurz, blond und mit viel Haarsprayvolumen auf Außenwelle modelliert. Die Frisur erinnert an Prinzessin Diana. Sie hat auch diese Aura – sie sieht in den Augen des Pförtners Schimmelpfennig, dass er merkt: Hoppla, irgendwas ist da, etwas Doppelbödiges.
Er legt das Käsebrot weg und schmettert: «Ihren Ausweis, bitte!»
Visitenkarten sind natürlich unter seiner Würde. Schließlich ist er Schwellenhüter einer Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes.
Schimmelpfennig vergleicht den Ausweis mit einer Liste. «Mensch, hier habe ich Sie doch, die Frau Dr. Ostermann!» Er kommt auf Touren und knipst sein Fünf-Sterne-Plus-Lächeln an. «Wir sind aber nicht zum letzten Mal da, wa?»
Sie schüttelt huldvoll lächelnd den Kopf. Der Heiratsschwindler flattert um den Tresen herum. Er nimmt ihr Handtasche und Mantel ab und schließt sie in einem Garderobenfach ein. Dann fährt Schimmelpfennig übertrieben lustvoll – so kommt es ihr vor – die Kontouren ihres Körpers mit einem Metalldetektor in der Form eines Tennisschlägers ab.
«Nehmen Sie einen Moment Platz», flötet er. «Ich rufe Pussi für Sie an.»
«Pussi?», fragt Elke Ostermann mit hochgezogenen Augenbrauen.
«Pussinskes Spitzname hier beim Dienst», flüstert ihr der Heiratsschwindler zu.
«Sehr nett, dass Sie ihn für mich anrufen», flüstert sie ironietriefend zurück. «Was würde ich nur ohne Sie anfangen, Herr Schimmelpfennig?»
«Wie wär’s», grinst der zurück, «wenn Sie etwas mit mir anfangen?»
Elke Ostermann lächelt das weg. Von Respekt hält hier offenbar niemand viel. Die Hauptstelle für Befragungswesen untersteht direkt dem Kanzleramt. Das heißt, in ganz West-Berlin hat den BND-Agenten keiner etwas zu sagen.
Major Ottmar von Pussinske holt Elke Ostermann im Foyer ab. Er greift nach ihrer Hand und deutet einen Handkuss an. Elke Ostermann weiß, dass Agenten wie von Pussinske – ältlich, Mund wie ein Briefschlitz, schlecht sitzender grauer Anzug, Pomade im dünnen Haar – haufenweise hier in dieser klassisch-monumentalen ehemaligen Nazi-Kaserne des Wehrkreiskommandos III auf einem parkähnlichen Areal in Schmargendorf sitzen. Sie bilden sich ein, sie hätten in West-Berlin alles im Griff. Ihre offizielle Aufgabe ist die Befragung von Asylbewerbern und DDR-Flüchtlingen. Ihre inoffizielle Aufgabe: alles, was anfällt.
Und dazu braucht Major Pussi jetzt eine Spezialistin wie Frau Dr. Ostermann. Er wedelt sie in den Fahrstuhl und durch die Amtsgänge in sein kärgliches dunkelbraunes Büro. Es riecht nach Nadelholzteer. Als Pussi hinter seinen Schreibtisch tritt, schiebt er die oberste Schublade mit dem Knie zu. Elke Ostermann erhascht einen Blick auf eine verstaubte Pistole und eine Flasche Pitralon-Aftershave. Sie nimmt auf seinem Besucherstuhl Platz.
«Ein ziemlich zierliches Schießeisen haben Sie da in Ihrem Schreibtisch», sagt Elke Ostermann. «Passt eigentlich mehr zu einer Frau, finden Sie nicht?»
«Verstehen Sie etwas von Waffen, Frau Dr. Ostermann?»
«Nein, aber von Frauen.»
«Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?», näselt von Pussinske verschnupft.
«Tee. Schwarz. Mit viel Milch und braunem Kandiszucker», nickt sie. Es ist einfach, eine schwierige Frau zu sein. Deshalb gibt es auch so viele davon.
Major von Pussinske ruft über eine Gegensprechanlage im Sekretariat an und bestellt die Getränke. «Zur Sache, Frau Dr. Ostermann. Major Galan und ich holen Sie morgen um 7 Uhr am Schloss Charlottenburg ab. Eine schwarze Limousine mit dunklen Scheiben. Seien Sie pünktlich. Wir erwarten Zar im Laufe des Vormittags.»
«Operation Zar also?»
Bevor von Pussinske antworten kann, öffnet sich die Tür, und eine Platinblonde betritt das Büro. Sie stellt ein Tablett ab und verschwindet. Sogar braunen Kandis gibt es. Vielleicht war die Platinblonde zwischendurch schnell im KaDeWe.
Von Pussinske atmet tief durch und schenkt ein. «Ein Bote bringt das Fabergé-Ei. Sie bestätigen die Echtheit. Major Galan übergibt das Geld. Der Bote geht. Sie planen eine Sonderausstellung und setzen das West-Berliner Kunstgewerbemuseum auf die internationale Landkarte. Genau rechtzeitig zur Eröffnung des Neubaus am Kulturforum in drei Jahren.»
«Das klingt sehr einfach.»
«Wir machen oft unproblematische Geschäfte mit der KoKo. Der Osten braucht das Geld.»
«Wie lange habe ich Zeit, um das Ei zu untersuchen?»
«Ein paar Minuten vielleicht.»
«Das ist wenig.»
«Sie gelten als internationale Kapazität auf dem Gebiet der kaiserlichen Fabergé-Eier», sagt er.
«Ich bin eine internationale Kapazität für osteuropäisches Kunstgewerbe, Schwerpunkt Goldschmiedearbeiten.» Elke Ostermann schlägt die Beine über und nippt an ihrem Tee. «Ich stamme aus einer alten Leningrader Apothekerfamilie. Ich habe über Peter Carl Fabergé promoviert, den russischen Hoflieferanten, Juwelier und Goldschmied, ebenfalls aus Leningrad. Also damals hieß das natürlich Sankt Petersburg. Selbstverständlich wissen Sie, dass Zar Alexander III. bei Fabergé 1885 das Hennen-Ei in Auftrag gab, das erste der kaiserlichen Prunkeier. Er schenkte es seiner Gattin Maria Fjodorowna zu Ostern. Sie war begeistert von der feinen Goldschmiedearbeit, und so wurden die kaiserlichen Ostereier zu einer Tradition, die auch der Zarensohn bis zu seinem Sturz 1917 fortführte. Insgesamt existieren 52 Eier in der sogenannten imperialen Qualität, zwei davon unvollendet. Die meisten lassen sich aufklappen und enthalten eine Überraschung. Das Hennen-Ei enthielt zum Beispiel kleine Eier aus Rubinen. Leider sind sie über die Jahre verschwunden.»
«Jaja. Entweder Sie können ein echtes Fabergé-Ei auf den ersten Blick von einer Fälschung unterscheiden oder nicht.» Von Pussinske schnipst unangenehm fahrig mit seinem Kugelschreiber.
Irgendwie eine Beleidigung, findet Elke Ostermann, zwingt sich aber trotzdem zu einer sachlichen Antwort: «Gefälschte Eier gibt es viele, wir nennen sie Fauxbergé. Die echten Eier haben Herkunftspapiere – am besten ist hier eine Originalrechnung oder Skizze aus der Werkstatt von Fabergé. Und sie sind punziert – also gestempelt in kyrillischer Schrift KF Karl Fabergé Hoflieferant, dann noch eine Goldpunze. So ein Ei kann leicht mehrere Millionen Dollar wert sein. Acht Eier sind allerdings seit der Russischen Revolution verschollen.»
«Also, würden Sie nun ein echtes Ei erkennen oder nicht?»
Elke Ostermann lacht. «Eine absurde Frage, Pussi. Ich darf doch Pussi sagen?»
«Natürlich nicht.» Jetzt sieht er beleidigt aus.
«Selbst mit verbundenen Augen würde ich ein Fabergé-Ei erkennen. Die verschollenen Eier sind so etwas wie der Heilige Gral meines Spezialgebiets.»
«Das ist erst mal das einzige, was morgen zählt», sagt von Pussinske und räuspert sich auf die schleimig-raspelnde Art eines degenerierten Adligen. «Und jetzt erzähle ich Ihnen noch eine Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie würden in der DDR leben. Sie