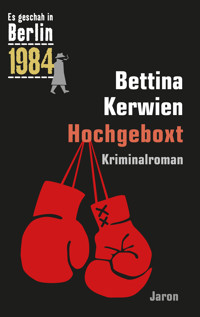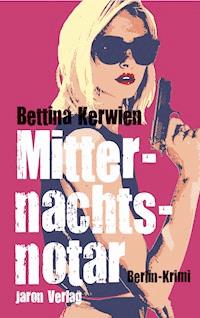Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Tag nach Bad Kleinen: Die RAF wird verraten, ihre Auflösung ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber die Mitglieder der dritten Generation werden nie gefasst. Beachtliche Geldbeträge aus Beschaffungsaktionen bleiben verschwunden. Ex-RAF-Mitglied Martin Landauer nutzt das herrenlose Geld auf seine Weise. Er räumt eines der geheimen Erddepots aus und gründet mit dem Politologen Lennard Johannson eine Stiftung, die sich der Wiedergutmachung von gesellschaftlichem Unrecht widmet. Allerdings ziehen sie damit den Hass von Staatssekretär Hans Grendel auf sich. Als auch die totgeglaubte RAF-Legende Michael Glass auftaucht, spitzt sich der Konflikt zu. Denn jeder der Beteiligten ist bereit, über Leichen zu gehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Kerwien
Machtfrage
Kriminalroman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Elmar Klupsch
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Burger
ISBN 978-3-8392-4672-6
Widmung
Für Bine
Zitate
soll der geier vergissmeinnicht fressen?
hans magnus enzensberger
verteidigung der wölfe gegen die lämmer
Gläubige, gebt Almosen von eurem risq (dem, was ich euch zum Unterhalte verlieh), bevor der Tag kommt, an dem es kein Unterhandeln, keine Freundschaft und keine Fürbitte mehr gibt.
Der heilige Koran, Sure Al -Bakarah 2:254
prolog: berlin, am hohenzollern-kanal
donnerstag, 17. juni 1971, 16:32 uhr
Michael Glass trägt enge Jeans mit Schlag und eine taillierte Lederjacke. Es ist Frühsommer. Die Vögel singen. Der Hohenzollernkanal glitzert in der Sonne. Glass geht spazieren, schiebt den Kinderwagen am Wasser entlang. Da teilen sich links die Büsche. Vier Vermummte springen auf den Weg, schießen ohne Vorwarnung. Glass reißt den Kopf herum, duckt sich. Die Kugel dringt oberhalb des rechten Ohrs in seinen Schädel ein. Er bricht zusammen, fällt auf den Kinderwagen. Der Wagen rollt los, Richtung Kanal. Zwei Vermummte stoppen ihn, zerren den leblosen Körper zu Boden. Das Kind schreit wie am Spieß. Ein Angreifer hebt die Babydecke hoch, presst sie dem Kleinen aufs Gesicht. Dann ist Ruhe.
Ein Funkgerät knistert. »Status?«, schnarrt es.
»Finaler Rettungsschuss.«
»Gratuliere!«
Die Vermummten rollen einen schwarzen Plastiksack aus. Sie ziehen den Reißverschluss auf, wälzen den toten Michael Glass hinein, beschweren den Sack mit einer Kette. Einer sticht Löcher in das Plastik. Danach wuchten sie ihn in den Kanal. Er schaukelt noch ein bisschen auf der Wasseroberfläche, dann versinkt er. Als die letzten Luftblasen aufsteigen, tauschen die Vermummten zufriedene Blicke.
Bleibt nur noch der Kinderwagen und sein lästiger Inhalt.
berlin-spandau, kraftwerk reuter west, block D
montag, 28. juni 1993, 8:58 uhr
Alexander Schmidt klappte das Visier herunter und drückte auf die Vorschubtaste. Es spritzte und puffte. Der verdammte Gaskegel zerflatterte ihm, als hätte er zum ersten Mal in seinem Leben eine Schweißpistole in der Hand. Eine Kaltfront aus Skandinavien. Im Radio hatten sie vor Bodenfrost gewarnt. Die Stahlträger waren viel zu kalt.
»Hallo? Junger Mann?«
Eine hohe Zitterstimme. Besuch. Auch das noch. Der Mann sah aus wie ein dicklicher Tatort-Kommissar kurz vor der Pensionierung. Er presste sich mit dem Rücken an die Tür des Lastenfahrstuhls und beäugte misstrauisch die Gitterroste vor ihm.
Der arme Kerl musste sich verlaufen haben. Schmidt klappte das Visier seines Schutzhelms hoch und legte die Schweißpistole beiseite. Hier auf Block D konnte man durch die Gitterroste 75 Meter in die Tiefe sehen.
Der Fremde umklammerte mit einer Hand seine Aktentasche, mit der anderen winkte er zaghaft. Schmidt nahm den Helm ab und schraubte seine Gasflaschen zu. Unter ihm lag halb erstarrt die Spree im Frühnebel. Er warf seine Handschuhe über den Drahtvorschub.
»Herr Schmidt?« Der Besucher tastete sich einen Schritt vor, als würde er eine Eisfläche betreten. »Sind Sie das?«
»Warten Sie.« Schmidt wollte auf gar keinen Fall unhöflich erscheinen. Er balancierte über den Träger, an dem er gerade noch geschweißt hatte, hinüber zum Fahrstuhl. »Ich bin Alexander Schmidt«, sagte er.
Der Besucher umklammerte seine Hand wie einen Rettungsanker. »Der, den sie Ali nennen? Originelle Abkürzung für Alexander. Aber eigentlich kein Name für jemanden, der aussieht wie’n Zehnkämpfer. Wo kommt der Spitzname her?«
Schon in der Grundschule hatten sie ihn so gerufen. Die anderen hatten Mahmut oder Hassan oder Erkan geheißen, und so hatten sie entschieden, sein Name solle Ali sein.
»Passte irgendwie«, sagte er. Sein Haar war dunkler gewesen als das seiner Schulkameraden, auch war er größer und seine Haut heller.
»Ganz schön luftig haben Sie es hier.« Der Mann lächelte gequält. »Hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Mein Name ist Karl-Heinz Harvichsbeck.« Er fischte eine Visitenkarte aus der Innentasche seines Trenchcoats und hielt sie Ali hin.
Ali nahm die Karte. »Private Arbeitsvermittlung? Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen Fahrstuhl genommen haben?«
Harvichsbeck grinste und wies mit dem Kinn auf Alis Schweißgerät. »Ich suche nach dem Mann, von dem ich in der Kantine gehört habe, dass er – und ich zitiere – einfach alles zusammenbrät, was man ihm hinlegt.«
Ein Lieblingsspruch von Richtmeister Krause.
»Das bin ich dann wohl«, gab er zu.
Harvichsbeck lächelte. »So wie der Meister geschwärmt hat, hätte ich einen älteren Mann erwartet. Alle Achtung. Machen Sie was draus. Ich hab ein Jobangebot für Sie. Interessiert?«
Der Wind blies Raureif über das Kesseldach und wehte ein paar Eiskristalle zu ihnen hinein. Sie tanzten in der Sonne. Das konnte Harvichsbeck nicht gesagt haben, entschied Ali. Er schob ihn beiseite und drückte auf den Fahrstuhlknopf. »Ich habe jetzt Pause«, sagte er.
»Ihre Kollegen sitzen ja schon seit einer halben Stunde in der warmen Kantine.« Harvichsbeck lächelte bauernschlau.
Darüber machte sich Ali keine Illusionen. Es war kurz vor neun, und er war seit 5 Uhr auf den Beinen. Ohne Frühstück. Dafür mit einem beständig zunehmenden Druck in den Stirnhöhlen.
»Die lassen Sie hier die Drecksarbeit machen«, bemerkte Harvichsbeck. »Verdienen Sie wenigstens gut?«
Ali strich sich das Haar aus der Stirn. Suchte in der Brusttasche seines Blaumanns nach Taschentüchern. Fand sie nicht. »Sie fragen den Meister, ob er einen guten Schweißer hat«, sagte er. »Sie wollen mich abwerben. Das ist auch Drecksarbeit.«
Harvichsbeck tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Sagen wir mal, Sie verdienen 20 Mark die Stunde.« Seine hohe Stimme überschlug sich vor Begeisterung. Warum kam der verdammte Fahrstuhl nicht? »Ich kann Ihnen einen Job vermitteln, wo Sie das Doppelte verdienen. Plus Auslösung und Erschwerniszulage.«
»Als Honorarkonsul?«
»Sie sind Schweißer, also biete ich Ihnen einen Job als Schweißer an. Bei einer Ölgesellschaft. Die suchen gutes Personal für die Instandhaltung von Bohrinseln. Sie sind jung, machen Sie was aus Ihrem Leben. Sie können die Welt sehen, und das ist ein Sprungbrett für eine schöne Karriere. Mit Pensionsansprüchen.«
Ali überlegte, ob Krause ihn kurz zur Apotheke gehen lassen würde, Aspirin holen. Harvichsbeck hatte sich warm gequasselt.
»Sie fahren zur Schulung in die Staaten – ein, zwei Monate Texas. Sonnenschein, Mädels, Bier, Rodeo – was Sie wollen. Und dann geht es los, ab auf eine Ölbohrinsel vor Norwegen oder nach Alaska oder in den Mittleren Osten. – Sie können doch Englisch?«
Der Aufzug kam. Es war ein riesiger Lastenfahrstuhl, aber Harvichsbeck baute sich so dicht vor ihm auf, dass Ali trotz seiner zuschwellenden Nase billiges Rasierwasser roch.
»Klingt das super?«, fiepte der Arbeitsvermittler.
Ali sah durch ihn hindurch. Er würde nirgendwo hingehen, schon gar nicht zum Rodeo.
»Wollen Sie mal einen Mustervertrag sehen?« Harvichsbeck machte Anstalten, seine Aktentasche zu öffnen. Ali packte ihn am Kragen seines Trenchcoats und hob ihn hoch. Dickerchen war leichter, als er gedacht hatte. Ein paar Nähte platzten. Ein Knopf sprang ab. Harvichsbeck wurde blass. Seine Augen quollen aus den Höhlen. Ali hielt ihn einen Moment fest.
»Ich habe kein Interesse«, sagte er ruhig. Stellte ihn wieder ab.
Harvichsbeck hyperventilierte, riss an seinem Hemdkragen. Der Fahrstuhl stoppte, die Türen glitten auf. Harvichsbeck schoss an Ali vorbei ins Freie, lief im Krebsgang vor ihm her.
»Sie machen einen Fehler!« Seine Stimme kiekste vor Wut. »Warum benutzen Sie statt Ihrer Hände nicht mal Ihren Kopf? Rufen Sie mich an. Aber warten Sie nicht zu lange! Andere sind nicht so zögerlich!«
Texas, dachte Ali. Die Vorstellung jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Er wusste nicht mehr über Amerika als das, was man im Fernsehen sah, aber er war 23, er war Westberliner, und manchmal wurde er von einem ungeheuren Fernweh gepackt, das ihm die Luft abdrückte. Weggehen. Die Kondensstreifen der Flugzeuge. Das Meer sehen. Alaska. Irgendwann würde er das tun. Aber nicht in diesem Sommer. Denn dies war der Sommer, in dem Onkel Roberto sterben würde.
bonn, innenministerium
montag, 28. juni 1993, 10:25 uhr
Der Tag nach Bad Kleinen. Zwei Tote, zwei Verletzte bei der Operation ›Weinlese‹. Als Polizeikoordinator des Innenministeriums hatte Hans Grendel seit mehr als 24 Stunden nicht geschlafen. Ein Desaster. Statt eines kontrollierten Zugriffs ein Shoot-out im wilden Osten. Und jetzt machte die Presse die Täter zu Opfern: RAF-Terrorist Wolfgang Grams sei von der GSG 9 hingerichtet worden, hieß es.
Durch das Fenster des Sitzungssaals konnte Grendel den Rhein sehen, dessen breites Band unter einer kalten Sonne glitzerte. Er hatte keine Zeit für Krisensitzungen. Auf dem Videomitschnitt des Einsatzes hatte er etwas Unglaubliches gesehen, das nach seiner Aufmerksamkeit schrie. Aber der Innenausschuss tobte, verlangte Antworten, Notfallpläne. Köpfe sollten rollen.
Der Innenminister hatte Grendel zu diesem informellen Treffen ins Ministerium geschickt, nur ihn, ein hochrangiges Kabinettsmitglieder und den BKA-Terrorismus-Chef.
Der Kollege von der Bundespolizei hatte einen Bogen Packpapier mit einer Tatortskizze vom Bahnhof Bad Kleinen an eine Tafel gepinnt. Nervös fasste er die gestrigen Geschehnisse zusammen. Der Mann hatte offenbar Angst um seinen Job. Er knetete seinen Zeigestock. »Die Aktion ›Weinlese‹ war nur auf Frau Hogefeld ausgerichtet. Sie hat mit unserem V-Mann einen Kurzurlaub in Wismar verbracht. Wir hören sie ab, sie sagt dem V-Mann, sie will sich nachher noch mit anderen Genossen treffen. Wir entscheiden, dass wir dieses Treffen abwarten und dann erst zugreifen. Hogefeld und der V-Mann steigen also in einen Zug nach Bad Kleinen, treffen dort um 13 Uhr ein.« Der BKA-Experte wies mit einem Zeigestock auf Bahnsteig 1/2. »Um 14 Uhr beobachten wir dann, dass Hogefelds Lebensgefährte Wolfgang Grams ankommt.«
»Wie viele Beamten hatten Sie am Bahnhof?«, fragte der Minister.
»120 Mann. Bundeskriminalamt und Bundesgrenzschutz.«
Der Mann machte sich eine Notiz. »Das erscheint mir ausreichend.«
Der BKAler nickte und schluckte hart. »Während sich Hogefeld und Grams begrüßen, entscheidet das Lagezentrum zuzugreifen.«
Das war der Kardinalfehler, dachte Grendel, dabei hatten die im Lagezentrum beste Sicht auf alle Observationskameras. Erschreckend. Er fröstelte. Mittlerweile war er in eine Position aufgerückt, die ihm jegliche Illusion über Deutschland raubte.
Der Bundespolizist tippte mit seinem Zeigestock auf die Tatortskizze. »Hogefeld, Grams und der V-Mann essen im Bahnhofsrestaurant. Die GSG 9 postiert sich in der Gleisunterführung. Es gibt nur diesen einen Weg aus dem Bahnhof. Die Zielpersonen gehen die Treppe runter. Frau Hogefeld bleibt hier stehen, liest den Fahrplan. Grams und der V-Mann gehen vor, warten am Treppenaufgang zum Bahnsteig 3/4. Sieben Kollegen kommen von hier um die Ecke. Ein Beamter fixiert Frau Hogefeld vor dem Fahrplankasten am Boden. Wolfgang Grams flieht die Treppe hinauf zum Bahnsteig 3/4. Die Beamten hinterher. Grams zieht seine Waffe, erschießt einen Kollegen, schießt den zweiten an. Dann wird er selbst getroffen. Er fällt auf die Bahngleise und stirbt.«
»Stirbt?« Der Minister knallte eine Zeitung auf den Tisch. »Im SPIEGEL lese ich, die GSG 9 hat Wolfgang Grams exekutiert? Hier: Grams liegt hilflos auf den Gleisen, und Ihre Leute erledigen ihn mit einem aufgesetzten Schuss in die Schläfe. Ein Super-GAU, Mann. Es hagelt schon Solidaritätsbekundungen aus der Bevölkerung.« Der Minister sprang auf. »Wir kommen rüber wie ein gottverdammter Polizeistaat. Der Innenausschuss fordert eine plausible Erklärung.«
Der Bundespolizist wand sich. »Wenn unsere Leute Grams tatsächlich erschossen haben, ist das das Ende der GSG 9, Helden von Mogadischu oder nicht. Und der Innenminister kann auch den Hut nehmen.«
Der Minister wurde blass. »Mein Vorschlag: Grams hat sich selbst erschossen. Denken Sie, der Generalbundesanwalt kann das verkaufen?«
Grendel schüttelte den Kopf. Der Minister tat ihm leid. Persönlich hatte der Mann sich nichts vorzuwerfen. Trotzdem – entweder ein Mann war ministrabel oder er war bloß ein netter älterer Herr.
Der Minister fuhr sich durch die grauen Haare. »Fassen Sie noch mal zusammen, mit wem wir es zu tun haben, Herr Grendel. Vielleicht ergibt sich ein Ansatzpunkt.«
Wenn du wüsstest, was ich weiß, dachte Grendel und quälte sich gehorsam aus dem Konferenzsessel. Er schob die Hände in die Taschen seiner Anzughose und zwang sein übermüdetes Hirn, sich auf sein Spezialgebiet zu konzentrieren und das Standardprogramm abzuspielen. »Die Gruppierung nennt sich seit Juni 1970 ›Rote Armee Fraktion‹. Die RAF hält den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat für faschistisch und repressiv. Seit den Frankfurter Kaufhausbränden vom April 1968 will diese radikalisierte Kleingruppe einen gesellschaftlichen Umsturz zu ihren Bedingungen erzwingen«, erklärte Grendel. »Die RAF geht aus der Baader-Meinhof-Gruppe hervor, als am 14. Mai 1970 der verurteilte Kaufhausbrandstifter Andreas Baader bei einem Freigang im Institut für Soziale Fragen in Berlin von der Journalistin Ulrike Meinhof befreit wird. Die RAF praktiziert den bewaffneten Widerstand gegen unsere Verfassungsorgane. Auf ihr Konto gehen bis heute 61 Tote, 230 Verletzte, Sachschäden von etwa 500 Millionen D-Mark. Um sich zu finanzieren, hat die RAF bis heute mindestens 31 Banken überfallen und dabei sieben Millionen Mark erbeutet. Mittlerweile haben wir es mit der dritten Terroristen-Generation zu tun. Die dritte Generation ist verantwortlich für alle Gewaltaktionen nach 1985: die Erschießung des Rüstungsmanagers Ernst Zimmermann im Februar, dann den Bombenanschlag auf Siemens-Manager Beckurts und seinen Fahrer im Juli 86, später im selben Jahr der Mord an Ministerialdirektor von Braunmühl, 1988 folgte der Anschlag auf Finanzstaatssekretär Tietmeyer, im November 89 stirbt Deutsche-Bank-Sprecher Herrhausen durch eine Sprengfalle, es folgt im April 1991 die Erschießung von Treuhand-Chef Rohwedder. Aktuell hat sich die RAF zu den Sprengsätzen im Gefängnisneubau Weiterstadt bekannt.«
»Was raten Sie?« Der Minister tippte sich an die Nase.
Grendel lehnte sich vor. »Die haben uns den Krieg erklärt. Und wir? Wir bewegen uns brav innerhalb rechtsstaatlicher Grenzen. Warum? Wissen Sie, was ich nach der ›Landshut‹-Entführung in Mogadischu gemacht hätte? Für jede tote Geisel hätte ich in Stammheim einen RAF-Gefangenen erschossen. Ganz offiziell. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das wären Wirkungstreffer gewesen.«
Dem Minister klappte angemessen der Unterkiefer herunter. Ja, da sprach Volkes Stimme. Grendel fand, ein Vollblutparlamentarier musste das abkönnen.
»Schauen Sie sich dieses PR-Debakel jetzt an«, fuhr er fort. »Wir werden angegriffen, wir antworten aber nicht in derselben Sprache. Wir schaffen Märtyrer. Schon tönt die RAF in Stammheim, sie will alles tun, damit die Gewalt nach Bad Kleinen nicht eskaliert. Hardliner wie Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar sind plötzlich für Gewaltverzicht. Das ist schlau. Wir stehen dumm da. Mit Bad Kleinen steigt das Verständnis für die RAF bei den Menschen.«
Der Minister winkte ab. »Leute hinrichten, so lenkt man keine westeuropäische Demokratie, Grendel. Wie können wir unsere Linie durchsetzen und unserer … Verantwortung gerecht werden?«
Und deinen Posten retten, dachte Grendel bitter. Er trat ans Fenster und sah über den Rhein. Er musste dringend ins Lagezentrum. Wie lange hatte er schon nichts mehr gegessen? »Ich rate zu einer Null-Toleranz-Linie«, sagte er. »Aber sowohl gegen unsere eigenen Fehler als auch gegen die der Terroristen. Radikalisieren Sie sich – werden Sie zu radikalen Verteidigern der Demokratie. Bad Kleinen zeigt unsere Probleme. Wir haben ein Zuständigkeits- und Verantwortlichkeitschaos in den Ministerien, Diensten, LKAs und so weiter. Keiner weiß, ob in Bad Kleinen genügend kugelsichere Westen vor Ort waren, weil sich keiner dafür zuständig fühlte. Notärzte wurden gar nicht bestellt – jede Behörde dachte, die andere hätte es gemacht. Beseitigen Sie dieses Chaos. Machen Sie dafür ein Konzept und stellen Sie es der Öffentlichkeit vor. Vielleicht retten Sie so Ihren Hals. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss mich um ein echtes Problem kümmern.«
Der Minister wurde plötzlich sehr gerade. »Sie sprechen recht offen, Herr Grendel. Lassen Sie mich Ihre Linie aufgreifen. Ihre Expertise scheint mir hier in Bonn verschwendet. Mit Ihrem Pioniergeist sollten Sie Aufbauhilfe in der ostdeutschen Provinz leisten. Was halten Sie von einer Versetzung nach Brandenburg? Kommt Ihre Familie nicht aus der Ecke?«
berlin-spandau, kraftwerk reuter west
montag, 28. juni 1993, 16:10 uhr
Das Wasser schoss aus dem Duschkopf, heiß und hart. Ali hielt sich an den Armaturen fest. Die Muskeln zitterten, die Gelenke schmerzten. Es kam selten vor, dass sein Körper ihn im Stich ließ. Es war ein guter Körper, wuchtige Schultern, schmale Hüften, ausgeprägte Muskulatur. Dampfendes Wasser lief über seine breite Brust die langen Beine hinab und färbte seine Haut krebsrot. Die Wärme tat ihm gut. Er zog alle Sachen übereinander, die er in seinem Spind fand, und fror trotzdem.
»Lange Männa unta de Jeans?«, spottete Richtmeister Krause. »Im Juni? Biste ’nen Mann oda ’ne Memme?«
Ali trat ans Waschbecken und löste zwei Aspirin im Becher seiner Thermoskanne auf. Sein Gesicht im Spiegel war klar und kantig, der Bartschatten gab ihm etwas Verwildertes, die schmale Nase war die eines Abenteurers. Ali war es gewohnt, dass sein Gesicht Offenheit und Energie ausstrahlte. Heute nicht. Drei steile Falten hatten sich zwischen seine Brauen gefressen. Seine grünen Augen glänzten fiebrig. »Ich geh zum Arzt«, sagte er zum Richtmeister.
Auf dem Weg zur U-Bahn begann seine Stirn zu glühen. Alis Zug kam, er drückte sich in eine Ecke und schloss die schmerzenden Augen. Er brauchte sie nicht, um in Berlin U-Bahn zu fahren, er hatte den Rhythmus der Stationen verinnerlicht wie ein alter Barpianist seinen Einsatz. An der Osloer Straße stieg er aus und lief die Koloniestraße hinunter. Mittlerweile war es vollständig dunkel, es fiel ein feiner eisiger Regen. Ali zitterte. Was für ein lausiges Wetter für diese Jahreszeit.
Die Pizzeria Napoli war ein baufälliger Holzschuppen, nach dem Krieg in den Vorgarten eines Mietshauses hineingebaut. Ali öffnete die Tür und betrat den Schankraum. Das ›Geschlossen‹-Schild klapperte metallisch an der Glastür. Heute war Ruhetag. Von seinen zahlreichen Abenden als Aushilfskellner kannte Ali nicht nur die Speisekarte, sondern auch die italienischen Schlagerkassetten auswendig. Die Luft in der Pizzeria war schwer. Normalerweise roch es nach kaltem Rauch, Knoblauch, abgestandenem Bier. Mit seinen geschwollenen Nasenschleimhäuten spürte Ali den Mief mehr, als er ihn roch.
In der Wohnung hinter dem Restaurant saßen Angelo und seine Mutter Sophia am Esstisch. Angelo war Alis bester Freund. Sie waren zusammen zur Schule gegangen. Angelos Familie hatte den elternlosen Ali quasi adoptiert. Sophia blätterte in einem Ordner mit Rechnungen. Der Fernseher lief, und Sophias Bruder, Onkel Roberto, lag davor in seinem Sessel, in der Hand eine Bierflasche. Ali warf seinen Rucksack in die Ecke. Sophia stand auf.
»Ciao, mein Junge.« Sie küsste ihn auf die Wange. Bekam diesen mütterlichen Blick. Drückte ihm ihren kühlen Handrücken gegen die Stirn. »Du bist ja ganz heiß! Jetzt isst du was, und dann ab ins Bett.«
Er nickte matt. Hinter Sophias Rücken wies Angelo mit dem Kinn auf Onkel Roberto.
»Schon gut, Sophia.« Ali schob sie beiseite, trat hinter Robertos Sessel und legte dem Onkel die Hand auf die Schulter.
»Ciao, Roberto«, sagte er. »Wie geht’s dir heute?«
Der Italiener wandte langsam den Kopf. Onkel Roberto war kaum 50 Jahre alt. Er hatte Darmkrebs. Inoperabel. Die Medikamente ließen sein Haar büschelweise ausfallen. Weiße Bartstoppeln bedeckten sein hageres Gesicht. Die hellbraunen Augen waren wässerig und blutunterlaufen. Und Roberto hatte wieder getrunken.
»Ali?« Ein glückliches Lächeln huschte über sein Gesicht. »Schön, dass du da bist. Was kochen wir morgen, was meinst du?«
Angelos Onkel würde sterben. Dem Onkel selbst war das vermutlich genauso klar. Aber Roberto war tapfer. Wie konnte Ali da weniger tapfer sein? Er klopfte Roberto auf die knochige Schulter. »Ich mache mir einen Kamillentee«, sagte er. »Willst du auch einen?«
Roberto nickte. »Si, mein Junge. Nett von dir. Tee wäre schön.«
berlin, bahnhof zoologischer garten
montag, 28. juni 1993, 17.09 uhr
Sein Körper musste funktional bleiben für den Kampf. Aber das rechte Auge war ein Problem. Es schwoll im Schlaf unvermittelt an und schmerzte. Michael Glass sah rechts manchmal nur noch eine Bildstörung wie im Fernsehen. Zum Arzt konnte er nicht. Erstens wegen der Meldepflicht für Schussverletzungen. Zweitens weil er tot war.
Er hasste es, in der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo zu übernachten, mit einer Isomatte auf dem Boden, zusammengerollt unter einer säuerlich feucht riechenden Wolldecke. Aber nach der Nacht im Zug hatte er irgendwo unterkommen müssen, wo ihn nicht jederzeit die Polizei aufgreifen konnte. In der Bahnhofsmission stank es nach Pisse, ungewaschenen Menschen, nassen Hunden. Andererseits war die Notunterkunft umsonst. Ein Illegaler konnte nicht wählerisch sein. Der Sold für Fighter wie ihn war kaum der Rede wert. Jeder Pfennig musste mühsam dem Kapital abgetrotzt werden – Lösegelder, Banküberfälle. Glass war oft genug selbst auf Beschaffung aus gewesen. Geld war kostbar, ein Machtfaktor. Nur Salonaktivisten wie Andreas Baader hatten sich schnelle Autos und Urlaub in Paris gegönnt.
Überhaupt führten ihm die Genossen den Kampf zu unernst. Das Revolutionäre war nur noch die Handhabung der Waffen, die Verweigerung sozialer Möglichkeiten – inhaltsleer, ein formaler Akt. Man hatte sich in der Bewaffnung eingerichtet. Sogar T-Shirts mit RAF-Logo konnte man schon kaufen. Als wären sie Popstars. Das kam dem Ausverkauf der Ideale gleich. Glass hatte von Fightern gehört, die Heidelbeeren einkochten, Tonbänder besprachen und beides nach Hause schickten, mit der Feldpost zwar, trotzdem erbärmlich sentimental. Für ihn galt die totale Isolation. Er hielt fest am Dogma der ersten Generation: Wenn ein Guerilla in den Untergrund abtauchte, sagte er sich vom Bürgerlichen los. Glass’ illegaler Status war nicht selbst gewählt, dafür umso radikaler. Keiner vermisste ihn. Selbst seine Frau war weitergezogen, zeigte Systemakzeptanz, stellte die Machtfrage mit dem System nicht mehr. Ein Guerilla abstrahierte vollkommen von sich. Er allein konnte das System überwinden. Und Michael Glass war das personifizierte Unerwartete. Denn Michael Glass war seit 22 Jahren tot.
Er quälte sich hoch, draußen war es bereits Nachmittag. Glass ging aufs Klo, putzte sich mit Handwaschseife und Zeigefinger die Zähne. Im Spiegel sah er ein hageres Gespenstergesicht, unrasiert, mit einem toten rechten Auge. An der Wand hing ein Schild: Drei Mark wollten sie fürs Duschen und für Seife extra. Das war Mehrwertaneignung. Den Tippelbrüdern wollte man hier für ein bisschen Wasser das letzte Geld abpressen. Glass’ nasse Finger kämmten das halblange, dunkle Haar über die ausgefranste Narbe hinterm Ohr.
An der Essensausgabe schob ihm ein Adjutantencharakter Tee und Streuselschnecken über den Tresen. Beim Herunterschlingen würgte Glass die Vorstellung, das Gebäck sei eine Spende des Großkapitals. Der Tee schmeckte wie Krankenhausplörre. Er musste hier raus, die Waffe aus dem Bahnhofsschließfach holen, seine Kommandomission erfüllen.
Glass trat auf den Platz vor dem Bahnhof Zoo. Von hier waren es nur hundert Meter bis zu den Elefantengehegen. Er hörte die Kamele hinter den Zäunen blöken. Tiergeruch verpestete die Luft.
Glass schlenderte durch die Eingangshalle des Bahnhofs nach hinten zu den Schließfächern. Die rote Digitalanzeige an der Tür seines Fachs zeigte zwölf Mark seit gestern Abend. Er griff in die Tasche, zählte sein Kleingeld, kam nur auf zehn Mark. Unfassbar. Mit zehn Mark in der Tasche sollte er einen Verräter passiv stellen. Enttäuschung und Selbstekel legten sich wie Würgehalsbänder um seinen Schlund. Aber Wut war bourgeois und sinnlos weibisch wie alle Emotionen. Glass war ein guter Taschendieb. Wie ein selbstvergessener Apologet drückte er sich bei den Reisebedarfsläden herum. In der ›Internationalen Presse‹ fiel ihm die Erbärmlichkeit der Bahnreisenden auf. Wer irgend konnte, reiste heutzutage im eigenen Pkw – ein Luxus, der ihn hilflos machte. Zwischen den Zeitungsstapeln stank es nach Druckerschwärze, Druck und Schwärze, eine zynische Allegorie. Vor einem Regal blätterte eine warzige Alte mit abgenutztem Koffer in einem Frauenblatt der Springer-Presse. Opfer der Agenda-Setting-Funktion der Mediengewalt. Das rechtfertigte den Einsatz von Diebstahl als revolutionärem Gewaltmittel. Glass sagte sich das vor wie ein Mantra. Aber Politik und Moral mussten eine nahtlose Einheit bilden. Als die Alte eine Waschmittelprobe aus dem Heft stahl, verging Michael Glass das Nützlichkeitsdenken. Er konnte das Geld armer Leute nicht nehmen, ihm fehlte die Gewissheit des Sieges. So widerstand er, denn das Widerstehen war die höchste aller Tugenden. Glass hatte Zeit. Er stahl einen SPIEGEL und Zigaretten und erwartete die Dämmerung.
berlin, pizzeria napoli
montag, 28. juni 1993, 17:38 uhr
Die Küche der Pizzeria war eng, die offenen Regale voller Geschirr. Das dumpfe Gefühl von stickiger Luft ließ Ali würgen. Er stieß die Tür zum Hof auf, griff nach dem Teekessel. Als er den Zündknopf am Gasherd drückte, geschah nichts. Ali probierte alle Flammen durch. Schließlich gab er auf und goss das Wasser in den elektrischen Wasserkocher.
Während Ali wartete, bis das Wasser heiß genug war, betrachtete er das gelbstichige Farbfoto an der Wand. Sophia, ihr Mann Toni und ihr Bruder Roberto posierten mit einem weißen Messerschmitt-Kabinenroller vor einer Berglandschaft. Ali hatte Angelos Vater Toni nicht mehr kennen gelernt. Er war nun schon seit fast 20 Jahren tot. Ein Arbeitsunfall – ein Stahlträger hatte ihn erschlagen. Und nun würde auch Roberto sterben, ohne nach Hause zurückgekehrt zu sein. Ob Roberto Italien noch einmal sehen wollte? Ali würde ihn fragen, sobald der Tee fertig war. Sie könnten ein Auto mieten. Am Wochenende wären sie in Sorrento.
Der Dampf des kochenden Wassers machte die Luft noch schwerer. Ali hustete qualvoll. Er sah Sternchen, hielt sich am Kühlschrank fest. Seine Stirn war feucht und heiß. Zitternd schloss er die Tür zum Hof. Dann goss er zwei Teebeutel auf.
Im Wohnzimmer entwand er Onkel Roberto die Bierflasche. »Der Herd funktioniert nicht«, sagte er.
Angelo seufzte. »Kannst du’s reparieren? Sonst können wir morgen nicht öffnen.«
»Nichts da.« Sophia schob Ali zur Tür. »Dein Freund geht jetzt ins Bett. Und wir beide schauen nach, ob beim Installateur in der Koloniestraße noch jemand ist. Auf dem Rückweg können wir gleich noch ein bisschen was einkaufen für morgen.«
berlin, bahnhof zoologischer garten
montag, 28. juni 1993, 18:15 uhr
Michael Glass würde die Berliner Bank zu einem Mitglied der RAF-Unterstützerszene machen. Nur ein paar Hundert Meter hinter dem Bahnhof lag an der Hardenbergstraße die Zentrale des Geldinstituts. Davor standen auf einem Parkplatz unter Kandelabern dicke Limousinen. Es dämmerte bereits. Irgendwann würde ein Mitglied des Großkapitals zu seinem Wagen gehen. Dann würde Glass sein Geld requirieren und seine unfreiwillige Selbstentwaffnung endigen.
Er lehnte sich an eine Straßenlaterne, rauchte, blätterte im SPIEGEL und wartete mit der Geduld eines Tierfotografen auf die entscheidende Zehntelsekunde. Glass las gern im SPIEGEL, der sich mit Akribie zu seinem Chronisten gemacht hatte, ohne es zu ahnen oder zu wollen. Diese Ausgabe brachte einen Artikel über den geplanten fälschungssicheren Personalausweis, die Antwort des Innenministeriums auf die Dokumentenfälschungen der RAF. Das passte zu der Aktion, die Glass durchziehen würde, sobald er seine Waffe wiederhatte. Zuerst würde er den Ex-Genossen Dieter Sonnenstein enteignen. Sonnenstein diente nur zum Warmlaufen, ein im Grunde harmloser Geläuterter, der die Trennlinie zwischen sich und dem Feind nicht mehr allein ziehen konnte. Und dann würde Glass Martin Landauer suchen, finden und neutralisieren.
Für Landauer war Kampf mehr als die Bereitschaft zur Bewaffnung. Jemand, der kein Problem hatte, sondern das Problem war. Ein V-Mann des Verfassungsschutzes vielleicht, oder vielleicht hielt er sich für die nächsthöhere Instanz. Glass wusste es nicht. Landauer hatte sich im Umfeld der RAF-Kader installiert und ihr Vertrauen abgesogen wie eine Zecke das Blut ihres Wirtes. Dann verschwand er, und mit ihm sein Täterwissen und eine Kiste Blanko-Ausweisformulare. Das durfte nicht ungesühnt bleiben. Die RAF konnte nicht verraten werden. Wer verraten werden konnte, war im Kern verrottet, verloren. Aus der Unterstützerszene hatte Glass Namen und Adresse von Landauers letzter Freundin erfahren, eine günstige Adresse in einem anonymen Wohnblock in Marzahn-Hellersdorf.
Drüben bei der Berliner Bank glitt das Eingangsportal auf. Ein fetter Blonder im mitternachtsblauen Anzug mit ondulierter Tolle schlenderte über den Parkplatz. Ein fast noch junger Mensch, aufgeschwemmt vom Rausch des Lebensglücks, sich im mittleren Management einer Großbank verortet zu haben. Betont unauffällig durchquerte der Kapitalist die Lichtkegel der Kandelaber wie ein Minenfeld an der ehemals innerdeutschen Grenze. Sein Hüftspeck, in Gourmetrestaurants angefressen, flapperte im Rhythmus entschiedener Schritte. Der Mann ging hinüber zum Bahnhof.
Michael Glass folgte ihm. Angesichts des Großkapitals kannte er keine Skrupel, denn auch der Anzugträger hatte keine. Flott bog der Fette in die schummerige Jebensstraße. Begann nach ein paar Metern eine Preisverhandlung mit einem blutarmen Strichjungen.
Glass ging das durchs Herz wie ein Eiszapfen. Die Gegenseite musste nicht mehr reflektiert werden, das waren krankhafte Idioten mit Systemakzeptanz, ohne jede Subjektgrundlage. Michael Glass entsann sich der Kompromisslosigkeit als revolutionärem Machtmittel, fasste sich, rannte den Fetten zu Boden, fing ihn auf, entschuldigte sich wortreich. Während Michael Glass dem pädophilen Schwein mit einer Hand süßlich lächelnd den Jackettkragen sauber klopfte, ließ er mit der anderen Hand dessen Brieftasche in der Gesäßtasche seiner Jeans verschwinden. »Einen schönen Abend noch«, wünschte Glass.
Nun, die avantgardistische Revolte ließ keine schönen Abende zu. Fünf Minuten später fütterte Glass den Geldschlitz am Schließfach mit grimmiger Vehemenz. Er riss die Tür auf, holte seinen Rucksack heraus, darin eine 9 Millimeter Parabellum-Bruenner CZ M 75 und mehrere Packungen Munition.
Glass verließ den Fernbahnhof und lief zur U-Bahn hinüber. Er fühlte sich ruhig, fokussiert. Angst war eine Emotion und als solche zu negieren. Das Leben war bei Weitem nicht das höchste Gut eines Revolutionärs.
berlin, pizzeria napoli
montag, 28. juni 1993, 18:32 uhr
Ein weißer Dampfer fuhr bei strahlendem Sonnenschein durch eine Flussauenlandschaft, an Deck sang ein Chor. Dann war die schöne Musiksendung zu Ende. Onkel Roberto kämpfte sich aus dem Fernsehsessel hoch. Ali war wirklich ein netter Junge, aber Robertos Leben war nicht mehr lang genug für Kamillentee. Er schlurfte über den Flur in die Küche, nahm ein Bier aus dem Kühlschrank und prostete Toni auf dem Foto zu. Wart’s ab, Toni, bald komme ich, dachte er.
Roberto fühlte keine Bitterkeit. 20 Jahre lang hatte er für seinen Schwager Toni Vaterstelle an Angelo vertreten, und aus Angelo war ein guter Junge geworden. Gut, aber schüchtern. Wenn Roberto tot war, würde Ali auf Angelo aufpassen müssen. Ali hatte keine Eltern, war im DRK-Heim in der Drontheimer Straße aufgewachsen. Sophia und er liebten ihn wie einen Sohn. Roberto hoffte, dass Gott ihm das bei der großen Abrechnung auf der Habenseite anschreiben würde. Er kramte eine zerknüllte Packung filterloser Zigaretten aus der Hosentasche. Seine Hände zitterten. Er brauchte drei Versuche mit dem Feuerzeug. Das silberne Rädchen ratschte über den Feuerstein. Ein Funke, ein Fauchen, und das Letzte, was Onkel Roberto in seinem Leben sah, war, dass die Luft um ihn herum brannte.
berlin, pizzeria napoli
montag, 28. juni 1993, 19:47 Uhr
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Polizei. Löschzüge sperrten die Straße. Menschen in Bademänteln standen in kleinen Gruppen, tranken Kaffee aus Pappbechern. Rot-weißes Absperrband flatterte im Wind.
Das Haus Soldiner Straße 45 lag im Dunkeln. Die Fassade im Erdgeschoss fehlte. Fahlblau huschten Taschenlampenkegel hinter scheibenlosen Fensterkreuzen. Das Innere der Pizzeria lag offen da wie ein Zimmer in einem Puppenhaus. Zwei Sanitäter schoben eine Trage mit einem grauen Plastiksack in einen Krankenwagen. Vermutlich roch es noch immer nach Gas, aber das wusste Ali nicht. Sein Kopf schwebte wie ein heliumgefüllter Ballon. Angelo, Sophia und er saßen im Innern eines Polizei-Busses. Ali hatte sich nicht ausweisen können – seine Papiere waren in seinem Rucksack, und der stand noch immer im Wohnzimmer, begraben unter Schutt und den Deckenbalken des ersten Stocks. Sein Mund war trocken, sein Herz raste. Das rotierende Blaulicht schmerzte in seinen Augen. Er sah, was geschehen war, aber es drang nicht in sein Bewusstsein. Angelo hielt Sophia im Arm, die still vor sich hin weinte. Ali hoffte, dass sie ihre Versicherungen bezahlt hatte. Ein junger Beamter stieg über das Absperrband. Der Bus ging in die Knie, als er einstieg. Er warf sich neben Ali auf die Bank.
»Kriminalpolizei«, sagte der Mann und zog für Sekundenbruchteile seinen Dienstausweis aus der Brusttasche. »Lanz. Ich leite hier die Ermittlungen.« Lanz wies mit dem Kopf auf Sophia. »Ihre Mutter?« Angelo nickte und zog sie fester an sich.
»Mein Beileid.« Lanz blätterte in den Papieren auf seinem Klemmbrett. »Die Explosion war kein Unfall. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.«
Sophia riss die Augen auf. »Nicht? Ja, aber – wieso?«
Dieser Lanz war kaum älter als Ali, aber er hatte so eine zackige, routinierte Art, die ihn ganz schwindlig machte.
»Die Spurensicherung hat einen Sachverständigen angefordert. Der Zuleitungsschlauch zum Herd war ab. Das Gewinde der Verschraubung ist unbeschädigt. Das heißt, es war bereits vor der Explosion ab.« Lanz sah in die Runde. Er liebt seinen Job, dachte Ali.
»Also Mord oder Selbstmord, Herrschaften. Deshalb meine Frage: Ist Ihnen an Ihrem Bruder in letzter Zeit etwas Besonderes aufgefallen?«
Angelo lachte bitter.
»Er hatte Darmkrebs im Endstadium«, sagte Sophia leise.
Lanz musterte sie streng und machte eine Notiz. »Hat er über Selbstmord gesprochen?«
»Er war ein tiefgläubiger Katholik, Herr Kommissar«, sagte Angelo würdevoll.
»Katholiken bringen sich nicht um.«
»Träumen Sie weiter.« Lanz drehte sich zu Ali um. »Und Sie? Alibi?«
»Ich war auf dem Weg ins Bett.« Ali musste sich zwingen, ruhig zu bleiben. »Hab mir was eingefangen.«
»Frau Di Nardo, Sie wussten, dass der Herd nicht in Ordnung war?«
Sophia nickte. »Wir wollten den Installateur holen.« Die Wahrheit hörte sich plötzlich nach fahrlässiger Tötung an. Was tun? Die Welt drehte sich um Ali.
»Wir haben Herrn Di Nardo neben dem Herd gefunden«, sagte Lanz. Sein Blick wurde stechend. »Er hatte ein Feuerzeug in der Hand.«
Ali hob die Schultern. »Roberto war Raucher.«
Lanz schüttelte den Kopf. »Die Explosionsgrenze für Erdgas liegt bei einer Sättigung zwischen fünf und 15 Prozent. Ist es mehr, ist zu viel Gas für eine Explosion vorhanden – ist es weniger, fehlt der Sauerstoff.«
»Lernen Sie das auf der Polizeischule?«, fragte Ali.
Lanz nickte. »Und wir lernen auch: Wer einen Mord begeht, hat ein Motiv. Was war es bei Ihnen?«
»Zufall?«
»Erzählen Sie keine Märchen. Das THW hat noch nach der Explosion in den Trümmern der Küche eine Erdgassättigung von 13 Prozent gemessen. Unmittelbar an der Austrittsstelle. Wenn Sie vor der Explosion den Zündknopf des Herds betätigt hätten, wie Sie sagen, dann wäre Ihnen das Haus um die Ohren geflogen.«
»Ich hatte die Tür zum Hof auf«, sagte Ali. Das Fieber schüttelte ihn so, dass er nur mit Mühe ein Zähneklappern verhindern konnte. »Ich konnte kaum atmen in der Küche.«
»Wie roch es denn? Nach faulen Eiern?«
Ali schüttelte den Kopf. Gerochen hatte er nichts. Es war mehr ein Erstickungsgefühl gewesen. »Vielleicht war der Zünder kaputt?«, fragte er.
»Sie hätten das verdammte Gas riechen müssen. Warum haben Sie nicht reagiert?«
Ali starrte Lanz an. Sein Gehirn brannte.
»Er hat Fieber«, sagte Sophia leise.
Die ganze Szenerie drehte sich um Ali, schnell und schneller. »Ich habe einfach nichts gerochen«, sagte er matt.
Lanz grinste. »Bullshit. Das muss ein Arzt bestätigen. Sonst kommen Sie damit nicht durch.«
Angelo stand auf. »Ich schaue nach, ob der Notarzt noch da ist.« Er verschwand in Richtung des Rettungswagens.
Lanz wandte sich wieder an Sophia. »Nehmen wir einmal an, es war doch Selbstmord. Dann sind Sie als Inhaberin des Restaurants dem Hauseigentümer gegenüber schadenersatzpflichtig. Und denken Sie nicht, Sie sind dagegen versichert.«
Sophias Augen weiteten sich. Lanz lächelte. »Die Wahrheit ist: Wer sich umbringt, indem er absichtlich eine Explosion herbeiführt, handelt grob fahrlässig. Die Versicherung kann ihre Leistungspflicht verneinen, wenn grobe Fahrlässigkeit vorliegt und nur der Versicherungsnehmer als Täter in Betracht kommt. Als Ihr Angestellter war Ihr Bruder an seinem Arbeitsplatz in der Küche für Sie tätig. Man nennt das einen Erfüllungsgehilfen. Das lernen wir auch auf der Polizeischule.« Lanz zog die Schultern hoch. »Und für Selbstmord reicht ein Indizienbeweis nach Paragraf 286 Zivilprozessordnung.«
»Sie werden’s noch weit bringen.« Ali legte den Kopf auf den Unterarmen ab.
»Das ist der Plan«, sagte Lanz. »Ja, Frau Di Nardo, also Mord oder schuldhafte Herbeiführung eines Versicherungsfalls.«
Sophia lächelte unsicher. »Das heißt, ich muss das hier alles bezahlen?«
Die Hausfassade war eingerissen bis hinauf zum vierten Stock. Das kostet eine halbe Million, dachte Ali. Wie komme ich an so viel Geld?
potsdam, am neuen garten
dienstag, 29. juni 1993, 5:45 uhr
Grendel war ins Auto gestiegen und nach Potsdam gefahren. Er hatte Bonn satt. Schön, sie würden ihn hierher versetzen, aber im Grunde war es eine Heimkehr. Die Gründerzeitvilla am Neuen Garten, das Stadthaus seiner Familie, war ihm gleich nach der Wende rückübereignet worden. Er hatte sie sanieren lassen, nun würde er den Lebensmittelpunkt der Familie wieder hierher verlegen. Es fühlte sich richtig an.
Er betrat das Arbeitszimmer, an dessen Wand ein Schwarz-Weiß-Foto in einem Goldrahmen hing. Es zeigte eine mittelalterliche Burganlage.
Der Staatssekretär trat auf den Balkon, genoss den hochherrschaftlichen Blick in den Landschaftsgarten und rauchte eine Mentholzigarette, während der Morgen dämmerte. Vom Personal noch unbemerkt, hatte er einen Aschenbecher zwischen dem üppigen Männertreu platziert. Seine Frau hatte das Rauchen im Haus strikt untersagt. Er ließ ihr oft in kleinen Dingen ihren Willen, aus taktischen Gründen.
Durch die geöffnete Balkontür konnte Grendel das Foto sehen. Es zeigte die Burg Auenwehr vom Fluss her, 1944, im Vordergrund blühten Schilfrohr und Iris im Burggraben. Die Festung war im Krieg beschädigt worden. Dann kam die DDR, Junkerland in Bauernhand, und nun gehörte Grendels Familie die Burg nicht mehr, enteignet, Jahrhunderte der Arbeit und Plackerei ausgelöscht. Nur das Foto war ihm geblieben.
Als vor elf Jahren die Zwillinge geboren wurden, hatte Grendel das Foto aus dem Rahmen nehmen und reproduzieren lassen. Es sollte nicht verbleichen oder verloren gehen. Ein Exemplar hing in seinem Büro in Bonn, ein weiteres bewahrte er in seinem Bankschließfach auf. Frank und Claudia, die Zwillinge, machten sich hervorragend in der Schule, sie mussten Jura studieren. Grendel würde ihnen eine gemeinsame Kanzlei einrichten. Oder er ebnete ihnen den Weg bei einem von den großen Vereinen. Eine Wirtschaftsberatung, ein Energiekonzern oder die Pharmaindustrie.
Grendels jüngste Tochter Lilly hingegen war erst zehn. Sie schlug nach seiner Frau Maren. Eine Träumerin mit schlechten Schulnoten, außer in Sport. Das Mädchen liebte ihn bedingungslos, das war ihm verdächtig. Die Zwillinge hatten immer etwas gewollt, von Anfang an, fördern und fordern. Grendel machte sich Gedanken über Nachhilfe für Lilly. Wenn er hierher zog, wollte er nicht morgens in den Potsdamer Neuesten Nachrichten lesen, dass seine jüngste Tochter irgendwie entrückt war.
Das Telefon klingelte. Grendel drückte die Zigarette aus, setzte sich hinter seinen Schreibtisch und hob ab. »Ja?«
»Schauen Sie sich die Frühnachrichten an«, flüsterte eine heisere, müde Stimme. »Explosion am Wedding. Wird Ihnen gefallen.«
berlin, rehberge
dienstag, 29. juni 1993, 10:23 uhr
Im Park übernahm der Sommer die Macht, spät in diesem Jahr. Der Sommereinbruch sprengte das Holz, platzte aus dem Eis, brach den Landfrieden, legte Feuer in der Stadt, agitierte und kämpfte: Der Frühling sollte zur Hölle fahren. Die Natur zeigte kollektiven Willen zum Aufbruch. Die Sonne schien, es war ihre Pflicht zu scheinen. Zwischen den Parkbänken am Plötzensee ging die Gestalt des Michael Glass auf und ab. Er musste sich in der Konfrontation durchsetzen, seinen Hass in Energie verwandeln, jetzt, hier, hinter dem Holundergebüsch.
Michael Glass wartete auf Dieter Sonnenstein. Dieter hatte 25 Jahre abgesessen. Die herrschende Klasse hatte die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt. Zu Unrecht. Über 9.000 Tage im Knast. Isolationsfolter. Keine Hafterleichterung. Schon gar kein Freigang. Jetzt war er alt, fertig, kaputt, hatte ein Gnadengesuch beim Bundespräsidenten gestellt. Und die Gnade war über Dieter hereingebrochen wie der Sommer über den Park. Kurz vor Weihnachten kam er frei. Gab Interviews, machte Fotos, hatte plötzlich Geld, Wohnung, einen Hund, sogar Urlaub nehmen wollte er. Urlaub wovon? Wie konnte jemand, der kämpfte, Urlaub machen? Dieter war labil. Glass musste aufpassen. Dieter wusste zu viel. Glass würde ihm zeigen, wie man schwieg.
Da kam Dieter schon die Allee herunter, in seinem Trenchcoat und den schicken Schuhen, an der Leine einen Mops. Alt und dick war Dieter geworden. Hatte keine Haare mehr. Fast wollte Glass ihn passieren lassen, aus einer plötzlichen bourgeoisen Mitleidsregung heraus. Aber erst im Kampf zeigte sich, wer kämpfen wollte. Glass trat auf die Allee. Dieter sah ihn. Erkannte ihn sofort. Fiel auseinander. Stierte hektisch um sich. Zerrte am Mops. Wurde totenbleich. Wollte abhauen.
Glass genoss die Reaktion. Lächelte leise. »Erinnerst du dich?«, fragte er.
»Aber … dich haben sie doch … du bist doch …« So stotterte der stolze Kader von einst und stolperte wer weiß wie ungeschickt rückwärts.
»Ich bin tot, Dieter.« Michael Glass gab es zu. »Vor mir kannst du nicht wegrennen.«
Dieter japste. »Was willst du von mir?« Bekam hektische Flecken.
»Freust du dich denn gar nicht, mich wiederzusehen?«
Dieter war ein Waschweib, kein Schauspieler. »Nicht doch, nein«, jammerte er. »Ich will nicht mehr. Ich hab’s abgesessen. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben! Nie mehr!«
»Euch?« Glass spuckte aus. »Bei uns kann man nicht aussteigen. Wir glauben an etwas. Das ist wie mit dem Papst. Steigt der Papst aus?«
Der Schweiß stürzte Dieter über die kahle Stirn. Er zitterte zum Gotterbarmen. »Ich mach nicht mehr mit, Micha.«
Glass lachte. »Was für ein Leben soll das sein, das du jetzt führst? Hast Bruchsal mit den Fernsehstudios getauscht? Bedienst die Oral-History-Junkies?«Dieter Sonnenstein krümmte sich und wand sich. »Ich sag nur, was die anderen nicht belastet«, greinte er.
Glass schüttelte den Kopf. Trat viel zu dicht an Dieter heran. »Du kapierst die strategische Linie nicht. Du bist geschult, checkst es trotzdem nicht. Du sprichst mit niemandem mehr. Noch ein einziges Interview, egal, warum, egal, worüber – und ich zeig dir, wie es ist, tot zu sein.«
Sonnenstein starrte ihn an. Seine Augen wurden rot wie die Blütenblätter des wilden Mohns. Er setzte sich mitten auf den Weg, schlug den Boden mit der flachen Hand wie ein trotziges Kind. Und heulte. Der Mops glotzte blöde. »Geh weg!«, schrie Dieter. Trommelte mit den Füßen. »Ich hasse dich!«
Glass ging in die Knie, hockte dort Auge in Auge mit Dieter und dem Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Dieter flennte wie ein kleines Kind. Glass schaute zum See hinüber, unter den Bäumen wogten die Wildblumen, sein Magen schmerzte, zuletzt hatte er in der Bahnhofsmission gegessen. Er durfte nicht mehr lange warten. Glass brauchte mehr Geld. Die Börse des Bankers hatte nur aus einem Hunderter für den Stricher bestanden, ansonsten Kreditkarten. Der Hunderter war für das Schließfach und den Rückfahrschein draufgegangen.
»Weißt du noch?«, sagte Glass schließlich. »Wie du versucht hast, Maren fertigzumachen, weil sie Coca Cola getrunken hat? Du fandest das konterrevolutionär. Hast gesagt, Maren würde den Imperialisten in die Hände spielen. Ich hab dir deine Haschzigaretten vorgehalten. Du wolltest mich verprügeln. Wir hatten es noch nie mit der Gewaltfreiheit.«
Dieters Kinn wabbelte mit seiner Unterlippe um die Wette. »Das ist 30 Jahre her, Mann!«, schrie er. »Wir waren Kinder damals! Hau endlich ab! Verpiss dich!«
»Hast du Angst?« Glass lachte. »Zu Recht. Die Revolution wird nicht unblutig untergehen.«
»Du bist doch verrückt, Mann!«, schrie Dieter. »Verschwinde! Ich hab nur ein Leben, und davon ist nicht mehr viel übrig!«
»Bald schon kann es ganz vorbei sein«, sagte Glass. »Und wäre das schade? Nein. Du verkaufst dich an das Kapital wie ein Lohnabhängiger. Das ist Zeitverschwendung, das ist reaktionär.«
»Ich will mit Politik nichts mehr zu tun haben!«, jaulte Dieter.
Michael Glass appellierte ein letztes Mal an Dieters Solidarität. Dieter lachte hysterisch wie ein Wahnsinniger. Warum gerade seine Solidarität? Er wolle seine Ruhe, heulte er, er wolle nur noch die bürgerliche Freiheitsillusion! Seinen Mops wolle er und seinen Sohn. Schnodderblasen hingen aus Dieters Nase. Glass begriff, es hatte keinen Zweck, den falschen Leuten das Richtige erklären zu wollen. Kampf war keine Phrase. Er griff Dieter in den Trenchcoat, zog ihm das Portemonnaie aus der Tasche. Dieter schnappte danach, griff ins Leere, die Augen rund vor Schreck. Glass nahm sein Geld, enteignete ihn, viel Geld, er drehte es auf wie einen Fächer.
»Für die Befreiungsfront«, sagte er und lachte.
Dieter zeterte: »Diese Wichser sollen selbst sehen, wie sie klarkommen!«
Glass hatte die Selbstabstraktion noch nicht perfektioniert. Plötzlich flog ihn eine große Zärtlichkeit an. Er wusste, im Grunde konnte Dieter nichts dafür. »Warum stehst du nicht mehr zu dem, woran du früher geglaubt hast?« Glass steckte das Geld ein, stellte die Gretchenfrage einzig als Tribut an die alten Zeiten, ohne jede Hoffnung.
Dieter heulte und schlug nach ihm. Nur die Ruhe. Schließlich war er schon über 60. Glass fasste ihn unter, er half ihm auf, sah die Allee entlang auf den Park, sein blindes Auge pochte, eine Spottdrossel sang, als gelte es das Leben. Dieter zerfloss unter seinen Händen. Er wurde so weich, Glass musste ihn fast zu einer Bank tragen.
Glass hielt seinen Arm. Dieter stank vor Angst. Er gierte nach Luft, zitterte, als wolle er sterben. Hatte aufgehört zu flennen. Glass lauschte der Stille.
»Ich will nur noch eins im Leben, Micha: meinen Sohn wiedersehen«, sagte Dieter nach einer Weile, ganz ruhig plötzlich. »Er lebt in Amerika. Deshalb brauche ich das Geld. Verstehst du?«
Der Mops legte den Nacken in Falten und schaute lieb. Wer würde auf den Mops aufpassen, wenn Dieter nach Amerika flog? Nicht Worte – die Tat allein machte den Menschen frei. Glass stand auf. Schmiss Dieter das Geld in den Schoß. Er wusste nicht, wo er heute Nacht schlafen geschweige denn, wann er wieder essen würde. Nachher würde er rauchen, gegen Hunger und Schmerzen.
bonn, innenministerium
montag, 12. Juli 1993, 18:12 Uhr
Es war dunkel im Besprechungszimmer. Der Overheadprojektor summte, es roch nach verbranntem Staub. Hans Grendel hatte ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild an die Wand geworfen. Es zeigte den Bahnhofsvorplatz von Bad Kleinen vor zwei Wochen. Ein großer, schlanker Mann lehnte mit verschränkten Armen an einem Opel Kadett. »Das Foto hat der Observationsbeamte gemacht«, sagte er. »Dieser Mann hier ist den Kollegen aufgefallen, aber nach dem Zugriff war er verschwunden. Wenn wir noch eine Viertelstunde gewartet hätten, hätten wir ihn auch gehabt.«
»Sie sind hier nicht mehr zuständig«, gab der kahlköpfige Mann zu bedenken, der am Türrahmen lehnte. »Ich schau mir das Foto hier nur mit Ihnen zusammen an, weil wir schon so lange zusammen arbeiten.«
»Ich muss das wissen, Dr. Verhoeven. Ich habe damals die Aktion geleitet, bei der er angeblich erschossen wurde.«
»Michael Glass müsste dann jetzt seit über 20 Jahren in der Illegalität leben«, sagte Verhoeven. »Wie wollen Sie ihn finden?«
Grendel hob den Zeigefinger. »Sagen Sie es mir. Ich habe gehört, Sie waren bei einer Schulung zum Profiler? Diese neue Methode aus Amerika.«
Verhoeven kratzte sich mit dem Kugelschreiber hinter dem Ohr. »Glass ist ein Narzisst«, stellte er fest. »Er hält sich für den Erfüllungsgehilfen einer übergeordneten Macht, die seine Taten sanktioniert. Somit sind alle Gewalttaten erlaubt, er kann sie genießen. Ich sehe emotionale Kälte, die Unfähigkeit, Beziehungen einzugehen, null Schuldbewusstsein. Westliche Demokratien wie Deutschland hält Glass für moralisch verkommen.« Dr. Verhoeven zuckte die Schultern. »Der Typus des lachenden Killers.«
Grendel zögerte. Sollte es so einfach sein? »Ich brauche einen konkreten Ansatzpunkt, den ich in eine Fahndungsmeldung für die Landespolizeien umschreiben lassen kann. Zum Beispiel, wo arbeitet so einer? Wo schläft er? Woher bekommt er Geld?«
Verhoeven schüttelte den Kopf. »Schwierig. Glass gilt als Experte für Bombenbau. So jemand ist handwerklich geschickt. Er kann nur ohne Steuerkarte arbeiten. Vielleicht auf dem Bau, da ist Schwarzarbeit üblich.«
»Scheiße, Verhoeven, geben Sie mir einen Tipp!« Grendel schlug auf den Tisch. »Sie wissen doch, dass ich hier persönlich involviert bin!«
Verhoeven seufzte. »Radikale neigen zur Selbstverdinglichung, der revolutionäre Kampf hat für sie anscheinend eine größere Bedeutung als das eigene Leben. Wenn der Kampf vorbei ist und die Gesellschaft sich nicht geändert hat, fragt sich der Revolutionär: Wie kann ich mit meinem Scheitern leben? Er erkennt, dass die revolutionäre Zelle nur ein funktionales Kollektiv war. Er ist allein. Und er muss sich in den Bedingungen einrichten, die er fundamental bekämpft hat. Einige schaffen es nicht. Andere ziehen einen Schlussstrich, wollen ein neues Leben. Sie werden privat, sentimental. Viele gehen ins Ausland, machen noch mal eine Berufsausbildung, besinnen sich auf ihre Familie, zu der sie oft seit Jahrzehnten keinen Kontakt hatten, oder wollen alte Freunde treffen. Unser Fall hier liegt anders. Michael Glass ist nicht aktiv. Fast so eine Art Schläfer. Was will er jetzt von den alten Kampfgenossen? Denn so wie Glass da an dem Auto lehnt, der wartet doch auf Hogefeld und Grams.«