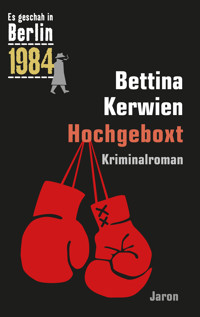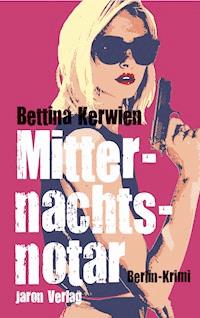
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Bewohner der idyllischen Reihenhaussiedlung „Am Rabennest“ in Reinickendorf sind auf hundertachtzig. Eine private Immobiliengesellschaft, die fest in der Hand der Familie Trasseur ist, hat ihre denkmalgeschützte Siedlung aufgekauft und will sie luxussanieren. Den Bestandsmietern wird mit horrenden Mieterhöhungen und Kündigung gedroht. Das löst ihren Protest aus. Doch dann hängt plötzlich der Hausmeister tot am Dachbalken. Hat er sich selbst umgebracht? Privatdetektiv Martin Sanders bezweifelt das. Der ehemalige Personenschützer mit dunkler Vergangenheit hat gerade sein eigenes Büro in Moabit eröffnet, als ihn sein Vater um Hilfe bittet. Der ist einer der Investoren der Immobiliengesellschaft und erhält seit einiger Zeit Drohbriefe, in denen er zum Sanierungsstopp aufgefordert wird. Auf einer Investorenparty, bei der die Siedlungsobjekte verkauft werden und der Mitternachtsnotar, das Familienoberhaupt der Trasseurs, die fragwürdigen Kaufverträge beurkundet, trifft Sanders die durchgeknallte Liberty Vale wieder. Sanders hat Libby bei seinem letzten Fall kennengelernt. Sie hat ihr Studium geschmissen, verdient sich ihren Lebensunterhalt als Escortlady und hat sich in Sanders verliebt. Als sie von Sanders’ Auftrag erfährt und zufällig in den Besitz eines Beweismittels gelangt, will sie ihn informieren. Aber dann kommt der Mitternachtsnotar ums Leben, und auch Libby gerät in Gefahr … Bettina Kerwien hat einen atemberaubenden Spannungsroman geschrieben, der Krimi, Actionroman und Liebesgeschichte in einem ist und das brisante Thema Gentrifizierung behandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Kerwien
Mitternachtsnotar
Berlin-Krimi
Jaron Verlag
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf
Vermittlung von BookaBook, der Literarischen Agentur
Elmar Klupsch, Stuttgart.
Originalausgabe
1. Auflage 2017
© 2017 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Carsten Tiemessen, Düsseldorf
Satz: Prill Partners | producing, Barcelona
E-Book-Herstellung Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-95552-234-6
Everything God does not want is mine.
Ted Hughes, Crow’s Feast
Für alle Rebellen
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat/Widmung
Verflucht
Momentversagen
Die Bombe
Der Herr Vater
Vorgeladen
Erweiterter Suizid
Doktor Selma
Familiengeheimnisse
Comeback
Reinickendorf steht auf
Die granatrote Dame
Wildes Herz
Ortstermin
Der Rädelsführer
Die Sehnsucht der starken Frau
Schmiergeld
Witwenschütteln
Abteilung Attacke
Mitternachtsnotar
Rechts- und ordnungswidrig
Nur geträumt
Spannungsrisse
Böses Geld
Einschreiben Rückschein
Californication
Liebe geht durch den Magen
Millionendorf
Hilflos
Aufgeschnitten
Ein bisschen Spaß muss sein
Besuchstag
Die Party
Fly Me to the Moon
Paradox
Hinein in die Nacht
Der Stewardessenkenner
Spree tut weh
Nächste Ausfahrt Kudamm
Kriegsberichterstatter
Das volle Programm
Das Gleichnis des ziehenden Wassers
Das Gefühl, alles erreicht zu haben
Das Schöne
Konfrontationsidentifikation
Ein Herz geht an Bord
Keine Angst vorm Fliegen
Frühstück im Mailicht
Leichengift
Der Fallschirm
Milchbrötchengefühl
Erdbeervergiftung
Spiel mir das Lied vom Tod
Der König der Welt
Die innere Weisheit der Waltraud T.
Ausgeschnitten
Der Besuch der jungen Dame
Nichts und wieder nichts
Amour fou
Kentuckys
Eine Hand wäscht die andere
Hasso
Das Ebenbild Gottes
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Schrei für mich
Leben und Sterben in Berlin
Handspiel
Die Frau, die den Regen liebt
Wir kommen in Ordnung
Vom Mehrwert der Moral
Gute Tage
Danke
Ebenfalls im Jaron Verlag erschienen
Verflucht
Berlin-Tegel. In den Vorgärten der Kleinhaussiedlung riecht es nach Ofenheizung und schlesischem Apfelkuchen.
Michael Waschke streckt seine Hand aus, in der er die nächste Kündigung hält. Sie ist erstaunlich ruhig. »Ich habe hier eine Zustellung für Sie.«
Magda Rausch wischt sich die Hände an der Kittelschürze ab. Sie setzt die Lesebrille auf und öffnet den Umschlag mit ihren dicken, roten, runzligen Fingern. Der Himmel über der Siedlung verdunkelt sich. Ein verrotteter Fensterladen knarrt im Wind. »Heute werde ich 85«, sagt sie mit ihrer Kleinmädchenstimme, während sie das Blatt Papier entgegennimmt und auffaltet. »Es gibt Apfelkuchen.«
Es gehört zu Michael Waschkes Pflichten, die Geburtstage aller Mieter zu kennen. Jedes Jahr an Weihnachten sitzt seine Frau mit den Kindern auf dem Schoß am Küchentisch und überträgt die Daten von einem Apothekenkalender in den nächsten.
Magda Rauschs papierene Lider zucken. Die alten Augen darunter sind veilchenblau. »Den Apfelbaum hinterm Haus hat der Otto gepflanzt, als er aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist.«
»Bitte unterschreiben Sie hier«, sagt Waschke. Er meint seinen eigenen Opa zu sehen, wie er plötzlich vor der Tür steht, nach acht Jahren Sibirien. Die Oma hat es ihm erzählt. Das Zustellprotokoll in der Sache Rausch flattert nervös in seiner Hand.
Magda Rausch zeigt Waschke ihre Goldzähne. »Nichts unterschreibe ich«, entgegnet sie. »Ich habe den Krieg und die Hitlerei überlebt. Ich habe die Mauer und die Blockade überlebt. Ich habe Otto überlebt. Ich werde auch das hier überleben.«
»Das tut mir wirklich leid.« Waschkes Stimme ist ihm tief in die Kehle gerutscht. »Die Häuser werden saniert, wissen Sie. Kamin, Swimmingpool, Wintergarten.«
»Deshalb können Sie mir kündigen?«
Waschke kann ihr nicht ins Gesicht sehen. »Nein, die Gesellschaft kündigt Ihnen, weil Ihr Garten vollkommen verwildert ist.«
Magda Rausch spuckt vor ihm aus. »Wissen Sie«, sagt sie, »Sie werde ich auch noch überleben.« Sie schlägt ein Kreuz.
Die Welt dreht sich plötzlich nicht mehr, und Michael Waschke sieht eine veilchenblaue Träne in Extremzeitlupe fallen. In der Träne spiegeln sich die Fassaden der idyllischen Kleinhaussiedlung. Steuern sparen mit Denkmalschutz-Immobilien in Bestlage, hört Waschke seinen Chef siegesgewiss schmettern. Und als die Träne neben den Krokussen auf den Plattenweg klatscht, gerät etwas in Michael Waschke ins Schlingern.
Er sagt noch einmal, dass es ihm leidtue, mehr zu sich selbst, und vielleicht geht es ihm auch mehr um sich selbst als um Frau Rausch. Dann macht er sich davon, geht über das Kopfsteinpflaster und zwischen den Forsythien hindurch. Das Laufen fällt ihm schwer, es ist ihm nie zuvor schwergefallen. Michael Waschke schleppt sich an den Vorgärten vorbei zu seiner Hausmeisterwohnung, wie ein alter Mann. Er staunt. Wie verwundbar er doch ist.
Momentversagen
Martin Sanders’ zukünftige Detektei ist klein und dreckig. Der Warteraum riecht nach nassem Hund. Als er die Glastür zum Büroraum öffnet, schlägt die Jalousie gegen die Scheibe. Im Gegenlicht wirbelt ein funkelnder Staubschleier hoch und legt sich auf sein Gesicht. Plötzlich schmeckt die Luft nach schon lange verstorbenen Hausstaubmilben.
Sanders fährt sich über die Augen. Vielleicht, dass eine unsichtbare Macht irgendwo im Himmel über Moabit ihn in diesem Moment mit einem Fluch belegt hat. Falls es über Moabit einen Himmel gibt.
Sein zukünftiger Vermieter, ein original Berliner Schlitzohr namens Pawel Krawczyk, hat Sanders die beiden winzigen Räume im ersten Stock als seine neue »Hauptstadtrepräsentanz« verkaufen wollen – immerhin augenzwinkernd. Denn hier in dieser Ecke hat Berlin so viel Klasse wie El Arenal, ist so sicher wie Mexico City und so ruhig wie der Große Bazar von Istanbul, wenn man sich noch zwei Millionen Automatencasinos hinzudenkt.
Bemerkenswert ist auch diese schlafwandlerische berlinische Stilsicherheit. Die Vormieterin des Büros hat die Wände mit Latexfarbe gestrichen, in einem hypnotischen Mauve. Dieses wilde, erdrückend feminine Violett mit seinem tieftraurigen Unterton schwingt beunruhigend genau auf Sanders’ Frequenz. Aber natürlich kann er das nicht so lassen. Kein Detektiv, der etwas auf sich hält, hat ein lila Büro, in dem auch noch phosphoreszierende Sternbilder an der Decke kleben.
Eine Möglichkeit wäre, auf Zeit zu spielen. Wenn Sanders das Büro zwanzig Jahre nicht renovieren und stattdessen Zigarren rauchen würde, könnte sich der Raum so dunkelbraun verfärben wie bei Liebling Kreuzberg, wo selbst die Nachwuchssekretärinnen schon einen Oberlippenbart tragen. Erfahrung schafft Vertrauen. Aber dieses Intime, Heimelige ist nicht Sanders’ Stil. Im Kopf verwandelt er das Büro bereits in etwas Weißes, Leeres, dem Geist eines japanischen Zenmeisters nicht Unähnliches.
Ein bisschen Farbe und eine Menge Desinfektionsmittel also, dann werden diese Räume ihren Zweck erfüllen. Sanders sieht in Gedanken schon den neuen Schriftzug an der Glastür kleben, seriös und kraftvoll wie ein Heilsversprechen: Martin Sanders – Private Ermittlungen. Aber dann kommt ihm in den Sinn, dass ein solcher oder ähnlicher Schriftzug mit diesem oder jenem Namen bereits an so vielen Glastüren überall auf der Welt in irgendwelchen dunklen Seitenstraßen klebt. Vielleicht würde er doch lieber etwas Moderneres schreiben: Martin Sanders Consulting. Laden Sie Ihren ganzen Dreck bei mir ab. Ein Hauch von Prätention, dafür ganzheitlich.
Sanders geht um den Schreibtisch herum und schaut aus dem Fenster. Er hat nicht viel übrig für dieses feuchte Wetter. Sein Nasenrücken schmerzt an den alten Bruchstellen. Seit er sich auf einem dunklen Weddinger Hinterhof für ein paar Euro die Stunde plus Spesen die Nase hat brechen lassen, sieht Sanders nicht mehr allzu gut aus. Eher wie ein melancholischer Auftragskiller in einem alten französischen Film, eine Menschenmaschine unter einer Hülle aus Haut. Beruflich ist das von Vorteil. Ein Detektiv sollte unauffällig und kühl wirken, stets Herr der Lage und stets Herr seiner selbst.
Er zieht ein Taschentuch aus der Jacke, wischt den Fensterriegel ab und kippt das Fenster an. Der Lärm auf der Beusselstraße schaltet sich ein wie ein vertrautes Radioprogramm. Es ist Frühling, und das Licht ist zurück in der Stadt. Hellgrün fällt es rechts und links der Straße auf die dürren Straßenbäume, die Spielkasinos, die Gründerzeithäuser mit ihrem abgeschlagenen Fassadenstuck, die Universalshops und Telecafés. Die »Europa«-Pizzeria hat bereits ein paar verwitterte Stühle auf den Bürgersteig gestellt, und schon wird dort gesessen, sich im Schritt gekratzt und palavert.
Die Beusselstraße ist der böse Clown unter Berlins Straßen, sie kichert, während sie dir an die Kehle geht mit ihrem Milieudruck, ihrem Menschengewinsel und ihrem Ozongestank. Sie ist ein Paradies für Perspektivkrüppel wie Sanders, und es gibt jede Menge Kundschaft für ihn. Aber er muss seinen Stundensatz überdenken. Denn der Beusselstraße ist es egal, ob ein Detektiv sein Büro hier oder in El Paso aufmacht. Vielleicht könnte er seine Dienste als Hilfe zum Lebensunterhalt deklarieren. Viele würden ihn als eine Art Grundsicherung ansehen: Hilfe, wenn niemand sonst hilft.
Sanders wischt den Schreibtischstuhl ab und setzt sich. Es ist mehr als fünf Jahre her, dass er hinter einem Schreibtisch mit einem Besucherstuhl davor gesessen hat. Bevor er deshalb sentimental werden kann, klappert die Jalousie erneut. Pawel Krawczyk schiebt seinen massigen Körper und seinen Gorillaschädel herein. In seinen Melonenhänden hält er zwei verbeulte Pappbecher, die aussehen, als wären sie zu heiß gewaschen worden. Eine Aura aus Kaffeegeruch, mit Alkohol abgetönt, umgibt den Vermieter. Er lässt sich auf den Besucherstuhl fallen und stellt die Becher zwischen Sanders und sich auf den Tisch.
»Begrüßungskäffchen.« Krawczyk grinst und lässt dabei eine Menge Goldzähne sehen. Vermutlich hat er das Gold dafür selbst geschürft, irgendwo im Permafrost östlich von Warschau. Krawczyk nimmt einen Schluck Kaffee und nickt zufrieden. »Is nich 77 Sunset Strip, aber schönet Büro, wa? Die Tante, die das Büro vor dir hatte, war Sterbebegleiterin.«
»Hab ich auch schon gemacht.« Sanders riecht am Kaffee.
Krawczyk beugt sich vor. »Bullshit. Ich mein, so Karma-Sterbebegleiterin für Fiffis, Herr Sanders. Wie hat se imma gesagt? Für Kleintiere, mit Heilgesang. Schlimmste Sorte, Mann. Wenn du dit hörst, stirbste freiwillig. Gott sei Dank hat se dann gekündigt und ist mit ihrer Praxis ans Ostkreuz gezogen. Brauchte was Größeres. Lief gut, so karmisches Totsingen von Meerschweinen und Zeugs.«
Sanders nippt an dem Gebräu, das überwiegend aus Wodka und Zuckerwürfeln besteht. »Familienrezept?«
Pawel Krawczyk nickt stolz. »Von Oma. Hab ich der Totsängerin nie angeboten, weißte. Die hat immer so gefaselt von Lichtpräsenz, dann abkassiert und die Viecha in die Mülle im Hof geschmissen. Im Sommer sind die dann nach zwei Tagen als Aasfliegen wiederauferstanden. Da warn die Callgirls vom Callcenter im Hinterhaus sauer, is ja klar.«
»Was ist mit den Büromöbeln?«
»Die gehören jetzt dir, Herr Sanders. Wenn du willst.«
Die angejahrten dunkelbraunen Regale und der klebrige Schreibtisch sehen aus, als wären die zarten Tierseelen, die in diesem Raum ins Licht gegangen sind, in ihrer Patina konserviert. Überhaupt fühlt es sich so an, als wäre in diesem Raum noch eine Präsenz, ein Frettchen vielleicht, das nicht sterben wollte und das Sanders von irgendwoher in den Kaffee gepuschert hat.
Oder vielleicht ist es einfach nur Pawel Krawczyk. Die Flügel seiner Senfgurkennase flattern mit einer gelblich-neugierigen Transparenz. »Ich kenn dich, Mann«, sagt er und kneift die wasserblauen Augen zusammen. »Irgendwo hab ich dein Gesicht schon ma gesehen. Hast ein ehrliches Gesicht. So’n Gesicht vergisst man nicht.«
Sanders hebt seinen leckgeschlagenen Pappbecher hoch und wischt den Kaffeerand auf dem Tisch mit einem Taschentuch weg. »Gutes Zeugs«, lobt er, »Kompliment an Oma.«
»Also, Herr Sanders«, fragt Krawczyk, »was ist das noch mal für ein Büro, dass du da aufmachen willst?«
»Ich bin Privatdetektiv.«
»Detektiv, hm? Gibt’s den Beruf überhaupt?«
»Doch. Wir sind die Typen mit den Verbrennungen am Oberschenkel.«
»Wieso ’n das?«
»Ist ein Naturgesetz. Wenn man jemanden im Auto observiert, geht die Verfolgungsjagd immer dann los, wenn man sich gerade einen heißen Kaffee besorgt hat.«
»Witzig. Mag ich. Pass auf, du siehst korrekt aus, mit deinem Anzug und allem. Man sieht heute selten ’n Typ, der seinen Anzug so gut tragen kann wie du. Andere Typen, die sehen im Anzug aus wie die Blues Brothers. Sag ma, warum fällt mir bloß nich ein, woher ich dich kenne?«
Sanders braucht etwas, das ihm als Untersetzer für die Kaffeebecher dient. Jetzt, wo das sein Schreibtisch ist, kann er darauf keine Kaffeeränder mehr dulden. Er zieht eine der Schreibtischschubladen auf, findet eine alte Berliner Woche, einen vergessenen Hundekeks und den gelblichen Tischkalender eines längst gelebten Jahres.
»Schmeiß den Scheiß weg«, grunzt Krawczyk und nimmt einen großen Schluck seiner Spezialmischung. »Erzähl doch ma: Wie wird einer wie du Privatdetektiv?«
Es klingt, als sei ihm etwas Schlimmes zugestoßen. Sanders denkt darüber nach. Er blättert durch den Kalender. Tierfotos und Lyrik – ein Frauenkalender. Aber Sanders ist 38, ledig, mehrfach und gründlich gescheitert – er kann zugeben, dass er manchmal das eine oder andere Gedicht liest.
Er reißt zwei Blätter ab. Einen Berggorilla, unter dessen Foto etwas über die »sanften Riesen Ugandas« steht, schiebt er unter Krawczyks Becher. Sanders selbst stellt seinen Kaffee auf das Foto einer blauschwarzen Krähe. Krähen sind respektlos und amüsant. Oft beobachtet er sie abends von seinem Wohnungsfenster aus, wie sie die Mülleimer der Strandbars an der Spree plündern, während der Fluss seine schlammbraune Seele gleichgültig in die Spundwände unterhalb der Ministergärten atmet.
Sanders fühlt sich plötzlich so müde, als hätte er schon Hunderte von Jahren gelebt. Das muss der Wodka sein. Jedenfalls ist er viel zu alt für ein neues Büro. Auf jeden Fall zu alt, um noch weiter nach einem anderen Büro zu suchen, wenn das hier schiefgeht.
»Sanfter Riese? Das ist Poesie, wa?« Pawel Krawczyk zeigt auf den Affen. »Das heißt immer was in Deutschland. So wie bei Fack ju Göhte – Ich weiß nicht, was soll et bedeuten und so.«
»Das ist Heine«, sagt Sanders.
Krawczyk lacht. »Was steht bei dir?«
»Da steht«, sagt Sanders, »wie ich Detektiv geworden bin.«
»Lies vor.«
»Vielleicht zu spät, als eine Krähe/unseren Morgen kappt. Ein Schlag./Und ob sie fällt und ob sie weiterfliegt –/Ich frag zu laut, ob du noch Kaffee magst./Dein Blick ist schroff, wie aus dem Tag gebrochen.« Sanders dreht das Kalenderblatt so, dass der plötzlich zum Poeten gewordene Krawczyk es lesen kann.
Dieses Gefühl des Unabwendbaren im Text, das ist ganz Silke – die Silke, die vor fünf Jahren noch seine Frau war. Oder vielleicht war sie das nie. Vielleicht ist sie einfach immer nur mit Sanders’ Beamtenjob beim Landeskriminalamt verheiratet gewesen.
»Deine Frau ist abgehauen?«, fragt Krawczyk.
Sanders wirft einen zerkratzten Euro in sein Kopfkino, eine Klappe öffnet sich, und er blickt in den Abgrund.
Krawczyk haut mit der flachen Hand auf den Tisch. »Jetzt weiß ich wieder!«, sagt er, und seine Augen leuchten auf wie ein Bremslicht. »Du bist der Bulle, dem die Lorenzos die Frau aufgeschnitten haben! Und Scheiße, Mann, die war auch noch schwanger, deine Frau!«
Der Puls an Sanders’ Daumenwurzel zuckt unter der Haut wie ein Wurm. Sanders beult den Pappbecher ein und wieder aus.
»Klar, Mann, das war doch großes Thema! Dein Bild war in der Abendschau. Hast du aufgehört bei den Bullen?« Krawczyks Augen werden ölig.
Sanders hält stand, lehnt sich lässig zurück, aber er weiß, er muss weg hier. Er muss duschen, vielleicht zwei- oder dreimal, dann noch irgendetwas mit mehr Klasse hinterher trinken, um den Wodkageschmack loszuwerden, und schließlich schlafen.
»Was ist mit dem Kind passiert?«, fragt der Gorilla. Das Karmische im Raum scheint auf Krawczyk überzugreifen.
»Kinder«, sagt Sanders, »sind nicht so mein Thema.«
»Haste recht, Herr Sanders.« Krawczyk kippt den Rest von seinem Gesöff runter, beugt sich vor und klopft ihm auf die Schulter. »Männer in deinem Alter sollten eher für die Geburt von Kindern verantwortlich sein und nich dafür, dass se sterben.«
»Weise Worte.«
»Mann, du bist eine Kiezlegende, Herr Sanders. Du warst im Fernsehen. Hätt nich gedacht, dass du in echt so dürr bist. Im Fernsehen hast du ausgesehen, als hättest du einen ganz guten Körper.«
Es ist immer dieselbe Geschichte. Der Verlierer verliert alles, sogar seinen Körper.
»Jeder hier hat davon gehört, wie du den kleinen Lorenzo ausgeknipst hast. Groß, Herr Sanders. Ganz groß! Die Lorenzos ham hier schon jeden gefickt. Mich auch. Rocco Lorenzo, den hat hier keiner gebraucht, weißte.«
»Sei einfach still, Krawczyk.« Sanders’ Haut wird feucht und kalt. Er wird doch nicht schon wieder Schüttelfrost kriegen?
»Erzähl mal, wie das war. Wie du ihn kaltgemacht hast.« Krawczyks Augen glitzern wie Diskokugeln. »Wenn du’s mir erzählst, kannst du umsonst auf dem Hof parken, Mann. Für immer. Ich schwöre.« Krawczyk legt zwei Finger seiner rechten Hand auf sein gewaltiges Herz.
Sanders fühlt sich wie ein Kartenverkäufer an einer Kinokasse, dem das Kino abhandengekommen ist. Denn was Krawczyk hören will, ist noch nicht mal eine richtige Geschichte. Eine richtige Geschichte braucht ein Motiv. Diese hier ist einfach nur passiert.
»Willst du nicht lieber schon mal meinen Ausweis für den Mietvertrag kopieren gehen?«, schlägt Sanders vor und reibt sich das Kratzen aus den Augenwinkeln. Aber natürlich kennt er die Antwort.
Krawczyk rührt mit seinem Zeigefinger in der Luft herum, als wollte er ein Schwungrad in Gang bringen. Der Sekundenzeiger seiner nachgemachten Protzrolex zuckt nervös.
»Na schön. Was willst du hören, Krawczyk?«
»Wer schuld war, Mann. Das ist das Wichtigste.«
Der Fall Lorenzo liegt so, dass man sich entscheiden muss, woran man glaubt: an Ethik oder an Strafrecht. Nur ist das Glauben an sich nicht Sanders’ Stärke. Glauben hat viel zu viel mit Vertrauen zu tun, und Vertrauen ist eine schlechte Angewohnheit. Also hat er sich etwas zurechtgelegt. Es gibt wahre und wahrscheinliche Geschichten. Diese hier ist wahrscheinlich.
»Ich bin auf Zivilstreife«, sagt er und schnipst den alten Hundekeks über den Tisch, »Rocco Lorenzo ist mit seinem großen Bruder Heiko in einem Sportwagen unterwegs, rot, flach, vier Auspuffrohre. Heiko ist aktenkundig. Wir halten seinen Wagen an. Der Kollege filzt ihn. Er hat eine 44er Magnum im Hosenbund stecken. Heiko macht ein Riesentheater, leistet Widerstand. Es kommt zum Handgemenge. Und in dem ganzen Chaos greift sich Rocco dann plötzlich in die Jacke. Ich zieh schneller als er. Es ist ein Reflex. Momentversagen.«
»Du hast gedacht, er oder ich, Herr Sanders.« Krawczyk zuckt mit den Schultern.
Sanders erzählt sich die Geschichte immer so, wie sein Ego es gerade noch ertragen kann. Es wäre schön, jetzt eine Packung Lucky Strikes und einen schwachen Moment zu haben. Aber einen schwachen Moment hatte er schon lange nicht mehr. »Ich war ein Bulle«, sagt er. »Und Rocco war erst zwölf.«
»Was hatte er denn für eine Knarre in seiner Jacke?«
»Keine Knarre. Ein Hundebaby.«
Krawczyk bekommt Bambiaugen, sie drohen überzulaufen. »Was für eine Scheiße!«, sagt er mit zerfranster Stimme. »Das ist mal wirklich eine knallharte Geschichte, Mann.«
»Wenn es eine Geschichte wäre, dann würde sie irgendwie Sinn machen, eine Moral haben. Irgendetwas.«
Krawczyk schaut an ihm vorbei, auf das gleichmütige Dahinströmen der Beusselstraße. »Ich erzähl dir das Ende von deiner Story. Ist mir wieder eingefallen. Die Lorenzos haben sich an dir gerächt. Sie nehmen das Blut deiner Frau, aber deine Frau hat’s überlebt. Du gibst nich auf, Mann. Frau weg, Kind weg, Job weg, Haus weg. Du ziehst in eine billige Einraumwohnung im Getto. Du brauchst Geld, also arbeitest du von zu Hause aus als Detektiv. Du hast eigentlich nur einen Auftraggeber. Und der ist jetzt auf Staatskosten eingefahren. Nun brauchste neue Kunden, also brauchste ein Büro. Deshalb stehste vor mir. Richtig?«
»Fast richtig.« Es tut gut, das Lila der Wände anzuschauen. Sanders stellt sich vor, dass man die Blutspritzer darauf kaum sehen würde, falls ihm jetzt das Herz platzt. »Meine Wohnung ist weder billig noch im Getto«, sagt er. »Qualifiziert mich das trotzdem für einen Büromietvertrag?«
»Klar. Ich schreib dir einen. Kannst schon ma Visitenkarten drucken lassen.« Krawczyk steht auf und klopft Sanders auf die Schulter. »Wenn du ma was brauchst, du Held, weißte ja, kommste einfach zu Onkel Pawel. Ich hab hier das Fitnessstudio und einen kleinen Sicherheitsdienst, Türsteher, Objektbewachung, so was. Falls du ma ein Back-up brauchst.« Krawczyk zwinkert Sanders zu.
»Vielleicht kann ich am Tor ein Schild aufhängen.« Sanders steht auch auf. »Endlich Gewissheit – Ihr freundlicher Privatdetektiv sorgt für Klarheit.«
»Was immer du willst.« Krawcyzk winkt ihm zu. »Mein Haus ist dein Haus.« Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss.
Sanders schmeißt die Pappbecher, die Zeitung und den Kalender in den Papierkorb. Sein Hemd hat er durchgeschwitzt, er muss jetzt dringend heiß duschen, gegen den Schüttelfrost. Die Beusselstraße hat ihn erwischt. Erwartbar. Schließlich saugt der Job des Detektivs Honig aus der allgemeinen Verkommenheit dieser Ecke: ein Gemisch aus Eifersucht, Neugier, Geiz, Geilheit. Niedere Instinkte lassen die Kasse klingeln. Und um zu verschleiern, dass man im Dreck wühlt, nennt sich eine diskrete Detektei heutzutage Consulting.
Sanders schwebt eine Internetseite vor, auf der er »wir« schreibt, wenn er »ich« meint. Selbstverständlich wird er nur auf Empfehlung tätig, hat 95 Prozent Aufklärungsquote, ist durchweg diskret, high profile und schlichtweg exzellent. Und faire Preise. Nichts als die Wahrheit.
Er sieht die schmalen Umrisse seines Körpers in der Glasscheibe zum Warteraum, von der Jalousie in schwarze Streifen geschnitten. Sanders’ Zukunft wird darin bestehen, dass ein paar Typen, die noch hilfloser sind als er selbst, ihn nach ihrem geklauten Custombike suchen oder das Smartphone ihrer Freundin orten lassen. Illegal? Keine Zeit für Luxusdiskussionen.
Der Vibrationsalarm seines Smartphones trifft ihn in die Brust wie ein Stromschlag aus einer Elektroimpulswaffe. Die Nerven. Sanders fischt das Telefon aus der Innentasche seiner Jacke. Seine Hände zittern. Er kennt die Nummer nicht.
»Hier auch Sanders«, sagt die glatte, eloquente Stimme eines einflussreichen Dahlemer Rechtsanwalts.
»Vater.« Sanders muss sich kurz am Schreibtisch festhalten. Er hat die Stimme seines alten Herrn eine Weile nicht gehört und hätte es gern dabei belassen. »Was kann ich für dich tun?«
Der Vater gibt ein Geräusch des Bedauerns von sich, aber vielleicht bildet Martin Sanders sich das auch nur ein. Zu viel Schicksal kann einen Mann romantisch und wehleidig machen.
»Du weißt, dass ich sehr viele Verpflichtungen habe«, beginnt der Vater. »Ich möchte, dass du zu mir in die Kanzlei kommst. Es ist wirklich dringend.«
»Dringend? Um das zu entscheiden, bräuchte ich mehr Informationen.«
Sanders senior lacht. »Ich bin dein Vater, Junge. Kein Klient. Das hier ist eine wirklich delikate Angelegenheit. Nichts, was ich dir am Telefon erklären kann. Du hast deinen letzten Fall doch abgeschlossen?«
Sanders hat seit vier Wochen keinen neuen Fall mehr, weil sein Hauptauftraggeber in der JVA Moabit sitzt. »Es gehört zu den reizenden Seiten meines Berufs, dass kein Fall jemals vollständig abgeschlossen ist«, sagt er trotzdem.
»Verschwenden wir unsere Zeit nicht mit Small Talk. Morgen um neun? Und bitte sei pünktlich, ich habe einen Anschlusstermin im Kanzleramt.«
Ein guter Detektiv darf sich niemals von den Gefühlen seiner Klienten infizieren lassen. Sanders betrachtet das schwarze Handydisplay. Er wischt die eigenen Fingerabdrücke mit einem frischen Taschentuch weg. Eine halbe Stunde hat er das neue Büro, und schon ist der Papierkorb voller Taschentücher. Er denkt an die klassische Büroflasche, von der man so oft hört. Aber Alkohol hilft nicht gegen zu viel Schicksal – im Gegenteil.
Immerhin ist der Villenvorort Berlin-Dahlem, in dem sein Vater residiert, im Frühling einen Ausflug wert. Reetdachhäuser und blühende Rosenbögen, die die Überwachungskameras verdecken. Außerdem kommt Sanders auf die Art mal wieder an die frische Luft. Und das ist ja, von Berlin-Moabit aus betrachtet, ein Wert an sich.
Die Bombe
Im Dunkeln berührt mich etwas. Es ist glatt und klebrig. Ich lieg im Bett und hab eine Flasche im Arm. Das passiert vielen Frauen, aber bei mir ist es eine Flasche Eierlikör. Was für ein Ausrutscher. Zugegeben, das kann sich nur jemand wie ich leisten, dessen Leben in den letzten Monaten ein einziger Exzess der Nichtigkeit gewesen ist. Zu viel gearbeitet – die Ausrede ist auch nicht neu.
Warum bin ich eigentlich wach? Weil das Handy klingelt. Wo ist es? Keine Ahnung. Ich streck mich, meine Knie tun weh von den High Heels. Ich bin 31, ich bin zu alt für diesen Zirkus. Aber ich trag noch immer das Parfüm, das ich letztes Jahr im Duty Free aufm Flughafen Singapur gekauft habe. Guter Stoff. Er flüstert den ganzen Abend: Baby, ich gehör nur dir! Eine Menge Kerle glauben das. Weil sie es glauben wollen. Und sie zahlen cash. Denn ich bin eine Ex-Stewardess mit Escortjob-Problemen.
Problem Nummer eins: Ich brauch die Kohle. Dringend. Also schweb ich elegant und stilsicher von Termin zu Termin, dabei immer – lyrisch gesprochen – auf der Flucht vor mir selbst. Ich versuch wie verrückt, eine bestimmte Telefonnummer zu vergessen. Da hilft es ungemein, wenn man jeden Abend ausgeht.
Problem Nummer zwei: Escort heißt bei mir Escort – ich bin eine Gesellschaftsdame. Na ja, Dame ist vielleicht zu viel gesagt. Jedenfalls essen gehen, küssen vielleicht, aber dann ist auch fini. Oft genug sind meine Kunden Jedermänner mit Knallchargenpathos, die mich schon während der Vorsuppe nach einem Blowjob fragen und aus denen ich, wenn ich männerfeindlich veranlagt wäre, gern noch bei Tisch sechs Sorten Scheiße herausprügeln würde. Aber für ein paar Hunnis am Abend hat man über die Fürsorgepflicht hinaus auch gewisse Erziehungsaufgaben.
Das Handy klingelt noch immer. Berlin ist unberechenbar – von wegen. Man muss nur das Unmögliche einkalkulieren, dann hat man Berlin ausgecheckt. Und das Unmögliche bin ich. Oder vielmehr, es ist in mir drin. Ich überrasch mich jedenfalls selbst damit, dass ich das Telefon aus dem Chaos auf dem Nachttisch hervorkram und kristallklar sag: »Liberty Vale.«
»Ich rufe dich nicht freiwillig an«, sagt eine Mädchenstimme.
Wanja, meine anadoptierte Schwester. Sie ist vierzehn, meine Mutter hat sie aus einem rumänischen Kinderheim gerettet. Da war sie fünf Jahre alt. Wanja ist unsere Familienprinzessin, und sie ist so angenehm wie eine Stielwarzenvereisung. Also sag ich erst mal nichts. Ich setz mich auf. Mein Gehirn schwankt wie ein Leichtmatrose.
»Willst du uns eigentlich komplett blamieren?«
Ich bin siebzehn Jahre älter als Wanja, aber sie ist immer sehr streng mit mir.
»Denkst du auch mal an uns? Familienehre und so?«
»Das machst du doch schon.« Ich komm langsam in Schwung. »Arbeitsteilung.«
»Arbeit?« Wanja kriegt sich nicht mehr ein. »Seit du letztes Jahr Weihnachten deinen Stewardessjob gekündigt hast, weißt du doch gar nicht mehr, was das ist, du Nacktschnecke!«
Ich drück die Eierlikörflasche noch ein bisschen fester an mich. Escortmodel, da denkt man immer: Wenig Aufwand, viel Geld. Jedenfalls haben sich meiner Mutter und ihrem zweiten Mann, der für eine wertkonservative Partei im Deutschen Bundestag sitzt, vor Peinlichkeit je ein hübsches Gehänge Hämorrhoiden ausgestülpt. Sicher rutschen sie deshalb immer so seltsam auf den Stühlen herum, wenn ich ihnen in die Augen seh.
»Ich hab nicht gekündigt«, klär ich Wanja auf, »sondern kurz vorm Take-off die Notrutsche einer 747 ausgelöst. Mach das erst mal nach, Prinzessin.«
»Du bist einfach komplett durchgeknallt.«
»Das war Notwehr.« Ich weiß gar nicht, warum ich mich verteidige. Wahrscheinlich Restalkohol. »Und ein Akt weiblicher Selbstbestimmung. Dieser Harry Konig …«
»Immerhin ein Schauspieler, der den Oscar gewonnen hat.«
»Dieser versoffene Drecksack wollte mich begrapschen. Dann hat er mir die ganze Erste Klasse vollgepisst. Mit Absicht.«
Ich hör Wanja mit der Zunge schnalzen, so ein südosteuropäisches Laisser-passer-Geräusch.
»Na gut«, geb ich zu, »vielleicht war ich etwas mit den Nerven runter. Jedenfalls konnte ich nichts mehr von dem einstecken, was der Typ ausgeteilt hat.«
»Wenn dir das wichtiger ist als das Bild, das unsere Familie in der Öffentlichkeit abgibt.«
»Konig wollte mich fertigmachen. Ich musste da raus. Das war ich mir einfach schuldig.« Ich krieg kalte Füße. Im Dunkeln angle ich nach meinen Socken.
»Kapier doch mal, ich hör mir das jeden Tag in der Schule an!«
Die Hormone. Wanja weiß nicht nur alles, sie findet auch alles peinlich. »Chill einfach, Prinzessin.«
»Mama hat sich so vor den Nachbarn geschämt.« Wanjas Stimme bebt auf einmal vor Gefühligkeit. »Und falls du jetzt darauf spekulierst, dass Papa dir die zweihunderttausend Euro Schadenersatz gibt, auf die dich die Airline verklagt hat – wir haben das im Familienrat diskutiert, das kannst du dir abschminken!«
»Bevor ich von Horst Geld annehm, verkauf ich lieber meine Organe.«
Wanja lacht böse. »Warum versuchst du’s nicht gleich als Leihmutter? Ist doch wie dein jetziger Job, nur konsequent weitergedacht.«
Sie hat gewonnen. Ich kann das zugeben. »Du wirst mir wirklich immer ähnlicher, Prinzessin. Warum rufst du an?«
»Na ja.« Sie tönt ihre Stimme ab, à la Schauspielschule. »Ich wollte nur Bescheid sagen. Wahrscheinlich wirst du dich bald eh nicht mehr über mich ärgern müssen.«
»Ach herrje!«
»Nächste Woche schreibe ich eine total wichtige Englischklausur«, jammert sie. »Ich brauche eine gute Note, sonst ist meine Versetzung gefährdet.«
»Familienehre, hm?« Ich spiel mit dem rosa Balconette-BH, der auf meinem Nachttisch liegt. »Bist doch sonst nicht so ein Minderleister. Worum geht’s denn?«
»Der Rabe von Edgar Allen Poe.«
»Oh, und ich dachte, ich soll dem Englischlehrer meinen Körper anbieten.«
»Das könnte ich zur Not selbst.«
»An dir ist doch nichts dran.«
Kleine Pause, großes Geständnis. »Mama und Papa haben sich Prospekte von Internaten schicken lassen«, fistelt Wanja.
Erwachsenwerden kann einem das Herz brechen. Entweder man checkt die Regeln des Zusammenlebens und spielt das Spiel mit oder nicht. Wanja war bisher immer die Elite in Person. Sie hat nix übrig für Problemiker. Nun ist sie plötzlich selbst einer.
»Auweia. Ich spiel die Hauptrolle im Notrutschenskandal, und wenn du jetzt auch noch absteigst«, sag ich, »dann sind nicht nur eins, fix, drei das I-Phone und das Taschengeld weg, sondern dann ist Schluss mit Berlin. Politik kann der Horst ja überall machen. Ihr zieht in die Provinz, wo euch keiner kennt – in Frankfurt/Oder soll es ja ganz viel Leerstand geben.«
Ich hör Wanja Luft holen. Sie hat jetzt mein Zimmer in einer feudalen Altbauwohnung mit hohen Decken, Eichenparkett und Dienstmädchenkammer. Zusammen unter einem Dach gewohnt haben wir nie. Ich hatte mich schon abgeseilt, als sie einzog. Aber wir haben so oft Weihnachten zusammen gefeiert, dass ich die Familienprinzessin auswendig kenn. Ich kann sie aufblasen wie’n Frosch.
»Ach, weißt du was«, zischt sie, »vergiss es!« Und sie legt auf.
Dieses Bittersüße, Unberechenbare steckt halt in jeder Berlinerin. Ich hätt ja zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich mal die Orientierung im Leben verlier. Eigentlich wollte ich Juristin werden. Das Gute an meinem Notrutschenskandal ist, dass ich zu diesem Berufszweig jetzt wieder mehr Kontakt habe: Ich könnt eine ganze Kanzlei beschäftigen. Nur leider nicht bezahlen. So ist Berlin. Es spielt mit deinen Hoffnungen und lässt dich am Ende zerstört zurück.
Ich steh vom Bett auf. Eigentlich will ich mit der Zukunft ja nichts mehr zu tun haben. Besonders kurz nach dem Aufstehen. Aber durch das gekippte Fenster hör ich die Stimme des freien Moabit im Hof krakeelen: »Vallah, Liberty, sie’s Bombe. Sie’s swietest Fame Bitsch eva. Schwöre!«
Alle Augen auf mich: Ich bin’s, Liberty »Libby« Vale. Also known as »die Bombe«. Du wolltest ein kühles Berliner Kindl, und da bin ich. Warum ich so seltsam heiße? Kurzversion: Weil mein richtiger Papa Amerikaner ist, Sherlock. Ansonsten bin ich so amerikanisch wie Sauerkraut. Durch meine kleine Auseinandersetzung mit Oscarpreisträger Harry Konig hab ich es zu einer gewissen lokalen Berühmtheit gebracht.
Draußen Gerangel. Das Geräusch einer Mülltonne, die umfällt.
»Piss dich ma, Nuttensohn! ’sch seh nisch.«
»Sie’s ieber krass! Rutsch ma!«
»Was, was, was? S’los?«
»Sch’ mach dich Karankenhaus!«
Und ich mach das Fenster zu. Was die Jungs dabei für Sekundenbruchteile durch die Gardine geflasht kriegen, ist hundert Prozent made in Berlin. Aber ich fühl mich schon einen Mikromillimeter besser. Weil ich meine kleine Schwester abgefiedelt hab. Und weil mich ein paar Minderjährige stalken. Ich sprüh wirklich vor Lebensfreude.
Dabei haben diese Kids unten im Hof mehr Ehrgeiz als ich. Verdienen sich in Ümit Ehrlichs Süpermarket im Erdgeschoss mit Regaleinräumen ein paar Öros. Und in den Pausen belauern sie meinen Balkon im ersten Stock. Auch Pubertät. Die wissen wirklich alles.
Der Wecker auf dem Nachttisch blinkt im Halbdunkeln. Ich leg das Handy zurück zwischen die Detektiv-Conan-Mangas, die Retro-Superman-Comics, die Aspirin und die Ohrringe. Das Display leuchtet immer noch wie ein Grablicht. Da ist noch ein letzter Strich für den Handy-Akku, und da ist noch ein letztes Foto im Fotoalbum. Ein Gesicht, so scharfkantig und fragil wie ein Glasmosaik. Martin Sanders. Privatdetektiv. Ein Mädchen kann in einem einzigen Leben sehr viele Fehler machen.
Ich geh ins Bad. Es ist still in der Wohnung. Nur meine Oberschenkel klatschen Beifall. Ich vermiss einfach alles. Meine langen blonden Haare zum Beispiel, die ich mir für den einzigen Job, bei dem ich je mit Sanders zusammengearbeitet hab, abschneiden lassen musste. Die kurzen Strähnen stehen ab wie ’ne Pelzmütze. Kämmen sinnlos. Vor dem Spiegel frag ich mich, ob es etwas nützen würde, wenn ich mir die restlichen Haare einfach ausreißen würde.
Der Herr Vater
Die abziehenden Ostgewitter lassen die Parks der Dahlemer Gründerzeitvillen an diesem Maimorgen so grün und gesättigt zurück wie Hochmoorwiesen. In den Rinnsteinen und Vorgärten glänzen die Pfützen, und noch immer ist der Regen nicht vorbei. Die Stadt ertrinkt, von den Scheibenwischern seines Wagens in zwei Wahrnehmungsbereiche geteilt: unscharf/scharf, scharf/unscharf und so weiter.
Das Auto hat Sanders gestern per Hand waschen lassen. Nur im Winter ist das in Berlin noch sinnloser als im Frühjahr, aber es gehört zu seinen persönlichen Ritualen. Einmal im Monat Haare schneiden und Auto waschen lassen. Das Auto ist oft genug sein Arbeitsplatz. Er konzentriert sich auf seinen nichtssagenden silbernen Mittelklassekombi, legt den Rückwärtsgang ein, lässt die Kupplung kommen – zu steil, um männlich-markant in die Parklücke zu stoßen. Ist es, weil ihm der verrutschte Anschnallgurt die Halsschlagader abdrückt, oder ist es das Hin und Her der Wischerblätter?
Herr Gott noch mal, er ist doch ein exzellenter Autofahrer. Sanders wischt sich die Hände an der Anzughose ab. Er spürt, dass ein bestimmtes Paar Augen in einem bestimmten Büro im Erdgeschoss seine beschämenden Parkversuche durch die Stechpalmenhecke beobachtet. Er fühlt, wie diese Augen überfrieren. Wie mit dem Kopf gezuckt wird. Eine Bewegung, die einem Schneidemesser gleicht.
Sanders schnallt sich ab. Berührt kurz sein Knöchelholster. Die SIG Sauer ist an ihrem Platz. Noch mal den Rückwärtsgang rein. Diesmal gelingt es besser, nicht perfekt, der Abstand zum Rinnstein ist zu groß, aber es muss genügen. Er holt seinen Mantel vom Rücksitz. Der Trenchcoat umarmt ihn wie eine liebende Mutter. Er schlägt den Kragen hoch, überquert den Bürgersteig und drückt die gebürstete Edelstahlklingel. Sie schnarrt genauso banal wie immer. Im Garten flüstert der Regen in den Rhododendren. Sanders betritt die Eingangshalle, ein schmaler dunkler Schatten in den blinden Wandspiegeln. Seine Ledersohlen treffen einem Metronom gleich auf den Marmor.
Die Gründerzeitvilla seines Vaters riecht klar, glatt und alt wie ein polares Eisschild. Eine Tür öffnet sich neben dem Kamin am Ende der Halle. Ruth Könitzer, die Haushälterin, trägt seit Jahrzehnten dasselbe dunkle Kostüm zur strengen Hochsteckfrisur. Ihr Haar glänzt silbern wie das einer Königinmutter. Sanders kennt Fräulein Könitzer schon seit dreißig Jahren. Trotzdem lächelt sie nicht. »Guten Morgen, junger Herr«, sagt sie stattdessen und neigt den Kopf.
»Wie geht es Ihnen, Fräulein Könitzer?« Kalter Regen läuft ihm aus den Haaren über die Stirn.
»Danke. Bitte geben Sie mir Ihren Mantel, bevor Sie noch den Fußboden ruinieren.«
Sanders reicht ihn ihr. Während Fräulein Könitzer seinen Mantel in die Garderobe bringt, richtet er seine Krawatte und schließt das Jackett, als wäre es eine kugelsichere Weste. Sein Blick wandert am vergoldeten Geländer der Freitreppe entlang hinauf in den ersten Stock. Dort schimmern in der Beletage die grünen Samttapeten. Sanders war seit fast zwanzig Jahren nicht mehr im ersten Stock. Er fragt sich kurz, ob es sein altes Zimmer noch gibt. Mit sechzehn ist er ausgezogen, um Polizist zu werden. Mit achtzehn hat er die Pflegschaft für seine Mutter übernommen. Er weiß nicht viel über die letzten Jahre im Leben seines Vaters. Der Mann hat immer noch dieselbe Haushälterin, aber es gibt eine neue Frau und ein neues Kind, einen Dobermann und ein Chalet in der Schweiz.
»Der Herr erwartet Sie in seinem Büro.« Fräulein Könitzer geht vor. In ihrem Windschatten riecht es nach Keller. Die Haushälterin führt ihn vorbei an dem um diese Zeit noch nicht besetzten Empfangstresen der Anwaltskanzlei, an Aktenrücken in Regalwänden, durch Intarsientüren, über Parkettböden. Nur das Blinken eines WLAN-Routers zeigt Sanders an, dass er nicht durch ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum gefallen ist.
Die Flügeltür zum Büro seines Vaters ist nur angelehnt. Fräulein Könitzer klopft, dann schiebt sie Martin Sanders hinein und löst sich in Luft auf.
Sein Vater sitzt mit dem Rücken zur Tür hinter einem enormen Schreibtisch. Im Hintergrund läuft leise Gitarrenmusik. Johnny Cash, unplugged. Selbst wenn er Musik hört, hat Rainhard Sanders noch die Haltung eines Herrn.
»Vater?«, fragt Martin Sanders dennoch.
Der Schreibtisch von Sanders senior ist leer. Bis auf eine Zeitung mit dem Foto einer umwerfenden Blondine: Liberty Vale. Sie ist nackt, und offensichtlich genießt sie es. So wie auch Sanders die Zusammenarbeit mit ihr genossen hat.
»I never thought I needed help before«, singt Johnny Cash mit brüchiger Stimme. Der Vater rührt sich nicht. Martin Sanders starrt ihm auf den schmalen dunklen Hinterkopf. Wenig graue Haare für sein Alter, denkt er, während Cash sich durch den Song quält. »Help me.« Es ist eine seiner letzten Aufnahmen. Martin Sanders spürt die Erschöpfung, die Trauer. So kaputt, der alte Mann, in seiner konzentrierten Todesnähe.
»Unerträglich, nicht wahr?« Rainhard Sanders hebt die Hand mit der Fernbedienung. Johnny Cash schweigt. Der Vater dreht sich um, steht auf. Groß, hager, militärisch. »Guten Morgen, mein Sohn.«
Martin Sanders absolviert den Händedruck knapp, beiläufig.
»Setz dich.«
Er öffnet den Jackenknopf, nimmt auf dem äußersten Rand des Besucherstuhls Platz. Mit einem Mal fühlt er sich nackt, der Stuhl ist aus Eis.
»Müde siehst du aus.« Rainhard Sanders scannt ihn von Kopf bis Fuß. »Und unrasiert. Ist das – wie sagt man? – hip in deinen Kreisen?«
Martin Sanders fährt sich übers Kinn. Der Dreitagebart, den er seit seinem letzten Fall trägt, erspart es ihm, sich länger als unbedingt nötig mit sich selbst zu beschäftigen. »Du wolltest mir etwas Dringendes erzählen«, sagt er.
Der Vater hebt die Brauen. »Ich verabscheue Moden«, sagt er. »Diese Bärte sind Virenfallen. Widerlich. Und das Risiko, einen Ausschlag zu bekommen …«
»… gehe ich ein«, unterbricht ihn der Sohn. »Ich bin halt eine Spielernatur.«
»Zu meinem Bedauern.« Rainhard Sanders schiebt das Foto von Liberty in seine Richtung. »Ist die Krise jetzt im Detektivgeschäft angekommen? Ich höre, du verkehrst in der Halbwelt?«
»Sagt wer?«
»Mein Kontakt im LKA.«
Sein Vater hat eine umwerfende Art, sich für sein Leben zu interessieren. Martin Sanders’ Zeigefinger zieht Libbys Hüften auf dem Foto nach. Er überlegt, ob er dieses Gespräch nicht einfach beenden soll. Sein Kopf schmerzt. Der Regen oder die Ohnmacht. »Diese Frau ist der Wahnsinn. Findest du nicht?«, fragt er und lächelt der Erinnerung an Libbys Stolz, an ihre Wärme hinterher.
Der Zeigefinger des Vaters fällt auf die Zeitung wie ein Scharfrichterbeil. »Eine Spielzeugpuppe«, zischt er. »Pubertär. Wie kannst du nur?«
»Ich hatte sie für einen Fall als Lockvogel engagiert«, sagt Sanders. »Mit sexy Skandalfotos Politiker gefügig machen – ich dachte, das ist der Job. Aber mein Auftraggeber wollte mehr: die Konkurrenz ausschalten und uns den Mord in die Schuhe schieben. Ohne Liberty wäre ich jetzt tot. Trotzdem. Wir sind nur Freunde, weiter nichts.« Er wünscht sie sich hierher. Ein fremdartiger, warmer Gedanke.
»Mach dir nichts vor, Martin. Das sind billige Reize. Ein Mann von Format ist für so etwas nicht empfänglich.«
»Für mich«, erwidert er, »ist sie eine sehr schöne Frau.«
Sein Vater schüttelt den Kopf. »Schönheit vergeht, Sohn.«
»Ich spreche nicht von Äußerlichkeiten, Vater.« Er atmet flach. Keine Bitterkeit. Dieser Mensch hier wird ihn nicht vergiften.
Rainhard Sanders legt die Fingerspitzen aneinander. »Eine Frau, die sich verkauft. Ich frage mich, wieso du ihr vertraust.«
»Ich kann dich wirklich vollkommen beruhigen, Vater.« Martin Sanders lehnt sich zurück. »Diese Frau interessiert sich kein Stück für mich als Mann. Möchtest du ihre Telefonnummer? Wolltest du mich deshalb sprechen?«