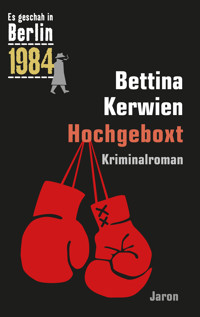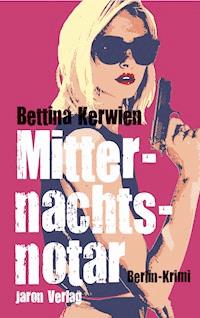Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Es geschah in Berlin
- Sprache: Deutsch
Das Dach der Kongresshalle im West-Berliner Tiergarten stürzt ein. Ein Unfall? Baumängel? Oder hat doch jemand nachgeholfen? Dann wird vor den Trümmern eine abgeschlagene Hand gefunden. Kommissar Peter Kappe nimmt mit Kriminalmeister Wolf Landsberger die Ermittlungen auf. Bald ist klar: Die Spur führt in die USA. Der Kommandant des Amerikanischen Sektors will den Fall an sich reißen. Ein Glück, dass sein Sonderermittler US-Major Bukowski nicht nur den Blues liebt, sondern auch Kappes neue Kollegin Roswitha Habedank. Aber genügt das, um den Fall zu lösen und die deutsch-amerikanische Freundschaft zu retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Kerwien
Tiergarten Blues
Ein Kappe-Krimi
Jaron Verlag
Bettina Kerwien lebt in Berlin. Sie studierte Amerikanistik und Publizistik. Als Geschäftsführerin eines Stahlbauunternehmens widmet sie sich in jeder freien Minute dem Schreiben. In der Reihe «Es geschah in Berlin» erschienen von ihr 2019 «Au revoir, Tegel» und 2020 «Tot im Teufelssee».
Originalausgabe
1. Auflage 2022
© 2022 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Prill Partners|producing, Barcelona
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-95552-046-5
Für Claudia Johanna Bauer.
You raise me up to more than I can be.
Gebe Gott, dass nicht nur die Liebe zur Freiheit, sondern auch ein tiefes Bewusstsein von den Rechten der Menschen alle Völker der Erde durchdringe, sodass ein Philosoph, wohin immer er seinen Fuß auch setzen möge, sagen kann: Dies ist mein Land!
Benjamin Franklin (1706–1790), Inschrift an der Kongresshalle
The blues is the roots, the rest is the fruits.
Willie Dixon, Blues-Bassist
PROLOG
DER 21. MAI 1980 ist ein lauer Frühsommertag. Im Berliner Tiergarten liegt auf einem Hügel am Ufer der Spree inmitten saftigen Grüns ein symbolträchtiger Bau: die West-Berliner Kongresshalle mit ihrem flott geschwungenen, schwerelos wirkenden Dach. Die westdeutsche Politik feiert die 1957 erbaute Halle als einen «Leuchtturm der Freiheit», der nach Osten ausstrahlen soll.
Mütter in hellblauen Frühjahrskostümen, die Handtaschen am Unterarm, führen ihre Kleinkinder auf den Wiesen rings um die Halle aus. Rollerfahrer nutzen den Hügel, auf dem das Gebäude steht, um ordentlich Schwung zu bekommen. Sie schert das Politische nicht. In einem der Spiegelteiche vor der Kongresshalle sprudeln zehn Schmuckfontänen, im Sprühnebel des Wassers schillert ein Regenbogen. In dem zweiten Teich, auf der anderen Seite der Freitreppe, lassen Ruheständler mit Schiebermützen, eine Zigarettenkippe im Mundwinkel, die Hemdsärmel aufgekrempelt, ihre Modellboote zu Wasser. Sie plaudern und fachsimpeln über Funkfernsteuerungen. Kinder hocken auf der Betoneinfassung des Teichs und beobachten fasziniert die kleinen Boote. Ein Mann hat das knallrote Modell eines Feuerlöschboots mitgebracht. Zur Freude der Kinder gibt das Boot auf Knopfdruck ein aufgeregtes blechernes «Tatütata» von sich. Und alle paar Minuten aktiviert der Bootsführer stolz lächelnd eine Pumpe, dann malt ein munterer Strahl aus den drei Löschwasserkanonen auf dem Vorderdeck des kleinen Boots filigrane Muster in den azurblauen Maihimmel.
Jürgen Prosch schwitzt. In der Küche des Restaurants der Kongresshalle herrscht Hochbetrieb. Probekochen für die Jahrestagung des Rings Deutscher Makler. Das traditionsreiche Restaurant liegt im spreeseitigen Flügel der Kongresshalle. Draußen vor dem Fenster fahren die Ausflugsdampfer. Jürgen Prosch arbeitet für das Kempinski, das bewirtschaftet die Restaurants in ICC, Funkturm und Kongresshalle. Gerade ist er zum Chefkoch befördert worden, er verdient jetzt ganz gut. Seine Spezialität ist die große Häppchen-Platte. Käsecreme-Häppchen mit Walnuss obendrauf. Die gab es schon vor zwei Jahren, als US-Präsident Jimmy Carter die Kongresshalle besuchte. Vielleicht, denkt Jürgen Prosch, während er eine süffige dunkle Bratensoße abbindet, könnte er am 17. Juni freinehmen und mit seiner Karin auch eine Dampferfahrt auf der Spree machen. Mit dem neuen Gehalt könnte er um ihre Hand anhalten. Eine Familie gründen. Der Gedanke gefällt ihm.
Munter wirbelt Prosch mit Töpfen und Pfannen, rührt, wendet, schmeckt ab, teilt die Arbeit ein, bringt seine Küchenmannschaft auf Trab, rennt von einem Gasherd zum anderen. Gerade schwingt er den Kotelettspalter. Deshalb hört er das dumpfe Grollen auch nicht sofort. Erst als die Wände schwanken, hält er entsetzt inne. Es knallt. Der Strom ist weg. Der Kotelettspalter fällt Jürgen Prosch aus der Hand. Plötzlich ist ein seltsames Pfeifen in der Luft. Ein gespenstisches Bersten und Krachen. Die Luft vibriert. Das Gebäude erzittert, Glas splittert. Jürgen Prosch dreht sich um, reißt die Tür zum Restaurant auf. Menschen schreien dort in Panik. Prosch rennt Richtung Spree, stürzt auf die Restaurantterrasse. Hinter ihm ein ohrenbetäubendes Getöse von zusammenbrechenden Betonmassen. Auf dem Rasen vor ihm stehen hustende Menschen und starren mit offenem Mund auf die Halle. Prosch wirft sich ins Gras. Glasscherben wirbeln durch die Luft, Betonstaubnebel wallt auf. Eine Bombe? Ein Erdbeben? Jürgen Prosch weiß, im Konferenzsaal ist noch eine Versammlung mit 120 Teilnehmern. Plötzlich schießt ihm durch den Kopf: Das Gas! Ich muss das Gas der Kochherde ausdrehen, sonst explodiert das ganze Haus!
«Haben Sie gesehen, wie das Dach abgehoben hat?», sagt einer hustend neben ihm im Gras.
«Det wa’n de Russen!», schreit eine Frau. «Ick hab’s imma jewusst!»
Jürgen Prosch kämpft sich hoch. Er muss wieder zurück ins Restaurant. Den Gashaupthahn abdrehen, der ist in der Spülküche. Aber eine schreiende Menschenmenge kommt ihm durch die Küchentüren entgegengequollen. Ein Mann rennt in Panik direkt in die Glasscheibe. Sein Blut spritzt Jürgen Prosch ins Gesicht. Der schiebt mit der Kraft der Verzweiflung die Menschen auseinander, quetscht sich zurück ins Haus, stürzt in die Küche. Der Boden ist glitschig von Blut. Glas knirscht unter seinen Schuhen. Prosch findet den Haupthahn und schraubt ihn zu. Das Gebäude scheint sich um ihn zu drehen. Dieser neumodische Spannbeton! Aber nein, denkt Jürgen Prosch, das haben doch die Amis gebaut. Und der TÜV hat’s abgenommen.
Prosch hat alles getan, was er tun konnte. Er sucht unter dem Betonstaub seinen Kotelettspalter und reißt ihn an sich. Er denkt an Karin. Er muss hier raus. Aber im Restaurant ist kein Durchkommen mehr zur Spree. Prosch wirbelt herum, läuft Richtung Foyer. Betonmehl wallt ihm entgegen. Er bekommt keine Luft, es ist dunkel im Foyer, Menschen schreien. Er taumelt durch Schutt und Bahnen von Dachpappe. Irgendwo vor sich sieht Jürgen Prosch etwas Licht, dort muss der Haupteingang sein. Er hastet am Aufgang zum Theatersaal vorbei auf das Licht zu. Große Gesteinsbrocken haben das Dach des Foyers durchschlagen und versperren den Weg zur Glasfront mit dem Eingang. Prosch gerät in Panik. Was, wenn er hier nicht rauskommt? Er klettert über einen Berg aus Stahlbeton, schürft sich Hände und Knie auf. Mit dem Kotelettspalter schlägt er das Glas aus einem Segment der Eingangsfront. Endlich Luft! Prosch zwängt sich durch das enge Fenster ins Freie. Der vordere Dachkranz liegt vor ihm – abgebrochen. Prosch erkennt darunter Autos, zerquetscht vom Betonbrocken. Er springt über ein geborstenes Geländer und kommt neben einem VW Käfer auf, der mal silberfarben war. Der Wagen ist gefaltet wie eine Papierserviette. Ein Knarren. Prosch schaut nach oben. Das Dach der Kongresshalle ist aufgegangen wie ein Reißverschluss.
Er hat unverschämtes Glück gehabt, denkt Jürgen Prosch. Jetzt wird er gleich das Aufgebot bestellen. Es hätte ja alles aus sein können. Da gibt es einen höllischen Knall, ein grauer Schatten fliegt auf Prosch zu. Er will an Karin denken, aber er kommt nur noch bis K.
EINSMontag, 6. Oktober 1980
HAM SE ’ne neue Braut?»
Kriminalkommissar Peter Kappe zuckt zusammen und schaut auf. Er steht vor der Haustür des humorlosen hellgelben Neubaus in der Fuggerstraße, in dem er seit vier Jahren wohnt. Der Oktoberregen macht gerade Pause. Die Witwe Schulze hat auf ihrem Ansitz im Hochparterre Platz genommen. «Unsere Fensterhenne», wie Kappes Nachbar sie immer nennt. Die Aufgabe der Schulze ist es, von ihrem Küchenfenster Ausguck zu halten. Dafür hat sie eine eckige helle Hornbrille mit dicken Gläsern und Brillis an den Bügeln. Ihre Dauerwelle ist frisch, ihre weißen Haare kringeln sich glamourös wie bei der Queen Mum. Ihre Löckchen passen zu dem Häkelmuster des Kissens, auf dem ihre wabbelweichen Unterarme ruhen.
«Schön wär’s, wenn ich eine neue Braut hätte», sagt Kappe lächelnd. «Wie kommen Sie denn auf so etwas?»
«Na, Se ham die Haare ab. Ihr Hippiezopp ist wech. Jetz sehn Se aus wie ’n richtia Beamta. Bei Frauen sacht man ja: neue Frisua, neuet Lebn.»
Kappe hat gar nicht mehr daran gedacht. Schnipp, schnapp, Zopf ab. Spontaner Entschluss letzte Woche, nachdem er Detektiv Rockford – Anruf genügt im Ersten gesehen hatte. Er mag den Rockford, der seine Knarre in der Keksdose versteckt und mit seinem Pontiac Firebird einen wahnsinnig amerikanischen U-Turn über die Mittellinie der Straße hinlegen kann. Seine halblangen Haare mit den Koteletten wirken locker und trotzdem seriös. Nicht so politisch wie die langen Haare, die Kappe getragen hat. Allerdings kommt der Winter, er wird hinten am Hals frieren. Außerdem vergisst er ständig, dass er seinen Küchenhaarschnitt bei einem richtigen Friseur nacharbeiten lassen muss. Nun ja, ein Friseurbesuch, für ihn ist das lästig, aber für Frauen im gesetzten Alter ist das wie Rock ’n’ Roll. «Habe ich selbst geschnitten», gesteht Kappe der Schulze. «Sie waren aber auch beim Coiffeur, nicht wahr? Sehr chic!» Eine Spinatwachteldauerwelle halt. Aber darum geht es ja gar nicht. Wie die Friseure in ihren abgewetzten Kitteln im Salon stehen und miteinander tratschen, das wirkt auf West-Berliner Witwen erotisierend. Das Haaremachen ist dabei vollkommen nebensächlich. Friseure sind in Charlottenburg Säulenheilige.
Die Schulze neigt errötend den Kopf. «Ach, Herr Kriminaler», flötet sie, «det fällt Se uff?»
Kappe nickt ihr abwesend zu. 38 ist er jetzt, und je älter er wird, desto zerstreuter wird er – auch hierin irgendwie Detektiv Rockford ähnlich. Jetzt zum Beispiel hat Kappe gerade seine cognacbraune Lederaktentasche durchwühlt, aber nichts: Er muss seinen Hausschlüssel im Schreibtisch auf dem Revier liegen gelassen haben. In solchen Fällen ist die Schulze sehr nützlich. Sie ist nicht nur billiger als eine Überwachungskamera, nimmt die Parade der Passanten und Nachbarn ab, sieht alles, weiß alles und ist für alles zuständig, sondern sie hat auch alle Zweitschlüssel. «Frau Schulze, hätten Sie vielleicht noch einen Moment Zeit für mich?», säuselt Kappe. «Ich fürchte, ich habe meinen Schlüssel im Büro vergessen. Wären Sie so nett, mich kurz in meine Wohnung zu lassen?»
Klar, die Schulze ist so nett. Die Rentnerinnengeneration mit ihrem Trümmerfrauenstolz, das sind typische Ur-Berliner. Gefühl und Härte, das ist ihr Lebensmotto. Ihre Männer sind im Krieg geblieben, also wärmen sie sich an der Abgeschlossenheit West-Berlins und dem Beschütztsein durch die Mauer. Die Mauer sorgt für ein wohliges Lebensgefühl, wodurch Frauen wie die Schulze so richtig Oberwasser bekommen.
«Dass det ma nich zur Jewohnheit wird, junga Mann!» Sie droht Kappe neckisch mit dem rheumagekrümmten Zeigefinger. «Ick bin ooch nich zu jede Tajes- und Nachtzeit jreifba. Na, kommse ma. Een Jlück, det ick hier fast alle Zweetschlüssel habe, wa? Und nett bin ick ooch noch!»
Echte West-Berlinerinnen leben von einem Schuss Arroganz. Na klar, die Schulze wohnt ja auch am besten Ort in Deutschland. Sie hat Charlottenburg wiederaufgebaut. Also maßt sie sich ein moralisches Urteil an. Über die Nachbarn, über Jüngere, über die Wessis, über die Ossis. Und über schusselige Kriminalkommissare.
Zwanzig Uhr. Ein bürgerliches Wohnzimmer in Baumschulenweg, Ost-Berlin. Es riecht nach Wofasept – scharf, muffig, ein bisschen nach Plaste. Irmgard Krämer putzt gerne damit. Ihr Mann Hugo hat das Reinigungsmittel von früher gebunkert, als er die Firma noch hatte. Irmgard putzt überhaupt gerne. Am liebsten den neuen Farbfernseher. Der RFT Colortron 3000 steht auf einem Tischchen mit Häkeldecke. Das Gerät hat 6250 Mark gekostet, ein Vermögen. Irmgard Krämer staubt es jede Woche montags sorgfältig ab. Ihr Mann Hugo liebt das Gerät auch: seine sanft geschwungene Mattscheibe, die elegante steingraue Front, das nussbaumfarben furnierte Gehäuse, die moderne grüne Digitalanzeige für den ausgewählten Sender. Die Krämers haben weiter nichts, was sie lieben könnten. Sie sind Rentner. Sie hatten mal eine Firma, aber seit der Verstaatlichung haben sie nichts mehr. Der Hugo war selbstständig mit einem Unternehmen, das er von seinem Vater geerbt hatte. Die Irmgard hat ihm in der Buchhaltung geholfen. Der Sozialismus hat ihnen alles genommen, glaubt sie – das Kind, das Lebensglück, zuletzt auch noch die Firma. Der Hugo hat sich kaputtgearbeitet. Das Herz. Reisen könnten sie sowieso nur ins sozialistische Ausland, also ist jetzt der teure Fernseher ihr einziger Luxus.
Irmgard Krämer macht ihnen jeden Tag nach dem Abendbrot noch eine zweite Tasse Mocca Fix Gold. Das hat medizinische Gründe. Sie trinken ihn aus den guten Sammeltassen ihrer Mutter. Und der Hugo biegt unterdessen die Antenne zurecht. Westfernsehen zu gucken ist nicht wohlgelitten, auch wenn man nichts Schlimmes mehr zu befürchten hat. Die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki im August 1975 hat nach und nach zu einer Tolerierung des Empfangs von Westsendern geführt. Nur die im Tal der Ahnungslosen – rund um Greifswald und Dresden – können das nicht empfangen. Alle anderen frönen der seichten Unterhaltung aus dem Westen. Das ist Republikflucht im Geiste. Sogar Honecker hat öffentlich erklärt, dass er Westsendungen sieht.
Die Krämers nehmen auf dem Sofa Platz, er links, sie rechts. Die Fanfare der Tagesschau erklingt, der hellgelbe Titel der Sendung erscheint vor der blauen Weltkarte. Andächtig lauschen die Krämers dem adretten Herrn mit der modischen Brille, der die Nachrichten von einem gelblichen Blatt Papier abliest. Es geht um den Protest der Westalliierten gegen die Militärparade, mit der die DDR heute in Berlin den 31. Jahrestag ihrer Staatsgründung gefeiert hat. Die Westmächte sehen durch die Feier den Viermächtestatus der Stadt verletzt. Dann geht es nach Großbritannien: In Brighton haben die britischen Konservativen ihren viertägigen Parteitag eröffnet. Premierministerin Margaret Thatcher bekräftigt, sie wolle ungeachtet der hohen Inflationsrate und der wachsenden Arbeitslosigkeit an ihrer Wirtschaftspolitik festhalten. Sie betont außerdem, dass Großbritannien die Europäische Gemeinschaft nicht verlassen werde. Danach berichtet die Tagesschau über das Attentat auf dem Münchner Oktoberfest in der vergangenen Woche. Der Bombenanschlag war der bisher schwerste Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik, sagt der Nachrichtensprecher: 13 Personen wurden getötet und 221 verletzt. Es wird vermutet, dass der Anschlag auf das Konto der rechtsextremen «Wehrsportgruppe Hoffmann» geht. Der Generalbundesanwalt ermittelt.
Gegen Ende der Sendung kommt ein Hintergrundbericht über den Einsturz des Dachs der West-Berliner Kongresshalle im vergangenen Frühjahr. Die Untersuchungen zur Unglücksursache stehen kurz vor dem Abschluss. Gezeigt wird die Untersuchungskommission bei einer Ortsbesichtigung in den Trümmern des Dachs.
Irmgard Krämer braucht ein paar Sekunden, um zu begreifen, was sie da sieht. Die Erkenntnis trifft sie wie ein Stromschlag. Sie lässt die Kaffeetasse fallen. «Hugo!», keucht sie und springt auf. «Da, Hugo! Hast du gesehen?»
Als die Fensterhenne vor Kriminalkommissar Kappe das Treppenhaus hochwippt, fällt ihm auf, dass ihre Beine mit zunehmendem Alter immer krummer und immer blauer werden.
«Wat macht denn die Familie?», fragt die Schulze über die Schulter.
Ein bisschen Klatsch und Tratsch, das ist der Preis, den man für die Dienste der Schulze zahlen muss. Und im Haus ist halt bekannt, dass Kappes Frau samt Tochter mit einem anderen durchgebrannt ist, der einen besseren Job hat: Handlungsreisender der Firma Schering in Sachen Verhütungsmittel.
Kappe gibt der Witwe Schulze, was sie braucht. «Meine Ex ist wieder schwanger», sagt er. «Alles gesund so weit. Es wird ein Junge.»
Seit letztem Jahr ist Kappes Scheidung von Sarah durch. Jetzt leben Ex-Frau und Tochter in Kenilworth, Union County, New Jersey. Das amerikanische Unternehmen Schering-Plough hat dort seinen Stammsitz. Schön im Grünen gelegen, aber nach New York City sind es nur ein paar Kilometer. Vier Jahre liegt die Trennung nun schon zurück. Anfangs hat er sich eingeredet, es sei nur eine Phase.
«Ick jratulier ma trotzdem», sagt die Schulze ganz pragmatisch. «Is ja ooch irgendwie een Familienmitjlied.»
Kappe lacht. «Der kann ja später die Familientradition fortsetzen und zum New York City Police Departement gehen», sagt er. Denn seit drei Generationen, seitdem Großonkel Hermann 1910 aus Wendisch Rietz nach Berlin gekommen war, arbeiten die Kappes bei der Polizei.
Das weiß die Schulze natürlich. Jeder weiß es. Es gehört zu West-Berlin wie der Durchsteckschlüssel und die Senatsreserve.
Sie kommen vor Kappes Wohnungstür an. Kappe ist etwas kurzatmig. Er denkt daran, mit dem Rauchen aufzuhören, wie jeden Tag. Im Briefschlitz seiner Wohnungstür klemmt die Tageszeitung. Strauß verliert, Schmidt bleibt im Amt, lautet die Schlagzeile.
«Und, wat hab ick Sie jesacht?» Die Schulze zieht die Zeitung aus dem Schlitz. «Een Bayernlümmel wie der Strauß kann in Westdeutschland niemals nich politisch janz nach oben komm.»
«Sie hatten recht, Frau Schulze.» Kappe lächelt. «Wie immer.»
Gestern, am Sonntag, hat man in Westdeutschland den 9. Deutschen Bundestag gewählt, und in West-Berlin hat man dabei zugeschaut. West-Berlin wird ja offiziell von den Westalliierten und nicht von der Bonner Bundesregierung regiert. West-Berliner haben nur einen «Behelfsmäßigen Personalausweis» und kein Stimmrecht, sie können die Wahl nur hinnehmen. Die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt ist bestätigt worden. CSU-Herausforderer Franz-Josef Strauß hatte keine Chance.
«So schlecht jeht et de Wessis nu doch noch nich, det se den wähln tun», fasst Frau Schulze das Wahlergebnis zusammen.
«Ich habe dem Strauß nicht verziehen, dass er gesagt hat, kritische junge Leute seien verdreckte Vietcong-Anhänger, die öffentlich Geschlechtsverkehr betreiben», sagt Kappe.
«So wat hört keener jerne.» Die Schulze kramt den Zweitschlüssel aus der Tasche ihrer Kittelschürze und schließt Kappes Wohnung mit einer verdächtig routinierten Bewegung auf. Triumphierend tritt sie beiseite. «Na, da hab ick Sie den Feierabend jerettet, wa?»
Kappe greift in seinen Küchenschrank und drückt ihr ein Pfund Kaffee in die Hand. Eduscho Gala Nr. 1. Na, wenn das nichts ist! «Sie sind wirklich noch vom alten Schlag.» Halb lobhudelt er, halb ist es ihm ernst. «Ich kann mich immer auf Sie verlassen, Frau Schulze. Dafür danke ich Ihnen. Machen Sie sich doch erst mal einen schönen Filterkaffee. Bei dem kalten Herbstwetter braucht man das.»
Kappe kann mit Filterkaffee großzügig sein, denn der schmeckt ihm nicht. Die braunrot glänzende Eduscho-Packung ist etwas klebrig. Sie ist schon durch das halbe Präsidium gereicht worden wie ein Wanderpokal. Vermutlich sind die Fingerabdrücke des gesamten LKA auf der Umverpackung. Kappe selbst hat das halbe Pfund von einem Mitglied der in Auflösung begriffenen Weiblichen Kriminalpolizei geschenkt bekommen, die es ihrerseits von einer Verdächtigen bekommen hatte, von der sie es aber nicht hätte annehmen dürfen. In Unkenntnis dieser Provenienz strahlt die Schulze und schiebt winkend ab.
Kappe wirft seine Aktentasche und den nassen Mantel über den Küchenstuhl. Oktober in Berlin, das ist wie 31 verregnete Montage am Stück. Und die Umstellung auf diese neue Sommerzeit steckt Kappe auch noch in den Knochen. Zum allerersten Mal wurden in diesem April alle Uhren in Ost wie West eine Stunde vorgestellt. Angeblich weil so das Tageslicht besser ausgenutzt und damit Energie gespart werden kann. Eine Idee, die während der Ölkrise entstanden ist. Die Deutsche Bundesbahn hat Zehntausende Fahrpläne neu drucken lassen und über 80 000 Uhren in den Bahnhöfen fristgerecht umstellen müssen. Ein Riesenaufwand.
Und am Sonntag vor einer Woche hat man die Zeit nun wieder auf Winterzeit umgestellt – die Nacht war unversehens eine Stunde länger gewesen.
Kappe greift nach dem Dosenöffner, um die bereits dritte Raviolidose in dieser Woche zu öffnen. Seinen einzigen Kochtopf hat er erst gestern benutzt und noch nicht abgewaschen.
Ob er einfach die Dose auf die Herdplatte stellen soll? Oder die Ravioli in der Bratpfanne warm machen? Sieht doch keiner. Kappe denkt nicht oft übers Essen nach, denn auf der Dienststelle ist zur Zeit viel zu tun. Am Mittwoch soll die 6. Mordkommission Verstärkung bekommen, hat ihnen ihr Chef, Kriminalhauptkommissar Harry Engländer, angekündigt. Soll ihm recht sein. Kollege Landsberger mit seiner menschenfreundlichen und korrekten Art wird den Neuen schon einarbeiten. Kappe kippt die Ravioli in die Pfanne, schaltet den Herd an und schaut der roten Sauce beim Blubbern zu. Er fühlt sich müde und machtlos, als hätten seine Tage keine Zukunft.
Sein Blick fällt auf das Stadtmagazin Zitty. Es liegt aufgeschlagen neben dem Herd. Kappe hat sich ein Konzert im «Quasimodo» angestrichen. Es spielt die Outpost Blues Band. Heute. Die Combo kennt er noch nicht. Er seufzt und schaut auf die Uhr. Es ist früher als gedacht, Zeit genug hätte er also noch. Kappe könnte sich auch mit einem Bier vor die Glotze setzen und Drei Lederhosen in St. Tropez schauen – laut Programm geht es um einen Zuchtstier und frech-frivole Völkerverständigung. Aber Peter Kappe lebt schließlich in West-Berlin, da kann er sich auch live von handgemachter Mucke ins Feierabendparadies schubsen lassen.
Das «Quasimodo» ist ein kleiner Club im Keller des Delphi-Filmpalasts in der Kantstraße. Kappe hat keine Ahnung, warum das «Quasimodo» so beliebt ist, denn es ist eng, niedrig, verraucht und eigentlich immer überfüllt. Eine ehemalige Studentenkneipe mit Kleinkunstbühne, die sich zu einem Musikertreff und Ort für spontane Jamsessions entwickelt hat. Es gibt mehrere Konzerte in der Woche, die immer abends um zehn anfangen. Das Programm ist gemischt, mit einem Schwerpunkt auf Jazz und Blues. Letztens hat sogar eine deutsche Band gespielt, Wolfgang Niedeckens BAP aus Köln. Die haben Kölsch gesungen, aber gar nicht übel.
Der Laden ist überheizt, die Luft steht, die Bühne ist mit staubigen schwarzen Vorhängen abgehängt. Kappe drängelt sich zur Bar vor und holt sich ein Beck’s Bier. Die Musiker kommen auf die Bühne. Eine Gitarristin, ein Bassist, ein Schlagzeuger und ein schwarzer Leadsänger mit einer Mundharmonika, alle gekleidet im psychedelischen Hippie-Stil. Kappe freut sich, dass er einen halben Kopf größer ist als die meisten Leute. So kann er lässig an der Bar lehnen bleiben, ohne etwas zu verpassen.
Es wird still im «Quasimodo». Kappe hört die ersten Töne. Der Drummer führt die Band in das richtige Tempo, indem er leise die Sticks gegeneinander schlägt. Kappe schließt die Augen und zählt innerlich mit: «1 – 2 – 3 …» Er weiß, die richtigen Blues-Cracks spielen «in between», also mit verzögertem drittem Schlag. Die Gitarristin schleift die ersten Noten ein, bluesig, kantig, bissig. Kappe erkennt das zerlegte Riff sofort, das seine Beine schon wippen lässt. Es groovt, zieht ihn mit, ohne dass er sich wehren kann oder will. Sein Kopf nickt im Takt. Kappe liebt das.
Er öffnet die Augen, um das Bier auf den Tresen zu stellen und sich eine Zigarette anzuzünden. Die Frau an der Gitarre geht ganz in ihrer Musik auf. Kappe kennt sie nicht. Das wundert ihn, denn die Szene in West-Berlin ist nicht allzu groß, und er hat die meisten Bands schon mal gehört. Sie trägt ein zerschlissenes Männerhemd, unzählige lange Halsketten übereinander, eine weite karierte Hose mit Hosenträgern sowie Cowboystiefel. Dazu eine lederne Baskenmütze, unter der sich dunkelblonde Locken kringeln. Die Frau ist nicht hübsch im eigentlichen Sinne – kein Make-up, dafür eine große runde John-Lennon-Sonnenbrille. Sie hat Klasse. Sie ist eine Frau, die schon ein Leben gelebt hat, bestimmt zehn Jahre älter als Kappe, groß und präsent. Und sie fühlt die Musik. Kappe greift nach seiner Eintrittskarte, um nach ihrem Namen zu schauen.
«Die ist gut, nicht wahr?», sagt in diesem Moment eine Stimme dicht neben seinem Ohr. «Was die spielt, ist der real deal, nicht so ein rockiger shit.»
Die Frau auf der Bühne legt den Kopf in den Nacken und schmeißt ihre Locken. Cool! Kappe wendet den Kopf. Ein großer, kräftiger Mann steht neben ihm, der ihm vage bekannt vorkommt. Der Typ ist Ende vierzig, ein schwarzer Amerikaner mit zackigem Haarschnitt. Sein Anzug ist in Topform, und sein Stiernacken sitzt wie ein Seidenschal. Er spricht Deutsch fast ohne Akzent, aber er wirkt trotzdem wie ein Soldat in Zivil.
«Als ich die das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht: Wow, wie kann es sein, dass eine weiße Frau so toll den Blues spielen kann!», sagt er.
«Bei Ihnen zu Hause erzählt man sich ja», entgegnet Kappe, «dass sich die richtigen Blues-Cracks mit dem Teufel einlassen. Im Tausch gegen ihre Seelen gibt ihnen der Teufel ihr musikalisches Genie.»
«Oh, really? Wie praktisch.» Der Mann mustert Kappe von oben bis unten. «Wenn der Teufel ihnen Genie gibt, müssen sie also nie mehr proben?»
«Sind Sie nicht dieser Offizier, der Make Blues, not war propagiert?» Unter dieser Überschrift hatte Kappe einen Artikel über den Mann in der Zitty gelesen.
«Zugegeben, ich bin mit der Army hier, ein buffalo soldier, aber ich bin auch ein blues man. Ich spiele Bass. Vielleicht haben Sie mich mit meiner Band schon mal hier gesehen. Big Bill Bukowski and his Bloody Blues Band.»
«Ja, natürlich.» Kappe nimmt einen Schluck. Ganz gut, diese Combo.
«Ich bin Big Bill.»
«Ich bin Kappe.»
Sie stoßen mit ihren Bierflaschen an. Kappe nimmt einen Zug von seiner Zigarette, lehnt sich zurück gegen den Tresen und widmet seine ganze Aufmerksamkeit dem nächsten Song. Es ist was Langsames, The Thrill is Gone, eigentlich von B. B. King, stimmungsvoll und direkt aus der Seele, in traditionellem zwölftaktigem Blues-Schema.
Kappe ärgert sich noch immer, dass er damals den Gitarrenunterricht an der Musikschule abgebrochen hat. Als kleiner behüteter Knirps weiß man eben noch nicht, was wichtig ist im Leben. Man kann noch nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen – und man hat keine Ahnung davon, dass einen eines Tages die Frau sitzen lassen wird. «You know, I’m free, free now, baby /I’m free from your spell», seufzt der Leadsänger ins Mikro. Manchmal hilft eben nur noch der Blues.
ZWEIDienstag, 7. Oktober 1980
NACH EINER VIERTELSTUNDE hat es aufgehört zu bluten. Er hat ein paar Kleenex-Tücher dabei gehabt, die hat er draufgepresst. Den Arm hochgehalten, den Ärmel des Mantels umgeschlagen. Jetzt fühlt er nichts mehr. Warum ist er bloß in diese gottverdammte Stadt gekommen! Aber es ist ja richtig, dass er gekommen ist. Englische und längst vergessen geglaubte deutsche Wörter laufen in seinem Kopf um die Wette. Seit ein paar Tagen gewinnen die englischen Wörter nicht mehr.
Er stolpert, seine Hoden sind geschwollen, dort, wo ihn der Fuß getroffen hat. Er zwingt sich zu einem Schritt und zu noch einem, durch den stockdunklen Tiergarten. Auch zwischen den Beinen müsste es eigentlich wehtun, aber das tut es nicht. Stattdessen nimmt er den Herbstgeruch des Parks überdeutlich wahr, Pilze, Moose, feuchtes Laub. In Amerika kann er die Jahreszeiten nicht so über den Geruch bestimmen. Hier riecht der Herbst nach Heimat. Wie ein Tier berauscht er sich an der morbiden Witterung vom nahen Ende. Vom Großen Stern hinkt er in die Hofjägerallee. Es ist drei Uhr morgens, mitten in der Nacht. Die Straßen sind leer, von einer gelegentlichen Nutte mal abgesehen. Trotzdem ist er wachsam. Wegen der Nähe zur Mauer fahren hier öfters Polizeistreifen.
Er wohnt im InterContinental an der Budapester Straße. Von der Kongresshalle kaum eine halbe Stunde zu Fuß. Als er durch den Hintereingang in die Garage des Hotels schlüpft, hat er schon keine Erinnerung mehr an den wahnhaften Fußmarsch. Er braucht etwas, um die Wunde zu versorgen. In so einem Fünf-Sterne-Hotel steht immer eines von den Schlachtschiffen unabgeschlossen in der Tiefgarage. Er nimmt den Verbandskasten aus dem erstbesten offenen Kofferraum. Er denkt: Eine Hand – gut, das ist ein Preis, den man zahlen kann. Der Mensch hat ja zwei. Es ist die rechte Hand, Gott sei Dank, und nicht die linke, an der er den Ehering trägt. Was hätte Victoria gesagt, wenn der Ring weg gewesen wäre? Er wird mit links schreiben lernen müssen.
Er hat eine Handvoll Aspirin geschluckt, die er immer dabei hat. Dann hat er den Stumpf verbunden. Hat den Room Service angerufen und sich zwei Flaschen Malteser Aquavit und eine Packung Spalt Schmerztabletten kommen lassen. Dann ist er eingeschlafen. Hat geträumt, dass er in seinem Haus am Atlantik am Pool liegt. Als er wach wird, nimmt er die Spalt-Tabletten. Obwohl er nichts spürt. Wenn er die Augen schließt, dann kann er jeden einzelnen Finger seiner rechten Hand bewegen. Aber wenn er die Augen aufmacht, ist da keine Hand.
Der Abend ist lang und melancholisch gewesen. Kappe ist bierschwer ins Bett gefallen und steht mit dem Gefühl auf, die Welt würde um ihn statt um die Sonne herumeiern. Apropos Sonne – die hat hier schon lange keiner mehr gesehen. Es regnet schon wieder. Scheinbar regnet sich ein Tief von der Größe Sibiriens am Teufelsberg ab. Kappe raucht eine Ernte 23 am offenen Fenster. Dann zieht er die Sachen von gestern wieder an. Der Badewannenrand hat sie aufgebügelt.
Er kramt die Dienstwaffe aus dem Brotkasten in der Küche. Brötchenkrümel kleben an der Griffschale. Kappes SchimanskiParka ist noch feucht von gestern Abend. Eleganz, Charme, Weltläufigkeit – nichts davon zeigt ihm sein Garderobenspiegel. Stattdessen eher den Körper eines 50-jährigen Religionslehrers. Aber für die Außenwirkung hat Kappe ja den Kollegen Wolf Landsberger im Team.
Das Präsidium der Mordkommission in der Keithstraße ist keinen Kilometer von Kappes Wohnung entfernt, aber es ist ein nasser Kilometer. Die Fuggerstraße riecht nach frischem Asphalt, Dieselsmog und Herbstlaub. Ein Auto braucht Kappe nicht mehr, seit er so zentral wohnt. Das macht sich auf seinem Konto gut. Den Unterhalt für die kleine Tabea zahlt er gerne und pünktlich. Obwohl die Ärztin Sarah das Geld nicht wirklich braucht. Es nervt Kappe fast selbst, dass er so handzahm geworden ist. Ein West-Berliner Polizist sollte charakterfest und kantig sein. Zumindest aber skurril. Denn hier sind alle irgendwie schräg. Ob West-Berlin solche Typen nur anzieht oder selbst produziert, ist ihm unklar. Kappe hat mal gehört, dass die großen Städte mit ihrer übersteigerten Genussgeschwindigkeit die Nerven überreizen, und schon passiert es: Der eine wird Künstler, der Nächste Wehrdienstflüchtling, der Dritte lebt recht komfortabel von Schwarzarbeit und/oder Sozialamt, wieder andere halten auf den Stufen der Gedächtniskirche unter dem Motto «Ficken ist Frieden» eine Mahnwache oder sind Kinder vom Bahnhof Zoo. In Berlin kann man machen, was man will, man muss dann eben bloß abkönnen, dass die anderen einen für eine Sau halten. Denn eine die Wogen glättende Mittelschicht gab es hier nie. Seit Vierzehnhundertlangsam war Berlin erst Residenzstadt, dann Hauptstadt, da wollten alle hin, Arbeiter und Hautevolee, Glücksritter, dazu ein paar Beamte. Beschaulichkeit à la Hamburg oder München ist der Stadt fremd. In Berlin muss jeder nach seiner Fasson selig werden, so die dreihundert Jahre alte und gern zitierte Botschaft des Alten Fritz: Alle machen, was sie wollen. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin, wie es in dem Song von Ideal heißt. Der Gesang schnell, punkig und so schnoddrig wie eine Bedienung an der Currywurstbude. Kappe mag diese Musik nicht, aber er mag sehr, dass es sie gibt. Auch Kappes Kiez in Schöneberg ist lasterhaft, voller Dynamik und Lebenslust – gleichzeitig aber auch spießig. Man weiß in West-Berlin, dass man hinter der Mauer in Sicherheit ist. Tagsüber beschaulich, nachts exzessiv.
Auf dem Weg zur Arbeit kommt Kappe an Künstlerkneipen und Herren-als-Damen-Clubs wie dem «Chez Romy Haag» oder dem «Chez Nous» vorbei. Das Versprechen französischer Frivolität in unsanierten Altbauten. Im Nachbarbezirk Wilmersdorf ist sogar ein stadtbekannter Zuhälter und Ganove namens Otto Schwanz – kein Künstlername! – aktives Mitglied der CDU und gut Freund mit dem Baustadtrat.
Kappe betritt das LKA 1, Delikte am Menschen. An der Glastür im Foyer hängen ein paar RAF-Steckbriefe. Kappe schüttelt sich den Regen aus dem Haar wie ein nasser Hund. Das Gebäude macht Eindruck. Mit seiner wuchtigen Schaufassade ist es als «Landesversicherungsanstalt für die Provinz Brandenburg» in der Kaiserzeit errichtet worden. Jetzt gehen hier schon seit Jahrzehnten Mörder, Vergewaltiger und Kinderschänder ein und aus. Es stimmt Kappe jeden Morgen nachdenklich, wie zu Hause er sich hier fühlt.
Er geht durch das in Grüntönen gehaltene, prachtvolle Foyer mit seinem gemusterten Steinboden, den Säulen, der Marmorfreitreppe. Die Pförtnerloge wird wie von einem Portal eingefasst. Über ihr hängt eine reich verzierte Messinguhr in der Größe eines LKW-Reifens an armdicken Goldketten von der hohen Decke. Kappe schließt seine Dienstwaffe in der Waffenkammer ein. Der Pförtner flüstert ihm ein bedeutungsschwangeres «Dein Chef hat schon nach dir gefragt!» zu.
Die Babsi heißt natürlich nicht wirklich Babsi. Aber keine Frau hier verwendet ihren richtigen Namen. Die Babsi geht auf den Strich, an der Straße des 17. Juni. In West-Berlin gibt es keinen Sperrbezirk, also stehen die Prostituierten auch hier, in Rufweite zum Reichstag. Der 17. Juni, das war mal ein Prachtboulevard, jetzt ist es nur noch eine kalte, verstümmelte Ost-West-Magistrale. Eine öde, löcherige, sechsspurige Betonpiste, die auf eine rot-weiß gestreifte Absperrung vor dem Sowjetischen Ehrenmal zuläuft. Davon hält man sich lieber fern. Ein grüner Wolga steht auf dem Mittelstreifen. Zwischen martialischen Panzern patrouillieren Ehrenwachen der Sowjetarmee. Die Inschriften versteht die Babsi nicht, Kyrillisch soll das sein, hat die Olga ihr erzählt. «Ewiger Ruhm den Helden» und so weiter. Zweitausend tote Soldaten sollen da verbuddelt sein, man darf nur Tempo dreißig fahren. Ein paar hundert Meter weiter, hinter einer kahlen Betonmauer, liegt grau und verloren das Brandenburger Tor auf einem Streifen Niemandsland. Hasen hoppeln über den Todesstreifen. Achtung!, verkündet ein schäbiges Schild, Sie verlassen jetzt West-Berlin. Jemand hat das durchgestrichen und Wie denn?? daruntergeschrieben. Am Torhaus weht die rote Sowjetflagge. Man kann hier jederzeit erschossen werden, einfach so.
Die Ecke ist der Babsi unheimlich. Deshalb hat sie ihren Stammplatz weiter oben, Richtung Technische Universität, kurz hinter dem Charlottenburger Tor am Landwehrkanal. Das Tor ist so ein bröckeliges Relikt aus der Kaiserzeit, aber es gibt der Babsi Sicherheit. Es ist beleuchtet, man kann sich bei Regen unterstellen. Es regnet zur Zeit oft, auch heute Morgen.
Die Babsi steht schon ein paar Stunden zwischen den parkenden Autos und tritt von einem Fuß auf den anderen. Neue kniehohe Lacklederstiefel. Die Füße tun ihr weh. Sechs Kunden, das reicht auch für eine Nacht. Selbst eine schwarze Limousine war dabei, da hat die Babsi für jedes Bein, an dem sie die Nylons runtergezogen hat, fünfzig Mark kassiert. Jetzt geht die Sonne auf, die Straßen beleben sich. Sie weiß, im Hellen sieht man, dass ihr Gesicht nicht mehr frisch aussieht.
Als die Babsi gerade Feierabend machen will, kommt die klapprige gelbe Ente vom Gero angefahren. So früh am Morgen, das ist gar nicht seine Zeit. Die Bremslichter leuchten auf. Der Gero sitzt hinter dem Lenkrad und raucht. Sein schütterer Vollbart zittert. Junger Kerl um die dreißig, Student, er hat nichts, aber was er hat, trägt er zu ihr. Die Babsi nennt den Gero für sich immer den «Kristallprinzen». Er wirkt so irre zerbrechlich, wenn er high ist. Ganz dünn ist der. Der Gero ist ein Stammkunde. Ein Stammfreund, könnte man sagen.
Die Babsi tut bei jedem Freier so, als ob sie naturgeil wäre. Sie ist unabhängig, kein Zuhälter, keine Drogen. Sie wirft einen Kaugummi ein, Kopf hoch, die Hüften schwingen, die Schritte setzt sie wie eine Katze. Sie geht rüber zur Ente vom Gero, öffnet die Beifahrertür und steigt ein. «Morgen, Gero», sagt sie. Im Wagen riecht es nach billigem Schnaps. Das Autoradio spielt blechern She’s Gone von Bob Marley. «Willst du ein bisschen feiern?», fragt die Babsi.
«Morgen, Babsi.» Verhuschter Seitenblick. Der Gero stößt die Zigarette in den Aschenbecher am oberen Armaturenbrett, der offen steht wie ein Mund, mit den zerquetschen Kippen als verrottenden Zähnen.
«Was ist passiert, Gero?», fragt die Babsi.
Der Gero hält ihr mit zitternden Fingern einen amtlich aussehenden Brief hin. Babsi faltet ihn auseinander. Exmatrikulation wegen fehlender Rückmeldung zum Wintersemester, steht da.