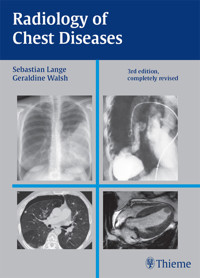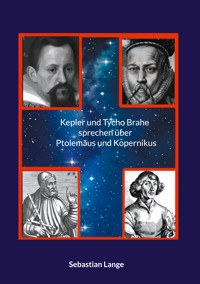Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1520 kam der Theologe, Astrologe, Magier und Meister der okkulten Philosophie Agrippa von Nettesheim in die freie Reichsstadt Metz. Dort führte er Gespräche über die Numerologie, die Astrologie, die Alchemie und die Astromedizin. Doch dann schickte ihn die Stadt als Beobachter zu einem Hexenprozess der Inquisition , und sein Leben veränderte sich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel: Vic-sur-Seille
Kapitel :Die Freie Reichsstadt Metz und die Kathedrale Saint Etienne
Kapitel: Die Stammtischrunde
Kapitel: Zahlenmagie
Kapitel: der Auftrag
Kapitel: Im Gerichtssaal I
Kapitel: Alchemie
Kapitel: Agrippa besucht den Bischof
Kapitel: Besuch in Woippy
Kapitel: Astrologie
Kapitel: Im Gerichtssaal II
Kapitel: Hexenfolter
Kapitel: Astromedizin
Kapitel: Agrippa bei Richter Leonhard
Kapitel: Abschied von Metz
Leben des Agrippa von Nettesheim
Literatur
Zeit der Handlung : 1520 bis 1522
Orte der Handlung : Freie Reichsstadt Metz, die Festung Vicsur- Seille, das Bauerndorf Woippy
Personen der Handlung
Agrippa von Nettesheim Doktor der Theologie und Medizin.
Beaumarchais: Apotheker in Metz
Dupont : Stadtmedikus in Metz
Laurent : Notar in Metz
Johann von Lothringen: Bischof von Metz
Conrad de Payen : Generalvikar der Diözese Metz
Nicolas Savini : Inquisitor und Assessor des Offizials
Josette Corbin: angeklagte Bäuerin aus Woippy
Jean Leonard: Richter in Metz
Richard de Raucourt: Oberschöffe von Metz
Philipp de Vigneuille: Stadtschreiber von Metz
1. Kapitel: Vic-sur-Seille
Am Anfang des 16.Jahrhundert lag im Tal der oberen Mosel die Grafschaft Metz. Der Landesherr, Graf Johann von Lothringen, war Bischof und vereinte auf sich -wie in seiner Zeit nicht unüblich- mehrere Kirchenämter. Ihm unterstand nicht nur das Bistum von Metz sondern auch das von Lyon, Narbone, Toul, Verdun und Nantes. Meist residierte er 30 Meilen südlich von Metz in Vic-sur Seille, einem kleinen Dorf, das zu einer Festung ausgebaut worden war. Es gab zwei Gründe, dass er diese kleine Ortschaft von nur 400 Seelen und nicht die große Stadt Metz als Residenz gewählt hatte. Zum einen war es die Nähe zu den Salzquellen in Vic-sur Seille, wo das gewonnene kostbare Salz dem Bischof den größten Teil seiner Einkünfte sicherte. Zum anderen war Metz im Jahre 1200 freie Reichsstadt geworden und stand unter dem Schutz des Kaisers. Die Bürger der Stadt waren wohlhabend und pochten gegenüber dem Landesherrn selbstbewusst auf ihren Privilegien. Bischof Johann empfand diese Stadt deshalb als eine Wanze im eigenen Fell oder eher als einen Pfeil im eigenen Fleisch. Zwar hatte das Generalvikariat des Bischofs seinen Sitz im Dominikanerkloster zu Metz, er selbst aber mied den Ärger mit den Bürgern und besuchte Metz so selten wie irgend möglich.
Im Tal der Seille sprudelten mehrere Solequellen, deren salzhaltiges Wasser in großen Tonpfannen, den sogenannten Briqetages, mit Holzfeuer erhitzt wurde, bis das Wasser vollständig verdampft war. Zurück blieb in den Pfannen das kostbare Salz, das in Becher und Kübel abgefüllt mit Ochsenkarren nach Vic-sur-Seile verfrachtet wurde, um später auf Lastkähnen über das Flüsschen Seille zur Mosel und nach Metz verschifft zu werden.
Die Besitzer von Salzquellen gehörten im Mittelalter und auch später immer zu den Reichen des Landes. Salz, das weiße Gold, war ein rares Gut und wurde von jedem gebraucht, denn ohne Salz verdarben Fisch, Butter, Käse, Fleisch, Wurst und Speck, und eine Vorratsspeicherung war überhaupt nur mit Salz möglich. Die Landesherren erhoben überall im Heiligen Römischen Reich eine Salzsteuer, die Gabelle. Das von ihnen billig erworbene Salz ließen sie in den Salzkammern, den Grenier à sel, zu hohen Preisen an die Bevölkerung verkaufen. Meist besaßen die Landesherren ein Staatsmonopol auf den Salzhandel und in einigen Regionen verordneten sie sogar, dass jeder Anwohner eine bestimme Menge Salz pro Jahr kaufen musste, um die Einnahmen des Landesherrn zu mehren.
Vic-sur-Seille an den Ufern der Seille war im Laufe der Jahrhunderte zu einer Burg mit Stadtmauer und Wassergraben ausgebaut worden. Über drei Zugbrücken erreichte man hohe Tore. Das Tor im Norden, port Saint-Christoph, war von zwei gewaltigen Türmen flankiert und führte nach Metz. Das Tor im Westen führte auf die Straße nach Nancy, und das südlich Tor zu den Salinen. Im Inneren der Festung standen etwa 30 Gebäude, vor allem Lagerhallen für das Salz, aber auch zwei Kirchen sowie einige Wohnhäuser für die Angestellten und Arbeiter des Bischofs. An der südlichen Stadtmauer erhob sich der Palast des Bischofs, das Chateau des Evéque, ein oktogonaler Turm mit drei Stockwerken und einem kleinen Innenhof.
Am 3 März im Jahre 1520 besuchte Conrad de Payen, Generalvikar der Diözese Metz, die Festung Vic- sur- Seille. Neben anderen ihm übertragenen Aufgaben war er auch für die Verwaltung der bischöflichen Salinen zuständig, und er kam zur üblichen Berichterstattung, die einmal jährlich erfolgte. Die Wächter am Metzer Tor waren über sein Kommen bereits unterrichtet, und hatten die Zugbrücke heruntergelassen. Hinter dem Tor erwartete ein junger Mönch den Generalvikar, um ihn zum Eingang des bischöflichen Palastes zu begleiten. Über eine breite Wendeltreppe gelangten die beiden in das dritte Stockwerk des Gebäudes, wo sie vor einem prächtigen Portal stehen blieben. Als auf ein zunächst leises und dann lauteres Klopfen von drinnen niemand antwortete, öffnete der Mönch vorsichtig die schwere Eichentür und der Generalvikar trat ein.
Der Audienzsaal des Bischofs lag in Dämmerlich, vor allem deshalb, weil die schwarzbraune Holztäfelung sowohl an der Decke als auch an den Wänden das helle Mauerwerk verbarg. Auch der Fußboden war mit dunklen gewachsten Eichenbohlen ausgelegt. In der Mitte des Raumes hing ein schmiedeeiserner Leuchter, auf dem etwa zehn Kerzen brannten. Ein großer steinerner Kamin stand rechts von der Tür und sein flackerndes Feuer erhellte unregelmäßig den Raum. An den getäfelten Wänden hingen Tapisserien und Gobelins mit eingewirkten Szenen aus der Bibel: Adam und Eva mit der Schlange, eine Anbetung der Könige und eine Himmelfahrtszene der Maria. An der dem Kamin gegenüber liegenden Wand befand sich ein kleiner Altar mit einer bemalten Holzstatue der Jungfrau Maria.
An einem langen Eichentisch, der in der Mitte des Saales stand, saß der Bischof. Er trug eine schwarze Soutane mit dem scharlachrotem Zingulum und auf dem Kopf das rote vierkantige Birett, das ihn als Kardinal auswies, denn Papst Leo X hatte ihm vor kurzen diese Würde verliehen.
Seine Wangen waren grau und eingefallen. Unter einer klobigen Höckernase wuchs spärliche ein grauer Bart, Mit blassen verhangene Augen blickte Johann müde auf den Ankömmling. Ganz offensichtlich war er aus einem Mittagsschlummer geweckt worden.
„Kommt näher, Conrad de Payen.“
Der Generalvikar nähert sich dem Tisch, kniete nieder und küsste den Ring, den Johann ihm gelangweilt hinhielt.
„Eminenz, wir haben uns ein ganzes Jahr nicht gesehen.“
„Ja“, seufzte Johann, „ …ich war beschäftig, In meinen anderen Bistümern muss ich mich gelegentlich sehen lassen. Aber meine Heimat ist hier, und..“, fügte er jovial hinzu, „ich bin immer gern bei Euch.“
„Vielen Dank, Eminenz.“ Der Generalvikar neigte den Kopf.
Es entstand eine Pause. Der Bischof saß bewegungslos in seinem Sessel und hatte die Augen halb geschlossen, so als ob er seinen Schlummer gern fortsetzen wollte. Schließlich versuchte Conrad de Payen das Gespräch wieder in Gang zu bringen.
„Und vieles hat sich draußen im letzten Jahr verändert.“
„Da habt ihr wohl recht“, murmelte der Bischof und fuhr dann etwas lauter fort, „zum Beispiel ist der Habsburger Karl zum König des Heiligen römischen Reiches gewählt worden. Leider! Leider! muss ich sagen. Lieber wäre mir, wie Ihr wisst, der Franz von Frankreich gewesen. Der Habsburger hat es wohl besser verstanden, die Hände der Kurfürsten zu salben. Mit dem Geld der Fugger ist ihm das gut gelungen. Nun, man wird sich irgendwie auch an den Habsburger gewöhnen müssen.“
„Habt Ihr auch gehört, Eminenz, dass der Habsburger den Portugiesen die Gewürzinseln streitig machen will. Ich erfuhr es erst gestern. Ein Kapitän namens Magellan soll die Inseln auf einer Route in westlicher Richtung erreichen, er ist vor zwei Monaten mit fünf Schiffen in See gestochen.“
„Der junge Kaiser Karl wird übermütig “, brummte der Bischof. „Aber, de Payen, Hochmut kommt noch immer vor dem Fall. Im Übrigen wird der Kerl nie die Gewürzinseln erreichen. Dazu müsste die Erde eine Kugel sein. Das hat schon dieser Seemann Columbus gemeint, bis er eines Besseren belehrt wurde.“
„Ja, das denke ich auch. Die Vorstellung, die Erde sei rund, ist absolute Phantasterei.“
„Wir können ja später noch etwas darüber reden. Nun aber, mein lieber de Payen,zu unseren Geschäften. Deshalb seid Ihr doch gekommen. Wie läuft es mit den Salinen? “
Der Generalvikar holte aus seiner Tasche mehrere Bücher und Listen, breitet sie auf dem Tisch aus und begann, dem Bischof die einzelnen Posten und Kalkulationen zu erklären.
Der Bischof, den die langen Zahlenkolonen schon bald ermüdeten, fragte schließlich enerviert:
„Und wie sieht, mein lieber de Payen, der Saldo und die Gesamtbilanz aus?“
„Sie ist sehr günstig Eminenz. Wir haben im letzten Jahr 4500 Klafter1 Salz produziert.“
„Sehr gut. Das ist besser als im Jahr davor.“
„Erfreulich“, fuhr de Payen fort, „ist auch, dass im letzten Jahr offensichtlich kein Salz gestohlen wurde. Das haben wir den härteren Strafen zu verdanken, die Eure Eminenz im vergangen Jahre auf Diebstahl verhängt haben. Neun Jahre Galeerendienst hat alle abgeschreckt.“
Der Bischof nickte zufrieden.
„Andererseits“, fuhr der Generalvikar fort, „wird die Beschaffung von Holz für die Salinen von Jahr zu Jahr schwieriger. Unsere Männer müssen die Bäume in gefährlichen Schluchten und an steilen Abhängen fällen. Wir haben im letzten Jahr dabei zwölf Männer verloren. “
„Nun, sie sind für einen guten Zweck gestorben.“ sagte der Bischof leichthin, „beschafft mir eine Liste der Namen. Ich werde für sie beten.“
„Ärgerlich ist auch“, fuhr de Payen fort, „die Kaufleute in Metz bestehen weiterhin auf hohen Rabatten. Leider!“
„Nun da wären wir bei einem wichtigen Thema!“ sagte Johann, und schien erst jetzt richtig aufzuwachen, „Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Oberschöffen der Stadt. Ohne Scheu und Scham, frech und dreist hat er mir in die Augen geschaut und widersprochen. Anstand und Ehrfurcht, die ich als Vertreter der Kirche und als Landesherr doch wohl erwarten kann, waren wie weggeblasen.“
Der Generalvikar schüttelte mitfühlend und missbilligend den Kopf.
„Und ich sage Euch“, fuhr der Bischof erregt fort „das hängt mit dem humanistischen Zeitgeist zusammen, der aus Italien zu uns überschwappt. Der christliche Glaube der Menschen schrumpft und schwindet. Überall bemerkt man den Einfluss der Ketzer, die den gläubigen Menschen die Gehirne und Herzen verdrehen. Wir müssen uns eins immer klar machen, de Payen: der einfache Glaube des Volkes ist die Wurzel unserer Macht. Diese Wurzel wird aber von Ratten und anderem Ungeziefer angenagt, sie fault und zersetzt sich wie ein Eitergeschwür.
„Wie meint Ihr das?“
„Na, ihr seht es doch selbst. Die Menschen, wie zum Beispiel dieser Herr Oberschöffe, sind stolz, selbstbewusst und hochmütig, Sie leben nur noch in der diesseitigen Welt. Sie scheinen das Jenseits, das Fegefeuer und die Hölle vergessen zu haben.“ Der Bischof hob bedeutungsvoll den Zeigefinger: „Sie haben einfach verlernt sich zu fürchten!“
„Eminenz, Ihr habt Recht. Die Bürger der Stadt stehlen, betrügen und, huren als ob es keine Strafe Gottes gäbe. Sie fürchten sich vor niemanden. Aber war das früher denn anders?“.
„Nein, natürlich war das früher auch so“, der Bischof war verärgert, „aber die Menschen gehen heute nicht mehr regelmäßig zur Messe, und die Beichtstühle stehen leer. Das ist ein Skandal. Das haben wir diesen widerwertigen Aufrührern gegen die heilige katholische Kirche zu verdanken. Das fing an mit dem Jan Hus in Böhmen und dem Savonarola in Florenz. Beide haben ihre gerechte Strafe -Gott sei es gelobt- auf dem Scheiterhaufen gefunden. Aber jetzt kommt dieser junge neunmalkluge AugustinerMönch aus Wittenberg -Luther ist sein Name, glaube ich-, hetzt die Menschen auf und wird von seinem Landesherrn nicht einmal ermahnt. Vor drei Jahren hat er 95 Thesen an uns Bischöfe verschickt. Mit guten Gründen sind wir zur Tagesordnung übergegangen und haben nicht geantwortet. Und was tut dieser freche Kerl? Er hängt diese Thesen an die Schlosskirchentür von Wittenberg, um auch den jüngsten Mönch damit zu infizieren.
Der Bischof war jetzt hell wach und wütend.
„Habt ihr den Unsinn gelesen, de Payen? Dieser Mann behauptet doch allen Ernstes: Allein der Glaube mache selig. Allein durch den Glauben – sola fidei nennt er das - erringen wir die Gnade Gottes, und sonst durch nichts. Er schreibt `Wenn du nun beständest aus guten und gerechten Werken bis an die Fersen, so wärst du doch nicht gerecht vor Gott `Das heißt doch für jeden vernünftig denkenden Mann: Du darfst sündigen, wie es Dir gefällt. Du darfst stehlen, lügen, huren und sogar töten. Alles das darfst Du. Wenn Du nur glaubst, vergibt Dir Gott und nimmt dich in das Paradies auf. Das ist doch absoluter Irrsinn und Blasphemie. Du brauchst nicht mehr die Segnungen der Kirche, keinen Ablass für deine Sünden, kein Gebet, keine Bußübung. Wenn Du nur glaubst- Sola fidei- ist schon alles geregelt. Den Gottesdienst in der Kirche darfst du ruhig vergessen, das Abendmahl brauchst du dir nicht spenden lassen. Keine Beichte musst Du ablegen, kein Sakrament achten, keinen Pfennig in den Opferstock legen. Nichts, nichts brauchst Du von der Kirche und wirst doch gerecht vor Gott, wenn du nur glaubst.“
Und noch einmal wiederholte der Bischof voll Abscheu und Verachtung: „Sola fidei!“
„Eminenz, Ihr hab Recht Es ist eine Schande.“
„Und jetzt setzt der Fant noch einen drauf“, fuhr der Bischof erregt und zornig fort, „Vorgestern wurde mir ein Pamphlet ´De libertate christiana´ zugesteckt. Darin erdreistet sich dieses Mönchlein zu behaupten: `Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemands Untertan´.
Das ist doch Aufruf zur Rebellion, ein Anstacheln zum Aufstand gegen die Kirche und jegliche Obrigkeit. Niemand muss einen Herrn über sich anerkennen. Keinem Befehl, keiner Anordnung muss man gehorchen. De Payen, das führt zu übelster Unordnung, zum Chaos, zum Tohuwabohu, zu Sodom und Gomorrha.
Der Generalvikar, der das Pamphlet auch gelesen hatte, wagte zu ergänzen. „Und dieser Luther schreibt wenige Sätze später ´Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermanns Untertan ´. Völlig inkohärent ist das. Eine reductio ad absurdum. Dabei beruft er sich auch noch frech auf den heiligen Paulus, der –übrigens in einem ganz anderen Zusammenhang- schreibt: ´Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht. Erster Korintherbrief 9,19 wenn ich nicht irre.“
„Ja“, bestätigte der Bischof, „Die beiden Sätze widersprechen sich, es ist eine ´ontologische contradictio in re´ wie Aristoteles es nennen würde. Wer soll denn das verstehen? Keiner wird das verstehen. Man wird sich an den ersten Satz halten: Ein Christ ist niemanden´s Untertan. Ihr werde es sehen, de Payen. Es wird Revolten geben und viele, viele Tote.“
„Ja, Eminenz. Es ist traurig.“
„Und wenn man das in einem größeren Zusammenhang sieht, ist es schier zum Verzweifeln. In Spanien hat die Reconquista gerade die Heiden, die Anhänger Mohammeds vertrieben. Gott sei es gelobt. Aber jetzt sitzt ein neuer Sultan in Konstantinopel auf dem Thron, Suleimann den Prächtigen nennen sie ihn. Der drängt mit seinem Türkenheer über den Bosporus nach Europa. Schon hat er Belgrad eingenommen. Jetzt braucht die Christenheit Einheit und Stärke, um diesem Satan zu widerstehen. Aber nein, da kommt dieser Spalter, dieser teuflische Phantast und Fanatiker, und sät Uneinigkeit in unser christliches Abendland.“
Es entstand eine Pause. Der Bischof musste sich von seiner Erregung erholen und der Generalvikar wartete stumm.
„Wir müssen etwas dagegen unternehmen“, sagte der Bischof schließlich „Wir müssen ein Exempel statuieren. Wir müssen den Menschen klar machen, dass der Teufel jeden einzelnen verführt, und dass alle ohne die Fürsprache und ohne den Segen unserer katholischen Kirche mit Gewissheit die schlimmsten Höllenqualen erleiden werden.“
Ratlos, wie ein solches Ziel zu erreichen sei, saß der Bischoff auf seinem Sessel und stützte das Kinn in die Hand.
„Wie wäre es mit einem Hexenprozess?“, sagte der Generalvikar stockend und blickte den Bischof lauernd an.
„Wie meint ihr das?“
„Wenn ich an Spanien denke, wo die Kirche sich gegen die Ketzer mit den Autodafés erfolgreich wehrt. Dort wurden vor kurzem, wie ich hörte, in Calahora nicht nur Häretiker, sondern auch dreißig Zauberinnen, also Hexen, verbrannt.“, sagte de Payen mit einem gehässigen Lächeln, „Es wird berichtet, dass dadurch die Frömmigkeit und der Gehorsam der Bevölkerung erstaunlich zugenommen hat.“
„Warum das? “
„Nun, wenn eine Hexe vor den Augen aller Bürger auf dem Feuer brennt, dann erschreckt ihr Wimmern und Heulen die meisten Menschen - selbst Männer wie den Oberschöffen von Metz.“
„Und wo wollt ihr so schnell eine passende Hexe hernehmen?“
Der Generalvikar zögerte, sagte dann aber leise:„Wie Ihr wisst, gibt es in Metz viel Neid, Missgunst und eine wahre Gier zum Verleumden und Denunzieren. Das Wort Hexe kommt vielen schnell über die Lippen. Man braucht nur einen beherzten Mann, der solche Aussagen und Behauptungen sammelt und daraus eine Anklage für einen Gerichtsprozess macht.“
„Und wie soll man so einen Mann finden?“
„Das lasst nur meine Sorge sein. In unserem Kloster lebt einen Assessor des Offizials -Nicolas Savini ist sein Name- ein ehrgeiziger junger Mann. Er brennt darauf sich als Inquisitor hervorzutun. Er hat die ehrbare christliche Absicht, das Böse in unserer Welt auszurotten. Manchmal hab ich aber auch das Gefühl, er genießt es einfach, andere Menschen in die Enge zu treiben, zu quälen und zu foltern. Richtig Freude scheint ihm das zu machen. Aber gerade das sind die Männer, die wir jetzt brauchen. Wenn er einmal Blut geleckt hat, bleibt er wie ein Hund auf der Fährte, bis er das Opfer aufgespürt und erledigt hat.“
Der Bischof setze sich, seufzte und atmete tief durch. Dann kniff er die Augen zusammen und schien zu überlegen: „Und Ihr glaubt man kann diesen Savini auf eine solche Fährte setzen?“
„Das muss natürlich vorbereitet werden, aber ich denke, es sollte gelingen.“
„Na gut! Aber der Savini soll die Sache behutsam angehen. Nichts wäre schädlicher für unser Ansehen, wenn der Prozess mit einem Freispruch endet, zumal wir ja leider auch einen Richter der Freien Stadt Metz hinzuziehen müssen.“
„Vielleicht sollte man einen willigen Richter gewinnen.“ murmelte de Payen wie zu sich selbst
Der Bischof, der die Worte des Generalvikars wohl gehört hatte, drohte lächelnd mit dem Finger „Na gut, aber übertreibt es nicht.“
Nach einer kurzen Pause betätigte Johann von Lothringen die Glocke auf dem Tisch und entschied: „Ihr könnt Euch jetzt entfernen.“
An der Tür erschien der junge Mönch und geleitetet den Generalvikar wieder nach draußen.
1 Ca 13.500 Kubikmeter
2. Kapitel : Die Freie Reichsstadt Metz und die Kathedrale Saint Etienne
Seit dem Jahre 1200 war Metz Freie Reichsstadt und gehörte zu den wenigen autonomen Stadtgemeinden des Mittelalters, die nicht ihrem Fürsten, sondern direkt dem Kaiser unterstanden. Damit waren etliche Privilegien verbunden, wie das Recht, freien Handel zu treiben, eine eigene Verwaltung aufzubauen, Steuern zu erheben, ein Heer zu unterhalten und die Gerichtshoheit auszuüben.
Diese Privilegien erleichterten es den geschäftstüchtigen Kaufleuten, ein gewaltiges Handelsimperium zwischen Mosel, Rhein und Maas aufzubauen. Wein, Weizen, Wolle, Leder und Salz aus der Region wurden in fast alle Teile der Welt geliefert. Metz unterhielt auch engen Kontakt zu den italienischen Handelsstädten und beherbergte zahlreiche sog. "lombardische Kontore", um Geld- und Kreditgeschäfte zu betreiben.
Nach und nach gelang es den Patriziern auch landwirtschaftlich nutzbares Gebiet, die sogenannten Pays Messin, dem Fürsten von Lothringen abzukaufen, so dass Metz die flächengrößte Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich wurde. Ihre Bedeutung zeigte sich unter anderem im Jahre 1358 als Kaiser Karl der IV auf einem Reichstag in der Stadt die berühmte `Goldene Bulle` verkündete.
Eine starke Stadtmauer mit Zinnen, Schießscharten, Pechnasen und widerstandsfähigen Toren war am Anfang des 16. Jahrhunderts zu einem sechs km langem Festungsgürtel angewachsen, um die 40.000 Bewohner der Stadt gegen feindliche Angriffe zu schützen.
Mehr als in anderen Reichsstädten wurde das Stadtbild von Metz von Kirchen, Kapellen und Klöstern geprägt. Es gab mehr als vierzig Gotteshäuser und die großen Dominikaner-, Benediktiner-, Franziskaner und christlichen Ritterorden hatten sich hier angesiedelt. Ein nicht unbedeutender Teil der Stadt wurde deshalb von Klerikern dominiert.
Die Kathedrale Saint Etienne in Metz war lange Zeit der schönste und größte gotische Dom diesseits der Alpen. Das Langschiff, das sich von Süd-West nach Nord-Ost erstreckte, wurde von zwei Türmen flankiert. Im Süden stand ein 90 Meter hoher Turm, der die Mutte trug, eine tonnenschwere Glocke, die wegen ihres weithin reichenden Klangs die `mächtige Stimme Gottes` genannt wurde. Das Mauerwerk der Kirche bestand aus dem gelben Stein der lothringischen Bergkette Jaumont, und, wenn bei aufgehender oder untergehender Sonne ihr Mauern golden strahlten, glaubte jeder, die Kathedrale sei von überirdischen Engeln und nicht von Menschenhand errichtet worden.
Die hohen und breiten Fenster machten die Kathedrale zu einem von Licht durchfluteten Dom, der in der ganzen Welt seines Gleichen nicht fand. Besonders die Fensterrose in der Westfront beglückte durch ihre herrlichen warmen Farben, und man nannte die Kathedrale mit gutem Recht `die Laterne des lieben Gottes`.
An einem Sonntag im März des Jahres 1520 -die Messe hatte noch nicht begonnen- saß ein kleiner ernster Mann auf einer Bank in der Kathedrale. Es war Agrippa von Nettesheim, ein jetzt 27 jähriger Doktor der Philosophie und Medizin. Erst gestern war er in der Stadt angekommen und ließ nun zum ersten Mal das prächtige Innere der Kathedrale und die herrlich bunten Fenster auf sich wirken.
Obwohl er morgen bei den Ratsherren der Stadt geladen war, um ein Amt als Stadtanwalt und Stadtredner anzutreten, fühlte sich Agrippa immer noch als Flüchtling. Sein ganzes Leben lang musste er von einem Ort zum anderen und von einem Land zum anderen wandern. In Köln studierte er, in Paris und London hielt er Vorlesungen, auch Spanien besuchte er kurze Zeit, doch nirgendwo fand er eine Stelle, mit der er das fürs Leben notwendige Geld verdient hätte. So war er von einer Stadt zur anderen gezogen, und immer wieder wurde er enttäuscht. Doch vor zwei Jahren konnte er in Italien Fuß fassen. Die Universität Pavia bot ihm eine Dozentur der Philosophie an und zahlte ihm ein stattliches Gehalt. Endlich war Ruhe in das Leben von Agrippa eingekehrt. An der Universität promovierte er zum Doktor beider Rechte und zum Doktor der Medizin. Er heiratete eine bildhübsche junge Frau aus Pavia, unterrichtete mit Freude eine kleine Schar von Schülern und arbeitete viele Stunden täglich an einem, wie er glaubte, wichtigen Buch über die Okkulte Philosophie.
Doch das Glück währte nicht lange. Die Lombardei und das Herzogtum Mailand waren seit langem ein Zankapfel zwischen dem französischen König und dem römisch-deutschen Kaiser Maximilian. Im September 1515 kam es bei Marignano zu einer Entscheidungsschlacht. Franz I von Frankreich siegte, und kurz darauf zogen seine Söldner marodierend durch das Herzogtum. Sie erreichten auch Pavia, wo sie grausam und bestialisch brandschatzten, mordeten und plünderten. Jeder Bürger, der nur eben konnte, ergriff die Flucht. Agrippa und seine Frau schlossen sich einer Gruppe von Vertriebenen an und machten sich auf den Weg, um zu Fuß über die Alpen nach Norden zu wandern.
Hier in der Kathedrale von Metz erinnerte sich Agrippa an die Flucht und plötzlich erschien ein Bild vor seinen inneren Augen: Auf einem schmalen Alpenbergpfad, den schweren Rucksack geschulter, quälte er sich mit einer Schubkarre vorwärts. In der Karre hatte er die notwendigsten Habseligkeiten geladen, Kleider, Schuhe, Decken und Nahrung, die wahrscheinlich nicht lange reichen würde, drei Laibe Brot, ein Sack Mehl und eine große Flasche mit Öl. Auch einige Goldmünzen, eine Sammlung von Büchern und seine Manuskripte hatte er eingepackt. Als das Rad seiner Karre in einer Kuhle des Weges stockte, und er sie auch mit größter Anstrengung nicht heraus hieven konnte, fiel er erschöpft auf den Boden. Zu seiner Frau, die herbeigeeilt war, um ihm zu helfen, klagte er verzweifelt und unter Tränen:
„Diese Flucht, diese verdammt Flucht. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist meine Schuld. Ich habe Dich da hineingezogen. Du hättest zu Deinen Eltern in den Süden fahren können und jetzt läufst du mit mir ins Ungewisse nach Norden.“
„Ach es gibt Schlimmeres“, hatte sie sorglos geantwortet, „ich gehöre zu Dir und laufe mit Dir. Das ist normal. Du weißt, ich liebe dich“. Einen kecken, fröhlichen Blick hatte sie ihm dabei zugeworfen, ihm beim Anschieben der Schubkarre geholfen, ihren eigenen Rucksack fester gefasst und war weiter gestapft. Diese Frau aus Pisa war für ihn ein Geschenk des Himmels. Das wurde ihm immer bewusster, und er war dankbar dafür. Die frische rosarote Farbe ihres Gesichtes, ihre seidenweiche Haut, ihr freundliches Lächeln und eigentlich alles an ihr entzückte ihn und wärmte sein Herz. Diese Frau war mit sich und der Welt zufrieden, lachte viel und war stets guter Laune. Agrippa hingegen quälte sich allzu oft mit zermürbenden Selbstzweifeln