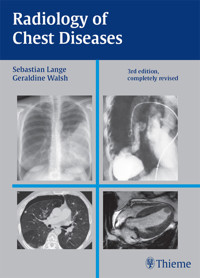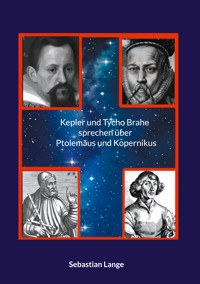Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Papst Urban’s Ruf „Deus lo vult! Gott will es!“ wurde auch noch im 13. Jahrhundert gehört, und tausende fromme Ritter und Pilger machten sich auf den Weg, um das Heilige Land von den Sarazenen zu befreien. Doch die Begeisterung der Gläubigen wurde bitter enttäuscht. Der 4. Kreuzzug unter Führung des machtversessenen venezianischen Dogen Dandolo endete mit der bestialischen Zerstörung Konstantinopels. Im 5. Kreuzzug starben viele an Hunger und Seuchen, andere fanden den Tod auf den Schlachtfeldern. Es gelang zwar dem Kaiser Friedrich II durch Glück und geniales Taktieren Jerusalem zu übernehmen, doch schon wenige Jahre später verloren die Christen das Heilige Land endgültig. Sorgfältig recherchierte historische Fakten wurden zu zwei spannenden Romanen verdichtet, die von der Sehnsucht und dem Glaubenseifer der mittelalterlichen Menschen berichten, und gleichzeitig die Intrigen, die Habgier, die Brutalität und die Gewissenlosigkeit ihrer Anführer schildern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DER VIERTE KREUZZUG UND DIE RELIQUIEN
Strafe Gottes
Auf Burg Hagenau
Ankunft in Venedig
Mangel an Männern und an Geld
Eroberung Zaras
Überwinterung in Zara
Eroberung von Konstantinopel
Krönung von Alexios
Im Chora-Kloster
Eintracht und Streit
Zweite Eroberung von Konstantinopel
Epilog
DER FÜNFTE KREUZZUG UND
DIE SCUOLA MEDICA IN SALERNO
Archiater Ursus von Lodi
Zaccaria
Constanza
Der Brief aus Tarent
Beratung in Oria
Al-Kamil und sein Wesir
Die Bäder von Pozzuoli
Ankunft in Akko
Der lateinische Patriarch
Das Horoskop
Schachspiel in Jaffa
Geburt in Gaza
Der Vertrag
Krönung in Jerusalem
Heimfahrt
Epilog
Die historischen Fakten
Meinungen über Friedrich II
.
GeographischeKarten
DER VIERTE KREUZZUG UND DIE RELIQUIEN
Zeit der Handlung: 1201 bis 1204
Orte der Handlung: Hagenau, Venedig, Zara, Konstantinopel
Personen der Handlung:
Isaak II. Angelos, Kaiser von Byzanz
Alexios Angelos III., Usurpator und Bruder von Isaak II.
Alexios Angelos IV., Sohn von Isaac II.
Margarethe von Ungarn, Ehefrau von Isaac II., später Ehefrau von
Montferrat
Murtzuphlos, Protovestiarios von Alexios Angelos IV.
Johannes X. Kamateros, Patriarch von Konstantinopel
Markarios, Abt des Choraklosters in Konstantinopel
Philipp von Schwaben, römisch-deutscher König
Irene Angelina, seine Ehefrau und Tochter von Isaac II.
Walter von der Vogelweide, Troubadour
Konrad von Krosigk, Bischof von Halberstadt
Jörg, Benediktinermönch und Vikar von Krosigk
Graf von Katzenellenbogen, deutscher Kreuzritter
Fulko von Neuilly, Kreuzzugsprediger
Enrico Dandolo Doge von Venedig und Kreuzritter
Jacopo Tiepolo venezianischer Adliger, Nachfolger von Dandolo
Venezianische Adlige: Domenico Ziani, Sebastiano Faliero
Markgraf Bonifaz von Montferrat, Anführer des Kreuzzugs
Balduin von Flandern, Kreuzritter und 1. Kaiser des lateinischen
Reiches
Heinrich von Flandern, Kreuzritter und 2. Kaiser
Graf Louis de Blois et de Chartres, Kreuzritter
Graf Hugh von Saint-Pol IV., Kreuzritter
Marschall Gottfried von Villehardouin, Kreuzritter und Chronist
Mathias von Montmorency, Kreuzritter
Peter of Bracieux, Kreuzritter
Graf Simon de Montfort, Kreuzritter
Lord Enguerrand of Boves, Kreuzritter
Strafe Gottes
Im Jahre 1198 rief Papst Innozenz III. zum vierten Kreuzzug in das Heilige Land auf. Doch das Abendland war von zwei vorangegangenen Kreuzzügen erschöpft, und der Aufruf des Papstes fand wenig Gehör. Erst als ein Priester aus der Nähe von Paris, Fulko von Neuilly, mit einer Gefolgschaft von Mönchen von Dorf zu Dorf zog und mit seinen Predigten die Menschen begeisterte, fanden sich viele bereit, den Zug nach Palästina zu wagen.
Bischof Konrad von Krosigk und zwei ihn begleitende Mönche hatten die üppige Vegetation und die Hitze des italienischen Alpentals hinter sich gelassen und konnten schon die schneebedeckten Gipfel des Sankt Bernhardino sehen. Hier in der Höhe war die Luft kühl und fast schon kalt, auch wenn die Oktobersonne die Haut noch angenehm wärmte. Auf einem schmalen Bergpfad zwischen Tannen und Krüppelholz, wanderten sie nun aufwärts zum Bernhardino Pass, den sie nach zwei Tagesmärschen zu erreichen hofften. Der Aufstieg war beschwerlich. Sie mussten zu Fuß laufen, nur begleitet von einem kleinen geduldigen Maultier, das unter der Last von Zelten, Werkzeugen, Decken, Kochutensilien und Proviantvorräten fast zu zerbrechen schien und dennoch ruhig aufwärtsstapfte. Später, wenn der Pass überwunden war, würden sie Pferde mieten, und die Reise würde schneller und auch angenehmer verlaufen.
Der Bischof stieg in Gedanken versunken mühsam Schritt für Schritt bergan. Er und seine beiden Gefährten hatten vor zwei Wochen Rom verlassen, und in nochmals vier Wochen würden sie die Heimat, das Bistum Halberstadt in Deutschland, erreichen.
Bischof Krosigk galt mit seinem stattlichem Bauch, dem feistem Doppelkinn und zwei wohlgenährten rot geäderten Hängebäckchen in Halberstadt als Respektperson. Unter der Tonsur, die von einem Kranz schlohweißer Haare umrandet war, und einer breiten Stirn blickten wasserblaue Augen gottergeben und fromm. Dies war ein Blick, der seine andachtheischende Wirkung bei der gläubigen Gemeinde nie verfehlte.
Der Aufstieg strengte Krosigk an, und er atmete schwer. Aber er war zufrieden und fast glücklich, denn in dem kleinen Bergdorf Ivrea hatte er endlich das erreicht, woran er jeden Tag während der langen Reise gedacht und was er sehnlichst erhofft hatte. Vom Kaplan der Santa Maria Assunta Kathedrale in Ivrea hatte er eine kostbare Reliquie erworben. Dieser Kauf machte ihn stolz, ja fast übermütig. Es war ein wunderbares Geschenk des Himmels, dieser Zahn des heiligen Evasius. Er würde einen würdigen Platz in der umfangreichen Reliquiensammlung von Halberstadt finden. Zwar hatte Krosigk den Kaplan überreden und mit einigen Münzen auch gefügig machen müssen, aber schließlich hatte der arme Tölpel nicht widerstehen können. Schnell, heimlich und mit deutlich erkennbarem Schuldgefühl hatte er den letzten Backenzahn aus dem Schädel des Märtyrers herausgebrochen und dem Bischof ausgehändigt.
Vorsichtig tastete Krosigk nach der kleinen Holzschachtel, die unter der Kutte an einer Schnur um seinen Hals hing. Jetzt war der heilige Backenzahn zwar noch in diesem erbärmlichen Kästchen aufgehoben, aber schon bald würde der Goldschmied Meister Capesius in Halberstadt einen kleinen Schrein fabrizieren, aus Gold mit filigranen Verzierungen, Edelsteinen und Perlen besetzt. Der Zahn sollte hinter einer Glasscheibe sichtbar sein, und oben auf dem Schrein würde ein feuriger Rubin funkeln, den Krosigk in Erwartung einer wichtigen Reliquie schon lange bereithielt. Herrlich und erhaben würde das……..…
Jäh wurde dieser so angenehme Gedankengang unterbrochen. Krosigk stolperte,verlor das Gleichgewicht, taumelte und glitt die Böschung hinunter. Gottlob, der Abhang war nicht steil, und ein Busch hinderte ein weiteres Rutschen in die Tiefe. Aber ein unerträglicher Schmerz war wie von einem Messerstich in Krosigks rechtes Bein gefahren. Mühsam versuchte er sich aufzurichten, doch das Bein gehorchte seinem Willen nicht mehr.
„Das ist Gottes Strafe!“, durchzuckte es den Bischof. Das schlechte Gewissen wegen des unanständigen Handels in Ivrea meldet sich. Verzweifelt faltete er die Hände und murmelte: „Herr, ich habe gesündigt. Aber du weißt, ich habe es aus Liebe zu meinen Klosterbrüdern in Halberstadt getan. Der Zahn des Heiligen wird dort alle entzücken und mit Dankbarkeit und Andacht erfüllen.“
Oder war der Sturz die Strafe für eine andere Liebe, die ihn seit langem beunruhigte und quälte? Erschrocken stockte Krosigks Atem, und ein leichtes Zittern durchlief seinen Körper.
Eine Liebe, von der der Apostel Paulus sagt, dass sie Männern das Reich Gottes verwehre. Krosigk war sich sicher: Nie, nie würde er sich einer solchen sündigen Tat hingeben. Doch war nicht schon der Gedanke daran Sünde? Hatte Jesus nicht gesagt: ‚Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, reiß es heraus und wirf es von dir.’1
„Exzellenz, was ist denn passiert? Wartet wir kommen!“
Die beiden Mönche seiner Gefolgschaft kletterten vorsichtig die Böschung hinunter, griffen unter die Arme des Alten und zogen ihn nach oben zum Weg. Krosigk stöhnte, der Schmerz in Rücken und Bein war, als würde ein Messer wieder und wieder ins Fleisch gestoßen. Das rechte Bein hing jetzt völlig schlaff und kraftlos am Körper und knickte bei jeder Belastung ein. Die beiden Begleiter lehnten den Bischof an einen Baumstamm. Der Jüngere der beiden – Jörg war sein Name – flößte seinem Herrn Wasser aus einer Feldflasche ein und wischte mit einem feuchten Tuch seine Stirn. Krosigk blickte sorgenvoll und voller Mitleid auf den schönen Jungen, denn der sah krank und müde aus. Er war erbärmlich mager, und die viel zu weite Kutte schlackerte um den ausgezehrten Körper. Flachsblonde Haarsträhnen hingen unordentlich in die Stirn, die dunkelblauen Augen lagen in tiefen Höhlen, und die Wangen waren eingefallen. Die sonst blasse, wächsern durchsichtige Haut des Gesichtes hatte sich, wohl wegen des Schrecks über den Unfall, gerötet.
Jörg war ein Benediktinermönch aus dem Kloster Huysburg bei Halberstadt. Dort hatte er schon mehrere Jahre in der Krankenabteilung gearbeitet, und weil er dies mit unermüdlichem Eifer und viel Geschick tat, hatte Bischof Krosigk beschlossen, ihn zum Arzt ausbilden lassen. Für eine solche Ausbildung war das italienische Mutterkloster der Benediktiner in Montecasino am besten geeignet. Als vor kurzem Papst Innozenz den Bischof nach Rom eingeladen hatte, hatte es nahegelegen, dass Jörg ihn auf der Reise begleitete. Später sollte der Junge allein weiter nach Montecasino wandern.
Doch dieser Plan wurde durchkreuzt. Schon auf dem Weg nach Rom erkrankte Jörg plötzlich an heftigem Fieber mit unbändigem Husten und blutigem Auswurf. Wahrscheinlich hatte er sich bereits in Huysburg bei Kranken, die an tödlicher Lungenfäule litten, angesteckt. In diesem Zustand hätte man ihn im Kloster Montecasino nicht aufgenommen, und deshalb war er jetzt zusammen mit Krosigk auf dem Weg zurück nach Halberstadt.
Mehrere Pilger wanderten nach und nach an Krosigk und seinen beiden Begleitern vorbei. Sie erkundigten sich, boten freundlich ihre Hilfe an, aber einen gelähmten Mann ohne Wagen und ohne Tragestuhl zu transportieren war unmöglich. So erklärten alle ihr Bedauern und zogen weiter. Endlich kam ein junger Bauer mit einem Eselkarren. Jörg lief ihm entgegen.
„Ich bitte dich, halte an. Du musst uns helfen. Unser Bischof ist gestürzt. Wir können ohne Wagen nicht weiter. Bitte hilf uns, wenigstens bis zum nächsten Dorf.“
Der Bauer, ein untersetzter junger Mann mit etwas einfältigen Gesichtszügen, brauchte längere Zeit, ehe er verstand. Dann zeigte er nach hinten auf den zweiräderigen Karren.„Nicht möglich. Bin selber abgestiegen. Der Esel schafft es nicht. Im Wagen liegt meine lahme Mutter. Der Esel kann nicht zwei Menschen ziehen. Der Weg ist hier zu steil.“
"Wir sind kräftig, wir werden den Wagen schieben", wandte der junge Mönch ein.
Endlich, nachdem Jörg dem Bauern seinen Geldbeutel gezeigt hatte, lief ein verstehendes Lächeln über das dümmliche Gesicht, und der Mann gab nach. Zu dritt hoben sie Krosigk in den Karren zu der Alten, einer abgemagerten geistig verarmten Frau, die mit zahnlosem Mund nur kurz ächzte und dann weiter vor sich hindöste.
Der Karren, vom Esel gezogen und von zwei Mönchen geschoben, holperte über den steinigen Weg, und Krosigk wurde unsanft hin und her gerüttelt. Er schloss die Augen, versuchte, dies äußere Ungemach zu verdrängen, und lenkte seine Gedanken zurück nach Rom.
In der Laterankirche hatte Papst Innozenz III. vor drei Wochen ihm und anderen Bischöfen des Abendlandes eine Audienz gewährt. Im feierlichem päpstlichen Ornat und mit der Tiara auf dem Kopf hatte er zu ihnen von der Kanzel herab gesprochen.
„Welch ein unsympathischer Asket, dieser neue Papst ", dachte Krosigk, „hager, dürr, übernächtigt, bleiche Wangen, eng stehende, leblose Augen, zusammengekniffene Lippen. Ein rastloser, von Ehrgeiz getriebener, fieberhaft nach Erfolg gierender Pontifex. Hochmütig, herrisch und mit ungeheurem Verstand hat er uns allen, den Bischöfen und Äbten, seinen Willen aufgezwungen.“
Beim Treffen im Lateranpalast hatte der Papst eine formvollendete Rede gehalten, in der er drastisch die Not der Christen in Palästina schilderte und die demütigende Schmach beklagte, dass ungläubige Moslems die heiligen Stätten schändeten. Als er von den Vorbereitungen des Kreuzzuges berichtete, geißelte er mit harten Worten die Trägheit und den Geiz der Menschen, denn nur schleppend meldeten sich Männer, die am Kreuzzug teilnehmen wollten, und nur langsam kam das benötigte Geld zusammen. Als den einzigen wirklich zuverlässigen Mitstreiter lobte Innozenz einen Priester, der in Frankreich unermüdlich für die Pilgerfahrt nach Palästina warb. Zahlreichen Gläubigen hatte er schon das Kreuzeszeichen angeheftet und viel Geld für die gute Sache beschafft.
„Nehmt euch Fulko von Neuilly als Vorbild und eifert ihm nach!“, rief der Papst und wiederholte dann unnachgiebig seine Forderung, jeder der Anwesenden müsse mit seiner Gefolgschaft ins Heilige Land ziehen und Geld, viel Geld, sammeln.
Einige Bischöfe und Äbte wagten, auf die Schwierigkeiten des Vorhabens hinzuweisen, aber sie wurden mit Verachtung und Hohn von Innozenz abgekanzelt. Krosigk hatte geschwiegen, denn – und das warf er sich reumütig vor – er hatte wieder einmal nicht den Mut aufgebracht, um zu widersprechen. Er war ein Duckmauser, ein Schwächling und ein Feigling, und er litt darunter. Am Ende der Audienz verneigten sich alle vor dem Heiligen Vater, und es schien, als ob sie sein Verlangen billigten. Krosigk fragte sich allerdings, wie viele von ihnen die Anweisungen des Papstes tatsächlich erfüllen würden. Für ihn selbst in Halberstadt würde es schwer werden, denn die Erinnerung an vergangene Kreuzzüge, an die Entbehrungen und an die vielen Toten war bei den Menschen noch allzu wach.
Im Grunde seines Herzens war Krosigk nie ein begeisterter Anhänger des Kreuzzugsgedanken gewesen. Ihm hatte immer schon die vita contemplativa mehr zugesagt als die vita activa, und nach der Audienz bei Papst Innozenz, der kalt, herrisch und ohne die geringste Spur christlicher Mitmenschlichkeit gesprochen hatte, war seine Abneigung gegen dieses kriegerische Unternehmen nur größer geworden. Konnte der Sturz am Bergpfad ein Zeichen Gottes sein? Sollte er ihn gnädig von der Pflicht entbunden haben, nach Palästina zu ziehen? Jetzt, als Krüppel mit einem gelähmten Bein, würde es ganz unmöglich sein, Mitstreiter in Halberstadt zu finden und sie bei der beschwerlichen Reise zu führen. Erleichtert atmete Krosigk aus, und mit dem Luftstrom aus seinen Lungen schienen sich auch seine Sorgen zu entladen. Er fühlte sich befreit, eine schwere Gewissenslast war von seinen Schultern genommen. Die Lähmung des Beines hatte etwas Gutes, sie war Gottes Fingerzeig, nicht am Kreuzzug teilzunehmen, und sie war eine für jeden nachvollziehbare Entschuldigung obendrein.
Seine Gedanken wurden unterbrochen, denn der Bauer, der mit den Zügeln in der Hand vor dem Eselskarren lief, rief den beiden jungen Mönchen zu:
„Wir kommen bald nach Aosta. Da werde ich Euch absetzen. In Aosta soll der Wunderheiler Fulko meiner Mutter helfen. Vielleicht kann er ja auch für Euren Bischof etwas tun.
„Fulko? ", fragte Jörg. „Wer ist das?“
„Wie? Ihr habt von Fulko noch nicht gehört?" Der Bauer schüttelte den Kopf und lachte. „Alle Welt hier spricht nur noch vom ihm. Er ist ein Prediger, ein Heiliger, der von Dorf zu Dorf zieht. Er ruft zum Kreuzzug auf. Aber nicht deshalb fahre ich meine Mutter dahin, sondern weil er Wunder vollbringt. Er heilt Kranke und macht Lahme gehend.“
„Ist das wieder ein Zeichen Gottes an mich?", fragte sich Krosigk. „Im Lateranpalast hörte ich zum ersten Mal diesen Namen, und jetzt schon werde ich diesen Fulko von Neuilly vermutlich treffen. Kann er mir vielleicht sogar helfen?“
Am späten Nachmittag erreichte der kleine Trupp das Bergdorf Aosta. Vor der Dorfkirche hatten sich bereits etwa hundert Menschen eingefunden, Männer, Bauern, Handwerker, Frauen, Kinder, Alte, Kranke und Bettler. Es war ein geräumiger Markplatz, im Westen von einigen Häusern, im Osten von einer Reihe Platanen umrandet, und im Süden begrenzte ihn die Kirchhofmauer. In der Mitte des Platzes befanden sich ein großes Brunnenbecken und eine steinerne Statue der Muttergottes, die mit dem Jesuskind im Arm huldvoll und liebevoll lächelte. Neben dem Brunnen stand der Pranger, eine Wand aus dicken Bohlen mit drei Löchern für die beiden Hände und den Kopf der Geächteten. Niemand wurde heute gefesselt zur Schau gestellt, aber die graue Holzbretterwand stand dort als stete Drohung und Warnung für die sündigen Dorfbewohner.
Einige Wartende hatten sich auf den Brunnenrand gesetzt, andere kampierten einfach auf dem Boden des Platzes, und wieder andere standen in kleinen Gruppen zusammen. Ein ohrenbetäubendes, auf und ab schwellendes Stimmengewirr der Menschenmenge vibrierte in der Luft, ab und zu übertönt vom schrillem Lachen einiger Weiber. Der geschäftstüchtige Bäcker des Ortes bot Kuchen und Semmeln feil, ein Gemüsehändler verkaufte Birnen, Äpfel und Trauben, und auch der Wirt des Gasthauses war auf dem Markt und reichte Wasser, Wein und Säfte dar.
Jörg und sein Begleiter hoben Krosigk aus dem Wagen und setzten ihn auf eine Decke an die Kirchhofmauer. Der Schmerz hatte etwas nachgelassen, aber das Bein war immer noch ohne jede Kraft, und Krosigk war froh, dass er sich anlehnen konnte. Jörg, den ein Hustenanfall plagte, kauerte sich neben seinen Herrn auf den Boden. Der zweite junge Mönch wurde losgeschickt, um im Dorf oder bei einem Bauern in der Umgebung ein Quartier für die Nacht zu suchen. Die Sonne war schon hinter den Bergen verschwunden, doch es war noch taghell, und der Himmel hing wie eine blasse, schwefelgelbe Kuppel über dem Talkessel. Ein Schwarm von Krähen kreiste in der Höhe und ließ sich schließlich mit lautem Gekrächze im Geäst der Platanen nieder.
Plötzlich verstummten die lärmenden Gespräche, das Lachen und Schreien der Dorfbewohner, die Menge wich auseinander, und über die nun frei gewordene Gasse näherte sich ein von zwei Ochsen gezogener Leiterwagen, der zwischen dem Pranger und der Kirchhofmauer anhielt. Männer und Frauen scharten sich eilig im Halbkreis um diesen Wagen, in dem mehrere schwarz gekleidete Mönche saßen. Zwischen ihnen stand der Priester Fulko von Neuilly. Hoch aufgerichtet stand er da mit zum Himmel gestreckten Armen. Er war ein Riese, und seine kräftigen Hände ragten wie Pranken aus den Ärmeln seiner Kutte. Auf einem langen, schlanken Hals saß ein breiter Schädel mit schwarzem Haupt- und Barthaar, mit mächtigen Backenknochen und wulstigen Lippen. Doch, was die Blicke aller Anwesenden anzog, waren die bleichen, hohlen Wangen und die großen dunklen Augen, die mit geheimnisvollem Glanz eine wilde Entschlossenheit und überirdische Kraft ausstrahlten.
„Ihr Männer und Frauen, lasset uns beten.“ Fulkos laute Stimme dröhnte über den Markplatz. Die Dorfbewohner knieten auf dem Pflaster nieder, und Fulko betete mit geschlossenen Augen zum Herrn Jesus Christus.
Danach sprach er zu der Menge: „Ihr Männer und Frauen, ich bin gekommen, um euch von den Gräueltaten zu berichten, die die Ungläubigen im fernen Palästina uns Christen zufügen. Sie schänden die heiligen Stätten, wo unser Herr Jesus lebte und litt. Sie besudeln die Grabeskirche in Jerusalem, sie bespucken in Bethlehem die Krippe, in der Maria unseren Heiland bettete. All das müssen die Christen dort dulden. All das müssen auch wir hier im Abendland dulden. Ich frage euch: Ist das noch zu ertragen?“
Fulko blickte drohend in die Runde.
„Nein, nein“, riefen viele wütend und empört.
„Und dennoch dulden wir es.“ Fulkos Stimme klang wie rollender Donner. „Wir dulden es, denn wir sind Sünder. Aber Sünder sind wir nicht nur deshalb. Nein, wir sind habgierig, wir lügen, wir sind der Wollust verfallen. Nicht nur ihr Bauern, Kaufleute und Handwerker, nein auch die Fürsten, Grafen und Kleriker suhlen sich in den Lastern dieser Welt. Die Menschen sind verdorben, und Gott hat gerechte Strafen über unser Land verhängt, die Hungersnot, die Seuchen und die Kriege. Wer liebt noch den Nächsten wie sich selbst? Wer von euch ist frei von Habsucht, Neid und Lüge? Wer hat noch nicht ein fremdes Weib begehrt? Du, und du, und du!" Fulko streckte seine Hand zornig gegen drei Bauern, die in der ersten Reihe fassungslos auf den Prediger starrten. „Ihr alle seid Sünder. Euch alle wird Belzebub in der Hölle mit eisernen Ringen würgen, Leviathan wird eure Därme zerwühlen, und Satan wird eure Glieder im Feuer braten. Und das nicht nur für kurze Zeit. Nein, ewig, ewig wird diese eure Qual dauern.“
Ein Zittern ging durch die Menge, die Männer duckten sich, die Weiber kreischten und schluchzten, auch kleine Kinder jammerten und weinten.
„Und dabei ist das Paradies doch für jeden von uns nah.“ Fulkos Stimme wurde zart und schmeichelnd. „In Frieden und Freuden könnten wir nach unserem Tod in der Nähe des gütigen Gottes und unseres Herrn Jesus leben. Im Garten Eden plätschern frische Quellen, in den lauen Lüften duftet das Rosenparfum, himmlische Musik erklingt, und leise Lieder der Engel erwarten die Rechtschaffenen und Unschuldigen.“
„Aber.…“, und wieder dröhnte Fulkos tiefer lauter Bass, „das ist nicht für euch Sünder, die ihr für die Hölle bestimmt seid. Doch …“ Fulko machte eine lange Pause, und alle starten erwartungsvoll auf seinen Mund. „ …es gibt einen Weg der Rettung! Unser Heiliger Vater in Rom hat diesen Weg gewiesen. Alle Sünden können euch vergeben und aus dem Buch der Engel gelöscht werden. Auch du und du …“, Fulko zeigte wieder mit seinem knorrigen Finger auf einige Bauern in der Menge, „… kannst ins himmlische Paradies gelangen. Nur eine Bedingung müsst ihr vorher erfüllen. Ihr müsst das Heilige Land befreien. Ihr müsst es befreien vom Unrat der Heiden. Ihr müsst ausziehen nach Palästina und den dort lebenden Christen in ihrer Not helfen. Das ist es, was Gott von euch fordert. Das ist es, was Gott will. ‚Deus lo vult’, hat vor hundert Jahren Papst Urban gerufen. Auch unser Heiliger Vater in Rom, Papst Innozenz, der sein Nachfolger auf Petri Stuhl ist, ruft uns diesen Satz zu. Er hat uns in seiner Großherzigkeit ein herrliches Versprechen gegeben. Und wie lautet dieses Versprechen? Jedem, der am Kreuzug teilnimmt, werden die Sünden vergeben, und nach dem Tod wird er auf sicherem Weg ins Paradies geleitet. Kommt her! Schwört, ins Heilige Land zu ziehen. Dort, nur dort könnt ihr Erlösung und Eingang ins Paradies finden. Ich und diese Mönche im Wagen werden das Kreuz auf eure Mäntel heften. Ihr werdet zu denen gehören, die im Heiligen Lande kämpfen. Halleluja! Danket alle Gott für diese seine Gnade.“
Die Mönche, die bisher sitzend der Predigt gelauscht hatten, erhoben sich und machten sich bereit, vom Wagen herunterzusteigen. Freudestrahlend und begeistert drängte sich das Volk heran. Doch Fulko schwenkte noch einmal den rechten Arm.
„Ihr werdet fragen, was geschieht mit den Alten und Kranken, die nicht die beschwerliche Reise unternehmen können? Auch ihnen hat der Heilige Vater Gnade gewährt. Auch sie können sich von ihren Sünden reinwaschen. Sie müssen nur die Hälfte ihres Eigentums spenden, um den Kreuzzug zu unterstützen. Wer könnte sich weigern? Mehr als die Hälfte wird jeder vernünftige Mann spenden, wenn solche Belohnung winkt. Lasst uns alle beten und unserem Herrn danken!“
Der Priester faltete die Hände zum Gebet, und die Menge tat es ihm nach. Dann stiegen Fulko und seine Begleiter vom Wagen. Jedem, der andächtig kniete, legten sie die Hände auf den Kopf, murmelten ein kurzes Gebet und hefteten ein kleines Kreuz aus schwarzem Tuch auf den Mantel.
Fulko kam auch zu Krosigk, der noch immer an die Kirchenmauer lehnte, und herrschte ihn an: „Warum kniest du nicht? Willst du dich denn nicht bekennen? Lehnst du das Kreuz ab?“
„Nein! Ich will es“, antwortete Krosigk unter Tränen. „Aber ich bin gelähmt. Ich kann nicht reisen.“ Und dann flüsterte er verzweifelt: „Es ist eine Strafe Gottes.“
„Sei unverzagt. Die Strafe wird dir erlassen.“ Mit kräftigen Händen griff Fulko unter die Arme des Alten und zog ihn mit einem Ruck nach oben.
„Bete, schwöre, und ich gebe dir das Kreuz.“ Fulkos Blick richtete sich streng auf Krosigk, und dem schien es, als ob Funken in den großen Augen blitzten.
War es die ruckartige Dehnung der Wirbelsäule, die den lähmenden Nerv befreit hatte, oder war es ein göttliches Wunder? Krosigk spürte plötzlich wieder Kraft in seinem Bein, es gehorchte seinem Willen wie eh und je, und es hielt seinem Gewicht stand. Leise weinte der Bischof von Halberstadt, faltete die Hände und dankte mit einem inbrünstigen Gebet Gott, dem Vater im Himmel. Gleichzeitig gelobte er im Stillen, nach Deutschland zurückzukehren, dort eine Gefolgschaft zu sammeln und mit ihr ins Heilige Land zu ziehen. Inzwischen hatte Fulko von Neuilly dem Bischof ein Kreuz aus schwarzem Tuch an die Kutte geheftet.
1 Römer 1.27, 1.kor. 6.9, Mt 5.29
Auf Burg Hagenau
Heinrich VI., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Sizilien, starb 1197 plötzlich und unerwartet während der Vorbereitung eines Kreuzzuges ins Heilige Land. Nach seinem Tod flammte in Deutschland der alte Streit zwischen Staufern und Welfen wieder auf. Es wurden zwei Könige gekrönt, der Staufer Philipp von Schwaben und der Welfe Otto IV. von Braunschweig. Papst Innozenz III. unterstützte den Welfen, denn er fürchtete eine Einkreisung des Vatikanstaates durch die Staufer, die im Gegensatz zu den Welfen auch in Unteritalien herschten.
Unabhängig von diesem Streit der Könige liefen die Vorbereitungen für einen neuen Kreuzzug. Als dessen Anführer war der Markgraf Bonifaz von Montferrat gewählt worden, und er bemühte sich, in Frankreich und Deutschland Ritter anzuwerben.
Wenige Tage vor Weihnachten im Winter 1201 hatte es zum ersten Mal in diesem Jahr geschneit. Dicke Schneeflocken waren während der Nacht im ganzen Elsass vom Himmel gefallen und hatten auch die Burg Hagenau, einst Lieblingspfalz von Kaiser Barbarossa und jetzt Wohnsitz seines Sohnes König Philipp von Schwaben, in eine weiße Decke gehüllt. Am Morgen zog auch noch ein kalter Nordwind auf, pfiff um die Burgecken, rüttelte an den Fensterläden und ließ die Wetterfahnen auf den Dächern knarren.
In der Mittagsstunde saß König Philipp zusammen mit seiner Gemahlin Irene-Angelina und deren jüngerem Bruder Alexios im Palas der Burg. Diener hatten die Fenster in den frühen Morgenstunden mit den Holzläden fest verschlossen, ein notwendiger Schutz gegen das Schneetreiben und den eisigen Wind. Die geräumige Kemenate war mit Teppichen ausgelegt und jetzt, da die Fenster verschlossen waren, allein von den lodernden Flammen der Eichenscheite im Kamin erhellt. Das Ehepaar saß auf einer Bank in der Nähe des Feuers. Vor ihnen stand eine Wiege, auf deren Kufe König Philipp einen Fuß gesetzt hatte und die neugeborene Tochter langsam hin und her schaukelte. Dem Königspaar gegenüber saß Alexios, ein Jüngling von fünfzehn Jahren. Auf seinen Schoß war die ältere Tochter des Königspaares, Beatrix, geklettert und zupfte den Onkel mit Vergnügen und lautem Juchzen wieder und wieder am spärlich sprießenden Bart. Alexios ließ es wie unbeteiligt geschehen und starrte abwesend in die Flammen. Plötzlich fuhr er aus seinen Gedanken hoch, sein bleiches Gesicht verzerrte sich hasserfüllt, er ballte die Fäuste und bebte vor Wut.
„Dieser Hund! Dieser Satan! Ich werde ihn in siedendem Wasser kochen, ich werde ihm die Haut Fetzen um Fetzen vom Leib reißen. Ich werde ihn mit glühendem Eisen blenden, so wie er es mit unserem Vater gemacht hat.“ Die letzten Worte wurden von erbärmlichem Schluchzen erstickte, das den jungen Mann überfiel, ohne dass er sich dagegen wehren konnte.
Königin Irene-Angelina war aufgesprungen und zu ihrem Bruder geeilt. Sie griff zärtlich tröstend mit beiden Händen seinen Kopf und drückte seine Stirn an die ihre.
„Beruhige dich, Alexios beruhige dich. Du kannst und musst unseren Vater nicht rächen.“ Auch ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, während Alexios herzzerreißend wimmerte.
Irene-Angelina und Alexios waren die Kinder des Kaisers Isaac von Byzanz, der mit Kaiser Barbarossa vor etlichen Jahren ein Bündnis geschlossen hatte. Ein Pfand dieses Bündnisses war Irene-Angelina, die an den jüngsten Sohn Barbarossas, Philipp von Schwaben, verheiratet wurde. Irene-Angelina galt trotz ihrer etwas zu spitzen Nase und den schmalen, oft energisch zusammengekniffenen Lippen als große Schönheit. Das perfekte Oval des Gesichtes, die zarte weiße Haut, die harmonisch geschwungenen Augenbrauen, die großen, dunklen und langbewimperten Augen verfehlten bei keinem Mann ihre Wirkung und verlangten auch den Frauen einige Bewunderung ab. Obwohl Irene-Angelina nun schon lange in Deutschland lebte und hier zwei Kinder geboren hatte, verabscheute sie immer noch dieses ihr fremd gebliebene Land. Die Kälte, der ewig graue Himmel, der unerträgliche Nieselregen, die dunklen Wälder, die unkultivierten, groben und schmutzigen Menschen, die kärgliche Behausung, die feuchten Burgmauern und das schäbige, unelegante Mobiliar waren für die verwöhnte junge Frau ein ständiges Ärgernis. Sie sehnte sich zurück an den Bosporus, ans Goldene Horn, ans türkisfarbene Marmarameer, sie vermisste den azurblauen Himmel des Südens, die warme Sonne und das leichte beschwingte Leben in den prächtigen Palästen und Gärten von Konstantinopel. In Deutschland fühlte sie sich der meisten Freuden und Annehmlichkeiten des Lebens beraubt. Oft war sie deshalb gereizt, missgelaunt, rechthaberisch und zänkisch, was den Umgang mit ihrem Mann und den Dienern am Hof manchmal unerträglich machte.
Vor einem Jahr war ein erschütterndes Unglück über sie und ihre Familie hereingebrochen. Ihr Vater, Kaiser Isaak Angelos, war in Byzanz vom Thron gestürzt worden. Der eigene Bruder hatte eine Revolte am Kaiserhof angezettelt und Isaac hinterrücks und heimtückisch überfallen. Nicht nur der Kaiser, sondern auch dessen Sohn Alexios, der noch ein halbes Kind war, wurden gefangen und eingekerkert. Dem Vater stach man die Augen aus, was eine Rückkehr auf den Thron ein für allemal unmöglich machte, denn ein Blinder galt als untauglich, um Kaiser in Byzanz zu sein. Wahrscheinlich war dem Sohn später ein ähnliches Schicksal zugedacht gewesen, wenn er als erwachsener Mann Ansprüche auf den Thron hätte stellen können. Irene-Angelina war verzweifelt. Sie bedrängte ihren Ehemann, Truppen nach Byzanz zu schicken, um den Vater und den Bruder zu befreien. Doch Philipp konnte wegen des erwarteten Kampfes mit dem Gegenkönig Otto von Braunschweig auf keinen seiner bewaffneten Männer verzichten. Er schickte aber Geld ins oströmische Reich, mit dem es Freunden gelang, einen Kerkermeister zu bestechen. Alexios konnte fliehen, und versteckt zwischen Fässern eines pisanischen Handelskutters kam er nach Ancona in Italien. Dort erwarteten ihn schon bewaffnete Knechte, die Irene-Angelina geschickt hatte und die den Jüngling nach Deutschland eskortierten. Unter großen Strapazen überquerte die kleine Truppe die Alpen, wo der Winter schon mit eisigem Frost und Schnee die Pässe unwegsam machte. Vor wenigen Tagen war Alexios endlich in Hagenau eingetroffen.
„Beruhige dich, Alexios, beruhige dich doch“, wiederholte Irene-Angelina und strich ihm mit der Hand über die Stirn. Der junge Mann war erschöpft und übermüdet. Unruhig und wie von bösen Geistern getrieben war er seit seiner Ankunft von Raum zu Raum gewandert, ohne Schlaf zu finden. Sein Gesicht war bleich und ausgezehrt, die Augen lagen tief in dunklen Höhlen und seine Lider mit den langen schwarzen Wimpern zuckten nervös.
„Du musst dich ausruhen und erholen“, sagte Irene-Angelina sanft und strich ihm immer noch mütterlich-tröstend über das Gesicht. „Wir werden schon etwas für dich finden. Du musst ein neues Leben beginnen und kannst das auch.“
„Ach, wozu soll ich ein neues Leben beginnen? Ich gehöre nach Byzanz. Hier bin ich unerwünscht, ein Fremdling. Ich will zurück nach Byzanz. Ich will die Sprache der Byzantiner hören, ich will die Luft am Marmarameer atmen, die südliche Sonne auf meiner Haut fühlen und den Anblick der golden glänzenden Paläste genießen.“
Erschöpft hing Alexios im Sessel und starrte gedemütigt und verzweifelt in die Flammen des Kamins.
Das kleine Mädchen Beatrix, die bei dem plötzlichen Wutausbruch des Onkels erschrocken von seinem Schoß gewichen und zum Vater geeilt war, kam jetzt vorsichtig wieder zurück und streichelte den von der Stuhllehne herabhängenden Arm des Onkels.
König Phillip freute sich über die Warmherzigkeit und das Mitgefühl seiner Tochter. Das Benehmen der Geschwister hingegen berührte ihn peinlich. Er fand die Gefühlsausbrüche seines Schwagers und das Verhalten seiner Frau übertrieben und theatralisch.
„Fasse dich, junger Mann“, sagte er aufmunternd .
Irene-Angelina warf ihrem Gemahl einen kalten, wütenden Blick zu und zischte böse: „Das kannst Du überhaupt nicht verstehen. Du bist ein Barbar, dir fehlt das kultivierte Mitgefühl. Du solltest ihm lieber helfen, als ihn zu ermahnen. Ja, helfen solltest du ihm. Helfen! Helfen! Helfen!“, wiederholte sie zornig.
Philipp hatte sich angewöhnt, Vorwürfe seiner Frau zu überhören, und versuchte jetzt, das Gespräch in ruhigere Bahnen zu lenken.
„Lasst uns vom Weihnachtsfest reden. Viele Ritter und Edelfrauen aus der Umgebung und auch von weit her werden übermorgen eintreffen, um mit uns zu feiern. Das wird auch dich auf andere Gedanken bringen, Alexios. Dein trauriges Gesicht sollte mal wieder lächeln und fröhlich lachen.“
„Und du glaubst das wirklich?“ Alexios blickte seinen Schwager verstockt und fast feindselig an.
Es klopfte. Ein Diener trat in die Kemenate: „Königliche Hoheit, der erwartete Gast, Marquis von Montferrat, wird in wenigen Minuten in die Burg einreiten. Der Wächter am Burgtor hat ihn und sein Gefolge in der Ferne gesichtet.“
„Nun, da werde ich ihm entgegengehen und ihn empfangen.“
Phillip sprang auf. Irene-Angelina machte ein ärgerliches Gesicht, denn das Gespräch war für sie noch nicht zufriedenstellend beendet. Philipp bemerkte den Unwillen seiner Frau und sagte:
„Bonifaz ist ein alter Freund der Familie, er hat immer zu uns Hohenstaufen gehalten und ist mit meinem Vater mehrfach ins Feld gezogen. Ich muss ihn am Tor empfangen. Das verlangt die Höflichkeit. Das weißt du genau so gut wie ich. Versuche, Alexios zu trösten und auf andere Gedanken zu bringen. Ich bin bald zurück.“
Philipp küsste seine älteste Tochter auf die Stirn, gab dem Schwager einen freundschaftlichen Schlag auf die Schultern, streichelte noch einmal zart mit dem Finger die rosige Wange des Säuglings und schritt dann eilig zur Tür. Dort warf er sich einen Pelz über die Schultern und folgte dem Diener hinunter in den Hof.
Philipp war dreiundzwanzig Jahre alt, hochgewachsen und schlank. Sein schönes vornehmes Gesicht war von kastanienbraunem Haupthaar und Bart umrahmt, dessen rötlicher Schein die Wissenden an seinen Vater, den Kaiser Barbarossa, erinnerte. In den letzten Jahren war für Philipp in unerwarteter Schnelligkeit ein Ereignis auf das andere gefolgt und hatte seinen Lebensplan von Grund auf verändert. Als Knabe hatte er sich zu einem geistlichen Amt berufen gefühlt und war schon zum Bischof Elekt in Würzburg bestellt worden. Doch dann starb erst sein Vater Barbarossa und wenig später sein Bruder Heinrich, der die Nachfolge des Vaters angetreten hatte. Philipp war nun der nächste in der Reihenfolge der Thronanwärter und wurde von den süddeutschen Fürsten zum König gewählt. Aber die Fürsten im Norden des deutschen Reiches erhoben Otto von Braunschweig aus dem Geschlecht der Welfen zum Gegenkönig. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den beiden Königen bahnte sich an und schien unvermeidbar. Philipp hasste diese Situation, und die Regentschaft war für ihn nicht Freude, sondern eine Last, eine schwere Last. Am liebsten hätte er sich dem Joch des Königtums entzogen. Aber davon konnte keine Rede sein. Zu groß waren die Verpflichtung gegenüber seinen Vasallen und die Verantwortung für das Geschlecht der Hohenstaufen.
Die Stiefel von Philipp und dem Diener klackerten auf den Steinstufen und hallten in dem feucht-kalten Gemäuer des engen Treppenhauses. Der junge König eilte voraus, immer zwei Stufen gleichzeitig nehmend, während der Diener, ein beleibter Mann mit gebeugtem Rücken und grauen Haaren, nur mühsam Schritt halten konnte. Als die beiden in den Hof traten, blendete sie die weiße Schneedecke, und ein eisiger Wind trieb dicke Schneeflocken in ihre Gesichter. Einige Diener hatten sich bereits hinter dem Tor in Reih und Glied aufgestellt, um den Gast zu empfangen. Die Zugbrücke im Eingangsturm war herabgelassen worden, und das Torgatter wurde gerade von zwei Wächtern heraufgezogen. Trompetenfanfaren ertönten zur Begrüßung der Ankommenden. Von Ferne antwortete der Klang von Hörnern.
Bald polterten Pferdehufe auf der hölzernen Zugbrücke, und der Marquis von Montferrat ritt begleitet von sieben Knechten und einem älteren Priester auf den Hof. Mit Klatschen und Hurrarufen wurde der kleine Trupp von den Burgbewohnern begrüßt.
Der Marquis war ein kräftiger, breitschultriger Mann von etwa fünfzig Jahren, und jedermann, der ihn sah, glaubte, einen Riesen mit der stämmigen muskulösen Statur und dem kantigen Gesicht eines Gladiators vor sich zu haben. Mit einer Eleganz und Kraft, die man seinem massigen Körperbau nicht zugetraut hätte, stieg er vom Pferd und trat mit weit ausholenden Schritten auf Philipp zu. Eine schnelle Handbewegung strich den Schnee aus seinem grauen borstigen Haar, und unter buschigen Augenbraunen, in denen sich einige vereiste Flocken gefangen hatten, blickte er freudig den ihm entgegeneilenden Philipp von Schwaben an.
Dem höfischen Anstand gehorchend, beugte er vor dem König das Knie.
„Aber nein, steht auf“, rief Philipp, fasste den Älteren an den Armen und zog ihn zu sich hin. „Ich freue mich so sehr, dass Ihr gekommen seid. Ihr, der Freund meines Vaters, gehört doch zur Familie. Früher, als ich noch Kind war, dachte ich tatsächlich, Ihr seid mein Onkel. Kommt herein in die Burg. Die Kälte ist ja widerlich und unerträglich.“
Nachdem der König auch die anderen Ankömmlinge, besonders Fulko von Neuilly begrüßt hatte, begaben sich alle in die Burg. Für den Marquis und Fulko wurde ein warmes Dampfbad bereitet, und die Knechte erhielten in der Burgküche eine kräftige Fleischsuppe mit Fladenbrot und einige Kannen des besten Pfälzer Weins.
________________
Am nächsten Morgen unternahm König Philipp mit seinen Gästen einen Ausritt in den Hagenauer Forst. Fulko wollte das Kloster Fürstenbrück besuchen, das man in zwei Reitstunden zu erreichen hoffte. In Pelze gehüllt verließen Philipp, der Marquis und Fulko begleitet von vier Landsknechten die Burg. Das Schneetreiben und der Nordwind hatten sich gelegt. Die Luft war aber immer noch eisig kalt, und Dampffahnen traten beim Atmen aus den Mündern der Menschen und den Mäulern der Pferde. Als das Burgtor hinter ihnen lag, ließen sie die Pferde über die schneebedeckten Felder galoppieren. Der erfrischende Ritt wärmte die Glieder von Mensch und Tier. Am Buchenwald angelangt, gestatteten die Männer den Pferden einen langsamen Schritt. Die Bäume waren winterlich kahl, und zwischen den mit Schnee bedeckten Zweigen schimmerte das blasse Licht eines milchig blauen Himmels. Auf dem engen Weg unter den Buchen konnten nur zwei Pferde nebeneinander laufen. Zwei Knechte machten die Vorhut, gefolgt von Philipp und dem Marquis. Hinter den beiden ritt der Mönch Fulko, schweigend und in Gedanken versunken. Die Nachhut bildeten wiederum zwei Knechte.
Da sie im Wald unter den Buchen längere Zeit nur im Schritt reiten konnten, glaubte Montferrat den Augenblick gekommen, ein wichtiges Anliegen zur Sprache zu bringen:
„Philipp, was würdest du sagen, wenn ich dich aufforderte, am Kreuzzug nach Palästina teilzunehmen.“
„Ach hör mir auf mit Kreuzzügen. Mein Vater ist dabei umgekommen, und mein Bruder Heinrich ist bei der Vorbereitung gestorben. Was soll ich im Heiligen Land? Ich habe hier in Deutschland genug Schwierigkeiten. Mit Otto dem Welfen wird es vermutlich zum Krieg kommen, und wer siegt, ist leider überhaupt nicht sicher. Selbst eine friedliche Pilgerfahrt nach Jerusalem kann ich mir nicht leisten, geschweige denn einen Zug zusammen mit bewaffneten Rittern.“
„Der einzige Grund, dass ich jetzt bei diesem eisigen Wetter hierher gekommen bin, ist, dass ich dich um Unterstützung für den Kreuzzug bitten wollte. Ich wollte dich überzeugen, mitzuziehen oder wenigstens einige Ritter mit uns ziehen zu lassen. Du weißt es sicher schon. Man hat mich inzwischen zum Anführer des Kreuzzuges gewählt. Es soll im nächsten Jahr losgehen.“
„Nein, das wusste ich noch nicht. Wie kam denn das? Was ich weiß, ist, dass mein verehrter Papst Innozenz“ – Philipp lachte verächtlich – „zu einem solchen Zug aufgerufen hat. Gleichzeitig hat er uns Staufer schlecht behandelt. Nicht nur, dass er Otto den Welfen unterstützt, nein, er hat mir und meinen Rittern auch noch mit der Exkommunikation gedroht, weil ich den mir zustehenden Thron beanspruche.“
„Das würde er natürlich sofort zurücknehmen, wenn du dich uns anschließt.“
„Nein, nein und abermals nein! Wenn ich aus Palästina zurückkehren sollte, würde ich in Deutschland ein Fremder sein. Otto der Welfe wäre König und würde mich aus dem Land jagen oder einkerkern oder sogar hinrichten lassen. Und wenn ich nicht zurückkehre, was ja auch möglich ist, wäre es mit dem Anspruch der Staufer auf den Thron für immer vorbei. Aber erzähle. Wie kam es, dass man dich gewählt hat? Einiges weiß ich. Aber die Gerüchte, die zu uns ins Schwabenland dringen, sind oft falsch und voll von Übertreibungen und Unrichtigkeiten. Erzähl mir, wie kam es.“
„Nun das ist eine längere Geschichte. Soll ich sie erzählen?“ „Nur zu!“, forderte Philipp den Freund auf, und der begann seinen Bericht.
Nach dem Tod des staufischen Kaisers Heinrich VI. fühlte sich Papst Innozenz berufen, einen Kreuzzug anzukündigen, der unter Führung des Stuhles Petri die heiligen Stätten in Jerusalem von den Sarazenen befreien sollte. Allen, die mit nach Palästina ziehen würden, versprach der Papst die Vergebung ihrer Sünden und einen sicheren Platz im Paradies. In seinem Auftrag zogen zahlreiche Priester durch die Länder Europas und warben für den Kreuzzug. Doch diesem Unternehmen war zunächst wenig Erfolg beschieden.
Das änderte sich, als ein begnadeter Prediger namens Fulko von Neuily Zutritt zu einem Turnier der Grafen Frankreichs und Flanderns erhielt. In der Burg Ecry sur Aisne in den nördlichen Ardennen hatte Thibaut, der Graf der Champagne, zu einem festlichen Turnier geladen. Diesen Rittern und Granden predigte Fulko. Er sprach von den Leiden der Christen im Heiligen Land und schilderte die geschändeten, heiligen Stätten. Er tadelte zornig und mit grollender Stimme die unnütze Kraftverschwendung der Ritter beim Turnier, denn Gott und Jesus verlangten ihren Einsatz und ihre Stärke an ganz anderer Stelle, nämlich in Palästina. Mit Engelszungen besang Fulko sodann die Freuden des Paradieses, die auf die siegreichen Befreier des Heiligen Landes warteten.
Damit entfachte er ein Feuer der Begeisterung in den Herzen der jungen, tatendurstigen Ritter. Sie warfen die Turnierwaffen von sich, sanken auf die Knie und ließen sich das Zeichen des Kreuzzuges anheften. Die mächtigen und reichen Herren, der Graf Thibaud, Balduin von Flandern, Louis von Blois, Geoffrey von Perche und Hugh von Saint-Pol und viele andere schworen, nach Jerusalem zu ziehen und den Zug mit Geld und Männern auszustatten, damit das Heilige Land für immer von den Heiden befreit werde.
In der Folgezeit fanden mehrere Treffen der Grafen und Barone statt, um die Reise zu planen und vorzubereiten. Eingedenk der großen Verluste beim Zug des Kaisers Barbarossa durch Anatolien, kam man überein, für die Reise diesmal den schnelleren und sichereren Seeweg zu wählen. Gesandte wurden beauftragt, nach Italien zu reisen und in Venedig die Möglichkeit einer Überfahrt nach Palästina zu erkunden. Obwohl alle überzeugt waren, dass sehr viel mehr Männer die Reise ins Heilige Land antreten würden, veranschlagte man vorsichtig, dass 5000 Ritter, 10.000 Knappen mit ihren Pferden und noch einmal 20.000 Gefolgsleute also insgesamt etwa 35.000 Menschen auf den Schiffen befördert werden mussten. Die einzige Seemacht, die ein solch gewaltiges Unternehmen leisten konnte, war Venedig. Die Abgesandten wurden in Venedig ehrenvoll empfangen, doch als die Kaufleute Venedigs von den Plänen der Kreuzfahrer hörten, waren sie zunächst zurückhaltend. Das Unternehmen würde einen Umfang haben, wie ihn Venedig bisher noch nie geschultert hatte. Etwa 500 große gut ausgerüstete Schiffe waren nötig, um Mensch und Tier zu transportieren. Den Venezianern war klar, dass die Stadt ein erhebliches Risiko einging, denn sollte das Vorhaben scheitern, wäre auch Venedig dem wirtschaftlichen Untergang geweiht.
Nach langen Verhandlungen versprach der Doge Dandolo eine Flotte auszurüsten. Viele Handelsschiffe der Stadt mussten umgerüstet und in der Werft weitere 300 Schiffe neu gebaut werden. Auf Drängen der Abgesandten erklärte sich Venedig bereit, auf eigene Kosten 50 Kriegsgaleeren zu stellen. Dafür forderte die Stadt aber die Hälfte der in Palästina erwarteten Beute. Schließlich einigte man sich, und die Übereinkunft wurde mit einem schriftlichen Vertrag besiegelt. Venedig verpflichtete sich, innerhalb von Jahresfrist eine Flotte von 500 Schiffen bereitzustellen, und die Kreuzfahrer verpflichteten sich, die Kosten von 85.000 Goldmark in zwei Raten an die Staatskasse Venedigs zu entrichten.
Zufrieden, diese wichtigen Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen zu haben, kehrten die Abgesandten nach Frankreich zurück. Dort erfuhren sie, dass der junge Thibaut, Graf der Champagne, der den Kreuzzug anführen sollte, im Mai 1201 unerwartet gestorben war. Ein neuer Anführer musste gefunden werden. Eine Delegation der Barone suchte den Marquis von Montferrat auf und trug ihm an, die Führung zu übernehmen.
„Und so wie ich dich kenne, hast du angenommen!“, sagte Philipp lachend. „Na dann, los geht’s!“
Die Pferde waren während des Berichtes von Montferrat langsam nebeneinander im Schritt gelaufen. Jetzt gab Philipp seinem Rappen die Sporen und galoppierte eine Wegstrecke voraus. Als Montferrat ihn eingeholt hatte, wiederholte Philipp:
„Du hast zugesagt, da bin ich sicher.“
„Zunächst hab ich mir eine Bedenkzeit ausbedungen. Aber eigentlich reizte mich das Unternehmen von Anfang an. Einerseits kann man für das eigene Heil im Jenseits etwas tun. Anderseits winken auch ertragreiche Pfründen in Palästina. Doch ich habe auch die Schwierigkeiten gesehen. Ich fragte mich, ob sich wirklich so viele Ritter am Zug beteiligen würden wie geplant. Deshalb bin ich zu allererst nach Paris zu König Philipp Augustus gereist. Die meisten Ritter werden aus Frankreich kommen, und ich musste mir seiner Zustimmung sicher sein.“
„Und hat er dir seine Zustimmung gegeben?“
„Ja. Im Übrigen hat er mir aufgetragen, dich zu grüßen und dir zu versichern, er wird immer an deiner Seite stehen, auch wenn es gegen die Welfen geht. Außerdem hat er den Papst aufgefordert, dich und nicht den Welfen zu unterstützen.“
„Ist ja allzu gütig.“ Die Ironie in Philips Worten war unverkennbar. Montferrat lächelte, auch er wusste, dass das Angebot von Philipp August nicht ohne Eigennutz war. Dessen Konflikt mit England würde sich nämlich sehr viel ungünstiger entwickeln, wenn der Welfe, ein Verwandter und erklärter Freund der Engländer, in Deutschland König wäre.
„Nachdem ich die Zustimmung des französischen Königs hatte“, fuhr Montferrat fort, „bin ich nach Soisson geritten und habe zugesagt. Anschließend war ich auf dem Weg zu dir noch in Citeaux, dem Mutterkloster der Cisterzienser. Dort hat Fulko herzzerreißend gepredigt, und Hunderte haben das Kreuz genommen. Nur nicht die richtigen. Es waren verarmte Bauern, die im Kampf wenig ausrichten werden. Deshalb wäre deine Hilfe uns sehr willkommen.“
„Schlag dir das aus dem Kopf. Leider kann ich dir nicht helfen!“
Um das ihm peinliche Gespräch nicht weiterführen zu müssen, gab Philipp seinem Pferd die Sporen. Die anderen folgten, und in raschem Galopp legte der kleine Trupp die letzte Meile bis zum Kloster Fürstenbrück zurück.
_________________
Das Weihnachtsfest in der Burg Hagenau wurde mit aller Pracht und mit allem aufzubietenden Prunk gefeiert. Die großzügige Ausstattung des Festes sollte die materielle Not und die unsichere Lage der Staufer vergessen lassen. Zuversicht und Macht des Königs sollte seiner Gefolgschaft strahlend vorgeführt werden, und der ausgestellte Reichtum sollte die Gäste beeindrucken.
Die Diener hatten die Säle und Zimmer der Burg gescheuert, die Tische mit frischen Tüchern belegt, die Wände mit Girlanden geschmückt, neue Kerzen in die Ständer gesteckt und Öl in den Lampen nachgefüllt. Im großen Rittersaal, diesem düsteren Festsaal mit seinen hohen Säulen und dem weit gespannten Kreuzrippengewölbe, waren alle Armleuchter an den Wänden mit Fackeln bestückt. Auf langen Holztischen glänzten blank geputzte Zinnteller, Bierkrüge und Weingläser. Für die Königin Irene-Angelina und ihren Bruder hatte man silberne Gabeln bereit gelegt. Die Gäste aus dem Norden, die solches Gerät nicht gewöhnt waren, bedienten sich lieber mit den Händen und Fingern. Sie hatten schon in der Vergangenheit über diesen extravaganten Dünkel der Byzantiner mehrfach den Kopf geschüttelt.
In der großen Hofküche und der Hofbäckerei, die außerhalb des Palastes in einem eigenen Gebäude an der Burgmauer untergebracht waren, begann schon mehrere Tage vor dem Fest ein geschäftiges Treiben. Eine Schar von Köchen, Bäckern und Helfern, angetrieben vom Truchsess, arbeitete und schwitzte. An Spießen wurden Schweine und Kälber über dem Feuer gedreht, die Mägde rupften Gänse und Hühner, putzten Zuckerrüben, zerschnitten Gemüse, zerrieben Bohnen für die Mehlsuppe und bereiteten Gänsepastete mit feinen Gewürzen. Gepökeltes Fleisch wurde herbeigeschafft, das schon seit dem Sommer sicher gegen Schimmel und Verderb in den Kühlkammern der Burg lagerte. Aus den Kaminen holten die Diener geräucherte Würste und Schinken, aus den Speisekammern Butter, sauren Rahm und Käse. Soßen wurden nach geheimen Rezepten zubereitet, und der Truchsess legte selbst Hand an, um die süßen Puddings mit Birnen, Apfelkompott, Waldbeeren und Kirschen auf köstlichste Weise zu garnieren. In der Backstube wurden Brötchen, Pfefferkuchen und Honigkuchen hergestellt und vor allem viele Teller aus Brot geformt, um in ihnen Suppe und Fleisch zu servieren. Einem altem Brauch folgend, würden die leergegessenen Brotschalen später den Armen der umliegenden Dörfer als Weihnachtsgabe überreicht werden.
Ein kleiner Trupp von Spielleuten war einige Tage vor Weihnachten auf der Burg eingetroffen. Walter von der Vogelweide, ein bekannter Sänger, der wegen seiner klaren Stimme die ‚Nachtigall’ genannt wurde, hatte es übernommen, mit der Gruppe Lieder und Instrumentalstücke einzuüben. Er wohnte seit einigen Monaten in der Pfalz Hagenau und unterhielt die Burgbewohner mit seinen Minneliedern, Reimen, Gedichten und Spottversen vergnüglich und trefflich zugleich.
_________________
Endlich war das lang ersehnte Weihnachtsfest gekommen. Nach der gemeinsamen Messe in der Pfalzkapelle betraten die Gäste, angeführt vom König und der Königin, den Speisesaal, wo sie von heiterer Musik und dem fröhlichem Gesang der Spielleute empfangen wurden. Die Fürsten und Grafen mit ihren Ehefrauen, Söhnen und Töchtern nahmen am Honoratiorentisch Platz, wo in der Mitte der Tafel auch König Philipp mit seiner Gemahlin Irene-Angelina und sein Schwager Alexios sich hinsetzten. Den Ehrensitz zur Linken des Königs hatte man dem Montferrat zugeteilt.
Als alle ihre zugewiesenen Plätze eingenommen hatten, erhob sich König Philip, um die Gäste zu begrüßen. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass so viele aus Fern und Nah erschienen seien, forderte alle auf, heute ihre Sorgen zu vergessen und in fröhlicher Stimmung das Weihnachtsfest zu genießen, erwähnte kurz die unsinnigen Anfeindungen des Welfen, die niemand ernst nehmen könne, und wünschte schließlich allen für heute und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und Zufriedenheit. Nachdem er sich gesetzt hatte, sagte er leise zu Montferrat:
„Und bitte denk heute nicht an den Kreuzzug und meine Absage, die dich so verdrossen hat“
.
„Schon gut. Keine Sorge.“ Montferrat lächelte. „Ich fürchte nur, unser Priester Fulko, der dort hinten am Gesindetisch sitzt, wird uns einen Strich durch die Rechnung machen. Sein Glaubenseifer giert nach öffentlichen Auftritten. Einer solchen Menschenansammlung wie hier wird er nicht widerstehen können und seine heiligen Reden schwingen wollen.“
„Das käme mir recht ungelegen. Bitte behaltet ihn im Auge. Ich kann, wie du weißt - und hoffentlich auch einsiehst -, keinen Ritter entbehren. Hindere ihn am Sprechen, wenn es nötig werden sollte.“
Fulko der Mönch hatte sich am Tisch des Gesindes zu den Musikanten gesellt und saß neben Walter von der Vogelweide. Während dieser in bester Laune mit den Nachbarn plauderte und scherzte, saß Fulko wie ein stummer Waldschrat in schwarzer Kutte auf der Bank, in sich gekehrt, mit ärgerlich gerunzelter Stirn und verächtlichem Zucken der Mundwinkel. Zu sehr erinnerte den gottbesessenen Priester das Treiben auf diesem Fest an das, was er bei Fürsten und Kirchenoberen anprangerte: die Völlerei, der sorglose, unbedachte und verschwenderische Umgang mit Brot, nach dem sich so viele hungernde Arme im Lande sehnten. Als Walter nun auch noch eine abfällige, zotige Bemerkung über den Papst Innozenz machte und seine Zuhörer über die witzige Formulierung schallend lachten, ergriff Fulko gerechter Zorn. Mit hochrotem Gesicht sprang er auf. Laut dröhnte seine Stimme durch den Saal.
„Wir feiern heute die Geburt unseres Herrn Jesus. Daran sollte jeder von euch denken und nicht an seine eigene Lust und eitle Freude. In einem Stall bei Ochs und Esel ist er geboren. In hartes Stroh wurde das Kind gebettet. Arme Hirten kamen zu seiner Krippe. Bescheidenheit, Armut und Not war überall. Kein Kerzenlicht, kein Fackelschein, keine wärmenden Lampen, kein Gelage mit Fleisch, Milch, Butter und Wein. Ihr Männer und Frauen denkt daran, was ….“
Montferrat war zu Fulko getreten und zog dessen bereits drohend erhobenen Arm sanft, aber bestimmt nach unten.
„Lasst die Leute feiern“, flüsterte er. „Wir müssen diese Menschen behutsam zu unserem Ziel führen. Jetzt ist es noch zu früh. Lasst mich nur machen.“
Sacht, aber doch mit festem Griff drückte er Fulko auf die Bank zurück. Er tat das mit einer solchen Ruhe, Sicherheit und Entschiedenheit, dass ihn der Mönch, überrumpelt und völlig verdutzt, gewähren ließ. Weil Montferrat verhindern wollte, dass Fulko allzu bald seine Nachgiebigkeit bereuen und erneut zu einer heiligen Predigt ansetzen würde, ließ er sich neben ihm auf der Bank nieder, nachdem Walter von der Vogelweide bereitwillig zur Seite gerückt war.
„Herr Walter, ich habe schon von euch gehört und freue mich, euch hier zu treffen“, sagte Montferrat mit einer angedeuteten Verbeugung. „Könnt Ihr nicht für mich und für Fulko von Neuilly einen Eurer Reime vortragen.“
„Welche Art von Reimen wünschen die Herren, einen Minnegesang, eine Heldenhymne oder ein politisches Lied?“, fragte Walter beflissen, und die Vorfreude auf einen Auftritt glänzte in seinen Augen.
„Wir beide, ich und Fulko, gehören schon zur älteren Generation“, Montferrat wandte sich an Fulko. „Oder fühlt ihr euch noch jung genug, um einen Minnegesang zu hören?“. Als Fulko unwirsch und ärgerlich den Kopf schüttelte, fuhr Montferrat fort. „Also wir sind alt, und die Liebeslieder, für die ihr so berühmt seid, sind nichts mehr für uns. Wie wäre es mit etwas Ernsterem?“
.
„Auch das ist möglich. Kennt Ihr vielleicht schon mein Lied: ‚Ich saß auf einem Steine’?“
„Nein bisher nicht. Tragt es vor. Ich bitte drum.“
„Ich saß auf einem Steine
und deckte Bein mit Beine.
Darauf der Ellbogen stand.
Es schmiegte sich in meine Hand
das Kinn und eine Wange.
Da dachte ich sorglich lange,
dem Weltlauf nach und irdischem Heil,
doch wurde mir kein Rat zuteil:
wie man drei Ding erwürbe,
dass ihrer keins verdürbe.
Zwei Ding sind Ehr und zeitlich Gut,
das oft einander Schaden tut,
das Dritte Gottes Segen,
den beiden überlegen:
Die hätt’ ich gern in einem Schrein
doch mag es leider nimmer sein,
dass Gottes Gnade kehre
mit Reichtum und mit Ehre
zusammen ein ins gleiche Herz;
sie finden Hemmungen allerwärts.“
Montferrat, nachdem er dem Vortrag mit vor der Brust verschränkten Armen, wohlwollend und mit zunehmender Erheiterung, gelauscht hatte, klatschte laut und lange in seine massigen Hände. Die anderen Gäste taten es ihm gleich, und besonders die Damen lobten überschwänglich den jungen Sänger. Auch Fulko nickte Walter anerkennend zu, obwohl er nicht umhin konnte, zu denken, dass Reichtum und Ehre für viele der hier Anwesenden wichtiger seien als Gottes Segen und dass das leider auch für Montferrat gelte.
Inzwischen war Königin Irene-Angelina von ihrem Sitz aufgestanden und zog den widerstrebenden und lustlosen Alexios mit sich. Entschlossen und zielstrebig lenkte sie ihre Schritte zu dem Tisch, an dem Montferrat mit Fulko saß, und legte ihre Hand auf die Schulter des Marquis.
„Marquis, ich möchte Euch meinen Bruder Alexios vorstellen. Er lebt seit einigen Tagen hier bei uns am Hofe.“
Montferrat erhob sich, verbeugte sich, reichte dem verlegen dreinblickenden Alexios seine Hand und drückte sie kräftig. Zu Irene-Angelina gewandt sagte er:
„Majestät, König Philipp hat mir bereits von Eurem Bruder erzählt. Ein vielversprechender, junger Mann. Mein aufrichtiges Kompliment! Und die schönen, dunklen Augen hat er von Euch.“
„Wir beide würden gern mit Euch allein sprechen. Lasst uns nach nebenan in die Kammer dort gehen.“
Sie schritt so bestimmend zu einer Tür am Ende des Rittersaals, dass die beiden Männer folgen mussten, wollten sie nicht unhöflich sein. Das kleine Zimmer, in das sie eintraten, war mit Teppichen ausgelegt, und in der Ecke stand ein Kamin, in dem ein Feuer flackerte. Mit einer Handbewegung forderte Irene-Angelina, dass man sich setzen solle.
Alexios war immer noch stumm, verlegen und abweisend. Deshalb ergriff die Königin das Wort:
„Marquis, Ihr habt sicher vom Unglück meiner Familie in Byzanz gehört. Mein Vater ist Opfer eines abscheulichen und gemeinen Komplotts geworden. Zeitlebens hat er seinem Bruder, meinem Oheim, alle Großzügigkeit und Freundlichkeit zukommen lassen. Doch dieser heimtückische Mann hat eine Revolte am Hof angezettelt. Mein Vater wurde vom Thron gerissen, und…“, Irene-Angelina stockte und wischte sich eine Träne aus dem Auge, „…jetzt fristet er ein jammernswertes Dasein in einem kalten Verließ von Konstantinopel.“
Im Gesicht von Monferrat spiegelte sich aufrichtiges Mitleid. Er senkte ehrerbietig den Kopf.
.
„Das bedauere ich sehr. Ihr habt mein volles Mitgefühl.“
„Mein Bruder Alexios war auch eingekerkert“, fuhr Irene-Angelina fort. „Gott sei es gedankt, er konnte fliehen. Aber hier in Deutschland fern der Heimat - seht ihn Euch an, Marquis - ist er ein Häufchen Unglück.“
Montferrat nickte verständnisvoll.
„Und dabei könnte es so leicht sein, die Lage in Byzanz zu ändern.“ Irene-Angelina machte eine Pause, und erst als Montferrat sie erstaunt und fragend anblickte, fuhr sie fort:
„Mein Oheim ist ein Tyrann. Das Volk hasst ihn. Hätte Alexios nur ein Duzend kampferprobter Ritter an seiner Seite, er könnte leicht die Stadt von dem Despoten befreien. Die Adligen und das Volk, die von den Soldaten meines Oheims jetzt noch grausam unterdrückt werden, würden sich sofort erheben und Alexios unterstützen.“
„Wenn der Tyrann so verhasst ist, werden ihn die Adligen auch ohne Hilfe von außen über kurz oder lang stürzen. Ich denke, Ihr Bruder sollte einfach die Zeit für sich arbeiten lassen und geduldig warten.“
„Aber Ihr wisst doch, wie das ist, Marquis. Solange kein Signal von außen kommt, sind die Bürger verängstigt, zumal mein Oheim gnadenlos gegen sie vorgeht.“
„Ja, da habt Ihr recht. So ist das leider oft“
Irene-Angelina wartete auf eine weitere Äußerung von Monferrat, doch als diese ausblieb, fuhr sie vorsichtig fort:
„Von meinem Gemahl erfuhr ich gestern, dass Ihr im Begriff seid, mit einem gewaltigen Heer ins Heilige Land zu ziehen.“
„Das stimmt.“
„Wie schön wäre es, wenn auch meine Landsleute aus Byzanz an diesem christlichen Zug teilnehmen könnten.“
„Das wäre uns in der Tat sehr willkommen.“
„Aber mein Oheim, dieser Tyrann, wird das nicht gestatten. Ganz im Gegenteil. Er unterhält gute Beziehungen zu den Sarazenen im Heiligen Land.“
Es entstand eine Pause.
Um das Gespräch in einfacheres Gewässer zu lenken, sagte Montferrat:
„Majestät, das Weihnachtfest am Hof ist wunderschön. Eure großzügige Gastfreundschaft können wir gar nicht genug loben.“ Aber so leicht ließ sich Irene-Angelina nicht von ihrem Thema abbringen.
„In Byzanz gibt es eine starke Partei, die alles geben würde, wenn mein Oheim vom Thron gestoßen und Alexios sein legitimes Erbe auf dem Kaiserstuhl antreten würde. Doch diese Menschen sind von den Söldnern des Oheims eingeschüchtert. Erbarmungslos und grausam bringen sie jeden um, der Widerstand leisten will. Diese armen Menschen! Und dabei könnte nur einge geringe Zahl von Rittern das ändern.“ Irene-Angelina blickte traurig zu Boden.
„Habt Ihr schon mit Eurem Gemahl, dem König, darüber gesprochen. Ein Duzend kampferprobter Ritter könnte sich hier im Schwabenland sicher finden lassen, um Byzanz von seiner Tyrannei zu befreien.“
Irene-Angelina seufzte. „Philipp ist völlig verstrickt in den verfluchten Streit mit dem Welfen. Ich habe ihn mehrfach gebeten und treffe immer nur auf taube Ohren. Marquis, mir kam ein Gedanke. Ich wage kaum, ihn auszusprechen.“ Irene-Angelina blicke verlegen und schüchtern zur Erde.
Sanftes, verführerisches Lächeln einer Madonna, dachte Montferrat. Und dahinter die eiskalte Berechnung einer Schlange. Sei auf der Hut, Bonifaz!
„Bitte, wagt es“, sagte er leichthin.
„Wäre es nicht denkbar, dass einige Ritter des Kreuzzuges einen kleinen Umweg über Konstantinopel machen.“ Irene-Angelina hatte langsam und mit Bedacht gesprochen, nun zögerte sie und blickte Marquis fragend an, dessen Gesicht unbeweglich blieb wie eine Maske.
„Und ….Ihr könntet“, fuhr Irene-Angelina leise und stockend fort, „leicht und schnell meinen Vater befreien und meinem Bruder Alexios den Thron verschaffen, der ihm zusteht.“
Wieder kein Zeichen des Verstehens auf dem Gesicht des Marquis.
„Herr Marquis!“ Die Stimme von Irene-Angelina wurde energischer, fast zornig. „Ihr müsst doch den Vorteil für den Kreuzzug sehen. Mein Bruder wird Euren Zug mit Geld unterstützen, und hunderte von byzantinischen Soldaten werden sich Euch anschließen, um Jerusalem zu befreien.“
„Hoheit, das zu entscheiden und anzuordnen steht nicht in meiner Macht. Das Ziel des Kreuzzuges ist das Heilige Land. Dort wollen wir die heiligen Stätten unseres Herrn Christus befreien. Ein kleiner Umweg, wie Ihr es nennt, ist bei keinem der Ritter und Pilger durchzusetzen.“
Irene-Angelina schien verzweifelt, und Tränen rollten über ihre Wangen.
„Nun, es war der Papst, der zum Kreuzzug aufgerufen hat“, sagte Montferrat beschwichtigend, „und Innozenz III. betrachtet sich immer noch als dessen Anführer. Eine Möglichkeit wäre es, dass sich Euer Bruder Alexios an den Heiligen Stuhl wendet. Dort wünscht man übrigens, die östliche Kirche unter die Oberhoheit Roms zu holen. Vielleicht könnte Prinz Alexios in dieser Hinsicht etwas erreichen. Ich weiß, dass der Heilige Vater schon einmal kreuztragende Ritter nach Süditalien geschickt hat, um auf dem kleinen Umweg - wie Ihr es nennt - Unteritalien von den Deutschen zu befreien. Doch nun entschuldigt mich, bitte. Ich habe Eurem Gemahl versprochen, auf Fulko zu achten. Seine allzu ernsten Reden sollen das fröhliche Weihnachtsfest nicht stören. Ich darf hier nicht länger verweilen.“
Alexios hielt Irene-Angelina zurück, während Montferrat die Kammer verließ. So bekam er nicht mehr mit, wie Irene-Angelina ärgerlich mit dem Fuß stampfte und wütend ihre kleinen, zarten Fäuste ballte.
Ankunft in Venedig
Im Sommer 1202 sammelten sich die von jenseits der Alpen angereisten Truppen des Kreuzzuges bei Venedig. Ihnen wurde von der venezianischen Behörde der Lido der Insel Sankt Nikolaus als Unterkunft zugewiesen, wo sie ihre Zelte aufschlugen. Nur wenigen Rittern und Geistlichen war es gestattet, in Venedig selbst Quartier zu beziehen.
Neben dem Kreuzzug war es ein weiteres wichtiges Anliegen von Papst Innozenz, die Kirchen West- und Ostroms zusammenzuführen. Weitgehend unbemerkt vom Abendland erkundete deshalb eine römische Gesandtschaft in Byzanz, wie man sich über die unterschiedlichen Glaubensinhalte, das Azyma, den Filioquezusatz und die Auffassung von der Erbsünde, einigen könne.
An einem Nachmittag im August des Jahres 1202 standen Bischof Konrad von Krosigk von Halberstadt, sein Begleiter Jörg und ein junger venezianischer Benediktinermönch im Mittelschiff des Markusdomes zu Venedig. Die beiden Männer aus Deutschland hatten die Köpfe in den Nacken gelegt und betrachteten andächtig die hohe Domkuppel, die mit einem goldenen, überirdisch schönen Mosaik geschmückt war.
Vor drei Tagen war Bischof Krosigk mit zweihundert Kreuztragenden nach langer beschwerlicher Fahrt am Rande der venezianischen Lagune angelangt. Die Ordnungskräfte der Stadt Venedig hatten ihn sogleich auf die Insel Sankt Nikolaus gewiesen, wo schon andere Kreuzfahrer kampierten. Krosigk hatte am Folgetag die befreundete Benediktinerabtei San Giorgio Maggiore auf der gleichnamigen kleinen Insel in der Lagune aufgesucht und war, was er insgeheim gehofft und erwartet hatte, vom Abt eingeladen worden, als Gast im Kloster zu bleiben. Die ihm und seinem Begleiter Jörg angebotene, weißgetünchte Zelle war bescheiden eingerichtet, mit zwei Betten, einem Schrank, einem Tisch und zwei Stühlen. Aber diese Unterkunft war bei weitem angenehmer und bequemer als ein Zelt auf Sankt Nikolaus. Der Abt hatte den jungen Novizen Mario beauftragt, die Gäste zu betreuen und ihnen auch die Stadt Venedig zu zeigen. Am nächsten Morgen waren sie zu dritt in eine vor dem