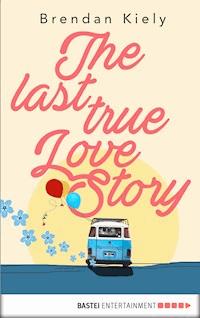9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Niemand ist eine Insel heißt es in einem Gedicht. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes, heißt es weiter. Doch Aidan bezweifelt das. Er hat seine Unschuld verloren und seinen Glauben. An Gott, an Vater Greg, an seine Eltern, eigentlich an alles und jeden. Erst als er Josie, Sophie und Mark kennenlernt, beginnt die Mauer zu bröckeln, die er um sich selber errichtet hat. Mit der Freundschaft zu den dreien wächst Aidans Selbstvertrauen. Und zwar soweit, dass er schließlich den Mut findet, die Wahrheit zu sagen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Niemand ist eine Insel heißt es in einem Gedicht. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes, heißt es weiter. Doch Aidan bezweifelt das. Er hat seine Unschuld verloren und seinen Glauben. An Gott, an Vater Greg, an seine Eltern, eigentlich an alles und jeden.Erst als er Josie, Sophie und Mark kennenlernt, beginnt die Mauer zu bröckeln, die er um sich selber errichtet hat. Mit der Freundschaft zu den dreien wächst Aidans Selbstvertrauen. Und zwar soweit, dass er schließlich den Mut findet, die Wahrheit zu sagen.
Über den Autor
Brendan Kiely hat Creative Writing studiert und seine Arbeiten in den unterschiedlichsten Magazinen veröffentlicht. Inzwischen unterrichtet er an einer Schule in New York, wo er mit seiner Frau auch lebt. Aidan – Sünde. Lüge. Liebe. Mut ist sein erster Roman, ein weiterer ist in Arbeit.
Brendan Kiely
AIDAN
SÜNDE. LÜGE. LIEBE. MUT.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Förs und Christa Prummer-Lehmair
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischsprachigen Originalausgabe: »The Gospel of Winter«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2014 by Brendan Kiely
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München Umschlagmotiv: © FAVORITBUERO, München, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock/Ollyy, shutterstock/stockimages E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1182-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Jessie, die sagte: Was wäre, wenn …?
Die Frage lautet nicht: Was soll ich glauben?, sondern: Was soll ich tun?
Sören Kierkegaard
Kapitel 1
Um euch zu erzählen, was wirklich passiert ist, was ihr nicht wisst, was die Journalisten nicht berichtet haben, muss ich mit Mutters alljährlicher Party an Heiligabend anfangen. Zwei Nächte zuvor hatte ein Schneesturm unsere kleine Ecke von Connecticut mit einer weißen Decke überzogen, als wäre das Universum Koproduzent bei Mutters großer Show. Sie war entzückt. Elektrische Kerzen im Fenster, Kränze an den Türen, Schneeverwehungen, die sich pittoresk an die Hausmauern schmiegten – alles war »einfach wundervoll«, wie ihre Freundinnen zu sagen pflegten. Dieses Ambiente würde die Stimmung heben, zumindest äußerlich. Das war typisch Mutter – Fröhlichkeit als Überlebensstrategie –, und alle zogen sich gerne ihr Festtags-Allheilmittel rein. Wir sollten über hundertfünfzig Gäste in unserem Haus willkommen heißen und dabei die Tatsache ignorieren, dass der alte Donovan – obwohl sein Name in Prägedruck neben ihrem auf den Einladungen stand, die schon Ende Oktober rausgegangen waren – in Europa war. Er hatte dort bereits den Großteil des Jahres verbracht und wollte jetzt für immer bleiben.
Früher durfte ich das Arbeitszimmer des alten Donovan nicht betreten, aber jetzt, da er nicht mehr zu Hause wohnte, hatte ich es in Besitz genommen. Ich drückte mich zwischen seinen Büchern und Kuriositäten aus aller Welt herum, in der Hoffnung, darin ein bisschen Weisheit zu finden, um diese schreckliche Leere zu füllen, die sich in mir ausbreitete. Wäre die Party nicht gewesen, hätte ich die ganze Nacht im Arbeitszimmer gesessen und Frankenstein für den Englischunterricht bei Mr Weinstein gelesen. Aber da war nun mal die Party, und Mutter war oben und machte sich fertig, deshalb sagte ich mir, scheiß drauf. Um das zu überleben, brauchte ich eine Starthilfe.
Ich schloss die Tür ab und setzte mich in den Drehsessel hinter dem Schreibtisch. Nur die weißen Lichterketten in den Sträuchern draußen vor den Fenstern beleuchteten den Raum. Eine Weile saß ich im Halbdunkel und lauschte, während anderswo im Haus die Leute vom Lieferservice zugange waren. Schließlich schaltete ich die kleine Leselampe ein, damit ich bei dem, was ich gleich tun würde, überhaupt etwas sah. Der Tischkalender war schon seit Wochen nicht mehr aktualisiert worden, doch als ich ihn über die Schreibunterlage zu mir heranzog und mit der Rückseite nach oben hinlegte, veränderte ich nichts daran. Die Metalloberfläche schimmerte im Lampenschein. Ich schüttelte ein paar Adderall-Pillen heraus und legte sie auf den Kalender. Mit einem von Donovans schweren Stiften zerkrümelte ich sie, teilte den Haufen in kleinere Häufchen, zerlegte den Stift und schnupfte durch das leere Röhrchen eine Line.
Alle möglichen Gedanken und Erinnerungen explodierten in meinem Kopf, und aus dem Dunkel schälte sich ein Bild des alten Donovan heraus – sein bleicher, kahler Kopf; die prüfend blickenden Augen. Er beugte sich zu mir und knurrte eine seiner üblichen Belehrungen. Junge, du kannst nur eins sein – jemand, der für die anderen Tatsachen schafft oder jemand, der sich vor vollendete Tatsachen stellen lässt. Der alte Donovan war jemand, über den man in der Zeitung las, einer der Männer, die sich in Davos, Peking oder Mumbai trafen und mit einem Händeschütteln die Weltwirtschaft veränderten. Global denken, lokal handeln, wollte ich ihm entgegenhalten, aber das mit dem »lokal handeln« kriegte er nicht hin, weil er nie zu Hause war. Außerdem, wann gab ich ihm schon mal Ratschläge – wann fragte er mich nach meiner Meinung?
Ich zog mir noch eine Line rein. Die geisterhafte Erscheinung des alten Donovan ließ sich in den Sessel fallen: Direkt vor meinen Augen materialisierte sich eine Erinnerung. Er las eine Ausgabe der Barron’s. Seine Socken hatte er in die Schuhe gestopft, die neben ihm auf dem Boden standen, und seine bloßen Füße ruhten auf dem Polsterhocker. Sie erinnerten an Rosinen, die vor dem Kamin verschrumpelten und austrockneten. Er schwitzte und kratzte sich den struppigen Haarkranz über seinen Ohren. Auf dem Tisch neben ihm lag ein Stapel gefalteter Zeitungen, darauf thronte ein kleiner Aschenbecher, aus dem zahlreiche zerdrückte Kippen wie Grabsteine aufragten. Auf der breiten Sessellehne stand ein Glas. Es war noch ziemlich voll, aber er goss den Inhalt komplett hinunter, seine große Nase an den Rand gedrückt. Wie üblich blieb ihm ein zähflüssiger Faden in der Kehle hängen, und er räusperte sich. Junge, du kannst von Glück reden, wenn du eine gottverdammte Fußnote der Geschichte wirst. Die meisten Menschen leben ein nichtssagendes, unbedeutendes Leben. Ich versuche dir zu helfen.
Ich konzentrierte mich, bis in meinem Kopf nur noch eine einzige Stimme war. Sie klang irgendwie nach mir; zumindest kam sie mir vertraut vor. »Ich bin hier!«, rief ich schließlich in die Leere um mich. »Ich bin hier im Zimmer.« Aber da war nur ich und die Stille um mich herum, und in diesem Nichts fürchtete ich mich. Ich fürchtete mich vor anderen Menschen und vor meinem eigenen verdammten Selbst, und meine Ängste überwältigten mich, sie bedrängten mich wie etwas Lebendiges, Atmendes, das bedrohlich auf mich zukam. Ich hätte nicht gewusst, wie ich ohne meine chemischen Aufputschmittel meine Sinne zusammengehalten und meine Ängste überwunden hätte. Ich schnupfte die letzte Line Adderall, brachte den Schreibtisch in Ordnung, schlüpfte aus dem Arbeitszimmer und fühlte mich endlich gewappnet für diesen Abend.
Um das Geländer der großen Treppe von der Eingangshalle zur Galerie im ersten Stock waren frische Laubgirlanden gewunden. In sämtlichen Räumen waren die Catering-Leute mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Zwei Kellner im Smoking drapierten eine künstliche Schneedecke aus Gaze um den Fuß des Weihnachtsbaums im Wohnzimmer. In der Bibliothek, im Durchgang zur Küche, stellte ein Barkeeper auf einer behelfsmäßigen Bar mehrere Reihen Gläser auf. Die Catering-Firma schickte nie zweimal dasselbe Personal zu Mutters Partys, und trotzdem wusste jeder, was zu tun war. Den ganzen Abend hindurch würde das stumme Ensemble aufs Stichwort die Bühne betreten und wieder hinter den Kulissen verschwinden. Sobald die Gäste eintrafen, war das das Zeichen für meinen Auftritt, aber im Augenblick schien niemand Notiz von mir zu nehmen.
In der Küche fand ich Elena, die sich mit ein paar Leuten von der Catering-Firma unterhielt. Missbilligend nahm sie die Unordnung in Augenschein, die sie anrichteten, aber als sie mich entdeckte, kam sie zu mir herüber. Sie trug die Bluse mit dem weißen Kragen, wie immer bei Mutters Partys. Sie war gerade erst beim Friseur gewesen, und als ich mich zu ihr hinunterbeugte, um sie zu umarmen, hatte ich Angst, die zarten Löckchen zu zerdrücken, die über ihre Knopfleiste wallten. »Wirst du dich heute Abend amüsieren?«, fragte sie auf Spanisch.
»Nein, bestimmt nicht.«
Sie rückte meinen Kragen zurecht. »Du musst besser auf dich achten.«
»Dafür habe ich doch dich«, entgegnete ich.
»Ah, m’ijo, bitte«, murmelte sie. Vor meinen Eltern nannte sie mich natürlich nie so, und in ihrer Gegenwart sprachen wir auch nicht Spanisch miteinander. Ich übte Spanisch mit ihr, wenn wir allein zu Hause waren, und inzwischen, nach all der gemeinsamen Zeit, beherrschte ich es beinahe fließend.
Sie küsste ihre Finger und drückte sie auf mein Gesicht. Als sie lächelte, wurden ihre Augen ganz schmal. »Bitte. Sei vernünftig.«
»Schau mich an«, sagte ich und deutete auf mein Jackett und die Krawatte, die ich meiner Mutter zuliebe angezogen hatte. »Ich bin bereit, meine Rolle zu spielen.« Sie beobachtete, wie sich die Caterer an den beiden Backöfen zu schaffen machten, und ich nahm ihre Hand. »Können wir uns nicht einfach in dein Apartment verziehen?«, fragte ich sie. »Sie wird nicht mal merken, dass wir nicht da sind. Bei all den Leuten, die sie engagiert hat. Sie braucht uns nicht.«
Elena musterte mich. »Geht es dir gut? Was ist mit deinen Augen?«
»Nichts.«
Ich hatte bestimmt rote Ränder um die Augen, aber Elena schüttelte nur den Kopf und fragte wie üblich nicht weiter nach. Sie umarmte mich, dann trat sie einen Schritt zurück und legte ihre Hände an meine Wangen. »Bitte. Hilf du auch mit. Für deine Mutter. Tu es für sie.« Dann gab sie mir einen Kuss und umarmte mich noch einmal, schloss mich wie so oft in ihre Arme.
Ich hätte noch länger so dagestanden, wenn der Kellner nicht eine Schüssel von der Küchentheke gestoßen hätte. Krachend zerbarst sie auf dem Küchenboden. Elena fuhr herum. »Ay, dios mio.« Sie funkelte ihn wütend an. »Nie passen sie auf«, murmelte sie, während sie sich anschickte, einen Besen aus der Abstellkammer zu holen.
Aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus machte ich mich auf die Suche nach Mutter und hörte ihre durchdringende Stimme aus dem Wohnzimmer. »Kein Sauvignon Blanc?«, fragte sie. Ich konnte mir nicht helfen: Manchmal, wenn sie sich so ereiferte, erinnerte sie mich an einen fiependen Delfin. »Kein Sauvignon Blanc?« Sie redete mit einem Phantom, das nur sie sehen konnte. Ihr tiefrotes Abendkleid ließ nahezu den gesamten Rücken frei. »Chardonnay und Sauvignon. Y Sauvignon, habe ich Elena gesagt. Y, Y, Y. Wir veranstalten doch hier nicht irgendeinen Charity-Empfang, sondern eine Weihnachtsparty. Etwas Auswahl gehört schon dazu, wenn man einen gewissen Stil wahren will.« Mutter fand immer die kleine Unregelmäßigkeit, die aus einem kostbaren Teppich einen wertlosen Fetzen machte. Es war Wein im Überfluss da, und wenn es so lief wie bei ihren anderen Partys, würden sich sogar die Leute vom Catering-Service aus den offenen Flaschen bedienen und am Ende des Abends zu ihren Lieferwagen torkeln.
»Sie hat ihn bestellt«, sagte ich. »Ich habe gesehen, dass der Barkeeper welchen kühl gestellt hat.«
»Was versteckst du dich denn zwischen den Möbeln?«, fragte sie. »Ich dachte, du wolltest mir heute Abend helfen.«
»Wer versteckt sich? Ich bin doch da. Ich sage nur, du musst ihr nicht immer für alles die Verantwortung zuschieben.«
»Das alte Lied. Ihr ewiger Verteidiger. Die heilige Elena.«
Sie atmete bewusst durch die Nase ein und zählte dabei. Ihre Schildkrötenatmung, wie sie es nannte, wenn gerade Yoga oder Tai Chi oder Pilates oder Seelen-Stretching oder sonst was in der Art bei ihr auf der Tagesordnung stand. »Na schön«, sagte sie, auf einmal betont fröhlich. »Sehen wir zu, wie wir dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Das hier ist immerhin eine Party. Du wirst Leute treffen.«
»Ich lächle doch.«
»Sei einfach locker«, sagte sie. Sie legte eine Hand auf ihre Hüfte. »Versuch, dir ein Beispiel an deinem Vater zu nehmen, und schau nicht so missmutig drein. Wir sind hier unter Freunden, Aidan.« Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass der alte Donovan bei der Begrüßung seiner Gäste letztes Jahr wie ein Politiker gegrinst hatte.
»Ich bin nicht er«, sagte ich.
»Nein«, sagte sie leise. »Aber tu wenigstens so.« Sie sah hinaus in den Garten und seufzte: »Bitte.«
Ich wollte ja. Ihr zuliebe.
Kerzen flackerten auf den Fensterbänken und auf Beistelltischen. Im Kamin knisterten Holzscheite, Funken sprühten. Die elfenbeinfarbenen Wände und Möbel nahmen im Schein des Feuers einen orangefarbenen Schimmer an. Als sie sich zu mir umdrehte, gab ich ihr, was sie wollte.
»Frohe Weihnachten«, sagte ich.
»Siehst du? Schon viel besser. Das ist es, was alle sehen wollen.«
»Na dann, auf ins Vergnügen«, entgegnete ich.
Sie lächelte triumphierend.
Als es an der Tür klingelte, strich Mutter ihr Abendkleid glatt und zwinkerte heftig. Es war so weit. Einer der Kellner richtete seine Fliege und öffnete die Haustür. Ich hatte die Hände in die Hosentaschen gesteckt, und kurz dachte ich, dass ich sie lieber rausziehen sollte. Aber es war nur Cindy, eine von Mutters besten Freundinnen, und Mutter rauschte in die Eingangshalle, als wäre sie wieder auf der Bühne im City Center und als wären keine zwanzig Jahre vergangen. Die beiden steuerten sofort die Bar an. Als sie ihre Getränke hatten, erhob Cindy ihr Glas. »Auf eine weitere von Gwens unvergleichlichen Partys«, sagte sie. »Sollen Jack und seine belgische Schlampe doch zur Hölle fahren.«
Obwohl beide hier in der Stadt aufgewachsen waren, hatten sie sich erst kennengelernt, als sie in die höchsten gesellschaftlichen Kreise Connecticuts eingeführt wurden. Cindy war noch zierlicher als Mutter, hatte jedoch ein breites, offenes Lächeln, das sich über ihr ganzes Gesicht zog. Gelegentlich traf ich Cindys Familie in unserer Kirche, Most Precious Blood, und ihr Sohn James war in der Country Day Academy zwei Klassen unter mir. Nur so konnte man bei Mutters Freunden den Überblick behalten: Indem man sie streng nach dem gesellschaftlichen Umfeld sortierte, in dem sie verkehrten. Wenn es genügend Überschneidungspunkte gab, begann ich, mir die Gesichter zu merken und die Eckpunkte ihrer Biografien, als wären es statistische Angaben auf der Rückseite einer Baseball-Sammelkarte. Doch anstatt ERA und RBI waren die Kategorien hier Privatvermögen, philanthropische Interessen oder die Anzahl der besuchten Donovan-Partys – und im Fall von Cindy hatte sie überall viel zu bieten.
Kurz darauf klingelte es erneut. Ich öffnete, sagte Hallo, und schon war ich mitten drin im Begrüßungsreigen. Ich musste ständig blinzeln, damit sich meine Augen nicht anfühlten wie zwei vor sich hin brutzelnde Spiegeleier. Die Gäste warfen mir nur ein kurzes Neonlächeln zu und gingen weiter. »Hallo«, begrüßte ich den nächsten Neuankömmling. »Hallo.« Ich dirigierte die Gäste, grinste übertrieben und klinkte mich dann ganz allmählich aus, sank zurück in eine trübe Leere. Auf einmal musste ich an die Frankenstein-Taschenbuchausgabe oben in meinem Sessel denken – die zum Leben erwachende Kreatur, die mit ihren gelben Augen vom Tisch aufblickt.
Die Räume füllten sich rasch mit Partygästen, und oft ließ es sich nicht vermeiden, dass man im Vorbeigehen Leute anrempelte. Die Gäste kippten ihre Drinks hinunter, um sie nicht zu verschütten. Sie taumelten mir entgegen und sagten mit ihren wun-der-vollen Stimmen etwas zu mir. »Topnoten!«, schrie ich zurück. »Oh, Yale, definitiv Yale.« Als Tüpfelchen auf dem i hätte ich fast noch diesen merkwürdigen Akzent nachgeahmt, den Amerikaner manchmal benutzen, um irgendwie britisch zu klingen, obwohl sie in Wirklichkeit von der Upper East Side stammen. Aber ich beherrschte mich und schlenderte ziellos von Raum zu Raum, während ich überlegte, wie ich all diesem verschwitzten und aggressiven Gelächter entkommen konnte.
Als ich mich an einer Menschenansammlung neben dem Klavier vorbeidrückte, um mal kurz im Arbeitszimmer zu verschwinden, entdeckte mich einer der ehemaligen Kollegen meines Vaters, Mike Kowolski, und winkte. Er balancierte seine mächtige Wampe quer durch die Eingangshalle zu mir herüber, sein Sohn Mark folgte ihm. Hätte Mark nicht das kräftige, kantige Kinn seines Vaters geerbt, hätte man sie kaum für Verwandte gehalten. In der Schule gab er sich cool und selbstsicher-distanziert, aber wahrscheinlich war er einfach gelangweilt. Wir trafen uns am Fuß der großen Treppe, wo Mike mich mit einem kräftigen Schulterklopfen begrüßte. »Sieh mal einer an, ganz der versierte Gastgeber. Meine Güte, Aidan, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Du bist ja schon so groß wie ich. Seit wann lässt dich dein alter Herr eigentlich mit solchen Haaren herumlaufen? Ein Mann sollte seine Augen nicht verstecken.« Er drohte mir mit dem Finger. »Du stellst Mark heute ein paar Leuten vor, ja? Sonst schnappst du deinem Freund hier noch all die guten Praktika weg.«
»Was geht, Donovan?«, fragte Mark. Uns als Freunde zu bezeichnen war ein Witz. Wir waren beide in der Zehnten, aber zum letzten Mal gegrüßt hatte er mich bei der obligatorischen Schwimmprüfung am Schuljahresanfang. Er war Kokapitän des Schwimmteams und musste uns alle der Reihe nach begrüßen, bevor wir ins Becken sprangen und zu beweisen hatten, dass wir uns zwei Bahnen lang über Wasser halten konnten. Meistens nannte ich ihn in Gedanken den Bronze-Mann, weil seine Haut das ganze Jahr über einen natürlichen Bernsteinton hatte. Die dichten Locken auf seinem Kopf schienen nie zu wachsen oder geschnitten zu werden. Früher waren wir zusammen zur Sonntagsschule gegangen, aber seit der Mittelstufe hatten wir nur noch miteinander geredet, wenn unsere Väter ein gemeinsames Dinner unserer beiden Familien arrangierten. Das letzte Mal lag Jahre zurück, bevor mein Vater die Firma verließ, um sich selbstständig zu machen.
»Mark muss heute Abend mit ein paar Leuten ins Gespräch kommen«, sagte Mike. »Da führt kein Weg dran vorbei. Das hier ist eigentlich keine Party, sondern eine Jobbörse, stimmt’s?« Er nickte seinem Sohn zu.
»Ich weiß, Dad.«
»Es hängt alles von der Betrachtungsweise ab, Jungs. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen.« Mike bohrte mir den Finger in die Brust.
Mark blickte zwischen seinem Vater und mir hin und her. »Na, dann sollte Aidan mich vielleicht ein bisschen herumführen.«
Mike packte Mark am Arm.
»Nutze den Tag«, sagte Mark. »Echt, ich hab’s schon kapiert. Aber ich kann doch jetzt ein bisschen mit Aidan abhängen. Ist schon okay.«
»Ich mache mit ihm die Runde«, sagte ich und bemühte mich dabei, so cool wie möglich zu klingen.
Mark wollte sich dem Griff seines Vaters entziehen, aber der ließ ihn nicht los. Er neigte sich zu uns hin. »Was zählt, ist der Fokus, Jungs. Das ist kein Spiel. Fokus, Fokus, Fokus. Wenn du etwas siehst, das du willst, dann geh darauf zu, und reiß es dir verdammt noch mal unter den Nagel.« Er lächelte uns an und zog auch mich näher zu sich heran, als wären wir eine Gruppe von Verschwörern. Sein Atem roch ein bisschen nach Shrimps. »Okay?«, fragte er.
»Sie sagen es«, antwortete ich.
Mark lächelte mir dankbar zu, und Mike schob seinen Sohn auf eine Gruppe von Männern zu, die im Wohnzimmer um den Kamin standen. Obwohl sie ihn in ihren Kreis aufnahmen, suchte Mark zwischen ihren Schultern hindurch meinen Blick. Seine auffällig hellblauen Augen fixierten mich. Hol mich hier raus, flehten sie. Ich war nicht daran gewöhnt, dass mich jemand um Hilfe bat. Wenig später war er allerdings schon dabei, die übliche Routine abzuspulen, indem er seinen Lebenslauf runterratterte – genauso wie ich immer auf Mutters Partys –, und war fürs Erste nicht zu retten.
Leg bloß deine Maske ab!, hätte ich Mike am liebsten ins Gesicht geschrien. Das lag mir auch bei den Kids in der Schule oft auf der Zunge. Legt eure künstlichen Mienen ab, dieses verdammte Grinsen, das euch jeden Weg freischaufelt. Ich hing manchmal mit solchen Kids herum – mit denen aus dem Debattierklub oder dem Schachklub – oder war bei jemandem zu Hause beim Essen oder setzte mich mit irgendwem beim Hockey oder Football auf die Tribüne. Aber wenn ich sie dann so reden hörte, kamen sie mir immer so sicher vor, so, als wäre ihnen ihr Selbstvertrauen in die Wiege gelegt worden. Niemand sagte jemals Ich weiß es nicht oder Ich habe Angst, und sie benahmen sich, als wären die Masken, die sie trugen, ihre wahren Gesichter und als könnten sie sich für immer und ewig allein mit ihrer Selbstsicherheit durchs Leben bringen. Sie schienen wirklich zu denken, dass sie niemand sonst brauchten. Wie hieß es in dem Gedicht von John Donne noch mal, das wir bei Mr Weinstein gelesen hatten, »Niemand ist eine Insel«? Hier war es anders. Wir waren ein gottverdammtes gesellschaftliches Archipel, das sich Gemeinschaft schimpfte. Warum hatte ich als Einziger das Gefühl, in einem Albtraum zu leben?
Und das Schlimmste war: Ich wusste genau, dass die Leute Angst hatten. Ich hatte die Angst in jedem einzelnen Gesicht an der Schule aufflackern sehen, im Herbst, als wir an einem strahlenden Dienstagmorgen auf einmal einen Horror vor Flugzeugen und dem Wort Dschihad bekamen. Seit diesem Tag ist die Angst ein Bestandteil unseres Lebens – bei Kindern, Erwachsenen, egal bei wem. Ich hörte die Beratungslehrer darüber reden: »Ich weiß nicht, was ich den Kindern erzählen soll. Ich habe doch auch Angst!« Warum hatte ich dann das Gefühl, ich sei der Einzige, der nach einer Art Stabilität suchte, nach einer Art Normalität, nach jemandem, der mir diesen ganzen Riesenhaufen Scheiße vom Leib hielt und mir sagte, dass alles wieder in Ordnung kommen würde?
Ich machte eine Schleife durch den Flur in die Bibliothek, überließ Mark seinem Schicksal und setzte mich an den Fuß der kleinen Treppe neben die behelfsmäßige Bar. Legt bloß eure Masken ab, wollte ich den meisten Gästen auf Mutters Party ins Gesicht sagen. Sie waren auch nicht besser als die Kids in der Schule. Mutter hatte verkündet, die diesjährige Weihnachtsparty solle alle bisherigen an Größe und Extravaganz übertreffen. Wir brauchen das, hatte sie gesagt, wir alle, und die Gäste schienen ihre Ansicht zu teilen. Wie in den Filmen über den Tag der Toten in Mexiko oder den Karneval, die ich gesehen hatte, trugen auch die Leute auf Mutters Party angemalte oder vom Alkohol gerötete Gesichter zur Schau.
Nach einer Weile spürte Mutter mich auf. Ich war überrascht, dass sie mich in dem überfüllten Raum gefunden hatte, aber sie steuerte zielstrebig auf mich zu. Sie hatte zwei Mädchen aus meiner Klasse im Schlepptau und quetschte sich durch eine Gruppe von Männern, die an der Bar anstanden. An ihrem strahlenden Lächeln war abzulesen, dass sie die beiden extra für mich eingeladen hatte. Ohne mich darüber zu informieren.
Sofort korrigierte ich meine Körperhaltung. Josie Fenton und Sophie Harrington kannte jeder Vollidiot. Viele an der CDA hielten sie für Stars, als wäre das Leben glamourös, wenn man sich nur richtig zu benehmen wusste. Im Herbst war Josie kurzzeitig mit einem aus der Zwölften gegangen, hatte aber nach einem Monat Schluss gemacht. Ich hatte mir angewöhnt, Josie zu beobachten und im Stillen mit ihr zu reden. Sie saß im Leistungskurs Englisch vor mir, und ich stellte mir vor, wie ich mit der Hand durch ihre langen braunen Haare fuhr. Wenn sie schrieb, warf sie den Kopf herum, sodass ihre Haare auf eine Seite fielen. Dann sah man die wundervoll zarte Neigung ihres Halses, die Stelle, die man bei einem Mädchen am liebsten küssen würde, wie ich fand. Sophie eilte ein anderer Ruf voraus, und viele Typen prahlten nur allzu gerne damit – und weil die Jungs sie immer anstarrten, hatte sie es sich angewöhnt, selbstbewusst zurückzustarren, mit ihren dunklen Augen und einem schmallippigen Grinsen, das sie älter wirken ließ als uns oder zumindest zynischer.
Nur weil die Mädchen die Töchter ihrer Freundinnen waren, hing Mutter offenbar der Illusion an, die beiden würden sich in der Schule mit mir abgeben. Als sie die beiden quer durch den Raum zu mir bugsierte, trug sie ein Lächeln im Gesicht, dass ich ihr wohl lieber nicht rauben sollte. »Sei ein guter Gastgeber«, sagte sie, während sie sich zum Gehen wandte. »Du hast heute Abend auch Gäste.«
Josie und Sophie standen neben mir und spähten durch die Menge, als suchten sie jemanden. Mit ihren High Heels und ihren engen Röcken sahen sie nicht anders aus als die Erwachsenen hier. Ich stand auf und wischte mir die Handflächen an der Hose ab. »Ich hatte keine Ahnung, dass ihr heute auch da seid«, sagte ich. Damit hatte ich die einzige Gelegenheit, ein bisschen Witz oder Charme zu versprühen, schon vermasselt.
»War wohl so ’n spontanes Ding oder so«, sagte Sophie. Die einsame Sommersprosse auf ihrer blassen Wange wanderte nach oben, als sie grinste.
»Hat hoffentlich nicht eure Pläne ruiniert.«
»Nein. Egal«, sagte Sophie. Josie ließ ein kurzes Lächeln aufblitzen. Sie trug Silberohrringe mit blauen Perlen, die zu ihrer Augenfarbe passten.
»Hoffentlich mussten sie euch nicht bestechen, damit ihr kommt.«
»Ach, hör schon auf«, sagte Josie und verdrehte die Augen. Es klang gelangweilt. »Jeder weiß, was für sagenhafte Partys deine Mutter schmeißt. So eine Einladung lehnt man doch nicht ab, oder?« Sie warf einen Blick zur Bar. »Schau dir bloß die Unmengen Alkohol an.«
Auch wenn sie nur höflich sein wollte, freute ich mich. »Darf ich euch einen Drink anbieten?«, fragte ich.
Irgendetwas am anderen Ende des Raums fesselte Josies Aufmerksamkeit, und sie antwortete nicht. Sophie sah sie an. »Vielleicht zwei Diät-Cola?«
»Nein«, sagte ich. »Ich meinte richtige Drinks.«
»Was?«, meinte Josie. »Echt?«
»Das ist doch hier ’ne Party.«
»Cool«, sagte Sophie. »Meine Mutter wird sowieso total blau sein.«
»Meiner wäre es vermutlich sogar noch recht«, sagte ich. »Besonders wenn sie mitbekommt, dass ich den ganzen Abend lang mit euch beiden abhänge.« Sie sahen sich mit zusammengepressten Lippen an, deshalb schob ich schnell noch nach: »Mark ist übrigens auch da.«
»Mark Kowolski?«, erkundigte sich Josie.
»Versuch mal, ob du ihn von seinem Vater loseisen kannst. Er hat Mark ein paar Typen im Wohnzimmer aufs Auge gedrückt, als ich ihn zuletzt gesehen habe.«
»Ooooh, eine Rettungsaktion«, sagte Sophie. »Kein Problem. Wo treffen wir dich mit den Drinks?«
Ich erklärte ihnen den Weg von der Eingangshalle zum Arbeitszimmer meines Alten, sie hakten einander unter und zogen ab, schoben sich wie eine zusammengeschweißte Einheit durch das Gedränge in die Bibliothek. Es sah aus wie ein Tanz, und kurz kam mir – wahrscheinlich, weil sie bei mir zu Hause waren – der Gedanke, dass ich mich ihnen anschließen könnte.
Ich brachte den Barkeeper dazu, mir ein paar Flaschen Sodawasser und einige Weingläser zu geben, und kehrte der Party so schnell wie möglich den Rücken. Als ich die Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters öffnete, waren sie alle schon versammelt. Josie und Sophie schlenderten an einer der Bücherwände entlang. Sie wirkten ganz gut gelaunt und hörten auch nicht auf, sich zu unterhalten, als ich zu ihnen trat. Zu meiner Überraschung sah es sogar so aus, als hätten sie Spaß. Mark stand neben dem sepiafarbenen Riesenglobus, der zwischen den beiden Ledersesseln aufgestellt war.
»Dein Dad liest wohl gern, was?«, fragte Josie. »Er hat das Arbeitszimmer hier und dann noch die Bibliothek.«
»Ein Dad, was war das noch mal?«, antwortete ich und stellte die Flaschen auf den Schreibtisch. Sophie drehte sich zu mir und sah mich teilnahmsvoll an. Josie nickte.
»Der Boss«, sagte Mark. »Ergebnisse! Das ist mein Dad. Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse.«
»Vielleicht klappt er ja mal zusammen«, sagte Josie. »Wie meiner. Jetzt ist er voll auf dem Ayurveda-Vinyasa-Trip.«
»Vielleicht«, sagte Mark.
»Tja, wenn der alte Donovan hier wäre, dürften wir sein Zimmer nicht betreten«, erklärte ich. »Schaut mal her.« Ich öffnete einen Verschluss am Globus, hob die obere Hälfte ab, und zum Vorschein kam eine Bar. »Wodka Soda?«, fragte ich und nahm die Flasche aus der Vertiefung. »Wir können auf unsere Väter trinken, ob sie nun abwesend sind oder ob wir wünschten, sie wären es.«
»Echt wahr«, sagte Sophie.
»Leute«, sagte Mark. »Überlegt euch das lieber noch mal. Sie werden merken, dass wir getrunken haben. Sie werden es riechen. Als mich mein Dad das letzte Mal dabei erwischt hat, hat er mich fast erwürgt. Ich wurde ungefähr einen Monat lang zu Hause angekettet. Haben wir nichts anderes da?« Er tippte mich an. »Du musst was anderes haben, Mann. Hast du Gras? Wir kiffen doch alle. Wenn ich kiffe, kriegen sie es nie mit.«
Ich lächelte ihn an; von mir aus konnten es auch die Pillen sein. »Genehmigen wir uns trotzdem erst mal einen. Die merken schon nichts. Ich bin bisher jedenfalls immer damit durchgekommen.« Sie setzten sich in die Sessel neben dem Globus, und ich machte mich daran, die Drinks zu mixen. Es war gut, eine Aufgabe zu haben, etwas, das mich in Bewegung hielt, mein Herz klopfte nämlich so heftig, als hätte ich mir noch eine Line Koks reingezogen. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit Josie, Sophie oder Mark reden sollte. Um Konversation zu machen, musste man spontan sein können, und Spontaneität machte mich nervös. Ich wollte nichts Dummes sagen und nichts, das ich später bereute.
»Nehmt mal einen Schluck«, sagte ich und reichte ihnen ihre Gläser.
»Das ist Belvedere, oder?«, fragte Josie, nachdem sie probiert hatte. »Schmeckt weich.«
»Ich dachte, du magst nur Ketel One.« Sophie lachte und trank dann ebenfalls. »Weißt du noch, bei Dustin? Oh mein Gott, wir waren so sturzbesoffen.«
Ich hob mein Glas auf eine Art, wie ich es bei einigen Erwachsenen auf der Party beobachtet hatte, indem ich es am Fuß hielt und nicht am Stiel. »Na dann, Cheers.«
Wir stießen an und amüsierten uns darüber, wie sich die anderen Partygäste betranken. Ich versuchte, nicht zu viel zu lächeln, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich mochte mein Lächeln nicht. Mir gefiel mein Gesichtsausdruck, wenn ich zuhörte oder eine Zigarette rauchte – ich hatte mich bei beidem im Spiegel betrachtet und konnte mit meinem Anblick leben –, aber wenn ich lächelte, sah ich ziemlich daneben aus.
Es überraschte mich jedes Mal, wenn ich einen Lacher bei den anderen landete, und ich hoffte, mir würden nicht plötzlich die Ideen ausgehen. Als ich meinen Drink schon zur Hälfte geleert hatte, fiel mir auf, dass die Gläser der anderen noch fast voll waren. Besonders das von Mark. Er hatte es auf dem Schreibtisch abgestellt. Eine Gesprächspause trat ein. Sophie starrte auf ihre Füße. Josie stand auf und ging zum Fenster, von dem aus man den ganzen Garten überblickte, bis hin zur Hecke der Fieldings.
»Was machen wir eigentlich auf dieser Rentnerparty?«, fragte Mark. Sophie verdrehte zustimmend die Augen. »Ich meine, nimm’s mir nicht übel, Donovan, aber das hier wäre viel cooler, wenn wir nicht drei Meter von unseren Eltern entfernt wären.«
»Mich stört es nicht«, sagte ich. »Ich habe nämlich was, womit ich es durchstehe.« Ich zog das Fläschchen Adderall aus der Innentasche meines Jacketts und schüttelte es. »Ich bin schon voll auf dem Trip.«
Sophie kniff die Augen zusammen. »Wirft man die einfach ein wie Vitaminpillen?«
»Nein«, sagte Josie. »Man schnupft sie, stimmt’s?« Sie trat auf mich zu und lächelte hinterlistig. »Machst du das jeden Tag?«
»Nicht jeden Tag.« Ich grinste. Sie lachte. Es war nicht mal ganz gelogen. Ich hatte es schon mal in der Schule gemacht, als ich am Einnicken war, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen hatte.
»Sollen wir?«, fragte ich.
»Das ist nicht mein Ding, Leute«, meinte Mark. »Nicht heute Abend. Mann. Ich klinge wie ein Spielverderber. Ihr wisst, dass ich das nicht bin.«
»Gut«, sagte Sophie. »Also ich bin dabei. Ich bin immer dabei.« Sie hob ihr Glas. »Versenken wir erst mal den hier.«
Ich erhob ebenfalls mein Glas und nahm einen großen Schluck, bekam jedoch zu viele Eiswürfel in den Mund. Einer blieb mir im Hals stecken und blockierte die Luftröhre. Mein Mund war total voll, aber luftleer. Das Sodawasser brannte in meiner Nase. Ich musste würgen.
»Oh mein Gott, bist du okay?«, fragte Sophie und beugte sich zu mir.
Ich atmete tief durch die Nase ein, aber ich bekam nichts hinein, oder es fühlte sich zumindest so an. Verzweifelt schnappte ich nach Luft. Das Sodawasser prickelte in meinem Mund und meiner Nase, meine Augen brannten. Um meinen Hals und meine Brust lag ein Gürtel, der sich immer enger zuzog. Angst wallte in mir auf, weil mir im Kopf so leicht zumute wurde wie bei diesem Spiel, bei dem man sich nur für den Kick absichtlich zur Ohnmacht bringt, und kurz bevor alles schwarz wird, denkt man: Scheiße, was, wenn ich zu weit gegangen bin? Was, wenn ich nicht wieder aufwache?
»Mein Gott, es klingt, als würdest du hyperventilieren«, sagte Josie.
»Er erstickt«, meinte Sophie. »Erstickt er gerade?«
Ich versuchte den Kopf zu schütteln und beugte mich vor, um etwas zurück in mein Glas zu spucken, aber dabei sprudelte der ganze Schwall heraus, und ich bespritzte Sophies Bluse und Rock.
»Verdammte Kacke!«, kreischte sie.
Meine Augen waren so tränenverschleiert, dass ich kaum etwas sah. »Tut mir leid«, stammelte ich. »Es tut mir so leid.«
»Seid doch leise!«, sagte Josie. »Reißt euch zusammen. Mach bloß keine Szene, sonst erwischen sie uns wirklich noch.«
»Tut mir leid. Ganz ehrlich.«
»Hat er meinen Rock ruiniert?«, wollte Sophie wissen. »Schau mal meine Bluse an! Was zum Teufel soll das?«
»Klappe! Echt jetzt.«
Mark ging zur Tür und lauschte aufmerksam auf die Stimmen in der Eingangshalle. Ich trocknete mir die Augen. Weil meine Kehle immer noch brannte, trank ich automatisch noch einen Schluck und goss dann aus keinem besonderen Grund den Rest hinunter, wobei ich die Eiswürfel mit den Zähnen zurückhielt. Mir wurde kalt bis in die Zehenspitzen, aber es fühlte sich gut an, wie der dicke, sirupartige Wodka mit dem Sodawasser meine Kehle hinabrann. Ich stellte das Glas ab, rupfte ein paar Kosmetiktücher aus der Box auf dem Schreibtisch und reichte sie Sophie, obwohl das gar nichts mehr nützte. Aus den Nebenräumen drang laute Musik herein, und die Leute brüllten über die Musik hinweg und versuchten sich gegenseitig zu übertönen. Niemand konnte uns hören.
Josie zog Sophie aus dem Sessel hoch, und sie begutachteten die dunklen Flecken auf ihrem grünen Rock. »Was soll ich bloß meiner Mutter erzählen?«, jammerte Sophie. »Was ist eigentlich mit dir los?«, fuhr sie mich mit gedämpfter Stimme an.
Josie packte mich am Arm. »Tu doch was! Bring uns sofort zu einem Badezimmer.«
Mit glühenden Wangen führte ich die Mädchen in den Flur. Mark folgte uns. Ein paar von Mutters spindeldürren Freundinnen, die in der Eingangshalle zusammenstanden, entdeckten uns. »Barbara. Barbara. Da ist er ja«, trällerte eine der Frauen. Obwohl ich einen Schritt vor Josie und Sophie ging, konnte ich mir ihre finsteren Mienen lebhaft vorstellen, als sie das hörten. Ich versuchte die Frau auszublenden, aber da überkam mich wieder dieses Beklemmungsgefühl. Ich winkte die Mädchen weiter, und wir gingen den Flur hinunter, weg vom Partygeschehen zu einem der ungenutzten Schlafzimmer, wo mein Vater ein paar Monate lang geschlafen hatte, bevor er sich endgültig vom Acker machte.
Ich hielt ihnen die Tür zu dem angrenzenden Badezimmer auf. »Hier stört uns keiner«, sagte ich. Josie rauschte an mir vorbei, und ich trat zur Seite, damit Sophie ihr folgen konnte.
»Treffen wir uns doch später draußen im Getümmel«, schlug Josie vor. »Ich mache Sophie wieder zurecht.« Sie hatte die Drinks mitgenommen und stellte sie auf die Ablagefläche neben dem Waschbecken.
»Ich kümmere mich um die beiden«, sagte Mark. Sie schlossen die Tür, und ich hörte sie flüstern, bevor das Wasser zu laufen anfing. Irgendwann stellten sie das Wasser wieder ab, doch die Tür blieb zu. Sie kicherten. Gläser klirrten. Mir war danach, etwas kaputt zu machen. Legt bloß eure Masken ab, ihr Wichser. Ich hätte es einfach sagen sollen, und sei es durch die verdammte Tür hindurch. Aidan ist ein Arschloch war in eine der Klotüren in der Schule geritzt, und ich war sicher, dass sie gerade etwas ganz Ähnliches sagten.
Noch mehr Gekicher, diesmal vom Flur. Eine der Frauen, die uns aus dem Arbeitszimmer hatte kommen sehen, stand im Türrahmen und sperrte das Licht aus, das vom Flur in das dunkle Schlafzimmer fiel. Sie winkte den Leuten hinter ihr zu. »Ja«, sagte sie, »sie sind hier drin.« Sie lehnte sich an den Türrahmen. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen. Sie war nur eine Silhouette, die im Dunkeln zu mir sprach. »Warum versteckst du dich denn da im Finstern, Aidan?«
In ihrer Stimme lag etwas Kaltes und Direktes, das mich erstarren ließ. Obwohl sie mich kaum sehen konnte, hatte ich das Gefühl, sie hätte mich nackt erwischt, und die Leere in mir breitete sich überallhin aus, sie sickerte in den Raum, auf den Teppich, die Bettlaken und die Korbmöbel. Eine zweite Frau gesellte sich zu ihr, dann noch eine, die mich ebenfalls fragte: »Was tust du denn da?«
Eine aus der Gruppe drängte sich zwischen den anderen hindurch und schaltete das Licht ein. Barbara Kowolski, Marks Mutter, trat in den Raum. Sie funkelte mich über ihre runden, erhitzten Wangen hinweg an. »Was hast du?«, fragte sie.
Ich schwieg, immer noch im Griff der Angst, die mich eben gepackt hatte. Die anderen Frauen lachten und begannen sich draußen im Flur zu unterhalten, aber Barbara stemmte die Hände in die Hüften. »Wo ist Mark? Wo sind die Mädchen?« Sie sah zur Badezimmertür und deutete darauf, wobei die Armreifen an ihrem Handgelenk klimperten. »Sind sie da drin? Ist Mark mit den Mädchen im Badezimmer?« Ich wollte verneinen, doch sie schob sich an mir vorbei und rüttelte an der Tür. Sie war abgesperrt. Marks Mutter sah wieder rüber zum Flur, die anderen Frauen waren gegangen. »Mark?«, sagte sie leise.
Kurzes Wasserlaufen, dann hörte man die Toilettenspülung. Josie öffnete die Tür und kam als Erste heraus. »Hallo, Mrs Kowolski.« Ihre Wangen waren gerötet. Sophie folgte ihr mit einem leeren Glas in der Hand, dahinter kam Mark, die Hände in den Hosentaschen vergraben. So nach vorne gekrümmt wirkte er viel jünger, wie ein Hund, der sich vor einer erhobenen Hand duckt.
»Junger Mann«, sagte Barbara zu ihm.
Keiner würdigte mich eines Blickes. »Mrs Kowolski«, begann Josie, »wir hängen nur zusammen ab. Was gibt’s? Wie geht’s denn so?«
Barbara runzelte die Stirn. Ihre Haut war so dauergebräunt und straff, dass ihr Gesicht sich wie der Blasebalg eines Akkordeons in Falten legte, wenn sie die Lippen bewegte. »Spar dir dein braves Getue.« Sie wandte sich an Mark. »Dein Vater hat nach dir gesucht. Er möchte dich jemandem vorstellen. Aber in diesem Zustand?« Barbara sah erneut zum Flur und dann wieder zu uns. »Folgendes wird jetzt passieren«, sagte sie. »Wir werden kein Wort über das hier verlieren. Wir werden euren Eltern nichts erzählen. Wir werden es Mike gegenüber nicht erwähnen. Kein Wort davon. Habt ihr mich alle verstanden?«
»Es ist nicht ihre Schuld«, sagte ich schließlich. »Der Alk ist von mir.«
Jetzt drehte sich Barbara zu mir und hielt mir einen ihrer blutroten Fingernägel vors Gesicht. »Ich weiß genau, wer schuld ist, Aidan.«
»Lass deine Wut nicht an ihm aus«, sagte Mark. Obwohl er am wenigsten von uns allen getrunken hatte, wirkten seine Augen glasig. Vielleicht waren es Tränen? »Aidan kann nichts dafür.«
»Und ob er das kann«, blaffte Barbara zurück. »Jetzt reicht es mir endgültig. Ich bring dich nach Hause.« Sie zeigte reihum auf die ganze Gruppe. »Ich bringe euch alle nach Hause.«
»Ma«, sagte Mark. »Komm schon.«
»Schluss jetzt«, sagte Barbara. »So ist es am besten für euch. Ich kläre das.« Sie zog Mark an sich und umarmte ihn kurz und leblos. »Du kennst doch deinen Vater, Liebling. Sei nicht dumm.« Sie schob Mark und die Mädchen in den Flur, während er sich noch von mir verabschieden wollte. »Nur weil dein Vater nicht hier ist, kannst du noch lange nicht tun und lassen, was du willst«, sagte sie zu mir. »Das sollte dir mal jemand klarmachen.«
Dann war sie weg. Ich schaltete das Licht im Badezimmer und im Schlafzimmer aus und setzte mich eine Weile im Dunkeln aufs Bett, während im Rest des Hauses die Party auf Hochtouren lief. Schließlich stand ich auf, trat ans Fenster und sah hinaus in den Garten. Das Mondlicht ließ die Schneedecke wie eine Mondlandschaft erscheinen – eine graue, geräuschlose Szenerie, die irgendwie so aussah, wie ich mir den Tod vorstellte –, eine Landschaft, in der man unweigerlich irgendwann einmal enden würde, für immer allein.
Am liebsten hätte ich mich verdrückt, vielleicht nach dort draußen, aber in der Eingangshalle und auf den Treppen waren überall Leute, sie bevölkerten alles. Die Party dehnte sich auf das ganze Haus aus und füllte ein Zimmer nach dem nächsten. All diese Leute, und niemand, mit dem man wirklich reden kann, dachte ich, bis ein vertrautes Lachen aus der Eingangshalle in den Flur drang. Ich kannte dieses Lachen, seit der Mann, zu dem es gehörte, in unsere Kirchengemeinde gekommen war, von Father Dooley die Messe übernommen und die Predigt in eine Märchenstunde verwandelt hatte. Seine tiefe und durchdringende Stimme, die wie ein Nebelhorn durch die Nacht hallte, weckte Heimatgefühle in mir. Erleichtert folgte ich ihrem Klang ins Partygewühl.
Keiner hatte ein Lachen wie Father Greg, ein Lachen, das aus ihm herausperlte und dann zunehmend an Volumen gewann. Er stand am Fuß der großen Treppe, sein rötliches Gesicht und der silbergraue Kinnbart glänzten im Schein des Kronleuchters. In einer Hand hielt er einen dicken Whiskeytumbler, und während er mit den Menschen sprach, die um ihn herumstanden, schwenkte er den Scotch darin. Die meisten mussten beim Zuhören zu Father Greg aufschauen, denn nicht nur seine Stimme war auffällig. Hätte man ihn zusammen mit Trainer Randolf von der CDA in den Ring gestellt, hätte dieser wohl nur schwerlich den Mut aufgebracht, gegen ihn zu boxen. Father Greg sah aus, als hätte er schon zu einer Zeit, als es noch keine Helme und Schulterpolster gab, Football gespielt und trotzdem keine Kratzer abbekommen.
Soeben lachte er über seine eigene Geschichte; als er mich sah, lud er mich mit einem Kopfnicken ein, zu sich zu kommen, was ich unverzüglich tat. Er war ein gern gesehener Partygast. Für ihn war Tanzen kein Teufelszeug, und er hatte vollstes Verständnis dafür, dass die Leute in unserem katholischen Städtchen zwar den Faschingsdienstag und das Osterfrühstück mochten, die Fastenzeit dazwischen aber lieber übersprangen. Er selbst ließ ja auch kaum ein Fest aus.
»Geld ist nur die eine Seite«, sagte Father Greg gerade, als ich zu ihm trat. »Wisst ihr, was wirklich schwere Arbeit ist? Liebe. Liebe ist schwere Arbeit, vielleicht die allerschwerste, aber genau das zählt letzten Endes. Darum geht es bei unserer Arbeit mit diesen Kindern. Lehre, einen Mann zu fischen? Ha.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Lehre, einen Mann zu lieben, Richard. Lehre, ein Kind zu lieben, das Lernen zu lieben, andere zu lieben. Und dann schau, was passiert.« Father Greg legte mir eine Hand auf die Schulter. »Stimmt’s, Aidan?«
»Ja, ja, die Kinder«, sagte Richard mit einem gezwungenen Lächeln. »An die denke ich immer, wenn ich meinen alljährlichen Scheck ausstelle.« Dann schoss er sich auf mich ein. »Ich habe dieses Jahr noch gar keinen Spendenanruf bekommen, Aidan, legst du bald los damit? Father, Sie haben doch vor, Aidan diese Aufgabe zu übertragen?«
Father Greg lächelte mich an. »Oh, das wäre nicht das Schlechteste. Aidan ist ja schon ein junger Mann. Wie sollte ich ohne ihn auskommen?« Er streckte mir die Hand entgegen, und ich klatschte ihn automatisch ab, als wären wir Mannschaftskollegen auf dem Platz. »Aidan ist jemand, der weiß, dass man Kohle für das Feuer braucht, damit der Zug weiterläuft.«
Ich nickte zustimmend. Ich half ihm tatsächlich dabei, Spenden für katholische Schulen in der Stadt zu sammeln. Es war ein bisschen übertrieben, meine Excel-Tabellen und Aufstellungen als »Kohle für das Feuer« zu bezeichnen, aber auch wenn ich nur Kuverts öffnete und Spendenbeträge in eine Datenbank eingab, leistete ich einen Beitrag.
»Ich habe den Gastgeber noch gar nicht begrüßt«, sagte Father Greg.
»Mutter muss hier irgendwo sein«, sagte ich und sah in Richtung Bibliothek.
Father Greg lachte. »Nein, ich meinte dich.«
»Oh«, sagte ich. »Ja.«
Er entschuldigte uns bei der Runde und führte mich ein paar Schritte weg, in Richtung Garderobe. Es tat gut, ein bisschen Führung zu spüren. Er lächelte, dann wurde seine Miene ernst, wie immer, wenn er nach den richtigen Worten suchte, um die Welt wieder ins Lot zu bringen.
»Wie geht es dir denn?«
Das war verdammt noch mal die erste ehrliche Frage, die mir an diesem Abend gestellt wurde. Ich wollte irgendwo sein, wo es ruhiger war. Ich wollte irgendwo sein, wo wir einander ernst nahmen, wo wir die Tür hinter all dem dummen Geschwätz schließen und wie zwei Leute miteinander sprechen konnten, denen wichtige Dinge am Herzen lagen. Es war höchste Zeit.
»Also«, sagte Father Greg, »ich wollte gerade rausgehen. Ich brauche eine Pause und ein bisschen frische Luft.« Er angelte seine Garderobenmarke heraus und gab sie dem Mann an der Tür. »Komm doch kurz mit.« Er nahm seinen Mantel und legte ihn sich wie einen Umhang um. Dann zog er aus den Tiefen seiner Brusttasche eine Zigarette. »Komm mit. Natürlich nur, wenn du möchtest.« Mit wehendem Mantel trat er auf die Veranda. Ich schnappte mir meinen Skianorak und folgte ihm.
Er stand an der Kurve der halbkreisförmigen, weiß gekiesten Auffahrt und blickte über den leicht abfallenden, verschneiten Vorgarten. »Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass du Spaß an deiner Party hast.«
Ich sah zu, wie meine weiße Atemwolke sich in der kalten Luft auflöste. »Das ist eigentlich nicht meine Party«, sagte ich. Ich zog den Reißverschluss meines Anoraks zu. »Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt hier soll.«
Father Greg trat zu mir und stellte einen Fuß auf die Veranda. Er atmete aus dem Mundwinkel aus, um mir den Rauch nicht ins Gesicht zu blasen. »Doch, das hast du. Du tust, was du immer tust. Du versuchst zu helfen. Geißle dich nicht selbst, Aidan.« Er nannte mich ziemlich oft beim Vornamen, was ich zu Anfang komisch fand, aber inzwischen gefiel es mir. Es gab mir das Gefühl, real zu sein, als wollte er ganz bewusst mit mir sprechen, als bedeutete ich ihm wirklich etwas – als würde auch er mich ein bisschen brauchen.
Ich starrte auf die Grüninsel in der Auffahrt mit der akkurat zurechtgestutzten Hecke. Er bot mir seine Zigarette an, und ich wandte den Blick ab, als ich daran zog. Das Nikotin stieg mir zu Kopf, und ich lehnte mich an die Säule. »Ich wäre lieber oben und würde die Schullektüre lesen«, sagte ich schließlich.
»Guter Junge, immer fleißig bei der Arbeit.« Ich zuckte die Schultern. »Aber ich verstehe dich. Ich weiß, was in dir vorgeht.« Er ließ mich noch einmal ziehen. »Wir haben uns schon einmal darüber unterhalten«, sagte er leise. »Es ist nicht leicht, auf solchen Partys bedeutsame Gespräche zu führen. Gespräche, wie Menschen wie du und ich es gewöhnt sind. Die meisten Gäste hier bekomme ich nur noch auf Festen zu Gesicht. Auch deine Eltern kenne ich doch vor allem, weil sie mich zu ihren Gesellschaften einladen.«
»Ja, und dann ist einer von beiden noch nicht mal da.«
»Ganz genau«, sagte Father Greg und nickte langsam, wie er es immer tat, wenn er mir zuhörte. Er drehte den Filter seiner Zigarette behutsam zwischen Daumen und Zeigefinger, bis der Tabakstummel auf den Boden fiel. Dann steckte er den Filter ein und sah zur Haustür. »Aber du bist nicht allein«, sagte er. Father Greg erklärte mir oft, dass die Präsenz Gottes in meinem Leben Sicherheit bedeute, echte Stabilität. Gott sei bei mir, und doch müsse Gott oft durch Menschen wie ihn wirken, hatte er gesagt, um mich an seine Präsenz zu erinnern. Gott war in meinem Bewusstsein nicht fest verankert, aber Father Greg war tatsächlich da, und am dringendsten brauchte ich etwas Greifbares und Konkretes. Gewissheit.