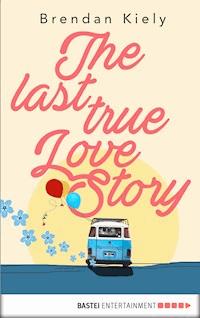
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Liebe findet jeden
THE LAST TRUE LOVESTORY ist eine gefühlvoll erzählte Geschichte, in der es neben der Bedeutung von Familie vor allem darum geht, sich zu verlieben. Am meisten berührten mich die besonderen, die leisen Momente, die gleichzeitig ein ganzes Leben verändern können. (Ava Dellaira, Autorin von LOVE LETTERS TO THE DEAD)
Der 17-jährige Teddy hat ein besonders enges Verhältnis zu seinem Großvater. Und so kann er ihm den Wunsch nicht abschlagen, ihn nach New York zu begleiten, um ein letztes Mal die Kirche zu betreten, in der er seiner bereits verstorbenen Frau das Jawort gegeben hat. Nur wie sollen die beiden von Los Angeles dorthin kommen? Da kommt Teddy Corrina in den Sinn. Das gleichaltrige Mädchen, eine Straßenmusikerin, besitzt einen Führerschein, nur hatte Teddy bisher nicht den Mut, seiner heimlichen Schwärmerei Taten folgen zu lassen. Jetzt ist seine Chance. Kurze Zeit später befindet sich das ungleiche Trio tatsächlich auf dem Weg, und während der Großvater von seiner vergangenen großen Liebe erzählt, funkt es auch zwischen Teddy und Corrina ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Die Liebe findet jeden THE LAST TRUE LOVESTORY ist eine gefühlvoll erzählte Geschichte, in der es neben der Bedeutung von Familie vor allem darum geht, sich zu verlieben. Am meisten berührten mich die besonderen, die leisen Momente, die gleichzeitig ein ganzes Leben verändern können. (Ava Dellaira, Autorin von LOVE LETTERS TO THE DEAD) Der 17-jährige Teddy hat ein besonders enges Verhältnis zu seinem Großvater. Und so kann er ihm den Wunsch nicht abschlagen, ihn nach New York zu begleiten, um ein letztes Mal die Kirche zu betreten, in der er seiner bereits verstorbenen Frau das Jawort gegeben hat. Nur wie sollen die beiden von Los Angeles dorthin kommen? Da kommt Teddy Corrina in den Sinn. Das gleichaltrige Mädchen, eine Straßenmusikerin, besitzt einen Führerschein, nur hatte Teddy bisher nicht den Mut, seiner heimlichen Schwärmerei Taten folgen zu lassen. Jetzt ist seine Chance. Kurze Zeit später befindet sich das ungleiche Trio tatsächlich auf dem Weg, und während der Großvater von seiner vergangenen großen Liebe erzählt, funkt es auch zwischen Teddy und Corrina …
Über den Autor
Brendan Kiely hat Creative Writing studiert und seine Arbeiten in den unterschiedlichsten Magazinen veröffentlicht. Inzwischen unterrichtet er an einer Schule in New York, wo er mit seiner Frau auch lebt. Aidan – Sünde. Lüge. Liebe. Mut ist sein erster Roman, ein weiterer ist in Arbeit.
Brendan Kiely
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Last True Love Story«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Brendan Kiely
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Andrea Euerle, Köln
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/Pablo Logat; shutterstock/Tatsiana Tyshanova; shutterstock/YanaDesign
E-Book-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4833-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Grandma und Jessie, die mich lehren, ein hörendes Herz zu haben
Dass Liebe alles ist,ist, was man von ihr weiß.
Emily Dickinson
So weise, wie du wurdest, und in solchem Maß erfahren,wirst du ohnedies verstanden haben, was die Ithakas bedeuten.
Konstantinos Kavafis
Prolog
Der Stand der Dinge: Wir haben uns irgendwo westlich von Albuquerque in der Wüsteverirrt, und das Auto, das wir gestohlen haben, hat einen Platten und steckt mit der Schnauze im Sand fest. Wir, das sind Grandpa, Corrina und ich. Mit jedem Tag, der verstreicht, verliert mein Großvater mehr den Bezug zur Realität, und wenn ich ihn nicht gut im Auge behalte, könnte es sein, dass er in den Sand hinauswandert und für immer verschwindet. Corrina ist von dannen gestapft, so sauer, dass sie kein Wort mehr mit mir wechselt, und ich bezweifle, dass sie überhaupt noch Lust auf diesen Trip quer durch das Land hat. Aber ich habe ihr versprochen, dass ich sie hinbringe. Grandpa habe ich dasselbe versprochen – dafür zu sorgen, dass er diese Kirche noch einmal sieht, bevor die Krankheit sie aus seinem Gedächtnis löscht und all seine Erinnerungen an Grandma verschwunden sind. Alles, was ich will, ist, diese unerfüllbaren Versprechen zu halten, aber Mom, Corrinas Eltern, Grandpas Ärztin, die Polizei und der Rest der verdammten Welt sind auf der Suche nach uns, und vor uns liegen immer noch über dreitausendzweihundert Kilometer, und dafür bleiben uns nur drei Tage Zeit.
Eigentlich müsste es sich anfühlen, als wäre hier Endstation, aber das lasse ich nicht zu. Weil es nicht sein darf. Es darf nicht das Ende sein, nicht für Grandpa, nicht für Corrina und nicht für mich. Denn erst hier auf der Straße mitten im Nirgendwo habe ich endlich begriffen, was mein Großvater meint, wenn er sagt, der Sinn des Lebens bestehe darin zu lernen, wie man liebt.
Teil I
Wie wir hierhergekommen sind
Kapitel 1
Das unerfüllbare Versprechen
Am Tag, bevor wir aus der Stadt abhauten, um über die breiten, windgepeitschten Straßen Amerikas zu düsen, stand ich drei Stockwerke unter Grandpas Apartment, starrte über den Strand hinweg auf das Wasser und drückte dabei ein frisch gerahmtes Foto zweier Toter an mich.
Die betreute Wohnanlage Calypso Sunrise Suites lag wie hingeplumpst auf halber Strecke zwischen dem Santa Monica Pier und der Strandpromenade von Venice Beach. Wenn gerade niemand vorbeifuhr und ich an den gebogenen Palmen und dem Streifen Strand vorbei auf die unendliche Weite des Pazifiks blickte, hätte es scheinen können, als wäre ich am Ufer einer Insel gestrandet, verschollen und vergessen im Meer.
Zumindest fühlte ich mich so, während ich dastand und meine ganze Kraft zusammennahm, um das Foto wieder zu Grandpa zurückzubringen. In der Woche zuvor hatte er bei einem seiner Anfälle das Glas und den Rahmen zerbrochen, und ich konnte zwar das Foto retten, ohne es zu knicken oder zu zerreißen, hatte mir dabei jedoch an den Scherben die Handfläche und die Finger aufgeschnitten. Aber wenigstens war das Foto unversehrt. Darauf stand Grandma, das Haar zu einer Sechzigerjahre-Bienenkorbfrisur hochtoupiert, vor ihrem alten holzverkleideten Kombi und hielt die Babyversion meines Dads in einem Bündel auf dem Arm. Grandpa hatte es nicht absichtlich kaputt gemacht, es war nämlich sein Lieblingsfoto von ihr. Er hatte es in einem Wutanfall zusammen mit allem anderen von seinem Schreibtisch gefegt, und es war am Fuß seiner Stehlampe zersprungen. Ich hatte eine halbe Stunde damit zugebracht, den Bereich um seinen Schreibtisch herum sorgfältig zu saugen.
Meine Hand tat immer noch weh, vor allem, weil ich Bumsers Leine zweimal drumherumgeschlungen hatte. Er trieb es gerade mit dem Bein einer der Bänke an der Promenade, was mich jedoch nicht störte. Er sollte sich ruhig abreagieren, bevor wir ins Calypso gingen. Dort waren Haustiere zwar willkommen, aber nur, wenn sie nicht einen der Bewohner, Gäste oder Mitarbeiter besprangen. Für einen American-Staffordshire-Terrier war Bumser eher klein, und mit dem Anblick seiner Zunge, die ihm so dämlich über die Zähne aus dem Maul hing, hätte das Kerlchen eine Leiche zum Lächeln gebracht. Schließlich wurde er müde und gähnte, um es mich wissen zu lassen, und so führte ich ihn um die Ecke zum Parkplatz und die Treppe zum Haupteingang hinauf.
Obwohl die Bewohner des Calypso nicht sonderlich betucht waren, umfasste die Anlage ein großzügiges, sich über einen ganzen Wohnblock erstreckendes dreistöckiges Gebäude mit Gemeinschaftsräumen, einem Bistro, einer Kunstwerkstatt, einer Gemeinschaftsterrasse und einem großen Garten, der einen baumumstandenen Springbrunnen beherbergte. Dort traf ich mich oft mit Grandpa und hörte mir seine Geschichten an oder las ihm Gedichte vor.
Ich kannte die meisten der freundlichen, mit blauen Poloshirts bekleideten Mitarbeiter und winkte den Leuten am Empfang zu, während Bumser und ich die Lobby durchquerten. Zuerst sah ich im Garten nach – wo Grandpa nicht war – und ging dann zurück zum Aufzug, um zu seinem Apartment hochzufahren. Ich klopfte. Niemand antwortete, deshalb öffnete ich die Tür und steckte den Kopf durch den Spalt.
»Verdammt«, sagte ich. Grandpa hatte wieder einen schlechten Tag.
Das Zimmer war verwüstet. Das Bett stand schief, die Laken waren am Fußende zerknittert wie gefrorene Wellen, und seine Kleider lagen überall auf dem Boden verstreut. Er hatte die Schubladen der Kommode komplett herausgezogen, ausgeleert und Richtung Badezimmertür geworfen. Auch im Badezimmer herrschte Chaos. Die Türen des Schränkchens unter dem Waschbecken standen offen, und Grandpas Pillenfläschchen, das Shampoo, die Zahnpasta und das Deo lagen in der Badewanne.
Derjenige, der all das angerichtet hatte, war nicht der echte Grandpa. Es war der Mann, der Besitz von ihm ergriff, wenn er einen Anfall hatte – der Mann mit den sturmumwölkten Augen. Ein Mann, den ich nicht wiedererkannte. Und manchmal, wenn es ganz schlimm war, wenn er mich mit wütend gerunzelten Brauen ansah, hatte ich Angst, er könnte mich ebenfalls nicht wiedererkennen. Dabei war es mies von mir zu behaupten, derjenige, der dort am Fenster seines Zimmers stand, sei nicht er, sondern jemand anders. Es war nicht fair, das zu behaupten. Denn es war Grandpa. Daran musste ich mich gewöhnen, und ich musste herausfinden, wie ich ihm helfen konnte.
Er empfing mich in seinem üblichen Outfit, der grauen Hose und dem zweifarbigen, kurzärmeligen Leinenhemd. Und er trug Schuhe, was ein gutes Zeichen war, denn es bedeutete, dass er an diesem Tag das Zimmer schon mal verlassen hatte. Er starrte aus dem Fenster, über die Promenade und den Sand hinweg auf den Pazifik.
»Grandpa«, sagte ich auf seinen Rücken zu. »Grandpa, ich bin’s, Teddy.«
Ich ließ Bumsers Leine los, und er flitzte hinüber zu Grandpa und schnüffelte an seinem Bein. Dann kam er zu mir zurück, als wollte er von mir wissen, was zu tun sei, und ich wünschte, ich wüsste das selbst.
Während ich quer durch das Zimmer zu Grandpa ging, wiederholte ich noch einmal meinen Namen. Er wandte mir beharrlich den Rücken zu, und weil ich vermeiden wollte, dass er unvermittelt auf mich einschlug, was durchaus geschehen konnte, berührte ich ihn nicht. Ich trat an seine Seite und lehnte mich an die Wand. Im Licht der Spätnachmittagssonne glitzerten die Tränen auf seinen Wangen golden. »Grandpa«, sagte ich noch einmal.
Jemand klopfte an die Tür. Bevor ich etwas sagen konnte, wurde sie geöffnet, und zwei Angehörige der Calypso-Poloshirt-Brigade standen im Türrahmen, Julio und Frank, zwei massige Muskelprotze. Sie erinnerten mich an die Footballspieler an meiner Schule, die beim Gehen die Brust blähten und die Arme ungefähr eine Schuhlänge vom Körper entfernt hielten, als müssten sie ständig ihre Achselhöhlen belüften. Julio und Frank tauchten immer dann auf, wenn in einem der Bewohnerzimmer Alarmstufe Rot herrschte oder wenn sich während einer der organisierten Aktivitäten oder einer Mahlzeit jemand im Bistro oder in der Lobby verirrte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Julio und trat ins Zimmer, obwohl er genau wusste, dass dem nicht so war. »Brauchen wir Dr. Hannaway?«
»Nein«, antwortete ich.
Grandpa atmete ruhig ein und aus und wischte sich die Tränen von den Wangen. Daran erkannte ich, dass er sich bereits beruhigt hatte und seine Wut abgeflaut war. Er war still, weil er Angst hatte. Sein Blick schoss zwischen mir und dem Fenster hin und her. Er wusste wahrscheinlich nicht, warum er das Zimmer zerlegt hatte. Möglicherweise erinnerte er sich nicht einmal daran, dass er es gewesen war. Bumser schmiegte sich an Grandpas Schienbein, und Grandpa beugte sich hinunter, um ihn zu kraulen.
»Ich hab das im Griff«, sagte ich zu den beiden Riesen.
»Das bezweifle ich«, entgegnete Frank. Seine Glatze glänzte, als er sich unter dem Türrahmen duckte und ins Zimmer trat. »Charlie?«, sprach er Grandpa an.
Ich trat vor sie. »Ernsthaft.« Ich hob meine Hand. »Ich hab das im Griff. Wirklich.«
Julio runzelte die Stirn. Er nickte zum Schreibtisch, wo alle Schubladen offen standen und die Stifte, das Papier und die Zeitschriften auf dem Teppich darum herum verteilt waren. »Komm schon, Teddy«, sagte er. »Wir sind Profis.«
»Und ich gehöre zur Familie«, konterte ich. Tatsächlich war Grandpa so ziemlich alles, was ich an Familie besaß. Da gab es natürlich Mom, aber sie war normalerweise auf irgendeiner Geschäftsreise, immer am Arbeiten – diese Woche in Shanghai –, und Grandpa sah ich öfter als sie, obwohl er nicht mehr bei uns wohnte. Mom hatte ihn in den sieben Monaten, seitdem sie ihn ins Calypso gesteckt hatte, vielleicht zweimal besucht.
Es gab also nur Grandpa und mich und Bumser. Dad war nämlich auch weg, und zwar schon so lange, dass wir nie über ihn redeten. Mein Dad: tot.
»Ich weiß, Kumpel«, sagte Julio. »Aber manchmal musst du diese Dinge uns überlassen. Du schaffst das nicht ganz allein.«
Ich war nicht Julios Kumpel. Ich war auch keine beschissenen zwölf mehr, obwohl er mit mir redete, als wäre ich auf einem Klassenausflug in der Mittelstufe und nicht ein Siebzehnjähriger, der nichts anderes versuchte, als seine Familie zusammenzuhalten – oder zumindest das, was davon noch übrig war –, während es den Rest der Welt keinen Scheiß interessierte, ob sich die Familie Hendrix einfach so auflöste wie eine von Grandpas Erinnerungen: puff, als hätte es uns nie gegeben.
»Grandpa«, sagte ich noch einmal. Ich trat von der Seite auf ihn zu, um ihn nicht zu überraschen oder zu erschrecken. »Grandpa, ich bin’s. Teddy. Wir haben einen Job zu erledigen.«
Teddy, wir haben einen Job zu erledigen. Das hatte er, als ich heranwuchs, mindestens eine Million Mal zu mir gesagt. Mom war immer bei der Arbeit. Da waren nur ich und Grandpa. Teddy, wir haben einen Job zu erledigen. Wenn wir den Küchenboden putzten. Teddy, wir haben einen Job zu erledigen. Wenn wir meinen Schulaufsatz fertig schrieben. Teddy, wir haben einen Job zu erledigen. Wenn wir hinüber in die Suppenküche von St. Christopher’s gingen, um für Obdachlose zu kochen, die dort strandeten wie Treibholz auf dem Sand.
Grandpa drehte sich vom Fenster um, und da wusste ich, dass er wieder Grandpa war. Der alte Kriegsheld, der Zuchtmeister – er zog einen Mundwinkel nach oben, ein halbes Lächeln, das bei ihm so viel galt wie bei anderen Menschen ein ganzes Lächeln. Die Wolken, die seine Augen verschattet hatten, waren vorübergezogen.
»Wonach suchen wir eigentlich?«, fragte ich ihn und riskierte damit, den Frieden des Augenblicks zu stören. Julio und Frank blieben skeptisch in Lauerstellung, als warteten sie nur darauf, dass Grandpa zum Schlag ausholte, um dann rufen zu können: Siehst du? Ich hab’s dir ja gesagt!
»Dieses Foto«, entgegnete Grandpa. »Das, auf dem deine Großmutter vor unserem Kombi steht.«
»Natürlich«, sagte ich, bemüht, so ruhig wie möglich zu bleiben. »Unser Lieblingsfoto.«
Grandpa nickte mir zu, immer noch mit seinem halben Lächeln. »Ja, genau. Unser Lieblingsfoto.«
»Also?«, sagte ich zu Julio und Frank. »Lasst ihr uns allein?«
Zunächst zögerten sie, aber Grandpa versicherte ihnen, dass es ihm gut gehe, und ich ebenfalls, und während ich anfing, die Kleider aufzusammeln, machte Grandpa das Bett. Bumser lief auf und ab und zog damit eine Linie zwischen den Riesen und uns. Schließlich verkrümelten sie sich, und mir kam in den Sinn, dass sich die Situation umgekehrt hatte und ich nun Grandpa half, als wäre er mein Kind, so wie er mir geholfen hatte, als er zu uns gezogen war, um die von meinem toten Dad hinterlassene Lücke zu füllen.
Dennoch fühlte ich mich auch wie ein verdammtes Kind, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Während ich die Schubladen wieder in die Kommode steckte und die Kleider aufräumte, war ich unschlüssig, ob ich Grandpa sagen sollte, dass ich das Foto hatte. Ich konnte einfach so tun, als hätte ich es unter dem Bett gefunden, oder ihm sagen, dass er es letzte Woche zerbrochen und ich ihm versprochen hatte, es zu reparieren. Das hatte ich ja auch getan, wenn auch nicht schnell genug. Mit anderen Worten: Ich konnte ihm die Wahrheit sagen, aber »Wahrheit« ist ein verflucht trügerisches Wort, wenn der eigene Großvater an Alzheimer stirbt.
Grandpa war mit dem Bett fertig, hatte die Laken glatt und straff gezogen und die Ecken so sorgfältig unter die Matratze gesteckt, wie es nur ein Marineinfanterist hinbekam. Nun trat er zurück ans Fenster. »Ich sehe sie immer noch vor mir, wie sie damals aussah«, sagte er, während er hinausblickte. »Die dünnen Silberarmreifen, die Blümchenbluse, ihre Haarfarbe. Ich kann sie auch noch hören. Ihr Lachen. Die Art, wie sie meinen Namen sagte.« Er ballte die Faust und schüttelte sie, als würde er den Pazifik weit hinter dem Strand verfluchen. »Diese gottverdammte Krankheit. Sie wird sie mir noch einmal wegnehmen.«
Ich schnappte mir die Tasche, die neben der Tür stand, und ging zu ihm ans Fenster. Obwohl ich Grandpa überragte, fühlte ich mich schrecklich klein und dumm mit der Tasche, die Grandmas Foto enthielt, als könnte ein Foto jemals einen Menschen ersetzen. Als ich meinen Arm um Grandpa legte und seinem Blick hinaus aufs Wasser folgte, fragte ich mich, ob es Liebe war, die uns dazu brachte, das Unmögliche zu versuchen. Wie bei Grandpa, der sich an jede nur mögliche Erinnerung an Grandma klammerte, obwohl die Krankheit sie ihm rapide entriss.
»Grandpa«, sagte ich, zog das Foto aus der Tasche und reichte es ihm. »Ich habe es.«
Er nahm es behutsam in die Hände, und als zöge ihn das Foto weg vom Fenster, hielt er es vor sich, während er zu seinem Bett ging und sich auf die Kante setzte. Hätte ich es ihm doch nur früher zurückgebracht, dachte ich, dann hätte ich ihn davor bewahren können, den Raum zu verwüsten wie ein Pirat, der plündert, was ihm eigentlich schon gehört.
Hatte ich aber nicht. Ich war verdammt noch mal zu langsam gewesen. Ich hatte zu lange gebraucht, und Zeit zu verschwenden war für Grandpa ein Luxus, den er sich nicht leisten konnte. Laut Dr. Hannaway hatte er das mittlere Stadium von Alzheimer erreicht, konnte jedoch immer noch mit seiner Umwelt interagieren. Und das sollte er auch tun. Die Ärztin sagte mir, er müsse öfter sein Zimmer verlassen und unter Menschen gehen. Ich bemühte mich, ihn dazu zu bringen, aber die Aktivitäten, die im Calypso angeboten wurden, interessierten ihn nicht.
Grandpa sah zu mir hoch. Er klopfte auf den Platz neben sich, und ich gesellte mich zu ihm. Bumser folgte mir und quetschte sich zwischen Grandpas Beine. Grandpa streichelte Bumsers Kopf, dann drückte er ihn sanft mit den Knien. Er legte den Arm um mich, wie um mich aufzumuntern, aber seine mandelförmigen Augenlider wirkten schwerer und trauriger als gewöhnlich. »Ich will nach Hause, Teddy.«
»Ich weiß«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Ich möchte auch, dass du nach Hause kommst. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Aber Mom sagt, du bist zu krank. Sie sagt, das geht nicht.«
»Ich bin ja auch krank.«
»Nein, bist du nicht.« Meine Stimme brach.
»Doch, Teddy. Es ist schrecklich. Ich weiß es. Ständig verschussele ich Dinge. Wie dieses Foto. Wie konnte ich es verlieren?«
Er verstummte. Ich schluckte den riesigen Softball in meinem Hals hinunter. »Du hast das Foto nicht verschusselt«, teilte ich ihm mit.
Er kniff die Augen zusammen, sagte jedoch nichts.
»Ich war letzte Woche hier. Der Rahmen …« Ich zögerte. »Na ja, er war zerbrochen, und deshalb habe ich ihn in die Werkstatt zur Reparatur gebracht.«
Er zog den Arm weg von mir, holte tief Luft und griff dann nach meiner Hand. »Teddy. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich den Rahmen zerbrochen habe.«
»Das macht doch nichts.«
»Doch.«
»Nein«, log ich. Und verschwieg ihm, dass er wieder einmal einen schlechten Tag gehabt hatte. Dass ich alles aufräumen und ihn beruhigen musste, um Julio und Frank nicht auf den Plan zu rufen.
»Komm schon«, fuhr ich fort. Ich erwiderte den Druck seiner Hand. »Mach dir keine Sorgen deswegen. Das ist gar nicht schlimm.«
»Nein. Nein, es ist nicht gar nicht schlimm«, widersprach er. »Ich habe das unangenehme Gefühl, dass mich die Leute ansehen, als hätten sie gerade mit mir geredet, mir gerade eine Frage gestellt, und ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß nicht einmal, was sie gefragt haben.« Sein Gesicht war rot. »Ich möchte nicht alles verlieren. Deshalb möchte ich nach Hause.«
»Ich kann dich nicht nach Hause holen, Grandpa. Mom würde es nicht erlauben.«
»Nicht mein Zuhause hier«, sagte er leise. »Nicht zu euch nach Hause. Zu mir. Ich möchte wieder in mein Haus in Ithaca, wo all meine Erinnerungen sind. Dort möchte ich hin, bevor sie alle verschwunden sind.«
Ich streichelte seinen Rücken, aber er sah mich an, und seine Miene wurde weich. »Lass nicht zu, dass ich sie vergesse. Bitte.« Ich war nicht sicher, ob er mit mir sprach oder nur laut dachte; sein Blick war glasig und abwesend. »Was würde ich dafür geben, wieder mit ihr zusammen die Mulberry Road entlangzugehen und die Treppe von St. Helen’s hinaufzusteigen wie bei unserer Hochzeit. Bitte lass nicht zu, dass ich sie vergesse. Nicht sie.«
Ich umarmte ihn und versicherte ihm, dass ich das nicht tun würde. »Ich bin bei dir, Grandpa. Ich, Teddy. Ich bin hier bei dir und werde es nicht zulassen.« Das sagte ich immer und immer wieder und drückte ihn an mich, während wir uns auf seiner Bettkante sanft wiegten.
Er atmete durch und straffte die Schultern, und ich merkte, dass er in diesem Moment ganz da war. Er packte meinen Arm und hielt mich fest. Dieselben blauen Augen wie meine starrten mich durchdringend an. »Es ist mir schnurzegal, was passiert oder was dafür nötig ist. Lass einfach nicht zu, dass ich sie vergesse, Teddy.«
»Werde ich nicht.«
»Versprich es mir.« Er umklammerte mich noch fester, und ich wusste, was ein Versprechen für Grandpa bedeutete.
»Ich verspreche es.«
»Ein Mann, ein Wort, Teddy.«
»Ich weiß. Ich verspreche es«, versicherte ich ihm. Dabei sagte mir der Kloß in meinem Hals, dass es eine Lüge war, obwohl ich gern daran geglaubt hätte. Es war das dritte Mal, dass er mich gebeten hatte, das dritte Mal, dass ich es versprochen hatte, und ich hatte wirklich keine Ahnung, ob ihm das klar war oder nicht. Nach dem letzten Mal war mir nur eine Lösung eingefallen, ich nannte sie das Hendrix-Familienbuch. Ich hatte angefangen, mir Notizen zu machen, alles aufzuschreiben, was Grandpa erzählte und noch im Gedächtnis hatte. Ich wollte alles niederschreiben, von Anfang bis Ende, all die kleinen Begebenheiten, die zusammengefügt die große Geschichte ergaben – vor allem sein Leben mit Grandma, der Teil, der ihm am wichtigsten war. Das HFB war alles, was mir einfiel, um sie für ihn zu bewahren.
Sein Lebensanker lag unter der Erde, doch nun, da sich sein Verstand losgelöst hatte, trieb er immer weiter von ihr fort.
Grandpa, der alte Kriegsheld, hatte Vietnam überlebt, den langen Heimweg nach dem Krieg, die negative Reaktion in der Heimat, die er nicht verstehen konnte, den Tod meines Dads, seines Sohns, und den Tod seiner Frau. Und nun welkte er in diesem Zimmer am Ufer des Ozeans vor sich hin, versteckte sich vor der Welt hinter einem Schleier aus Tränen und verlor den Kampf gegen Alzheimer.
»Die Krankheit mag mich umbringen, Teddy, aber lass nicht zu, dass ich sie vergesse.«
Kapitel 2
Corrinas Lied
Als Bumser und ich die Calypso Sunrise Suites verließen, ging die Sonne bereits unter, und wir liefen die Strandpromenade entlang Richtung Heimat, vorbei am Skatepark und durch die Menschenansammlungen, die sich im Halbkreis um Straßenmusiker und Kunsthändler drängten. Gerade hatten wir den Outdoor-Fitnessbereich am Muscle Beach mit seinem Geächze und klirrenden Metall hinter uns gelassen, da sah ich Corrina vor einer Baumgruppe stehen. Der Strand überzog sich mit einem rosigen Gold, und die Stämme der Palmen zeichneten sich schwarz vor dem orangefarbenen Himmel ab, als ich mich unter einen der Bäume setzte, um ihr zuzuhören.
Sie hielt eine dieser akustischen Gitarren im Arm, die man auch einstöpseln kann, und hatte einen Fuß auf ihren Verstärker gestellt. Das Haar hing ihr ins Gesicht, während sie eine langsame, verschlungene, bluesartige Melodie spielte. Egal, bei welchem Lied, sie versank immer vollkommen darin, überließ sich ganz der Musik. Es war nicht aufgesetzt, keine gefakte dämonische Ekstase, die einem sowieso keiner abkaufte, sondern es war, als würde sie mit der Musik eins werden, als würde etwas in ihr in perfektem Einklang mit jeder Note schwingen. Ihre Stimme war beim Singen warm und satt wie das Sonnenlicht, das hinter ihr mit dem Meer verschmolz.
Als das Lied zu Ende war, klatschten die Leute, und manche warfen Münzen und Scheine in ihren Gitarrenkoffer. Sie bedankte sich bei ihrem Publikum, das sich bereits zerstreute. Es war heiß, und das Haar hing ihr in verschwitzten Strähnen herunter. Sie wischte sich die Stirn ab und schob sich die Sonnenbrille als Stirnreif ins Haar. Ich konnte nicht verstehen, wie sie es bei dieser Hitze in schwarzen Jeans und Stiefeln aushielt, dazu ein weites Karohemd, dessen Zipfel sie am Nabel verknotet hatte. Trotzdem wirkte sie, abgesehen von dem Schweiß auf der Stirn, irgendwie frisch.
Ich kannte sie aus der Schule. Wir gingen auf dieselbe riesige Highschool oben am Hügel und waren gleich alt, sie hatte allerdings gerade ihren Abschluss gemacht. Im Frühjahr hatten wir beide als Wahlfach den Lyrikkurs belegt, aber obwohl mir viele ihrer Gedichte noch sehr deutlich im Gedächtnis waren – persönliche Gedichte über ihre Adoption in Guatemala durch ein weißes Paar aus L.A. –, waren wir keine Freunde. Wir waren einfach nur zwei Menschen, die einander in einem Meer aus Tausenden wiedererkannten. Ich wusste also kaum etwas über sie, nur dass ich sie gerne singen hörte. Und wenn du in die elfte Klasse der Highschool gehst und sich dein Leben anfühlt wie ein Strudel, der dich immer weiter runterzieht, und alles, was du zu kennen glaubst, auseinanderbricht und mit dir versinkt, sind diese kleinen Augenblicke der Schönheit die Luftblasen, die dich in dem ganzen Schlamassel über Wasser halten.
Sie hatte den ganzen Sommer über an der Strandpromenade Straßenmusik gemacht, und da mein Heimweg vom Calypso dort vorbeiführte, machte ich oft Halt und hörte ihr zu, ergänzte und ordnete dabei meine Notizen im HFB oder ließ meine Gedanken schweifen, während ich Gedichtzeilen kritzelte. Für gewöhnlich nickten wir uns dann zur Begrüßung zu oder wechselten sogar ein paar Worte, wobei ich in der Regel wartete, bis sie die Initiative ergriff. Aber an jenem Tag dachte ich: Ach, was soll’s. Nur Mut. Ich sprach sie an.
»Die letzten Riffs hast du heute extra fies rausgehauen«, sagte ich in der Hoffnung, den richtigen Jargon getroffen zu haben.
Sie sah mich an und hob die Augenbrauen. »Hendrix«, entgegnete sie. »Ich lach mich tot, Mann.« Alle nannten mich Teddy oder Ted, nur Corrina nicht. Für Corrina war ich Hendrix. Das gefiel mir.
»Egal. Es war cool.«
»Ja, ich hab in letzter Zeit ziemlich viel Orianthi gehört.«
»Wen?«
»Ja, genau. Wenn sie ein Kerl wäre, würde sie jeder kennen.« Sie wischte sich den Schweiß von der Oberlippe. »Musst du dir mal reinziehen. Die ist echt der Hammer.« Sie sah sich um. Die Leute waren gegangen, und wir waren allein. »Aber ich habe auch selbst an was Neuem gearbeitet«, sagte sie. »Willst du mal hören?«
Ich nickte. Sie schleppte den Verstärker näher zu einem Baum und stellte ihn leiser. Das kupferfarbene Tattoo um ihr Handgelenk schimmerte in der untergehenden Sonne, als sie ihre Hände und Finger lockerte, die Augen schloss und zu spielen begann.
Die Nacht senkte sich über die Promenade, und ein leichter Rausch erfasste die Menschen, die noch unterwegs waren. Die Gruppen von Trommlern am Strand spielten lauter und wilder, und es blieben weniger Leute bei Corrina stehen, um ihr zuzuhören. Haschischwolken waberten vom Strand herüber. Corrina wetteiferte mit dem Stimmengewirr, das inzwischen das Aufschlagen und Rollen der Boards und Räder im Skatepark abgelöst hatte.
Als sie ein neues Lied anstimmte, schlenderte eine Gruppe Jugendlicher aus der Schule, von denen die meisten wie Corrina gerade ihren Abschluss gemacht hatten, auf sie zu. Sie zogen als ultracoole Clique durch die Gegend und versuchten, mit ihren Tausend-Dollar-Outfits wie verlotterte, erschöpfte Partymenschen auszusehen – wie sonnentrunkene Neo-Hippies oder übermüdete Hardrocker mit Ringen unter den Augen, die wirkten, als würden sie die Nacht zum Tag machen. Mit diesen Leuten hatte ich Corrina auf den Fluren oder auf der Treppe vor der Schule gesehen. Kids, die in die Autos ihrer Freunde sprangen und zu Partys düsten, wie ich sie nur aus Kinofilmen kannte. Auf der Promenade hätten sie leicht einen großen Bogen um Corrina machen können, aber sobald der Anführer der Meute, Shawn Doggin, Corrina erspähte, zog er die anderen zu ihr hinüber. Man konnte ihn nicht übersehen. Er war ein Hüne, und in seinen neonfarbenen Sneakers und den abgeschnittenen Tarnshorts hätte er einer der Typen vom Muscle Beach sein können, die so mühelos Langhanteln stemmten, wie andere Leute Schokoladenkuchen aßen. Er warf seinen Arm einem anderen Kerl um die Schultern und deutete auf Corrina. Sie lachten, dann drehte sich Shawn um und teilte den Witz mit dem Rest der Gruppe.
Corrina spielte gerade ein Stück mit einem sanften, traurigen Refrain, die tiefen Töne der Gitarre klangen so getragen wie eine Glocke irgendwo in einem Hafen. Es war eines ihrer eigenen Lieder, aber das interessierte Shawn und die anderen Kids nicht. Sie waren nicht hier, um zuzuhören. »Our child doesn’t act that way«, intonierte Corrina.
»Darauf wette ich!«, rief Shawn.
Corrina schloss die Augen und sang unverdrossen weiter.
»Als ob wir das nicht wüssten!«, zog Shawns Kumpel nach.
Auf diese Tour machten sie weiter, störten Corrina das ganze Lied hindurch mit lauten Kommentaren, und immer wieder lachte einer, wenn er zu Corrina hinsah. Auch ein paar der Mädchen aus der Gruppe beteiligten sich daran. Das überraschte mich, weil ich immer angenommen hatte, das wären ihre Freundinnen. Dakota, ein weißes Neo-Hippie-Mädchen in einer weiten Bluse und Jeans-Shorts, trat jetzt hinter Shawn hervor.
»Gehst du nicht zu O’Keefes Party?«, fragte Dakota. »Hast wohl deine Mitfahrgelegenheit verpasst, was?« Aber noch im Reden errötete sie, an ihrem Hals bildete sich ein Archipel brennend roter Flecken.
Ich dachte, Corrina würde vielleicht ihren Verstärker hochdrehen und ihnen mit ein paar fetten, höllisch krachenden Akkorden die Ohren wegblasen, tat sie aber nicht. Stattdessen hörte sie ganz auf zu spielen. Sie lehnte ihr Instrument an den Verstärker und faltete ihre Hände über dem Gitarrenkopf und den Stimmwirbeln. »Wovon sprichst du?«, fragte sie, stellte einen ihrer schweren Doc Martens auf eine Ecke des Verstärkers und starrte Dakota an.
»Ist das dein Ernst?«, kam ein anderes Mädchen Dakota zu Hilfe. »Du gehst nicht hin, um Toby anzuschmachten?«
»Ich bin nicht seine Freundin«, entgegnete Corrina. »Ich führe nicht Buch darüber, wo er sich aufhält.«
»Ja, klar«, sagte Dakota. »Natürlich nicht.«
»Was ist mit letzter Woche?«, fragte Shawn. »Auf dem Rücksitz seines Autos?« Er machte Pumpbewegungen mit der Hüfte und lachte.
»Was soll damit sein?«, fragte Corrina. Ihr Fuß rutschte vom Verstärker, und sie versuchte, sich rasch wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
»Glaubst du, wenn du mit einem Typen schläfst, geht er mit dir aus?«, fragte Dakota.
»Ich … Was?«, brachte Corrina heraus.
»Er mag dich nicht mal, Corrina«, fügte Dakota hinzu.
Corrina atmete schwer. »Ich habe nicht mit ihm geschlafen«, sagte sie.
»Ja, logo«, sagte Shawn.
»Nein«, bekräftigte Corrina.
»Oh mein Gott!«, rief Dakota. Sie trat vor und zeigte auf Corrina. »Klar hast du. Frag Toby. Er erzählt es nämlich jedem.«
»Nein, nein«, widersprach Corrina. »D, so war’s nicht. So ist es nicht gelaufen.«
»Seht ihr!«, sagte Dakota und drehte sich zu ihren Freunden um. »Seht ihr, sie gibt es sogar zu!«
»Nein. D, ernsthaft«, flehte Corrina. »Lass es mich erklären.«
»Oh, Toby hat es schon erklärt«, sagte Shawn und wedelte mit der Hand in der Luft herum, was ihm Lacher von ein paar der Jungs einbrachte.
»Wie dem auch sei«, ging Dakota über beide hinweg. »Die Sache ist die, Corrina. Du hängst anscheinend nur noch mit Kerlen ab. Seit du angefangen hast, Gitarre zu spielen, und dich für eine Art Latino-Patti-Smith hältst.«
Corrina straffte die Schultern. »Was?«, wiederholte sie mit angespannter, schwacher Stimme. »Warum sagst du das?«
»Komm drüber weg. Du hältst dich wohl für ach so cool, oder? Tja, deshalb laufen dir wahrscheinlich auch alle nach«, fuhr Dakota fort. »Es ist offensichtlich. Du benimmst dich wie ’ne Schlampe, und sie kleben an dir.«
»Oooooohhh«, machte Shawn, um Dakota anzustacheln.
Corrina marschierte auf die Gruppe zu, die Hände zu Fäusten geballt. Sie wollte zu Dakota, aber Shawn trat dazwischen. Er war riesig, und neben ihm wirkte die ohnehin zierliche Corrina wie ein Zwerg. »Hey«, sagte er. »Bleib locker.«
»Mach verdammt noch mal Platz, Shawn«, sagte Corrina. Als sie um ihn herumzugehen versuchte, hielt er sie mit einer seiner Bärenpranken am Arm fest.
Ich weiß nicht, ob die Lampen an der Promenade auf einmal heller leuchteten oder ob die Nacht um uns immer finsterer und drohender wurde, jedenfalls war dies einer jener Momente, in denen die Stimmung überkocht und die Leute durchdrehen: Corrina keifte Dakota an, und die Mädchen keiften zurück. Auch Shawn und ein paar der Jungs brüllten auf Corrina ein, und Corrina, immer noch in Shawns Griff, beugte sich der Meute entgegen und brüllte zurück; da stand ich auf. Ich war sicher, dass Bumser spürte, wie mein Puls mit mehr als hundert Schlägen pro Minute in meinen Arterien pochte, in meinen Händen vibrierte, die Leine entlang bis zu seinem Hals. Er fing an zu bellen und in einem engen Kreis herumzuspringen, sodass ein paar Kids aus der Gruppe herübersahen. Ich wollte sie am liebsten den Strand hinauf bis nach Santa Monica prügeln, aber stattdessen ergriff Bumser die Initiative und schoss nach vorn, riss sich von mir los und lief auf Shawn zu.
Die meisten Hunde hätten sich mit gefletschten Zähnen ins Getümmel gestürzt und nach einem Kampf gelechzt, nicht so Bumser. Er besprang Shawns Bein und verrichtete dort sein anstößiges und namensgebendes Werk.
»Was zum Teufel soll das?«, rief Shawn.
Ein paar der Kids kreischten, weil sie dachten, Bumser würde Shawn in die Wade beißen, aber als sie sahen, dass Bumsers nasse Zunge fröhlich in der Luft baumelte und er die Rauferei mit einer Orgie verwechselte, fingen die meisten an zu lachen.
Sogar Corrina war überrascht. Staunend sah sie zu, wie Bumser an Shawn mächtig zu Werke ging. Shawn ließ sie los, als er versuchte, sein Bein zu befreien, was Corrina allerdings nicht nutzte, um sich auf Dakota zu stürzen. »Sieht ganz so aus, als hättest du endlich jemanden gefunden, Shawn«, sagte sie.
Darüber mussten auch andere aus der Gruppe lachen, und Shawn schien nicht übel Lust zu haben, Corrina eine reinzuhauen, aber er war immer noch voll und ganz mit Bumser beschäftigt. Da ich verhindern wollte, dass er Corrina oder den Hund schlug, ging ich dazwischen und versuchte, mir die Leine zu schnappen. Nachdem ich eine Weile mit Shawn im Kreis herumgetanzt war, bekam ich endlich Bumsers Halsband zu fassen und zerrte ihn weg.
Alle starrten mich an, oder zumindest fühlte es sich so an. Ich hatte keine Ahnung, ob mich einer von ihnen kannte oder sich an mich erinnerte, jedenfalls schien es einen kurzen Moment lang so, als hätte sich alles beruhigt.
Bis Shawn brüllte: »Was zum Teufel ist eigentlich mit deinem Hund los?« Er konnte nicht still stehen, und bestimmt war er vor lauter Angst noch mächtig unter Strom, denn seine Hände und Beine zitterten.
»Tut mir leid, Mann«, sagte ich, froh, dass mir die Stimme nicht wegblieb. »Er steht mehr auf Sex als auf Kämpfen.«
Shawn fand das nicht witzig. Er holte so schnell aus, dass ich keine Zeit hatte, in Deckung zu gehen. Von den fünf Prügeleien in meinem Leben hatte ich exakt null gewonnen, und als Shawn mir die Faust in den Bauch rammte, bestätigte ich ein weiteres Mal meinen einsamen Rekord verlorener Kämpfe.
Ich krümmte mich auf dem Boden, während Bumser knurrte und bellte, aber da ich die Leine fest um den Arm geschlungen hatte, versuchte er vergeblich, Shawn anzuspringen. Bevor der noch mehr Schaden anrichten konnte, rief Corrina seinen Namen. Shawn drehte sich um. Corrinas großer schwarzer Stiefel schoss nach vorn wie ein Pfeil und traf ihn direkt in die Eier. Er sackte auf die Knie. Alle schrien durcheinander, und Bumser bellte ununterbrochen. Ich wollte nur noch weg, aber Shawn hatte voll meinen Solarplexus erwischt, und ich wusste gar nicht, wie ich jemals wieder Luft bekommen sollte – deshalb war ich quasi bewegungsunfähig.
Während ich nach Atem rang, ging das Gebrüll weiter, bis schließlich einer aus der Gruppe Shawn fortzog. Im Weggehen nannten ein paar der Mädchen Corrina eine Nutte und noch einiges andere – Schimpfwörter, die allzu oft nur Mädchen zu hören bekommen und nicht Jungs, die genau dasselbe tun. Warum nannte eigentlich keiner Toby eine Nutte? Schließlich erzählte er seine Sexabenteuer überall herum.
Corrina blieb bei mir und half mir hinüber zu den Bäumen. Ich klemmte Bumser zwischen meine Beine und versuchte, ihn zu beruhigen. Aber er war nicht so dumm, wie er geil war, und bestimmt konnte er die fiebrige Nervosität spüren, die immer noch durch meine Finger floss, während ich sie in den beigefarbenen Falten seines Halses vergrub und ihn kraulte.
»Shawn ist ein Arsch«, sagte Corrina. »Aber dein Hund ist lustig. Macht er das immer?«
»Ja. Leider. Ich kann ihn nicht zu Hause lassen, sonst ruiniert er die Möbel.«
Wieder musste sie lachen, es kullerte nur so aus ihr heraus, frei und unbeschwert. »Magenschwinger eingesteckt, und du lächelst trotzdem«, sagte sie. »Das sagt viel über dich aus. Außerdem«, fügte sie hinzu, »ist das ein cooler Bandname: Magenschwinger eingesteckt und du lächelst trotzdem.«
»Danke übrigens«, sagte ich.
»Dafür, dass ich dich gerettet habe?«
»Meine Heldin«, bestätigte ich lächelnd.
Wieder lachte sie. »Ja. Ja.« Sie nickte mir zu und sprach wie zu einem unsichtbaren Publikum. »Ja, dieser Junge flirtet. Magenschwinger eingesteckt und du flirtest trotzdem – dieselbe Band, Jahre später, mit einem neuen Bassisten.«
»Was?«
»Ach, egal, Hendrix.«
Ich bekam immer noch schlecht Luft, teils wegen des Schlags, aber auch, weil ich neben Corrina saß, dem Mädchen, das jedes Mal, wenn wir uns unterhielten, meine Magennerven zum Explodieren brachte. Eine kleine blasse Narbe prangte wie ein Stern neben ihrem linken Auge, und als sie mich aus dem Augenwinkel ansah und mit wissender Ironie anlächelte, verschlug es mir erneut den Atem.
Sie sah weg, hinüber zum Strand, und blinzelte in die dunkle Ferne. »Aber weißt du, wem ich gern einen Magenschwinger verpassen würde? Toby ›Arschloch‹ Fuller.« Sie stand auf und lief vor mir auf und ab. Ihre Nasenflügel blähten sich beim Atmen, und ich rechnete fast damit, dass sie mir eine verpassen würde, weil Toby gerade nicht greifbar war.
»Corrina?«, sagte ich. »Alles in Ordnung?«
»Machst du Scherze? Nein. Mit mir ist nichts in Ordnung, Hendrix.« Sie blieb stehen und funkelte mich wütend an.
»Kann ich mir denken«, sagte ich. »Du wirkst sauer.«
»Ich bin nicht sauer!«, schrie sie. »So sehe ich aus, wenn ich traurig bin, okay?«
»Okay«, sagte ich, so ruhig ich konnte. »Okay. Ich wollte dir keinen Vorwurf machen. Ich würde dir gern irgendwie helfen.«
»Ha. Ja«, sagte sie. »Weißt du, was mir jetzt helfen würde? Ein Auto. Ich wünschte, ich hätte ein Auto. Ich bin so verdammt sauer, dass ich mir den Typen vorknöpfen will, auf der Stelle.« Wieder lief sie auf und ab und schwang die Arme, während sie redete wie ein Maschinengewehr. »Gott! Ich wünschte, ich könnte mir jetzt das Auto meiner Eltern schnappen.« Sie schrieb Anführungszeichen in die Luft. »Ich habe ihr Vertrauen in mich verspielt? Ehrlich, die können sich ihr Vertrauen sonst wohin stecken«, sagte sie und streckte mir dabei den Mittelfinger entgegen. Mit der Hand über dem Kopf fuchtelnd wirbelte sie herum, Richtung Strand. »Das ist nicht dein Problem, Hendrix. Sondern meins. Du musst nicht mitkommen.« Dann drehte sie sich mit Schwung zurück zu mir. »Und was ist mit dir? Du hast nicht zufällig ein Auto, oder?«
»Nein. Das von Mom? Nein, das können wir nicht nehmen«, sagte ich. »Ich zumindest nicht.«
»Warum nicht?«, fragte sie, doch ich sah bereits, wie ihr Gesicht aufleuchtete und eine Idee in ihr Gestalt annahm.
»Ich habe keinen Führerschein.«
Corrina lachte. »Hendrix. Du schaffst mich. Wer zum Teufel bist du, Mann? Wer wohnt in L.A. und hat keinen Führerschein?«
»Ich.«
»Okay, aber kann ich mit ihrem Auto fahren?«, fragte Corrina.
Das machte mich verflucht nervös, denn (a) ja, Mom hatte ein Auto, einen kleinen blauen VW Beetle, das neueste Modell, und sie war so oft weg, dass sie ihn so gut wie nie benutzte. Normalerweise stand er bloß in unserer Einfahrt rum und verhöhnte mich, aber ich war (b) auch nicht der Typ, der mit dem Auto seiner Mutter durchbrannte, weil ich nicht der Typ war, der jemals ausging oder irgendetwas anstellte. Aber es gab auch noch (c), und (c) ließ sich einfach nicht ignorieren. (C) war Corrina. Ich hatte mir das ganze Frühjahr lang den Kopf darüber zerbrochen, wie ich Corrina dazu bringen konnte, ihre Lippen auf meine zu drücken. Und als ich daran dachte, wie wichtig Grandpa seine Erinnerungen waren, wurde mir klar, dass ich nichts haben würde, worauf ich zurückblicken konnte, wenn ich einmal so alt war wie er – außer ich ging jetzt da raus und verschaffte mir selbst etwas. Ich musste etwas tun, das die Erinnerung lohnte. Also entschied ich mich für (d).
»Ja«, sagte ich. »Kannst du.«
Kapitel 3
Die Flucht von O’Keefes Party
Eine halbe Stunde später rasten wir auf der Suche nach Toby die Centinela Avenue Richtung Interstate 10 entlang. Angeblich spielte er einen Gig bei einer Privatparty in den Hollywood Hills. Corrina suchte einen Kanal mit Musik im Radio, und während diese aus den Lautsprechern dröhnte, dachte ich ungefähr alle zwölf Atemzüge: So muss sich das Leben mit Corrina anfühlen. Die restliche Zeit allerdings machte ich mir Sorgen, wir könnten in ein anderes Auto oder eine Reihe Plastikmülltonnen reinfahren oder zu schnell auf die Gegenfahrbahn wechseln, dabei durch die Leitplanke brechen und auf der anderen Straßenseite hügelabwärts auf eines der Hausdächer krachen, weil Corrina einen Bleifuß hatte und immer überholte, wenn es irgendwie ging.
»Wohin fahren wir?«, brüllte ich.
Sie gab keine Antwort. Wir schossen am Santa Monica Airport vorbei und fuhren auf die Interstate 10, wo Corrina noch mehr Gas gab.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















