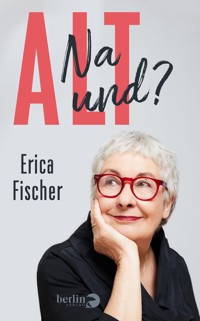8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine verbotene Liebe in Zeiten des Krieges – Die wahre Geschichte von Aimée und Jaguar Berlin, 1942. Lilly Wust, 29, verheiratet, vier Kinder, führt das Leben von Millionen deutscher Frauen. Doch dann lernt sie die 21-jährige Felice Schragenheim kennen. Es ist Liebe, fast auf den ersten Blick. Aimée & Jaguar schmieden Zukunftspläne, schreiben einander Gedichte und Liebesbriefe, schließen einen Ehevertrag. Als Jaguar-Felice ihrer Geliebten gesteht, dass sie Jüdin ist, bindet dieses gefährliche Geheimnis die beiden Frauen noch enger aneinander. Doch ihr Glück währt nur kurz. Am 21. August 1944 wird die Jüdin Felice verhaftet und deportiert. Erica Fischer ließ sich von der 80-jährigen Lilly Wust die Geschichte erzählen und verarbeitete sie zu einem eindringlichen Zeitzeugnis. Nach Erscheinen des Buches 1994 meldeten sich weitere Zeitzeuginnen, und so konnte in der vorliegenden Ausgabe neues Material hinzugefügt werden. Die bewegende Liebesgeschichte von »Aimée und Jaguar« wurde durch die Verfilmung von Max Färberböck mit Juliane Köhler und Maria Schrader in den Hauptrollen weltweit bekannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Erica Fischer
Aimée & Jaguar
Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erica Fischer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erica Fischer
Erica Fischer, geboren 1943 in der englischen Emigration der Eltern, 1948 Rückkehr nach Österreich, Studium am Dolmetsch-Institut der Universität Wien, Feministin der ersten Stunde in Wien, seit Mitte der 70er Jahre publizistisch tätig, lebt seit 1988 als freie Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin in Deutschland, seit 1994 in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Berlin 1942. Lilly Wust, 29, verheiratet, vier Kinder, führt das Leben von Millionen deutscher Frauen. Doch dann lernt sie die 21-jährige Felice Schragenheim kennen.
Es ist Liebe fast auf den ersten Blick. Aimée & Jaguar schmieden Zukunftspläne, schreiben einander Gedichte, Liebesbriefe, schließen einen Ehevertrag. Als Jaguar-Felice ihrer Geliebten gesteht, daß sie Jüdin ist, bindet dieses gefährliche Geheimnis die beiden Frauen noch enger aneinander. Doch ihr Glück währt nur kurz. Am 21. August 1944 wird die Jüdin Felice verhaftet und deportiert.
Erica Fischer ließ sich von der damals 80jährigen Lilly Wust die Geschichte erzählen und verarbeitete sie zu einem eindringlichen Zeugnis. Nach Erscheinen des Buches 1994 meldeten sich weitere Zeitzeuginnen, und so konnte in der vorliegenden Ausgabe neues Material hinzugefügt werden.
In der Verfilmung von Max Färberböck – die auf diesem Buch basiert – mit Juliane Köhler und Maria Schrader in den Hauptrollen wurde die Geschichte von Aimée und Jaguar weltweit bekannt.
»Wer anfängt zu lesen, hört nicht mehr auf. So fesselnd liest sich die ungewöhnliche Liebesgeschichte von Lilly und Felice.«Der Tagesspiegel
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Widmung
Ich danke
Die wichtigsten Personen der Handlung:
Vorwort
Artikel aus Der Tagesspiegel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Bücher und Zeitschriften
Tafelteil
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden einige Namenvon der Autorin geändert.
Für Felice
Ich danke
Ingrid Lottenburger, Margot Scherl, Sonja Wohlatz und Inge Keller, die mir ihre Wohnungen in Berlin zur Verfügung gestellt haben;
Gerd W. Ehrlich, der mir sein unveröffentlichtes Manuskript überlassen hat;
Leo, die mir Material über Groß-Rosen besorgt hat;
Susanne Pollak, die meine Arbeit von Anfang an mit großer Anteilnahme verfolgt hat;
Christel Becker-Rau, die wunderschöne Fotos von Lilly gemacht und die Reproduktionen liebevoll bearbeitet hat;
Robert S. Mackay, der als Lillys Agent und Freund den Kontakt zu Kiepenheuer & Witsch hergestellt hat;
der Stiftung »Omina-Freundeshilfe« für ihre finanzielle Unterstützung;
dem Kultusministerium NRW für ein Arbeitsstipendium;
Mieczysław Mołdawa, der mir sein Buch über Groß-Rosen geschickt und mir wichtige Hinweise gegeben hat;
Stella Leibler, die mir einen Bericht über Peterswaldau geschrieben hat;
meiner Mutter Irena Fischer, die Stella Leiblers Briefe und Auszüge aus Mieczysław Mołdawas Buch für mich aus dem Polnischen übersetzt hat;
den Wiener Frauen, deren Zuspruch und Wärme bei meiner ersten Probelesung aus dem unvollendeten Manuskript mich ermuntert hat;
Erwin Buchwieser, Gerd W. Ehrlich, Siegfrid Gehrke, Elenai Pollak, Olga Selbach, Lola Sturmova, Inge Wolf und Dörthe Zivier ebenso wie Lillys Söhnen Albrecht, Bernd und Eberhard Wust, die sich meinen Fragen ausgesetzt haben;
Christa Maria-Friedrich, Felices ehemalige Schulfreundin, die wichtige Details zu Felice und ihrer Familie beigesteuert hat;
meiner Lektorin Erika Stegmann, die immer an das Gelingen des Buchs geglaubt und mich – nicht zum ersten Mal – mit liebevoller Strenge durch den Entstehungsprozeß begleitet hat;
und schließlich der Hauptperson Lilly Wust, die sich in endlosen und manchmal quälenden Gesprächen Erinnerungen aus der Vergangenheit hat entreißen lassen und das Vertrauen in mich nie verloren hat, auch dann nicht, wenn ich bisweilen ungeduldig und unbeherrscht war.
Die wichtigsten Personen der Handlung:
Elisabeth Wust, genannt Lilly und Aimée
Felice Schragenheim, genannt Lice, Fice, Putz und Jaguar
Albrecht, Bernd, Eberhard und Reinhard Wust, Lillys Söhne
Inge Wolf, Buchhändlerin und Lillys Pflichtjahrmädchen
Günther Wust, Lillys Ehemann
Günther und Margarethe Kappler, Lillys Eltern
Erwin Buchwieser, Albrechts Vater
Käthe Herrmann, Lillys beste Freundin
Dr. Albert und Erna Schragenheim, Felices Eltern
Irene Schragenheim, Felices Schwester
Käte Schragenheim, geb. Hammerschlag, auch »Mulle« genannt, Felices Stiefmutter
Hulda Karewski, Felices Großmutter
Dr. Walter Karewski (Karsten), Felices Onkel in Amerika
Felices Freundinnen: Elenai Pollak, Nora, Ilse Ploog, Christine Friedrichs, Luise Selbach, genannt Mutti, und Olga Selbach, Muttis Tochter und Felices Schulfreundin
Hilli Frenkel, Felices beste Schulfreundin
Georg Zivier, genannt Gregor, Schriftsteller und einer von Felices Freunden
Dörthe Zivier, Gregor Ziviers Frau
Gerd W. Ehrlich, ein Bekannter von Felice und Mitglied einer jüdischen Untergrundgruppe
Fritz Sternberg, einer von Felices Freunden
Lola Sturmova, Lillys ausgebombte Untermieterin
Lucie Friedlaender, Dr. Rose Ollendorf, genannt Petel, Dr. Katja Laserstein – Lillys »drei Hexen«
Willi Beimling, Lillys zweiter Ehemann
Liesl Reichler, Günther Wusts Verlobte
Vorwort
Fast zwei Jahrzehnte sind seit dem erstmaligen Erscheinen von Aimée & Jaguar vergangen. Das Buch hat weite Kreise gezogen. Neben prominent aufgemachten Vorabdrucken und Besprechungen, der Übersetzung in zwanzig Sprachen, etlichen in- und ausländischen TV-Dokumentationen und Hörfunk-Features sowie unzähligen Lesungen und Diskussionen wurden Felices Gedichte vertont, bereiteten Schauspielerinnen den Briefwechsel zwischen Aimée und Jaguar als szenische Lesung auf, wurden im niederländischen Maastricht und im ungarischen Budapest Theaterstücke aufgeführt, malte die Künstlerin Anna Adam Ölgemälde von Felice »Jaguar« Schragenheim, und bot ein Schauspieler Lesungen aus den Büchern an, die Felice mit in die Emigration nehmen wollte. Dazu kam 1999 die Verfilmung unter der Regie von Max Färberböck, mit Maria Schrader als Felice und Juliane Köhler als Lilly Wust. Der Film erhielt bei der Berlinale den Silbernen Bären und wurde in den USA für den Golden Globe nominiert.
Ich selbst gestaltete zusammen mit der Fotografin Christel Becker-Rau und dem Grafiker Wolfgang Wittor eine umfangreiche Ausstellung mit dem Titel »Das kurze Leben der Jüdin Felice Schragenheim«, die jahrelang in vielen deutschen Städten gezeigt wurde. Mit der grafischen Aufbereitung der außergewöhnlich großen Zahl von Fotos, Briefen, Gedichten und Dokumenten, die Lilly »Aimée« Wust für die Nachwelt aufbewahrt hatte und die einen fast lückenlosen Einblick in Felices kurzes Leben bieten, konnten wir dem Buch eine eindrucksvolle visuelle Dimension hinzufügen und es vor allem jungen Menschen ermöglichen, sich anhand eines Einzelschicksals mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Beim Deutschen Taschenbuchverlag erschien 2002 das nunmehr vergriffene gleichnamige Buch, das auch ins Italienische übersetzt wurde. Felice Schragenheims einmaliger Nachlaß lagert nun sicher im Berliner Jüdischen Museum.
Und nun also Aimée & Jaguar auch als E-Book! Mit neuem Material, das in der Taschenbuchausgabe nicht enthalten ist.
Für die 2006 verstorbene Elisabeth Wust bedeutete die Veröffentlichung ihres Lebens und ihrer Liebe das Ende ihrer Isolation. Seit ihrem »Coming-out« in der Talk-Show »Boulevard Bio« sammelte sich ein großer Stapel von Briefen aus ganz Deutschland bei ihr an. Geschrieben hatten ihr offen lesbisch lebende Frauen, die sich mit ihr identifizierten, aber auch Verheiratete, die das Bedürfnis hatten, ihr über ihre eigene geheime Liebe zu einer Frau zu erzählen. In der Zeit zwischen dem Erscheinen des Buches und ihrem Tod im Alter von 93 Jahren führte Lilly ein teilweise bewegtes Leben. Sie fand neue Freundinnen, reiste mit dem Filmteam nach Los Angeles und entwickelte sich im Umgang mit Journalistinnen und Journalisten zu einem regelrechten Profi.
Auch ich fand durch Aimée & Jaguar neue Freundinnen und Freunde. Einige, die ich für das Buch interviewt hatte, blieben mir bis zu ihrem Tod verbunden, viele schrieben mir oder kamen zu meinen Lesungen. Besonders glücklich bin ich über die Bekanntschaft mit David Cahn, dem Sohn von Felices Schwester Irene. David wuchs mit wenig Wissen über seinen familiären Hintergrund auf. Seine verstorbenen Eltern, beide Berliner Juden, schwiegen – wie so viele ihrer Generation – und betraten nach ihrer erzwungenen Emigration nie wieder deutschen Boden. Ihre beiden Söhne David und Oliver sprechen kein Deutsch und hatten bis zum Erscheinen der englischen Ausgabe von Aimée & Jaguar Deutschland nicht besucht. Das Buch eröffnete ihnen neue Einblicke in ihre Familiengeschichte. Der Kontakt zu mir und die erwachte Neugierde brachen schließlich den Bann. Als erster kam David Cahn nach Berlin und besuchte die Orte, an denen seine Familienmitglieder gelebt und gelitten hatten. Ein besonderer Augenblick war der Besuch am Grab seines Großvaters Dr. Albert Schragenheim auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. David Cahn wird vom Schicksal ihrer Familie geprägt bleiben wie die meisten Jüdinnen und Juden der zweiten Generation, doch er hat mit seiner Reise nach Berlin den gerissenen Faden der Geschichte wiederaufgenommen, seiner eigenen und der so vieler Berliner Juden, die ermordet wurden oder gerade noch davonkamen.
Während einige hundert Kilometer entfernt die »ethnischen Säuberungen« in Bosnien ihren Lauf nahmen, half auch mir selbst das Schreiben von Aimée & Jaguar, meine eigene Familiengeschichte nachzuvollziehen. Ich wurde aber auch in schmerzhafte Erinnerungen anderer hineingezogen, riß bei Überlebenden Wunden auf, die nur oberflächlich vernarbt waren. Manche nahmen mir das übel. Felices Freundinnen konnten und wollten keinen Frieden schließen mit Lilly Wust, der Nazi-Mitläuferin von damals. Sie gaben ihr keine Chance, ihre Mittäterschaft wiedergutzumachen. Vermutlich wäre Lilly dazu aber auch nicht in der Lage gewesen.
Ich selbst stand dazwischen, verteidigte Lilly, wo das Urteil allzu harsch ausfiel, war aber auch Beteiligte an der Geschichte. Ich konnte zwar Elisabeth Wusts allzu deutsches Schweigen über die abgespaltenen Teile ihrer Vergangenheit psychologisch verstehen, nicht aber wirklich verzeihen. Ich, die ich mich als Jüdin der Geschichte näherte, konnte nicht so nachsichtig sein wie viele junge Frauen, die sich dagegen sperrten, auch nur über eine mögliche Mitschuld von Aimée nachzudenken. Die Liste der Entschuldigungen ist lang: Es hätten damals alle so gedacht und geredet, die Menschen seien manipuliert worden, eine Frau mit vier Kindern habe weder Zeit noch Gelegenheit gehabt, sich zu informieren, sie habe sich bloß den Meinungen ihres Mannes angepaßt, und außerdem habe man »das« damals ja alles nicht gewußt.
»Mitgefühl und Einfühlungsvermögen verteilen sich nicht zufällig«, schreibt Birgit Rommelspacher in ihrem Essayband Dominanzkultur (Berlin 1998). »Verständnis wird zumeist sehr viel eher denen entgegengebracht, die zu ›uns‹ gehören, und denjenigen, die hier das Sagen haben. Gefühle werden zu Kollaborateuren der Macht.« Im Fall von Jaguar und Aimée habe ich den Eindruck, daß sich so manche junge Frau mit ihrem Verständnis für Lilly Wust dagegen sträubt, sich mit der Mitschuld und dem Schweigen ihrer eigenen Groß- und Urgroßmutter auseinanderzusetzen. Mit der Empathie für das ermordete Opfer Felice und die unverheilten Wunden der Überlebenden der ersten, zweiten und dritten Generation tun sich viele hingegen auch heute noch schwer.
Der Erfolg des Buches ist darauf zurückzuführen, daß es von einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte erzählt, die keine Chance hatte, sich im Alltag abzunützen, und die in ihrer Tragik daher zu Projektionen einlädt. Das Bedürfnis lesbischer Frauen nach Vorbildern und Heldinnen, die eine Kontinuität zur eigenen Lebensgeschichte herstellen, ist so groß, daß die kritische Distanz zu den Ereignissen zwischen 1933 und 1945 häufig verlorengeht. Daß die eine als Jüdin und nicht als Lesbe umgebracht wurde, und die andere wegen ihrer Liebe zu einer Frau im »Dritten Reich« nicht verfolgt wurde, will nicht in das herbeigesehnte Bild lesbischen Heldentums passen. Und doch war es so. Es ist in Deutschland leider schwer, Kontinuitäten herzustellen, sie werden immer gebrochen bleiben. Damit müssen auch weitere Generationen leben.
Möge dieses Vorwort helfen, die bittersüße Liebesgeschichte von Aimée und Jaguar mit all ihren Brechungen zu lesen, ohne daß dabei ihre zeitlose Schönheit und Romantik verlorengehen.
E.F. Berlin, im August 2013
Gestern überreichte Innensenator Lummer das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz am Bande an Elisabeth Wust (68) aus Lichterfelde. Elisabeth Wust hatte in den Jahren von 1942 bis 1945 vier Jüdinnen in ihrer Schmargendorfer Wohnung versteckt und versorgt. Eine der Frauen wurde 1944 von der Gestapo aufgespürt und kam im KZ Auschwitz ums Leben. Drei der Frauen überlebten das Nazi-Regime. Es ist das 21. Verdienstkreuz für »Unbesungene Helden« in Berlin. So werden Personen bezeichnet, die Verfolgten während der Nazizeit Hilfe geleistet haben.
Der Tagesspiegel, 22. September 1981
1
Die breite mit einem rostroten Läufer bespannte Holztreppe knarrt, als Inge Wolf, zwei Stufen auf einmal nehmend, in den vierten Stock des Hauses Friedrichshaller Straße 23 hochsteigt. Die bunten bleiverglasten Fenster an den Treppenabsätzen gehen hinaus auf den begrünten Hinterhof und das ans Vorderhaus anschließende Gartenhaus, eine schlichtere, niedrigere Ausgabe des Vorderhauses für die weniger Begüterten. Von Stock zu Stock weitet sich der Blick auf Schmargendorfer Dächer und herbstlich getönte Linden.
Es ist der erste Oktober, und Inge Wolf muß sich beeilen, eine geeignete Stelle zu finden. Wenn sie nicht bald ihr hauswirtschaftliches Pflichtjahr antritt, wird man sie zum Reichsarbeitsdienst einziehen. Die Friedrichshaller Straße ist an diesem Donnerstagvormittag schon ihr zweiter Versuch.
Bei »Wust« öffnet eine schlanke Rothaarige mit randloser Brille.
»Guten Tag.«
Inge Wolf atmet auf. Nach vier Hausfrauen in Kittelschürzen, die sie mit »Heil Hitler« empfangen haben und »Ach, ist das schön, daß Sie kommen!«, hat sie auf ein schlichtes »Guten Tag« schon gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Die Anhäufung von Nazissen kommt wahrscheinlich daher, daß Inge mit ihren 21 Jahren das Pflichtjahr in einer Familie mit mindestens vier Kindern ableisten muß. Wäre sie erst sechzehn, würde auch ein Einzelkind genügen. Schlimm genug, daß eine wie sie, die wahrlich mehr im Kopf hat als Kochen und Putzen, sich in den Dienst anderer Leute stellen muß, aber Nazipack muß es nun wirklich nicht sein. Wenn eine schon in ihrer eigenen Wohnung den Führer anruft, ist leicht auszudenken, was alles noch kommen kann.
»Ach, wissen Sie, ich hab so viel Auswahl, ich muß mich erst umgucken«, sagte sie jeweils hastig und suchte das Weite.
Ist es die spindeldürre Person mit den abstehenden Ohren und dem struppigen Kurzhaarschnitt, die mit ihren prüfenden schwarzen Augen Elisabeth Wust veranlaßt, »Guten Tag« zu sagen, oder ist es der erste unüberhörbare Zweifel an den Überzeugungen ihres Gatten? Seit einiger Zeit ist Elisabeth Wust unzufrieden, ohne genau zu wissen warum. Äußeren Grund zur Klage hat sie nicht, ihre Söhne gedeihen prächtig, sollen eines Tages auf die Napola[1] gehen. Am 12. August ist sie Trägerin des Mutterkreuzes in Bronze geworden, ihr vierter Sohn wurde vor einem Jahr geboren. Günther Wust ist in Bernau bei Berlin Soldat, gottlob weitab von der Front. Im zivilen Leben ist er Beamter bei der Deutschen Bank, kurz vor der Prokura, ein fescher Kerl, groß, schlank, dunkelhaarig, immer auf gute Formen bedacht, der Typ von Mann, den sich jedes Mädchen erträumt. Als Elisabeth Wust ihn in einem Heim der Deutschen Bank 1932 kennenlernte, gab sie ihrem früheren Verlobten gleich den Laufpaß.
Inge Wolf steckt den Stapel Karteikarten mit den Adressen vom Arbeitsamt mit einem Seufzer der Erleichterung in die Jackentasche und beschließt, die Sucherei zu beenden. Am säuberlich geschrubbten Küchentisch erledigen die beiden Frauen die Formalitäten. Arbeitszeit ist von acht bis fünf.
»Ich zeig Ihnen mal die Wohnung.«
Die geräumige Vierzimmerwohnung mit den stuckverzierten Decken hat einen größeren Balkon auf die schattige Friedrichshaller Straße und einen kleineren an der Küche mit dem Blick auf das Dach des Gartenhauses. Kaum hat sie das Wohnzimmer mit den weitgeöffneten Flügeltüren betreten, erkennt Inge Wolf ihren fatalen Irrtum. Blank geputzt und aus Bronze: das Relief des Führers! Was tun? Im Grunde genommen wäre es jetzt an der Zeit, ihr Sätzlein aufzusagen und zu flüchten. Doch die Papiere liegen ausgefüllt auf dem Küchentisch, ein Rückzug könnte Mißtrauen erwecken. Eine Denunziation hätte ihr gerade noch gefehlt. Auch macht sich angesichts dieser neuerlichen Enttäuschung in Inge eine traurige Mattigkeit breit. Wer weiß, wie oft sie noch durch Berlin wird fahren müssen, ehe sie eine Familie findet, die der braunen Brut widerstanden hat. Gibt es das überhaupt noch nach bald einem Jahrzehnt Hitlerdiktatur?
Sie beschließt, in den sauren Apfel zu beißen.
»Eins muß ich Ihnen aber gleich sagen«, sucht Inge nach einer letzten Möglichkeit, ihre Entscheidung zurückzunehmen, »im Haushalt bin ich eine absolute Niete.« Schließlich soll das 1938 eingeführte land- und hauswirtschaftliche Pflichtjahr für alle ledigen Frauen unter 25 »die Freude am hauswirtschaftlichen und sozialen Beruf erwecken«, wie es erst kürzlich in der Zeitung stand. Diesen Dienst wird Inge der Reichsfrauenführerin bestimmt nicht erweisen.
Doch die Wust ist angesichts der immer rarer werdenden Haushaltshilfen nicht abzuschrecken. »Ach Kindchen, haben Sie eine Ahnung, welche Niete ich erst bin. Gemeinsam werden wir es schon schaffen«, gluckt sie mit einem tiefen kehligen Lachen und schiebt Inge zur Tür hinaus.
»Bis Montag.«
Es tut mir leid, wir haben nie ein Hitlerbild gehabt. Das hat Inge bestimmt erfunden. Sie hat mich eben als Nazi eingeordnet. Sicher, wir waren eine treudeutsche Familie, logisch. Geb ich ja zu. Mein Haushalt war ausgerichtet wie bei Millionen Deutschen, geb ich zu. Ich habe nie Hitler gewählt, aber ich war mit einem Nazi verheiratet. Mein Mann war ein Nazi, kein Parteigenosse, aber ein guter Deutscher und Nazi, das war er. So hat Inge mich kennengelernt. Er war ein richtiger Preuße, obwohl er eigentlich Sorbe war. Wir haben, glaube ich, Mein Kampf gehabt, ja das haben wir. Und wir haben den Völkischen Beobachter gehabt. Ich rede nicht gern darüber. Ich gebe ungern zu, daß mein Mann ein Nazi war und ein bißchen Antisemit, das lag in der Familie, der übliche Antisemitismus ohne viel Nachdenken. Meine Eltern haben immer gestichelt, mein Vater hat mich beschimpft, daß ich einen Nazi geheiratet hab. Und auch mein Bruder war überhaupt nicht damit einverstanden, solange er noch in Deutschland war. Doch dann hat er sich nicht weiter um mich gekümmert. Aber ich hätte mir ohnedies nicht dreinreden lassen. Ich hab damals gemacht, was ich wollte. Und ich wollte es unbedingt durchsetzen. Ich war dumm und dämlich, aber vor allen Dingen wollte ich aus dem Haus. Über was andres hab ich überhaupt nicht nachgedacht. Er war ein hübscher Kerl, er war überall gern gelitten, er hatte Aussicht, was zu werden. Ich hab doch den Günther geheiratet, nicht den Nazi! Und ich hab ohne meine Eltern geheiratet. Nicht einmal meine Schwiegereltern waren bei der Hochzeit, denen war ich zu jung und zu lebhaft. Meine ganze Lebensart paßte ihnen nicht. Mein Vater war zu meiner Hochzeit im Altvatergebirge. Wir haben ihn ja gezwungen, die schriftliche Erlaubnis zu geben, weil ich noch nicht 21 war. Mein Vater war so furchtbar rechthaberisch. Ich hab ihn erst wieder gesehen, als Bernd geboren wurde. Durch das Enkelkind hat sich die Feindschaft aufgelöst. Und dann wurde ich eine kleine Hausfrau und bekam Kinder. Ich bin im Grunde genommen darauf dressiert worden, eine Familie zu haben, einen Haushalt zu führen, und nu hat sich’s. So hab ich die nächsten Jahre auch gelebt. Kinder kriegen, Windeln, Haushalt, Mann besorgen. Ich hab mich immer über meinen Mann geärgert, später dann erst recht. Wenigstens am Sonntag hätte er mich entlasten können, nein, es mußte immer alles pünktlich auf dem Tisch stehen. Oder er hätte mal mit den Kindern spazierengehen können. Mit kleinen Kindern konnte er nichts anfangen. Auf seine Söhne war er zwar ungeheuer stolz, aber mir die Kinder einmal abnehmen, das kam ja gar nie in Frage. Es gab Tausende solcher Haushalte, die sich um nichts gekümmert haben als um ihre Nachkommenschaft. Wir Frauen haben uns gegenseitig Rezepte zugesteckt, das war für uns viel wichtiger als alles andere. Napola? Nee, da muß ich aber lachen. Da hätte mein Mann doch in der Partei sein müssen, nicht? Da kamen doch nur die Kinder von ganz strengen Parteigenossen rein. Nie, so ein Nazi war er wirklich nicht. Wie viele eben, wie Tausende. Deutschland sollte wieder was werden, so war es doch. Wie viele sind mitgelaufen und sind sogar Parteigenossen geworden, weil sie geglaubt haben, daß der Hitler was draus macht. Was nachher daraus wurde … Aber zuerst haben die Menschen sich das wirklich nicht so vorgestellt. Napola – seit zig Jahren höre ich das Wort zum ersten Mal wieder. Meine Güte, das ist bestimmt über 50 Jahre her! Nein, um Gottes willen, ein braver Bankbeamter war er, wäre seinen Weg gegangen. Die Kinder wären vielleicht auch in die Deutsche Bank gekommen oder sie hätten studiert. Der Weg war ja sozusagen vorgeschrieben. Er war eben ein guter Deutscher.
Am 5. Oktober 1942 spricht Reichsmarschall Hermann Göring in seiner Rede zum Erntedanktag vom »großen Rassenkrieg«: »Ob hier der Germane oder der Arier steht oder ob der Jude die Welt beherrscht, darum geht es letzten Endes, und darum kämpfen wir draußen.« Die Rede wird in den Zeitungen in voller Länge abgedruckt. Am selben Tag ergeht von Reichsführer-SS Heinrich Himmler die Order, alle Juden aus den Konzentrationslagern im Deutschen Reich nach Auschwitz zu deportieren.
Derweil beginnt Inge Wolf sich im Hause Wust einzuleben. Widerwillig muß sie lernen, den wachsenden Stapel des Völkischen Beobachter im Herrenzimmer so auszurichten, daß der gefaltete Mittelbug genau an der Kante des kleinen Glasschränkchens zu liegen kommt. Doch die niedlichen Kinder sind ihr schon nach wenigen Tagen ans Herz gewachsen. In schöner Regelmäßigkeit hat die neunundzwanzigjährige Wust alle zwei Jahre ein Kind geboren: Bernd ist sieben, Eberhard fünf, Reinhard drei und Albrecht ein Jahr alt.
Inges erste Aufgabe am Morgen ist es, Albrecht, den seine beiden Brüder mit randvoller Hose vom Kinderbunker heimbringen, von seiner stinkenden Last zu befreien. Ansonsten ist sie eher für die beiden mittleren Wust-Sprößlinge zuständig. Eberhard läuft der Tante Inge jeden Tag mit seinem Honigkuchenpferdgrinsen entgegen und legt dabei eine entzückende Reihe von Karies befallener Zahnstummel frei. Reinhard, der mit hellwachen ernsten Augen die Welt begutachtet, liegt ihr andauernd in den Ohren, ihn mit ins Kino zu nehmen, wo er dann glückselig und mucksmäuschenstill auf ihrem Schoß sitzt. Bernd, der hochgeschossene Älteste, nimmt wenig Kenntnis von Inge und verbringt seine Nachmittage lieber auf der Straße beim Kriegspielen.
Ihre Kinder versteht die Wust mit großem Geschick so zu organisieren, daß ihr genügend Zeit bleibt, ihrem für eine Nazisse bemerkenswerten Freizeitvergnügen nachzugehen. Mit entwaffnender Vertrauensseligkeit beteiligt sie ihr Pflichtjahrmädchen an den Vorkehrungen für ihre Herrenbesuche, so daß zwischen den beiden Frauen fast schon so etwas wie Komplizenschaft entsteht, gleichwohl Inge Wolf weder für die politischen noch für die sexuellen Vorlieben ihrer Arbeitgeberin Verständnis aufbringen kann und will. Arbeitskollegen von Günther Wust sind sie, die da nachmittags ihre Aufwartung machen, Herren mit guten Manieren, von gepflegtem Äußeren und stattlicher Erscheinung. »Sie ist die große Geliebte für kleine Beamten«, spöttelt Inge daheim und rächt sich so für die Schmach, Hitlers Bronzenase abstauben zu müssen. Wenn Herrenbesuch angesagt ist, richtet die Wust ihr Nachthemd mit der blaßgrünen Spitze am Ausschnitt her, und Inge muß das Bett frisch beziehen. Danach geht es ab mit den Kindern in den Zoo. Besonders wenn sie einen gewissen Patenheimer erwartet, wird die Wust von einer geröteten Aufgeregtheit erfaßt. Bankbeamter und Alter Kämpfer[2] ist er, mit einem Schatten auf der Lunge und deshalb von der Wehrmacht freigestellt. Dann rennt die Wust wie ein Backfisch durch die Wohnung, steckt sich in einem fort das Haar hoch, scheint andauernd etwas zu suchen, rückt Gegenstände zurecht. Mit Alten Kämpfern kann sie am besten, sagt sie.
Das waren Männer aus unserem Bekanntenkreis, im Alter meines Mannes. Sie waren auf Urlaub oder auf irgendwelchen Posten in Berlin. Es mußte ja auch Männer geben, die die Betriebe aufrechterhielten. An Männermangel hab ich nie gelitten. Aber die meisten, na ja, die konnten mehr oder weniger nicht, das war eine traurige Sache. Wenn ich es mir überlege, war Günther immer noch der Beste von allen. Ich kann mir das nur so erklären, daß ich gar keinen Anteil daran hatte. Orgasmus, wie man heute sagt, habe ich überhaupt nicht gekannt. Aber sie wollten mich, und ich hab nicht nein gesagt. Natürlich schmeichelt es einer jungen Frau, wenn die Männer hinter ihr her sind. Im Krieg lockern sich die Sitten. Niemand wußte, was morgen sein würde, also haben wir das Leben eben genossen, so gut es ging. So haben’s die Männer auch gemacht. Mein Mann hatte ja auch die Liesl.
Gern gehabt habe ich ihn schon, den Günther, sonst hätte ich ihn doch nicht geheiratet, ist doch Unsinn. Aber ich war viel zu jung und viel zu dämlich damals. Ich bin erst aufgewacht, als ich 26 Jahre alt war. Da hatte ich schon drei Kinder. Plötzlich wollte ich kein Hausmütterchen mehr sein. Ich wollte nicht nur gebändigte Mutternatur sein. Da gab’s die ersten Unstimmigkeiten zwischen meinem Mann und mir. Da fing ich an, erwachsen zu werden und mich zu wehren. Er ging gerne mal alleine ein Bier trinken. Ich wollte zwar nie in die Kneipen mitgehen, aber ich wollte auch nicht bloß Kinder hüten, Himmelherrgott noch mal. Ich wollte ins Theater gehen, irgend etwas Nettes mit ihm gemeinsam unternehmen. Da wurde mir plötzlich klar: Wohin gehst du jetzt? Und da fing ich an, mich von meinem Mann zu entfremden. Wenn man’s genau nimmt, hat das mit dem Krieg begonnen. Da hatten wir beschlossen, einige Tage mit den Herrmanns zu verbringen. Der Ewald war wie Günther bei der Deutschen Bank, die ältesten Kinder waren gleichaltrig, so haben wir uns kennengelernt. Und die Käthe war meine beste Freundin. Dann merkte ich, daß sich etwas abspielt. Als mein Mann 1940 eingezogen wurde, beschwerte er sich in einem Brief, daß die Käthe sich nicht meldet. Da bin ich wutschnaubend rausgefahren zu meiner Freundin. »Wenn Günther mir Briefe schreibt, soll er sie gefälligst an mich schreiben«, hab ich sie angefaucht. Da fing die Käthe an zu weinen. »Liebt ihr euch denn so sehr?« – »Ja«, hat sie gehaucht. Da hab ich sie in den Arm genommen und hab sie getröstet. »Dann liebt euch doch, aber laßt mich in Frieden.«
Eigentlich hab ich ihm das gar nicht übelgenommen. Laß bloß die Familie nicht von der Leine, sonst mach, was du willst, war meine Devise. Ich wollte es bloß nicht wissen. Einmal hab ich ihm vorgeschlagen, fünf Jahre lang getrennt zu leben, in derselben Wohnung. Ich führe den Haushalt, ich mache das alles, aber bitte sonst nichts. Da hat sich mein Mann auf die Stirn getippt. Ich suchte einen Ausweg. Ich büchste aus. Früher hätte ich mir nie vorstellen können, meinem Mann untreu zu sein. Aber er übertrieb es ein bißchen. Ich hab es ihm dann später auch vorgeworfen. Als wir in irgendeinen Streit geraten waren – Albrecht, der vierte, war gerade ein dreiviertel Jahr alt –, da packte mich die Wut und ich hab ihm gesagt: Übrigens ist das nicht dein Kind. Das hat ihn schwer gewurmt. Vor allem, er kannte den Erwin, nicht wahr? Aber ich hab ihm dann gesagt, daß er selber schuld wäre. Warum hat er sich andauernd mit anderen Frauen rumgetrieben, ich fühlte mich eben alleine, zum Donnerwetter, da hab ich mal nachgegeben, nicht wahr? Mit dem Erwin hatte ich auch keine längere Beziehung, beim dritten Mal ist es wohl passiert. Das war sowieso ein wildes Jahr, er war ja nicht der einzige. Mein Mann wußte, wie sehr der Erwin hinter mir her war. Vor dem Traualtar hatte der mich noch beschworen, ihn zu heiraten und nicht meinen Mann. Wir hatten immer Kontakt. Wir sind doch kreuz und quer durch Berlin gezogen, und er ist uns immer gefolgt. Als er Beamter im Rathaus Wilmersdorf wurde, hat er uns dann die Wohnung in Schmargendorf verschafft.
Nein, so viele Kinder wollte ich nicht. Bernd und Eberhard waren gewollt, Bernd sollte ein Brüderchen haben. Aber der Reinhard war ein Versehen, da hab ich drei Tage nicht mit meinem Mann gesprochen. Ich hatte mich doch grade erst erholt. Mit drei Wochen hatte Eberhard einen Magenpförtnerkrampf, der ist mir unter den Händen fast weggestorben, der Junge. Über ein halbes Jahr mußte ich ihm alle zwei Stunden zu essen geben. Der war nur noch ein Strich. Und schon wieder ein Kind, das war mir zu viel. Aber dann hat meine Natur gesiegt. An Abtreibung hätte ich nie gedacht, auch nicht beim Albrecht. Ich hab’s als Schicksal angenommen, und ich hab ja meine Kinder gerne bekommen. Nur die Machart, das ist eine andere Sache.
Ich habe Lilly Anfang 1933 kennengelernt. Wir nahmen beide an einem Kursus für Steno und Schreibmaschine teil, den die Deutsche Bank eingerichtet hatte, um Arbeitslose von der Straße zu holen. Mein Vater war in der Depositenkasse der Deutschen Bank, Lillys Vater war in der Auslandsabteilung, aber sie kannten einander nicht. Ich war 21, hatte vorher Autoschlosser gelernt und war arbeitslos. Ich wäre gerne Ingenieur geworden, aber das scheiterte an den wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Kursus war eine Geste, mit der sich die Bank mit den neuen Machthabern gutstellen wollte, so eine Art »Notopfer«. Es kostete sie ja nicht viel.
Lilly war für mich einfach genau das, was ich mir immer vorgestellt hatte. Rothaarig, das war der erste Eindruck, für mich immer ein meistens unerfüllter Traum. Ihre Lebhaftigkeit, ihre sichere Art und ihre guten Umgangsformen haben mich sehr beeindruckt. Die mir ja ganz abgingen. Ich war ein Wildwuchs. Ich war schüchtern und zurückhaltend, aber irgendwie war zwischen uns der Kontakt gleich da, ohne daß es groß ausgesprochen wurde. Aber sie war ja schon gebunden. Ich habe nie versucht, sie umzustimmen. Das hätte auch keinen Sinn gehabt. Es war ja alles so gut eingefädelt. Die Eltern von Lilly und Günther Wust waren ein bißchen gehoben gegenüber dem, was ich war. Ich war ja eigentlich nur ein Proletarier. Mein Vater war zwar auch Bankangestellter, aber wir haben gesellschaftlich gesehen in ganz kleinen Verhältnissen gelebt. Ich war nichts und ich hatte nichts. Später habe ich auch Günther Wust kennengelernt, als er Lilly vom Kursus abgeholt hat. Er hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Ein bißchen vornehmes Getue, aber er hatte schon einen gehobeneren Posten in der Bank und mußte seinem Klientel gegenüber eine gewisse Haltung zeigen. Korrekt, höflich und gebildet war er. Lilly war natürlich auch gebildet. Sie hatte Abitur, ich nicht. Ich bin auch sicher vom Wust nicht ernst genommen worden. Mein Vater war ein unbedeutender Angestellter, der von einer kleinen Stadt nach Berlin gekommen war und der Berlin eigentlich nie richtig verkraftet hat. Lilly war also in jeder Weise ein erstrebenswertes Ziel, aber an Heirat war gar nicht zu denken. Ich war arbeitslos, und der Günther Wust hatte eine feste Stellung. Die Deutsche Bank hat ja keinen entlassen, auch nicht in jenen Krisenzeiten, die stand immer gut da.
Ich habe dann im August 1938 eine andere Frau geheiratet, aber für Lilly habe ich weiter geschwärmt. Sie war etwas Kostbares für mich, eine Art Juwel, vielleicht auch zerbrechlich, ganz abgesehen von der erotischen Kraft, die von ihr ausging. Sie war alles, was ich je wollte, rothaarig, intelligenter als ich, gebildeter als ich. Sie war kurzsichtig und trug eine Brille. Ich habe ihr immer gesagt, sie soll sie abnehmen, damit sie meine Schwächen weniger sieht. Als wir dann endlich miteinander ins Bett gingen, war bei mir überhaupt kein Unrechtsbewußtsein da. Im Januar ’41, nach dem Frankreichfeldzug, lagen wir südlich von Berlin in einem Dorf namens Schöneweide, wo wir sozusagen aufgefrischt worden sind, bevor wir nach Rußland gingen. Ich hatte damals eine ganze Menge Bewegungsfreiheit. Da muß es wohl geschehen sein.
An ein Hitlerbild im Wohnzimmer kann ich mich nicht erinnern. Aber das war ja die Regel damals, es wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Oder vielleicht doch? Vielleicht hätte ich eine Bemerkung gemacht, wie »der liebe Adolf ist ja auch schon da« oder so was. Ein Hitlerbild konnte damals aber auch eine Tarnung gewesen sein. Man mußte ja damit rechnen, daß der Blockwart, der kam, um für die NSV[3] zu kassieren oder fürs Winterhilfswerk, sich umschaute, ob Sie denn wenigstens ein Hitlerbild haben oder eine Fahne raushängen. Die Hälfte des Volkes bestand doch aus Spitzeln und Denunzianten. Aber ist das so wichtig? Ich hab bei Lilly nie irgendwelche Begeisterungsstürme für Hitler erlebt. Ich selbst war ja Nationalsozialist aus Überzeugung, bin 1931 in die Partei eingetreten, weil mir das Programm gefallen hat. Und im Programm stand von diesen Dingen nichts drinnen. Ich bin heute noch glücklich, daß ich Soldat wurde und die Dinge, die sich hier abgespielt haben, als Parteigenosse nicht mitmachen mußte. Daß man die Juden in KZs bringt und dort umbringt … Nirgends war zu lesen, daß man sie vernichten wollte. Und wenn, dann habe ich gedacht wirtschaftlich. Es lief doch alles darauf hinaus, daß die Juden angeblich überall Einfluß hatten mit ihrem Kapital. Ja, das habe ich geglaubt, daß sie eine sehr überragende Rolle im Wirtschaftsleben spielten. Da wurden uns auch Beispiele gesagt: Bankiers waren grundsätzlich jüdisch und die Filmgewaltigen in Hollywood auch. Die sind eben tüchtiger, du lieber Gott, aber das haben wir damals nicht so gesehen. Ich habe keinem Juden was zuleide getan, nicht einmal verbal, aber das sagen ja alle von sich. Ich frage mich heute manchmal: Warum haben wir eigentlich so wenig gemerkt? Aber meinen Sie, das hat einer von den kleinen Leuten ernst genommen, wenn sie da blutrünstige Lieder sangen gegen die Juden? Dann mußten sie auch einen zweiten Vornamen annehmen, einen jüdisch klingenden. Ja, Gott, das waren Dinge … Ob ich das damals so richtig empfunden habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Es hat mich ein bißchen befremdet.
1933, als wir den Kurs der Deutschen Bank besuchten, wurde schon manchmal beiläufig gesagt »Es geht vorwärts!« und »Sieg!«. Aber nur ganz allgemein, keiner hat Propaganda für irgendeine Partei gemacht. Da war ja auch Bob dabei, Lillys Bruder, der war Kommunist oder Sozialdemokrat. Ich hatte immer den Eindruck, daß Lillys Elternhaus konservativ eingestellt war, das, was man früher deutsch-national nannte. Die Konservativen waren doch heilfroh über die Nazibewegung. Die nationalsozialistischen und die kommunistischen Arbeiter haben sich gegenseitig den Kopf eingeschlagen, darauf haben die gesetzt. Es waren ja in der Regel Arbeiter, die sich die Köpfe einschlugen. Aber ich hatte ganz andere Ideen, wenn ich mit Lilly zusammen war, als mich mit ihr über politische Dinge zu unterhalten.
Elisabeth Wust merkt gleich, daß Inge ein intelligentes Mädel ist, ganz anders als das letzte, das ihr weggeheiratet wurde, ehe das Jahr um war. Inge Wolf hingegen findet die rothaarige Gnädige mit ihrem durchsichtigen sommersprossigen Teint und den scharfkantigen hohen Backenknochen zwar nicht unhübsch, aber reichlich dämlich. In die Verlegenheit, einem Gespräch über Politik ausweichen zu müssen, kommt sie selten. Die Wust hat meistens anderes im Sinn. Nur manchmal plappert sie geistlos nach, was sie eben im Völkischen Beobachter gelesen hat. Und wenn vor dem Haus die Pimpfe in ihren schneidigen Uniformen mit Tschinderassabum vorbeimarschieren, öffnet sie das Fenster, hebt den Eberhard hoch und zeigt nach unten: »Schau, Eberhard, Hitlerjugend. Wenn du zehn bist, darfst du auch mitmarschieren.«
Einmal wöchentlich bekommt Günther Wust von seiner Bernauer Wachkompanie frei, um die Familie zu besuchen. Mit seinem kleinen Schnurrbärtchen sieht der schmal gebaute Sechsunddreißigjährige nicht übel aus, und wenn er an seiner Pfeife saugt, verströmt er jene verträumte Gelassenheit, die Pfeifenrauchern eigen ist.
Richtig politisch wird es im Hause erst, wenn die Eltern der Wust, die Kapplers, zu Besuch kommen. Kaum ist die Wohnungstür hinter Vater Kappler ins Schloß gefallen, zieht es ihn schon zum Adolf hin, der alsbald mit dem Gesicht nach unten auf der Kommode zu liegen kommt. Dann faltet seine Frau die Hände über ihre korpulente Leibesmitte und lächelt zufrieden. Diese Eintracht ist ein seltenes Vorkommnis, denn üblicherweise herrscht Krieg zwischen Günther und Margarethe Kappler. Freunde der Familie berichten, daß im Januar regelmäßig eine neue Vase aus böhmischem Kristall angeschafft werden muß, die beim Streit während der Weihnachtsfeiertage zu Bruch gegangen ist. Mutter Kappler schmeißt bisweilen auch mit Glühbirnen und Meißener Porzellan um sich, ganz zu schweigen von ihrer leichtsinnigen Art, sich wegen eines hübschen Kleids mit einem Krägelchen aus Brüsseler Spitze bedenkenlos zu verschulden, eine Verantwortungslosigkeit, die ihren zum Geiz neigenden Ehemann zur Weißglut bringt. Besonders ärgerlich findet es die Wust, daß der Vater, zu Hause ein pedantischer Tyrann und Angeber, mit der Angewohnheit, an verschiedenen Stellen der Wohnung kleine Zettelchen mit der Aufforderung »Tu’s gleich« an die Wand zu heften, bei Außenstehenden als amüsanter Alleinunterhalter gerngesehener Gast ist. Die Besuche der Eltern in der Friedrichshaller Straße enden denn auch nicht selten im Streit und lassen die Wust in Tränen aufgelöst zurück. Der Vater liebt es, seine Tochter durch Aufsagen schlüpfriger Gedichtchen in Verlegenheit zu bringen. Ein Luftikus ist er, sagt die Wust mit zusammengekniffenen Lippen und blickt errötend zu Boden.
Inge Wolf kann den schlanken Mann mit dem kleinen Oberlippenbärtchen gut leiden, schon allein wegen seiner politischen Haltung. Wie ihr Vater ist er bei der KPD gewesen, hat aber 1933 seiner ängstlichen Frau zuliebe das Mitgliedsbuch verbrannt. Zu Hitlerbildern hat er eine besondere Beziehung. Auch bei sich zu Hause hält er sich eins: Es liegt unter dem Läufer gleich bei der Eingangstür, und dem Kappler bereitet es ein diabolisches Vergnügen, zu beobachten, wie jeder, der in seine Wohnung in Berlin-Südende kommt, erst einmal auf den Hitler treten muß. Besonders freut er sich, wenn derjenige sein smarter Schwiegersohn Günther ist, dessen Versuch, der NSDAP beizutreten, an der vorübergehenden Aufnahmesperre des 1. Mai 1933 gescheitert ist. Daß Günther Wust es aus gekränktem Stolz dann später bleibenließ, konnte am vernichtenden Urteil seines Schwiegervaters nichts mehr ändern.
Ich glaube nicht, daß wir daheim ein Hitlerbild gehabt haben, es kann aber auch sein, im nachhinein traue ich es meinem Vater ohne weiteres zu. Was es gegeben hat, waren diese Soldaten aus Pappmaché oder aus Ton – und da hat es eben auch den Führer gegeben, in Feldherrnpose. Ich hatte einen Haufen Soldatenspielzeug, ’ne ganze Kiste voll hatte ich, schießende Soldaten, Soldaten hinter Kanonen, marschierende Soldaten und so kleine Pferde, ähnlich wie Zinnsoldaten, nur ein bißchen größer und bemalt. Wir haben die als Kinder auch getauscht – wie viele Schützen hast du? Und dann hatte da einer schwarze SS, na ja, die waren natürlich mehr wert. Diesen Führer hat’s also gegeben. Und immer wenn mein Großvater da war, hat man ihn dann irgendwo umgedreht aufgehängt gefunden. Der stand breitbeinig da, zwischen den Beinen war also eine Lücke, wo man ihn irgendwie an einen Haken oder Schlüssel hängen konnte. Das war Aufhängen, ganz klar. Vati hat ja auch einen Haufen anderes Zeugs gehabt, zum Beispiel eine ganze Menge Hefte von der NSDAP, so Hefte für Funktionäre, das hat er regelmäßig bezogen, konnte man ja wohl auch kaufen. Und die hatte Mutti nicht weggeschmissen. Und als dann die Russen kamen – das war ja eindeutig, was das war, mit dem Adler drauf und so –, haben wir das unter die Betten geschoben. Und als wir im Keller saßen und die Russen das Haus durchsuchten, haben wir ganz schön gezittert, daß die das finden.
In der Folge einer Unterschlagungsaffäre bei der Berliner Gestapo kommt der einstige Leiter der Wiener »Zentralstelle für jüdische Auswanderung« und persönliche Sekretär Adolf Eichmanns, SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, Mitte November 1942 nach Berlin. Der als »Schlächter von Wien« bekannte Österreicher hat Wien seit Mitte Oktober praktisch »judenrein« gemacht. Der kleine O-beinige Brunner sieht seinen Auftrag darin, »diesen verdammten preußischen Schweinen zu zeigen, wie man mit schweinehündischen Juden umspringt«. Brunner führt den in Wien erprobten Möbelwagen ein, mit dem Juden ohne großes Aufsehen von der Wohnung oder vom Arbeitsplatz abgeholt werden können. Sicherheitspolizisten und jüdische Helfer durchkämmen systematisch ganze Stadtviertel. Wie Hundefänger fahren sie mit den geschlossenen Wagen durch die Straßen und stoßen Menschen, die den gelben Stern tragen, hinein. Seit Brunners Ankunft ist Berlin voll von Gerüchten. Gerd Ehrlich, der Sohn eines wohlhabenden, 1940 an einem Herzanfall gestorbenen Berliner Rechtsanwalts, dessen Bekanntschaft Inge Wolf und Elisabeth Wust bald machen werden, wird nach Kriegsende im Schweizer Exil aufschreiben, wie er und seine Familie die »Brunner-Aktionen« erlebt haben.[4]
Er brachte eine Tasche voll teuflischer Ideen mit. »Lassen wir doch die Juden sich selbst ausrotten.« Die Gemeinde sollte nunmehr selbst die Sammlung der Opfer für den Transport vornehmen. Nur in den ganz seltenen Fällen, wo die jüdischen »Ordner« auf Widerstand ihrer Glaubensgenossen stießen, sollten die Beamten der Stapo noch einschreiten. Diese gemeine Idee wurde dem Gemeindevorstand in einer außerordentlichen Sitzung am 19. November vorgelegt. Zur Ehre unserer Repräsentanten muß gesagt werden, daß sich ein guter Teil der anwesenden Vorstandsmitglieder weigerte, Henkerdienste zu leisten. Leider fingen die alten Herren ihren Widerstand gegen den Befehl der Burgstraße[5] falsch an. Sie konnten nur passiv resistieren und wagten nicht, zum Aufstand aufzufordern. Der Erfolg war, daß die anständigen Menschen sofort verhaftet und zum nächsten Transport eingeteilt wurden. Die Leitung unserer Gemeinde kam dadurch ganz in die Hände der willfährigen Werkzeuge der Nazis.
Unter den am 19. November ’42 verhafteten Repräsentanten befand sich auch mein braver Stiefvater. Er kam von der Gemeindesitzung gar nicht mehr nach Hause, und ich habe ihn nie wiedergesehen. Ich hatte an diesem schwarzen Tage gerade in der Nachtschicht gearbeitet. Nach dem Mittagessen hatte ich mich nochmals in mein Bett gelegt, um zu schlafen. Gegen vier Uhr kam meine Mutter schreckensbleich in mein Zimmer mit der Hiobsbotschaft: »Benno ist verhaftet. Die ganze Familie muß sich heute abend im Sammellager einfinden.« Voll Entsetzen sprang ich aus meinem Bett und zog mich an. Der furchtbare Moment war gekommen. Gemäß der Vereinbarung mit meinen Eltern mußte ich mich von ihnen trennen, um so lange wie irgend möglich in Berlin bleiben zu können. Ich half meiner armen Mutter und meiner kleinen Schwester noch die letzten Sachen in die Rucksäcke verstauen. Diesen furchtbaren Nachmittag werde ich nie vergessen. Gott sei Dank waren wir viel zu sehr mit den Vorbereitungen für die »Reise« beschäftigt, um uns über die ganze Tragik des Augenblicks klarzuwerden. Hilfreiche Nachbarhände halfen beim Verpacken des armseligen erlaubten Gepäcks. Gegen acht Uhr abends war alles verstaut, und der schwere Weg zum Bahnhof wurde angetreten. Ich begleitete Mutter und Schwester bis zum Sammellager, das sich in der Großen Hamburger Straße in einem ehemaligen jüdischen Altersheim befand. An der Tür des polizeilich bewachten Gebäudes mußte ich die liebsten Menschen, die ich habe, für immer verlassen. Ein letzter Kuß für meine kleine Schwester Marion, ein letzter Segen meiner guten Mutter für meine Zukunft, und das Tor des Gefängnisses schloß sich hinter den beiden. Eine Welt war untergegangen. – Mit dem Schließen des Tores war meine trotz allem Schweren noch verhältnismäßig wohlbehütete Jugend beendet. Von nun an hieß es auf eigenen Füßen stehen. […]
Wenige Tage nach dem Transport meiner Angehörigen kamen die Stapobeamten, um die Zimmer zu versiegeln. Ich hatte gerade wieder Nachtschicht gearbeitet und machte ihnen persönlich die Wohnungstür auf. Sie sahen etwas verdutzt in die kahlen Zimmer. (Ich hatte alle transportablen Dinge an wohlgesinnte Nachbarn verkauft.) Boshaft fragten sie mich, wer denn die Sachen ausgeräumt habe. Ich spielte den Unwissenden und erklärte, ich sei lediglich Untermieter, arbeite meine 12 Stunden in der Fabrik und sei viel zu müde, mich um anderer Leute Dinge zu kümmern. Ich konnte den Kerlen ganz beruhigt erklären, mit »Familie Walter« nichts zu tun zu haben, da ich ja den Namen meines ersten Vaters trage. Die Zimmer wurden also brav versiegelt, und ich legte mich trotz der Drohung, daß die leeren Zimmer noch unangenehme Folgen für mich haben würden, wieder in mein Bett. Doch die »liebenswürdigen« Worte der beiden Beamten bestärkten mich noch mehr in dem schon gefaßten Entschluß, mich bald in die Illegalität zurückzuziehen.
Um nicht vorzeitig Verdacht zu erregen, ging ich vorerst weiter zur Arbeit in die Fabrik. Ich konnte mich mit meinem Ablöser einigen, so daß ich immer in der Nacht- und er in der Tagschicht arbeitete. Geschlafen habe ich kaum während der ersten Dezemberwochen. Die letzten Vorbereitungen für die ungewisse Zukunft mußten getroffen werden. Koffer mit den letzten Sachen wurden heimlich aus der Wohnung geschafft, Wertgegenstände noch schnell verkauft, belastendes Material verbrannt. Mitte Dezember war ich endgültig bereit. Gerade im richtigen Moment.
Am 24. November 1942 hält der New Yorker Rabbiner Stephen Wise in Washington eine Pressekonferenz. Er teilt den Reportern mit, daß nach vom State Department bestätigten Quellen zwei Millionen Juden in einer »Vernichtungskampagne« ermordet wurden, mit dem Ziel, alle Juden Europas auszulöschen. Diese Information wird am selben Tag in Jerusalem bestätigt. Ein ausführlicher Bericht über den Bau von Gaskammern in Osteuropa und über Transporte, die jüdische Erwachsene und Kinder »zu riesigen Krematorien in Oświęcim, in der Nähe von Krakau«, bringen, geht um die Welt. Obwohl der Massenmord an Juden in Auschwitz schon seit Mitte 1942 betrieben wird, ist dies der erste Hinweis, der die Außenwelt erreicht. Auch in Deutschland können BBC-Berichte über Vergasungen und Erschießungen von Juden empfangen werden.
Ende November wird der von Präsident Roosevelt eingebrachte President’s Third War Powers Bill im amerikanischen Kongreß niedergestimmt. Der Entwurf fordert die kriegsbedingte Aufhebung von Gesetzen, die »die freie Bewegung von Personen, Eigentum und Informationen in die und aus den Vereinigten Staaten« behindern. »So wie ich diesen Gesetzesentwurf verstanden habe«, faßt ein republikanischer Abgeordneter die Mehrheitsstimmung zusammen, »wollen Sie die Einwanderungstür weit aufstoßen.« Die konservative Presse, allen voran der Chicago Tribune, zeigt sich »geschockt« darüber, daß Politiker versuchen, »diese Nation mit Flüchtlingseinwanderern aus Europa und anderen Nationen zu überfluten«. »Die häßliche Wahrheit ist«, schreibt Newsweek am 30. November 1942, »daß der entscheidende Faktor bei der erbitterten Opposition gegen die Forderung des Präsidenten, ihm während seiner Amtszeit die Befugnis zur Aufhebung der Einwanderungsgesetze einzuräumen, Antisemitismus ist.«
2
Am 27. November sind Elisabeth Wust und Inge Wolf um drei Uhr nachmittags im Café Berlin neben dem Ufa-Palast am Bahnhof Zoo mit einer von Inges Freundinnen verabredet. Seit einiger Zeit schon erzählt Inge in einem fort von ihren Freundinnen. Elisabeth Wusts Verdacht, daß diese Mädchen anders sind, erhärtete sich, als Inge eines Tags beim Bettenmachen anfing, ihr den Arm zu streicheln, und sie fragte, was sie dabei empfände. Auch mit Frauen könne es sehr schön sein, flötete sie und schaute der Gnädigen mit ihren leuchtenden schwarzen Augen schamlos ins Gesicht. Oh ja, das könne sie sich schon vorstellen, antwortete Elisabeth Wust verlegen und senkte den Blick. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm sie von da an zur Kenntnis, daß Inge andersrum sei. Eine von Inge hochgeschätzte Eigenschaft der Wust ist ihre Diskretion. Sie stellt einfach keine Fragen, was andererseits wieder den Nachteil hat, daß ihr Mitteilenswertes aufgedrängt werden muß.
Die sehr gepflegte brünette junge Frau im rostroten Kostüm aus feinem englischen Tuch, der Elisabeth Wust im Café Berlin vorgestellt wird, nennt sich Felice Schrader. Elisabeth Wust ist überrascht, hat sie doch eine Elenai erwartet, von der Inge öfter mal gesprochen hat. Mit ihren langen Beinen in glänzenden Seidenstrümpfen ist Felice Schrader etwas größer als Inge. Sie scheint es darauf abgesehen zu haben, Elisabeth Wust zu imponieren. Was sie sagt, ist unerheblich, aber wie sie es sagt, ist bezaubernd. Immer wieder strahlt sie Elisabeth Wust mit einem breiten Lächeln an und zeigt dabei ihre makellosen Zähne.
Inge murmelt irgendwas von einem möblierten Zimmer, in dem ihre Freundin wohnt. Elisabeth Wust schweigt, wie es ihre Art ist. Sie schaut nur fasziniert auf Felice Schraders feingliedrige Hände mit den dezent lackierten Fingernägeln und atmet den Duft ihres Parfums. Es entgeht ihr nicht, daß Inge und Felice einander gar nicht so verstohlene schelmische Blicke zuwerfen. Elisabeth Wust fühlt sich in einen magischen Kreis hineingezogen und spürt, wie alle ihre Sinne wie aus einem Tiefschlaf erwacht eine ungewöhnliche Schärfe annehmen. Neben Felice Schrader kommt sie sich in ihrem für die Jahreszeit zu dünnen dunkelblauen Kunstseidenkleid, bestickt mit weißen und hellblauen Röschen, peinlich hausbacken vor.
An der Tramhaltestelle vor dem Ufa-Palast, zu der sie die beiden Freundinnen nach einer allzu schnell vergangenen Stunde begleiten, fröstelt sie. Da öffnet Felice Schrader ihre Mappe – es ist Elisabeth Wust gar nicht aufgefallen, daß sie eine dabeihatte – und schenkt ihr mit einem kleinen verlegenen Lächeln einen Apfel, den Elisabeth Wust zitternd umklammert.
»Auf Wiedersehn«, sagt Felice Schrader, und Elisabeth Wust ist, als hätte sie ihr zugeblinzelt.
Einige Tage darauf merkt Elisabeth Wust, daß Inge gegen Ende ihrer Arbeitszeit unruhig wird und immer wieder zum Wohnzimmerfenster läuft. Unten auf dem Kopfsteinpflaster der Friedrichshaller Straße steht Felice Schrader und traut sich nicht hinauf.
»Kommen Sie herauf, Sie können doch nicht unten in der Kälte stehenbleiben!« ruft die Wust hinunter in ihrem unnachahmlichen Ton, der keine Widerrede duldet.
»Inge, holen Sie Felice sofort herauf. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage, daß sie unten auf der Straße auf Sie wartet.«
Immer häufiger steigt Felice nun um fünf Uhr nachmittags zur gnädigen Frau in die vierte Etage und wird nicht selten gemeinsam mit Inge zum Abendbrot eingeladen.
»Sagen Sie doch Lilly zu mir, da komm ich mir weniger alt vor«, kokettiert die Wust mit dem achtjährigen Altersunterschied.
Manchmal wird die Abendbrotrunde durch diesen oder jenen Herrn komplettiert. Obwohl die Berliner Hausfrauen zunehmend über Lebensmittelknappheit klagen und die Schlangen gereizter Menschen vor den Geschäften immer länger werden, ist Lilly dank der vier Kinderzuteilungen stets reichlich mit Essen versorgt. Zu Weihnachten gibt es überdies eine Sonderzuteilung: 50 Gramm Bohnenkaffee und 0,7 Liter Spirituosen für Erwachsene, ebenso wie Fleisch, Butter, Weizenmehl, Zucker, Hülsenfrüchte, Käse und Süßwaren.
Immer noch in der Rolle der Gnädigen beobachtet Lilly mit Vergnügen, wie sich ihre Wohnung allmählich füllt. An ein gastliches Haus ist sie gewöhnt. Bei den Gesellschaften ihrer Eltern ging es immer hoch her. Dann bestellte die Mutter die Zugehfrau, die bei Tisch servierte und den Abwasch besorgte, der Vater holte den Koblenzer Weißwein aus dem Keller, öffnete die Flügeltür zwischen Wohnzimmer und Herrenzimmer und stimmte das Klavier, um seine Gäste zu vorgerückter Stunde mit Improvisationen zu ergötzen. Zum Vergnügen der eingeladenen jungen Herren legte Lilly manchmal zu des Vaters Begleitung einen improvisierten Tanz aufs Parkett. Auch sonst wurde im Hause Kappler viel musiziert. Wenn der Vater im Sommer bei offenem Fenster auf dem Klavier Schubertlieder spielte, Lillys Bruder Bob dazu auf der Geige kratzte und die Mutter mit Lilly im Duett sang, klatschten die Leute draußen auf der Straße Applaus.
Richtig bunte Vögel sind diese scheinbar unbeschwerten jungen Frauen, die sich bald mehrmals wöchentlich bei Lilly einfinden. Die Schönste ist Elenai Pollak. Mit ihren tiefblauen Augen und dem dichten, langen, schwarzen Kraushaar sieht sie verstörend exotisch aus. Wenn Lilly aufgekratzt vor sich hin plappert, entzückt von der interessanten Wendung, die ihr Leben genommen hat, verfällt Elenai in brütendes Schweigen. Nur wenn sie im Gespräch jemand von ihrer Meinung überzeugen will, wird sie plötzlich überraschend laut und heftig, ihre Wangen röten sich, und die Augen blitzen angriffslustig.
Wer mit wem ein Verhältnis hat, vermag Lilly nur unklar zu erkennen. Inge und Felice bestimmt, Inge und Elenai ebenso. Die farblose blonde Nora scheint in Elenai verschossen zu sein. Diese wiederum spricht auch Männern zu. In den Gesprächen taucht bisweilen eine Christine auf. Und wenn Inge tagsüber nicht rechtzeitig zum Telefon stürzt, um Felices Anruf abzufangen, kommt Lilly in den Genuß einer Dame, die am anderen Ende der Leitung Süßholz raspelt, was das Zeug hält. Lilly lächelt dann derartig versonnen, daß Inge ein gewisses Unbehagen nicht unterdrücken kann. Von der Wust soll Felice lieber die Finger lassen. Neulich kam sie mit einem Riesenstrauß roter Rosen angetanzt.
Sylvester 1942 wird ein ausgelassenes Fest. Felice hat einen Kofferplattenspieler, Lilly einen altmodischen Apparat mit Kurbelantrieb. Nach und nach hat Felice alle ihre Grammophonplatten angeschleppt und so Lillys Schlagersammlung von Zarah Leander über Marika Rökk und Hans Albers zurück zu Zarah Leander verbotenes französisches Liedgut hinzugefügt, La mer und Germaine zum Beispiel. »Kann denn Liebe Sünde sein?« und »Auf dem Dach der Welt, da ist ein Storchennest«, grölen die Mädchen im Chor, und Lilly serviert beglückt belegte Brötchen mit Ei und Schnittlauch.
Ebenso beglückt ist der Wehrmachtsangehörige Günther Wust. Bei seinen Familienbesuchen fühlt er sich geschmeichelt durch die Anwesenheit der charmanten Damen in seinem Haus und freut sich, seine Lilly aufgeräumt wie schon lange nicht zu sehen. Seit der unglücklichen Geschichte mit der Käthe Herrmann hat es häufig Streit gegeben, und seit er mit der Liesl geht, ist die Entfremdung perfekt. Wenn es diese Freundinnen schon früher gegeben hätte, wäre vielleicht auch die dumme Sache mit dem Erwin nicht passiert.
Am 30. Januar 1943, dem 10. Jahrestag der Machtergreifung, muß die Berliner Bevölkerung über zwei Stunden auf den Beginn von Hermann Görings Rede warten, weil englische Aufklärer zum ersten Mal am hellichten Tag über der Stadt kreisen. Vier Tage nachdem Göring seiner unerschütterlichen Siegesgewißheit Ausdruck verliehen hat, kapitulieren die Reste der in Stalingrad eingeschlossenen deutschen Truppen. Unter Trauermusik wird die Niederlage im Radio bekanntgegeben.
Am 18. Februar spornt Reichspropagandaminister Goebbels das deutsche Volk zu noch größeren Anstrengungen an. In einer »Kundgebung des fanatischen Willens« im Berliner Sportpalast kündigt er zur »Rettung Deutschlands und der Zivilisation« den »totalen Krieg« an. Um der Opfer des Rußlandfeldzugs zu gedenken, wird eine dreiminütige Verkehrsstille angeordnet. Am Zoo stehen die Menschen wie versteinert da, ohne einander anzusehen. Obwohl den meisten klar ist, daß der Krieg nunmehr endgültig verloren ist, wagt keiner, es auszusprechen.
Die Propaganda stürzt sich verstärkt auf den »inneren Feind«. Gauleiter Goebbels gelobt, Hitler zu seinem 54. Geburtstag am 20. April Berlin »judenfrei« zu übergeben. Die Gestapo stürmt Häuser, knackt Türschlösser, durchsägt Stahlriegel, zertrümmert Türen mit Äxten, steigt durch die Fenster der Nebenwohnungen ein. Viele Juden tauchen unter. Furchtbare Gerüchte über das Schicksal der »Evakuierten« machen die Runde.
Am 20. Februar gibt das Reichssicherheitshauptamt Richtlinien für die »technische Durchführung« der Deportationen nach Auschwitz aus. Mitzunehmen sind: Marschverpflegung für etwa 5 Tage, 1 Koffer oder Rucksack, 1 Paar derbe Arbeitsstiefel, 2 Paar Socken, 2 Hemden, 2 Unterhosen, 1 Arbeitsanzug, 2 Wolldecken, 2 Garnituren Bettzeug, 1 Eßnapf, 1 Trinkbecher, 1 Löffel, 1 Pullover.
Ende Februar erweitert sich Lillys Freundeskreis um zwei Personen: Die dunkelhaarige und leicht gehbehinderte Ilse Ploog mit den traurigen schwarzen Augen im breitflächigen Gesicht hat Felice das Fotografieren beigebracht. Felice besitzt eine Leica und möchte Journalistin werden. In ihrem Auftrag muß die immerfort um ihren Mann im Feld bangende Ilse Ploog Porträtfotos von Lilly und den Kindern machen. Die andere Bekanntschaft ist der 46jährige Schriftsteller Georg Zivier, genannt Gregor. Er ist zwar verheiratet, reißt sich aber vorerst nicht drum, der Hausfrau mit dem Kupferhaar und ihrer weiblichen Entourage seine Frau Dörthe vorzustellen.
Felices Werben um Lilly wird immer offensichtlicher. Täglich ruft sie an und bringt bei jedem Besuch Blumen mit. Ihre Komplimente werden von Mal zu Mal kesser. Lilly gefällt es, obwohl es ihr, mit Vernunft betrachtet, eigentlich nicht gefallen dürfte. Hat sie Felice, weil es ihr unerklärlicherweise gefallen hat, unbewußt zu dem ermuntert, was sich in der zweiten Februarhälfte zuträgt?