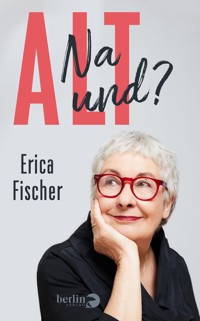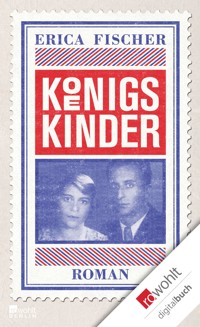15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Solange wir noch lesen können, leben wir!« 1. Januar 1943. Im englischen Exil der Eltern kommt Erica Fischer zur Welt. Die ersten Lebensjahre stehen im Schatten einer entwurzelten Familie, die gegen den Willen der jüdischen Mutter 1948 nach Wien zurückkehrt. Die Eltern denken modern, können ihren Kindern aber keine Geborgenheit geben. Ein beeindruckendes, bewegendes Frauenleben Durch Intelligenz, Charme und Lebenshunger gelingt Erica der Sprung in die Freiheit: Sie wird eine der Gründerinnen der österreichischen Frauenbewegung und eine gefeierte Autorin. Die Geschichte einer vielseitigen Lebenskünstlerin, die sich für Entrechtete einsetzt und ihre Lebenslust dabei nie verliert. Die Autorin des Weltbestsellers Aimée & Jaguar istein kluges und inspirierendes Role Model
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022
Bild 50, 51 und 53: STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien). Fotografiert von Erica Fischer. Alle anderen Fotos stammen aus dem Privatbesitz der Autorin.
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Irena Fischer; FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
Ersticken
Kinder oder keine
Mein Bruder
Von Hitler zur Jüdin gemacht
Spät lieben gelernt
Todesarten
Weiblich geboren
Sichtbare Spuren
Feilen an den Sätzen
Fleischlaberl & Paradeiser
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Mir war langweilig. Es war Lockdown, und ich hatte gerade eine umfangreiche Übersetzung beendet. Ein seit Längerem fertiggestelltes Buch wartete noch auf seine Veröffentlichung, sodass ich auch hier nicht tätig werden konnte. Wenn ich nicht arbeite, geht es mir aber nicht gut. Eines Tages kam mir ein Aspekt meines Lebens in den Sinn, der mir später als Erwachsene nicht mehr so wichtig erschien. Und ich fing an zu schreiben. Zufällig begann diese Erinnerung – Asthma – mit dem Buchstaben A. Ich tauchte ein in die ersten Jahre meiner Kindheit, die wesentlich bestimmt waren von dieser beklemmenden Krankheit.
Dann kam mir die Idee, das Alphabet als Stütze heranzuziehen, um mein Leben noch einmal Revue passieren zu lassen. Schließlich nähere ich mich meinem achtzigsten Geburtstag, ein geeignetes Datum, um Rückschau zu halten. Ich kam jedoch nur bis zum Buchstaben B wie »Bruder«, ein schmerzhafter Teil meines Lebens, über den ich auch schon an anderer Stelle geschrieben habe. Danach befreiten sich meine Erinnerungsfetzen vom Alphabet – zu Y wäre mir auch beim besten Willen nichts Aussagekräftiges eingefallen.
Mit einem Mal war mir nicht mehr langweilig. Zu jeder Tages- und Nachtzeit fielen mir Aspekte meines Lebens ein, die sich, erst einmal festgehalten, möglicherweise zu einem organischen Ganzen zusammenfügen ließen. Und langsam kam eine Person zum Vorschein, die in ihrer Widersprüchlichkeit auch mir selbst bis heute nicht wirklich begreifbar ist.
Mir wurde bewusst, dass mein Leben – knapp vor Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen – geeignet ist, in der Kapsel meiner unbedeutenden Person die großen Themen des 20. Jahrhunderts zu illustrieren. Geboren im Exil der Eltern, die vor den Nazis aus Österreich nach England flüchten mussten, war der Ekel vor der rassistischen Entwertung von Menschengruppen von Anfang an in meine DNA eingeschrieben. Und auch der Ekel vor jeder anderen Form von Diskriminierung, insbesondere jener, die sich gegen mein eigenes Geschlecht richtet. Der tief greifende Einfluss der Frauenbewegung auf meine persönliche Entwicklung ab Ende der 1960er-Jahre steht stellvertretend für Millionen Frauen meiner Generation.
Sie und ich befanden uns an einem historischen Wendepunkt, der die politischen, kulturellen und ökonomischen Beziehungen zwischen Frauen und Männern umkrempelte. Doch die persönliche und gesellschaftliche Prägung meiner Mädchenjahre ließ sich nicht mit einem einzigen Befreiungsschlag abschütteln, und so bin ich mein Leben lang gespalten geblieben zwischen dem Vorher und dem Nachher dieser geschlechterpolitischen Zeitenwende. Das hat sich besonders in meinen Beziehungen zu Männern, aber auch in meinem Berufsverlauf bemerkbar gemacht.
In den Nullerjahren angekommen, steht meine Beschäftigung mit dem Älterwerden und dem Alter im Vordergrund, dem kein Mensch entgeht, der nicht jung stirbt. Bei Frauen, denen Jugendlichkeit und Schönheit abverlangt wird, ist dieser Lebensabschnitt mit besonderen Problemen verbunden. Ich habe jedoch den Eindruck, dass die Frauen meiner Generation mit den Wechseljahren und dem »Verblühen« ihres Körpers selbstbewusster umgehen, als es Frauen früherer Generationen möglich war. Wir leben ja in der Regel auch länger als sie und auch länger als die meisten Männer, deren Lebensweise sich nicht selten als selbstzerstörerisch erweist.
Von meiner Geburt an durchzieht die Gewalt mein Leben – Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun. Schon als Kind musste ich erfahren, was mit meinen polnisch-jüdischen Großeltern geschehen war. In den 1950er- und frühen 1960er-Jahren beschäftigte ich mich mit den Repressionen der Kolonialmächte gegen die Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika. In den 1960er-Jahren demonstrierte ich gegen die Kriege in Vietnam und Kambodscha. In den 1970ern nahm ich aktiv in erster Linie den Krieg der Männer gegen die Frauen wahr, wenngleich es nie eine Periode gegeben hat, in der nicht irgendwo auf der Welt Krieg und blutige Repression herrschten.
Ende der 1980er-Jahre braute sich nach dem Tod Titos der Krieg im ehemaligen Jugoslawien zusammen. Er berührte mich in besonderer Weise, weil Jugoslawien ein Land war, das ich von mehreren Reisen gut kannte. Über medica mondiale, eine deutsch-bosnische NGO, die sich vergewaltigter und kriegstraumatisierter Frauen annimmt, schrieb ich ein Buch.
Die Hoffnung auf Demokratie und Freiheit im Jahr 1989, zuerst nach den Ereignissen am Tian’anmen-Platz in Peking, dann in Berlin, währte nicht lange. Seitdem wurden weltweit Kriege entfacht – im Irak, in Syrien, im Jemen, in Tschetschenien und in Georgien, um nur die bekannteren Schauplätze zu nennen. Und jetzt müssen wir dem Krieg in der Ukraine zusehen, live. Auch dieses Land durfte ich noch in friedlichen Zeiten bereisen.
Es sieht nicht gut aus für alle, die ich auf dieser Welt zurücklassen werde.
Berlin, im Juni 2022
Ersticken
Ich liege im Bett. Draußen scheint die Sonne und dringt durch das geöffnete Fenster. Auf der Straße spielen die Kinder, ich höre sie lachen. Ich schreie und strample die Decke weg. Aber ich muss liegen bleiben, denn ich bin krank – nicht im eigentlichen Sinn, ich habe nur Asthma. Unser Hausarzt Dr. Sommers ist ein österreichischer Emigrant, dem meine Eltern vertrauen, weil er wie sie vor den Nazis nach England geflohen ist. Er hat mir Bettruhe verordnet. Aber Asthma ist unheilbar, egal, wie lange ich das Bett hüte, es wird nicht vergehen. »Es ist unheilbar!«, wiederholte meine Mutter achtzig Jahre später ein ums andere Mal, als das Asthma auch ihr die Luft zum Atmen nahm, sie aber keinen Facharzt aufsuchen wollte. Am Ende half nur Cortison, das sie unansehnlich aufquellen ließ.
Aber vorerst glaubte sie noch Dr. Sommers. Und der war es wohl auch, der meinen besorgten Eltern empfahl, mich zur Erholung ans Meer zu schicken. Also wurde ich nach Devon im Westen Englands verfrachtet, an einen Sommerfrischeort in der Nähe von Bidefort mit dem eigenartigen Namen Westward Ho!, heute etwa fünf Eisenbahnstunden von London entfernt. Bekannt ist der Ort für seinen ungewöhnlichen Namen, der von dem 1885 veröffentlichten Roman Westward Ho! von Charles Kingsley herrührt. Das Buch, dessen Handlung in Bidefort spielt, wurde ein Bestseller und trug dazu bei, den Tourismus in der Gegend anzukurbeln. Deshalb nannte man ein Familienhotel »Westward Ho!-tel«, und bald schon hieß das ganze Dorf Westward Ho!. Auf das Ausrufezeichen wurde großer Wert gelegt.
Die kräftigende Brise des Atlantischen Ozeans sollte mein Asthma lindern, so war es gedacht. An die drei Monate muss ich in Westward Ho! gewesen sein. In das Kinderheim, in dem ich untergebracht war, durften keine Eltern zu Besuch kommen. Meine Mutter weinte, weil ihr das geschwätzige Töchterchen fehlte. Auch meiner Therapeutin traten viele Jahre später Tränen in die Augen, als ich ihr davon erzählte, denn sie wusste, dass das Erinnerungsvermögen eines Menschen erst ab etwa dem vierten Lebensjahr einsetzt. Ich muss drei gewesen sein, als ich mich in Westward Ho! erholen sollte, und bei meiner Rückkehr waren mir Mutter und Vater fremd geworden. Mein Kinderzimmer hätte ich nicht mehr erkannt, haben mir meine Eltern später erzählt. In meiner Abwesenheit hatte mir der Vater eine Puppenküche gebaut. Vielleicht sollte das helfen, mich wieder heimisch zu fühlen.
Bild 1: Mit meiner Mutter, September 1943
Das Asthma aber konnte Westward Ho! nicht heilen, und die sporadisch auftretenden Anfälle von Atemnot begleiteten meine gesamte Kindheit. Ich hatte einen Inhalator, ein bauchiges Glasfläschchen mit Mundstück, das ein bisschen wie eine Ente aussah. Daran war ein roter Gummischlauch mit einer Pumpe befestigt. In das Glasfläschchen kam eine bräunliche Flüssigkeit, die beim Pressen der Pumpe als Nebel in den Rachen drang. Ein tiefer Atemzug, und schon ging es mir besser. Meine Eltern bewahrten das Gerät in einem zylindrischen Metallbehälter auf. Die hellbraune Flüssigkeit, die »Asthminal« hieß, wurde in einer verschweißten Glasampulle geliefert, deren schmal zulaufende Spitze mit einer winzigen Säge gekappt werden musste. Durch Kontakt mit der Luft färbte sich das Medikament mit der Zeit dunkelbraun und malte einen verkrusteten Rand an die Glaswand. Dann war es Zeit, eine neue Ampulle anzubrechen. Heute sind die angebotenen Sprays kleiner, handlicher und luftdicht verschweißt. Auf Reisen hatte ich, als ich schon längst kein Asthma mehr hatte, immer noch eine kleine Flasche dabei, für alle Fälle. Sie war lebensrettend.
Wenn ich heute darüber schreibe, spüre ich noch immer eine beklemmende Verengung der Atemwege. Die Angst vor dem Ersticken ist mir geblieben. Als wir schon in Wien lebten, kam manchmal ein an Asthma leidender Mann zu Besuch, der wie meine Eltern aus der englischen Emigration zurückgekehrt war. Wir wohnten in einem Neubau im ersten Stock. Schon diese paar Stufen waren ihm zu viel. Wenn wir die Wohnungstür öffneten, hörten wir, wie Doktor Spitzegger am ersten Treppenabsatz schwer atmend stehen blieb, um sich mithilfe des Inhalators Luft zu verschaffen. Hörte ich dieses Geräusch, bekam ich sofort Atemnot.
Die englischen Ärzte ließen meine Eltern hoffen, mein Kinderasthma würde in der Pubertät von allein vergehen. So war es dann glücklicherweise auch. Stattdessen entwickelten sich schon früh eine Pollen- und eine Katzenhaarallergie. Selbst die Jacke meiner Mutter aus Wildkatzenfell ließ mich als Teenager nach Atem ringen.
In unserer Nachbarschaft in meinem englischen Geburtsstädtchen St Albans wohnten zwei ledige Schwestern mit ihren zahlreichen Katzen. Mich diesem Haus auch nur zu nähern war mir strengstens verboten. Obwohl ich mich als Kind gern in unserer Wohngegend herumtrieb und unsere Nachbarinnen mit meinen munteren Fragen von der Hausarbeit abhielt, nahm ich dieses Verbot ernst. Doch in meinen Tagträumen kamen sie häufig vor, die beiden »Hexen«. Im verbotenen Haus waberten Geheimnisse, ich stellte mir eine von Katzen mit glühenden Augen belagerte Gespensterhöhle vor, die mich gleichermaßen anzog wie abschreckte.
Bild 2: Die Kathedrale von St Albans
Bild 3: St Albans, Juli 1945
Als lebensbedrohliche Situation ist mir eine Nacht in Erinnerung, in der ich nach Luft rang, das Asthminal für meinen Inhalator aber zu Ende gegangen war. Zudem hatte ich hohes Fieber. Ob das Drama sich noch in England oder schon in Wien abspielte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls schien ich bereits zu wissen, was sterben bedeutet. Ich flehte meine Eltern an, mich nicht sterben zu lassen. Im Haus herrschte Alarmstimmung. Zu guter Letzt machte mein Vater eine Apotheke ausfindig, die nachts geöffnet hatte, fuhr mit dem Taxi hin und kehrte mit dem Medikament zurück. Augenblicklich öffnete mir der Zerstäuber die Bronchien, und die Gefahr war gebannt. Ich konnte wieder atmen. Und leben.
Einer der Gründe, warum sich meine Eltern nach zehn Jahren in der englischen Emigration 1948 entschieden, nach Wien zurückzukehren, war das englische Wetter, der Nebel. Das trockenere Klima in Österreich sei besser für mich, empfahl Dr. Sommers. Ich besuchte in England sogar schon die Schule und erinnere mich an hohe Fenster, durch die helles Licht in unser Klassenzimmer drang. Ich habe sie auf einer Zeichnung festgehalten. Da ich oft krank war und meine Eltern sich endgültig entschlossen hatten, nach Wien zurückzukehren, schickten sie mich in den Monaten vor unserer Abreise nicht mehr zur Schule.
Rückblickend wäre ich lieber in England geblieben, und auch meine jüdische Mutter hätte ihr Fluchtland auf jeden Fall dem naziverseuchten Österreich vorgezogen, aber mein Vater wollte unbedingt zurück. In Österreich wurde er geboren, und dort waren sein Vater und seine beiden Brüder. Er wollte auch zurück, um nach der Niederlage des Faschismus mitzuhelfen, ein besseres Land aufzubauen. Meine Mutter hat ihm diese Rücksichtslosigkeit ihren Ängsten gegenüber nie verziehen. Und auch wir Kinder nicht. Zeit unseres Lebens blieb uns eine sentimental verklärte Sehnsucht nach England. Freunde meiner Eltern schickten mir eine englische Schuluniform, einen dunkelblauen Trägerrock mit tiefen Falten, der über einer hellen Bluse getragen wurde. Während diese Schuluniform bei den englischen Mädchen gewiss verhasst war, trug ich meine voller Stolz.
Bild 4: Vor unserem Haus in St Albans, Ramsbury Road 51, 1948
Vielleicht ging es mir in Österreich gesundheitlich tatsächlich besser, nur die Sonntagsausflüge in den Wienerwald machten mir zu schaffen. Hügeliges Gelände, das beim Aufstieg meine Bronchien verengte, strengte mich an, und in der Schule genoss ich das Recht, beim Turnunterricht auszusetzen, wenn mir eine Übung zu viel wurde. Was ich bald erkannte, war, dass mir neben körperlicher Anstrengung auch psychische Belastung nicht guttat. Schon als Kind lernte ich, mich im Bett zu entspannen, die Hände über die Decke zu legen und mit ruhigen Zügen zu atmen, also eine Art autogenes Training.
Als das Asthma bereits am Abklingen war, ist mir ein Anfall in Erinnerung, der mich ereilte, als ich auf einer Urlaubsreise nach Jugoslawien in einen heftigen Konflikt mit meiner Mutter geriet. Meine Mutter war sehr nervös. Ihr Leben war nicht nach ihren Vorstellungen verlaufen. Manchmal presste sie ihre Hände gegeneinander und verkrampfte ihre Kiefer zu einer hässlichen Grimasse. Daran war ich gewöhnt. Es heißt, dass eine besitzergreifende Mutter dem Kind die »Luft zum Atmen nimmt«. Durchaus möglich. Ich habe nicht viel Liebe von ihr erfahren, aber besitzergreifend war sie allemal.
Die Luft zum Atmen nahm mir auch der Vulkan Stromboli. Stärker als den anderen Gruppenmitgliedern beim nächtlichen Aufstieg zum Feuer speienden Krater machten mir die aus dem schwarzen Gestein aufsteigenden gelblichen Schwefeldämpfe zu schaffen. Ich rang nach Luft. Erst als mir der Gruppenleiter eine Atemmaske gab, legte sich die Beklemmung. Es war wie eine Erinnerung an eine ferne Zeit.
Auf diese Weise habe ich eine Ahnung, wie sich Ersticken anfühlt. Es ist ein Tod, den in den letzten Jahren Tausende Migrantinnen und Migranten erlitten haben, die auf der Suche nach einem besseren Leben im Mittelmeer ertrunken sind. Und der von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis, Minnesota, im Würgegriff eines Polizeibeamten. I can’t breathe.
Kinder oder keine
Kürzlich wurde ich eingeladen, vor der Kamera der Deutschen Welle über meine Kinderlosigkeit zu sprechen. Die Redakteurin, die gewunden anfragte, schien sich mir wie auf Zehenspitzen zu nähern, als lade sie mich ein, über meine geheimen sexuellen Vorlieben Auskunft zu geben. Ich sagte sofort zu; es sei bei mir aber ganz unproblematisch gewesen, ließ ich sie beruhigend per E-Mail wissen, weil sie von mir eine Leidensgeschichte zu erwarten schien.
Tatsächlich ist es aber doch so, dass ich die immer mal wieder gestellte Frage nach Kindern und Enkelkindern irgendwie peinlich berührt verneine. So, als schämte ich mich dafür, meine eigentliche Aufgabe als Frau nicht erfüllt zu haben. In Mosambik, wo ich mich in den frühen 1980er-Jahren zweimal aufhielt, schienen manche Frauen an Unfruchtbarkeit zu leiden, in einem afrikanischen Land eine Katastrophe. Als ich auf die Frage der Frauen nach den Themenschwerpunkten der hiesigen Frauenbewegung den Kampf um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nannte, reagierten sie mit Unverständnis, denn ihr Problem war die Kinderlosigkeit. Meine eigene erklärten sie sich wohl mit etwaiger Unfruchtbarkeit und stellten diskret keine weiteren Fragen.
Ich war jedoch – leider – keineswegs unfruchtbar und hatte mich aus freien Stücken gegen Kinder entschieden. Und doch hatte ich die Erwartung an mich und an alle Frauen, die Mutterschaft als unseren wichtigsten Lebensinhalt zu akzeptieren, so sehr verinnerlicht, dass ich mich für meine anscheinend abartige Entscheidung irgendwie schämte. Es ist ja nicht so, dass ich in meiner Generation die Einzige war, die sich zu diesem Schritt entschlossen hat oder durch die Lebensumstände dazu gezwungen wurde. Die Gesellschaft war im Umbruch, meine Generation nahm das Leben in der Kleinfamilie mit dem Mann als Brotverdiener draußen in der Welt und der Frau als Hüterin von Heim und Herd nicht mehr als gottgegeben hin. Und schon gar nicht die Frauen.
Mehr als für die Männer, die letztlich ihre herkömmliche Rolle nicht wirklich infrage stellten, war für die Frauen in den frühen 1970er-Jahren nichts mehr, wie es einmal war. Aber schon die Mütter der Feministinnen hatten ein gebrochenes Leben hinter sich und mussten sich als Kriegerwitwen und Ehefrauen kaputter Männer in den Nachkriegsjahren in einer Weise durchkämpfen, wie es das bürgerliche Familienskript eigentlich nicht vorsah. Vielleicht haben damals nicht wenige junge Frauen in meinem Alter bezüglich ihrer künftigen Aufgabe eine zwiespältige Botschaft erhalten.
Für mich selbst waren im Wesentlichen drei Faktoren ausschlaggebend: Meine Mutter war alles andere als eine glückliche Hausfrau und Mutter; und im Gegensatz zu vielen österreichischen und deutschen Frauen ihrer Generation versuchte sie, uns Kindern und ihrem Mann auch keine Zufriedenheit vorzuspielen. Mein Vater hingegen hatte eher eine konventionelle Vorstellung von Familie und war stolz darauf, sie ernähren zu können, ohne dass seine Frau genötigt war, »dazuzuverdienen«. Meine Mutter behauptete, er habe es ihr sogar verboten. Das wiederum fällt mir schwer zu glauben, weil sie eine sehr durchsetzungsstarke Person war und sich von meinem Vater nichts befehlen ließ. So scheint es mir wenigstens.
In einem Interview, das sie in den 1980er-Jahren einer Journalistin gab, bekannte meine Mutter, ihre Kinder als Zugeständnis an ihren Mann bekommen zu haben. »Unnötigerweise« habe sie zwei Kinder bekommen, sagte sie, »in einer Ehe muss man eben Kompromisse schließen«. Als ich das las, erschrak ich, wäre ich doch gern erwünscht gewesen, aber später wurde mir klar, dass nicht stimmte, was meine Mutter da von sich gab. Denn aus ihrer Korrespondenz mit meinem im Sommer 1940 als enemy alien von England nach Australien deportierten Vater entnehme ich, dass sie sich damals nach einem Kind sehnte und im Alter von dreißig Jahren unsicher war, ob sie dafür nicht schon zu alt war.
Und wie eine richtig glückliche Mutter sieht sie auf dem Foto aus, auf dem sie im Liegestuhl in unserem englischen Garten sitzend ihr dreijähriges Mädchen strahlend der Kamera entgegenhält. Ich weiß aber, dass sie später ihr Leben als Hausfrau und Mutter in Österreich hasste und sie mir eine eindeutige Botschaft mit auf den Weg gab: Erlerne einen Beruf, der dir ökonomische Unabhängigkeit sichert, und bekomme keine Kinder. Sie hat diesen Auftrag nicht näher erläutert, aber es war mir klar, dass die Mutterschaft für sie den Verlust von Freiheit bedeutete.
Bild 5: Im Garten hinter dem Haus in St Albans, 1948
Mit zwei Kindern war sie angekettet. Angefeuert von der US-amerikanischen Frauenbewegung, verlangte sie eines Tages von meinem Vater einen »Lohn für Hausarbeit«. Ihr Mann war empört. Er hielt Hausarbeit und die Sorge um die Kinder für ihre Aufgabe, denn schließlich brachte er das Geld ins Haus. »Meine Frau will eine Apanage«, zog er bei unseren Nachbarn über sie her. Er war der Meinung, alles in unserer bescheidenen Gemeindebauwohnung gehöre ihm – was er ihr bei einem Streit auch einmal an den Kopf warf.
Bild 6: Meine Mutter mit ihren beiden Kindern, 1950
Also verdiente sich meine Mutter ein »Taschengeld« mit Übersetzungen aus dem Polnischen und Englischnachhilfe für Kinder aus der Umgebung. Ihre eigenen und meine wunderschönen Kleider nähte sie mithilfe einer Singer-Nähmaschine mit Handkurbel, auch Hosen, Mäntel und Kostüme – ein Beitrag zum Familienbudget, den mein Vater nie ausreichend geschätzt hat. Mein Lehrer in der vierjährigen Volksschule verhöhnte mich als »Modepuppe«, weil ich im Gegensatz zu den anderen Mädchen in unserer Arbeitersiedlung immer schick angezogen war, mit Kleidern aus bestimmt nicht billigen Stoffen, die meine Mutter in der Innenstadt kaufte.
Seit meiner Kindheit habe ich mich gern mit Mode befasst, und die Anproben gehören zu meinen schönsten Erinnerungen. Zwischen meiner Mutter und mir herrschte bei diesen Gelegenheiten ein Einvernehmen, das sonst selten war. Als Künstlerin, die an der Wiener Kunstgewerbeschule auch Textildesign und das Anfertigen von Lederhandschuhen und Gürteln gelernt hatte, machte ihr das Nähen von Kleidungsstücken für mich und sich selbst Spaß. Es war wesentlich kreativer, als zu putzen und täglich für die Familie zu kochen. »Ich bin eine schlechte Hausfrau«, war einer ihrer Standardsätze, wenn sie uns das Mittagessen auftischte. So war also das Bild der Unzufriedenen, das meine Mutter überwiegend abgab, nicht geeignet, mir als Vorbild zu dienen. Für mich war klar: Auf keinen Fall wollte ich werden wie meine Mutter. Und doch hat sie mir auch etwas Widerständiges mitgegeben, das mich davor geschützt hat, allzu viele Kompromisse einzugehen, um gemocht zu werden.
Der zweite Grund für meine Kinderlosigkeit war die bereits erwähnte 68er-Bewegung mit ihrer grundlegenden Kritik an der bürgerlichen Kleinfamilie und bald darauf der Aufbruch der Frauen. Das erste Heft unserer Zeitschrift AUF – Eine Frauenzeitschrift im Oktober 1974 hatte die Familie zum Thema. Das Cover des aus heutiger Sicht rührend handwerklich hergestellten himmelblauen Hefts zierte eine Zeichnung der Avantgarde-Künstlerin Renate Bertlmann, eine Pyramide der Mühe und Macht: die Hausfrau und Mutter ganz unten, und auf ihren Schultern die ganze Last der Familie.
Als im Herbst 1972 in Wien das erste Treffen der »Aktion Unabhängiger Frauen« (AUF) stattfand, geriet ich – nunmehr dreißig Jahre alt – in einen aktionistischen Strudel, der jegliches Nachdenken über Schwangerschaft und Mutterschaft ausschloss, abgesehen davon, dass keiner meiner Freunde Lust gehabt hätte, mit mir eine Familie zu gründen. Irgendwie hatte ich sie mir schon entsprechend ausgesucht, um genau diesen Konflikt zu vermeiden. Außerdem hatte ich noch Zeit. Bis in die 1980er-Jahre war mein Leben bestimmt von Aktionismus, dem Aufsaugen stets wachsender Erkenntnisse über die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, innerfeministischen Konflikten und wechselnden Liebesbeziehungen, die nie gut ausgingen. Seit der Abtreibung nach meiner ersten sexuellen Beziehung mit Anfang zwanzig unter den keineswegs angenehmen Bedingungen der Illegalität hatte ich mich der Pille verschrieben, der medizintechnischen Voraussetzung für ein sorgenfreies Liebesleben. Zumindest im Hinblick auf ungewollte Schwangerschaften; denn Sorgen mit der Liebe hatte ich reichlich. Ja, ich hatte noch Zeit, aber die biologische Uhr tickte.
Bild 7: UNO-Frauenkonferenz in Kopenhagen, 1975
Eines Nachts wachte ich in einem Meer von Blut auf. Ich setzte mich in die Badewanne und schluchzte vor Entsetzen. Die Frauenärztin stellte ein Myom fest und riet zur Entfernung des Uterus, was in diesem frühen Stadium noch vaginal möglich war, also weniger invasiv als mit Bauchschnitt. Nun war es endgültig zu spät. Als ich im Krankenhausbett weinte, dachten die philippinischen Krankenschwestern, ich würde den Verlust meiner Gebärmutter betrauern, und trösteten mich. Doch ich weinte nur, weil es mein damaliger siebzehn Jahre jüngerer Lover – wahrscheinlich unter dem Schock dieser für den jungen Mann wohl unerklärlichen Frauenkrankheit – ausgerechnet einen Tag nach dem Eingriff für angebracht gehalten hatte, mir brieflich mitzuteilen, dass er nun doch seine gleichaltrige Freundin vorziehen würde.
Von der Traurigkeit über diesen Brief erholte ich mich rasch, genoss auf dem Balkon des Franz-Josef-Krankenhauses die Sonne, empfing wie eine Königin Besuch von unzähligen Freundinnen und arbeitete an einer Übersetzung. Als ich das Krankenhaus verließ, hatte ich einige Kilo abgenommen und war braun gebrannt. Die Ringe unter den Augen sah ich erst zu Hause im Spiegel.
Der Blick in den Spiegel war ein anderer als der während meiner Schwangerschaft Anfang der Sechzigerjahre. Damals war ich entsetzt über das Fremde, das von meinem Körper Besitz ergriffen hatte. Ich fühlte mich noch als Kind, hatte erst mit einem einzigen Mann geschlafen, wohnte bei meinen Eltern und sollte jetzt mit einem Schlag Mutter werden! Und der unfreiwillige Samenspender war bereits zum Studium in die USA zurückgekehrt.
Im Spiegel forschte ich nach Spuren einer Veränderung hin zu Mütterlichkeit, doch sah ich bloß ein hilfloses Mädchen, das nicht wusste, wie sich dieser Last zu entledigen. Nach der Entfernung meiner Gebärmutter im Alter von fast vierzig Jahren fühlte ich mich nur unendlich erleichtert. Es war vorbei. Ich war die Bürde der Weiblichkeit los. Keine Monatsblutungen mehr, keine übel riechenden Tampons, keine Angst vor Schwangerschaft. Ich hatte einmal einen Freund, der sich in der Zeit unseres Zusammenseins sterilisieren ließ und diesen Eingriff als »Jagdschein« bezeichnete. Nun hatte auch ich einen Jagdschein. (Es war noch die Zeit vor AIDS.) Im Spiegel sah ich eine erwachsene Frau, die sich dem gesellschaftlichen Druck, Mutter zu werden, entzogen hatte. Nun konnte mir niemand mehr einen Vorwurf machen. Ich hatte mich für die Kinderlosigkeit entschieden.
Der dritte Faktor für diese nunmehr endgültige Entscheidung war mein mangelndes Bedürfnis nach einem Leben mit Kindern. Meine beiden besten Freundinnen, die wie ich lange gewartet hatten, entschieden sich Ende dreißig für ein Kind. Beide lebten in brüchig gewordenen Beziehungen und waren dennoch wild entschlossen, das Projekt Kind auch ohne väterliche Unterstützung durchzuziehen. Beide haben ihre Söhne schließlich allein aufgezogen und sind heute stolze Großmütter.
Besonders Susi hat gleich mehrere Enkelkinder, die sie heiß liebt. Ich stehe ihrem Familiensinn einigermaßen ratlos gegenüber. Seit vierzehn Jahren lebe ich mit einem Italiener zusammen und bin nun sogar mit ihm verheiratet. Er telefoniert regelmäßig mit seinen beiden Schwestern in Rom und Nashville, mit seinem Sohn in Barcelona und der Tochter in Bologna. Er hat drei Enkelkinder, für die er zu deren Geburtstagen bunte Zeichnungen anfertigt und die er regelmäßig besuchen fährt. Ich freue mich für ihn, finde die jüngste Enkeltochter auch bezaubernd, mische mich aber nicht ein in seine Familie. Ich habe kein Bedürfnis, die Rolle der Stiefoma zu übernehmen, und Massimo verlangt es auch nicht von mir. Als seine Tochter einmal mit ihren beiden Söhnen über ein Wochenende zu uns nach Berlin kam, war ich danach geschafft wie schon lange nicht mehr. Der Großvater jedoch auch.
Meine beiden »spätgebärenden« Freundinnen hatten beide feste Anstellungen, die durch ihre Schwangerschaft nicht infrage gestellt wurden. Ich hingegen arbeitete freiberuflich und verdiente gerade so viel, um mich selbst durchzubringen. Daraus konnte ich niemandem außer mir selbst einen Vorwurf machen. Ich war einfach ungeeignet für ein geregeltes Arbeitsleben.
Nach dem Studium versuchte ich es in zwei Jobs als Übersetzerin. Beim Patentanwalt wurde ich nach der einmonatigen Probezeit entlassen, weil ich mich weigerte, der Frau des Chefs Büstenhalter in den USA zu bestellen. Danach wollte ich es noch einmal wissen, obwohl ich schon beim Patentanwalt zutiefst deprimiert war. Die Mittagspause verbrachte ich im Selbstbedienungslokal WÖK (Wiener Öffentliche Küchen) an der Ecke zum Schottenplatz und weinte inmitten von anderen Lohnsklaven und -sklavinnen in meine Pampe auf dem Kunststofftablett. Mein Leben dehnte sich in meiner Vorstellung als schnurgerade Autobahn vor mir aus, die sich in der Ferne im trostlosen Nichts verlor.
Die neue Firma stellte Extruder her, keine Ahnung, was das war. Dort gab es eine Stechuhr. Bei denen, die nach acht Uhr eintrafen, also zu spät kamen, wurde die Uhrzeit rot ausgedruckt. Meine Karte war durchgehend rot, denn ich hatte einen langen Fahrtweg und sah nicht ein, warum ich meine Übersetzungen so früh am Morgen beginnen sollte, zumal ich abends oft länger im Büro blieb, wobei diese Arbeitszeitüberschreitung auf meiner Stechkarte jedoch nicht rot ausgedruckt wurde. Nach der Probezeit, diesmal drei Monate lang, bestand mit Hinweis auf mein rotes Meer kein weiterer Bedarf an meiner Mitarbeit. Zum Glück, denn wer weiß, ob ich den Mut gehabt hätte, selbst zu kündigen. Danach beschloss ich, mich nicht mehr einspannen zu lassen und ein Leben in Freiheit zu wagen.
Ende der Leseprobe